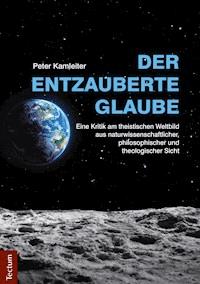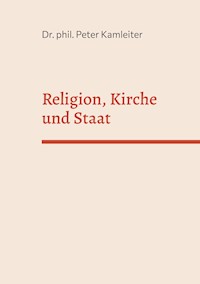
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Noch immer wird Kirchen- und Religionskritik auch in westlichen Gesellschaften stigmatisiert. Dabei wären die modernen westlichen Verfassungen und demokratischen Gesellschaften, von denen auch religiöse Menschen profitieren, ohne diese - als zentrales geistiges Anliegen der Aufklärung - gar nicht erst entstanden. Der Philosoph Dr. Peter Kamleiter zeigt auf, dass die Kritik an Religion und deren Institutionen neben dem aktuellen gesellschaftlichen Aspekt auch in der Sache mehr als berechtigt ist. Aus philosophischer, historischer, naturwissenschaftlicher aber auch theologischer Sicht zeigt er im ersten Teil die profane Genese der Religionen, ihre intellektuellen und moralischen Unzulänglichkeiten sowie deren Widersprüche exemplarisch am Christentum auf. Im zweiten Teil erfolgt unter Bezugnahme auf das Religionsverfassungsrecht eine kritische Evaluation des aktuellen Verhältnisses von Religion, Staat und Kirche in der BRD. Beispielsweise hinterfragt Kamleiter, wie es noch zu rechtfertigen ist, dass die immensen Kosten, die mit einer nicht mehr zeitgemäßen Kirchenprivilegien verbundenen sind, von einer immer mehr anwachsenden Zahl von kirchenfernen Steuerzahlern finanziert werden müssen. Eine weitere zentrale Frage in diesem Zusammenhang betrifft die nach der Berechtigung des von den Kirchen in Anspruch genommenen Selbstverständnisses, als eine in unserer Gesellschaft immer noch maßgebliche moralische Instanz zu gelten. Damit nämlich begründen die Kirchen und die kirchenfreundlichen Politiker die hier in Frage gestellten Kirchenprivilegien trotz einer dramatisch ansteigenden Austrittssituation und einer sich immer mehr multireligiös aber gleichzeitig auch atheistisch entwickelnden Gesellschaft. Kamleiter untermauert diese Grundsatzfragen nach dem Verhältnis von Staat und kirchlichen Institutionen mit Zahlen und Fakten. Gleichzeitig fordert er die Schieflage zwischen Verfassungsnorm und Verfassungswirklichkeit unter Berücksichtigung der sich dramatischen ändernden gesellschaftlichen Entwicklung endlich politisch zu begradigen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 311
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALT
Vorwort
Teil I
Die inhaltlich-faktische Berechtigung der Religions- und Kirchenkritik
1. Einleitung
1.1 Das Alte Testament
1.2 Das Neue Testament
1.3 Religions- und Kirchenkritik aus philosophischer Sicht
1.4 Charles Darwin und Albert Einstein
1.5 Der heutige naturwissenschaftliche Kenntnisstand und das theistische Welt- und Gottesbild
1.6 Resümee
2. Woher stammen unsere heutigen „westlichen“ Werte wie die Menschenrechte und die Würde des Menschen wirklich?
2.1 Gibt es eine ethisch-moralische Notwendigkeit für eine staatliche Privilegierung der Religionen und Kirchen?
2.2 Zusammenfassung und Vorausschau
TEIL II
Staat Religion und Gesellschaft. Norm und Wirklichkeit des Religionsverfassungsrechts im Wandel der Zeit
3. Einleitung
3.1 Fakten zur religionssoziologischen Entwicklung in der BRD
3.2 Entwicklung der Religionszugehörigkeit seit 1950
3.3 Was glauben Katholiken und Protestanten?
3.4 Woran glaubt die Gesamtbevölkerung?
3.5 Zwischenfazit
4. Neutralität Trennung und Gleichberechtigung. Defizite in der praktischen Umsetzung des Religionsverfassungsrechtes
4.1 Der christliche Gottesbezug in diversen Landesverfassungen
4.2 Exkurs. Yuval N. Hararis Gegethese: Der Homo Deus
5. Die Schieflage zwischen Verfassungsnorm und Verfassungswirklichkeit
5.1 Kirchen als Körperschaften des öffentlichen Rechts
5.2 Der Reichtum der Kirchen und verfassungsrechtlich problematische Staatsleistungen
5.2.1 Die Kirchensteuer
5.2.2 Steuerbefreiungen
5.2.3 Staatlich finanzierte Bischöfe
5.2.4 Die Finanzierung der theologischen Fakultäten
5.2.5 Historische Staatsleistungen
5.2.6 Vertragskirchenrecht
6. Praktische und lebensweltliche Auswirkungen christlicher Religionspolitik
6.1 Die vorgeburtliche Phase
6.2 Nach der Geburt
6.3 Die Kindergarten- und Schulzeit
6.4 Religiöse Symbole in öffentlichen staatlichen Räumen
6.5 Das Berufsleben
6.6 Alter und Tod
6.7 Weitere Schieflagen zwischen Rechtsnorm und Rechtspraxis
7. Die Notwendigkeit der Religionskritik für offene demokratische Gesellschaften im Hinblick auf den Islam
8. Schluss
9. Anmerkungen
Vorwort
Religions- und Kirchenkritik ist ein noch immer heikles und gesellschaftlich stigmatisiertes Unterfangen. Mit diesem Buch soll aber in Teil 1 dargelegt werden, dass es sich dabei nicht nur um ein unmittelbar in der Sache sehr berechtigtes, sondern auch um ein mittelbares, nämlich für freiheitliche und offene Gesellschaften existentielles Unternehmen handelt. Religionskritik ist kein Unterfangen, für das man sich zu schämen hätte, sondern ganz im Gegenteil, ihr gebührt Respekt und Anerkennung, da sie - historisch betrachtet - aufgrund der eng mit ihr verbundenen Aufklärung eine unabdingbare Voraussetzung für die Entwicklung der modernen freiheitlichen Verfassungen und Gesellschaften darstellt. Die wichtigsten Einwände gegen die monotheistischen Glaubensansprüche, stellvertretend am Christentum dargelegt, werden hier chronologisch und wissenschaftsbasiert aus theologischer, philosophischer und naturwissenschaftlicher Sicht vorangestellt. Mit dieser seit der Neuzeit einsetzenden, permanent zunehmenden und in der Aufklärung kulminierenden Religionskritik ist auch der korrelativ hierzu schwindende Einfluss des Religiösen auf Gesellschaft und Politik verbunden, der die heutigen freiheitlich-säkularen Verfassungen und Gesellschaften erst ermöglicht hat.
Im zweiten Teil soll, unter Bezugnahme auf das Religionsverfassungsrecht, eine kritische Evaluation des Verhältnisses von Religion, Kirche und Staat in der heutigen BRD vollzogen werden. Dabei wird deutlich, dass durch die zahlreichen und weltweit beispiellos großzügigen Privilegien, welche den beiden großen christlichen Kirchen seitens des deutschen Staates im Laufe der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland zuerkannt worden sind, es immer mehr zu einer verfassungsrechtlich problematischen Schieflage zwischen Rechtsnorm (Grundgesetz) und Rechtspraxis gekommen ist. Der Zusammenhang zwischen den Themen der beiden Teile des Buches besteht darin, dass dann, wenn die beiden großen christlichen Volkskirchen in ihren ethisch-moralischen wie auch in ihren Glaubensansprüchen aufgrund einer zunehmend religionskritischer und somit säkularer werdenden Bevölkerung massiv an gesellschaftlicher Bedeutung verlieren, auch nicht mehr der von ihnen beanspruchte exorbitante Einfluss auf Politik, gesellschaftliche Institutionen und Medien gerechtfertigt ist. Das gilt insbesondere auch für die noch aus den für die Kirchen „besseren“ Zeiten herrührenden und zudem auch noch sehr kostspieligen Privilegien, die ihnen vom bundesdeutschen Staat in einer weltweit einzigartigen Großzügigkeit zugestanden werden. Es ist gesellschaftspolitisch schlicht nicht mehr zu rechtfertigen, dass diese mit den Kirchenprivilegien verbundenen, exorbitant hohen Kosten von einer immer mehr anwachsenden Zahl an kirchenfernen Steuerzahlern mitfinanziert werden müssen. Sowohl die auf den den christlichen Kirchen zuerkannten Status der Körperschaft des öffentlichen Rechts beruhenden Privilegien als auch deren gesellschaftlich schwindende Bedeutung, was die Mitgliedszahlen und die moralische Akzeptanz in der Bevölkerung betrifft, sind Veranlassung genug, deren verfassungsrechtlich problematische staatliche Bevorzugung kritisch zu hinterfragen.
Im ersten Teil wird somit zunächst anhand einiger Beispiele dargelegt, dass Religionskritik neben ihrer inhaltlichen Berechtigung auch von entscheidender Bedeutung gewesen ist, was die Entwicklung von mittelalterlichen theokratischen Gesellschaftsstrukturen hin zu den modernen säkularen und freiheitlichen Verfassungen angeht. Das ist kein Prozess, der damit abgeschlossen wäre, denn auch heute noch stellt die permanente kritische Auseinandersetzung mit religiösen Systemen und ihren ideologischen wie gesellschaftlichen Ansprüchen eine notwendige und existentielle Bedingung für den Erhalt von offenen und demokratischen Gesellschaften dar. Das mag gegenwärtig mehr für den Islam als für das mittlerweile weitgehend sich an die Aufklärung angepasste Christentum gelten. Letztendlich aber profitieren auch die in der BRD immer mehr zur Minderheit werdenden religiösgläubigen Bürger von der durch die Religionskritik und Aufklärung erst ermöglichten säkularen Verfassung, denn sie gewährt - ebenso wie andere demokratische Staaten mit ihren freiheitlichen Verfassungen auch - allen Bürgern, egal welcher Glaubensgemeinschaft sie angehören, ein Leben in Freiheit, religiöser Selbstbestimmung, Frieden und damit letztlich auch in materiellem Wohlstand. Als ein grundlegendes Moment der Aufklärung war und ist die Religionskritik somit eine conditio sine qua non für einen über Jahrhunderte andauernden und in Wellen verlaufenen Säkularisierungsprozess, an dessen vorläufigem Ende die heutigen freiheitlich demokratischen Staaten mit ihren säkularen Verfassungen und den Menschenrechten stehen. Insofern ist die Religionskritik nicht nur inhaltlich, sondern auch was ihre historische Auswirkungen auf freiheitliche Verfassungen und Gesellschaften angeht, weitaus bedeutender und besser als ihr bisheriger, von klerikaler Seite propagierter schlechter Ruf. Denn mit einer sich auf Vernunft und wissenschaftlichen Erkenntnissen stützenden Religionskritik ist immer auch eine Relativierung der inhaltlichen und gesellschaftlichen Ansprüche religiöser Systeme verbunden. Eine Hinterfragung von Religionen, Gottheiten und allein selig machenden Glaubenswahrheiten hat als Wirkung immer auch eine gesunde kritische und vor allem auch gelassenere Einstellung der Gesellschaft gegenüber den religiösen Institutionen zur Folge, was deren Autorität, Macht und Einflussnahme deutlich eingrenzt. Damit wiederum wird auch die Toleranz gegenüber anders- oder „ungläubigen“ Systemen und somit letztlich auch der gesellschaftliche Frieden gefördert. Denn, wie die Geschichte gerade der monotheistischen Weltreligionen lehrt, standen Freiheit, Friedfertigkeit und Wohlstand tatsächlich immer dann in größter Blüte, wenn der Einfluss des Religiösen auf die Menschen am geringsten war. Dass dies auch heute noch seine Gültigkeit besitzt, zeigt der Vergleich zwischen den sehr gegensätzlichen theokratisch und demokratisch verfassten Staaten. Insofern stimmt die These, dass auch religiöse Glaubensgemeinschaften und gläubige Bürger von den Segnungen, die im Zusammenhang mit Religionskritik, Aufklärung und den säkularen Verfassungen stehen, letztlich profitieren. Leider scheint diese historisch belegbare Tatsache vielen der in offenen demokratischen Gesellschaften lebenden und von ihnen profitierenden Mitbürgern mit einer eher „orthodoxen“ oder gar fundamentalistischen Glaubensgesinnung nicht bewusst zu sein.
Bevor die gesellschaftlichen und politischen Auswirkungen der Religionskritik für das Zustandekommen freiheitlicher und offener Gesellschaften gewürdigt werden, soll aber zunächst als Voraussetzung hierzu, die sachliche Berechtigung einer wissenschaftsbasierten Religionskritik auf der Grundlage der historisch-kritischen Theologie, an einigen Beispielen aus dem Alten und Neuen Testament aufgezeigt werden. Danach werden weitere Einwände von bedeutenden Philosophen, Theologen und auch Naturwissenschaftlern gegen die (monotheistischen) Offenbarungsreligionen am Beispiel des Christentums zusammengefasst. Die damit verbundene Chronologie der Religionskritik zeigt deren zunehmenden Einfluss auf den damit korrelierenden Säkularisierungsprozess in Europa seit der Neuzeit bis heute sowie den damit verbundenen Autoritäts- und Glaubwürdigkeitsverlust vermeintlich allein seligmachender Glaubenssysteme. Dabei wird ebenfalls deutlich werden, dass die durch die Aufklärung errungenen freiheitlichen Werte wie die Menschenwürde oder die Menschenrechte als humanistische Errungenschaften weit über die sogenannte „christliche Ethik“ hinausgehen und nicht wegen des Christentums, sondern trotz des Christentums entstanden sind, da sie erst gegen den erheblichen Widerstand der christlichen Kirchen durchgesetzt werden mussten. Freiheitliche Grundwerte wie Religionsfreiheit, Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit, Emanzipation, sexuelle Selbstbestimmung oder Toleranz gegenüber Andersdenkenden mussten ihnen erst in einem langwierigen und erbitterten Kampf abgetrotzt werden. Noch 1864 hatte Pius IX. in seinem „Syllabus errorum“ in Form eines Bannfluchs achtzig liberale Irrtümer angeprangert, darunter auch die individuelle Religionsfreiheit, die staatliche Schule, die staatliche Ehescheidung, die Anerkennung einer anderen als der katholischen Religion als ausschließliche Staatsreligion. Seit der Aufklärung kämpfte die christliche Theologie gegen den humanistischen Autonomiegedanken als frevelhafte Anmaßung. Selbst im Evangelischen Staatslexikon von 2006 befindet sich unter dem Kapitel Grundrechte keinerlei Hinweis auf eine christliche Herkunft der Menschenrechte.1
Mit der Aufklärung und mit kritisch denkenden Philosophen ist somit auch in ethischer und gesellschaftlicher Hinsicht ein Fortschritt verbunden, der zu den heutigen freiheitlichen und säkularen Verfassungen bzw. Staaten geführt hat. Aufgrund der restriktiven Rolle, die die Kirchen in diesem Entwicklungsprozess und in der Historie im Allgemeinen gespielt haben, liegt dann natürlich auch die Frage auf der Hand, ob deren Anspruch als unverzichtbare ethischmoralische Instanz für unsere Gesellschaft überhaupt gerechtfertigt ist. Immerhin wird mit dem Argument der ethisch-moralischen Leitfunktion der Einfluss der Kirchen auf Gesellschaft, Politik und staatliche Einrichtungen und vor allem auch deren noch näher zu schildernden Privilegien, gerechtfertigt. Zumindest war es für die Väter und Mütter des Grundgesetzes nach den Erfahrungen der Nazidiktatur ein Hauptanliegen, mit dem Religionsverfassungsrecht ein kooperatives Modell zwischen Staat und Religion zu erschaffen, das auf der Annahme beruhte, die christlichen Kirchen hätten einen besonderen ethisch-moralischen Status, der der Sittlichkeit und dem inneren Frieden dienlich ist. Die sehr fragwürdige historische Rolle, die die katholische wie auch evangelische Kirche im „Dritten Reich“ gespielt haben, scheint hierbei allerdings übersehen worden zu sein. So auch die Frage, wie aus einer hauptsächlich aus katholischen und evangelischen Christen bestehenden christlichen Gesellschaft der Weimarer Zeit der Nationalsozialismus und der Holocaust hervorgehen konnte. Wenn man das Argument des unentbehrlichen ethisch-moralisch Führungsanspruchs der christlichen Kirchen ernst nimmt, hätte es in einer ausschließlich christlich zusammengesetzten Bevölkerung wie der deutschen in der Vorkriegszeit, diese schreckliche Entwicklung von 1933 bis 1945 inklusive des Holocaust, gar nicht geben dürfen. Das ethisch-moralische Argument, mit dem die große gesellschaftliche Bedeutung der beiden großen christlichen Kirchen und die ihnen deshalb zugestandene staatliche Privilegierung aufrecht erhalten werden soll, scheint historisch betrachtet jedenfalls nicht zu greifen. Auch Umfragen belegen, dass der ethisch-moralische Führungsanspruch der Kirchen und das in sie gesetzte Vertrauen in der bundesdeutschen Bevölkerung enorm eingebüßt haben.2 Das mag unter anderem an dem Scheitern an den eigenen Ansprüchen in der Kirchengeschichte, an dem im Vergleich zu ihrem Religionsstifter „unanständigen“ Reichtum oder aber an den zahllosen Skandalen (Missbrauchsfälle) liegen. Hinzukommt noch ein enormer Glaubwürdigkeitsverlust, was den durch die historisch-kritische Methode aufgedeckten Wahrheitsgehalt der biblischen Geschichten und der darauf beruhenden Religionen angeht. Heute glauben selbst zahlreiche Katholiken und Protestanten nicht einmal mehr an ganz zentrale und essentielle Glaubenswahrheiten und Dogmen, die doch das Wesen und die Identität einer jeden Religion ausmachen. Auch dies wird mit Statistiken und Zahlen zu belegen sein.
Wie bereits eingangs kurz erwähnt, soll im zweiten Teil des Buches die Beziehung zwischen Staat, Kirche und Gesellschaft in Hinblick auf das Religionsverfassungsrecht durchleuchtet werden. Hierbei zeigt sich, dass die zahlreichen und sehr weitgehenden, dabei in der Welt fast einmaligen Privilegien, welche die beiden christlichen Volkskirchen staatlicherseits zugesprochen bekommen, verfassungsrechtlich als teilweise hoch problematisch einzustufen sind. Auch die demographische und religionssoziologische Entwicklung in der BRD, bei der die christlichen Kirchen in den vergangenen Jahrzehnten dramatisch an Mitgliedern und gesellschaftlicher Bedeutung eingebüßt haben (und auch allen Prognosen gemäß in Zukunft weiterhin noch einbüßen werden), drängt nach einer kritischen Hinterfragung der in der BRD sehr weitgehenden Kirchenprivilegien. Immerhin müssen die damit verbundenen finanziellen Kosten für die privilegierten christlichen Institutionen und ihren immer weiter sinkenden Mitgliederzahlen von den damit korrelierenden, immer mehr werdenden nicht-christlichen Steuerzahlern getragen werden. Insofern geht die im ersten Teil dargelegte Notwendigkeit und Berechtigung der Religionskritik für das Zustandekommen und für den Erhalt freiheitlicher und demokratischer Verfassungen und Gesellschaften über in eine im zweiten Teil vollzogenen Kritik an einer nicht verfassungskonformen Umsetzung des Religionsverfassungsrechtes durch die Politik und teils auch durch die Justiz. Hier ist eine - vielleicht aus persönlichen religiösen oder traditionalistischen Gründen zu erklärende - Verweigerungshaltung zu konstatieren, die noch immer vorhandene Bevorzugung und Privilegierung der christlichen Kirchen zu unterbinden. Damit werden die verfassungsrechtlich zumindest als „problematisch“ einzustufenden und nicht mehr zeitgemäßen, weil den demographischen und religionssoziologischen Veränderungen in der BRD nicht Rechnung tragenden Kirchenprivilegien künstlich und zu Lasten der steigenden Zahl an kirchenfernen Steuerzahlern aufrecht erhalten. Dieser Missstand wird anhand konkreter Beispiele im Einzelnen deutlich gemacht und dessen Beseitigung gefordert. Vorher wird aber zu prüfen sein, wie sich die demographische und religionssoziologische Situation in der BRD, in Zahlen ausgedrückt, darstellt. Diese hat sich aufgrund starker Flucht- und Migrationsbewegungen dramatisch verändert. Gleichzeitig und parallel zu dieser multireligiösen Entwicklung hat eine zunehmende Säkularisierung der bundesdeutschen Bevölkerung stattgefunden. Mittlerweile stellt die Gruppe der „Konfessionsfreien“ die größte weltanschauliche Fraktion (38 Prozent), noch vor den den Katholiken (27 Prozent) und Protestanten (25 Prozent) dar. Und das vor dem Hintergrund noch immer anhaltender Austrittszahlen. Der Rest der bundesdeutschen Bevölkerung setzt sich aus ca. 5% Muslimen und zahlreichen kleineren Religionsgemeinschaften zusammen. Interessant ist dabei, wie viel mediale Aufmerksamkeit diese religiösen Gemeinschaften im Vergleich ihres prozentualen Anteils an der Gesamtbevölkerung und vor allem im Vergleich zu der stärksten Fraktion, nämlich den nicht-religiös gebundenen Bürgern, zugesprochen bekommen. Jedenfalls hat sich die Bundesrepublik seit ihrer Gründung von einem einst fast zu einhundert Prozent rein christlichen zu einem zunehmend polyreligiösen und gleichzeitig säkularer werdenden Land entwickelt, bei anhaltender Tendenz. Das bedeutet eine enorme kulturelle Verschiebung von einer vor wenigen Jahrzehnten noch religiös homogenen, hin zu einer multikulturellen und weltanschaulich höchst diversen Gesellschaft, verbunden mit sehr unterschiedlichen und konfliktgeladenen Interessenlagen. Darauf muss der säkulare und weltanschaulich-religiös neutrale Staat als „Heimstatt aller Bürger3 reagieren und einen angemessenen für alle weltanschaulich und religiösen Gruppierungen als gerecht und neutral empfundenen Interessensausgleich sorgen. Eine Privilegierung von speziellen Religionsgemeinschaften, auch wenn das aus historischen und prägenden Gründen von christlich gesinnten Politikern, Juristen und Theologen so gesehen und mit dem Begriff „christliche Leitkultur“ gefordert wird, darf es laut unserer Verfassung nicht geben. Man muss kein Freund der multikulturellen Einwanderungspolitik sein, aber da sie nun mal auch religionssoziologische Fakten geschaffen hat, darf hier nach maßgeblicher Vorgabe durch das Grundgesetz nicht mit zweierlei Maß gemessen werden. Auch diese nicht zu leugnende demographische Entwicklung, bei der die Kirchen auch zahlenmäßig immer weiter an Bedeutung verlieren, drängt also immer mehr zu der Frage, wie zeitgemäß die Kirchenprivilegien überhaupt noch sind und wie sehr die Kirchen erst schrumpfen müssen, bis selbst die hartgesottensten Kirchenlobbyisten einsehen werden, dass nun der Punkt erreicht ist, an dem diese zur Makulatur verkommen sind, weil sie keinerlei gesellschaftlichen Rückhalt mehr besitzen.
Mit der eben erwähnten liberalen Flüchtlings- und Migrationspolitik, die insbesondere mit einem immensen Zuzug von Menschen aus islamischen Ländern verbunden ist, ergeben sich aufgrund der großen kulturellen Unterschiede weitere Probleme, die eben auch mit der Religion, also mit dem Islam, verbunden sind. Da die beiden großen christlichen Volkskirchen eine Aufklärung durchlaufen mussten und längst den säkularen, religions- und weltanschaulich neutralen Staat akzeptieren, muss das Hauptaugenmerk einer künftigen Religionskritik auch auf der Auseinandersetzung mit dem Islam liegen. Hier sind die mit der Aufklärung verbundenen freiheitlichen Errungenschaften noch lange nicht verinnerlicht oder gar zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Selbst bei vielen hier schon seit Generationen lebenden Muslimen sind rückwärtsgewandte, archaische und patriarchalische Strukturen noch immer fest verwurzelt. Skeptiker sehen hier eine grundsätzliche Unvereinbarkeit des Islam mit der westlichen Art des Lebens, mit den offenen Gesellschaften und ihren freiheitlichen Werten. Denn in säkularen Demokratien beruhen die Gesetze und Werte auf dem Willen der Bürger und nicht auf heiligen Büchern oder irgendwelchen Gottheiten. Das Volk selbst ist hier der Souverän, es selbst gibt sich seine Verfassung inklusive der darin enthaltenen Wertvorstellungen und Gesetze. Götter und Religionen sind ihr untergeordnet, eben weil man aus der Geschichte gelernt hat. Die damit verbundene Depotenzierung des Göttlichen und Religiösen könnte dabei durchaus einen unüberwindbaren Widerspruch zwischen dem Selbstverständnis des Islam und dem säkularer Demokratien darstellen, der sich genau dann in für die freiheitlichen Gesellschaften existenzbedrohenden Konflikten entladen könnte, wenn es die demographischen Verhältnisse eines Tages erlauben sollten. Wie also soll der säkular geprägte freiheitliche Rechtsstaat mit den teilweise gegen ihn selbst gerichteten antidemokratischen und antiliberalen Formen des Religiösen umgehen? Auch auf diese Frage soll näher eingegangen werden. Allerdings muss der Grundsatz gelten, dass nicht die größtmögliche Religiosität, sondern ein gutes und friedliches Leben in Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit oberstes Verfassungsgebot ist. Damit verbunden ist aber auch das für freiheitliche Gesellschaften existentiell wichtige Prinzip: Keine Toleranz gegenüber der Intoleranz!
Die thematische Verbindung zwischen dem ersten religionskritischen Teil und dem zweiten religionssoziologischen bzw. religionsverfassungsrechtlichen Teil besteht also darin, dass dann, wenn etablierte Religionen und ihre Götter sich für immer mehr Bürger der BRD aufgrund ihres säkularen Weltbildes als nicht mehr annehmbar erweisen und sie zudem auch noch ihre ethisch-moralische Glaubwürdigkeit einbüßen, auch ihr gesellschaftspolitischer Anspruch (von dem die Väter und Mütter des Grundgesetzes noch überzeugt waren) verfällt, für das gesellschaftliche Zusammenleben die höchste ethisch-moralische und göttlich legitimierte Instanz zu sein. Was aber rechtfertigt dann noch die zahlreichen und weltweit einmaligen Privilegien der ohnehin unermesslich reichen Kirchen? Ein unermesslicher Reichtum, der zudem völlig konträr zur Armut des Religionsgründers steht und von dem ebenfalls noch näher zu sprechen sein wird. Insofern stellt der zweite Teil des Buches keine Religionskritik mehr dar, sondern geht einen Schritt darüber hinaus, indem er die Politik und die staatlichen Institutionen anklagt, weil sie das Religionsverfassungsrecht in wichtigen Bereichen nicht adäquat und zeitgemäß umsetzen. Politik und Teile der Justiz tun sich sehr schwer damit, die gesellschaftlichen Veränderungen in religionssoziologischer Hinsicht zum unterstellten Zweck der kirchlichen Besitzstandswahrung zur Kenntnis zu nehmen und daraus die notwendigen Konsequenzen zu ziehen, nämlich die Abschaffung der Kirchenprivilegien.
Schließlich soll noch betont werden, dass es nicht die Absicht des Buches ist, für eine Gesellschaft ohne Gott zu werben, sehr wohl aber für einen säkularen Staat ohne Gott, so wie es im Grundgesetz bzw. im Religionsverfassungsrecht festgeschrieben ist. Hierzu aber gehört die konsequente Umsetzung der religiösen und weltanschaulichen Neutralität des Staates, die Trennung von Staat und Religion/Kirche sowie die Äquidistanz des Staates zu allen Weltanschauungs- und Religionsgemeinschaften, mit der auch deren Gleichbehandlung verbunden ist. Die dabei von der säkularen Verfassung durchaus intendierte enge Kooperation des Staats mit den Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften (RWG) ist zu respektieren, sie fordert aber dennoch die Unterordnung aller Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften unter das Grundgesetz, was für den gesellschaftlichen Frieden in einer multireligiösen Gesellschaft durchaus förderlich ist. Nicht vergessen werden darf bei alldem, dass trotz der zunehmenden polyreligiösen Entwicklung viel mehr noch eine säkulare Entwicklung innerhalb der bundesdeutschen Bevölkerung zu konstatieren ist, was bei der Umsetzung von Religionsfragen ebenfalls von staatlicher und religionspolitischer Seite irgendwann nicht mehr ignoriert werden kann. Der Anteil dieser „schweigenden“ und friedlichen Mehrheit, nämlich der Konfessionslosen und der im strengen Sinne der Kirchen nicht mehr kirchengläubigen Bürger, stellt mittlerweile - bei anhaltender Tendenz - die größte Gruppierung noch vor allen anderen religiösen Glaubensgemeinschaften dar. Dies darf religionspolitisch, trotz massiver Lobbyarbeit und größter kirchenpolitischer Einflussnahme auf die Politik, von dieser nicht außer Acht gelassen werden.
TEIL I
Die inhaltlich-faktische Berechtigung der Religions- und Kirchenkritik
1. Einleitung
Eine sichere und auch nachweisbare Antwort auf die Frage, ob ein höheres Wesen (oder auch mehrere höhere Wesen) existiert, das die Welt erschaffen hat und lenkt, ist objektiv betrachtet noch keinem Menschen gelungen. Sie ist seriös auch nicht abschließend beantwortbar. Als eine mögliche Option wird sie aber seit Menschengedenken sowohl in den primitiven Religionen bis hin zu theologischen und (natur-)philosophischen Theorien in allen möglichen Varianten diskutiert. Sofern man dieses höhere Wesen rein abstrakt in Erwägung zieht, ohne die ihm in den Religionen zugeschriebenen Eigenschaften und (Wunder-)Geschichten, die der Mensch bzw. jede Kultur letztlich aus seinem/ihrem eigenen Wesen ableitet, ist die Hypothese einer rein abstrakten höheren Macht ohne Eigenschaften für jede Religionskritik unangreifbar. Denn jede Kritik benötigt konkrete Aussagen, auf die sie sich beziehen kann. Und diese finden wir in den traditionellen (monotheistischen) Religionen zuhauf. Sie bestehen aus ganz konkreten Vorstellungen und Erzählungen, die mit einem absoluten Wahrheitsanspruch verbunden sind, den es um des Seelenheilswillen zu glauben gilt. Umso konkreter die Glaubensinhalte und Geschichten in den heiligen Büchern sind, um so besser lassen sie sich fassen und überprüfen. Somit geht es in der Religionskritik primär gar nicht um die Frage, ob ein höheres Wesen prinzipiell existiert oder nicht, sondern darum, ob die konkreten Angaben, die Religionen und deren zugrunde liegenden heiligen Bücher machen, plausibel und glaubhaft sind, ob sie einer kritischen Evaluation der Vernunft und der Wissenschaften standhalten können. Und hier zeigt sich eben anhand einer kritischen und wissenschaftsbasierten Evaluation, dass auch Religionen mit ihren Geschichten, Gottes- und Weltbildern ganz profan der kulturellen Evolution unterliegen, dass sie sich völlig kausal als letztlich psychologisch, soziologisch, politisch, kulturell und historisch ausweisbare Produkte der Menschheitsgeschichte herleiten lassen. Damit werden sie in ihren transzendent begründeten Glaubens- und Machtansprüchen freilich stark infrage gestellt, womit durchaus individuelle, Trost spendende und mit paradiesischen Glaubensvorstellungen verbundene Hoffnungen zerbrechen können. Der mit ihrer Entzauberung allerdings auch einhergehende positive Effekt zeigt sich darin, dass Religionen mit der Aufklärung und der dieser zugrunde liegenden Religionskritik ihre Macht und ihren immensen gesellschaftlichen Einfluss im irdischen Dasein immer mehr verloren haben. Das war eine wesentliche Voraussetzung für die Entwicklung von theokratischen Gesellschaftsmodellen hin zu freiheitlichen säkularen Verfassungen und Gesellschaften.
Die „Karriere“ Jahwes beispielsweise, von einer ursprünglich regional begrenzten und unbedeutenden Gottheit unter vielen anderen hin zum alleinigen omnipotenten Weltenschöpfer, sie lässt sich rein kulturhistorisch und ohne Hinzuziehung übernatürlicher Spekulationen sehr plausibel nachzeichnen. In Nicäa (325) wurde Jesus als „Gottessohn“ dogmatisiert und in Konstantinopel (381) folgte, nach jahrzehntelanger Diskussion, das Dogma vom dreieinigen Gott, indem der „Heilige Geist“ als Teil des Göttlichen festgelegt wurde. Am 1. November 451 erhält Christus in Chalkedon seine zwei Naturen als "wahrer Mensch und wahrer Gott". Somit lässt sich historisch sehr stringent nachvollziehen, wie die Karriere Jahwes unter ganz profanen Voraussetzungen verlaufen ist. Er avancierte zunächst von einer ehemaligen unbedeutenden regionalen Berggottheit zu einem Kriegsgott, dann zum Vater eines Sohnes (Jesus Christus), der später zusammen mit dem Heiligen Geist eine trinitarische Einheit darstellt, mit dem Anspruch nun auch noch als alleiniger allwissender, allgütiger und allmächtiger Schöpfer des gesamten Universums zu gelten. Auch die damit verbundene biblische Vergöttlichung und Adaption Jesu durch den alttestamentarischen Gott hat nur noch wenig mit dem historischen Jesus zu tun. Zurecht unterscheidet man in der Theologie deshalb den Jesus des Glaubens, so wie er in der Bibel dargestellt und vergöttlicht wird, von dem historischen Jesus, also dem Menschen, wie er wirklich gelebt und gewirkt hat.
Mehr noch als von naturwissenschaftlicher oder philosophischer Seite sind es mittlerweile die Erkenntnisse einer kritisch-historisch vorgehenden Theologie selbst, die essentielle Glaubensgrundlagen kompetenter infrage stellt, als es andere Disziplinen je tun könnten. Ohne argumentative Umwege, wie in der Philosophie oder den Naturwissenschaften, setzt sie mit der historischen Infragestellung und Analyse zentraler Glaubensaussagen in den heiligen Büchern und den daraus entstandenen dogmatischen Konstrukten die Axt direkt am Stamm des Baumes an, an dem sich die vielzähligen Verästlungen der theistischen Religionen mit dem Judentum, Christentum, Islam und ihren zahlreichen Erscheinungsformen seit der Entstehung des (abrahamitischen) Monotheismus auf ganz profane Weise verzweigt haben. Aus einer historischen Sichtweise heraus lässt sich nämlich mühelos aufzeigen, dass alle Religionen von älteren Kulturen, also auch von anderen Religionen und vor allem auch von politischen Ereignissen beeinflusst wurden. Auch Religionen unterliegen somit einem „evolutiven“ Entwicklungsprozess. Die geographische Lage zu benachbarten Kulturen, die klimatischen Verhältnisse und die damit verbundene Lebensweise, dies und noch vieles mehr spielt eine Rolle bei der Herausbildung von Religionen. Nomadenvölker haben andere Gottesvorstellungen als Bergvölker oder sesshafte Kulturen, in denen sich eine schriftliche Fixierung religiöser Vorstellungen herausbilden konnte. Die unterschiedlichen lebensweltlichen Verhältnisse wie geographische Lage, Klima, politische Bündnisse, gewonnene oder verlorene Kriege, die damit verbundenen spezifischen Lebenssituationen, gegenseitige kulturelle Beeinflussungen, Sorgen, Nöte, Hoffnungen usw., alle diese natürlichen und menschlichen Einflüsse unterliegen einem ständigen Wandel und prägen im Laufe der Geschichte die Religionen unterschiedlicher Kulturen.
Diese natürliche, nämlich anthropologische, soziologische, psychologische oder historische Erklärung für die Entstehung unterschiedlichster religiöser Systeme und ihren Heiligen Schriften steht natürlich im Gegensatz zu deren behaupteter göttlichen Provenienz und dem damit verbundenen Absolutheitsanspruch. Dabei ist der Eingottglaube nicht einmal die Erfindung der abrahamitischen Offenbarungsreligionen. Er wurde wahrscheinlich von Echnaton im 14. Jahrhundert v.u.Z. in Ägypten erstmals in der Geschichte der Menschheit eingeführt und erst später von den Juden in veränderter Form und unter Einfluss benachbarter Religionen wie dem Zoroastrismus übernommen. Denn für das frühe Israel ist die Verehrung mehrerer Götter archäologisch wie exegetisch nachweisbar.
Aber auch diese Religionen wurden, ebenso wenig wie der Jahweglaube, nicht aufgrund ihrer intellektuellen Plausibilität verbreitet und angenommen, sondern neben den gerne angenommenen paradiesischen Versprechungen eines ewigen Lebens für ihre Anhänger musste noch gewaltig mit dem Schwert nachgeholfen werden. Zahlreiche grausam vollzogene Zwangsmissionierungen, die als Alternative nur den Tod oder die Taufe kannten, waren ebenfalls dazu notwendig. Die Liste und die Schilderungen der Grausamkeiten, die im Namen der monotheistischen Offenbarungsreligionen verübt wurden, ist lang und schockierend. Die religiösen Systeme des Judentums, Christentums und des Islam, ihre Macht, ihr Reichtum, ihr gesellschaftlicher und politischer Einfluss, all das existiert nicht aufgrund irgend eines tatsächlich sich in diesen offenbarenden Gottes, sondern zu einem ganz erheblichen Teil aufgrund eines intoleranten Wahrheitsanspruchs, der mit unerbittlicher Gewalt durchgesetzt wurde. Hat also Nietzsche aus heutiger Sicht nicht Recht, wenn er die rhetorische Frage stellt, ob man sich mit dem Christentum (aber ebenso auch mit allen anderen auf Offenbarung beruhenden monotheistischen Schriftreligionen) „nach dem gegenwärtigen Stand der Erkenntnis“ überhaupt noch einlassen kann, „ohne sein intellektuales Gewissen heillos zu beschmutzen“? Diese suggestive, aber keinesfalls unberechtigte Frage müsste aufgrund des heutigen Kenntnisstandes über die „Kriminalgeschichte“ der monotheistischen Religionen sogar noch auf das „ethisch-moralische“ Gewissen bezogen und erweitert werden.
Im Nachfolgenden soll eine kurze Zusammenfassung einer auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhenden Betrachtungsweise heiliger Schriften am Beispiel des Alten und Neuen Testamentes gegeben werden.4
1.1 Das Alte Testament
Der Name des alten biblischen Gottes JHW taucht erstmals in einer ägyptischen Ortsnamensliste um 1350 v. Chr. auf. Die Rede ist dort von Jahwe-Beduinen. Abgeleitet wird diese Bezeichnung sowohl von dem von dieser Gruppe verehrten Gottesnamen als auch dem Berg, auf dem dieser Gott verehrt wurde. Land, Bewohner und Gott hatten also den gleichen Namen. Daraus lässt sich folgern, dass Jahwe ursprünglich eine regionale Berggottheit gewesen war und anfänglich noch gar nichts mit Israel zu tun hatte, das in vorstaatlicher Zeit auch noch gar nicht existierte. So wie es sich heute darstellt, war Jahwe ursprünglich nur eine von zahlreichen regionalen Gottheiten, die von einem kleinen Bergstamm, den Schasu-Medianiter, an einem bestimmten Ort, dem Gottesberg am Roten Meer auf heutigem saudiarabischen Territorium, verehrt wurde. Irgendwann muss es zum Kontakt mit einer Gruppe von Judäern gekommen sein, die ihn sozusagen „adoptierten“ und bei denen er schließlich zum Kriegs- und Staatsgott und später sogar zum universellen Weltenschöpfer der Juden, Christen und Muslime avancierte. Für diese These spricht auch, dass die Erzväter Abraham, Isaak und Jakob Jahwe noch gar nicht kannten. Ihnen sind noch die sogenannten El-Gottheiten erschienen. (Vgl. Ex 6,2-3) Erst in nachexilischer Zeit setzte sich, und zwar durch entsprechenden Einfluss der Priesterschaft, der Jahweglaube durch. Die Existenz anderer Götter anderer Völker wurde dabei aber immer noch anerkannt und nicht geleugnet (Monolatrie).Der sich im Laufe der Zeit zum drei-einigen Gott der Christen weiter entwickelnde Gott des Alten Testaments hatte im 9. und 8. vorchristlichen Jahrhundert sogar eine Gemahlin namens Aschera, die ebenfalls als gleichberechtigte Göttin an seiner Seite verehrt wurde. Erst mit der Rückkehr aus dem Babylonischen Exil im 6. Jahrhundert v.u.Z., entwickelte sich die alleinige Verehrung Jahwes durch die Israeliten. Daneben existierten aber noch weitere Gottheiten, wie die Fruchtbarkeitsgöttin Astarte und Baal als ebenfalls lokale Gottheiten in Samaria, der Hauptstadt Israels, von denen sich noch die polytheistischen Spuren im Alten Testament auffinden lassen.
Im babylonischen Exil wurden die über viele Jahrhunderte nur mündlich tradierten Sagen und Legenden von den Priestern verklärend an die religiösen und pölitischen Wunschvorstellungen angepasst und schriftlich fixiert. Angefangen von der frei erfundenen und neu komponierten judäischen Vorgeschichte über Abrahams Wanderung, Mose Rückkehr aus Ägypten bis hin zur ebenfalls frei erfundenen kriegerischen Landnahme Kanaans.5 Das allermeiste, was uns im Alten Testament überliefert wurde, vom Schöpfungsbericht über die Erzvätergeschichten, dem Auszug aus Ägypten bis hin zu den Gründungsmythen des Staates Israel, wurde erst zur Zeit der Babylonischen Gefangenschaft von der Priesterschaft, also erst viele Jahrhunderte nach einer fiktiven und verklärenden mündlichen Tradition erstmals schriftlich fixiert. Eine historische Geschichtsschreibung mit dem Anspruch auf Objektivität, hat es dabei noch nicht gegeben und war auch gar nicht die Absicht der Autoren. Es sind Geschichten, die der theologischen Phantasie entspringen, wenngleich dahinter im Kern durchaus historische Rudimente zu vermuten sind. So waren die im AT genealogisch verbundenen Erzväter Abraham, Isaak und Jakob ursprünglich drei unterschiedliche Stammespatriarchen, die nichts miteinander zu tun hatten und die jeweils ihre eigenen Vätergötter verehrten (Gott Abrahams, Gott Isaaks, Gen 31,42, der Starke Jakobs, Gen 49,24). Als später diese Nomadenstämme sesshaft wurden und sich vereinigten, wurde auch die Erzvätertraditionen vereinigt, indem man die Väter in eine genealogische Reihe brachte. Isaak als Sohn Abrahams und Jakob als Sohn Isaaks.
Zum Gründungsmythos kam neben der Erzvätertradition dann auch noch die Exodus- und Sinaitradition hinzu, benannt nach einem wohl schon damals heiligen Berg im Norden der arabischen Halbinsel. Das Zusammentreffen mit der Berggottheit Jahwe am Berg Sinai führte – wie eben schon angedeutet - zum Beginn jenes Monotheismus, der dann auch in das palästinensische Kulturland eingeführt wurde.6 Den damit in der Bibel geschilderten Zusammenhang mit dem Exodus und der Landnahme des Gesamtvolkes Israel aus Ägypten kann es aber so realiter nicht gegeben haben, da Israel als Volk im 13. und 12. vorchristlichen Jahrhundert noch gar nicht existierte. Aufgrund der Ergebnisse der modernen Archäologie wissen wir heute, dass die Städte Jericho und Ai zur Zeit der angeblichen Landnahme gar nicht besiedelt waren. Auch Ausgrabungen anderer, angeblich durch die Landnahme zerstörter Städte geben keinerlei Hinweise einer Eroberung zu dieser Zeit. Somit ergibt sich die Erkenntnis, dass aus drei unabhängigen Überlieferungstraditionen im Laufe der Zeit eine Einzeltradition entstand, die zu einer Gesamtüberlieferung komponiert wurde.7 Der Glaube an Jahwe als den einzigen Gott Israels neben den selbstverständlich akzeptierten Göttern anderer Völker entstand also erst in der Königszeit, nachdem er in der Vorzeit von außen (Exodus- und Sinai-Tradition) nach Kanaan eingeführt wurde. Vor der Zeit Mose wurden noch die El-Gottheiten der Erzväter verehrt. Erst mit dem Wirken der Propheten Elia (um 850 v.u.Z.) und Hosea (etwa 750 v.u.Z.) kam es für Israel zur Durchsetzung des Alleinigkeitsanspruches Jahwes im Rahmen der Monolatrie. Der auf die Monolartie folgende Monotheismus, also der Universalitätsanspruch Jahwes als alleiniger König und Schöpfer der gesamten Welt, wird dann insbesondere in Deuterojesaia (Jes. 40-55, entstanden in der Auseinandersetzung mit der babylonischen Religion und am Ende des Babylonischen Exils), schriftlich festgelegt.8 Dieses unter rein profanen und entwicklungsgeschichtlichen Gesichtspunkten zu erklärende monotheistische Produkt „Jahwe“ wurde später noch zum Ausgangspunkt zweier weiterer Weltreligionen, nämlich des Christentums und des Islams.
Nicht unerwähnt bleiben darf auch der Einfluss des Zarathustra (um 800 v.u.Z.) - also des persischen Propheten und Begründers des Zoroastrismus - auf die Entwicklung der nahöstlichen Religionen und somit auch auf das Judentum und das spätere Christentum. Zarathustra führte den monotheistischen Glauben ein, als in Palästina noch der Polytheismus verbreitet war. Ebenso den ethischen Dualismus, den Kampf des Guten gegen das Böse mit anschließendem Weltgericht, bei dem die Bösen bestraft und die Guten mit Heil und Unsterblichkeit belohnt werden. Aufgrund der geographischen Nähe und des kulturellen Austausches ist stark davon auszugehen, dass diese Auffassungen auf das Judentum und somit auch indirekt auf das Christentum eingewirkt haben.
Den heutigen Christen ist der alttestamentarische Gott mittlerweile allerdings peinlich geworden, da er ein grausamer Kriegsgott ist, dessen blutige Schandtaten den Gewaltexzessen, wie sie auch im Koran zu finden sind, in nichts nachsteht. Besonders perfide ist dabei die Konstruktion, dass Jahwe selbst es ist, der die Völker und Menschen „verstockt“, um sie dann auch noch dafür zu töten. Die Menschen hatten also nicht einmal eine Wahl, sie hatten keinen freien Willen und sind für ihre Taten nach heutigem ethischen Verständnis deshalb auch nicht verantwortlich zu machen. Ohne den freien Willen, mit dem sich der Mensch frei für das Böse oder das Gute entscheiden kann, macht aber die ganze spätere christliche Ethik, die Vorstellung eines Jüngsten Gerichts, nach der die Menschen entweder zur Strafe in die ewige Hölle oder zum Lohn in das ewige Paradies kommen, keinen Sinn. Die Bibel ist auch an diesem Punkt in sich höchst widersprüchlich und zeigt damit, dass sie nicht von einem allwissenden und weisen Gott herrühren kann, sondern eher als Synthese von lange zurückliegenden, nur mündlich tradierten und verklärten historischen Geschehnissen, Wunschdenken und menschlicher Phantasie anzusehen ist. Ein besonders ins Auge fallender grundlegender Widerspruch besteht in dem grausamen und eifersüchtigen Kriegsgott des Alten Testamentes, der noch gar nichts von der Trinität, also von seinem Sohn und dem Hl. Geist wusste, der aber der gleiche Gott sein soll, wie der „liebe“ und trinitarisch gedachte Gott des Neuen Testamentes. Die Peinlichkeit des Gottes des Alten Testamentes für die heutigen Christen besteht aber hauptsächlich in ethischer Hinsicht. So erteilt beispielsweise Jahwe in der Schlacht um Jericho (Jos 6) den Befehl, alles Lebendige, Männer, Frauen, Kinder, Greise, sogar Rinder und Schafe und Esel zu töten sowie die Schätze zu plündern. Im Zusammenhang mit dem Auszug aus Ägypten (Ex 11) geht Jahwe um Mitternacht sogar selbst durch Ägypten und tötet jede Erstgeburt, auch die des Viehs. In „Sprüche gegen die Babylonier“ (Jes 13) verkündet Jahwe bei der Musterung seines Heeres, dass die Erde in eine Wüste verwandelt, alle Meder durch das Schwert fallen, die Kinder zerschmettert, Häuser geplündert und Frauen geschändet werden. In den Psalmen ist zu lesen: "In deinem Namen zertreten wir unsere Gegner" (P44) "Der Herr steht dir zur Rechten, er zerschmettert Könige am Tage seines Zorns. Er hält Gericht unter den Heiden, er häuft die Toten, die Häupter zerschmettert er weithin auf Erden“ (Ps 110). Weiter heißt es: "Wohl dem, der deine kleinen Kinder packt und sie am Felsen zerschmettert." (Ps 137) Mit der Sintflut wird sogar die gesamte Menschheit vernichtet. Man vergleiche dagegen den Psalmspruch: "Lobet den Herrn, denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich."
Nach heutigem ethischen Verständnis war Jahwe ein grausamer Schlächter, eben ein Kriegsgott. Moses und Josua wären nach heutigem Rechtsverständnis als Kriegsverbrecher zu verurteilen. Wenn sich heute Politiker und Geistliche auf die Bibel und die (ethische) Bedeutung des Christentums für unsere Gesellschaft berufen, wird das Alte Testament deshalb gerne ausgeblendet, obwohl auch dies zum christlichen Gottesglauben dazu gehört. Fairerweise muss man aber zugestehen, dass die Quellen der eben geschilderten Grausamkeiten natürlich nicht die des behaupteten Gottes Jahwes sind, sondern der Phantasie der Priesterschaft während der babylonischen Gefangenschaft entsprangen, was dann aber der Auffassung gläubiger Christen, die Bibel sei ein von Gott geoffenbartes Buch, widerspricht. Jahwe und die ihm im Alten Testament zugeschriebenen Eigenschaften sind für gläubige Christen eine untrennbare Einheit, Jahwe wird durch diese definiert. Von den Eigenschaften Gottes, die ihm das spätere Christentum mit seiner Dogmengeschichte anheften wird, wussten die alttestamentarischen Autoren noch nichts. Dass Jahwe einen Sohn haben soll, dass er von einer Jungfrau geboren sein soll, dass er eine Dreiheit und gleichzeitige Einheit zusammen mit einem heiligen Geist sein wird, dass er jetzt auf einmal auch noch seine Feinde liebt, nachdem er sie vorher auf blutrünstige Weise abgeschlachtet hat, all das entspricht nicht den alttestamentarischen Vorstellungen über Gott, wie sie von den Priestern im Babylonischen Exil schriftlich festgelegt wurden. Der Gott des Alten Testaments bildet zwar die theologische Grundlage für den Gott des Neuen Testaments, dennoch gehen die ihm jeweils zugesprochenen Eigenschaften so weit auseinander, dass sie sich aufgrund ihrer Widersprüchlichkeit nicht vereinbaren lassen. Der Kriegsgott Jahwe und der daraus evolvierte barmherzige und zu Mensch gewordene dreieinige Gott der Christenheit könnten trotz ihrer behaupteten Identität gegensätzlicher nicht sein. Man muss schon Theologe oder streng gläubiger Christ sein, um in dieser Widersprüchlichkeit einen höheren und konsistenten Sinn der Offenbarung zu erkennen beziehungsweise ihn notfalls eben zu konstruieren. Die These, dass Heilige Bücher und darauf sich gründende Religionen nicht als göttliche Offenbarungen vom Himmel gefallen sind, sondern eine kulturhistorisch nachvollziehbare Entstehungsgeschichte aufweisen, wird aufgrund solcher und weiter unten im Zusammenhang mit dem Neuen Testament noch zu erörternden Ungereimtheiten erhärtet. Religionen sind nicht göttlichen, sondern „menschlich-allzumenschlichen“ Ursprungs. Das ergibt sich schon alleine aus der logischen Konsequenz der Tatsache, dass sich die Religionen selbst widersprechen und sich somit gegenseitig in ihren Wahrheits- und Glaubensansprüchen negieren.
1.2 Das Neue Testament
Die wichtigste, das Christentum ganz wesentlich prägende Tradition kommt aus dem Judentum. Jesus selbst war Jude und hatte, wie viele andere Propheten auch, das kurz bevorstehende Reich Gottes verkündet. Ob er sich dabei tatsächlich für den Sohn Gottes gehalten und ausgegeben hat oder ob er im Nachhinein von seinen Anhängern und vor allem von Paulus dazu erst verklärt wurde, nachdem sich seine Prophezeiungen über das Reich Gottes nicht erfüllt hatten und er unerwarteter Weise hingerichtet wurde, das ist die entscheidende Frage, was die Kernaussage des christlichen Glaubens angeht, dass nämlich Jesus Gottes Sohn ist. Sie wird unter den Theologen durchaus kontrovers diskutiert. Von ihrer Beantwortung hängt existentiell das ganze Konstrukt des christlichen Glaubens ab. Entweder Jesus war der Sohn Gottes oder er wurde von seinen Anhängern zu diesem erst post mortem verklärt. Wir werden gleich noch näher darauf eingehen.