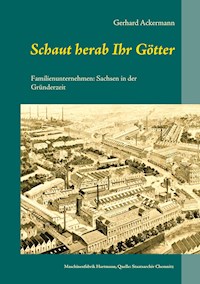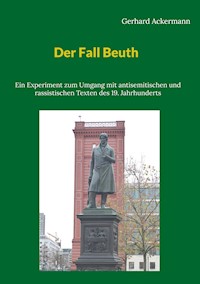
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Christian Peter Wilhelm Beuth, im 19. Jahrhundert Reformer der Ingenieurausbildung in Preußen wird bezichtigt, einer der schlimmsten Antisemiten seiner Zeit gewesen zu sein. Hintergrund ist der Fund eines ihm zugerechneten antisemitischen Schriftstücks in der Jagiellonischen Bibliothek Krakau Anfang des 21. Jahrhunderts. Seine Zeitgenossen haben Beuth dagegen immer für einen großen und integren Staatsmann und wichtigsten Reformer der preußischen Wirtschaft gehalten. In dem Buch wird gezeigt, dass die Verurteilung Beuths ein krasses Fehlurteil ist. Beuth hat nichts mit dem Pamphlet aus Krakau zu tun. Er war ein aufgeklärter, toleranter Mensch, ein unabhängiger Freigeist, der als Mitglied der Regierung unter Fürst von Hardenberg das Edikt zur Judenemanzipation, das Friedrich Wilhelm III. in Preußen erlassen wollte, mit Überzeugung unterstützte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 96
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„Wer geistreich denkt und eifrig schafft
Dem dient Natur mit ihrer Kraft“
Medaille, Aufschrift
Medaille zum Abschied von C. P. W. Beuth als Vorsitzendem des Gewerbevereins, 1846
Hersteller: Carl Heinrich Lorenz, 1846
Quelle: Helmut Caspar, Berlin
INHALT
EINLEITUNG
DAS EXPERIMENT
ANTISEMITISMUS UND ANTIJUDAISMUS IN KANTS WERKEN – DIE GRUNDLAGE
Aus der „Anthropologie in pragmatischer Hinsicht“
Aus „Vorkritische Schriften II (1757–1777)“
Aus „Der Streit der Fakultäten“ / Euthanasie
ERNST MORITZ ARNDT – DER PROBELAUF
Der Hass gegen das Frankreich Napoleons
Die öffentliche Rede von Joachim Lege in Greifswald
Eine weitere Äußerung aus der Universität Greifswald
ZWISCHENBILANZ
DER FALL BEUTH – DAS FEHLURTEIL
Die Deutsche Tischgesellschaft
Reden der DTG im Jahre 1811
Inhalt und Qualitätskategorie von Nr. 23
Der Itzig-Skandal
Beuths Jugend und Studium: Kleve und Halle
Beuth, Hardenberg und das Edikt zur Judenemanzipation – Beuth in Berlin
Leumund Beuths
Beuth und der Itzig-Skandal
FAZIT FÜR DREI LEUCHTTÜRME DES 19. JAHRHUNDERTS
KONSEQUENZEN – AUCH FÜR UNS
ANHANG: DIE REDE VON JOACHIM LEGE AUF DEM MARKTPLATZ IN GREIFSWALD AM 4. MÄRZ 2017
LITERATURVERZEICHNIS
BILDQUELLEN
INDEX
DANKSAGUNG
Einleitung
Wenn Sie, lieber Leser, demnächst einen Besuch des Humboldt-Forums in Berlin planen, ist das sicher eine gute Idee. Sollten Sie die „Ernst-Moritz-Arndt-Kirchengemeinde“ dort auch aufsuchen wollen, werden Sie etwas Probleme haben, bis Ihnen jemand sagt, diese heiße jetzt „Emmaus-Gemeinde“; suchen Sie in Dortmund die „Beuth-Straße“, wird Ihnen Ihr Navi antworten, die gäbe es nicht, oder ob Sie vielleicht die „Straße zur Vielfalt“ suchen. Wir könnten dieses „Spiel“ mit der Ernst-Moritz-Arndt-Universität in Greifswald oder der Beuth-Hochschule in Berlin fortsetzen oder mit der Umbenennung des „Bismarck-Zimmers“ im Auswärtigen Amt in „Saal der Deutschen Einheit“, um nur zwei, drei weitere Beispiele unter vielen zu nennen.
Die Namen von Personen, die in der Vergangenheit wegen ihrer Leistungen auf verschiedensten Gebieten berühmt waren, für Gebäude, Vereine und Gesellschaften und anderes mehr zu verwenden, war zwar bisher gängige Praxis, steht aber mehr und mehr in der Kritik. Die Erfahrungen der jüngsten Geschichte, des Holocausts, hat die Gesellschaft sensibilisiert. So werden immer mehr Stimmen laut, die Menschen aus der Historie des Rassismus, der Menschenfeindlichkeit, des Antisemitismus und weiterer Delikte wie „antidemokratisches Verhalten und Meinung“ beschuldigen. Ob diese möglichst flächendeckende Umbenennung richtig ist oder dadurch nicht flächendeckende historische Erinnerungen – gut und schlecht – ausgelöscht werden, ist eine Frage, die bisher nicht genug diskutiert wurde.
Gelegentlich hat man den Eindruck, dass Anschuldigungen umgesetzt werden, ehe sie ausreichend auf Echtheit geprüft wurden. So kann es auch zu Fehlurteilen kommen.
Wir beschäftigen uns hier mit einem solchen Fall. Bei seinen Arbeiten zu einem Buch, das sich mit der Deutschen Tischgesellschaft (DTG) befasst, einer reinen Männervereinigung des 19. Jahrhunderts in Berlin, machte Stefan Nienhaus in der Jagiellonischen Bibliothek in Krakau eine sensationelle Entdeckung. Er fand im Nachlass von Karl August Varnhagen von Ense (1785– 1858) ein bis dahin unbekanntes Schriftstück voller schrecklichster antisemitischer Verunglimpfungen, welches er für eine Rede von Christian Peter Wilhelm Beuth hielt, die dieser vor der Deutschen Tischgesellschaft gehalten haben soll. Nienhaus attestierte Beuth einen „ungehemmten, persönlichen Judenhass“ (Nienhaus, 2003, S. 242). Diese Aussage steht im krassen Gegensatz zu der Einschätzung, die Henderson in einer Publikation über „Peter Beuth and the Rise of Prussian Industry“ gegeben hat. Er beginnt seinen Aufsatz in The Economic History Review, New Series mit dem Satz: „Few men have a better claim than Beuth to be known as ‘father’ of Prussian industry“ (Henderson, 1955, S. 222).
Beide Aussagen können kaum gleichzeitig richtig sein. Letztlich ist aber der Fund und die Einschätzung von Stefan Nienhaus der Auslöser für die Namensänderung der „Beuth-Hochschule für Technik“ in Berlin gewesen. Auch dafür, dass in Kleve eine Erinnerungstafel an den großen Sohn der Stadt abgehängt und in Dortmund die erwähnte Beuth-Straße umbenannt wurde.
Die Hochschule in Berlin trug bis 2009 den Namen „Technische Fachhochschule Berlin“ (TFH Berlin) und änderte ihn dann in „Beuth-Hochschule für Technik“ auf der Grundlage von Recherchen, die mein Nachfolger im Amt des Präsidenten veranlasste. Der neue Name deutete auf die Wurzeln der Hochschule hin, die wie auch für die Technische Universität Berlin bei den Aktivitäten von Christian Peter Wilhelm Beuth zu suchen sind.
In einem mehrere Jahre dauernden, teilweise emotional geführten Verfahren, bei dem mein Nachfolger und ich vergeblich versuchten, eine Gegenposition zu der Verurteilung Beuths aufzubauen, wurde durch Mehrheitsbeschluss der Akademischen Versammlung der Hochschule der Name „Beuth“ abgelegt. Die Hochschule heißt jetzt „Berliner Hochschule für Technik“.
Auf der Homepage findet man eine Stellungnahme des Präsidenten, aus der wir zitieren:
„Grund für die Umbenennung sind antisemitische Äußerungen und Handlungen des Namensgebers der Hochschule, C. P. W. Beuth … Nach einem hochschulweiten Diskurs stimmten die Mitglieder der Akademischen Versammlung im Januar 2020 für das Ablegen des Namens, Beuth‘. Soweit aus dem Text des Präsidenten der Hochschule Prof. Dr. Werner Ullmann.“ (Homepage der BHT Berlin)
Diesen Beschluss halte ich für falsch und ungerechtfertigt. Ich will zeigen, dass man auf der Grundlage intensiver und detaillierterer Recherchen zu einem ganz anderen Urteil über Beuth kommen muss, der mit dem christlichen Antisemitismus eines Achim von Arnim, der hier eine unrühmliche Hauptrolle spielt, gar nichts zu tun hatte. Weiter gehende Recherchen hätten von Anfang an deutlich gemacht, dass Beuth der Antisemit nicht ist, für den ihn die Mehrheit der Akademischen Versammlung damals auf der Grundlage der Einschätzung der beauftragten Experten und der Ergebnisse einer Tagung an der Hochschule halten musste. Diese neue Sicht zu Beuth soll hier in einem Experiment entwickelt werden.
Das Experiment
Ein wesentliches Instrument naturwissenschaftlicher Forschung ist das Experiment. Heute ist es eher unwahrscheinlich, dass ein Naturwissenschaftler allein ein Experiment plant und dann im Labor ausführt. Es sind oft Heerscharen von Wissenschaftlern, die zusammen an einem Problem arbeiten und dieses – verteilt über die ganze Welt – in die Tat umsetzen. Wir haben das gerade erlebt im Bereich der Weltraumforschung (James Webb Space Telescope) und des Mikrokosmos (Higgs-Teilchen, Entdeckung am CERN). In der Welt der Geisteswissenschaften ist die Beschäftigung mit wichtigen Themen vielleicht nicht immer so öffentlichkeitswirksam, aber oft nicht weniger spektakulär, wenn man beispielsweise an die Entdeckung von bisher unbekannten Dokumenten denkt, von denen wir eben berichtet haben. Als Physiker ist der Einstieg in die Geisteswissenschaften zwar nicht ohne Risiko, aber einige Gehversuche in den Geisteswissenschaften hat der Autor ja schon „überlebt“.
Es geht hier um ein Experiment zum Umgang mit judenfeindlichen und rassistischen Texten des 19. Jahrhunderts. Ein Experiment will sorgfältig geplant werden. Im physikalisch-optischen Labor ist klar, dass man Instrumente braucht, die das ermöglichen, was man untersuchen will, also braucht man Laser, optische Instrumente wie Linsen, Blenden, Strahlteiler und anderes mehr, um das Problem zu bearbeiten, um das es geht. Auch in dem bevorstehenden Experiment werden wir uns Werkzeuge beschaffen, die wir für das „Projekt Beuth“ benötigen. Die sehen zwar etwas anders aus, aber auch sie sollen Licht bringen, hier in die Angelegenheit Beuth. Das Projekt besteht deswegen aus drei Teilen. Im ersten Teil geht es darum, ein Verfahren oder Kriterien, also unsere „Werkzeuge“, zu finden, die wir für dieses Experiment in den Geisteswissenschaften benötigen. Das geschieht anhand der Person Immanuel Kants. Es gibt glücklicherweise eine brillante, detaillierte Untersuchung von Bettina Stangneth (Stangneth, 2001) zu judenfeindlichen Äußerungen bei Kant. Diese Untersuchung ist geeignet, Kriterien zu entwickeln, nach denen man historische Texte untersuchen kann.
Die Kenntnisse werden dann auf eine zweite Persönlichkeit des 19. Jahrhunderts angewendet, der mit heute rassistisch eingestuften Publikationen gegen Napoleon und Frankreich agitierte, Ernst Moritz Arndt. Zum Problem, als Namenspatron der Universität abdanken zu müssen, gibt es aus Greifswald aktuelle Publikationen, aus denen weitere Grundsätze für die Behandlung und Einschätzung von judenfeindlichen oder rassistischen Äußerungen gewonnen werden können.
Mit diesen Werkzeugen zum systematischen Vorgehen und zu kritischer Einschätzung solcher historischen Veröffentlichungen folgt der zentrale dritte Teil, Christian Peter Wilhelm Beuth.
Es geht um eine Persönlichkeit, für welche die publizierten Texte besonders schwer zu beurteilen sind. Geheimrat Beuth war ein Jurist, Mitglied der Regierung König Friedrich Wilhelm III. und Reformer der Wirtschaft Preußens im 19. Jahrhundert.
Eine neue Bewertung der Schriftstücke, die bekannt sind, dazu neues Material und vertiefte Recherchen sollen helfen, ein klares Bild von Christian Peter Wilhelm Beuth zu zeichnen. Sie werden zeigen, dass er frei von allen Anschuldigungen ist, die ihn unter die Antisemiten seiner Zeit setzten. Als Namenspatron für Institutionen, Gesellschaften und Preise wird man in den Ingenieurwissenschaften kaum einen besseren finden.
Für die Entwicklung der Instrumente oder Werkzeuge des Experiments werden wir uns Zeit nehmen müssen, um mit den ersten zwei Teilen eine Sicherheit in der Beurteilung zu gewinnen. Zitate der beteiligten Personen werden in der Regel in der im Original verwendeten Orthografie wiedergegeben.
Antisemitismus und Antijudaismus in Kants Werken – die Grundlage
Bild 1: Immanuel Kant (1724–1804) Denkmal in Königsberg / Kaliningrad Quelle: IMAGO
„Handle so, als ob die Maxime deiner Handlung durch deinen Willen zum allgemeinen Naturgesetze werden sollte.“ Allgemeiner Imperativ der PflichtImmanuel Kant
Der Vorwurf des Antisemitismus gegenüber Kant überrascht ganz besonders. Als Naturwissenschaftler kennt man die frühen naturwissenschaftlichen Schriften Kants ebenso wie den von ihm formulierten „kategorischen Imperativ“, der jede verletzende oder herabsetzende Äußerung nicht nur gegenüber Juden verbieten würde: „Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde“ (Kant IV, 1968, S. 421). (Zitate werden wörtlich und in der publizierten Orthografie aus den zitierten Publikationen übernommen.)
Wo in seinen philosophischen Werken sollte Platz für judenherabsetzende Aussagen sein? Das ist zwar nicht vorstellbar, aber es gibt sie. Bettina Stangneth hat eine Arbeit über „Antisemitische und antijudaistische Motive bei Immanuel Kant?“ veröffentlicht (Stangneth, 2001). Es ist die prämierte Schrift eines wissenschaftlichen Preisausschreibens. Die akribische Durchmusterung der Hauptwerke Kants bringt eine Flut von Motiven zutage, die unter das Thema Antijudaismus und Antisemitismus fallen.
Um diese richtig einzuordnen, teilt Stangneth die Quellen in vier Kategorien ein (ebd. S. 75 f.). Wirklich verlässlich sind die veröffentlichten Schriften Kants, wie sie z. B. in der Akademieausgabe von de Gruyter vorliegen, die auch wir verwenden, wobei Stangneth hierunter die ersten zehn Bände subsummiert. Die nachgeordneten Kategorien der Verlässlichkeit umfassen die Briefe und Kants handschriftlichen Nachlass. Die geringste Zuverlässigkeit schreibt sie den Mitschriften aus seinen Vorlesungen zu. Bei den Vorlesungsmitschriften ist es besonders schwierig, als den Urheber Kant festzumachen, weil er selbst ja nicht die Mitschriften anfertigte. Diese Mitschriften sind mit größerer Vorsicht und Zurückhaltung zu behandeln. Nicht alles kann nach Stangneth Kant verlässlich zugeordnet werden. Die Vorlesungsmitschriften stehen deswegen am Schluss der Wertung, da Kant sie nicht selbst verfasst hat. Für die folgenden Untersuchungen sind diese Einschätzungen Stangneths exemplarisch nutzbar. Sie sollen als Grundlage dienen für die Beurteilungen der zu analysierenden Texte.
Einige der Funde, die Bettina Stangneth in ihr Essay aufgenommen hat, sollen genauer betrachtet werden. Dabei ergeben sich meiner Meinung nach Zusätze und schließlich auch Einschätzungen Dritter, die aus allgemeinem Interesse mitdiskutiert werden. Bei Letzterem wird die Gefahr von Fehlurteilen deutlich werden, die entstehen, wenn der Kontext einer Aussage außer Acht gelassen wird.
Aus der „Anthropologie in pragmatischer Hinsicht“
In der Anthropologie von 1798 befasst sich Kant unter „Anthropologie in pragmatischer Hinsicht“ im ersten Teil „Anthropologische Didaktik“ und dort im 1. Kapitel „Vom Erkenntnißvermögen“ unter anderem mit dem Teilaspekt „Von den Schwächen und Krankheiten der Seele in Anschauung ihres Erkenntnisvermögens“. Dort geht es unter dem Punkt B. „Von den Gemütsschwächen im Erkenntnisvermögen“ um Witz und Humor, die die Urteilskraft beeinflussen, um Verschlagenheit und Dummheit, um Kaufleute, Betrug und