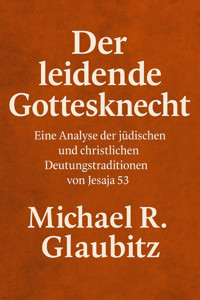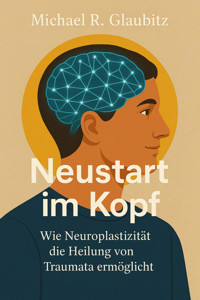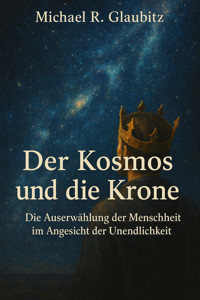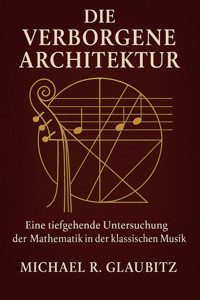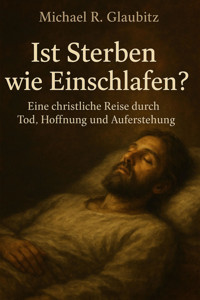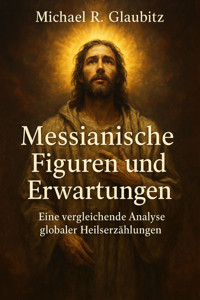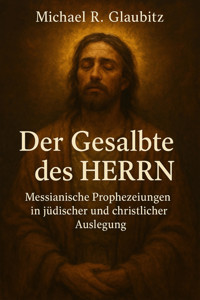
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: von Glaubitz
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Was bedeutet es, wenn Judentum und Christentum aus denselben prophetischen Texten zu so unterschiedlichen Überzeugungen gelangen? Dieses Buch geht genau dieser Frage auf den Grund. Mit philologischer Präzision und theologischer Tiefe analysiert Michael R. Glaubitz zentrale messianische Prophezeiungen des Alten Testaments und stellt ihre jüdische und christliche Auslegung gegenüber. Von der Verheißung eines „Sprosses aus Isai“ über das rätselhafte Gottesknechtlied bis hin zu Psalmen und den Schriften Sacharjas: Der Autor beleuchtet historische Kontexte, hermeneutische Grundhaltungen und die tiefgreifenden Konsequenzen für das jeweilige Glaubensverständnis. Dabei wird deutlich, wie sehr sich Erwartung und Erfahrung, Schrift und Offenbarung, Hoffnung und Erfüllung unterscheiden – und dennoch aufeinander bezogen bleiben. Ein packendes, hochaktuelles Werk für alle, die sich für Bibel, Theologie und jüdisch-christlichen Dialog interessieren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Copyright©2025by Michael R. Glaubitz
All rights reserved.
No portion of this book may be reproduced in any form without written permission from the publisher or author, except as permitted by U.S. copyright law.
Impressum
Michael R. GlaubitzHoltenser Landstr. 5731787 Hameln
Contents
Einleitung
DieFigurdesMessias, des Gesalbten, stellt einen der zentralen und zugleich umstrittensten theologischen Knotenpunkte zwischen Judentum und Christentum dar. Während beide Traditionen ihre Hoffnung auf eine von Gott gesandte Erlöserfigur in den Hebräischen Schriften, dem Alten Testament, verankern, führen ihre Interpretationen dieser Texte zu fundamental unterschiedlichen Verständnissen von Person, Auftrag und Werk des Messias. Dieses Buch unternimmt eine detaillierte Exegese ausgewählter prophetischer Schlüsseltexte, um die jeweiligen jüdischen und christlichen Lesarten in ihrem historischen und theologischen Kontext nachzuzeichnen. Ziel ist es, die tiefgreifenden hermeneutischen Unterschiede aufzuzeigen, die aus einem gemeinsamen Textkorpus zwei divergierende, aber in sich kohärente Glaubenswege hervorgebracht haben.
Der Messias – Konzept und Erwartung
Der Begriff „Maschiach“ (Gesalbter) im Alten Testament
ImbiblischenHebräischbezeichnet der Begriff Maschiach (מָשִׁיחַ) wörtlich „einen Gesalbten“. Ursprünglich war dies kein eschatologischer Titel, sondern eine Funktionsbezeichnung für Personen, die durch ein Salbungsritual für ein von Gott übertragenes Amt legitimiert wurden. In erster Linie waren dies die Könige Israels. So wird König Saul und später David als „Gesalbter des HERRN“ bezeichnet, eine Bezeichnung, die ihm eine von Gott verliehene Autorität und einen besonderen Schutzstatus zusprach. Die Salbung symbolisierte die Erwählung und Bevollmächtigung durch Gott. Neben den Königen wurden auch die Hohepriester gesalbt, um sie für ihren heiligen Dienst im Tempel zu weihen.
Die Transformation des Begriffs von einer gegenwärtigen Amtsbezeichnung zu einer zukünftigen Heilsfigur ist eng mit der politischen Geschichte Israels verknüpft. Nach der Zerstörung des Ersten Tempels und dem Ende der davidischen Monarchie im Jahr 586 v. Chr. verlagerte sich die Hoffnung von einem gegenwärtigen gesalbten König auf einen zukünftigen, idealen Herrscher. Die Propheten kündigten einen Nachfahren Davids an, der die Dynastie wiederherstellen, das Volk Israel aus der Fremdherrschaft befreien, die verstreuten Stämme sammeln und ein endzeitliches Reich des Friedens und der Gerechtigkeit aufrichten würde. Dieser zukünftige Maschiach wurde zur zentralen Gestalt der jüdischen Eschatologie, eine Hoffnung, die im rabbinischen Judentum und in der Liturgie einen festen Platz fand.
Das Spektrum der Messiaserwartung im Judentum des Zweiten Tempels
Zur Zeit Jesu war die jüdische Messiaserwartung keineswegs einheitlich oder monolithisch. Die Texte aus dieser Periode, einschließlich der Schriftrollen vom Toten Meer, zeichnen ein vielfältiges Bild. Es gab die weit verbreitete Erwartung eines triumphierenden, königlichen Messias aus der Linie Davids, der als Kriegsherr die Feinde Israels besiegen und eine politische Theokratie mit Jerusalem als Zentrum errichten würde. Diese Vorstellung speiste sich aus Texten wie Daniel 7, die einen siegreichen „Menschensohn“ beschreiben.
Gleichzeitig gab es andere Modelle. Der Prophet Sacharja sprach von einem demütigen Friedenskönig, der auf einem Esel in Jerusalem einzieht (Sacharja 9,9). In den Qumran-Gemeinden erwartete man sogar zwei messianische Gestalten: einen königlichen Messias aus der Linie Davids und einen priesterlichen Messias aus der Linie Aarons, was die duale Führung von Staat und Tempel im erneuerten Israel widerspiegelt.
Trotz dieser Vielfalt lassen sich Kernaufgaben des jüdischen Messias identifizieren, die von den meisten Gruppen geteilt wurden: die Wiederherstellung der nationalen Souveränität Israels, die Sammlung der Exilierten, der Wiederaufbau des Tempels in Jerusalem und die Einleitung einer Ära universellen Friedens (Schalom) und globaler Gotteserkenntnis. Die Erlösung, die der Messias bringt, ist primär eine nationale, politische und diesseitige Befreiung. Die Idee einer Erlösung von persönlicher Sünde durch einen stellvertretenden Sühnetod, wie sie im Christentum zentral ist, gehört nicht zum traditionellen jüdischen Messiasbild.
Die christliche Neudefinition des Messias
Das Neue Testament und das frühe Christentum stellen eine radikale Neudeutung der messianischen Prophezeiungen dar, die vollständig auf die Person Jesu von Nazareth zentriert ist. Die ersten Christen, selbst Juden, standen vor einer enormen theologischen Herausforderung: Die Gestalt, die sie als Messias bekannten, hatte die zentralen jüdischen Erwartungen nicht erfüllt. Er hatte keine politische Befreiung gebracht, Rom nicht besiegt und war stattdessen den schändlichsten Tod am Kreuz gestorben.
Um dieses Paradoxon aufzulösen, entwickelten sie eine tiefgreifende theologische Neukonzeption. Sie argumentierten, dass das Leiden und Sterben des Messias nicht das Scheitern, sondern die notwendige Erfüllung der Schrift sei. Dafür rückten sie Texte wie das Lied vom leidenden Gottesknecht in Jesaja 53 in den Mittelpunkt, die in der jüdischen Tradition nicht primär messianisch gedeutet wurden, und interpretierten sie als Vorhersage des stellvertretenden Sühnetodes Jesu für die Sünden der ganzen Welt.
Das christliche Messiasbild ist somit untrennbar mit Konzepten verbunden, die im jüdischen Denken fremd oder sekundär sind:
Inkarnation: Der Messias ist nicht nur ein menschlicher König, sondern der präexistente Sohn Gottes, der Mensch wird („Gott mit uns“).
Sühnetod: Sein Hauptwerk ist nicht die politische Befreiung, sondern die Erlösung von der Sünde durch seinen Opfertod am Kreuz.
Auferstehung: Seine Auferstehung von den Toten ist der Beweis seiner Messianität und der Sieg über den Tod, der die Hoffnung auf ewiges Leben für die Gläubigen begründet.
Die christliche Theologie postuliert zudem ein zweifaches Kommen: Das erste Kommen war geprägt von Demut und Leiden zur Erlösung der Sünden, während das zweite Kommen in Herrlichkeit erfolgen wird, um das endgültige Reich Gottes aufzurichten und die verbleibenden Prophezeiungen zu erfüllen.
Hermeneutische Grundlagen und der zentrale Interpretationskonflikt
Die unterschiedlichen Schlussfolgerungen von Judentum und Christentum wurzeln in fundamental verschiedenen hermeneutischen, also auslegenden, Herangehensweisen an die Heiligen Schriften.
Die christliche Hermeneutik arbeitet mit einem Erfüllungsmodell