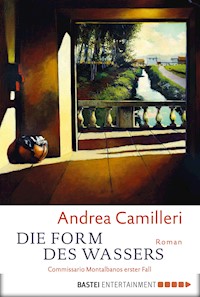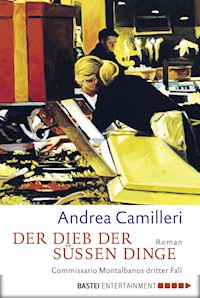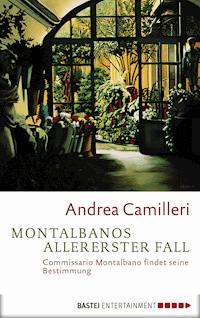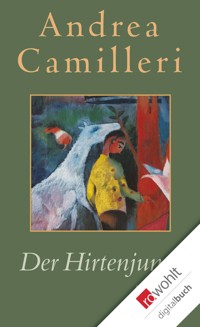
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Metamorphosen-Trilogie
- Sprache: Deutsch
In dem sizilianischen Dorf Alagona wohnen neben ein paar reichen Bürgersleuten zahlreiche Minenarbeiter, die ihren kargen Lohn in einem der fünf Bergwerke verdienen. Als der Pfarrer des Ortes eines Nachts verkündet, ein schreckliches Unglück werde über Alagona kommen, ahnen die Leute, dass es mit den Bergbauarbeiten zu tun haben wird. Und tatsächlich: Zweihundertzehn junge Minenarbeiter kommen ums Leben. Schnellstmöglich müssen neue Kräfte in den umliegenden Küstenorten rekrutiert werden. Auch in Vigàta, wo der Fischer Adelio mit seiner Familie wohnt, werden Jungen mit der Aussicht auf unvorstellbar hohe Löhne angeworben. Drei Tage später verlassen vier Karren mit je zehn Jungen Vigàta. Giurlà Savatteri, der Sohn von Adelio, ist nicht darunter. Sein Vater erfuhr gerade noch rechtzeitig, unter welch harten Bedingungen die Kinder wirklich arbeiten müssen. Glücklicherweise bietet sich Giurlà bald die Gelegenheit, auf andere Weise Geld für die Eltern dazuzuverdienen: Er wird in die Berge geschickt, weit weg von zu Hause, um Ziegen zu hüten. Was er inmitten saftig grüner Wiesen und einer Schar von Ziegen erlebt, hätte er sich nicht träumen lassen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 218
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Andrea Camilleri
Der Hirtenjunge
Roman
Aus dem Italienischen von Moshe Kahn
Rowohlt Digitalbuch
Inhaltsübersicht
Erster Teil
Eins
Am ersten Sonntag des Monats Februar des ersten Jahres, als das neue Jahrhundert noch gleich einem Lämmlein auf unsicheren Beinen stand, geschah es, dass die beiden Glocken der Hauptkirche verzweifelt zu läuten begannen, noch bevor es vier Uhr in der Frühe war.
Die Bürgersleute mit den eigenen Uhren im Haus wohnten im Zentrum des Ortes, sodass sie die Rathausuhr mit ihren nervtötenden Viertelstundenschlägen deutlich hören konnten. Und dann waren da noch die Minenarbeiter, die Bauern, die Tagelöhner, die Karrenkutscher und die Hungerleider, die alle keine eigenen Uhren hatten und fast schon auf dem Land wohnten, aber trotzdem wussten sie um die Tages- oder Nachtzeit, und das sogar besser als mit Uhr, weil sie den Sonnenlauf oder auch den Lauf der Sterne verfolgten.
Darum wunderten sie sich alle sehr über das Läuten: Nicht nur sollte die Frühmesse erst in zwei Stunden beginnen, sondern noch dazu läuteten die Glocken Sturm, was ein Zeichen für große Gefahr oder auch für große Ausgelassenheit war. Doch weil es im Ort seit Menschengedenken nicht den geringsten Grund für große Ausgelassenheit gegeben hatte und man auch am fernen Horizont keinen solchen Grund erkennen konnte, obwohl es hieß, dass dieses Jahrhundert das beste von allen sein würde, fand sich niemand, dem nicht auf der Stelle klar war, dass in einer der fünf Minen – in denen auf die eine oder andere Weise und eben auch am Sonnabend sämtliche Einwohner von Alagona schufteten – ein schweres Unglück geschehen sein musste.
Während sie sich im Dunkeln rasch anzogen, weil die Glocken zur Eile drängten und ihnen keine Zeit ließen, Kerzen oder Petroleumlampen anzuzünden, redeten sie alle miteinander, stellten Fragen, fluchten und beteten.
Innerhalb einer halben Stunde war die Kirche so voll, wie es nicht einmal zur Christmette am Weihnachtsfest vorkam. Doch Don Aitano Persico, der Pfarrer, erschien nicht. Er zog sich erst noch an, weil er im Nachthemd die Glocken geläutet hatte.
«Wo ist denn der Pfarrer? Was macht er?», fragten die Leute den Messner Filomeno.
«Er betet noch», antwortete dieser, während er weihrauchschwenkend durch die Kirche ging, denn wenn die Leute morgens aufstehen und sich nicht waschen, stinken sie nach einer Weile, wie man weiß. Und je mehr Menschen beisammen sind, umso größer ist der Gestank.
Dann erschien aus der Sakristei endlich der Pfarrer.
Zu der Zeit ging Don Aitano bereits auf die siebzig zu, und sein Kopf sah aus wie ein Totenschädel, so hager war er. Doch wenn er predigte, drang eine Stimme aus ihm hervor, die selbst die Leichen auf dem Friedhof aufzuschrecken vermochte. Er trug kein Messgewand, daher kehrte er dem Altar den Rücken zu, erhob zitternd eine Hand, die just aus einer hundertjährigen Grabesruhe aufzusteigen schien, und sprach:
«Nichts ist geschehen.»
In der Erwartung einer schlimmen Nachricht hatten die Menschen in der Kirche alle den Atem angehalten, doch nun atmeten sie wieder tief durch.
«Alles muss erst noch geschehen», fuhr der Pfarrer fort.
Und wieder hielten die Menschen den Atem an.
Don Aitano hatte die Eigenart, in manchen Nächten von Dingen zu träumen, die erst noch eintreten mussten. Und er irrte sich nie: Die Dinge traten wirklich ein. Hatte er nicht gesagt, dass der zweite Stollen der Mine Trabonella über zwölf Unglückseligen zusammenbrechen würde? Und tatsächlich war der zweite Stollen eingebrochen und hatte zwölf Tote unter seinen Trümmern begraben. Hatte er nicht gesagt, dass der Sommer des Jahres 1895 heiß sein würde wie die Hölle? Und war es nicht so, dass die Weizenfelder von selbst zu brennen begonnen hatten?
«Doch was da geschehen soll», sagte der Pfarrer, «habe ich noch nicht ganz verstanden. Am Himmel war ein riesenhafter Kometenstern, der sich wie eine Schlange um sich selbst drehte und die anderen kleinen Sterne auffraß. Und ihr alle, meine lieben Pfarrkinder, habt in meinem Traum vor Schmerzen geweint, weil der Kometenstern euch schweren Schaden zufügte. Mehr kann ich euch nicht sagen, denn mehr habe ich nicht gesehen, nur die Tränen in euren Augen. Einen Strom, ja ein Meer von Tränen! Sofern es euer Wille ist, können wir von nun an jeden Morgen um vier miteinander beten, die Kirche wird zu dieser Stunde geöffnet sein. Vielleicht ändert der Kometenstern durch unsere Gebete ja noch seine Bahn.»
Angesichts der Tatsache, dass sich in den Minen kein Unglück ereignet hatte, ging die eine Hälfte der Gemeindemitglieder wieder schlafen. Wenn die Zeit kommen sollte, in der geweint werden musste, dann würden sie schon noch weinen. Die andere Hälfte blieb in der Kirche für die Novene.
Der Winter verging, der Sommer verging, der Herbst zog ein, und die Menschen gelangten allmählich zu der Überzeugung, dass Don Aitano sich dieses Mal geirrt hatte. In den fünf Minen hatte es gerade einmal zwei Tote gegeben, die Jahreszeiten hatten ihre Pflicht getan, und daher hatte die Erde reichlich Früchte hervorgebracht. Doch am fünfzehnten Tag des Monats Oktober starben innerhalb von einer Woche zwei kleine Jungen, die in der Mine Trabonella gearbeitet hatten, der eine war sechs und der andere zehn Jahre alt. Danach starben sechs in der Mine Fiannaca, darauf fünf in der Mine Mintina. Dann kehrte der Tod in die Mine Trabonella zurück, und er verschonte auch nicht die Minen Bozzo-Risi und Terranova. Im Dezember betrug die Anzahl der toten Jungen im Alter von sechs bis dreizehn Jahren zweihundertzehn. Alles Mögliche wurde versucht. Aus Deutschland ließ man einen Arzt kommen, der ein Spezialist für Minenkrankheiten war, doch der sagte am Ende nur, dass dies eine Krankheit sei, über die er keinerlei Kenntnisse besitze. Da kam der Bischof von Montelusa persönlich, um alle Minen zu segnen. Drei Prozessionen wurden anberaumt und ein Priester herbeigerufen, der die Teufel austrieb. Doch nichts brachte Erfolg.
Der Arzt im Ort, Dottor Jacopino, der weder an Gott noch an den Teufel glaubte, sagte, es handele sich um eine Krankheit, die Grippe hieß, und diese Krankheit werde die Schwächsten befallen wie eben diese kleinen Jungen, und man müsse daher die Arbeit in den Minen einstellen, weil dort der Ansteckungsherd sei. Doch das ging den Eigentümern zum einen Ohr rein und zum anderen wieder heraus. Was für eine Vorstellung! Die Minen schließen! War diesem Dottor Jacopino eigentlich klar, was er da verlangte? Die Minen schließen! Alle waren dagegen: die Eigentümer, weil sie ihre Einkünfte verlieren, und die Bergleute, weil sie nicht einmal mehr eine halbe Lira für die tägliche Nahrung haben würden.
Im Januar des folgenden Jahres war das Sterben so plötzlich vorbei, wie es aufgetreten war. Doch in den fünf Minen von Alagona gab es keine kleinen Jungen mehr.
Da hatte der Marchese von Terranova einen glücklichen Einfall, den er auch den anderen Eigentümern zur Kenntnis brachte: Wie wäre es, wenn man Anwerber für kleine Jungen in die Küstenorte schickte? Wohnten denn nicht auch in diesen Gegenden notleidende Familien mit gerade einmal ein paar Lumpenfetzen am Leib, Familien, die bereit wären, ihre Söhne herzugeben und zum Arbeiten in die Minen zu schicken?
So kam es, dass ein paar Tage später Don Filibertu Alagna in Vigàta eintraf, ein Mann von vierzig Jahren, der wie ein kleines Fass aussah, eine Tonne, von untersetzter Statur, mit rundem Gesicht, rundem Bauch, runden Händchen, ein Mann, der immer lachte, immer fröhlich war und immer rasch neue Freundschaften schloss. Kurzum, ein Mann, der großes Vertrauen einflößte, wenn man ihn nur ansah. Nachdem er seinen Koffer in der Pension Pace abgestellt hatte, erkundigte er sich, wie er zur Via Calibardi kommen könne, und begab sich gleich darauf dorthin.
Die Via Calibardi war ein ziemlich enges Gässchen, das hinter dem Rathaus begann und sich in Serpentinen den Mergelhügel hinaufwand. Auf dessen Kuppe befanden sich ein paar ärmliche Hütten und der Friedhof. Dahinter begann das offene Land. Die Straße aber war im Ort bekannt als die Straße des Honigs, weil die Fliegen dort in Schwärmen einfielen, wie sie’s immer machen, sobald sie ein paar Tropfen Honig wittern. Die Leute dort wohnten in catoj, fensterlosen, höhlenartigen Räumen zu ebener Erde, in die nur durch die Tür Luft drang und in denen ein einziges Bett für die ganze Familie mit Großeltern, Söhnen und Enkeln stand, umgeben von ein paar Hühnern, einem Esel oder einer Ziege. Einige Häuschen mit einer Etage gab es auch, aber die waren wie ineinander verschachtelt, sodass das Fenster des einen Hauses sich manchmal ins Schlafzimmer des Nachbarhauses öffnete.
Don Filibertu war ein geschickter Mann. Und weil es, als er in der Via Calibardi auftauchte, zehn Uhr am Vormittag war, genügte ihm ein einziger Blick, um zu erfassen, dass sich in den catoj nur Frauen, Alte und kleine Kinder aufhielten. Die Männer waren entweder arbeiten oder auf der Suche nach Arbeit. Er bemerkte eine etwas größere Hütte, in der ein Alter auf einem Stuhl hockte und eine etwa fünfunddreißigjährige Frau die Matratze aufschüttelte. Vier kleine Kinder wuselten um sie herum: ein Mädchen von nicht einmal einem Jahr und drei Jungen im Alter von vier, sechs und acht Jahren.
«Bongiorno», sagte Don Filibertu und betrat, bis über beide Ohren lächelnd, die Hütte.
Als die Frau den Fremden gewahrte, wurde ihr angst und bange.
«Was wollt Ihr?»
«Mit dir reden», sagte Don Filibertu, zog aus seiner Tasche drei Bonbons und gab sie den Jungen.
«Ich rede mit Euch nicht allein.»
«Aber der Opa ist doch hier!»
«Der ist verrückt. Der versteht nichts mehr.»
«Dann ruf doch ein paar Freundinnen herbei! Besser wär’s, wenn sie verheiratet sind und Kinder haben.»
Die Frau ging hinaus und kam mit vier Frauen wieder zurück. Den Opa trugen sie mit dem ganzen Stuhl hinaus, die Jungen wurden zum Spielen auf die Straße geschickt, und Don Filibertu fing an zu reden.
«Ich heiße Filibertu Alagna und komme aus einem reichen Ort, der Alagona heißt. Habt ihr schon mal von ihm gehört? Der Ort ist reich, weil’s dort fünf Minen gibt, in denen Schwefel abgebaut wird. Also das, was in eurem Hafen liegt und ins Ausland verkauft wird. In den Minen arbeiten gut bezahlte erwachsene Männer, kleine Jungs und Jugendliche. Das Alter der kleinen Jungs geht von sechs bis elf, das der Jugendlichen von zwölf bis achtzehn. Für jeden Arbeitstag bekommt ein kleiner Junge fünfundachtzig Cent, ein Jugendlicher neunzig. Ich erkläre euch mal, wie das Ganze sich abspielt: Jeder Junge oder Jugendliche wird von einem Hauer in Obhut genommen, der ihnen zu essen gibt, dafür behält er natürlich ein paar Cent vom Lohn ein. Doch hier kommt dann das Schöne: Der Hauer schenkt euch im Tausch für euren Sohn etwas, das sich ‹Totenbeistand› nennt. ‹Beistand› bedeutet Hilfe, und ‹tot› heißt, dass ihr es bekommt und es ihm nicht zurückzahlen müsst. Der Totenbeistand besteht aus zweihundert Lire – ich sage es noch einmal: aus zweihundert Lire! –, die ich euch im Namen der Hauer in dem Moment bar auf die Hand zahle, wenn ihr mir euren Sohn übergebt. Wenn ihr mir zwei Söhne übergebt, zahle ich euch vierhundert Lire, übergebt ihr mir drei, zahle ich euch sechshundert Lire. Versteht ihr? Dieses Geld gehört dann euch, und ihr könnt damit machen, was ihr wollt, und müsst niemandem Rechenschaft darüber ablegen. Denkt gut darüber nach! Ein kleiner Junge von zehn, elf Jahren, was ist der denn für eure Familien? Er ist eine Last! Er arbeitet nicht und ist ein weiterer Mund, der gestopft werden will. Wenn ihr ihn mir überlasst, dann arbeitet der Junge und verdient Geld; er liegt euch also nicht mehr auf der Tasche, und gleichzeitig habt ihr so viel Geld in der Hand wie nicht mal in euren kühnsten Träumen. Sprecht doch mit allen Frauen darüber, die ihr kennt, und beredet das auch mit euren Männern. Ich bin in der Pension Pace. Bringt mir eure Söhne, und ich bezahle euch auf der Stelle. Aber ich sage euch: Ich bleibe nur drei Tage in Vigàta! Also lasst euch das Glück nicht entgehen!»
Zwei Stunden später redeten nicht nur die Bewohner der Via Calibardi, sondern ganz Vigàta über Don Filibertus Vorschlag. Die Nachricht verbreitete sich auch in der Via delle Cannelle, wo die Fischer wohnten, deren kleine Häuser direkt am Meer standen. Der einzige Unterschied zwischen den Bewohnern der Via Calibardi und denen der Via delle Cannelle bestand darin, dass die Letzteren weniger stanken, denn immerhin hatten sie ja das Meer vor der Haustür, um sich darin zu waschen. Der Hunger jedoch war der gleiche.
Einer der Fischer hieß Adelio Savatteri und hatte ein Boot gemeinsam mit seinem Schwager Lollo Miccichè. An den Tagen, an denen das Wetter günstig war, fuhren sie morgens um vier Uhr in der Frühe hinaus aufs Meer. Der eine ruderte, der andere hielt die Netze, und bei Dunkelheit kehrten sie wieder zurück. Den Fang teilten sie sich, und Adelio brachte seinen Anteil zu Don Pitrino Vadalà, seinem einzigen Kunden, der ihm dafür so viel zahlte, dass es gerade eben reichte, die Familie nicht vor Hunger sterben zu lassen. Die Familie, das waren seine Frau Zina und die zwei Kinder, der vierzehnjährige Giurlà und die neunjährige Maria.
Nachdem Adelio an jenem Abend seinen Fang zu Don Pitrino gebracht hatte, erzählte Zina ihm die Sache mit dem Mann aus Alagona, der gekommen war, um Jungen und Jugendliche zu kaufen. Sollten sie ihm Giurlà überlassen? Adelio dachte, das Beste wäre, die Sache mit seinem Schwager Lollo zu bereden, der einen zehnjährigen Sohn hatte. Als er zu Lollo kam, erfuhr er, dass sein Schwager und dessen Frau sich bereits entschlossen hatten, ihren Sohn dem Mann aus Alagona zu überlassen. Nachdenklich kehrte Adelio nach Hause zurück, denn er mochte die Vorstellung nicht, Giurlà nicht mehr durchs Haus streifen zu sehen. Da kam ihm eine Idee, und er schlug eine andere Richtung ein.
Don Pitrino Vadalà, der sich gerade zu Tisch setzen wollte, um seinen Fisch zu essen, zeigte sich überrascht.
«Was gibt’s denn?»
«Ich brauche Euren Rat.»
Kaum hatte er angefangen zu erzählen, unterbrach Don Pitrino ihn auch schon.
«Ich kenne die Geschichte mit dem Mann aus Alagona. Du willst ihm Giurlà überlassen?»
«Ich weiß nicht, was ich tun soll, Don Pitrì.»
«Weißt du, wie die Arbeit eines Jungen in einer Mine aussieht?»
«Nein.»
«Dann erkläre ich dir das mal: Die Jungen arbeiten Tag und Nacht in drei- bis vierhundert Meter Tiefe in bestimmten Stollen ohne Luft noch Licht, und diese Stollen sind so niedrig, dass ein erwachsener Mann sich nur gebückt darin fortbewegen kann. Die Jungen laden sich Körbe voller Schwefel auf die Schultern, die sehr schwer sind, und tragen sie bis zu den Loren. Alle arbeiten nackt, denn da unten ist es höllisch heiß. Und hin und wieder schnappt sich irgendeiner der Hauer den Jungen, der ihm gehört, und vergeht sich an ihm. Und dann, am Ende der Woche, wenn er ihn bezahlen soll, gibt er ihm keinen Cent.»
«Aber wieso denn?»
«Weil er ihm erzählt, dass er ihm mit allem, was er ihm zu essen gegeben hat, nichts mehr schuldet. Und weißt du was? Alle Jungs, die da unten in den Minen arbeiten, nehmen Schaden für den Rest ihres Lebens. Die Brust- und Schulterknochen werden krumm. Glaub mir, Adè: Gefängnis ist da wesentlich besser!»
Als die drei Tage vergangen waren, mietete Don Filibertu Alagna vier Karren samt Kutschern, ließ auf jeden Karren zehn Jungen klettern und fuhr davon. Giurlà Savatteri befand sich nicht unter den vierzig kleineren und größeren Jungen.
Giurlà lebte sein Leben als großer Junge weiter. Er war in die Grundschule gegangen und hatte es bis zur dritten Klasse geschafft. Dann hatte sein Vater ihn aus der Schule genommen, weil es für einen Fischerssohn sinnlos war, sich die Augen über Büchern zu verderben, denn ein Fischerssohn blieb doch immer ein Fischerssohn. Giurlà aber schwamm wie ein Fisch, und wie ein solcher konnte er so lange unter Wasser bleiben, dass die, die ihn nicht kannten, jedes Mal dachten, er wäre ertrunken. Und Giurlà fing auch Fische, doch dazu benutzte er weder Netz noch Angel, sondern allein seine Hände. Er schwamm so weit hinaus aufs Meer, wie er konnte, und tauchte dann unter Wasser. Sobald er einen schönen dicken Fisch sah, schoss er pfeilschnell auf ihn zu und packte ihn mit beiden Händen. Wenn der Fisch dann zu entwischen versuchte, tötete Giurlà ihn mit einem gezielten Biss in den Kopf und warf ihn in eine Art Korb, den er um den Hals trug. Und weil dies genug zum Essen für die Familie war, konnte Adelio seinen ganzen Fang verkaufen.
Am zwanzigsten Februar fuhren Adelio und Lollo wie fast jeden Tag mit dem Boot hinaus. Doch sie hatten starke Zweifel, ob sie es wirklich tun sollten. Sie trauten dem Wetter nicht; ein heimtückischer Wind blies, und von Westen her zog eine schwarze Wolkenwand auf.
«Komm, lass uns rausfahren», sagte Lollo. «Und wenn wir sehen, dass das Wetter richtig schlecht wird, kehren wir schnell wieder um.»
Tatsache aber war, dass sie es nicht schafften, rechtzeitig umzukehren. Das Wetter schlug so plötzlich um, dass sie, obwohl sie beide aus Leibeskräften ruderten, nicht mehr ans Ufer zu gelangen vermochten. Auf halber Strecke wurde das Boot seitlich von einer gigantischen Welle erfasst und zum Kentern gebracht. Adelio und Lollo konnten sich zwar eine Zeitlang noch an dem umgekippten Boot festklammern, doch dann zwang sie der gewaltige Wellengang loszulassen, und sie mussten schwimmen. Entkräftet und außer Atem gelangten sie ans Ufer, ihr Boot aber war verloren.
«Ach, lass nur!», sagte Lollo. «Ich kauf mir ein neues.»
«Und wer soll dir das Geld dafür geben?»
«Ich hab doch Geld. Hast du vergessen, dass Don Filibertu mir zweihundert Lire gegeben hat?»
«Heilige Jungfrau, das stimmt ja! Dann können wir …»
«Moment, Moment!», sagte Lollo. «Ab jetzt verhalten sich die Dinge anders.»
«Wieso?»
«Weil ich das neue Boot von meinem Geld kaufe. Das andere hatten wir jeweils zur Hälfte gemeinsam gekauft, wenn du dich erinnerst.»
«Na und?»
«Entschuldige mal, wie willst du denn deine Hälfte bezahlen?»
Sie kamen überein, dass Adelio jeden Tag, wenn er das Geld für den Verkauf seines Fangs bekommen hatte, Lollo die Hälfte davon abgeben würde. Und so reichte das Geld, das Adelio mit nach Hause brachte, nicht mehr länger für die Familie. Sie aßen immer den Fisch, den Giurlà fing, doch Pasta machten sie nun ohne alles, denn sie hatten nicht das Geld für eine Dose Tomaten. Und abends saßen sie im Dunkeln, um Petroleum für die Lampe zu sparen.
Eines Tages redete Adelio mit Don Pitrino darüber.
«Ihr habt mich dazu verleitet, einen fatalen Fehler zu machen.»
«Ich? Wieso denn das?»
Und Adelio erzählte ihm die Geschichte von dem Boot.
«Wenn ich Giurlà aber dem Mann aus Alagona gegeben hätte, dann hätte ich heute zweihundert Lire und könnte mir die Hälfte des Bootes kaufen», sagte er zum Schluss.
Don Pitrino antwortete nichts darauf. Doch am folgenden Abend sagte er zu Adelio:
«Bring mir morgen deinen Sohn! Ich will ihn kennenlernen.»
Seine Mutter Zina verbrachte einen halben Tag damit, Giurlà die Haare zu schneiden und seine Kleider, die am wenigsten zerrissen waren, notdürftig zu flicken.
Doch seine Füße waren nackt, als Giurlà sich zu Don Pitrino aufmachte, denn das einzige Paar Schuhe, das er besaß, passte ihm nicht mehr.
Don Pitrino sah ihn wieder und wieder an, und dann stellte er ihm eine sonderbare Frage:
«Bist du jemand, der lange allein sein kann?»
Giurlà dachte einen Augenblick nach. Dann antwortete er: «Wenn ich tauche, bin ich immer allein. Und am liebsten würde ich Jahre da unten sein.»
Da machte Don Pitrino Adelio seinen Vorschlag.
Zwei
Don Pitrino Vadalà war sechs Jahre zuvor mit seiner Frau nach Vigàta gekommen. Nach dem, was man sich im Ort über ihn erzählte, war er steinreich, doch keiner wusste, was er machte und woher er kam. Er hatte die Villa des Barons Lúmia gekauft, die außerhalb der Ortschaft fast am Meeresufer lag, und dort lebte er, ohne jemals sein Haus zu verlassen. Die beiden Bediensteten, die er mitgebracht hatte, gingen alles besorgen, was er brauchte, und um die Sonntagsmesse kümmerte sich ein Priester, der sie in der Kapelle der Villa las. Es hieß, Don Pitrino sei nach Vigàta gekommen, weil die Ärzte ihm gesagt hätten, dass Meeresluft gut gegen seine Krankheit sei und er außerdem viel Fisch essen müsse. Daher hörte Adelio ihm voller Wissbegier und Verwunderung zu.
«Ich», sagte Don Pitrino, «komme aus einem Ort, der Castrogiovanni heißt. Dort habe ich viele Ländereien, Häuser, Rinder, Pferde, Schafe und Ziegen. Nun hat mir einer meiner Jagdaufseher mitteilen lassen, dass er einen Jungen braucht, und da habe ich an Giurlà gedacht.»
«Und was müsste mein Sohn tun?», fragte Adelio.
«Er soll Ziegen hüten.»
Adelio musste lachen.
«Aber Giurlà hat es doch mit Fischen zu tun, nicht mit Ziegen! Er ist ein Küstenjunge!»
«Da gehört doch nicht viel dazu, um ein Landjunge zu werden! Und dann denk mal nach: Du wolltest ihn dem Mann aus Alagona mitgeben, damit er Tag und Nacht unter der Erde schuftet. Wenn du ihn aber mir gibst, lebt er immer an der frischen Luft. Und ich zahle ihm eineinhalb Lire pro Tag, auch an Sonn- und Feiertagen. Er bekommt kostenlos Brot und Käse. Sonntags steht ihm ein Teller Brei aus dicken Bohnen zu oder ein Teller Caponatina und danach gebratenes Lamm. Milch kann er trinken, so viel er will. Denk drüber nach und gib mir vor dem 15. März Bescheid, denn dann kommt der Jagdaufseher. Wenn Giurlà zustimmt, wird er am selben Tag noch abreisen müssen.»
«Wie lange wird er dann wegbleiben?»
«Mindestens drei Monate. Danach entscheidet er selbst, ob er heimkehren oder bleiben will. Ach ja, wenn er annimmt, dann statte Giurlà mit einem Wollpullover aus, ebenso mit einer Decke und einem Paar Schuhe. In der Gegend dort wird es nachts ziemlich kalt.»
«Ich werde jetzt gleich noch mit meiner Frau sprechen», sagte Adelio. «Und morgen schon geben wir Euch Bescheid. Gott segne Euch!»
Er sah seinen Sohn an, der während Don Pitrinos Rede nicht einmal den Mund aufgemacht hatte, und Giurlà sagte:
«Gott segne Euch!»
Vater und Sohn wollten hinausgehen.
«Ach ja», sagte Don Pitrino. «Eine meiner Hausbediensteten muss zurück in ihr Heimatdorf. Würde es deiner Frau etwas ausmachen, herzukommen und ihre Stelle anzutreten?»
«Auf keinen Fall!», sagte Zina resolut. «Wenn ich dahin gehe und Hausbedienstete bei Don Pitrino werde, welche Notwendigkeit besteht dann noch, dass Giurlà uns verlässt?»
Wo sie recht hatte, hatte sie recht. Adelio und Zina redeten die ganze Nacht miteinander. War es nicht besser, dass Giurlà diese Gelegenheit beim Schopf packte? Wenn er größer wurde, welche Arbeit würde er dann im Ort finden können? So aber, da sie dann zu dritt Geld verdienen würden, könnten sie das halbe Boot schneller und leichter abbezahlen. Und es bestand ja auch die Möglichkeit, dass es Adelio gelingen würde, gar ein ganzes Boot für sich zu kaufen.
Am nächsten Morgen, als es noch dunkel war, weckte Adelio seinen Sohn.
«Wir haben beschlossen, dass du fortgehst. Heute Abend sag ich’s Don Pitrino.»
«Ganz wie ihr wollt.»
Doch in der Zwischenzeit musste Geld aufgetrieben werden, um die Dinge zu kaufen, die Giurlà brauchte. Bis zum 15. März waren es nur noch sieben Tage. Da hatte Zina einen guten Einfall: Sie verpfändete eine Halskette und Ohrringe, die ihre Tante ihr vererbt hatte, und so konnte sie nicht nur eine warme Bettdecke kaufen und die Schuhe, sondern auch zwei Pullover, zwei Unterhosen und vier Paar Wollsocken.
Dass er abreisen würde, erzählte Giurlà seinen beiden Freunden Pippo und Fofò, als sie sich am Strand trafen. Die beiden waren wie er echte Küstenjungen, nur dass sie weniger gut Fische mit der Hand fangen konnten.
«Und was machst du da, wo du jetzt hingehst?», fragte Pippo.
«Ich werde Ziegen hüten.»
Zuerst sahen die beiden ihn verblüfft an, dann brachen sie in Gelächter aus.
«Was gibt’s denn da zu lachen?», fragte Giurlà.
«Fofò», sagte Pippo und fing an, alberne Gesten zu machen, «riechst du nicht auch diesen merkwürdigen Gestank?»
«Ja, doch», erwiderte Fofò geistesgegenwärtig. «Aber was ist das bloß für ein Gestank?»
«Meiner Meinung nach stinkt’s hier nach Ziege. Da ist doch sicher ein Ziegenhirt irgendwo in der Nähe.»
Giurlà wurde wütend und versetzte ihm einen Fausthieb gegen die Brust. Pippo packte ihn mit beiden Händen und versuchte, seinen Kopf unter Wasser zu drücken.
Ach, war das herrlich, sich miteinander im Meer zu balgen!
In der Nacht auf den 15. März konnte einzig Maria ruhig schlafen. Zina hingegen weinte nur. Adelio, der beschlossen hatte, nicht zum Fischen hinauszufahren, damit er seinen Sohn begleiten konnte, wälzte sich unaufhörlich von einer Seite auf die andere, während es Giurlà, der kein Auge zutun konnte, fürchterlich heiß war, wie wenn er einen Fieberanfall hatte, und er versuchte verzweifelt, sich das Leben vorzustellen, das ihn erwartete.
Um elf Uhr am nächsten Morgen nahm Zina die Wolldecke, packte Giurlàs Sachen hinein und verknotete die Zipfel miteinander. Eine halbe Stunde später, als Adelio und Giurlà sich zum Aufbruch fertig machten, sagte sie:
«Wartet auf mich, ich komme auch mit!»
Und Maria sagte: «Ich will auch mitkommen.»
«Nein», entgegnete Zina. «Du bleibst hier, bringst das Haus in Ordnung und bereitest das Essen vor.»
Und so verstand Maria, dass sie nun erwachsen geworden war.
An der Haltestelle der Überlandbusse nach Montelusa standen schon der Jagdaufseher Don Sisino und die Hausbedienstete, die in ihr Dorf zurückkehren wollte und Zuda hieß. Sie hatte einen großen Koffer bei sich.
Still warteten sie, bis der Autobus kam.
Adelio reichte dem Busschaffner Giurlàs Bündel, der es in den Gepäckraum legte. Don Sisino machte das Gleiche mit Zudas Koffer. Zina war außerstande, Giurlàs Hand loszulassen, da trennte Adelio sie beide voneinander, gab seinem Sohn einen Kuss auf den Kopf und bugsierte ihn in den Bus.
In Montelusa stiegen sie aus, gingen zum Bahnhof und nahmen den Zug nach Castrogiovanni. Noch nie war Giurlà mit einem Zug gefahren. Ach, wie der raste! Und wie viel Krach der machte! Und plötzlich sah er durch das kleine, halb geöffnete Fenster das Meer in der Ferne. Er sprang auf und stellte sich ans Fenster.