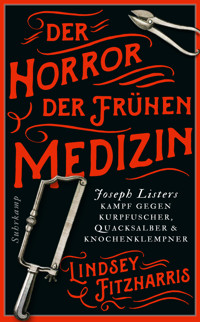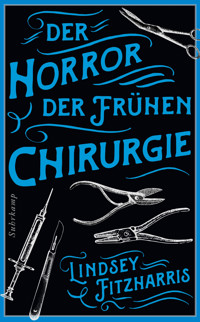
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Als Harold Gillies die Verheerungen des Ersten Weltkriegs mit eigenen Augen sieht, ist er schockiert. Zu viele junge Männer werden nach nur einem falschen Augenblick ihrem Schicksal überlassen: für immer entstellt, für immer Monster in den Augen der Gesellschaft. Nach seiner Rückkehr ins Königreich setzt der junge Arzt alles daran, einen Weg zu finden, um das Leiden zu verringern. Mit stetem Einsatz, vielen Verbündeten und unkonventionellen Methoden baut er die erste »Schönheitsklinik« der Welt auf und kämpft fortan gegen das Stigma einer Generation. Sein Leben wird zum Gründungsakt einer Disziplin, die unsere Gegenwart unmissverständlich prägt.
Für die, die schön sein wollen, mussten andere leiden. Denn die Operationen der Schönheitschirurgie – Rhinoplastik, Lidstraffung, Fettabsaugung – haben ihren grausigen Ursprung im Ersten Weltkrieg. Im Schlamm der Schützengräben verlor eine ganze Generation das Gesicht, bis ein furchtloser Arzt den Grundstein legte für eine neue, revolutionäre Disziplin … Lindsey Fitzharris erzählt packend und erkenntnisreich vom Leben dieses Mannes und dem Wert der menschlichen Züge.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 436
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Titel
Lindsey Fitzharris
Der Horror der frühen Chirurgie
Aus dem Englischen von Volker Oldenburg
Suhrkamp
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2022
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage des suhrkamp taschenbuchs 5279.
Deutsche Erstausgabe© der deutschsprachigen Ausgabe Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2022Copyright © 2022 by Lindsey Fitzharris
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Rothfos & Gabler, Hamburg
Umschlagabbildungen: Chirurgische Instrumente (Radierung), Englische Schule des 19. Jahrhunderts, Privatsammlung, Foto: Ken Welsh/Bridgeman Images
eISBN 978-3-518-77444-1
www.suhrkamp.de
Widmung
Für meinen Vater Mike Fitzharris, der immer an mich glaubt, selbst wenn ich an mir zweifle.
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Inhalt
Vorbemerkung
Prolog »Ein abstoßendes Ding«
1 Das Hinterteil der Ballerina
2 Der Silver Ghost
3 Ein besonderer Auftrag
4 Eine sonderbare neue Kunst
5 Das Gruselkabinett
6 Die Station ohne Spiegel
7 Blechnasen und Herzen aus Stahl
8 Die Wundertäter
9 Die Männer auf den blauen Bänken
10 Percy
11 Glorreiche Niederlagen
12 Unter schwierigen Bedingungen
13 Es ist nicht alles Gold
Epilog Auf neuen Wegen
Anmerkungen
Prolog: »Ein abstoßendes Ding«
1: Das Hinterteil der Ballerina
2: Der Silver Ghost
3: Ein besonderer Auftrag
4: Eine sonderbare neue Kunst
5: Das Gruselkabinett
6: Die Station ohne Spiegel
7: Blechnasen und Herzen aus Stahl
8: Die Wundertäter
9: Die Männer auf den blauen Bänken
10: Percy
11: Glorreiche Niederlagen
12: Unter schwierigen Bedingungen
13: Es ist nicht alles Gold
Epilog: Auf neuen Wegen
Danksagung
Informationen zum Buch
Er würde sich den kleinen Leuten zeigen und ihren Müttern und Vätern und Brüdern und Schwestern und Frauen und Liebsten und Großmüttern und Großvätern und über sich hätte er ein Schild und auf dem Schild würde stehen das ist der Krieg und er würde den ganzen Krieg in so einem kleinen Stück Fleisch und Knochen und Haar zusammenballen dass sie es niemals vergessen würden solange sie lebten.
Dalton Trumbo, Und Johnny zog in den Krieg
Nur die Toten haben das Ende des Kriegs gesehen.
George Santayana (1922)
Vorbemerkung
Eine der Herausforderungen für jede Sachbuchautorin ist, die Leser:innen nicht mit zu vielen Einzelheiten zu überfordern – und diese Gefahr ist groß, wenn man die immense Fülle von Ereignissen nachzeichnet, die die Welt zwischen 1914 und 1918 erschütterten. Dieses Buch hat nicht den Anspruch, die Geschichte der plastischen Chirurgie im Ersten Weltkrieg erschöpfend darzustellen. Ebenso wenig ist es eine vollständige Biografie über Harold Gillies, den Chirurgen, der sich während des Krieges daranmachte, die Gesichter entstellter Soldaten zu rekonstruieren. Renommierte Wissenschaftler:innen haben über diese Themen, wie in den Endnoten nachzulesen, eine Vielzahl von Aufsätzen und Büchern geschrieben. Vielmehr möchte ich auf anschauliche Weise die Schwierigkeiten vermitteln, mit denen Gillies und sein Team im Queen's Hospital tagtäglich konfrontiert wurden, und einen Einblick in die Schicksale der Männer geben, die durch ihre Verwundung auf dem Schlachtfeld und den leidvollen Genesungsprozess doppelt traumatisiert waren.
Dieses Buch ist ein Sachbuch. Alles, was in Anführungszeichen gesetzt ist, stammt aus einem historischen Dokument – sei es ein Brief, ein Tagebuch, ein Zeitungsartikel oder der Fallbericht eines Chirurgen. Alle beschriebenen Gesten, Gesichtsausdrücke, Gefühle und so weiter beruhen auf Berichten aus erster Hand.
Ich hoffe, dieses Buch ermöglicht den Leser:innen eine neue Sicht auf die schrecklichen Folgen des Stellungskriegs und die persönlichen Kämpfe, die viele Soldaten führten, lange nachdem sie die Waffen niedergelegt hatten.
Prolog
»Ein abstoßendes Ding«
20. November 1917
Der Osthimmel leuchtete feuerrot und golden, als über Cambrai der Morgen anbrach. Die französische Kleinstadt, etwa vierzig Kilometer vor der belgischen Grenze, war eine wichtige Versorgungsstelle für die deutsche Armee. Auf einer nahen Anhöhe lag Soldat Percy Clare vom 7. Bataillon des East Surrey Regiments neben seinem Zugführer im feuchten Gras und wartete auf das Signal zum Sturm.
Eine halbe Stunde vorher hatte er das riesige Aufgebot an Panzern gesehen, die sich in breiter Front durch das matschige Gelände auf die von Stacheldraht umgebene deutsche Defensivstellung zubewegten. Die britischen Truppen waren im Schutz der Dunkelheit schnell vorangekommen. Doch was zunächst nach einem sicheren Sieg aussah, entwickelte sich schnell zu einem blutigen Gemetzel mit furchtbaren Verlusten auf beiden Seiten. Als Clare sich im Morgengrauen auf den Angriff vorbereitete, war die verwüstete Landschaft bereits mit toten und verwundeten Soldaten übersät. »Ich fragte mich, ob ich noch einmal die Sonne über den Schützengräben aufgehen sehen würde«, notierte er später in seinem Tagebuch.
Der Tod war kein Unbekannter für den sechsunddreißigjährigen Soldaten. Ein Jahr zuvor hatte er monatelang in den Schützengräben an der Somme verbracht, wo sich ermüdende Phasen des Nichtstuns mit plötzlichem massivem Beschuss und nächtlichen Überfällen abwechselten. Alle paar Tage kamen Wagen, um Verpflegung gegen Leichen zu tauschen. Aber die Toten waren einfach zu viele, um sie komplett abzutransportieren. »Sie lagen in den Gräben, so, wie sie gestorben waren«, erinnerte sich ein Soldat. »Man sah sie nicht nur, man rutschte auch auf ihnen aus, wenn man auf sie trat.«
Verwesende Leichen waren allgegenwärtig im Frontalltag. Sie säumten die Grabenwände, verengten die Gänge. Arme und Beine ragten über die Brustwehr. Die Leichen wurden auch dazu verwendet, um Granattrichter in strategisch wichtigen Straßen zu füllen. »Sie schaufelten alles Mögliche in den Krater, dann warfen sie tote Pferde und Leichen obendrauf […], bis das Loch zu war und sie weiterfahren konnten«, erinnerte sich ein Soldat. Taktgefühl und Respekt gingen verloren, während die Beerdigungskommandos sich mühten, mit den Opferzahlen Schritt zu halten. Tote hingen wie Wäschestücke über dem Stacheldraht, bedeckt mit einem zentimeterdicken schwarzen Pelz aus Fliegen. »Am schlimmsten«, erinnerte sich ein Infanterist, »waren die Würmer, die in Massen aus den Leichen krochen.«
Zu dem schrecklichen Anblick, den die Toten boten, kam der fürchterliche Gestank. Der ekelhaft süßliche Geruch von faulem Fleisch hing im Umkreis von Kilometern in der Luft. Nicht selten roch ein Soldat die Front, bevor er sie sah. Der Gestank haftete an dem alten Brot, das er aß, dem abgestandenen Trinkwasser, seiner zerschlissenen Uniform. »Wissen Sie, wie eine tote Maus riecht?«, fragte Lieutenant Robert C. Hoffman, ein US-amerikanischer Veteran des Ersten Weltkriegs, als er seine Landsleute zwei Jahrzehnte später davor warnte, in den Zweiten einzutreten. »Dann haben Sie eine ähnlich gute Vorstellung davon, wie ein Haufen seit Langem toter Soldaten riecht, wie ein Sandkorn Ihnen eine Vorstellung von den Stränden Atlantic Citys vermittelt.« Sogar die Erkennungsmarken, die den Toten vor dem Begräbnis abgenommen wurden, erinnerte sich Hoffman, »stanken so entsetzlich, dass einige Offiziere sich übergeben mussten.«
Clare hatte sich an die Toten gewöhnt, aber nicht an die Sterbenden. Das unvorstellbare Leid, das er gesehen hatte, hatte sich tief in sein Gedächtnis gegraben. Einmal war er in einem Schützengraben auf zwei schwer verletzte deutsche Soldaten gestoßen, beide mit aufgerissener Brust. Sie sahen einander verblüffend ähnlich, was Clare zu der Annahme veranlasste, dass es sich um Vater und Sohn handelte. Ihr Anblick ließ ihn nicht mehr los: »Die Gesichter der beiden armen Kerle waren so gespenstisch bleich […], der Blick so erfüllt von Schmerz, Grauen und Angst, vielleicht um einander.« Clare wartete bei den Verletzten auf medizinische Hilfe, doch schließlich musste er weiter. Später erfuhr er, dass ein Kamerad namens Bean die beiden nach seinem Weggang mit dem Bajonett getötet hatte. »Ich war zutiefst aufgebracht«, schrieb Clare in sein Tagebuch. »Ich sagte ihm, dass er den Krieg nicht überleben werde, dass Gott eine so feige und grausame Tat gewiss nicht ungestraft lassen werde.« Wenig später entdeckte Clare die halb verweste Leiche seines Kameraden in einem Schützengraben.
Als Clare jetzt den Blick vom Hügel aus über das Schlachtfeld schweifen ließ, fragte er sich, welche neuen Schrecken ihn wohl erwarteten. In der Ferne hörte er das leise Stakkato der Maschinengewehre und das Pfeifen fliegender Granaten. »Beim Aufprall«, schrieb Clare, »schien die Erde zu beben, zuerst mit einer heftigen Erschütterung, als schreckte ein Riese aus dem Schlaf auf, dann mit einem andauernden Zittern, das sich auf unsere liegenden Körper übertrug.« Kurz darauf gab sein Zugführer das Signal.
Es war so weit.
Clare pflanzte das Bajonett auf sein Gewehr, dann standen er und die anderen Männer aus seinem Zug vorsichtig aus dem Gras auf. Auf dem Weg den ungeschützten Hang hinunter kamen sie an zahlreichen Verwundeten mit angstbleichen Gesichtern vorbei. Plötzlich explodierte weiter unten eine Granate und hüllte die Umgebung in dichten, schwarzen Rauch. Als der Rauch sich lichtete, sahen sie, dass der Zug vor ihnen ausgelöscht worden war. »Nach ein paar Minuten gingen wir weiter und stiegen über die verstümmelten Leichen unserer armen Kameraden«, schrieb Clare in sein Tagebuch. Ein Toter fiel ihm besonders auf, denn er war völlig nackt. »Die gesamte Kleidung war ihm vom Leib gerissen worden […], ein sonderbarer Effekt von Sprengstoffexplosionen.«
Clares Zug rückte an den Toten vorbei auf das Angriffsziel zu: einen schwer befestigten Schützengraben, gesichert von einem breiten Stacheldrahtgürtel. Als sie sich der Stellung näherten, nahmen die Deutschen sie unter Beschuss. Maschinengewehre feuerten von verschiedenen Positionen gleichzeitig. Auf einmal fühlte sich Clare jämmerlich schlecht vorbereitet. »Wie absurd all das doch schien: Eine schmale Reihe Soldaten rückte gegen diese enorm starke Verteidigungsanlage vor, aus der immer massiver geschossen wurde.«
Clare kam mit dem schweren Tornister, den alle Infanteristen tragen mussten, nur langsam voran. In den bis zu fünfundzwanzig Kilo schweren Tornistern befand sich alles, was ein Soldat im Einsatz brauchte, von Munition und Handgranaten bis zu Gasmaske, Schutzbrille, Schaufel, Drahtzange und Trinkwasser. Clare schnitt sich durch den Stacheldraht, wobei er sich dicht am Boden hielt, um dem Kugelhagel auszuweichen.
Dann, etwa siebenhundert Meter vor dem Schützengraben, verspürte er einen heftigen Schlag im Gesicht. Eine Kugel war durch seine Wange geschlagen und auf der anderen Seite wieder ausgetreten. Blut strömte ihm aus Mund und Nase, tränkte seine Uniform. Clare schrie, aber der Schrei blieb stumm. Sein Gesicht war so schlimm verletzt, dass es sich nicht einmal vor Schmerz verziehen konnte.
Ab dem Moment, als an der Westfront das erste Maschinengewehr ratterte, stand eines fest: Die Fortschritte in der Militärtechnologie stellten die Medizin vor ungeahnte Herausforderungen. Kugeln sausten mit furchterregender Geschwindigkeit durch die Luft. Granaten besaßen eine Sprengkraft, die Soldaten über das Schlachtfeld schleuderte wie Stoffpuppen. Munition mit Magnesiumzündung explodierte erst, wenn sie ins Fleisch eingedrungen war. Granatsplitter, oft mit keimbelastetem Schlamm verunreinigt, fügten ihren Opfern furchtbare Verletzungen zu. Knochen wurden zerschmettert, Körper durchbohrt und Gliedmaßen abgerissen. Gesichtsverletzungen waren oft besonders traumatisch. Nasen wurden weggesprengt, Kiefer zertrümmert, Zungen und Augen herausgerissen. Manchmal wurden ganze Gesichter zerstört. Eine Frontkrankenschwester formulierte es so: »Die Heilkunde stand der Wissenschaft der Zerstörung ratlos gegenüber.«
Die Zahl der Gesichtsverletzungen war im Grabenkrieg erwartungsgemäß hoch. Viele Soldaten erlitten Schusswunden im Gesicht, weil sie einfach keine Vorstellung von den Gefahren hatten. »Sie bildeten sich wohl ein, sie könnten den Kopf aus dem Graben stecken und sich schnell genug ducken, um dem Hagel der Maschinengewehrkugeln auszuweichen«, schrieb ein Frontarzt. Andere, wie Clare, wurden beim Vorrücken auf die feindlichen Stellungen verwundet. Männer wurden verstümmelt, erlitten schwere Brandverletzungen oder wurden durch Giftgas verätzt. Manche bekamen auch einen Pferdehuf ins Gesicht. Bis Kriegsende erlitten allein 280 000 britische, französische und deutsche Soldaten eine Gesichtsverletzung. Der Erste Weltkrieg war eine effiziente Maschinerie, die Millionen von Verwundeten produzierte.
Auch die Zahl der Gefallenen war höher als in allen Kriegen zuvor. Dies war unter anderem auf völlig neue Waffen zurückzuführen, die es möglich machten, Menschen in Massen zu töten. Automatische Waffen erlaubten den Soldaten, innerhalb einer Minute Hunderte Schüsse auf ferne Ziele abzugeben. Artilleriegeschosse waren technisch so weit fortgeschritten, dass die Bediener die Erdkrümmung berücksichtigen mussten, um korrekt zu zielen. Die größte Langrohrkanone der Deutschen, das gefürchtete Paris-Geschütz, beschoss die französische Hauptstadt aus einer Entfernung von hundertzwanzig Kilometern mit neunzig Kilo schweren Sprenggranaten. Auch die Infanteriewaffen waren seit Beginn des 20. Jahrhunderts deutlich verbessert worden. Ihre Feuergeschwindigkeit war um ein Vielfaches schneller als bei allen bis dahin eingesetzten Kriegswaffen. Laut dem Militärhistoriker Leon van Bergen bedeuteten diese Fortschritte in der Waffentechnik, dass eine Kompanie aus dreihundert Mann im Jahr 1914 »die gleiche Feuerkraft aufbieten konnte wie die gesamte sechzigtausend Mann starke Armee unter dem Kommando des Duke of Wellington in der Schlacht bei Waterloo.«
Neben verbesserten Waffen in Infanterie und Artillerie brachte der wissenschaftliche Fortschritt noch zwei weitere grauenhafte Neuheiten hervor. Die erste war der Flammenwerfer, der bei denen, die diese neue Kriegswaffe zum ersten Mal sahen, blankes Entsetzen auslöste. Er wurde zuerst von den Deutschen eingesetzt, unter anderem 1916 gegen die britischen Stellungen um Hooge. Die tragbare Waffe spie eine Stichflamme aus brennendem Öl aus, die in einer Reichweite von zwanzig Metern alles abfackelte und die Soldaten dazu zwang, aus den Schützengräben zu fliehen wie Mäuse aus einem brennenden Heuhaufen. Der flüssige Feuerstrahl ließ viele mit schweren Verbrennungen am ganzen Körper zurück. Ein Soldat musste entsetzt zusehen, wie ein Kamerad Opfer der Flammen wurde: »Sein Gesicht war zu Asche verkohlt, der Oberkörper verschmort und gargekocht.«
Die andere zerstörerische Neuheit waren chemische Kampfstoffe. Der erste große, todbringende Giftgasangriff ereignete sich am 22. April 1915, als eine Spezialeinheit der deutschen Armee hundertsechzig Tonnen Chlorgas über das Schlachtfeld im belgischen Ypern blies. Innerhalb weniger Minuten waren mehr als tausend französische und algerische Soldaten qualvoll erstickt, weitere viertausend hatten schwere Verätzungen erlitten. Die meisten Überlebenden ergriffen mit brennenden Lungen die Flucht, sodass sich im Schützengraben große Lücken auftaten. Ein belgischer Methodistenpfarrer beobachtete das grausige Schauspiel: »Dann taumelten hustende und geblendete französische Soldaten in unsere Mitte, keuchend, mit fürchterlich roten Gesichtern, vor Schmerzen nicht in der Lage zu sprechen. Hinter ihnen, in den gasvernebelten Gräben […] lagen Hunderte tote und sterbende Kameraden.« Obwohl man die Soldaten eilends mit Gasmasken ausstattete, wurde Giftgas sofort zum Synonym für die Grausamkeit des Ersten Weltkriegs.
Panzer waren ein weiteres Novum auf dem Schlachtfeld. Ihre Erfinder, die Briten, nannten sie tanks, um dem Feind gegenüber ihren wahren Zweck zu verschleiern. Als Wassertanks getarnt sollten die mit Kanonen und Maschinengewehren ausgerüsteten Stahlungeheuer die Besatzung schützen, während sie unaufhaltsam auf den Feind zurollten. In Wahrheit war die Panzerung anfällig gegen Granatfeuer, und den Besatzungen drohten alle möglichen Verletzungen, unter anderem Verbrennungen durch ungeschützte Gasbehälter, die mitunter explodierten, wenn der Panzer getroffen wurde.
Wie Percy Clare kämpfte auch Captain Jono Wilson am ersten Tag der Schlacht von Cambrai. Er befehligte eine Division mit drei Panzern. Während des Vorstoßes ging seinem eigenen Panzer der Treibstoff aus. Er sprang aus dem liegengebliebenen Fahrzeug, lief zum zweiten Panzer in der Formation und kletterte hinein. Er wollte gerade eine Nachricht am Fuß einer Brieftaube befestigen, als der Panzer von einer Granate getroffen wurde. Durch die Explosion kippte der Panzer auf die Seite, und im Inneren brach Feuer aus. Bevor die Besatzung fliehen konnte, wurde der Panzer ein zweites Mal getroffen. Der Fahrer wurde getötet, Wilsons Gesicht wurde von einem glühenden Granatsplitter getroffen. Während Blut aus dem klaffenden Loch strömte, wo vorher seine Nase gewesen war, kletterte er aus dem Panzer und ging in einem Granattrichter in Deckung. Dort stärkte er sich mit einem kräftigen Schluck Rum aus der Feldflasche. Schließlich wurde er von vier deutschen Gefangenen geborgen.
Jagdflieger führten derweil am Himmel Luftkämpfe oder wurden von Bodentruppen beschossen. Die Flugzeuge, die aus Holz, Draht und Stoff bestanden, waren nicht kugelsicher, und die meisten Piloten waren so schutzlos wie ihre Kameraden am Boden. Die Luftfahrt steckte zu Anfang des Krieges noch in den Kinderschuhen. Erst elf Jahre zuvor war den Gebrüdern Wright der erste gesteuerte Motorflug gelungen, und Flugzeuge waren noch immer primitive Maschinen. Die Flieger, die noch keine Fallschirme hatten, mussten ein brennendes Flugzeug entweder bruchlanden oder hinausspringen. Ein Pilot überlebte einen Abschuss. Sein Körper blieb nahezu unversehrt, aber sein Gesicht war bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Die meisten Flieger trugen einen Revolver oder eine Pistole bei sich, nicht um auf den Feind zu schießen, sondern um ihrem Leben ein Ende zu setzen, wenn ihr Flugzeug in Brand geriet. Das Fliegen war damals so gefährlich, dass viele Piloten, ohne den Feind gesehen zu haben, schon in der Ausbildung starben. Die ersten Flieger bezeichneten sich manchmal als den »20 Minute Club« – so lange dauerte es im Schnitt, bis ein Pilot im ersten Einsatz abgeschossen wurde.
Trotz all dieser Entwicklungen in der Kriegstechnik, die zum Großteil den direkten Feindkontakt verhindern sollten, wurde weiterhin so roh und brachial gekämpft wie in den Jahrhunderten zuvor. Im Nahkampf ereigneten sich Szenen, die die Überlebenden noch lange nach Kriegsende verfolgten. John Kirkham vom Manchester Regiment erinnerte sich an den Augenblick, als er in der Schlacht an der Somme einen deutschen Soldaten mit einer Grabenkeule attackierte. Diese primitive Waffe erinnerte eher an die Kriegsführung im Mittelalter als an die »moderne« Version des Gemetzels im Ersten Weltkrieg. Die Standardausführung war ein Knüppel oder Schlagstock mit Bleikern, in dessen Kopf Hufnägel eingetrieben wurden. »Die Keule drang tief in seine Stirn«, schrieb Kirkham. »Im Handgemenge verlor er seinen Helm, und ich sah, dass er ein kahlköpfiger alter Mann war. Ich habe diesen kahlen Kopf nicht vergessen und werde es wohl auch nie, der arme Teufel.«
Neben stumpfen Keulen wurde im Nahkampf auch das scharfe Bajonett eingesetzt. Keine Waffe war gefürchteter als das deutsche Sägerücken-Bajonett, das auch die Schlächterklinge genannt wurde. Die gezahnte Klinge diente dazu, dem Feind die Eingeweide herauszureißen, was für das Opfer einen langsamen, qualvollen Tod bedeutete. Die Waffe war so grauenhaft, dass Franzosen und Briten den Deutschen damit drohten, jeden Soldaten, der bei der Gefangennahme ein solches Bajonett bei sich trug, zu foltern und hinzurichten. 1917 war das Sägerücken-Bajonett weitgehend vom Schlachtfeld verschwunden. Dennoch wurden während des gesamten Krieges neue Waffen entwickelt und verbessert, meistens mit grausigen Folgen.
Sogar leere Marmeladendosen wurden in der Anfangszeit des Krieges zu tödlichen Waffen umfunktioniert. Die Soldaten füllten sie mit Sprengstoff und Metallteilen und versahen sie mit einem Zünder. Angesichts der beispiellosen Fülle an neuen Waffen mit möglichst großer Zerstörungswirkung überrascht es kaum, dass die Schlachtfelder Ruinenlandschaften glichen. Ein britischer Soldat beschrieb es so: »Es gab keinerlei Zeichen von Leben mehr. […] Keinen Baum, bis auf ein paar tote Stümpfe, die im Mondlicht einen eigenartigen Anblick boten. Keinen Vogel, nicht einmal eine Ratte oder einen Grashalm. […] Tod stand überall in Großbuchstaben.«
Dies waren nur einige der Schrecken des ersten der beiden Weltkriege, die das 20. Jahrhundert prägten. Der Krieg forderte zwangsläufig eine astronomisch hohe Zahl an Opfern. Die Schlachtfelder waren mit Toten übersät, Verletzte drängten sich in ganz Europa und darüber hinaus in den Lazaretten. Zwischen acht und zehn Millionen Soldaten starben in der Zeit von 1914 bis 1918, mehr als doppelt so viele wurden – oft schwer – verwundet. Die Genesenen mussten zurück an die Front. Nach Hause geschickt wurde nur, wer eine dauerhafte Behinderung zurückbehielt. Soldaten mit Gesichtsverletzungen wie Percy Clare stellten für die Frontärzte eine der größten Herausforderungen dar.
Anders als Amputierte wurden Männer mit entstellten Gesichtern nicht unbedingt als Helden gefeiert. Während ein fehlendes Bein Respekt und Mitgefühl auslöste, rief ein zerstörtes Gesicht häufig Ablehnung oder sogar Ekel hervor. In den Zeitungen von damals wurden Gesichts- und Kieferverletzungen als das Schlimmste überhaupt geschildert, was die Vorurteile widerspiegelt, denen Menschen mit gezeichneten Gesichtern von jeher ausgesetzt waren. Der entstellte Soldat, schrieb die Manchester Evening Chronicle, »weiß, dass bekümmerte Angehörige und staunende, neugierige Fremde dort, wo früher ein hübsches, liebenswertes Gesicht war, nur noch eine mehr oder weniger abstoßende Maske zu sehen bekommen.« Die Historikerin Joanna Burke hat aufgezeigt, dass ein »besonders schwer verunstaltetes Gesicht« zu den ganz wenigen Verletzungen zählte, für die das britische Kriegsministerium die volle Kriegsrente bewilligte – neben dem Verlust mehrerer Gliedmaßen, einer Querschnittlähmung und dem sogenannten »Kriegszittern«, unter dem viele vom Grabenkampf traumatisierte Soldaten litten.
Es ist nicht verwunderlich, dass entstellte Soldaten anders beurteilt wurden als ihre Kameraden mit anderen Kriegsverletzungen. Jahrhundertelang galt ein entstelltes Gesicht als Zeichen moralischer oder geistiger Degeneration. Die Menschen verbanden ein verstümmeltes Gesicht mit verheerenden Krankheiten wie Lepra oder Syphilis, einem schlechten Charakter, sündiger Lebensführung oder sahen es als Strafe Gottes. Ein verunstaltetes Gesicht galt in der Tat als so furchtbarer Makel, dass französische Soldaten, die während der Napoleonischen Kriege solche Verletzungen erlitten, bisweilen von ihren eigenen Kameraden getötet wurden. Diese rechtfertigten ihre Tat damit, sie hätten dem Verwundeten nur weiteres Leid ersparen wollen. Der Irrglaube, eine Entstellung sei »ein Schicksal schlimmer als der Tod« war zu Beginn des Ersten Weltkriegs noch weit verbreitet.
Das Gesicht ist gewöhnlich das Erste, was wir an einem Menschen wahrnehmen. Es gibt Auskunft über Geschlecht, Alter, ethnische Zugehörigkeit und andere wichtige Aspekte der Identität. Es kann uns auch etwas über die Persönlichkeit unseres Gegenübers verraten und hilft uns dabei, miteinander zu kommunizieren. Die Mimik mit all ihren Feinheiten und Nuancen ist eine ganz eigene emotionale Sprache. Wird ein Gesicht ausradiert, geht auch diese essenzielle Expressionsmöglichkeit verloren.
Die Bedeutung, die wir dem Gesicht als Ausdruck von Gefühlen oder Absichten beimessen, schlägt sich auch in unserer Sprache nieder. Wir lesen im Gesicht eines anderen wie in einem Buch. In unangenehmen Situationen versuchen wir, das Gesicht zu wahren. Ein mutiger Mensch zeigt Gesicht, ein unehrlicher hat zwei Gesichter. Wir können das Gesicht auch verlieren, im übertragenen und im wörtlichen Sinn. Die Liste lässt sich beliebig fortsetzen.
Gesichtsverstümmelte Soldaten lebten nach der Heimkehr aus dem Krieg oft in selbstgewählter Isolation von der Gesellschaft. Die abrupte Verwandlung vom »normalen« zum »entstellten« Menschen war nicht nur ein Schock für den Betroffenen selbst, sondern auch für seine Angehörigen und Freunde. Verlobungen wurden gelöst. Kinder ergriffen beim Anblick ihrer Väter die Flucht. Ein Patient erinnerte sich an einen Arzt, der es aufgrund seiner schweren Verletzungen vermied, ihn anzusehen. Später schrieb er darüber: »Damals glaubte ich, er [der Arzt] rechnete damit, dass es mit mir in den nächsten Stunden zu Ende gehen würde.« Solche Reaktionen von Außenstehenden konnten schmerzlich sein. Der kanadische Arzt Robert Tait McKenzie, der während des Kriegs für das Royal Army Medical Corps, den Sanitätsdienst der britischen Streitkräfte, tätig war, schrieb über entstellte Soldaten: »Viele verzagen und werden schwermütig, was in manchen Fällen sogar zum Selbstmord führt.«
Die Leben der betroffenen Soldaten waren oft so zerstört wie ihre Gesichter. Ihrer Identität beraubt, wurden sie zum abschreckenden Symbol einer neuen, mechanisierten Form der Kriegsführung. In Frankreich hießen sie lesgueules cassées (zerhauene Visagen), in Deutschland Gesichtsversehrte oder Menschen ohne Gesicht. In Großbritannien nannte man sie einfach TheLoneliest of Tommies, die tragischsten aller Kriegsopfer, fremd sogar sich selbst.
Soldat Percy Clare in Cambrai war im Begriff, einer von ihnen zu werden.
Als die Kugel seine Wange durchschlug, wusste er sofort, dass die Verletzung lebensbedrohlich war. Er kam einen Augenblick lang schwankend auf die Beine, dann sank er, fassungslos darüber, dass er möglicherweise sterben würde, auf die Knie. »Ich hatte so viele gefährliche Situationen überstanden, dass ich mich unbewusst für immun hielt«, notierte er später in seinem Tagebuch.
Seine Gedanken wanderten zu Frau und Kind, als ihm ein Offizier namens Rawson zu Hilfe kam. Geschockt von Clares Anblick, riss Rawson das eingenähte Erste-Hilfe-Päckchen aus seiner Uniformjacke. Darin befanden sich, eingewickelt in wasserdichtes Gummi, Verbandsmull, Bandagen und ein Fläschchen Jod. Als es ihm nicht gelang, die Blutungsquelle zu ermitteln, geriet Rawson in Panik. Er stopfte Clare den gesamten Mull in den Mund, dann kehrte er zurück zu seinen Männern. Clare musste erkennen, wie schnell man am eigenen Blut ersticken kann, wenn große Adern in Gesicht oder Hals verletzt sind. »Vielleicht glaubte er […], er könnte das Loch verschließen und so die Blutung stillen«, schrieb er. »Aber er erreichte nur, dass ich fast erstickte, und ich schluckte hastig Blut, bis ich alles [Verbandszeug] herausgezogen hatte.«
Clare wusste, dass die Zeit drängte, als ihm vom Blutverlust die Fingerkuppen brannten. Er nahm die letzten Kräfte zusammen und kroch über das Schlachtfeld auf eine ferne Straße zu, wo die Aussicht, gefunden zu werden, größer war. Arme und Beine waren so schwer, als »trüge ich eiserne Ketten«, und schließlich brach er mitten auf dem Schlachtfeld zusammen. Während er dort lag, dachte er an sein Grab: »Ich stellte mir das Begräbniskommando vor, das am Abend oder vielleicht am nächsten Morgen vorbeikommen und mich entdecken würde, denn irgendwann würde man diesen hässlichen Lehmklumpen finden und ihn auf dem Schlachtfeld […] in einem flachen Grab verscharren, so wie ich oft andere begraben hatte.« Er zog eine kleine Bibel aus der Tasche und hielt sie fest vor die Brust, in der Hoffnung, dass die Leute, die seine Leiche finden würden, sie an seine Mutter schickten.
Er verlor immer wieder das Bewusstsein. In den wachen Phasen betete er, dass bald medizinische Hilfe kommen würde. Aber Clare wusste, dass die Aussichten auf eine schnelle Bergung gering waren. Viele Männer starben, während sie auf die Krankenträger warteten. Ein Soldat namens Ernest Wordsworth, der am ersten Tag der Somme-Offensive schon nach wenigen Minuten verwundet worden war, harrte tagelang mit einer stark blutenden Gesichtswunde auf dem Schlachtfeld aus, bis er schließlich gerettet wurde.
Um Verwundete zu bergen, mussten Krankenträger und Sanitäter die Deckung verlassen und wurden so selbst zum Angriffsziel. Während der Schlacht bei Loos im Herbst 1915 wurden drei Männer getötet und ein weiterer verletzt, als sie versuchten, einen Kompanieführer namens Samson zu bergen, der nur zwanzig Meter vom Schützengraben entfernt von mehreren Kugeln getroffen worden war. Als schließlich ein Sanitäter zu ihm vordrang, gab Samson ihm zu verstehen, dass es sich nicht lohne, ihn zu retten. Nachdem das Feuer verstummt war, fanden seine Kameraden ihn tot, mit siebzehn Schusswunden. Er hatte sich die Faust in den Mund gesteckt, damit seine Schmerzensschreie nicht noch mehr Männer dazu veranlassten, ihr Leben aufs Spiel zu setzen, um seines zu retten. Solche tragischen Geschichten waren keineswegs selten.
Angesichts dieser Umstände starben viele Soldaten auf dem Feld, bevor sie medizinisch versorgt werden konnten. Mitunter war es schwierig, die Aufmerksamkeit der Rettungskräfte auf sich zu ziehen, besonders für jene mit schweren Gesichtsverletzungen. Die Grausamkeit dieser Verletzungsart versetzte selbst hartgesottenen Kämpfern einen Schock. Der französische Soldat Louis Barthas erinnerte sich an den Moment, als ein Kamerad im Gesicht verwundet wurde. »Einen Augenblick lang standen wir entsetzt da«, schrieb er. »Der Mann hatte fast kein Gesicht mehr; eine Kugel hatte ihn in den Mund getroffen, seine Wange durchschlagen, den Kiefer zertrümmert und ihm die Zunge herausgerissen, die nur noch an einem Faden hing, und aus diesen schrecklichen Wunden floss das Blut in Strömen.« Der junge Mann war noch am Leben, aber ohne Gesicht war er für niemanden aus seiner Einheit zu erkennen, was Barthas zu der Frage veranlasste: »Ob nicht mal seine Mutter ihn in diesem Zustand erkannt hätte?«
Wenigstens in dieser Hinsicht hatte Percy Clare Glück. Trotz seiner schweren Verletzung wurde er von einem vorbeikommenden Kameraden namens Weyman erkannt. Er hörte eine Stimme neben sich: »Hallo, Perc, du armer Kerl, wie geht es dir?« Clare gab ihm mit einem Zeichen zu verstehen, dass es mit ihm wahrscheinlich zu Ende ging. Weyman kniete sich neben ihn, um die Lage zu beurteilen, dann winkte er einen Bergungstrupp herbei. Clares Hände und sein Gesicht waren über und über mit Blut beschmiert, und aus den Löchern in seinen Wangen rann noch immer frisches nach. Der Sanitäter schüttelte bloß den Kopf und drängte seine Leute weiter. »Die Sorte stirbt immer schnell«, murmelte er.
Aber Weyman gab nicht so schnell auf. Er machte sich im Granatfeuer auf die Suche nach einem anderen Bergungsteam. Auch der zweite Trupp rechnete mit Clares Tod und lehnte eine Bergung ab. Clare, der von Minute zu Minute schwächer wurde, konnte ihnen die Entscheidung kaum verübeln. »Ich war so mit Blut besudelt und bot einen so jämmerlichen Anblick, dass ihre Einschätzung vermutlich berechtigt war, der lange Transport […] wäre sinnlos«, schrieb er.
Einen Mann wie Clare zu retten, dessen Tod sicher schien, bedeutete, Soldaten mit besseren Überlebenschancen auf dem Schlachtfeld zurückzulassen, und so musste jede Entscheidung sorgfältig abgewogen werden. Der Abtransport von Verwundeten war nicht nur gefährlich, sondern auch körperlich anstrengend. Ein großer Teil der Rettungsausrüstung erwies sich im Kampf als nutzlos. Die Sanitätshunde, die speziell dafür ausgebildet waren, Verwundete auf dem Schlachtfeld aufzuspüren, drehten im Granatfeuer durch. Karren, die für den Verwundetentransport bestimmt waren, konnten auf dem unwegsamen, von Kratern übersäten Gelände oft nicht eingesetzt werden. Folglich mussten die Krankenträger die Verwundeten auf mit Schultergurten versehenen Bahren in Sicherheit bringen. Manchmal waren acht Leute nötig, um einen einzigen Soldaten zu bergen. Nichts ging einfach, nichts ging schnell. Als Soldat W. Lugg in der Dritten Flandernschlacht einen Verwundeten barg, musste er zehn Stunden lang durch den Matsch waten, bevor er endlich Hilfe fand. Selbst wenn die Bergung erfolgreich verlief, kam oft jede Hilfe zu spät. Jack Brown, Sanitäter beim Royal Army Medical Corps erinnerte sich: »Oft ging es nur noch darum, ihnen eine Zigarette anzuzünden und ein paar Worte über ihre Familie daheim mit ihnen zu wechseln, bevor sie starben.«
Aufgrund der Stelle seiner Verwundung drohte Percy Clare noch eine andere Gefahr. Viele Soldaten mit Gesichtsverletzungen erstickten, wenn sie flach auf den Rücken gelegt wurden. Blut und Schleim verstopften die Atemwege, oder die Zunge rutschte in den Rachen. Ein Soldat erinnerte sich, dass er einen »leichten Schlag« verspürte und ein dumpfes Geräusch vernahm, als eine Kugel durch sein Gesicht ging und in seiner Schulter stecken blieb. »Ich war fassungslos […] Meine Freunde sahen mich voll Entsetzen an und rechneten damit, dass ich in den nächsten Augenblicken sterben würde.« Er lag stundenlang Blut spuckend im Schützengraben, bis er endlich geborgen wurde.
Zu Beginn des Krieges erlebte der Zahnarzt William Kelsey Fry die besonderen Gefahren von Gesichtsverletzungen, als er einem jungen Soldaten zu Hilfe kam, dem bei einem Nachtangriff der Kiefer weggesprengt worden war. Kelsey Fry wies den Soldaten an, den Kopf nach vorne zu neigen, um seine Atemwege freizuhalten. Nachdem er ihn durch die Schützengräben geführt und an die Sanitäter übergeben hatte, machte er kehrt, um auf seinen Posten zurückzukehren. Er war kaum fünfzig Meter weit gekommen, als man ihm ausrichten ließ, dass der Mann, kurz nachdem man ihn auf eine Trage gelegt habe, erstickt sei. Dieses Erlebnis begleitete ihn sein ganzes Leben lang: »Ich erinnere mich gut daran, dass ich ihn in jener Nacht in eine Decke wickelte und ihn begrub. An diesem Tag fasste ich den Entschluss, dass ich jede Gelegenheit ergreifen würde, um diese Lehre an andere weiterzugeben.« Erst später im Krieg gaben erfahrene Sanitätsoffiziere wie Kelsey Fry offiziell die Empfehlung aus, gesichtsverletzte Soldaten in Bauchlage zu transportieren und darauf zu achten, dass der Kopf über den Rand der Trage hing.
Trotz aller Erschwernisse konnte Weyman schließlich einen dritten Krankenträgertrupp davon überzeugen, seinen Freund mitzunehmen. Clare hatte enorm viel Blut verloren, als er endlich auf die Trage gelegt wurde. Später schrieb er in sein Tagebuch, er habe den »Heimatschuss« bekommen, womit im Soldatenjargon eine Verwundung bezeichnet wird, die so schwer ist, dass sie nur zu Hause behandelt werden kann.
Die Erleichterung, die Clare bei seiner Rettung verspürt haben mag, war nur von kurzer Dauer. Am nächsten Tag erlitt er beim Blick in den Spiegel einen Schock. Niedergeschlagen stellte er fest: »Ich war ein abstoßendes Ding.«
Der Krieg war für Clare vielleicht vorbei, aber sein Kampf, wieder gesund zu werden, hatte gerade erst begonnen. 1917 konnten verwundete Soldaten durch ein besser organisiertes Sanitätswesen schneller und effizienter medizinisch versorgt werden. Dies trug, zusammen mit Fortschritten in der Wundbehandlung, dazu bei, dass mehr verwundete Soldaten überlebten. Das galt auch für Gesichtsverletzungen. Verbesserte Hygienebedingungen in den Lazaretten sorgten außerdem dafür, dass es deutlich seltener zu Infektionen kam als in früheren Kriegen.
Die Verwundeten wurden zur Erstversorgung in den Sanitätsunterstand gebracht, der sich an einem geschützten Ort in unmittelbarer Nähe des Kampfgeschehens oder im Schützengraben selbst befand. Danach kamen sie in mobile Feldambulanzen und von dort in Feldlazarette, die in sicherer Entfernung zur Front lagen. Die Feldlazarette waren teilweise in feststehenden Gebäuden wie Schulen, Klöstern oder Fabriken untergebracht, die meisten aber befanden sich auf einem großen, offenen Gelände mit Zelten oder Holzbaracken.
In diesen voll ausgestatteten Krankenhäusern herrschten teils wüste Zustände, vor allem zu Beginn des Krieges. Der britische Journalist Frederick August Voigt beschrieb eine erschütternde Szene:
Im Operationssaal sah es aus wie in einer Schlachterei. Der Fußboden war übersät mit Spritzern und großen Lachen aus Blut. Überall lagen Fleischteile, Hautfetzen und Knochenstücke. Die Kittel der Assistenten waren mit Blut und gelber Pikrinsäure [ein Antiseptikum] beschmiert. Jeder Kübel war randvoll mit blutgetränkten Handtüchern, Schienen und Verbänden, darauf lag eine Hand oder ein Fuß oder ein überhängender abgetrennter Unterschenkel.
In den Feldlazaretten wurden die Verwundeten stabilisiert und medizinisch versorgt, bevor sie in großen Gruppen auf Schiene, Straße oder zu Wasser in die britischen Lazarette an der französischen Nordküste gebracht wurden, die über bis zu zweieinhalbtausend Betten verfügten und mit allen möglichen Fachärzten und Pflegepersonal ausgestattet waren. Die Fahrt konnte je nach Transportweg bis zu zweieinhalb Tage dauern.
Für Soldaten, die den Heimatschuss bekommen hatten, standen riesige graue Lazarettschiffe zur Fahrt über den Ärmelkanal bereit. Große rote Kreuze an den Seiten zeigten an, dass es sich um einen Verwundetentransport handelte. Nach der Ankunft in Großbritannien wurden die Soldaten in die vielen Militärkrankenhäuser gebracht, die während des Krieges gebaut wurden. Stetige Verbesserungen an diesem durchdachten Versorgungssystem führten im Verlauf des Krieges zu einem erheblichen Rückgang der Sterberate.
Die Ärzte und Krankenschwestern in den Kriegsspitälern sahen sich mit enormen Herausforderungen konfrontiert. Die größte stellten jedoch die Männer mit Gesichtsverletzungen dar. Für sie genügte es nicht, einfach zu überleben. Weitere medizinische Eingriffe waren nötig, damit die Betroffenen zumindest teilweise in ihr altes Leben zurückkehren konnten. Eine Prothese musste dem Arm oder dem Bein, das sie ersetzte, nicht unbedingt ähneln. Bei einem Gesicht sah das völlig anders aus. Ein Chirurg, der sich der ungeheuren Aufgabe stellen wollte, das Gesicht eines Soldaten zu rekonstruieren, musste sich nicht nur um Funktionsverluste wie die Fähigkeit, feste Nahrung zu sich zu nehmen, kümmern, sondern auch ästhetische Faktoren berücksichtigen, um ein Ergebnis zu erzielen, das von der Gesellschaft akzeptiert wurde.
Zu Clares Glück hatte ein visionärer junger Chirurg namens Harold Gillies im englischen Sidcup vor Kurzem das Queen's Hospital gegründet – eines der weltweit ersten Krankenhäuser, das sich auf Gesichtsrekonstruktionen spezialisiert hatte. Im Laufe des Krieges entwickelte Gillies grundlegende Methoden der plastischen Chirurgie weiter und erfand völlig neue. Sein unerschütterliches Engagement richtete sich ganz darauf, in der Hölle der Schützengräben zerstörte Gesichter und Seelen zu reparieren. Um diese gewaltige Herausforderung zu bewältigen, umgab er sich mit einem einzigartigen, multidisziplinären Team aus Chirurgen, Ärzten, Zahnärzten, Radiologen, Künstlern, Bildhauern, Maskenbauern und Fotografen, die allesamt von Anfang an am Rekonstruktionsprozess beteiligt waren. Durch Gillies und seine wegweisenden Methoden verließ die plastische Chirurgie ihr Nischendasein und wurde zu einem bedeutenden Fachgebiet der modernen Medizin. Seitdem blüht sie und hinterfragt auf der ganzen Welt durch Neuerungen in der wiederherstellenden und ästhetischen Chirurgie unsere Vorstellungen von unserem Ich und unserer Identität.
Aber an jenem Herbstmorgen im November 1917 musste Percy Clare nur lange genug am Leben bleiben, um die ärztliche Hilfe zu bekommen, die er so dringend brauchte.
1
Das Hinterteil der Ballerina
Niemand hatte eine Vorstellung vom Krieg und seinen Schrecken, als sich Harold Delf Gillies und seine Frau an einem Frühlingsabend 1913 in Covent Garden durch die Menschenmenge schlängelten. Der schlanke, dreißigjährige Chirurg mit der Adlernase und den dunkelbraunen Augen, in denen oft der Schalk aufblitzte, wirkte durch die gebeugte Körperhaltung kleiner als seine ein Meter fünfundsiebzig. Das Paar schob sich an den Standbesitzern und Straßenhändlern vorbei, die auf den kopfsteingepflasterten Straßen ihr Tagesgeschäft beendeten. 1913 war Londons Stellung in der Welt noch weitaus bedeutender als vor Beginn des Zweiten Weltkriegs sechsundzwanzig Jahre später. Mit einer Bevölkerung von über sieben Millionen Menschen war die pulsierende Metropole größer als Paris, Wien und Sankt Petersburg zusammen.
Aber London war nicht nur groß, sondern auch reich. Frachtschiffe kamen auf der Themse in die Stadt und verließen sie Richtung Nordsee, beladen mit Gütern aus allen Teilen der Welt. Der Londoner Hafen gehörte zu den größten und blühendsten der Welt und war ein riesiger Umschlagplatz für Luxusgüter aus den Kolonien. Täglich entluden die Schauerleute Kisten mit chinesischem Tee, Elfenbein aus Afrika, indischen Gewürzen und jamaikanischem Rum. Mit den Waren kamen Menschen aus zahllosen Ländern, von denen sich manche dauerhaft in der britischen Hauptstadt niederließen. Folglich war London kosmopolitischer als je zuvor.
Die Londoner arbeiteten hart und genossen das Leben. 6566 Schanklokale erlaubten ihnen ihrem Lieblingszeitvertreib – dem Trinken – nachzugehen und hielten die Polizei auf Trab. Dazu gab es in der Stadt fünf Fußballclubs, dreiundfünfzig Theater, einundfünfzig Musik- und Varietébühnen und fast einhundert Kinos, deren Besucherzahlen sich bis zum Ende des Jahrzehnts verdreifachten.
An diesem ungewöhnlich warmen Frühlingsabend wurde im Royal Opera House für die gut betuchten Freunde der klassischen Musik die Londoner Premiere von Verdis Aida gegeben. Gillies hatte Karten von seinem Chef Sir Milsom Rees bekommen, einem Laryngologen, der auf die Behandlung von Erkrankungen des Kehlkopfs spezialisiert war. Als medizinischer Berater der Royal Opera kümmerte sich Rees um die empfindlichen Kehlen der Solisten und Solistinnen. An diesem Abend war er jedoch verhindert, und so schickte er seinen jungen Kollegen als Vertretung.
Gillies war drei Jahre zuvor mehr oder weniger zufällig an seine bequeme Stellung bei Rees gelangt, der im eleganten Stadtteil Marylebone praktizierte. Als er zum Bewerbungsgespräch erschien, hatte er gerade seine klinische Ausbildung am Londoner St. Bartholomew's Hospital abgeschlossen. Während dieser Zeit hatte er ein reges Interesse an der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde entwickelt, ein Teilgebiet der Medizin, das sich im weitesten Sinn mit Erkrankungen, Fehlbildungen und Verletzungen im gesamten Kopf- und Halsbereich befasst. Der Chefarzt der Abteilung, Walter Langdon-Brown, hielt Gillies für einen der besten Studenten seines Jahrgangs. Es waren jedoch nicht seine Fähigkeiten als Chirurg, die ihm die Stellung bei Rees am anderen Ende der Stadt eingebracht hatten. Sein Ruf als ausgezeichneter Golfspieler hatte das Interesse des älteren Arztes geweckt.
Kurz zuvor war Gillies bei den Englischen Amateurmeisterschaften bis in die fünfte Runde gekommen. Mitten im Vorstellungsgespräch holte Rees seine Golfschläger aus dem Schrank und bat Gillies um seine Meinung. Als der Laryngologe seinen Schwung demonstrierte, wurde Gillies ungeduldig. »So etwas Albernes. Wann spricht er endlich über die Stelle?«, fragte er sich. Wie sich schnell herausstellte, ergab sich keine Gelegenheit, die Arbeitsbedingungen zu besprechen. Kurz darauf erschien ein Patient, und Rees komplimentierte den verblüfften Gillies eilig aus seinem Büro. Als er die Tür schloss, wandte er sich noch einmal kurz an den jungen Arzt und bemerkte salopp: »Ach, mein Lieber, fast hätte ich es vergessen! Was halten Sie von fünfhundert [Pfund] im ersten Jahr? Alle Privatpatienten, die Sie an Land ziehen, dürfen Sie behalten. Einverstanden?« Gillies, der im Krankenhaus fünfzig Pfund im Jahr verdiente, war hellauf begeistert von der Aussicht, als HNO-Spezialist in Rees' Praxis das Zehnfache zu verdienen. Es sollte nicht das letzte Mal sein, dass seine sportlichen Leistungen ihm beruflich Türen öffneten.
Gillies war immer ein Überflieger gewesen. Talent – ob auf sportlichem, künstlerischem oder wissenschaftlichem Gebiet – war für ihn eine Gabe, die man auf »wundersame Weise erbte, und nichts, das man sich mühsam erarbeitete«, schrieb sein Biograph Reginald Pound. Harold Gillies wurde als jüngstes von acht Kindern am 17. Juni 1882 in Dunedin, Neuseeland geboren. Sein Großvater John war 1852 von der schottischen Isle of Bute dorthin ausgewandert. Sein ältester Sohn Robert, Gillies' Vater, ließ sich als Landvermesser in Dunedin nieder. Dort verliebte er sich in Emily Street, und die beiden heirateten kurze Zeit später.
Gillies machte seine ersten Kinderschritte in einer riesigen viktorianischen Villa. Sein Vater, ein Hobby-Astronom, hatte auf dem Dach der Villa eine Sternwarte mit Drehkuppel bauen lassen. Er nannte das Haus »Transit House«, zu Ehren der neuseeländischen Astronomen, die während des Venustransits 1874 wissenschaftlich wertvolle Beobachtungen gemacht hatten.
Gillies war ein aufgeweckter Junge, der gerne durch die weite Landschaft in der häuslichen Umgebung streifte. Oft setzten ihn seine fünf älteren Brüder auf Brogo, das Familienpferd, und nahmen ihn mit auf Jagd- und Angelausflüge. In seinen ersten Lebensjahren zog sich Gillies, als er zu Hause das lange Treppengeländer hinunterrutschen wollte, eine Ellbogenfraktur zu, die für immer die Beweglichkeit seines rechten Arms einschränkte. Diese Behinderung veranlasste ihn später dazu, einen ergonomisch geformten Nadelhalter für den Operationssaal zu entwickeln, der es ihm erleichterte, Nähte anzulegen.
Im Juni 1886, zwei Tage vor seinem vierten Geburtstag, nahm Gillies' unbeschwerte Kindheit ein jähes Ende. Am Morgen ging einer seiner Brüder nach oben, um nach ihrem Vater zu sehen, der am Vorabend über Unwohlsein geklagt hatte. Als er ins Schlafzimmer kam, war Robert Gillies wach und guter Dinge. Er sagte, er werde gleich hinunter zum Frühstück kommen. Der Junge lief nach unten, um der Familie die freudige Nachricht zu überbringen.
In der Küche wurde mit Töpfen und Pfannen geklappert, und schließlich pfiff der Wasserkessel. Nur der Vater kam nicht, und Gillies' Bruder wurde von Minute zu Minute unruhiger. Nach einer halben Stunde stieg er wieder die breite Treppe hinauf. Im Schlafzimmer erlebte er einen Schock. Der fünfzigjährige Robert Gillies lag tot im Bett. Todesursache war ein geplatztes Herzaneurysma.
Nach dem Tod ihres Mannes zog Gillies' Mutter mit den acht Kindern nach Auckland, um näher bei ihrer eigenen Familie zu sein. Als Gillies acht Jahre alt war, wurde er nach Großbritannien geschickt, um Lindley Lodge zu besuchen, ein Jungeninternat in der Nähe von Rugby im Herzen Englands. Vier Jahre später kehrte er zur Fortsetzung seiner schulischen Ausbildung nach Neuseeland zurück. Er blieb nicht lange. 1900 zog er als Achtzehnjähriger zurück nach England, um in Cambridge Medizin zu studieren. Sein Entschluss, Arzt zu werden, kam für alle überraschend. Laut Gillies war diese Entscheidung aus dem Wunsch gereift, sich von seinen Brüdern abzugrenzen, die allesamt Anwälte waren. »Ich fand, es sollte noch ein anderer Beruf in der Familie vertreten sein«, scherzte er.
In Cambridge erwarb er sich schnell den Ruf eines Nonkonformisten, nachdem er sein gesamtes Stipendium für ein neues Motorrad ausgegeben hatte. Er scheute sich nicht, die Worte seiner Professoren anzuzweifeln, und stritt sich im Sektionsraum der Universität gerne mit dem Prosektor. Trotz seines mangelnden Respekts gegenüber Autoritäten war er ungemein beliebt. Sowohl Lehrer als auch Kommilitonen bewunderten ihn für sein »heiteres Wesen und sein Lächeln, das in schallendes Gelächter überging«. Seine Beliebtheit trug ihm den Spitznamen »Giles« ein, der sein Leben lang an ihm hängen blieb.
Trotz seines rebellischen Geistes war Gillies ein methodischer Mensch mit einer Vorliebe für Vorschriften und Regeln – besonders, wenn sie von ihm stammten. Während seiner Studienzeit bewohnte er mit fünf anderen jungen Männern ein viktorianisches Reihenhaus. Wie bei Studenten üblich, kamen und gingen seine Mitbewohner, wie es ihnen gefiel. Da nicht alle regelmäßig zu den Mahlzeiten erschienen, ersann Gillies ein System zur Kostenkontrolle. Jeder Bewohner musste aufschreiben, ob er am Essen teilgenommen, wie viele »Einheiten« er verzehrt und wie viel eine Einheit gekostet hatte. Ein Mitbewohner sprach von einem »höchst originellen, genialen Plan«, der Gleichheit garantierte und für alle die Kosten senkte. Weniger beeindruckt zeigten sich seine Freunde, als Gillies ihnen Zinsen berechnete, nachdem er ihre Schulden beglichen hatte. Gerechtigkeit ging für Gillies über alles.
Während des Studiums entwickelte sich seine Leidenschaft fürs Golfen, und er tauschte den Federhalter regelmäßig gegen einen Satz Schläger. An einem Wochenende, an dem er mit ein paar Kommilitonen zu einer Feier nach Sandwich gefahren war, entstand die Idee, sich für das Golfteam der Universität zu bewerben. Er hatte seine Schläger mitgenommen, um eine Runde auf dem berühmten Golfplatz zu spielen, wo einige Tage später ein Turnier zwischen Cambridge und Oxford stattfinden sollte. Nach der Feier stieg Gillies unverrichteter Dinge in den Zug nach Hause. In letzter Sekunde überlegte er es sich anders. Er schnappte sich die Golftasche und sprang aus dem Waggon, als der Zug sich dampfend in Bewegung setzte. Kurz darauf wurde er in die Golfmannschaft der Cambridge University aufgenommen.
Oft schloss sich Gillies unverschämt lange im Badezimmer ein, was seine Mitbewohner mit Sicherheit in Rage brachte. Sein tägliches Ritual in dem winzigen Raum bestand darin, die Füße immer auf die beiden selben Linoleumfliesen zu stellen und vor dem Spiegel seinen Schwung zu üben. Sein Freund Norman Jewson, der später ein berühmter Architekt wurde, war beeindruckt von seiner »enormen Konzentrationsfähigkeit und seiner Willensstärke«. Seine Bekannten bescheinigten ihm ein »übernatürliches Talent« fürs Golfen. Später sollten seine Patienten sein Können als plastischer Chirurg mit ähnlichen Worten preisen.
Im Verlauf seines Studiums trat Gillies' Begabung für die Chirurgie zutage. Angesichts seines ausgeprägten Präzisionsstrebens war das keine große Überraschung. Er verfügte über einen Ehrgeiz, der den meisten anderen jungen Männern aus seiner sozialen Schicht fehlte. Oft vergrub er sich in der Bibliothek, während seine Altersgenossen sich vergnügten. Ein Freund drückte es so aus: »Wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hatte, konnte ihn nichts davon abbringen.« Seine Hartnäckigkeit sollte ihm im Leben gute Dienste erweisen.
Das galt auch für Herzensangelegenheiten. Obwohl Gillies sich geschworen hatte, nie eine Krankenschwester zu heiraten, verliebte er sich bis über beide Ohren in Kathleen Margaret Jackson, eine Krankenschwester vom St. Bartholomew's Hospital, wo Gillies seine klinische Ausbildung absolviert hatte. Es gab jedoch ein Problem: Auch ein anderer Arzt machte ihr den Hof.
Gillies, der sich nie vor Konkurrenz scheute, legte sich umso mehr ins Zeug. Eines Abends mietete er ein Hansom-Cab und lud Kathleen zu einer Spazierfahrt ein. Als sie eingestiegen waren, ließ Gillies den Kutscher so lange durch die Stadt fahren, bis sie seinen Antrag angenommen hatte. Die strengen Anstandsregeln der damaligen Zeit schrieben vor, dass Krankenschwestern auf dem Klinikgelände wohnen und ledig sein mussten. Und so kündigte Kathleen kurz nach der Verlobung ihre Stellung. Sechs Monate später, am 9. November 1911, gaben die beiden sich das Ja-Wort. Zu diesem Zeitpunkt hatte Gillies bereits seine einträgliche Stellung in Rees' Praxis angetreten.
An jenem lauen Frühlingsabend betraten Gillies und seine Frau in Vorfreude auf die Aida-Vorstellung das Opernhaus mit den imposanten Säulen. Ihren Erstgeborenen – einen kleinen Jungen namens John, der im Zweiten Weltkrieg in Kriegsgefangenschaft geriet, als seine Spitfire über Frankreich abgeschossen wurde – hatten sie zu den Großeltern gebracht. Als nach dem ersten Akt der Vorhang fiel, kam eine Aufsicht mit weißen Handschuhen diskret an Gillies' Platz und bat ihn, ihn hinter die Bühne zu begleiten. Da sein Chef bei diesen Gelegenheiten gewöhnlich nur leichte Aufgaben zu erfüllen hatte, rechnete Gillies damit, nicht viel mehr tun zu müssen, als ein schmerzlinderndes Mittel in eine überanstrengte Sängerkehle zu sprühen. Stattdessen erwartete ihn eine halbnackte, verletzte Tänzerin. Felyne Verbist, die belgische Primaballerina, hatte sich versehentlich auf eine Schere gesetzt, deren Spitze sich tief in ihr wohlgeformtes Gesäß gebohrt hatte. Gillies machte sich daran, die delikate Stelle zu verarzten.
Auf dem Weg zurück zu seinem Platz überlegte er, wie er seiner jungen Frau die lange Abwesenheit – und die »Halsbehandlung« – erklären sollte. Während der restlichen Vorstellung fiel es ihm schwer, sich auf etwas anderes zu konzentrieren, als »auf die kleine Ausbuchtung, die mein mehr schlecht als recht angelegter Verband im Kostüm der schönen Tänzerin hinterlassen hatte.«
Gillies gab diese Geschichte in späteren Jahren oft zum Besten, als wäre das Entfernen einer spitzen Schere aus dem Hinterteil einer Ballerina die Glanzleistung seiner Chirurgenkarriere gewesen.
Ein Jahr später, am 28. Juli 1914, tanzte Felyne Verbist in derselben Aida-Inszenierung. An diesem Tag erklärte Österreich-Ungarn Serbien offiziell den Krieg, und der Erste Weltkrieg begann. Eine Woche später – die Briten strömten noch einmal in Scharen ans Meer, um den letzten Ferientag zu genießen – erklärte Großbritannien dem Deutschen Reich den Krieg und stürzte die Nation in einen der blutigsten bewaffneten Konflikte der Geschichte. Nur wenige Menschen sahen an diesem drückend heißen Sommertag die Katastrophe voraus, die über das Land hereinbrechen würde. Der Krieg kam für die meisten völlig überraschend.
Der Auslöser der Krise hatte sich einen Monat zuvor ereignet. Der serbische Nationalist Gavrilo Princip hatte in Sarajevo den österreichischen Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin Sophie Fürstin von Hohenberg erschossen. Das Paar war in die bosnische Hauptstadt gereist, um einem Truppenmanöver beizuwohnen. Princip war der Auffassung, Bosnien-Herzegowina, das 1908 von Österreich-Ungarn annektiert worden war, gehöre rechtmäßig zu Serbien, und wollte Vergeltung üben. Ausgestattet mit Waffen der serbischen Terrororganisation Die Schwarze Hand kam Princip mit fünf Mitverschwörern nach Sarajevo, um den Thronfolger zu ermorden.
Franz Ferdinand war sich der Gefahr eines Anschlags durchaus bewusst. Drei Jahre zuvor hatte die Schwarze Hand ein Attentat auf seinen Onkel, Kaiser Franz Joseph I., geplant. Angeblich hatte er sogar kurz vor Antritt der Reise einem Familienmitglied anvertraut, er habe seine eigene Ermordung vorausgesehen. Dennoch war Franz Ferdinand offenbar nicht allzu besorgt um seine Sicherheit, denn er hatte den Termin für seinen Sarajevo-Besuch bereits zwei Monate zuvor öffentlich bekanntgemacht – und damit jedem potenziellen Attentäter reichlich Zeit gegeben, einen Anschlag vorzubereiten.
Im Rückblick hat es den Anschein, als hätten alle Beteiligten eine Verabredung mit dem Schicksal gehabt.
Am Morgen des 28. Juni kam das Thronfolgerpaar mit dem Zug in Sarajevo an. Beide waren bester Stimmung, denn es war ihr Hochzeitstag. Unter anderem deswegen hatte die Herzogin darauf bestanden, bei diesem Staatsbesuch an der Seite ihres Mannes zu sein. Bei ihnen war ihr persönlicher Chauffeur, ein pausbäckiger Mann mit Schnauzbart namens Leopold Lojka. Lojka half dem Paar in den Doppelphaeton des Automobilherstellers Gräf & Stift. Der Wagen trug das NummernschildA III-118 – ein sonderbarer Zufall, wenn man bedenkt, dass der Tag des Waffenstillstands später auf den 11. 11. 18 fiel.
Das luxuriöse Sportcoupé war der zweite Wagen in einer Kolonne aus sechs Fahrzeugen, die auf dem Appelkai, entlang der Uferbefestigung der Miljacka, Richtung Rathaus fuhr. Am Vortag war es kalt und regnerisch gewesen, aber an diesem Vormittag wurde das Thronfolgerpaar von der Sonne begrüßt. Wegen des herrlichen Wetters fuhr der Wagen mit offenem Verdeck, damit die Schaulustigen am Straßenrand den Erzherzog und seine Gemahlin sehen konnten. Obwohl es mehrere Hinweise auf ein mögliches Attentat gab, wurden entlang der Strecke keine besonderen Sicherheitsvorkehrungen getroffen.
Die Attentäter hatten sich am Morgen, bewaffnet mit Pistolen und Bomben, entlang der Wegstrecke verteilt, um den günstigsten Moment für den Anschlag abzupassen. Versagte einer, stand der nächste bereit. Jeder der sechs hatte ein Tütchen Zyanidpulver dabei, um sich das Leben zu nehmen, falls der Plan schiefging. Das geschah ziemlich schnell.
Der erste Attentäter, der eine Bombe werfen sollte, war der achtundzwanzigjährige Muhamed Mehmedbašić. Doch als die Wagenkolonne langsam an ihm vorbeirollte, verließ ihn der Mut. Später gab er an, ein Polizist sei hinter ihn getreten und er habe Angst gehabt, die gesamte Mission zu gefährden, sollte er das Ziel verfehlen. Ein paar Minuten später näherte sich der Konvoi dem neuzehnjährigen Nedeljko Čabrinović, der einen überzeugenden Grund hatte, sich nicht vor den Konsequenzen seiner Tat zu fürchten: Er litt an Tuberkulose, die 1914 noch unheilbar war, und wusste, dass er bald sterben würde.
Čabrinović brach an einem Laternenpfahl die Sprengkapsel auf und schleuderte die Bombe in Richtung des Wagens mit dem Erzherzog. Lojka sah die Bombe durch die Luft fliegen und gab Gas. Es ist nicht gesichert, ob die Bombe vom zurückgelegten Verdeck abprallte oder ob Franz Ferdinand sie mit dem Arm abwehrte. Jedenfalls explodierte sie unter dem folgenden Fahrzeug, wobei zwei im Wagen sitzende Offiziere und mehrere Schaulustige am Straßenrand verletzt wurden.
Čabrinović drängte sich durch die aufgebrachte Menge. Auf der Flucht schluckte er das Zyanid und sprang über die Uferbrüstung, um sich in der Miljacka zu ertränken. Aber der Selbstmordversuch schlug fehl. Das Gift war alt und verätzte ihm nur die Kehle. Außerdem führte der Fluss an dieser Stelle kaum Wasser, und so blieb Čabrinović am sandigen Ufer liegen und übergab sich. Bevor die wütende Menge sich auf ihn stürzen konnte, wurde er von zwei Ordnungshütern abgeführt.
Unterdessen ließ der Erzherzog die Kolonne anhalten, um sich nach dem Zustand der beiden Offiziere zu erkundigen. Als man ihm mitteilte, die beiden seien nur leicht verletzt, gab er den Befehl weiterzufahren: »Der Kerl ist verrückt. Meine Herren, wir wollen unser Programm fortsetzen.« Die Kolonne setzte sich wieder in Bewegung, aber die restlichen Attentäter gerieten in Panik und tauchten in der Menge unter. Wenig später fuhr der Wagen mit Franz Ferdinand und Sophie vor dem Rathaus vor.
Ein Splitter hatte Sophies Wange gestreift, aber sonst war das Paar unversehrt. In seiner Aufregung klammerte sich der Bürgermeister an seine vorbereitete, angesichts der Ereignisse ziemlich unpassende Begrüßungsrede: »Die ganze Bürgerschaft der Landeshauptstadt