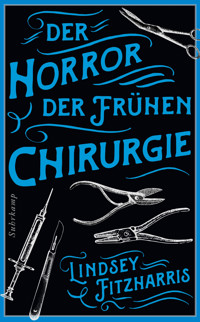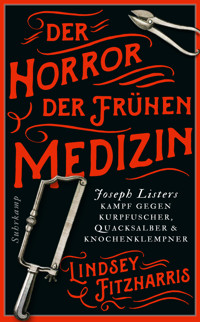
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Grausig sind die Anfänge der Medizin: Leichenraub, blutige Operationen wie Kirmesspektakel, Arsen, Quecksilber, Kokain als verschriebene Heilmittel. Mitte des 19. Jahrhunderts ist das Unwissen der Ärzte sagenhaft, wie sie praktizieren, ein einziger Albtraum. Bis ein junger Student aus London mit seinen Entdeckungen alles verändert … Lindsey Fitzharris erzählt vom Leben dieses Mannes und vom Horror, den ein einfacher Arztbesuch damals bedeutete – schaurig, unterhaltsam, erhellend.
Als Joseph Lister 1844 sein Studium in London beginnt, ist die medizinische Versorgung der Bevölkerung desaströs: Die Krankenhäuser sind überfüllt und verseucht. Um aufgenommen zu werden, müssen Patienten genug Geld für die eigene Beerdigung mitbringen. In den Operationssälen arbeiten Chirurgen in Straßenklamotten vor schaulustigem Publikum. Warum fast alle Patienten sterben, wie sich Krankheiten ausbreiten, darüber herrscht nicht im Geringsten Einigkeit, nur hanebüchene Theorien. Joseph Lister wird Chirurg, er will ganz praktisch helfen. Und von Neugier und hellem Verstand geleitet, entwickelt er eine Methode, die das Sterben vielleicht beenden kann …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 371
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Lindsey Fitzharris
Der Horror der frühen Medizin
Joseph Listers Kampf gegen Kurpfuscher, Quacksalber & Knochenklempner
Aus dem Englischen von Volker Oldenburg
Suhrkamp
Der Horror der frühen Medizin
Joseph Listers Kampf gegen Kurpfuscher, Quacksalber & Knochenklempner
Inhalt
Prolog Das Zeitalter der Qualen
1 Durch das Objektiv
2 Das Todeshaus
3 Der genähte Darm
4 Der Altar der Wissenschaft
5 Der Napoleon der Chirurgie
6 Froschschenkel
7 Sauberkeit und kaltes Wasser
8 Alle sind tot
9 Der Sturm
10 Der Glasgarten
11 Der Abszess der Königin
Epilog Der dunkle Vorhang hebt sich
Danksagung
Anmerkungen
Prolog
Das Zeitalter der Qualen
Wenn ein angesehener, aber älterer Wissenschaftler behauptet, dass etwas möglich ist, hat er mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit recht. Wenn er behauptet, dass etwas unmöglich ist, hat er höchstwahrscheinlich unrecht.
Arthur C. Clarke
*
Hunderte von Männern strömten am 21. Dezember 1846 in den Operationssaal des University College Hospital, wo sich der berühmteste Chirurg Londons anschickte, sein Publikum mit einer Oberschenkelamputation zu fesseln. Niemand ahnte, dass sich an diesem Nachmittag einer der bedeutendsten Momente der Medizingeschichte ereignen würde.
Der Saal war gerammelt voll, und die meisten Zuschauer hatten den Straßenschmutz des viktorianischen Londons hereingetragen. Der Chirurg John Flint South schrieb, das Gerangel um die Plätze im Operationssaal habe sich genauso wild abgespielt wie im Theater. Die Leute »standen wie die Heringe«, die Zuschauer in den hinteren Reihen reckten die Hälse und riefen »Kopf weg, Kopf weg«, wenn ein Vordermann ihnen die Sicht nahm. Manchmal herrschte am Operationstisch so dichtes Gedränge, dass der Saal teilweise geräumt werden musste, ehe der Chirurg mit dem Eingriff beginnen konnte. Die Luft war zum Schneiden, und obwohl Dezember war, war es fast unerträglich heiß.
Das Publikum bestand aus einer bunten Mischung von Leuten. Die ersten beiden Reihen waren in der Regel für die Assistenten reserviert, die den Chirurgen mit ihren Verbandskoffern bei der Visite begleiteten und sich um die Wunden der Patienten kümmerten. Dahinter drängten sich die Studenten, die die ganze Zeit aufgeregt miteinander tuschelten, sowie Ehrengäste und andere Privatpersonen.
Voyeuristische Sensationsgier war nicht neu in der Medizin. Sie begann in den schummrigen anatomischen Theatern der Renaissance, wo die Leichen hingerichteter Verbrecher seziert wurden, um sie zusätzlich für ihre Übeltaten zu bestrafen. Das begeisterte Publikum sah gebannt zu, wie der Anatom die aufgeblähten Bäuche verwesender Leichname aufschnitt, aus denen Blut und stinkender Eiter quoll. Manchmal wurde das makabre Schauspiel von lieblicher Flötenmusik begleitet. Öffentliche Sektionen waren Theateraufführungen, eine ebenso beliebte Form der Unterhaltung wie Bearbaiting oder Hahnenkämpfe. Aber nicht jeder fand Gefallen an der grausigen Darbietung. Der französische Philosoph Jean-Jacques Rousseau schrieb über das Erlebnis: »Welch eine schaurige Angelegenheit ist doch ein Anatomiesaal! Stinkende Leichname, fahles, feuchtbrandiges Fleisch, Blut, eklige Därme, scheußliche Gerippe, pestilenzartige Dünste! Nein, dort wird sich ‒ mein Wort darauf ‒ Jean-Jacques seinen Zeitvertreib nicht suchen.«
Der Operationssaal im University College Hospital sah nicht viel anders aus als alle anderen in der Stadt. Er bestand aus einer Bühne mit halbrunden Zuschauertribünen. Diese erstreckten sich bis hinauf zu einem großen Oberlicht, der einzigen natürlichen Lichtquelle. War es an stark bewölkten Tagen zu dunkel im Saal, wurden große Kerzen angezündet. Der fleckige Holztisch in der Mitte war übersät mit den Spuren früherer Schlachtorgien. Sägespäne auf dem Boden sollten das Blut aufsaugen, das in Kürze aus dem abgetrennten Bein strömen würde. Meistens übertönten die grauenhaften Schmerzensschreie der wehrlosen Patienten die hereindringenden Straßengeräusche: Kinderlachen, Passantengespräche, vorbeirumpelnde Kutschen.
In den 1840ern waren Operationen eine schmutzige, hochgefährliche Angelegenheit und unter allen Umständen zu vermeiden. Viele Chirurgen weigerten sich aufgrund der Risiken strikt zu operieren und beschränkten sich auf die Behandlung von äußeren Leiden wie Hautkrankheiten und oberflächlichen Wunden. Operationen waren eine Seltenheit, und so strömten die Menschen in Scharen herbei, wenn eine auf dem Programm stand. In der Glasgower Royal Infirmary zum Beispiel wurden 1840 nur hundertzwanzig chirurgische Eingriffe durchgeführt. Der Griff zum Skalpell war immer der letzte Ausweg im Kampf um Leben und Tod.
Der Arzt Thomas Percival empfahl allen Chirurgen, zwischen den Eingriffen den Kittel zu wechseln und den Tisch sowie die Instrumente zu reinigen, allerdings nicht aus Gründen der Hygiene, sondern um »alles zu vermeiden, was Schrecken hervorrufen könnte«. Nur die wenigsten befolgten seinen Rat. Die Chirurgen der damaligen Zeit trugen blutverkrustete Kittel, wuschen sich nur selten die Hände, arbeiteten mit unsauberen Instrumenten und brachten den unverwechselbaren Gestank von verfaultem Fleisch mit in den Saal, den die Ärzte fröhlich als den »guten, alten Krankenhausmief« bezeichneten.
Damals galt Eiter unter Chirurgen nicht als unheilvolles Zeichen einer Sepsis, sondern als natürliche Begleiterscheinung des Heilungsprozesses, und die meisten Patienten starben an postoperativen Infektionen. Der Operationssaal war ein Tor zum Tod. Es war sicherer, sich in den eigenen vier Wänden operieren zu lassen, als in einem Krankenhaus, wo die Mortalität drei- bis fünfmal so hoch war wie in der häuslichen Umgebung. Doch erst 1863 stellte Florence Nightingale fest: »Die Sterblichkeit in den Krankenhäusern, besonders in denen in großen, dicht besiedelten Städten, ist in Wahrheit um ein Vielfaches höher, als die Schätzungen vermuten lassen, die wir aufgrund der Sterblichkeit bei außerhalb des Krankenhauses behandelten Patienten mit denselben Erkrankungen angestellt haben.« Allerdings konnten es sich nur die wenigsten leisten, den Chirurgen zu sich nach Hause zu bestellen.
Schmutz und Infektionen waren keineswegs das einzige Problem. Operationen waren schmerzhaft. Schon seit Jahrhunderten suchte man in der Medizin nach Wegen, das Leid der Patienten zu lindern. Obwohl die betäubende und schmerzstillende Wirkung von Lachgas (Distickstoffmonoxid) bekannt war, seit der Chemiker Joseph Priestley es 1772 erstmals rein dargestellt hatte, wurde es aufgrund seiner unzuverlässigen Wirkung nur selten bei Operationen eingesetzt. Auch der Mesmerismus ‒ benannt nach dem deutschen Arzt Franz Anton Mesmer, der dieses Hypnoseverfahren in den 1770ern entwickelt hatte, konnte sich in der Schulmedizin des 18. Jahrhunderts nicht durchsetzen. Mesmer und seine Anhänger glaubten, durch Handauflegen oder sogenannte Luftstriche ließen sich magnetische Heilströme auf den Patienten übertragen. Dies sollte sich nicht nur positiv auf den Heilungsprozess auswirken, sondern auch übersinnliche Kräfte wecken. Die meisten Ärzte blieben skeptisch.
In den 1830ern erlebte der Mesmerismus in Großbritannien durch den Arzt John Elliotson noch einmal einen kurzen Aufschwung. Elliotson veranstaltete im University College Hospital öffentliche Mesmerismus-Sitzungen mit zwei seiner Patientinnen, den Schwestern Elizabeth und Jane Okey, die angeblich das Schicksal anderer Krankenhauspatienten vorhersagen konnten. Nachdem Elliotson die Schwestern hypnotisiert hatte, behaupteten sie, über den Betten der Patienten, die kurz darauf tatsächlich starben, den Todesengel zu sehen. Aber der Spuk währte nicht lange. 1838 gelang es dem Chefredakteur der weltweit führenden medizinischen Fachzeitschrift The Lancet, den Okey-Schwestern ein Betrugsgeständnis zu entlocken. Damit war Elliotson als Scharlatan entlarvt.
Dieser Skandal war den Zuschauern im Saal noch in bester Erinnerung, als der berühmte Chirurg an diesem 21. Dezember bekanntgab, er wolle an dem Patienten die Wirksamkeit von Äther testen. »Meine Herren, wir werden heute einen Yankee-Trick ausprobieren, der den Menschen schmerzunempfindlich macht!«, verkündete er, als er zum Operationstisch schritt. Im Saal herrschte verblüffte Stille. Äther galt wie der Mesmerismus als dubiose ausländische Methode, um Menschen in den Dämmerzustand zu versetzen und willenlos zu machen. Die Bezeichnung »Yankee-Trick« war darauf zurückzuführen, dass die erste Äthernarkose in Amerika durchgeführt worden war. Entdeckt wurde Äther bereits 1275, doch seine betäubende Wirkung wurde erst erkannt, als der deutsche Botaniker und Arzt Valerius Cordus 1540 aus Ethanol und Schwefelsäure Diethylether herstellte. Sein Zeitgenosse Paracelsus führte mit Äther Versuche an Hühnern durch und beobachtete, dass die Tiere, wenn sie die Flüssigkeit getrunken hatten, einschliefen und nach einiger Zeit ohne jeden Schaden wieder aufwachten. Er kam zu dem Schluss, dass die Substanz »alle Leiden einschränkt ohne irgendeinen Nachteil, jeden Schmerz betäubt, jedes Fieber mildert und Komplikationen verhütet.« Doch es sollten noch Jahrhunderte vergehen, bis das Narkotikum zum ersten Mal an Menschen erprobt wurde.
1842 war es schließlich so weit. Der amerikanische Arzt Crawford Williamson Long aus Jefferson, Georgia war der erste Mediziner, der Äther als Narkosemittel einsetzte, als er einem Patienten einen Tumor aus dem Hals entfernte. Leider dokumentierte Long die Ergebnisse seines Experiments erst 1848. Zwei Jahre zuvor, im September 1846, war der Bostoner Zahnarzt William T. G. Morton dadurch zu Ruhm gelangt, dass er einen Patienten vor dem Ziehen eines vereiterten Backenzahns mit Äther betäubt hatte. Eine Zeitung berichtete über den erfolgreichen schmerzlosen Eingriff, und ein renommierter Chirurg vom Massachusetts General Hospital bat Morton daraufhin, ihm bei der Operation eines Patienten zu assistieren, dem ein großer oberflächlicher Tumor am Unterkiefer entfernt werden musste.
Am 18. November 1846 schrieb der Chirurg Henry Jacob Bigelow im Boston Medical and Surgical Journal über dieses bahnbrechende Ereignis: »Seit Langem gehört es zu den wichtigsten Aufgaben der Heilkunde, eine Methode zu ersinnen, die bei chirurgischen Eingriffen den Schmerz lindert. Endlich ist ein Mittel gefunden, das diesen Zweck effizient erfüllt.« Bigelow schilderte in seinem Artikel, wie Morton den Patienten vor Operationsbeginn die Dämpfe eines Gases inhalieren ließ. Der Zahnarzt hatte es »Letheon« genannt, nach Lethe, dem Fluss des Vergessens in der griechischen Mythologie. Die genaue Zusammensetzung hielt Morton, der sich den Wirkstoff nach dem Eingriff patentieren ließ, sogar vor den Chirurgen geheim. Bigelow schrieb jedoch, er habe den widerlich süßen Geruch von Äther gerochen. Die Nachricht von dem geheimnisvollen Mittel, das den Patienten während der Operation in Bewusstlosigkeit versetzte, verbreitete sich wie ein Lauffeuer, und Chirurgen auf der ganzen Welt machten sich begeistert daran, die Wirksamkeit von Äther an ihren eigenen Patienten auszuprobieren.
Bigelow schrieb an den in London praktizierenden amerikanischen Arzt Francis Boott und schilderte ihm das epochale Ereignis in allen Einzelheiten. Boott war fasziniert und überredete den Zahnchirurgen James Robinson, eine Zahnextraktion unter Äther durchzuführen. Das Experiment verlief so erfolgreich, dass Boott noch am selben Tag ins University College Hospital eilte, um Robert Liston davon zu berichten.
Liston war skeptisch, aber er wollte sich auf keinen Fall die Gelegenheit entgehen lassen, etwas Neues im Operationssaal auszuprobieren. Eine Äthernarkose würde auf jeden Fall für Aufsehen sorgen, und für seine spektakulären Vorstellungen war er schließlich im ganzen Land berühmt. Er erklärte sich bereit, das Experiment bei seiner nächsten, für den übernächsten Tag angesetzten Operation zu wagen.
Als Liston nach London kam, war der akademisch ausgebildete Arzt (physician) ein Gentleman, der in der Welt der Heilkunst über enorme Macht und hohen Einfluss verfügte. Ärzte gehörten zur gesellschaftlichen Elite und standen ganz oben in der Medizinhierarchie. Dementsprechend streng wachten sie über ihre Zunft und nahmen nur Männer aus angesehener Familie und von tadellosem Ruf in ihren erlauchten Kreis auf. Sie waren Gelehrte ohne nennenswerte praktische Ausbildung, deren Wissen aus dem Studium griechischer und lateinischer Schriften stammte. Sie arbeiteten nicht mit den Händen, sondern mit dem Verstand. Es war damals nichts Besonderes, dass ein Arzt eine Behandlung verordnete, ohne den Patienten vorher zu untersuchen. Manche bekamen ihre Patienten sogar nie zu Gesicht, sondern erteilten ihren medizinischen Rat ausschließlich mittels schriftlicher Korrespondenz.
Der Chirurg war hingegen jahrhundertelang ein praktisch ausgebildeter Handwerker gewesen. Die Chirurgie gehörte nicht zu den Lehrfächern an der Universität, und wer Chirurg werden wollte, musste bei einem anderen Wundarzt in die Lehre gehen. Bis ins 19. Jahrhundert hinein hatten viele Chirurgen nie eine Universität von innen gesehen. Manche waren sogar Analphabeten. Direkt unter den Chirurgen standen die Apotheker, die Arzneimittel zubereiteten. In der Theorie waren die beiden Berufe klar voneinander abgegrenzt. In der Praxis aber konnte ein Mann, der das Chirurgenhandwerk erlernt hatte, auch als Apotheker tätig sein und umgekehrt. Dadurch entstand in England der Beruf des surgeon-apothecary, der sich vielleicht mit dem modernen praktischen Arzt vergleichen lässt. Der »Chirurg-Apotheker« war vor allem außerhalb der Großstädte die erste ärztliche Anlaufstelle für die Armen.
Mit der Zeit regte sich Widerstand gegen die klassische Trennung von Arzt und Chirurg, und 1815 wurde in Großbritannien ein einheitliches medizinisches Ausbildungssystem eingeführt. Fortan mussten die Londoner Studenten der Chirurgie Vorlesungen besuchen und mindestens sechs Monate lang im Krankenhaus arbeiten, bevor sie vom Royal College of Surgeons, dem Berufsverband der Chirurgen, ihre Approbation erhielten. Überall in der Hauptstadt entstanden Lehrkrankenhäuser, zuerst 1821 das Charing Cross Hospital, dann 1834 das University College Hospital und 1839 schließlich das King's College Hospital. Wer nach mehr strebte und Mitglied des Royal College of Surgeons werden wollte, musste sechs Jahre studieren ‒ davon drei an einem Krankenhaus ‒, mindestens sechs klinische Fallberichte vorweisen und eine außerordentlich anstrengende zweitägige Examensprüfung ablegen, zu der unter anderem anatomische Sektionen und das Operieren von Leichen gehörte.
So begann in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Entwicklung des Chirurgen vom schlecht ausgebildeten Handwerker zum modernen Facharzt. Als Professor für klinische Chirurgie an einem Londoner Lehrkrankenhaus war Robert Liston maßgeblich an diesem Professionalisierungsprozess beteiligt.
Mit seinen 1,88 Meter war Liston zwanzig Zentimeter größer als der britische Durchschnittsmann. Rohe Gewalt und Schnelligkeit waren sein Markenzeichen, beides unerlässlich, um in der damaligen Zeit die Überlebenschancen des Patienten zu erhöhen. Wer bei seinen Operationen zusah, lief Gefahr, das Entscheidende zu verpassen, wenn er nur einen winzigen Moment den Blick abwandte. Seine Kollegen sagten über seine Amputationen: »Dem Aufblitzen des Messers folgte so unverzüglich das Geräusch der Säge, dass es fast so schien, als geschähe beides gleichzeitig.« Angeblich hatte er so viel Kraft in der linken Hand, dass er sie als Tourniquet einsetzte, um das Blut zu stauen, während er mit der rechten Hand das Messer schwang. Das erforderte nicht nur Muskelkraft, sondern auch großes Geschick, da sich viele Patienten aus Angst vor den Schmerzen heftig gegen die Messerattacke des Chirurgen wehrten. Liston konnte ein Bein in weniger als dreißig Sekunden amputieren, und damit er bei der Arbeit beide Hände frei hatte, klemmte er sich das blutige Messer mit Vorliebe zwischen die Zähne.
Aber Listons Schnelligkeit war nicht immer ein Segen. Einmal schnitt er einem Patienten versehentlich nicht nur das Bein ab, sondern auch einen Hoden. Sein berühmtestes (allerdings nicht eindeutig belegtes) Missgeschick unterlief ihm, als er während einer Operation so rasant das Messer schwang, dass er seinem Assistenten drei Finger abtrennte und einem dabeistehenden Zuschauer den Rock aufschlitzte. Der unglückliche Zuschauer erlitt vor Ort einen tödlichen Schreck, Assistent und Patient starben später an Wundbrand. Es handelt sich um die einzige Operation in der Medizingeschichte mit einer Mortalität von dreihundert Prozent.
Bevor die Narkose Einzug in die Operationssäle hielt, waren die Möglichkeiten der Chirurgie aufgrund der Schmerzen und drohenden Schockreaktionen der Patienten stark begrenzt. Ein chirurgisches Lehrbuch aus dem 18. Jahrhundert drückte es so aus: »Schmerzhafte Maßnahmen sind für einen Mann, der sein Fach gründlich beherrscht, immer das letzte Mittel; doch sie sind das erste oder vielmehr das einzige Mittel desjenigen, dessen Wissen auf das Handwerk des Operierens beschränkt ist.« Wer gezwungen war, sich unters Messer zu legen, musste unvorstellbare Qualen erdulden.
Die grauenhaften Szenen, die sich im Operationssaal abspielten, waren auch für so manchen Studenten im Publikum zu viel. Der schottische Geburtshilfearzt James Young Simpson ergriff panisch die Flucht, als er während seines Studiums an der Universität Edinburgh bei einer Mastektomie zusah. Als das Weichgewebe mit einem hakenähnlichen Instrument angehoben wurde und der Chirurg sich anschickte, die Brust mit zwei schwungvollen Schnitten zu entfernen, hielt Simpson es nicht mehr aus. Er drängte sich durch die Menge, stürzte aus dem Saal und eilte vom Krankenhaus direkt zum Parliament Square, wo er atemlos verkündete, er wolle künftig Jura studieren. Zum Glück für die Nachwelt konnte Simpson ‒ der später die Chloroform-Anästhesie erfand ‒ von seinem Vorhaben abgebracht werden.
Liston wusste natürlich, was seine Patienten auf dem Operationstisch erwartete, doch er spielte die Schrecken oft herunter, um die Nerven der Gepeinigten zu schonen. Nur wenige Monate vor seinem Äther-Experiment lag der zwölfjährige Henry Pace auf Listons Tisch, dem aufgrund einer tuberkulösen Geschwulst im Knie das rechte Bein abgenommen werden musste. Als der Junge fragte, ob der Eingriff wehtun werde, antwortete Liston: »Nicht mehr als das Ziehen eines Zahns.« Am Tag der Amputation wurde Pace mit verbundenen Augen in den Saal gebracht und von Listons Assistenten festgehalten. Der Junge zählte sechs Streiche mit der Säge, bevor sein Bein abfiel. Das schreckliche Erlebnis war Pace zweifellos noch lebhaft in Erinnerung, als er die Geschichte sechzig Jahre später vor Medizinstudenten am University College London erzählte, demselben Krankenhaus, an dem er einst sein Bein verloren hatte.
Wie die meisten Chirurgen der Prä-Narkosezeit war Liston immun gegen das Protestgeschrei der an den blutbespritzten Operationstisch Gefesselten. Einmal nahm ein Patient, dem ein Blasenstein entfernt werden sollte, kurz vor dem Eingriff Reißaus und schloss sich im Waschraum ein. Liston rannte ihm hinterher, brach die Tür auf und zerrte den Schreienden zurück in den Operationssaal. Nachdem er den Mann an den Tisch fixiert hatte, führte er ihm ein gebogenes Metallrohr in den Penis ein und schob es durch die Harnröhre in die Blase. Dann drang er mit dem Finger ins Rektum ein und tastete nach dem Stein. Als er ihn gefunden hatte, zog sein Assistent das Metallrohr heraus und ersetzte es durch einen Holzstab. Dieser diente dem Chirurgen als Orientierungshilfe, damit er beim Schneiden in die Blase weder Rektum noch innere Organe verletzte. Als der Stab richtig positioniert war, schnitt Liston diagonal durch den Dammmuskel, bis er auf den Holzstab stieß. Dann dehnte er die Öffnung mit einer Sonde, wobei die Prostata aufriss. Der Holzstab wurde herausgezogen, und Liston holte den Stein mit einer Zange aus der Blase.
All das erledigte Liston, der den Beinamen »das schnellste Messer im West End« trug, in unter sechzig Sekunden.
*
Als Liston an diesem Tag kurz vor Weihnachten im neuen Operationssaal des University College London vor sein Publikum trat, hielt er einen Glaskolben mit der klaren Flüssigkeit hoch, die den Chirurgen möglicherweise vom Zwang des schnellen Operierens befreite. Wenn die Äthernarkose tatsächlich so wirksam war, wie die Amerikaner behaupteten, könnte das die Chirurgie von Grund auf verändern. Doch der Starchirurg war weiterhin skeptisch, ob es sich bei dem Wundermittel nicht wieder einmal um einen Schwindel handelte, der für die Chirurgie wenig oder gar keinen Nutzwert hatte.
Die Spannung war groß. Eine Viertelstunde vor Listons Auftritt hatte sich sein Kollege William Squire an die dicht gedrängte Zuschauermenge gewandt und um einen freiwilligen Probanden gebeten. Nervöses Getuschel machte sich breit. Squire hielt einen gläsernen Apparat mit Gummischlauch und glockenförmiger Maske in der Hand, der einer arabischen Wasserpfeife ähnelte. Das Gerät war eine Erfindung von Squires Onkel, einem Londoner Apotheker, und erst zwei Tage vorher erstmals von dem Zahnchirurgen James Robinson bei einer Zahnextraktion eingesetzt worden. Dem Publikum war das sonderbare Ding nicht geheuer. Niemand wollte das Versuchskaninchen spielen.
In seinem Zorn verdonnerte Squire den Saaldiener Shelldrake, sich als Demonstrationsobjekt zur Verfügung zu stellen. Shelldrake war kein geeigneter Kandidat, denn er war »fettleibig, rotgesichtig und seine Leber zweifellos gewöhnt an große Mengen starken Alkohols.« Vorsichtig legte Squire die Maske auf das fleischige Gesicht des Saaldieners. Nachdem Shelldrake ein paar Mal tief eingeatmet hatte, sprang er angeblich vom Tisch und stürmte unter wüsten Beschimpfungen von Arzt und Publikum aus dem Saal.
Damit war die Testphase beendet. Der unausweichliche Moment war gekommen.
Um fünf vor halb drei wurde Frederick Churchill, ein 36-jähriger Butler aus der Harley Street, auf einer Trage hereingebracht. Der junge Mann litt unter einer chronischen Osteomyelitis des Schienbeins, einer infektiösen Knochenentzündung, durch die sein rechtes Knie stark angeschwollen und deformiert war. Bei seiner ersten Operation drei Jahre zuvor hatte man den entzündeten Bereich aufgeschnitten und »mehrere unregelmäßig geformte, erbsen- bis saubohnengroße Fremdkörper« entfernt. Am 25. November 1846 war Churchill erneut ins Krankenhaus gekommen. Diesmal nahm Liston eine Inzision vor und führte eine Sonde in das Knie ein. Mit ungewaschenen Händen vergewisserte er sich, dass sich der Knochen nicht gelöst hatte. Er ließ die Wunde mit warmem Wasser auswaschen und verbinden und verordnete dem Patienten Bettruhe. Doch in den folgenden Tagen verschlechterte sich Churchills Zustand. Er verspürte einen stechenden Schmerz, der von der Hüfte bis in die Zehen ausstrahlte. Als der Schmerz nach drei Wochen erneut auftrat, beschloss Liston, das Bein abzunehmen.
Churchill wurde von der Trage auf den hölzernen Operationstisch gelegt. Zwei »kräftige Assistenten« standen bereit, um den Patienten während der Amputation festzuhalten, falls die Narkose fehlschlug. Squire trat auf Listons Zeichen vor und drückte Churchill die Äthermaske auf Mund und Nase. Nach wenigen Minuten war der Patient bewusstlos. Dann legte Squire ihm ein mit Äther getränktes Taschentuch über das Gesicht, damit er während der Operation nicht aufwachte. Er nickte Liston zu und sagte: »Das sollte genügen, Sir.«
Liston öffnete eine große Schatulle und holte ein gerades Amputationsmesser heraus, das er selbst entwickelt hatte. Ein Augenzeuge des Ereignisses schrieb, es habe sich augenscheinlich um eines seiner Lieblingsmesser gehandelt, denn an den vielen kleinen Kerben im Griff sei zu erkennen gewesen, dass er es bereits viele Male benutzt hatte. Der Chirurg vergewisserte sich mittels Daumenprobe, dass die Klinge scharf genug war, dann wies er seinen Assistenten William Cadge an, Churchills Puls zu kontrollieren, und wandte sich an sein Publikum.
»Und nun, meine Herren, messen Sie meine Zeit!«, rief er. Taschenuhren wurden gezückt, und Sprungdeckel klappten auf.
Liston wandte sich wieder dem Patienten zu. Mit der linken Hand packte er den Oberschenkel und führte einen blitzschnellen tiefen Schnitt oberhalb des rechten Knies aus. Sofort stoppte ein Assistent mit einem Tourniquet den Blutfluss. Liston schob mit bloßen Fingern den Hautlappen zurück und legte mit ein paar weiteren schnellen Schnitten den Oberschenkelknochen frei. Dann hielt er inne.
Viele Chirurgen schreckten beim Anblick des nackten Knochens davor zurück, zur Säge zu greifen. Noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts hatte der schottische Anatom Charles Bell seine Studenten dazu angehalten, die Säge langsam und mit Bedacht zu führen. Sogar Chirurgen, die im Umgang mit dem Messer wahre Meister waren, verließ bisweilen der Mut, wenn es so weit war, das betreffende Körperteil abzutrennen. 1823 schrieb der Chirurg Thomas Alcock: »[Die Menschheit] erschaudert bei dem Gedanken, dass Männer, die, abgesehen vom täglichen Umgang mit Messer und Gabel, über keinerlei Kenntnisse im Gebrauch von Werkzeug verfügen, sich anmaßen, mit ihren gottlosen Händen ihre leidenden Mitmenschen zu operieren.« Er gab die schaurige Geschichte eines Chirurgen wieder, dessen Säge sich so fest im Knochen des Patienten verkeilte, dass sie sich partout nicht mehr bewegen ließ. Um solche grauenhaften Situationen zu vermeiden, empfahl sein Zeitgenosse William Gibson allen Anfängern, an einem Stück Holz zu üben.
Liston reichte das Messer einem Assistenten und bekam dafür die Säge. Dann zog der Assistent die Haut- und Muskellappen hoch, die später zur Bildung eines belastbaren Beinstumpfes verwendet werden sollten. Der große Chirurg vollführte ein halbes Dutzend Streiche mit der Säge, dann fiel das Bein in die aufgehaltenen Hände des zweiten Assistenten, der es sofort in eine Kiste mit Sägespänen neben dem Operationstisch warf.
Der erste Assistent löste derweil kurz das Tourniquet, damit die durchtrennten Arterien sichtbar wurden, die noch verschlossen werden mussten. Bei einer Beinamputation oberhalb des Knies sind das in der Regel elf. Liston unterband die Arteria fermoralis mit einem Doppelknoten und kümmerte sich dann um die kleineren Blutgefäße, die er mit einem spitzen Haken, dem sogenannten Ternaculum, hervorzog. Zum Schluss vernähte er das restliche Gewebe, und das Tourniquet wurde endgültig gelöst.
Liston brauchte nur achtundzwanzig Sekunden, um Churchills Bein abzunehmen. Der betäubte Patient verhielt sich dabei völlig still und schrie nicht einmal auf. Als der junge Mann wenige Minuten später aus der Narkose erwachte, soll er sich erkundigt haben, wann denn endlich die Operation beginne. Die Antwort erübrigte sich, als er zur großen Belustigung des immer noch verblüfften Publikums seinen hochgelagerten Stumpf entdeckte. Ein strahlender Liston verkündete euphorisch: »Dieser Yankee-Trick, meine Herren, ist dem Mesmerismus haushoch überlegen.«
Das Zeitalter der Qualen neigte sich dem Ende zu.
*
Zwei Tage später las der Edinburgher Chirurg James Miller seinen Medizinstudenten einen Brief vor, in dem Liston begeistert von »dem neuen Licht« schwärmte, das plötzlich auf die Chirurgie gefallen sei. Chirurgen und prominente Persönlichkeiten strömten Anfang 1847 neugierig in die Operationssäle, darunter der Admiral Charles John Napier und Prinz Jérôme Bonaparte, der jüngste Bruder von Napoleon I. Alle wollten sich mit eigenen Augen von der Wunderwirkung des Äthers überzeugen.
Der Begriff »Ätherisierung« wurde geprägt, und ihr Gewinn für die Chirurgie wurde in ganz Großbritannien in der Presse gefeiert. »Nichts in der Geschichte der Medizin reicht an den Triumph heran, der durch den Einsatz von Äther erzielt wurde«, meldete die Exeter Flying Post. Das Londoner People's Journal jubelte: »Ach, welche Freude für jedes fühlende Herz […] von dieser edlen Erfindung zu erfahren, die es vermag, das Schmerzempfinden zu betäuben, und Auge und Erinnerung vor den Schrecknissen einer Operation bewahrt […] WIR HABEN DEN SCHMERZ BESIEGT!«
Aber Listons spektakuläres Ätherexperiment war an diesem 21. Dezember nicht das einzige Ereignis, das die Chirurgie revolutionieren sollte. Ebenso bedeutend war die Anwesenheit eines jungen Mannes namens Joseph Lister, der unauffällig hinten im Saal Platz genommen und die packende Vorstellung begeistert verfolgt hatte. Als der ehrgeizige Medizinstudent hinterher hinaus auf die Gower Street trat, erkannte er, dass sich sein künftiger Beruf für immer verändert hatte. Nie wieder würden er und seine Studienkollegen eine »so grauenvolle, erschütternde Szene« erleben wie der Medizinstudent William Wilde, der unfreiwillig mit ansah, wie einem Patienten ohne Betäubung das Auge herausgeschnitten wurde. Nie wieder würde jemand die Flucht ergreifen wie John Flint South, weil er das Geschrei der wehrlos dem Messer Ausgelieferten nicht ertrug.
Als Lister sich den Weg durch die Scharen von Männern bahnte, die sich zu ihrer Berufswahl und diesem denkwürdigen Sieg gratulierten, war ihm absolut bewusst, dass der Schmerz nur ein Hindernis für den Erfolg der Chirurgie darstellte.
Seit Jahrtausenden setzte die stets drohende Infektionsgefahr dem Behandlungsspektrum des Chirurgen enge Grenzen. So endete das Aufschneiden des Bauches für den Patienten fast immer tödlich. Dasselbe galt für das Öffnen des Brustkorbs. Während die anderen Ärzte innere Leiden behandelten ‒ daher der heute noch gebräuchliche Begriff »innere Medizin« ‒, kümmerten sich die Chirurgen hauptsächlich um äußere Leiden: Brüche, Hautgeschwüre, Verbrennungen, Wunden aller Art. Nur bei Amputationen drang das Messer des Chirurgen tief in den menschlichen Körper ein. Eine Operation zu überleben, war eine Sache. Wieder ganz gesund zu werden, eine völlig andere.
In den ersten beiden Jahrzehnten nach Einführung der Äthernarkose verschlechterten sich die Operationsergebnisse zunächst. Mit der Gewissheit, den Patienten operieren zu können, ohne ihm dabei Schmerzen zuzufügen, sank bei den Chirurgen die Hemmschwelle, zum Messer zu greifen, und die Zahl postoperativer Infektionen und septischer Schocks stieg rasant an. Je häufiger operiert wurde, desto schmutziger war es in den Operationssälen. Da man noch nicht wusste, wodurch Infektionen verursacht werden, wurden die Instrumente zwischen den Eingriffen nach wie vor weder gereinigt noch gewechselt. Dazu kam, dass immer mehr Zuschauer in die Operationssäle strömten, die nicht einmal die simpelsten Hygienevorschriften einhalten mussten. Viele, die unters Messer kamen, starben oder fristeten hinterher ein Invalidendasein. Dieses Problem betraf alle. Überall auf der Welt gerieten Patienten beim Wort »Krankenhaus« in Panik, und selbst die besten Chirurgen zweifelten an ihrem Können.
Mit seinem geglückten Ätherexperiment hatte Robert Liston das erste der beiden großen Hindernisse der Chirurgie beseitigt ‒ den Schmerz. Beflügelt von der grandiosen Vorstellung, der er an jenem Dezembernachmittag beigewohnt hatte, sollte sich der scharfsinnige Joseph Lister schon bald einem Vorhaben zuwenden, das schließlich zu seiner Lebensaufgabe wurde: die Ursachen postoperativer Infektionen zu ergründen und sie zu beseitigen. Und so kündigte sich im Schatten eines der letzten großen Schlächter seiner Zunft bereits die nächste chirurgische Revolution an.
1
Durch das Objektiv
Und nun wollen wir die weitere bedeutende Tatsache nicht übersehen, dass die Wissenschaft nicht nur der Bildhauerei, Malerei, Musik und Poesie zugrunde liegt, sondern dass die Wissenschaft selbst poetisch ist. […] Mit wissenschaftlichen Untersuchungen Beschäftigte zeigen uns beständig, dass sie nicht weniger lebhaft, sondern lebhafter als andere, die Poesie ihres Gebietes erfassen.
Herbert Spencer
*
Der kleine Joseph stellte sich auf die Zehenspitzen und spähte durch das Okular des neusten Mikroskops seines Vaters. Das wunderbare Gerät war überhaupt nicht zu vergleichen mit den kleinen Taschenmikroskopen, die so viele Touristen bei ihren Ausflügen ans Meer dabeihatten. Es war schön, elegant und leistungsstark: ein Symbol des wissenschaftlichen Fortschritts.
Als er zum ersten Mal durch ein Mikroskop blickte, staunte der kleine Lister über die neue, geheimnisvolle Welt, die sich vor seinen Augen auftat. Anscheinend konnte man mit dem Vergrößerungsglas unendlich viele Dinge studieren. Er war begeistert. Einmal fing er eine Garnele und betrachtete ehrfürchtig »das sehr schnell schlagende Herz« und die »pulsierende Aorta«. Er konnte sogar sehen, wie das Blut unter dem Außenskelett langsam durch das lange, röhrenförmige Herz und den Körper des zappelnden Tierchens floss.
Joseph Lister wurde am 5. April 1827 geboren. Anfangs wurde er nicht groß beachtet, doch als er sechs Monate alt war, schrieb seine Mutter in einem Brief an ihren Mann: »Das Baby war heute ungewöhnlich reizend.« Er war der zweitgeborene Sohn und das vierte von insgesamt sieben Kindern. Seine Eltern Joseph Jackson und Isabella Lister waren strenggläubige Quäker.
Lister hatte in seiner Kindheit reichlich Gelegenheit, mit dem Mikroskop Miniaturwelten zu erkunden. Quäker waren Anhänger des einfachen Lebens. Der kleine Lister durfte weder jagen noch Sport treiben noch ins Theater gehen. Das Leben war ein Geschenk, das dazu diente, Gott zu ehren und seinen Nächsten zu helfen. Es sollte nicht mit banalen Beschäftigungen verschwendet werden. Daher wandten sich zahlreiche Quäker der Wissenschaft zu, einem der wenigen Zeitvertreibe, die ihre Religion ihnen gestattete. In vielen Familien gab es einen Gebildeten, der große wissenschaftliche Leistungen erbrachte.
Listers Vater war dafür das beste Beispiel. Er verließ mit vierzehn die Schule und ging bei seinem Vater, einem Weinhändler, in die Lehre. Viele Quäker im viktorianischen England lebten abstinent, obwohl ihr Glaube dies nicht ausdrücklich verlangte. Als das jahrhundertealte Geschäft der Listers gegründet worden war, war das Trinken von Alkohol in der Quäkergemeinde noch durchaus üblich gewesen. Joseph Jackson Lister wurde schließlich Kompagnon seines Vaters. Weltweite Anerkennung erlangte er jedoch durch seine Erfindungen im Bereich der Optik. Sein Interesse für optische Phänomene war bereits in seiner Kindheit geweckt worden, als er im Arbeitszimmer seines Vaters einen Lufteinschluss in der Fensterscheibe entdeckte und feststellte, dass die Blase wie eine einfache Lupe funktionierte.
Anfang des 19. Jahrhunderts waren Mikroskope vor allem Spielzeuge für den wohlhabenden Gentleman und wurden in teuren, mit Samt ausgeschlagenen Schatullen verkauft. Manche Modelle waren auf einem Holzfuß mit Schubladen befestigt. Darin befanden sich zusätzliche Objektive und anderes Zubehör, das so gut wie niemand benutzte. Die meisten Hersteller lieferten ihren reichen Kunden fertig präparierte Objektträger mit Tierknochenstücken, Fischschuppen oder zarten Blüten. Kaum jemand kaufte sich damals ein Mikroskop, um ernsthafte wissenschaftliche Forschungen zu betreiben.
Joseph Jackson Lister war eine Ausnahme. Er liebte das Mikroskop und beschäftigte sich zwischen 1824 und 1843 intensiv damit, die technischen Mängel des Gerätes zu beheben. Die damals gebräuchlichen Linsen verursachten Verzerrungen, da sie Licht verschiedener Wellenlänge unterschiedlich stark brachen. Dadurch entstanden an den Objekträndern violette Farbsäume. Wegen dieses Halo-Effekts hielten viele Leute die mikroskopische Darstellung für einen Schwindel. Lister arbeitete fieberhaft daran, die störenden Farbsäume zu eliminieren, und präsentierte 1830 eine achromatische Linse, die den Abbildungsfehler korrigierte. Obwohl er weiterhin hauptberuflich als Weinhändler tätig war, fand er die Zeit, seine Linsen selbst zu schleifen und die Messwerte so präzise festzulegen, dass er sein Mikroskop bei einem der führenden Londoner Instrumentenmacher in die Herstellung geben konnte. 1832 wurde er für seine Verdienste in die Royal Society aufgenommen.
Im ersten Stock von Listers Elternhaus befand sich das »Museum«, ein Raum mit Hunderten Fossilien und anderen Schätzen, die alle möglichen Familienmitglieder im Lauf der Zeit zusammengetragen hatten. Alle Lister-Kinder mussten ihrem Vater vorlesen, während er sich morgens anzog. Die Bibliothek bestand aus religiösen und wissenschaftlichen Wälzern. Eines der ersten Geschenke, das Joseph von seinem Vater bekam, war Evenings at Home or, The Juvenile Budget Opened, ein vierbändiges Kinderbuch mit Fabeln, Märchen und naturkundlichen Beschreibungen.
Anders als viele seiner Zeitgenossen war Lister während seiner Kindheit so gut wie nie in ärztlicher Behandlung, denn sein Vater vertraute ganz auf die vis medicatrix naturae, die Heilkraft der Natur. Wie viele Quäker hielt er nichts von Ärzten und Medikamenten, sondern beharrte eisern darauf, dass die Vorsehung über den Genesungsprozess entschied. Die Verabreichung körperfremder Stoffe war seiner Meinung nach nicht nur überflüssig, sondern mitunter sogar lebensgefährlich. Da die meisten Arzneien damals hochgiftige Substanzen wie Heroin, Kokain oder Opium enthielten, lag Lister senior mit seinen Ansichten vielleicht gar nicht so falsch.
Entsprechend groß war die Überraschung, als der junge Lister seinen strenggläubigen Eltern mitteilte, er wolle Chirurg werden ‒ ein Beruf, bei dem man aktiv in die Schöpfung eingriff. Bis auf einen entfernten Cousin war niemand in der Familie Arzt. Dazu kam, dass die Chirurgie nicht nur in der Quäkergemeinschaft kaum Ansehen genoss. In der Gesellschaft galten Chirurgen als Handwerker, die ihren Lebensunterhalt mit körperlicher Arbeit verdienten, so ähnlich wie heute Schlosser oder Klempner. Ihre niedrige soziale Stellung zeigte sich unter anderem daran, dass sie in relativer Armut lebten. Bis 1848 beschäftigte keines der großen Krankenhäuser einen fest angestellten Chirurgen, und mit Privatpraxen ließ sich kaum Geld verdienen.
Aber natürlich machte sich der junge Lister noch keine Gedanken über Geld und gesellschaftliches Ansehen. Sein Interesse galt ganz anderen Dingen. Im Sommer 1841 schrieb der Vierzehnjährige an seinen Vater: »Als Mama nicht da war, war ich allein zu Hause und hatte nichts zu tun, als Skelette zu zeichnen.« Lister bat um einen Zobelhaarpinsel, damit er »einen Mann mit allen Muskeln« wiedergeben konnte. Er zeichnete und beschriftete jeden Schädelknochen und obendrein jeden Handknochen von der Vorder- und Rückseite. Wie sein Vater war Lister ein begabter Künstler ‒ ein Talent, das ihm später als Chirurg dabei half, seine mikroskopischen Beobachtungen mit verblüffender Genauigkeit festzuhalten.
Zu Listers Studienobjekten in diesem Sommer gehörte auch ein Schafskopf. In demselben Brief schrieb er: »Ich habe fast alles Fleisch abgelöst; ich muss wohl noch das Hirn entfernen … bevor ich ihn im Bottich mazeriere.« Damit wollte er das restliche Schädelgewebe aufweichen. Später setzte er das Skelett eines zuvor sezierten Frosches wieder zusammen und montierte es auf ein Holzstück, das er aus der Kommode seiner Schwester gestohlen hatte. Voller Begeisterung schrieb er seinem Vater: »Es sieht aus, als wolle er davonhüpfen«, und fügte verschwörerisch hinzu: »Bitte sag Mary nichts von dem Holzstück.«
So groß seine eigenen Vorbehalte gegen die Schulmedizin auch sein mochten, für Listers Vater stand fest, dass sein Sohn einmal Arzt werden würde.
*
Als Lister mit siebzehn sein Studium am University College London (UCL) aufnahm, begann für ihn ein völlig neues Leben. Sein Geburtsort Upton war eine Kleinstadt mit knapp dreizehntausend Einwohnern. Upton lag nur zehn Meilen östlich vom Londoner Zentrum, war aber nur auf unbefestigten, schlammigen Wegen zu erreichen. Ein Bach mit einer chinesischen Brücke floss durch den Garten der Listers, in dem Apfelbäume, Buchen, Ulmen und Kastanien standen. Sein Vater schrieb über den Blick aus seinem Arbeitszimmer: »Die milde Wärme und Stille, das Zwitschern der Vögel und das Summen der Insekten, das helle Grün des Rasens und der Aloen, das dunklere Grün der Zedern und darüber der blau und weiß marmorierte Himmel; all das verleitet zu untätigem Vergnügen, dem ich mich nicht hingeben darf.«
Verglichen mit den farbenfrohen, üppigen Gärten rund um das Upton House war London eine Sinfonie in Grau. Der Kunsthistoriker John Ruskin beschrieb die Stadt als »grauenerregende Anhäufung gärenden Mauerwerks, Gift strömend aus jeder Pore.« Der Abfall türmte sich vor den Häusern, die teils keine Türen mehr hatten, weil die Armen sie in den kalten Wintermonaten als Brennholz verfeuert hatten. Die Straßen und Gassen waren voll mit Pferdeäpfeln, denn Tag für Tag rumpelten Tausende Karren, Kutschen und Droschken durch die Stadt. Alles, von den Häusern bis zu den Menschen, war mit einer Rußschicht überzogen.
Zwischen Anfang und Ende des 19. Jahrhunderts wuchs die Einwohnerzahl Londons von einer Million auf über sechs Millionen. Die Reichen zogen aus der Stadt ins grüne Umland. Die leer stehenden prächtigen Häuser wurden in kleine Wohnungen aufgeteilt und an die Armen vermietet. Oft teilten sich dreißig oder mehr in schmutzige Lumpen gehüllte Leute aller Generationen ein einziges Zimmer. Dort mussten sie essen, schlafen und ihre Notdurft verrichten. Die Ärmsten hausten in fensterlosen Kellern, in die nie ein Lichtstrahl drang. Ratten nagten an den Fingern und Gesichtern unterernährter Kleinkinder, die zuhauf in diesen feuchten, stinkenden Kellerlöchern starben.
Der Tod war ein häufiger Gast bei Londons stetig wachsender Bevölkerung, und die Frage, wohin mit den Leichen, stellte ein immer größeres Problem dar. Die Kirchfriedhöfe quollen vor Toten über und waren eine ernsthafte Bedrohung für die öffentliche Gesundheit. Nicht selten ragten Gebeine aus frisch umgepflügter Erde. Aufgrund des Platzmangels mussten die Toten übereinander beerdigt werden. Viele Gräber waren offene Gruben, in denen sich reihenweise Särge stapelten. Angeblich waren Anfang des 19. Jahrhunderts zwei Männer nach dem Sturz in ein sechs Meter tiefes Massengrab an den ausströmenden Verwesungsgasen erstickt.
Für die Menschen in der Umgebung muss der Gestank unerträglich gewesen sein. Die Clement's Lane im Londoner Zentrum grenzte direkt an einen Friedhof, aus dessen Gräbern Faulschlamm sickerte. Der Verwesungsgeruch war so penetrant, dass die Anwohner das ganze Jahr über die Fenster geschlossen hielten. Ihre Kinder, die zur Sonntagsschule in die Enoch Chapel mussten, konnten dem ekelhaften Gestank nicht entfliehen. Während des Unterrichts schwirrten haufenweise Fliegen durch das Klassenzimmer, die eindeutig aus der Krypta kamen, wo zwölftausend Leichen vor sich hin faulten.
Auch die Entsorgung menschlicher Fäkalien war völlig unzureichend geregelt. Erst 1848 wurde im Rahmen eines neuen Gesetzes eine zentrale Gesundheitsbehörde geschaffen, und es wurden radikale Maßnahmen zur Hygieneverbesserung eingeleitet. Bis dahin waren weite Teile Londons eine offene Kloake, die riesige (und mitunter tödliche) Mengen an Methan freisetzte. Die primitiven Back-to-back-Reihenhäuser in den Arbeitersiedlungen waren nur durch enge, höchstens einen Meter fünfzig breite Durchgänge voneinander getrennt. In der Mitte verlief der Abwassergraben, in dem Urin und Fäkalien schwammen. Dass die Zahl der Wasserklosetts zwischen 1824 und 1844 deutlich zunahm, trug zwar zur Bequemlichkeit, aber nicht zur Lösung des Problems bei. Durch den gestiegenen Wasserverbrauch liefen nämlich die Sickergruben über, und so floss das Abwasser in die Kanalisation und von dort in die Themse. Die Hauseigentümer mussten extra Arbeitskräfte engagieren, um die Fäkalien aus den Sickergruben zu entfernen. Bald schon gab es eine ganze Armee von Leuten, die in den Abwasserkanälen und im Flussschlamm auf Beutesuche gingen. Diese Abfallsammler ‒ der Autor Steven Johnson bezeichnet sie als die ersten Müllrecycler der Geschichte ‒ stöberten zwischen Unrat, Fäkalien und Tierkadavern nach wiederverwertbaren Waren und verkauften ihre stinkenden Fundstücke auf dem Markt an Bauern und Handwerker.
Andere Berufe waren der Gesundheit auch nicht zuträglicher. Flecksieder, Abdecker, Schinder, Ausweider und Gerber gingen in einem der dichtbesiedeltsten Teile der Stadt ihrer stinkenden Tätigkeit nach. So gab es zum Beispiel in Smithfield ‒ nur ein paar Gehminuten von der St. Paul's Cathedral ‒ einen Schlachthof. Die Wände waren über und über mit Fett und geronnenem Blut beschmiert. Die Tiere wurden durch die Stadt auf das Gelände getrieben, abgestochen, gehäutet, ausgenommen und zerlegt. Nach der Schicht kehrten die Schlachthofarbeiter in ihrer verdreckten Arbeitskluft zurück in ihre Slumbehausungen.
Überall in der Großstadtwelt lauerten unsichtbare Gefahren. Sogar die grüne Farbe in den Blumentapeten der Reichen und im Blätterschmuck von Damenhüten enthielt tödliches Arsen. Alles war mit Giftstoffen belastet, von der täglichen Nahrung bis zum Trinkwasser. Als Lister ans UCL kam, erstickte London an seinem eigenen Dreck.
Trotz dieser verheerenden Zustände taten die Londoner viel, um ihre Stadt zu verschönern. Bloomsbury, der Stadtteil, in dem Lister studierte, war zum Beispiel proper wie ein frisch gebadetes Baby. Das Viertel befand sich in stetigem Wandel und veränderte innerhalb weniger Jahrzehnte so grundlegend sein Gesicht, dass frühere Bewohner es kaum wiedererkannt hätten. Als der junge Arzt Peter Mark Roget ‒ der später den berühmten Roget's Thesaurus herausgab ‒ 1800 in die Great Russell Street 46 zog, schrieb er begeistert von der »reinen Luft« und den parkähnlichen Gärten. 1823 begann der Architekt Robert Smirke in Rogets Wohnstraße mit dem Bau des neuen Britischen Museums. Über zwanzig Jahre lang wurde gemeißelt, gehämmert und gesägt, bis das imposante neoklassizistische Gebäude fertiggestellt war. Mit der beschaulichen Ruhe, die Roget in Bloomsbury so geschätzt hatte, war es vorbei.
Die Universität war Teil dieser Stadtentwicklung. An einem lauen Juniabend 1825 saß der künftige Lord Chancellor Henry Brougham mit einigen fortschrittlich gesinnten Parlamentsmitgliedern im Wirtshaus Town and Anchor an der Themse. Dort beschlossen sie eine Universität zu gründen, an der absolute Religionsfreiheit herrschte. Tatsächlich war das UCL das erste College in Großbritannien, dessen Studenten nicht zum täglichen Besuch des anglikanischen Gottesdienstes verpflichtet waren ‒ ein Umstand, der Lister ausgesprochen zusagte. Später beschimpften die Studenten vom rivalisierenden King's College ihre Kollegen vom UCL als »gottlosen Abschaum aus der Gower Street«.
Der Lehrplan des UCL sollte genauso fortschrittlich sein wie seine weltliche Ausrichtung, entschieden die Gründer. Neben den klassischen Studienfächern, die in Oxford und Cambridge gelehrt wurden, wollte man auch moderne Fächer wie Geographie, Architektur und neuzeitliche Geschichte anbieten. Auch die Gründung einer medizinischen Fakultät war vorgesehen.
Das Vorhaben, in London eine Universität zu gründen, stieß vielerorts auf Kritik. Die satirische Sonntagszeitung John Bull äußerte ihre Zweifel, ob die lärmende Großstadt der richtige Ort für die Ausbildung von Großbritanniens Jugend sei. In seinem typischen sarkastischen Ton witzelte das Blatt: »Die Tugendhaftigkeit Londons, die Stille und die gute Luft machen die Hauptstadt in unseren Augen zum idealen Ausbildungsort.« Als Universitätsstandort schlug der Autor des Artikels spöttisch Tothill Fields vor, ein berüchtigtes Elendsviertel unweit der Westminster Abbey. Des Weiteren regte er an: »Um die Bedenken zu zerstreuen, die manche Familienoberhäupter dagegen vorbringen könnten, dass man ihre Söhne den lauernden Gefahren in überfüllten Straßen aussetzt, empfehlen wir, eine große Zahl einfacher, ehrbarer Frauen in mittleren Jahren einzustellen, welche die Studenten täglich in der Frühe zum College begleiten und des Abends wieder abholen.« Aber alle Einwände und Proteste blieben vergeblich. Das UCL wurde gebaut und nahm zum Wintertrimester 1828 den Studienbetrieb auf. Sechs Jahre später wurde die medizinische Fakultät eingeweiht, die gegenüber den Konkurrenzuniversitäten Oxford und Cambridge mit einem eigenen Lehrkrankenhaus punkten konnte.
*
Das UCL stand noch ganz am Anfang, als Joseph Lister 1844 nach London kam. Es gab nur drei Fakultäten: klassische Geisteswissenschaften, Medizin und Jura. Auf den Wunsch seines Vaters hin schrieb sich Lister zunächst für ein geisteswissenschaftliches Studium ein. Dieses bestand in Anlehnung an die Sieben Freien Künste der Antike aus den Fächern Geschichte, alte Sprachen, Mathematik und Naturwissenschaften. Das war ein eigenwilliger Schritt für einen zukünftigen Chirurgen. Die meisten seiner Zeitgenossen ersparten sich diesen Umweg und stürzten sich gleich ins Medizinstudium. Jahre später führte Lister seine Gabe, trockene Theorie in medizinische Praxis umzusetzen, auf seine umfassende Allgemeinbildung zurück.
Mit seinen knapp 1,80 Meter überragte Lister die meisten seiner Kommilitonen. Seine imposante Gestalt und seine anmutigen Bewegungen sorgten für Eindruck in seinem Bekanntenkreis. Mit seiner geraden Nase, den vollen Lippen und dem braunen gewellten Haar entsprach der junge Lister ganz dem klassischen Bild von einem schönen Mann. Er war ein unruhiger Geist, und in Gesellschaft anderer war er besonders nervös. Hector Charles Cameron ‒ Listers Biograf und späterer Freund ‒ schrieb über seine erste Begegnung mit dem künftigen Chirurgen: »Als ich den Salon betrat, stand Lister, in der Hand eine Teetasse, mit dem Rücken zum Kamin. Soweit ich mich erinnere, habe ich ihn bei unseren Begegnungen fast immer stehend erlebt. […] Sehr selten nur setzte er sich für ein paar Minuten, und sobald das Gespräch eine neue Wendung nahm, sprang er wieder auf.«
Listers Gedanken standen nie still. Wenn er aufgeregt oder verlegen war, zuckten seine Mundwinkel, und das Stottern, das ihn in früher Kindheit gequält hatte, kehrte zurück. Trotz seiner inneren Unruhe beschrieb ihn sein Student Dr. John Stewart viele Jahre später als »außerordentlich sanftmütig, ja beinahe schüchtern.« Ein Freund schrieb über ihn: »Er lebte in seiner eigenen Gedankenwelt, bescheiden, taktvoll, zurückhaltend.«
Lister war ein ernster, besonnener Mensch, nicht zuletzt aufgrund seiner strengen Erziehung. Seine Religion schrieb ihm vor, sich stets unauffällig zu kleiden und andere mit den altmodischen Pronomen »thou« und »thee« anzureden. Seine Kindheit war geprägt von Männern in schwarzen Gehröcken und mit breitkrempigen Hüten, die nicht einmal während des Gottesdienstes abgelegt wurden. Die Frauen trugen einfache Kleider mit gefalteten Halstüchern und schlichten Schals. Als Kopfbedeckung diente ihnen die sogenannte Schute, eine Haube aus weißem Musselin. In seinem schlichten, gedeckten Aufzug stach Lister zwischen seinen modisch gekleideten Kommilitonen ganz sicher genauso heraus wie durch seine Körpergröße.
Kurz nach seiner Ankunft in London zog Lister in die London Street 28 in unmittelbarer Nähe des UCL. Er teilte sich die Wohnung mit dem acht Jahre älteren Edward Palmer, der wie Lister Quäker war. Palmer, ein »Mann mit bescheidenen Mitteln, aber aufrichtiger Leidenschaft für den Beruf des Chirurgen«, war einer von Robert Listons Assistenten. Die beiden freundeten sich schnell an. Lister hatte es Palmers Beziehungen zu verdanken, dass er am 21. Dezember 1846 bei Listons historischem Experiment dabei sein durfte. Man kann jedoch davon ausgehen, dass dies nicht sein erster Besuch einer medizinischen Lehrveranstaltung war: Der große Liston hätte an jenem Nachmittag ganz sicher keinen völlig fremden Studenten in den Saal gelassen. Tatsächlich begann Lister sein Anatomiestudium schon mehrere Monate vor seinem Examen in Geisteswissenschaften. In seinem Haushaltsbuch notierte er im letzten Quartal des Jahres Ausgaben für »Pinzetten und den Messerschleifer« sowie die Zahlung von elf Shilling an einen geheimnisvollen »U. L.«, von dem er ein Körperteil zum Sezieren erwarb. Es war nicht zu übersehen, dass er förmlich darauf brannte, endlich mit dem Medizinstudium zu beginnen.