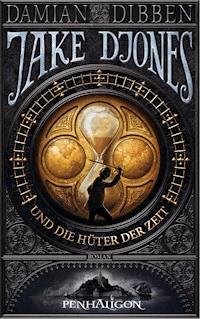18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
»Eine Winternacht in Venedig im Jahr 1815. Ein 217 Jahre alter Hund, der auf sein Herrchen wartet …« So beginnt die Geschichte von Tomorrow, einem Hund, der an den Königshöfen und auf den Schlachtfeldern Europas nach dem Mann sucht, dem er einst gehörte und der ihn unsterblich machte. Sein abenteuerlicher Weg führt ihn vom großen Frostjahrmarkt in London im Jahre 1608 bis an den Hof des Sonnenkönigs in Versailles, vom goldenen Zeitalter Amsterdams bis ins Venedig des neunzehnten Jahrhunderts. Valentyne, kultivierter Gentleman und gefragter Arzt und Alchimist seiner Zeit, besitzt das Wundermittel Jyhr, welches Unsterblichkeit verleihen kann. Als er eines Tages an den Stufen der gerade eingeweihten Kirche Santa Maria della Salute spurlos verschwindet, wartet sein treuer Hund vergeblich auf ihn. Tomorrow trifft auf Menschen und Tiere, die ihm freundschaftlich begegnen, er verliebt sich (nur einmal in seinem Leben), bewundert die Menschen für ihre Fähigkeit zur Musik und verzweifelt an ihrem Drang, Kriege zu führen. Er begegnet Gondolieri, Soldaten, Glasbläsern und Herzoginnen und gewinnt tiefe Einblicke in die Stärken und Schwächen der menschlichen Seele. Doch die Suche nach Valentyne ist auch ein Wettlauf gegen die Zeit: Tomorrow muss seinen Herrn finden, bevor dessen alter Feind Vilder ihn aufspürt und für immer vernichtet. Denn Valentyne und Vilder verbindet ein düsteres Geheimnis ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
© 2018 by Damian Dibben
Die Originalausgabe erschien bei Michael Joseph/Penguin Random House UK Titel der englischen Originalausgabe: Tomorrow
Aus dem Englischen übersetzt von Karl-Heinz Ebnet
© 2020 für die deutschsprachige Ausgabe:
Thiele Verlag in der Thiele & Brandstätter Verlag GmbH, Wien Umschlaggestaltung: Christina Krutz, Biebesheim am Rhein
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
www.thiele-verlag.com
Inhalt
Cover & Impressum
WIDMUNG
NACHER
VORHER
PROLOG
I
II
MORGEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
DANK
Für Ali & Dudley,wen sonst,meine ständigen Gefährten
NACHER
1603 ~ König James I. besteigt den englischen Thron.
1606 ~ William Shakespeare schreibt Antonius und Cleopatra sowie Macbeth.
1608 ~ Frostjahrmarkt in London.
1616 ~ Galileo Galilei verkündet, dass die Erde nicht im Mittelpunkt des Universums steht.
1618 ~ Beginn des Dreißigjährigen Krieges.
1620 ~ Mit dem Aufstieg Amsterdams beginnt das Goldene Zeitalter der Niederlande.
1631 ~ Belagerung von Magdeburg.
1638 ~ Der zukünftige Sonnenkönig, Louis XIV., wird in Saint-Germain-en-Laye geboren.
1642 ~ Ausbruch des Bürgerkriegs in England, der königliche Hof zieht nach Oxford.
1649 ~ König Charles I. wird vor dem Banqueting House in London enthauptet.
1673 ~ Molière stirbt auf der Bühne bei einer Aufführung von Der eingebildete Kranke.
1687 ~ Die Kirche Santa Maria della Salute in Venedig wird nach fünfzigjähriger Bauzeit eingeweiht.
1769 ~ Der elfjährige Wolfgang Amadeus Mozart bereist Italien.
1797 ~ Napoleons Truppen besetzen Venedig, die Adelsrepublik löst sich auf.
1815 ~ Die Briten und ihre Verbündeten besiegen Napoleon in der Schlacht bei Waterloo.
1833 ~ Mit dem Slavery Abolition Act wird im Britischen Empire die Sklaverei abgeschafft.
VORHER
1337 ~ Der italienische Gelehrte Francesco Petrarca prägt für die zurückliegenden 800 Jahre den Begriff »dunkles Zeitalter« und spricht vom Heraufziehen einer neuen Epoche.
1347 ~ Fast die Hälfte der europäischen Bevölkerung stirbt an der Pest.
1418 ~ Filippo Brunelleschi entwirft die achteckige Kuppel des Doms in Florenz.
1423 ~ Masolinas und Masaccios Madonna mit der heiligen Anna kündet von einem neuen »realistischen« Stil in der Malerei.
1439 ~ Johannes Gutenberg erfindet den Buchdruck mit beweglichen Lettern und leitet die Massenproduktion von Büchern ein.
1453 ~ Aufgrund der Eroberung Konstantinopels wandern viele Gelehrte nach Italien aus.
1486 ~ Leonardo da Vinci erhält den Auftrag für Das Abendmahl.
1492 ~ Christoph Kolumbus landet in Amerika.
1496 ~ Giovanni Bellini verewigt in seinem Gemälde Prozession auf dem Markusplatz den gleichnamigen Platz in Venedig.
1543 ~ Nikolaus Kopernikus veröffentlicht De revolutionibus orbium coelestium (Über die Umschwünge der himmlischen Kreise) und befördert damit das naturwissenschaftliche Denken.
1580 ~ Erste Weltumsegelung durch Sir Francis Drake.
1599 ~ William Shakespeare schreibt Hamlet.
1603 ~ James I. besteigt den englischen Thron …
PROLOG
I
Schloss Helsingör, Dänemark, 1602
Sie begann ganz gewöhnlich, diese etliche Lebensalter umspannende Reise: Wir beide machten uns auf den Weg, um an der Küste nach Austern zu suchen. Mein Herr schätzte Austern mehr als alles andere, und er schätzte das Ritual – das Aufbrechen der rauen Schale, um an das wertvolle Innere zu gelangen, an den glatten Alabaster und die nahezu substanzlose Flüssigkeit. Und wenn er die Austern genüsslich ausschlürfte, veränderte sich seine Haltung von Grund auf: Seine Schultern entspannten sich, die Falten auf seiner Stirn glätteten sich, und sein Blick wurde so sanft, dass ihm manchmal sogar Tränen in die Augen traten.
»Heute Nachmittag sollte uns das Glück doch hold sein«, sagte er und schlüpfte in seine Stiefel. »Es ist Ebbe, das Wasser steht so niedrig, dass wir fast nach Schweden laufen könnten.« Er nahm seinen Umhang, schüttelte ihn kurz aus, verknotete ihn am Hals und warf ihn sich über die Schultern. »Und ich hab so ein Gefühl …« Er entriegelte die Tür und stieß sie auf. »Ja, das Licht ist noch gut.« Als er bemerkte, dass ich nicht hinterherkam, blieb er stehen, drehte sich um und neigte den Kopf zur Seite, eine fragende Silhouette in der Tür. »Wo bleibst du denn, mein Bester?« Selbst jetzt noch bricht mir das Herz, wenn ich nur an den Klang seiner Stimme denke, die so tief und sanft war wie ein Gebirgsbach im Wald.
Ich blieb im Schatten, halb verborgen hinter dem Balusterbein des Tischs im großen Saal. Leicht könnte man meinen – jetzt, Jahrhunderte später und einen halben Kontinent entfernt –, dass mich eine böse Vorahnung beschlich, die schreckliche Befürchtung, dass wir etwas Unheimliches unten im Schlick finden sollten, doch dem war nicht so. Auch waren es weder Unverfrorenheit noch Sturheit, die mich zurückhielten – beides sollte ich mir erst später zu eigen machen. Nein, meine Gründe waren weniger bemerkenswert. Wir waren bereits am Morgen unterwegs gewesen, und bald würde der Abend hereinbrechen. Es war längstens an der Zeit, ein Feuer im eichengetäfelten großen Saal oder in der Schlossbibliothek zu entfachen, vor dem ich mich niederlassen und mir das Fell wärmen konnte, während er seine Bücher wälzte und vor sich hinmurmelte.
Er entdeckte mich im Dunkel, und seine Augenwinkel kräuselten sich zu einem Lächeln. »Na, was ist das denn?« Er ging vor mir in die Hocke, kraulte mir den Nacken und ließ mich vor Beschämung erzittern. »Wohin soll das Leben uns denn führen, wenn wir uns unter Tischen verkriechen? Die Welt draußen, da werden wir unsere Antworten finden. Und Wonne. Und Austern, mein Bester.« Er lachte, erhob sich, machte auf dem Absatz kehrt, und diesmal ging ich mit.
Draußen kehrten die Lebensgeister wieder. Ein warmer Wind trug die Gerüche vom Landesinneren heran, von süßen Fichten, von Wimpernfarn und Thymian, und ich erkannte nun doch, dass es noch lange hin war bis zur Abenddämmerung: Die wohlgesonnene rosafarbene Sonne hatte sich erst halb zum Horizont hin gesenkt. Ich besah mir das alles, hatte den Hals gestreckt, die Ohren gespitzt, überblickte die Küste von den Schlossmauern bis zur offenen See. Zu der Zeit kannte ich nichts als die kleine Stadt Helsingör und ihr Schloss. Ich wusste nicht, dass mir das Dasein eines Wanderers bestimmt sein sollte, dass ich unaufhörlich von einem Palast zum anderen reisen würde und von einem Schlachtfeld zum nächsten. An jenem Nachmittag aber, erinnere ich mich, war ich dankbar für mein Los: für mein Zuhause, meinen Gefährten, mein glückliches Leben.
Er spürte meinen Stimmungswandel und lachte wieder. »So, kommst du also doch mit, mein empfindsamer Freund.« Er griff sich einen Kübel, schüttete das Regenwasser aus, und Seite an Seite gingen wir die Steintreppe zur Küste hinunter. »Schau, mein Bester, das Meer hat sich gänzlich zurückgezogen! Wie nett von ihm, uns seine Beute preiszugeben.« Vor uns erstreckte sich eine endlose Fläche silbrig schimmernden feuchten Sandes, der sich in einem diffusen Horizont verlor.
Sofort stieß er auf eine Ansammlung von Austern, kauerte sich hin, nahm ein Messer aus der Tasche und stemmte eine der Schalen frei. Er wog sie in der Hand, untersuchte sie von allen Seiten und runzelte vielsagend die Stirn. »Ist die für unseren Geschmack nicht etwas zu verzagt? Oder sind wir nur zu grob für sie?« Er hielt sie mir hin. Ich machte mir damals so wenig aus Austern wie heute – ihr Salzgeruch setzte sich mir aufdringlich in die Nase –, aber aus Höflichkeit strich ich mit der Schnauze über die Schale, was ihn erneut zum Glucksen brachte. »Ich stimme dir aus ganzem Herzen zu. Ein junges Dingelchen. Wir geben sie am besten ihrer Familie zurück und wünschen ihr viel Glück. Also weiter. Suchen wir uns kühnere, salzigere Exemplare, die uns eher munden.«
Wir entfernten uns immer mehr vom Strand. Der Sand wurde steiniger, kälter und nasser, grobem Mörtel nicht unähnlich. Und auch das Wetter änderte sich. Eine kühlere Brise wehte von Norden heran. Sie schien die Sonne aller Farbe zu berauben, und auch den Himmel, der mit einem Mal so grau war wie der Schlick und ohne jede Tiefe. Als würden wir eine grenzenlose Landschaft durchwandern, zwei Gestalten auf einer Opernbühne – auch diese sollte ich später in meinem Leben kennenlernen –, in einer anderen, künstlichen Welt mit dramatisch verkürzter Perspektive.
Als mein Herr die größeren Austern entdeckt hatte und damit begann, sie vom Untergrund zu lösen und in den Kübel zu geben, war meine Stimmung erneut umgeschlagen. Ich sah zurück zum Schloss. Es verströmte etwas Bedrückendes, Erstarrtes. Mit Ausnahme unserer Räume nahe der Küche waren alle Fenster dunkel. Der größte Teil der königlichen Gesellschaft war vor Anbruch des Winters abgereist. Obwohl mich mein Herr von den anderen Bewohnern des Schlosses meist ferngehalten hatte, weil mein Benehmen noch sehr welpenhaft gewesen war, so hatte ich das prächtige Schauspiel im Gebäude, die Zubereitung der Speisen, die spielenden Kinder, das Gewese der Aufwärter und Kammerdiener, die Klänge der Lauten, der Cembali und das Gelächter doch sehr genossen. Neben der alten Königin – zu deren Aufwartung mein Herr noch hier war, für den Fall, dass sie krank werden sollte – war nur die mürrischste Dienerschaft geblieben: ungesellige Wachleute, auf ewig von windgeblähten Tüchern verdeckte Waschweiber und Nachtwärter mit schweren Schlüsseln. Ich wandte mich wieder zu meinem Herrn hin, hoffte, er wäre fertig, doch er hatte sich erhoben, stand konzentriert und aufrecht, mit seitlich von sich gestreckten Armen; der Kübel war zu Boden gefallen.
»Schh«, sagte er, als ich zu ihm trottete, und das in so scharfem Ton, dass ich die Ohren anlegte und mich schon fragte, ob ich etwas falsch gemacht hatte. Aber sein Blick war auf eine kleine felsige Untiefe in einiger Entfernung vom Strand gerichtet. Gewöhnlich war sie vom Wasser überspült, die Ebbe jedoch hatte ihre Fundamente freigelegt. Als eine Windbö darüberstrich, blähte sich einer der felsigen Zacken zu einem länglichen Halbmond, bevor er wieder in seine vorherige Gestalt zusammenfiel. Verwundert sah ich zu meinem Herrn auf, aber er ließ sich weder zu einer Erklärung noch zu einer Beschwichtigung herab. Sein Blick blieb starr in die Ferne gerichtet. Der pfeifende Wind rührte schaurige, über uns hinwegtanzende Sandgespenster auf. Erneut hob sich die Felsseite, doch diesmal erkannte ich, dass es etwas dahinter sein musste, was sich bewegte: das Segel eines Bootes.
»Wer ist das? Wer ist dort?«, rief mein Herr mit strenger Stimme, worauf ich bellend mit einfiel. Er nahm meine Schnauze fest in seine Hände. »Kein Ton von dir, hörst du? Nicht ein Ton.« Dann marschierte er los, näherte sich vorsichtig der Stelle, bis wir das Wrack vor uns sahen: ein kleines, auf Grund gelaufenes Gefährt, ein Segel war zwischen Bugspriet und Heck gespannt, im Rumpf klaffte ein breiter Spalt. Eine dritte, schwerere Bö strich jetzt über das Wrack hinweg und trug diesmal auch einen Geruch heran, beißenden Ammoniakgestank, der mir in der Nase brannte.
Zwei Kisten lagen umgedreht im Sand, eine unbeschädigt, die andere aufgebrochen, bunt schimmernde Glasphiolen waren herausgefallen. Mein Herr richtete die unbeschädigte Kiste auf, wischte den Schlamm vom Wappen an der Vorderseite und fuhr überrascht zurück. »Von Opalheim.« Er wandte sich an mich. »Von Opalheim also«, murmelte er wieder. Diesen Namen sollte ich in den folgenden Jahren noch häufig hören, und immer schien er ein glorreiches, nichtsdestotrotz verhängnisvolles Ende heraufzubeschwören. Das Wappen zeigte drei bezinnte Türme unter einer Mondsichel. Die Hand meines Herrn fuhr über die Phiolen, aber er hob keine von ihnen auf. Sie glichen exakt jenen in seinem Arbeitszimmer, in denen er Pulver und Metalle aufbewahrte.
»Wer ist da, sag ich?!« Erneut ertönte seine Stimme, mit der er sich, wie ich später erfahren sollte, in den Schlachten verständlich machte, aber als Antwort kam nur das Knarren der Taue, das Knattern des Segels und unverkennbarer Verwesungsgestank. Damals war mir solch ein Geruch höchstens von einer toten Möwe oder Ratte vertraut, aber nie hatte ich ihn so durchdringend erlebt wie in diesem Augenblick. Meinem Herrn musste er ebenfalls aufgefallen sein, denn seine Hände zitterten, und er sonderte schwachen Adrenalingeruch ab, den Duft der Angst. Wir umrundeten das Boot und entdeckten den Toten schließlich auf der anderen Seite. Seine Beine hatten sich in einem Seil verfangen und waren zum Mast hinaufgezogen worden, während Kopf und Oberkörper halb im Schlick steckten. Mit jeder ächzenden Bewegung des Schiffes wurde auch der Leichnam mitgezerrt. Mein Herr fuhr sich mit der Hand über die Wange und kratzte sich. »Mein Bester, was tun wir denn nun?« Und leise, fast kleinlaut und mit einem Unterton der Hoffnung, wie mir schien, stellte er dem Leichnam die Frage: »So bist du nun tot, oder?«
Er riss sich zusammen, streckte die Schultern durch, ging zu dem Toten und drehte ihn auf den Rücken. Sofort glätteten sich die Falten in seinem Gesicht, die Angst schwand aus seinem Blick, nur vermochte ich nicht zu sagen, ob aus Erleichterung oder Enttäuschung. »Ein Kurier«, sagte er dann. »Als ich das Intaglio sah, die drei Türme, hab ich gedacht … aber es ist nur ein Kurier. Der Arme. Ertrunken. Ein Kurier, der mir meine Habe brachte, nicht mehr. Es ist so lange her, dass ich danach verlangt habe. Ich hatte es schon vergessen.« Wieder dieses seltsame Lachen. »Der Sturm, du erinnerst dich? Wann war das? Vor einer Woche? Nur ein Bote, der mir meine Materialien bringen wollte, der Arme.«
Aus der Nähe drohte der Gestank mich zu ersticken. Der Leichnam war grotesk verzerrt, Oberkörper und Gesicht waren aufgebläht, die Haut von Venen marmoriert. Die Zunge stand als Kohlenkiesel aus dem knochenweißen Mund, die Augen waren nur noch blassgraues Glas.
»Was sollen wir mit ihm machen?«, fragte mein Herr. Er sah zu den Wellen, die sich um uns brachen. »Wenn ich ihn ins Wasser hinausziehe, spült die Flut ihn wieder an Land. Das ist kein Ende für einen Menschen. Nicht für einen guten Menschen.« Nach seinem kurzen Angstanfall war er jetzt wieder so, wie ich ihn kannte, ein durch und durch praktischer Mensch. »Ich werde es wie die Römer machen.« Er warf einen Blick zur Sonne, die schon im Niedergehen begriffen war. »Schnell, mein Bester, es wird bald dunkel.«
Er eilte zum Schloss zurück, ich aber verharrte einen Moment so fasziniert wie angewidert vor dem Toten. Er lebte nicht im buchstäblichen Sinn des Wortes, er atmete nicht mehr, trotzdem schien er mit größerer Intensität zu existieren als die Menschen, die mir bislang untergekommen waren. Vielleicht, weil der Verfall die virulenteste Lebensform ist, vielleicht, weil nichts mehr vom Phänomen des Daseins kündet als dessen Abwesenheit.
»Komm jetzt!« Die Stimme meines Herrn wurde vom Wind verzerrt. Er war schon halb am Schloss, der Umhang flatterte hin und her, während er den Felsen auswich. Ich sprang auf und folgte ihm.
Er stieß das Tor mit der Schulter auf und ließ mich als Erstes ein. »Du wartest hier auf mich, verstanden?« Ich gehorchte, widerwillig, blieb in der unbeleuchteten Halle, während er durch den Gang eilte. Der Boden war eiskalt, so kauerte ich mich unwillig hin und spitzte die Ohren beim Klirren des Metalls und dem Knarren des Holzes, das aus der Stiefelkammer drang. Mein Herr kehrte mit einem schweren Krug und einer Zunderbüchse zurück, und als er an mir vorbeiging, fing ich den Geruch von Lampenöl und Talg ein. »Du wartest. Ich komme gleich wieder.« Damit schlug er die Tür zu.
Mir wurde übel. Erneut entfernten sich seine Schritte zum Strand. In der Eingangshalle wurde es dunkel, ich trottete im Kreis, erst in die eine, dann in die andere Richtung, und versicherte mir, dass es keinen Grund zur Sorge gebe, dass mein Herr bald nach Hause kommen und alles gut sein werde – dennoch nahm meine Furcht zu. Ich warf einen Blick zur Statue am Treppenaufgang, einer Skulptur, mit der er manchmal redete, einem alten, traurig dreinblickenden Jagdhund aus Marmor, der den Kopf verdreht hielt und zu einem zerlumpten, sich von hinten nähernden Mann blickte. »Guten Morgen, Argos«, sagte mein Herr, wenn er vor der Statue stehen blieb, und dann streichelte er den Kopf des Hundes. »Wie geduldig du auf seine Rückkehr gewartet hast.«
Ich musste sehen, was mein Herr tat, also schlich ich durch die Seitentür in den Hauptbereich des Schlosses und ging über die Treppe hinauf in die lange Galerie. Ich hatte sie einmal besichtigt, im Sommer, als es im Gebäude von Menschen nur so gewimmelt hatte. Jetzt waren nur noch Statuen hier. Ich sprang auf einen Stuhl, stützte mich aufs Fensterbrett und sah hinaus aufs Meer. In der Ferne schnitt der Schatten meines Herrn durch die glitzernde Schlickfläche. An der felsigen Untiefe machte er sich an dem Boot zu schaffen, bis kurz darauf ein goldenes Licht aufflammte. Die Glasscheiben der Fensterflügel schimmerten in seinem Schein. Er verbrannte den Leichnam. Ich erinnere mich – als wäre es gestern gewesen –, wie sich mir der Magen zusammenzog, als die Flammen hoch aufloderten.
Mein Herr blieb, wartete pflichtschuldig, bis das Feuer heruntergebrannt war, bevor er wieder zurückkam. Ich sprang auf den Boden und betrachtete die versammelten Skulpturen: einen vollbärtigen Koloss im Ringkampf mit einem Seeungeheuer, eine auf einer Chaiselongue hingestreckte junge Dame mit einer Leier in der Hand, einen alten Gelehrten, der drohend ein aufgeschlagenes Buch schwang. Die nächtlichen Schatten, die sich über ihre Konturen legten, ließen sie auf grausige Art lebendig erscheinen. Und dann gab es noch die Gemälde, täuschend echte Darstellungen von Menschen, auf Leinwand platzierte Trugbilder aus Farbpigmenten: einen edlen Herrn in pelzbesetztem Mantel mit einem Falken auf dem Unterarm, ein altes Weib in einem enggeschnürten karmesinroten Kleid, einen jungen, schwarzgewandeten Stutzer mit einem Totenschädel in der Hand. In jener Zeit stand es mir erst bevor, fremde Länder zu bereisen, die Erhabenheit und die Schrecken der Städte zu erfahren, den Krieg aus erster Hand zu erleben – den durchdringenden Geruch von heißem Metall und kupfernem Blut aufzusaugen –, oder zu lernen, was es heißt, einen geliebten Freund zu verlieren. Noch stand es mir bevor, zu entdecken, dass die Jahrhunderte an mir vorüberziehen würden und ich immerfort leben sollte. All das sollte erst kommen. Und dennoch, in diesem Augenblick, inmitten dieser gespenstischen Gestalten, ereilte mich eine Vorahnung dessen, was mir bevorstand. Die Abenddämmerung umschloss den Raum und machte mich wahnsinnig vor Angst – dann endlich hörte ich unten, wie die Tür schlug. Mein Herr kam zurück. Ich sprang, zwei Stufen auf einmal nehmend, die Treppe hinunter. Er hatte eine der Kisten mit den bunten Gläsern gefüllt, den Phiolen, die verstreut im Sand gelegen hatten, und stellte sie jetzt vorsichtig im Gang ab. Ich sprang an ihm hoch, hieß ihn mit wildem Bellen willkommen und leckte ihn ab.
»Was für ein Theater! Was für ein Theater!«, sagte er nur, obwohl auch er sichtlich erschüttert war. Ich folgte ihm in die Stiefelkammer und sah im fahlen Licht, wie er sich die Hände wusch, dann in den großen Saal, wo er die Kerzen entzündete und die Fensterläden schloss. Bevor er den letzten Laden dichtmachte, sah er hinaus zur felsigen Untiefe, offenbar immer noch aufgewühlt von dem, was er dort entdeckt hatte.
»Alles wird gut werden, nicht wahr?«, sagte er, ging in die Hocke und hielt mit beiden Händen meinen Kopf umfasst. »Wir sind mit unserem Leben zufrieden, oder?« Die plötzliche Eindringlichkeit seines Tons verunsicherte mich, und wieder musste ich an den Leichnam denken, an das sich entzündende Körperfett, die sich schwärzenden, verkohlenden Knochen. Ich dachte an die Statuen und Gemälde in der dunklen Schlossgalerie – den bärtigen Koloss, die hingestreckte Dame, den Stutzer mit dem Totenschädel –, und auch sie schienen zur Welt der Toten zu gehören. Erst als mein Herr im Kamin ein Feuer entzündet hatte und wir in behaglicher Wärme davorsaßen – er auf einem Lehnstuhl, ich zu seinen Füßen –, wurde mein Herz ruhiger.
»Ach je!« Er richtete sich auf und sah sich um. Ich hob den Kopf, sah zur Tür und fragte mich, was er gehört haben mochte. »Die Austern.« Er seufzte. »Ich hab sie am Strand gelassen. Und unseren Kübel auch. Die Flut wird sie mit sich nehmen.« Er zuckte mit den Schultern und lehnte sich wieder zurück. »Egal. Morgen machen wir uns wieder auf den Weg. Morgen finden wir vielleicht noch schönere.«
Aus dem Augenwinkel heraus beobachtete ich, wie er einschlief und seine Hände schlaff wurden. Erst dann fiel mir wieder sein seltsames Verhalten am Strand ein. »So bist du nun tot, oder?«, hatte er in einem so seltsamen Ton gesagt, wie ich ihn noch nie aus seinem Mund vernommen hatte. Was, fragte ich mich, hatte er denn erwartet.
Ich sollte es bald herausfinden.
II
Whitehall, England
Fünf Jahre später
Wir warteten in der Kälte des Torhauses, bis eine Dame uns holen kam.
»Ja?«, fragte sie knapp. Sie war zart wie ein Vögelchen, ganz in Schwarz gekleidet und hielt einen dicken Bund Schlüssel umklammert.
Mein Herr lüpfte seine Samtkappe und lächelte. »Kann es sein, dass Ihr Euch nicht an mich erinnert?«
Ihr schmächtiger Brustkorb pochte. »Das ist ja nicht möglich! Der allzeit fortstrebende Arzt.«
Mein Herr lächelte. »Verzeiht, Margaret, dass ich nach Euch schicken ließ, aber es ist viel Zeit vergangen, seitdem ich hier war, und ich war mir nicht sicher, wer noch da sein würde aus den alten Tagen.«
»Na, ich bin da. Man muss mich schon in einer Kiste raustragen.« Sie musterte ihn ungläubig. »Wie lange ist das her? Vierzehn Jahre?«
»Zweiundzwanzig.«
Es verschlug ihr den Atem. »Ihr lügt. Ihr seid noch ganz der Alte, während ich zu einer alten Mamsell geworden bin.«
»Unsinn, Unsinn.«
Gelächter.
»Und diesmal kommt Ihr mit einem Gefährten?« Sie sah zu mir herunter, mein Schwanz schlug hin und her. Ich mochte sie sofort, sie und ihre Lebensfreude. »Was für ein hübscher Kerl. Und wie er einen anzulächeln scheint.«
»In der Tat«, verkündete mein Herr stolz. »Immer freundlich, so ist er, mein Bester. Er hat für jeden ein Lächeln übrig.« Das Kompliment ließ meinen Schwanz mit doppelter Geschwindigkeit wedeln.
»Zwei Jahrzehnte, kann das wirklich sein?«, sagte Margaret versonnen. »Wie einem doch die Zeit durch die Finger rinnt. Wo um alles in der Welt seid Ihr herumkarriolt?«
»Ich …« Grübchen erschienen auf seinen Wangen, wie immer, wenn er nicht gleich wusste, wie er antworten sollte. »Wir kommen von Dänemark. Davor waren wir in Florenz. Ein kurzer Aufenthalt in Madrid. Und so weiter …« Er winkte ab. »Reisen bedeutet, am Leben zu sein, ist es nicht so?«
Ich wusste nicht recht, ob Margaret ihm zustimmte, sie sah ihn jedoch lächelnd an. »Und jetzt?«
»Whitehall? Falls man dort meiner Dienste bedarf, mögen sie auch noch so gering sein. Ich habe Sehnsucht nach London, vor allem anderen.«
Ihre Freude war unverhohlen. »Ich könnte kokettieren, tu es aber nicht. Eure Arzneien fehlen mir viel zu sehr, und ich brauche sie heute mehr als je zuvor. Ich werde für Euch eine Anstellung finden. Mag auch ein neues Regime herrschen, aber Ihr werdet bemerkt haben, dass ich immer noch im Besitz der Schlüssel bin. Kommt rein, kommt rein, Ihr und Euer liebenswürdiger Gefährte.« Sie bedeutete uns, einzutreten, mein Herr aber zögerte.
»Sagt mir erst, war in den letzten Jahren ein Herr auf der Suche nach mir?«
»Ein Herr?«
»Genau. Es steht nicht zu erwarten, aber Ihr hattet doch schon immer ein so sorgfältiges Auge auf alles Kommen und Gehen …«
»Ich erinnere mich an niemanden. Gibt es Probleme?«
»Nein, nein.« Obwohl mein Herr das Thema angeschnitten hatte, schien er es nun rasch beenden zu wollen. »Nur mein ehemaliger Geschäftskompagnon, ein Chymiker wie ich.«
»Einer von Euresgleichen, wie aufregend. Wie sieht er denn aus?«
»Wirklich, es ist nicht von Belang. Er hat mich hier besucht, vor langer Zeit, und ich dachte, Ihr erinnert euch vielleicht an ihn, aber … verzeiht. Die lange Reise. Ich bin doch etwas durcheinander. Und Ihr habt recht, was das Wetter betrifft – geht Ihr voran.«
Margaret führte uns um einen abgeschlossenen viereckigen Innenhof herum. Das Schloss in Helsingör war schlicht gewesen verglichen mit Whitehall und seinen sich aneinanderdrängenden Bauten, Türmen und Kolonnaden, seinen farbenprächtigen Buntglasfenstern und den von Tausenden Ziegelfiguren geschmückten Dächern.
»Natürlich habt ihr die Nachrichten schon vernommen? Die Königin. Vier Jahre sind es nun schon her, und immer noch fürchte ich, sie könnte jeden Moment durch die Tür stürmen und zeternd die Stimme gegen mich erheben.« Sie senkte die Stimme zu einem Flüstern. »Vielleicht, wärt Ihr am Hof gewesen, würde sie noch leben. Sie ließ sich ja nichts sagen, was das Bleiweiß anging. Man munkelt, es habe sie vergiftet. Ihr Ende, man muss es nicht ausdrücklich erwähnen, glich einem fantastischen und düsteren Theaterstück. Sie befahl, alle Spiegel im Richmond Palace abzunehmen, ließ sich, auf Kissen gebettet, auf dem Boden nieder, lag dort mit den Fingern im Mund wie ein Säugling und trug nach wie vor ihre gezierte Perücke. Schließlich verkündete sie: ›Ich wünsche nicht länger mehr zu leben, sondern begehre zu sterben.‹ Und so geschah es dann auch.«
»Man wird sie nicht so schnell vergessen.«
»Nein, keineswegs. Und dann, natürlich, der Vorfall im vergangenen November. Habt Ihr davon gehört?«
»Mehrfach.«
Margaret blieb stehen, sah sich im Innenhof um und ergriff seinen Arm. »Unaussprechlich, unaussprechlich.« Ihr saß der Schalk im Nacken, was ein erfrischender Gegensatz zum langwintrigen Trübsinn im strengen Helsingör war. Sie setzte ihren Weg fort durch das Labyrinth der Gänge und Innenhöfe und sprach mit leiser Stimme. »Eine Schreckenszeit, jawohl. In einem unterirdischen Gewölbe fand man sie, drei Dutzend Fässer. Reines Schießpulver. Hier, fast unter unseren Füßen. Es folgten unzählige Befragungen, fürchterliche Folter, höfische Erlasse und Prozesse. Der König höchstselbst nahm daran teil, hinter einem Vorhang verborgen. Könnt Ihr Euch das vorstellen? Der gesamte Hof mit den Nerven am Ende. Jeder misstraute dem anderen. Dann die ganzen Hinrichtungen. Du liebe Zeit! Ich bin nicht hin. Aber die Massen wollten sich das Vierteilen nicht entgehen lassen. Grausam, grausam. Aber denkt nur, was gewesen wäre, hätten sie Erfolg gehabt, die Verschwörer! Dann wären wir jetzt auf einem ganz anderen Weg.« Wir gelangten in einen großen Raum, in dem ein Feuer brannte. »Und wart ihr mit ihm überworfen, als Ihr Euch von ihm getrennt habt?«
»Von wem?«
»Na, Eurem Kompagnon. Ich weiß doch, wie Fehden entstehen. Erst neulich gab es einen Streit zwischen zwei Glasmachern in der Strand über Rezepturen, der so sehr ausartete, dass einer von den beiden in Newgate landete. Wurden Euch geheime Formeln gestohlen?«, fragte sie begierig. Doch mein Herr runzelte nur die Stirn und schwieg.
»Ihr Armer. Ich sehe schon, ich werde es Euch nicht entlocken. Was bin ich doch für eine Klatschbase. Wartet hier, wärmt Eure Knochen, ich rede mit den Herren.« Sie hielt kurz inne. »Mein allzeit fortstrebender Arzt und sein freundlicher Hund. Wirklich außergewöhnlich, wie wenig Ihr Euch verändert habt.« Mit diesen Worten verließ sie das Zimmer.
»Lasst mich Euch anschauen«, sagte eine Stimme.
Die Kammer, in die wir geführt wurden, lag in so fahlem Licht und war derart mit vergoldeten Ornamenten überladen, dass mir der Mann, der in einer Ecke saß, zunächst gar nicht aufgefallen war.
Ein blasses, pausbäckiges Gesicht erhob sich aus einer dicken Halskrause, schwere Lider, dünner Bart. Seine Kleidung war auserlesen, plissierter Samt in kompliziert-symmetrischen Mustern, aber er verströmte den frischen Geruch von Blauschimmelkäse. Eine Wolfshündin lag zu seinen Füßen. Sie hob den Kopf und blickte zu mir herüber, und ich begrüßte sie mit einem Wedeln. Worauf sie mich so abschätzig taxierte, dass ich schamvoll nach unten sah, während sie den Kopf wieder sinken ließ.
Mein Herr trat vor. »Sire.«
Der andere, König James, wie ich bald erfahren sollte, studierte das Pergament, das mein Herr ihm überreicht hatte. Er hatte es mit seiner gleichmäßigen, leicht nach rechts geneigten Handschrift während unserer Überfahrt auf der Nordsee verfasst.
»Ihr wart an allen diesen Palästen in Diensten?« Der König sprach mit einem schwerfälligen Lispeln, seine Zunge schien zu groß für seinen Mund. Schmutz hatte sich in den Falten seiner Hände festgesetzt, so dass nur die Fingerspitzen ihren natürlichen Hautton zeigten.
»An allen möglichen Höfen Europas, Sire. Und auch hier in Whitehall. Sechs Jahre war ich in den Diensten Eurer Cousine, der Königin.«
»Dann kennt Ihr diese Hallen besser als ich. Alchymie? Ist das die Zauberei der Hexen? Die stille Lüfte in Gewitter verwandeln?«
»Das hat nichts mit Alchymie zu tun, Sire, bei allem Respekt. Alchymie ist eine Wissenschaft. Eine auf Vernunft und Logik basierende hohe Kunst. Ich bin kein Hexenmeister.«
Der König richtete den Blick wieder auf das Pergament, dann fuhr sein Kopf überrascht hoch. »Und auch in Persien? Wirklich?«
»In der Tat, Sire. Am Palast von Ismail in Täbris.«
»Persien.« Er war verblüfft. »Das ist eine Welt von unserer entfernt. In diesem Reich gibt es sicherlich Zauberei.«
»Es gibt vielleicht die Mathematik. Die Weisheit ist den Persern in die Wiege gelegt, Sire. Alte Weisheiten. Dort entlang der Seidenstraße jenseits der Wüste erlernte ich die Geheimnisse meines Handwerks – mehr als irgendwo sonst.«
In den folgenden Jahren würde ich meinen Herrn noch oft von Persien, von Täbris und der Mathematik erzählen hören, und immer geriet er darüber ins Schwärmen.
»Und wie alt seid Ihr?« Der König wedelte mit dem Pergament. »Um auf einen solchen Lebenslauf zurückblicken zu können?«
»Fünfzig …«, erwiderte mein Herr schnell, obwohl es eher wie eine Frage klang. »So ungefähr.«
Der König lächelte, und nun war zu sehen, dass seine Zähne von gleicher Farbe waren wie seine Hände. Er stemmte sich hoch und schlurfte zu mir. Er war nicht alt, nur schwach auf den Beinen, und von gewöhnlichem Aussehen, ein Straßenhändler in sehr eleganter Kostümierung. Er hielt mir die Hand vor die Schnauze, damit ich sie beschnüffeln konnte. Nur aus Höflichkeit nahm ich eine Prise. Sie stank nach Eisengallustinte und Fäkalien. »Willkommen in Whitehall«, sagte er zu meinem Herrn und gab zu verstehen, dass die Unterredung positiv beschieden sei. »Ihr und Euer Hund.«
»Die Stadt der Kostümierungen«, so nannte mein Herr London. Seitdem habe ich so viele Städte gesehen, dass ich mitunter leicht vergesse, wie beeindruckt ich von meiner ersten wahren Metropole war. Lange Gevierte mit Giebelhäusern, jedes einzelne eine Festung für sich, aber durch wunderbare Glasgeometrien miteinander verbunden. Und eine ganz neue Welt von Gerüchen, die sich mir auftat. Nach dem alles durchdringenden Geruch von Roggenmehl, der in Helsingör dem bemalten Holz anhing, nach den langweiligen Räuchereien und Fischverkäufern dort war die Luft hier erfüllt von exotischen Düften: Zucker, Zimt, Muskatnuss, Kaffee und Schokolade. Und, wie ich lernen sollte, dem Geruch des Geldes.
Auch die Menschen, die über die blaugrauen Pflastersteine der breiten Straßen eilten und unter den Kolonnaden wandelten, waren in ihrem Selbstbewusstsein und ihrer Unterkühltheit ausgesprochen prachtvoll anzusehen. Es war die Zeit wagenradgroßer Halskrausen, reich bestickter, dunkler Gewänder und hoher, konischer Capotain-Hüte. Die Männer trugen Voll- oder Oberlippenbart, das Haar wurde von der Stirn glatt nach hinten gestrichen, manche gefielen sich mit Schmachtlocken, viele hatten dazu einen kurzen Umhang über eine Schulter drapiert. Ebenso selbstbewusst gaben sich die Frauen, die in Kleider mit hohem Halsausschnitt und gebauschten Schultern geschnürt wurden.
Wie schon in Helsingör hatte mein Herr auch hier beständig ein wachsames Auge auf Neuankömmlinge. Trafen Boote an der Anlegestelle ein, spähte er, seitlich am Fenster stehend, nach unten und beobachtete, wer gerade anlandete. Oder hörte er eine fremde Stimme aus dem Hof oder den angrenzenden Zimmern, drückte er das Ohr an die Wand. Ich glaubte zu wissen, warum er das tat: Er erwartete jene Person, die nicht im Schlick von Helsingör angespült worden war. Die Augen dieses Fremden, dieses mysteriösen Menschen, der mir nie begegnet war, schienen uns überallhin zu folgen, selbst im Schlaf, so stellte ich mir vor, schwebte er über uns in der Dunkelheit. Ich wusste nicht mehr über ihn, als dass seine vermeintliche Ankunft von jenem Intaglio mit den drei Türmen unter einer Mondsichel angekündigt worden war.
Wir lebten bereits einige Jahre in Whitehall, als wir an einem Wintertag mit Margaret den Frostjahrmarkt auf der Themse besuchten. Tatsächlich war es ihre Idee gewesen, dorthin zu gehen. Sie und mein Herr waren enge Freunde geworden, sie lachten zusammen und besprachen sich, blieben bis spät in die Nacht auf, brüteten im Kerzenlicht über Büchern, während sie süße Köstlichkeiten naschten, Marzipan und Pfefferkuchen. Ich spürte eine Anziehung zwischen ihnen, die sich von reiner Freundschaft unterschied. Mein Herr gehörte zu jenen wenigen, die sich in Gegenwart von Frauen völlig ungekünstelt betrugen, die von Haus aus liebenswürdig und rücksichtsvoll waren und dennoch lebhaft genug, um selbst die sauertöpfischste Dame zum Lächeln zu bringen. Margaret als Gefährtin, schien mir, beflügelte seine Schritte. In Whitehall fragte ich mich daher, warum er es nicht zuließ, dass sich ihre Freundschaft weiterentwickelte: Denn zweifellos war er es, der sich reserviert gab. Stets kam sie mit Plänen zu ihm, reichte ihm immer wieder vertrauensvoll die Hand. Wenige Jahre später sollte ich sein Verhalten voll und ganz verstehen.
Die Themse war in diesem Winter vollkommen zugefroren, die Eisdecke so dick, dass Pferdegespanne von der London Bridge bis nach Westminster fahren konnten. Hier und dort waren Schiffe im Eis gefangen, ihre nackten Masten glichen kahlen Bäumen. Rotwangige, teils bis zu den Augen verhüllte Menschen drängten sich um die Attraktionen – Bogenschießen, Stierhatz, Kegeln und Schaukeln –, während die Kinder auf Kufen vorbeiglitten oder sich auf Schlitten ziehen ließen. Mein Herr schien überaus fasziniert davon, ich aber fühlte mich auf dem Eis nicht wohl, was ich mir allerdings nicht anmerken ließ. Bis heute mag ich diese brennende Kälte an den Pfoten nicht, und auch nicht den scharfen Geruch, der mir wie Pfefferminz in die Nase stach – vor allem aber litt ich an der Angst, das Eis könnte unter mir einbrechen.
»Schaut, kaufen wir uns Hüte«, sagte mein Herr und steuerte umgehend eine der Buden an. »Ich kenne diesen Gentleman. Das Maskenspiel der Königinnen, das wart doch Ihr?«, fragte er den älteren Budenbesitzer, der seinen Mund zu einem runzligen Lächeln verzog. »Dieser Mann ist ein Genie, Margaret, ein Hutmacher. Wir werden beide einen nehmen.«
»Nicht für mich, nicht für mich«, flehte Margaret lachend, aber kaum hatte sie sichs versehen, hatte er auch schon zwei Hüte erworben und krönte sie mit einem Kopfputz aus papageienbunten Federn und sich selbst mit einem glasrubinbesetzten Turban.
»Ihr sollt die Königin des Amazons sein, und ich bin der Sultan von Arabien.« Das alles war so unterhaltsam, dass ich begeistert bellte und meine Angst vor dem Eis ganz vergaß. Mein Herr liebte Verkleidungen. Und kamen Spielleute in den Palast, folgte er ihnen in einem fast berauschten Zustand, nur um dann kein Wort herauszubringen, wenn er angesprochen wurde. Einmal besuchte uns ein wirklich freudloser Stückeschreiber in unseren Räumlichkeiten in Whitehall und befragte ihn stundenlang zu seiner Arbeit. Während des Gesprächs war mein Herr so beeindruckt von dem Theatermann, dass er fast seine Sprache zu verlieren schien, aber noch Monate später brüstete er sich gegenüber jedem, der es hören wollte: »Wisst Ihr schon, Mr. Jonson schreibt ein Stück über mich? Ich werde auf der ganzen Welt berühmt werden.« Als er die Aufführung später einmal sah, schämte er sich so sehr, als ein Quacksalber dargestellt worden zu sein, der sich bloß als Alchymist ausgab, dass er noch vor dem Abschlusslied das Theater verließ.
Wir gingen weiter und sahen einer Tanztruppe zu, die zu einer schnell spielenden Fiedel achtköpfige Figuren bildete. Mein Herr wippte mit dem Fuß, wie er es immer tat, wenn er am liebsten mitmachen wollte. Er liebte den Tanz ebenso sehr wie das Verkleiden, meiner Meinung nach war das Tanzen allerdings nichts für ihn, da er sich dabei sehr ungeschickt anstellte.
Als ein Mann sich aus der Gruppe der Tanzenden löste, dachte ich schon, er würde seinen Platz einnehmen – aber dann erregte etwas am Flussufer seine Aufmerksamkeit. Ich sah, wie seine Miene sich verdüsterte, seine Nasenlöcher sich weiteten, und witterte den scharfen Geruch, den er mit einem Mal verströmte – den der Hysterie, wie ich glaubte.
»Wir sollten zurück. Diese Unterhaltung ist ein bisschen gewöhnlich.« Eilig setzte er sich in Bewegung und achtete nicht einmal darauf, ob Margaret und ich ihm folgten. Ich versuchte zu erkennen, was ihn so sehr beunruhigt hatte, aber mein Blick wurde durch eine Gruppe, die sich hinter uns drängte, verstellt. Mein Herr war so aufgeregt, dass er gegen eine der Tänzerinnen stieß und sie aus dem Gleichgewicht brachte. Sie fiel zu Boden. Weder entschuldigte er sich, noch half er ihr auf, wie er es sonst getan hätte, sondern eilte einfach weiter. »Schnell«, blaffte er nur. Der Turban fiel ihm vom Kopf, ich wollte ihn schon retten, als er uns erneut antrieb: »Los, macht schon!« Mit der Freude war es an diesem Tag dahin, außerdem benahm sich der Pöbel unflätig und rüpelhaft, so meldete sich mein Unbehagen wegen des aufbrechenden Eises zurück, und ich stellte mir vor, wie kalt und finster der Fluss in der Tiefe wäre. Endlich erreichten wir eine freie Fläche, mein Herr blieb abrupt stehen und fluchte leise. »Warum laufe ich eigentlich davon? Ich sollte ihm entgegentreten.« Margaret starrte ihn verblüfft an, als er sich jetzt umdrehte. »Wie lang hat er uns schon beobachtet?«
Erst jetzt sah ich auf den Stufen zum Ufer eine einzelne Gestalt stehen, deren schwarzer Umhang sich deutlich von der verschneiten Stadt abhob. Der Mann stieg zum Fluss herab und kam gemessenen Schritts auf uns zu. Selbst aus der Ferne war er eine beeindruckende Person: breitschultrig, selbstbewusst, wie ein Schwan glitt er durch die ihn umringende Menge über das Eis, bewegte sich mit seiner ganz eigenen Geschwindigkeit, war von ganz eigener Art und in einer ganz eigenen Welt zu Hause.
»Der Gentleman, den Ihr erwartet habt?«, fragte Margaret gedankenschnell wie immer. »Euer einstiger Kompagnon? Gibt es Grund zur Sorge?«
Mein Herr erwiderte nichts, sondern schob mich nur hinter seine Beine. Der Fremde blieb einige Meter vor uns stehen und streckte meinem Herrn die Hand entgegen.
»So finde ich dich also in London.«
Dabei lächelte er, so selbstgewiss, dass ein Kribbeln über mein Fell strich. Sein Gesicht lag halb verborgen unter einem breitkrempigen, mit einer Straußenfeder geschmückten Hut und seinen Haaren, kohlrabenschwarzen, bis auf die Schultern fallenden Locken. Der Frost schien ihm nichts anzuhaben, seine Miene war gelöst, und seine Haut strahlte in einem mediterranen Schimmer. Und er war angetan mit Reichtümern aller Arten: einem preußisch-blauen, mit Perlen bestickten Wams aus Samt und Seide; einem liegenden Kragen aus spanischer Spitze (wie ihn damals die modebewusstesten Höflinge nicht trugen); Lackschuhen, die solchermaßen poliert waren, dass sich alles in ihnen spiegelte; er hielt einen Offiziersstock mit goldener Spitze in den Händen, und um den Hals trug er einen Smaragd. Jeder andere hätte in solch einem Aufzug protzig oder weibisch ausgesehen, nicht jedoch er. Mein Herr, den ich trotz seiner markanten Nase, seinen großen Händen und seinem ungebändigten blonden Haarschopf stets für gutaussehend gehalten hatte, verblasste in der Gegenwart dieses Fremdlings. Mein Herr trat vor, deutete eine Verbeugung an.
»Vilder«, sagte er nur.
Der Fremde, der etwas kleiner war als mein Herr, aber von kräftigerer Statur, sah ihn nur an, weiße Atemwölkchen stoben aus seiner Nase, offenbar weidete er sich an der Verlegenheit seines Gegenübers, bevor er schließlich sagte: »Wie schön, dich zu sehen.« Dann sah er zu mir herab, seine Augen glommen wie Kohlegruben, so dass es mich fast schwindelte. »Er gehört dir?«, fragte er meinen Herrn, bevor er Margaret mit einer knappen, aber durchaus einnehmenden Verbeugung bedachte. »Mein alter Kompagnon war immer schon ganz vernarrt in diese Spezies.« Er musterte Margaret mit einem amüsierten Zucken seiner Mundwinkel. »Mir gefällt Euer Hut.«
Margaret hatte ganz vergessen, dass sie den albernen Kopfputz noch trug. Ich bin überzeugt, sie hätte nichts lieber getan, als ihn sich vom Kopf zu reißen, aber sie ertrug den Spott, errötete leicht und zuckte scherzhaft mit den Schultern. Es folgte ein peinliches Schweigen; drei Personen, die sich auf dem Eis versammelt hatten.
»Seid Ihr weit gereist?« Margaret blieben die Worte im Hals stecken, sie räusperte sich und richtete verlegen ihren Kragen. »Woher kommt Ihr denn, Sir?«
»Aus dem Harz. Aus Engern. Dem alten Land.« Er sprach anmutig und lächelte viel, aber seine wohlklingenden Worte waren mit Unheil verpestet.
»Aus Engern. Sicherlich einem märchenhaften Land«, erwiderte Margaret. »Und sehr weit weg.«
Mir schien, dass Vilder für unverfängliches Geplauder nicht viel übrighatte, trotzdem antwortete er. »Ich würde diese Strecke zehnfach zurücklegen, wenn es darum geht, den ältesten Bekannten, den ich auf der Welt habe, aufzuspüren.«
Mein Herr schien Vilders Worte zu bedenken, als enthielten sie eine verborgene Bedeutung.
»Hattet Ihr eine mühselige Reise?«, fragte Margaret. »Und teilt Ihr die Begeisterung für die Alchymie? Die Metallurgie – und solche Dinge? Woher kommt Euer Interesse, Sir?«
Vilder betrachtete sie mit sonniger Verachtung, bevor er zu einer Antwort ansetzte. »Meine Eltern besaßen vor langer Zeit Bergwerke. Ich hab sie geerbt. Ein schmutziges Geschäft.« Er drehte einen riesigen Saphir, der auf seinem Handschuh steckte, und der Stein funkelte im blendenden Licht dieses Tages.
»Das klingt einleuchtend, Bergwerke und die Schätze, die man in ihnen findet – wenn man sich da mit Alchymie befasst, meine ich. Und Ihr sprecht unsere Sprache wie ein Einheimischer.« Sie trug emsig allerlei Fakten zusammen, aber ihre Hartnäckigkeit ließ mich nervös werden, und meinen Herrn ebenso.
»Meine Mutter war Engländerin«, entgegnete Vilder. »Auf ihren Wunsch hin wurde ich am Balliol College in Oxford ausgebildet.« Er deutete auf meinen Herrn. »Wir beide haben dort gemeinsam studiert – obwohl ich weit davon entfernt war, ein vorbildlicher Student zu sein.«
»Ah, jetzt wird alles klar: Ihre Verbindung, die Universität in Oxford …«
Vilder unterbrach sie mit einem Schlenker seines Offiziersstocks. »Ich freue mich, ein anderes Mal mit Euch eine längere Unterhaltung zu führen, aber Ihr müsst uns nun entschuldigen. Eine Ewigkeit ist vergangen, seitdem wir uns das letzte Mal gesprochen haben.« Er wies auf meinen Herrn, und Margarets Wangen nahmen die Farbe gekochten Schinkens an.
Sie nickte, murmelte eine Entschuldigung, lüpfte ihren Rock und wollte gehen, bemerkte dann, dass sie die falsche Richtung eingeschlagen hatte, drehte sich um und verließ uns mit ihrem Papageienhut in einem konfusen Zickzack.
Eine Weile wurden die beiden Männer von einer nahezu magnetischen Stille zusammengehalten.
»Es freut mich, dich bei so trefflicher Gesundheit zu sehen«, sagte mein Herr schließlich. »In Helsingör dachte ich …« Er brach den Satz ab und begann von Neuem. »Ich war jedenfalls sehr dankbar, dass du mir damals meine Sachen geschickt hast. Leider konnte ich dir nur mit solch einer betrüblichen Nachricht antworten. Du hast meinen Brief erhalten? Kanntest du den armen Teufel, den Ertrunkenen?«
»Nicht persönlich.« Vilder musterte meinen Herrn wie ein Gentleman-Gauner, der sich die Auslagen eines Juwelierladens ansieht. »Na, wie die Dame schon bemerkt hat, ich bin weit gereist in dieser bitteren Kälte. Du lädst mich sicher in deine Räumlichkeiten, oder?« Er deutete mit einem Kopfnicken in Richtung Whitehall und grinste. »An den Hof des schottischen Königs.«
»Erfrischung gefällig?«, fragte mein Herr, als wir unser Gesellschaftszimmer betraten. Vilder sah sich um und bemerkte die Regalreihen mit den kleinen Glasflaschen und Phiolen, die mein Herr immer an seinem Arbeitsplatz anhäufte.
»Ja«, sagte er. »Bereite mir doch eins von deinen belebenden Elixieren zu. Sie haben mir gefehlt.« Vilder behielt seinen Umhang an, nahm den Hut aber ab. Ich bemühte mich, sein Gesicht nun richtig zu erfassen und die Bruchstücke, die ich bislang nur unter der Krempe ausgemacht hatte – kantiger Kiefer, breite Nase, gewölbte Stirn –, zu einem Ganzen zu verbinden, aber es war zu dunkel im Raum.
»Ein Elixier?«, fragte mein Herr.
»Ja, mit einer Prise …« Vilder zuckte mit den Schultern. »… irgendeines Opiats. Laudanum, falls du das haben solltest.«
Mein Herr schien unschlüssig. »Bist du krank?«
»Muss ich es sein?«
Mein Herr antwortete nicht und entzündete schweigend die Kerzen auf dem großen Standleuchter an der Tür. Ich trottete näher, um den Besucher in Augenschein zu nehmen, aber er trat ans Fenster, und ich sah nur seine Umrisse.
»Komm schon, stell dich nicht so an«, sagte er nun zu meinem Herrn. »Ein Elixier, es wird mich glücklich machen. Ist das nicht Grund genug?«
Mein Herr machte sich an die Arbeit, schürte erst den Ofen an, bevor er Phiolen von den Regalen nahm und Zutaten abmaß. Obwohl er einen gewissen Widerwillen an den Tag legte, blieb sein Ton freundlich. »London hat sich, wie du sehen wirst, sehr verändert. Es ist jetzt so, wie Florenz einmal war. Voller Eifer, Neugierde und so fesselnden Wissenschaften, dass ich vor Aufregung manchmal nicht schlafen kann.«
»Wissenschaftler?« Vilder lachte. »Wir sind doch die verfemtesten Gestalten von allen. Die Narrenkönige.« Er nickte mit dem Kopf in die Richtung meines Herrn. »Am besten gibst du gleich noch etwas Schierling dazu.«
»Wie?«
»Ich scherze nur, mein Lieber.« Wieder ertönte ein glucksendes Lachen, und Vilder sah erneut aus dem Fenster. Eine blasse Wintersonne senkte sich hinter den Mastenwald der Schiffe, die auf der Themse schaukelten. Während unser Besucher ihm den Rücken zuwandte, versteckte mein Herr rasch seine rote Samtbrieftasche unter den Pfannen und Tiegeln auf dem Arbeitstisch. Sie enthielt seine kostbarsten Besitztümer: eine hexagonale Glasphiole mit einem Rest dunkler Flüssigkeit und ein Schildpattetui in der Größe einer Schnupftabaksdose, in der sich, wie ich wusste, nur ein graues, völlig geruchloses Pulver befand, das sich in seinem Aussehen von Sand nicht unterschied. Ich hatte ihn bislang diese Gegenstände immer nur betrachten sehen, so als wolle er sich vergewissern, dass sie noch da waren, aber er hatte nie etwas davon benutzt. Später sollte ich erfahren, dass die Substanz, in roher und flüssiger Form, Jyhr genannt wurde und in meinem Leben noch eine wesentliche Rolle spielen würde.
»Weißt du, wie diese Leute reich wurden?«, fragte Vilder und tippte mit dem oberen Ende seines Offiziersstocks gegen die Fensterscheibe. »All die Seehändler und Zuckerfeilscher da draußen – weißt du, woher deren Reichtum kommt?«
»Von fernen Ländern?«
»Vom Tod. Er kommt vom Tod.« Kurz sah er zu meinem Herrn, bevor er sich wieder umwandte. »Die Pest vor zwei Jahrhunderten und alle Seuchen seitdem. Die Zugrunderichtung des Menschengeschlechts. Die Welt, ihrer Menschen beraubt, dennoch strotzt sie vor Schätzen: Eisen, Kupfer, Gold. Eine Leere tat sich auf, genau zu dem Zeitpunkt, als neue Erfindungen aufkamen. Und wer füllte diese Leere besser, machte sie sich besser zunutze als Kaufleute und Gewürzhändler?«
»Ein trauriger Umstand, nicht wahr? Nach all der Zeit.«
»Und die Pest machte die Menschen nicht nur reich, sie beflügelte auch ihre Intelligenz.« Er senkte die Stimme. »Wenn ich – wenn jedermann – ein schreckliches Ende erleiden, bei lebendigem Leib von Pestbeulen in Leisten und Achseln aufgefressen und meine Haut schwarz werden würde wie Teer, wenn mein Leben auf diese Weise enden sollte, so muss ich vorher doch etwas aus ihm machen. Was, wenn es kein Paradies gäbe? Wenn dieser morsche Leib alles wäre, was wir haben? Hätte Michelangelo dann seinen Meißel ergriffen? Hätten Euripides und Plato ihre Gedanken aufgezeichnet? Oder Spenser oder Donne Tinte aufs Papier gebracht? Im Bemühen, der Sterblichkeit ein Schnippchen zu schlagen?«
»Bist du den langen Weg gekommen, um mit mir über die Pest zu philosophieren?« Die Kühle in der Stimme meines Herrn veranlasste den Besucher, sich umzuwenden.
»Du hast recht. Ich bin aus einem bestimmten Grund hier und werde ganz offen sein. Komm mit mir nach Opalheim. Ich habe einen Auftrag für dich.«
»Opalheim?«
»Du erinnerst dich?«
»Ja, ich erinnere mich.«
Leise lachte Vilder in sich hinein. »Wie übellaunig du geworden bist.«
»Ich werde nicht nach Opalheim gehen. Ich werde diesen Ort nicht betreten. Es ist dein Heimatort, von dem ich nicht schlecht sprechen möchte, aber …«
»Du sprichst schlecht von ihm.«
Eine angespannte Stille folgte. Die Palastglocken schlugen. Mein Herr schüttelte etwas Pulver aus einer Phiole in seine Hand, streute es in den Topf und rührte alles um.
»Was für einen Auftrag?«, fragte er dann.
Flackernd fiel das Licht des Ofens auf Vilders Turmalin-Pupillen, ansonsten war er nichts als ein erhabener Schatten. »Du sollst eine Umwandlung durchführen.«
»Nein.«
»Ich traue mich nicht, die Prozedur selbst auszuführen, sonst …«
»Das solltest du auch nicht.«
»Sonst würde ich dich nicht um deine Hilfe bitten.«
»Ich sage nein.«
»Dabei bleibt es?«
»Du bist ebenso qualifiziert dazu wie ich. Du weißt, wie es zu tun ist. Tu es. Ich will damit nichts zu schaffen haben.«
Vilder sah zu mir herüber, lächelte verstohlen und raunte: »Es scheint, wir stehen nicht mehr auf gutem Fuß, mein Freund und ich. Ich fürchte, das liegt an der Zeit.«
»Wen willst du umwandeln? Eine Geliebte, einen Geliebten? Die doch nichts anderes sind als eine deiner Kapricen? Du spaßt mit dem Schierling. Damit ist nicht zu spaßen. Du verlangst von mir, dass ich jemanden mit einem Fluch belege? Das werde ich nicht tun. Es wäre äußerst gewissenlos und unmoralisch, einem anderen Lebewesen die Bürde eines Lebens ohne ein natürliches Ende aufzuerlegen – nur um später festzustellen, dass du seiner überdrüssig geworden bist, wie du aller deiner Kapricen irgendwann überdrüssig wirst. Nein, ich weigere mich. Du bist unverantwortlich und sorgst dafür, dass unsere Handwerkskunst übel beleumdet ist.«
»Er ist keine Kaprice.«
»Und ich bin kein Narrenkönig!«
Mir sträubte sich das Fell: Nie hatte ich meinen Herrn so brüllen hören. Er wischte sich Schweißtropfen von der Stirn und rührte weiter im Topf. Seine Hände zitterten. »Alles ist gut, mein Bester, alles ist gut«, flüsterte er mir zu. Er dachte wohl, dass mich der Besucher ängstigte, dabei war ich vor allem interessiert. Dieser Fremde war wie eine zum Leben erweckte Figur aus dem Theater oder der Oper. Von einem Stück voller Spannung und Dramatik, in dem man Morde zu gewärtigen hatte und mächtige Frauen und hinfällige Helden sich in dunklen Palastzimmern Dinge zuflüsterten.
Vilder war eine Größe zu eigen, in seinem Betragen, seinem Reden und seinen Bewegungen, in den undefinierbaren Gerüchen, die von ihm ausströmten, die mir niemals vorher und seitdem nur selten untergekommen ist. Ich vermochte nicht zu sagen, ob er tapfer und ehrenhaft oder ein Schurke war, dem es gefiel, andere zu bezaubern. Der einzige andere, den ich kennenlernte, Jahrzehnte später, der ebenfalls über eine solch gravitätische Größe verfügte, war Louis, der »Sonnenkönig« von Versailles.
Es dauerte, bis mein Herr wieder das Wort an Vilder richtete. »Ich wünschte, ich könnte dir helfen. Wirklich.« Er klang mit einem Mal versöhnlich. »Du weißt, in jeder anderen Angelegenheit, in wichtigen Angelegenheiten, würde ich dir assistieren, sofern du mich bittest, aber hier kann ich es nicht. Du weißt, warum. Es ist das einzige Gesetz in meinem Leben, das ich niemals breche.« Mein Herr räusperte sich, gab den Inhalt des Topfs über einen Trichter in einen Becher und stellte ihn auf den Tisch.
Vilder seufzte. »Du hast recht. Ich hätte es nicht vorschlagen sollen. Der Gedanke kam mir, und …« Mittlerweile weiß ich, dass Vilder ein Heuchler, ein Falschspieler ist, der das eine sagt und das andere meint, zu jener Zeit aber war ich fasziniert, wie schnell sein Zorn verrauchte und scheinbare Reue an dessen Stelle rückte. »Ich werde nicht mehr davon sprechen.« Er nahm seinen Umhang ab und legte ihn sorgfältig über eine Stuhllehne. »Ich habe einen besseren Vorschlag: Erneuern wir unsere alte Verbindung. Zu viele Jahre sind vergangen, um einander noch gram zu sein.«
Vilder war so liebenswürdig, dass mein Herr alle Vorsicht fahren ließ. »Nichts würde mich glücklicher machen.« Sie umarmten sich ein wenig unbeholfen, bevor sich Vilder niederließ und nach dem Becher griff.
»Ob du solche Elixiere gutheißt oder nicht«, sagte er, »du stellst jedenfalls die besten her. Vielleicht beruht es auf einer Täuschung des Gehirns, aber meine eigenen Mixturen scheinen nie so gut zu wirken.« Er roch an dem Becher, tauchte den Finger in die Flüssigkeit und gab einen Tropfen auf die Zunge. Sofort löste sich sein Kiefer, seine Schultern lockerten sich. Nachdem der Trunk etwas abgekühlt war, leerte er ihn ganz und lehnte sich, weich wie warmes Wachs, zurück. Mein Herr beobachtete ihn, mit einem gewissen Widerwillen, glaubte ich zu erkennen, aber als er dann zwei Becher mit Wein vollgoss und sie anstießen, war alle Feindseligkeit verschwunden. Sie unterhielten sich eher wie zwei Freunde: über Alchymie, Silberminen, Florenz, Rom, die tote Königin.
Nach Mitternacht, als beide kurz davorstanden, in ihren Lehnstühlen einzuschlafen, sagte Vilder: »Er heißt Aramis, meine Kaprice. Er ist Soldat. Und ein wunderbarer Mensch.«
Ich wurde von einem metallischen Geräusch und einem goldenen Licht geweckt, das über meine Augen huschte. Vilder griff gerade nach seinem Offiziersstock, der im Licht der durch das Fenster fallenden Morgendämmerung aufblitzte. Er strich sich die Haare zurück, setzte seinen Hut auf und fuhr sich über die Feder. Dann warf er einen Blick auf die Stelle, wo mein Herr am Vortag seine Brieftasche versteckt hatte, ein roter Streifen zwischen den Tiegeln. Er lächelte, fasste aber nichts an. Als er bemerkte, dass ich wach war, verbeugte er sich vor mir und schlüpfte aus dem Zimmer. Mein Herr schlief noch, und ich überlegte, ob ich ihn wecken sollte, dann aber beschloss ich, Vilder allein zu folgen. Ich zwängte mich durch die Tür, bevor sie zufiel. Der Schatten der Straußenfeder stahl sich die Treppe hinunter, ich ging ihr hinterher.
Ich folgte ihm aus dem Palast zur Themse. Es schneite. Im Schneetreiben konnte ich noch nicht einmal das Südufer des Flusses erkennen, nur den andersweltlichen Flockenwirbel und die verschwommenen Silhouetten der Menschen, die zu dieser Morgenstunde schon unterwegs waren. Vilder schritt über das Eis, ohne zu schlittern oder auszurutschen. Der Wind blies den Fluss entlang, die Spitze der Straußenfeder bog sich und wäre fortgeweht worden, hätte nicht der unnachgiebige Schaft sie an Ort und Stelle gehalten.
In seinem Windschatten gelangte ich fast bis zur anderen Seite der Themse, ich wartete nahezu darauf, dass er sich umdrehte und mich erblickte, mich auf seine dunkle, überspannte Weise betrachtete und ich ein letztes Mal seine imposante Gestalt in voller Gänze sehen könnte. Am Ende blieb ich stehen. Vilder drehte sich weder um, noch unterbrach er seine Schritte. Es schmerzte beinahe, ihn im Weiß des Schneegestöbers verschwinden zu sehen.
Einen Augenblick lang war ich wie in Trance, dann musste sich der Himmel etwas verdunkelt haben, und mir wurde bewusst, wie kalt es war, dass ich auf dem Eis stand und mich allein auf dem Fluss befand. Ich drehte mich um. Von Whitehall war nichts mehr zu sehen, es war vom Weiß verschluckt, und plötzlich fühlte ich mich fürchterlich beschämt, dass ich meinen Herrn verraten hatte und mich von jemandem betören ließ, der ihm augenscheinlich Kummer bereitete. Ich machte mich auf den Rückweg, aber meine abergläubische Ader – die ich immer hatte und auch jetzt noch habe – wollte mir weismachen, dass wegen meiner Treulosigkeit das Eis aufbrechen, dass sich ein Riss auftun und ich untergehen würde. Ich stellte mir vor, wie mich die Strömung erfasste, wie ich gegen die Eisdecke gestoßen und hinaus aufs Meer getrieben wurde.
Ich konnte es kaum erwarten, zurückzukehren zum Bett meines Herrn, damit er wusste, dass ich ihn nicht verlassen hatte, damit ich zeigen konnte, dass ich ihn nie verlassen würde, aber ich brauchte eine Ewigkeit, um das Nordufer zu erreichen. Immer wieder musste ich stehen bleiben, musste meinen Mut sammeln, stand zitternd auf dem Eis, war überzeugt davon, dass London mir geraubt worden war, bevor ich mich wieder zwang, meinen Weg fortzusetzen. Endlich tauchten die Türme von Whitehall auf, und nun beeilte ich mich und hielt nicht mehr inne.
Ich rannte durch den Innenhof, sprang die Treppe hinauf, durch die Tür in unser Zimmer – und war erleichtert. Eine Gestalt lag unter der Decke, dazu der für mich so vertraute Geruch – der Geruch nach Mitternacht im Hochwald, nach knisterndem Pergamentpapier und einem Hauch Kiefernharz. Mein Herr.
Ich sprang hoch, und er, noch halb im Schlaf, hob die Decke.
»Alles gut, mein Bester?« Er lächelte. »Wie kalt du bist.« Und damit döste er wieder ein.
Ich wühlte mich zu seinen Füßen in die Decke und lag dort in der Wärme, mit wild pochendem Herzen.
Meinem Zuhause.
Wie viele Jahre sind seit diesem Morgen am Fluss vergangen? Mehr als zweihundert. Es war ein anderes Zeitalter, am Anfang meines Lebens. Mehr als zweihundert Winter sind seitdem gekommen und gegangen, mehr als zweihundert Mal wehten aus dem Norden die Novemberwinde heran, und Menschen schlüpften in ihre Pelze und Hüte und entfachten Feuer in den Straßen. Ich habe alle Winter gezählt und spreche mir immer die neue Zahl vor, wenn der Neujahrstag ansteht. Daher weiß ich, wie alt ich bin – zweihundertundsiebzehn Jahre.
Der Besucher, Vilder, sollte in unser Leben zurückkehren, er warf auf alles einen dunklen Schatten und war – ich zweifle nicht daran – verantwortlich dafür, dass mir mein Herr genommen wurde.
Oft denke ich an Helsingör und Whitehall und die anderen Höfe, an denen mein Herr seine Kunst ausübte. Und an unsere späteren Jahre – an die schrecklichen Ereignisse in Amsterdam –, an einander nachsetzende Armeen, das Schlachtfeld, den rotnebeligen, knochenzermalmenden Schrecken des Krieges. Die Erinnerungen an diese gemeinsam verbrachten Jahrzehnte durchströmen mich ständig. Ich träume von ihnen jede Nacht, Gespinste, die so lebendig und eindringlich sind, dass es mir manchmal schwerfällt, sie nicht für wirklich zu halten.
Aber warum ich – ein Hund – seit mehr als zweihundert Jahren am Leben bin, auf diese Frage habe ich nur vage Antworten.
Natürlich, wenn ich ihn finden könnte, meinen Herrn, der kein Heuchler oder Zauberer oder eine so rätselhafte Gestalt wie Vilder war. Der ehrbar war und treu und gewissenhaft, ein gütiger, zurückhaltender Engel, der in seiner Bescheidenheit der Welt niemals von seiner Größe erzählt hat – wenn ich ihn finden könnte, sofern er noch lebte, irgendwo … dann könnte ich das alles vielleicht verstehen.
MORGEN
1
Verlorene Seele
Venedig, Mai 1815, hundertsiebenundzwanzig Jahre, nachdem ich ihn verloren habe
Welch herrlicher Morgen!
Zwei Wochen lang war ich eingesperrt in meinen Bau, starrte vom Eingang hinaus in den unablässigen Regen und auf das freudlose Menschengewirr, das mit nassen Rocksäumen und quietschenden Sohlen hin und her watete. Heute aber ist die vom adriatischen Meer neu aufgewirbelte Luft wieder klar.
»Buongiorno!«, ertönt eine Stimme, und ein Stiefelpaar nähert sich, der Lastenträger vom Zollhaus. »Eine Überraschung für dich.« Er geht in die Hocke und lässt einen Kuchen vor mir auf die Pflastersteine platschen. »Torta de fagioli!«, sagt er und küsst seine Fingerspitzen. Ich schnuppere. Spinat und Bohnen in Teig, nur einige Bissen fehlen. Der Lastenträger, ein Mensch, so schnörkellos wie die Fässer, die er jeden Tag aus den Handelsschiffen lädt, kommt oft zum Plaudern vorbei, manchmal bringt er mir auch Leckereien mit, aber selten etwas so Verführerisches wie das hier.
Für mich?, frage ich stumm und mit einem einstudierten Stirnkräuseln.
Er lacht und krault mir mit seinen riesigen Händen den Nacken. »Si, mi signore, der du nie deinen Posten verlässt und den ganzen Tag die einlaufenden Schiffe beobachtest. Lass es dir schmecken.« Er verbeugt sich im Scherz und geht.
Ich streiche mit der Schnauze über die torta und atme tief ein. Seit Tagen hab ich kaum was gegessen, ich könnte sie sofort hinunterschlingen – aber ich zügle mich: ein Viertel heute Nacht, ein Viertel morgen, genug für eine Woche, wenn ich mich mäßige. Ich trete hinaus in den Sonnenschein und lasse den Blick über den Kai schweifen: Ein Schiff läuft aus, ein anderes legt an, ein halbes Dutzend Besatzungsmitglieder lassen über Winden Kisten auf den Kai hinunter. Er ist nicht unter ihnen. Ich sehe zur Kirche: Ein junger Priester steigt die Stufen hinauf und schlüpft durch das zweiflügelige Portal.
Dann vernehme ich ein verspieltes Bellen, und ein mir nur allzu vertrauter Hund trottet durch den Hafen. Ich schiebe meine Köstlichkeit außer Sichtweite. Sporco, wie ich ihn nenne, »der Schmutzige«, ein einheimischer Streuner, der sich oft am Zollhaus herumtreibt und auf Abfälle aus ist. Er gehört zu jenen Kreaturen, die ich in meinem früheren Leben, jenen herrlichen Zeiten, als ich ein Hund am Hofe war, gemieden hätte – als ich in ihm vielleicht ein wenig zu sehr das wilde Tier gesehen hätte, ein Sklave der misslichen Umstände und in der beständigen Gier nach Futter. Jetzt aber bin ich auch so wie sie, nur die Vergangenheit unterscheidet uns natürlich. Sporcos Leben jedenfalls begann ganz entsetzlich, wie ich selbst miterleben durfte.
»Schwül heute«, sagt er. »Noch ist Frühling, aber so schwül schon, nein?«