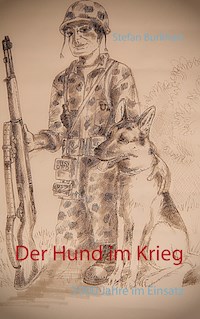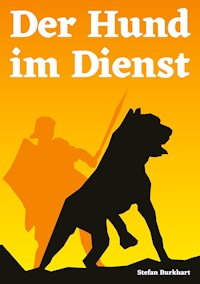
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Krieg - Konflikt - Kampf Eine Militär- und Kulturgeschichte des Hundes von prähistorischer Zeit bis zum 1. Weltkrieg. Der Krieg ist die ewige Geisel des Menschen... und der Hund ist sein treuster Begleiter. Das Buch stellt dar, wie Hunde stets Verwendung fanden in Krieg, Kampf und Konflikt. Die Darstellung beginnt tief in prähistorischer Zeit und endet mit dem 1. Weltkrieg. Die Fakten sind eingebettet in den grösseren historischen Kontext und angereichert mit vielen plastisch dargestellten Episoden. Das Buch ist eine wahre Fundgrube an neuen, überraschenden, ergreifenden Fakten. Wer seinen Fokus auf Kultur und Geschichte ausgerichtet hat, wird daran ebenso Gefallen finden wie ein militärhistorisch geneigter Leser. Und jeden Hundefreund wird es sowieso erfreuen, seinen besten Freund an der Seite des Menschen durch die Epochen wandeln zu sehen, wie er ihm immer treu und hingebungsvoll dient. Kurzum: Ein fesselnder Versuch, ein faszinierendes Thema darzustellen, das bislang von der historischen Forschung weitgehend vergessen wurde.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 585
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gewidmet allen, die unschuldig leiden.
***
Wir werden noch manch Ähnliches, nichts Größeres zu berichten haben.
Hans Delbrück über die Schlacht bei Marathon.
ZUM AUTOR
Stefan Burkhart wurde 1968 in Liestal bei Basel / Schweiz geboren. Nach einer kaufmännischen Ausbildung weilte er zunächst in Frankreich und Korea. Außerdem erwarb er ein Publizistik-Diplom in Zürich. Er hat viele Artikel über Hunde und auch andere Themen publiziert. Er ist ein großer Hundenarr - derzeit allerdings ohne eigenen Hund und starker Betonung auf »Narr«. Er liebt die Hunde, natürlich. Aber anders als es die ernste Thematik dieses Buches erahnen ließe, bevorzugt er weniger das technische Training, geschweige denn die strenge Erziehung zu Gehorsam. Viel eher liegt ihm ausgiebiges Spielen und munterer Sport mit den Vierbeinern, wohl wissend um den unendlichen Reichtum, den alle Hunde in unser menschliches Leben zu tragen wissen. Für Geschichte und gesellschaftliche Themen hat er sich schon seit Jugendtagen interessiert. Und so kommen in diesem Buch drei Linien zusammen: das Flair fürs Schreiben, das Interesse an der Geschichte und die Liebe für die Hunde. Zuvor publizierte Bücher waren das Pitbull-Syndrom (2009), eine Analyse über gesellschaftliche Vorurteile und der Ausgrenzung von Minderheiten, in diesem Fall den Kampfhunden und ihren Besitzern. Es ist dies eine Problematik, die auch auf anderen Themenfeldern leider - nach wie vor aktuell bleibt. Mit dem Buch der Hund im Krieg (2015) näherte er sich erstmals umfassend dem Thema von Kriegshunden an. Auch zur lokalen Industriegeschichte hat er einen Beitrag geleistet mit dem 2018 veröffentlichten Buch die Geschichte der Florettspinnerei Ringwald AG. Es handelte sich dabei um eine der größten Spinnereien in der Schweiz, die bis 1957 im Niederschönthal, nahe Basel, domiziliert war. Stefan Burkhart lebt seit 2010 in Basel, wo er die Nähe zu Frankreich und Deutschland genießt.
INHALTSVERZEICHNIS
EINLEITUNG
Der Mensch ist die Krone der Schöpfung, meint er selbst. Der Krieg ist der Vater aller Dinge, sagt Heraklit. Und der Hund ist des Menschen bester Freund, wissen wir alle. Schiebt man diese drei Gewissheiten übereinander, so hat man eine unglaubliche Geschichte vor sich, die über viele Tausend Jahre reicht. Seit mindestens 15'000 Jahren trottet der Hund an der Seite des Menschen durch die Weiten der Weltgeschichte. Nach neuen Erkenntnissen könnten es sogar wesentlich mehr gewesen sein, vielleicht 100'000 Jahre. In dieser riesigen Zeitspanne fanden mit aller Sicherheit stets Kriege, Kämpfe und Konflikte statt. Die Inanspruchnahme der hündischen Fähigkeiten für im weitesten Sinne kämpferische Zwecke begann in tiefster Vorzeit und hat sich durch alle Epochen bis in die Gegenwart fortgeschrieben. Anders als Pferde oder Brieftauben, geschweige denn Kampfelefanten, stehen die Hunde in den Kriegen der Gegenwart nach wie vor an der Seite des Menschen, sogar mehr denn je und stets so, wie man sie schon immer kannte: treu bis in den Tod, motiviert bis in die letzte Körperzelle.
Bedenkt man jetzt, wie prägend Kriege in der Geschichte des Menschen sind, bedenkt man weiterhin, dass Hunde in diesen Kriegen stets in der einen oder anderen Form dabei waren, so fragt man sich etwas betrübt, wieso diese Thematik noch nie so richtig aufgearbeitet worden ist. Dieses schwarze Loch mit möglichst griffigem Material aufzufüllen, war bereits die Absicht meines 2015 erschienen Buches der Hund im Krieg, in dem es mir zumindest gelang, den Kenntnisstand zusammenzufassen und anzureichern. Natürlich war das Buch weder vollständig noch frei von Fehlern. Deshalb folgt dieses zweite Buch, in das viele Anregungen eingeflossen sind, die mir von interessierten Lesern zugeschoben wurden und für die an dieser Stelle herzlich gedankt sei.
Frage ist natürlich: Wieso hat das Thema noch niemanden richtig angepackt? Die Antwort scheint mir klar: Das Thema von Hunden im Krieg ist genau im Schnittpunkt von Kynologie und Militärgeschichte angesiedelt. Beides sind Stiefkinder anderer Disziplinen. So wird die Kynologie als Randgebiet der Zoologie, der Tiermedizin oder der Verhaltensforschung gesehen, während die Militärgeschichte bestenfalls eine Mauerblümchen-Existenz im langen Schatten der allgemeinen Geschichte fristet. Zumal im deutschen Sprachraum löst der Gegenstand noch heute Nasenrümpfen aus, zu vergiftet erscheint alles Militärische nach den Erfahrungen des Naziregimes zu sein. Wie auch immer:
Hund & Krieg ist eine Kombination, die weder in der breiten Öffentlichkeit noch im Mainstream-Milieu der Akademiker Begeisterungsstürme auszulösen vermag. Entsprechend leer nehmen sich die Literaturverzeichnisse aus. Wesentlich besser präsentiert sich die Ausgangslage im englischen und etwas besser im französischen Sprachraum. Das mag mit dem Status vor allem des Englischen als Weltsprache zusammenhängen, hat aber auch mit einem wacheren Blick dortiger Schreiber und Forscher zu tun.
Hier noch ein kleiner Hinweis auf meine Zitierweise: Angesichts der desolaten Quellenlage im Deutschen erstaunt es nicht, dass ich viele fremdsprachige Quellen zitiere, viel aus dem Französischen und Englischen, etwas aus dem Spanischen. Im Sinne einer besseren Lesbarkeit habe ich Zitate aus diesen Sprachen teilweise recht freihändig, aber inhaltlich akkurat ins Deutsche übersetzt. Auch Textquellen aus der antiken Literatur habe ich oft in dieser Weise wiedergegeben. Solcherlei ins Deutsche übertragene Zitate habe ich nicht in Anführungszeichen gesetzt. In Anführungszeichen erscheinen nur wörtliche Zitate aus deutschen Quellen oder wörtlich übersetzte Zitate aus fremdsprachigen Quellen.
Beim vorliegenden Buch habe ich den zeitlichen Rahmen eingegrenzt bis zum 1. Weltkrieg. Der 2. Weltkrieg gäbe das Material für ein eigenes Buch her. Zudem ist die Erforschung der kynologischen Belange in der Wehrmacht und SS äußerst schwierig. Hier stießen meine Kapazitäten an ihre Grenzen. Es bräuchte an dieser Stelle einen vor allem militärhistorisch versierten Rechercheur. Wiewohl das Hundewesen im 2. Weltkrieg eine gewiße Zentralisierung unter dem Dach der SS erlebte, verteilten sich die Hunde auf viele verschiedene militärische und bürokratische Einheiten. Schriftliche Dokumente, sofern noch vorhanden, müßte man aus vielen verschieden Archivbeständen zusam-mentragen, was nur möglich ist für jemanden, der bereits über fundierte, spezifische Vorkenntnisse verfügt, ohne die man sich in den Verästelungen der militärischen Infrastruktur im 3. Reich verirren würde. Besser ergründbar sind die Hundeeinsätze in den großen Kriegen nach dem 2. Weltkrieg, wie Algerien oder Vietnam, die ich in meinem Buch der Hund im Krieg ausführlich beschrieben habe. Zu den Kriegen der jüngsten Vergangenheit, etwa in Irak oder Afghanistan, findet der interessierte Leser sogar eine erfreulich umfangreiche Palette an Publikationen, allerdings fast nur in Englisch.
Wenn ich also den zeitlichen Horizont bis zum 1. Weltkrieg eingedampft habe, so bohrte ich dafür inhaltlich tiefer. Außerdem bin ich vom engen militärischen Verwendungszweck immer ausgeschweift in benachbarte Gebiete wie Bewachung, Sanitätsdienst, Kriminaldienst, Transport u.a., in denen Hunde stets hervorragende Dienste erbrachten. Wenn man den kämpferischen Einsatz der Hunde richtig würdigen will, darf man nicht auf das Militär im engen Sinn fixiert bleiben, sondern muss alle Aspekte menschlicher Konflikte abhandeln: offene Kriege, Kleinkriege, Aufstände, Terrorismus, Kriminologie, Sicherung, Stabilisierung, emotionale Aspekte usw. Gerade in militärischen Grenzbereichen und gerade in Konflikten tieferer Intensität stachen die hündischen Leistungen besonders hervor, bis heute.
Das vorliegende Buch ist jetzt mein zweiter Anlauf, die großartige und immer heroische Geschichte des Hundes an der Seite des Menschen im Krieg umfassend darzustellen. Natürlich muss man realistisch bleiben. Ein so großes Gebiet praktisch ohne vorausgehende Literatur zu erschließen, wird nicht in einem Anlauf, auch nicht in zwei gelingen. Wenngleich die Tiefe der Erkenntnis und die Breite des Materials maßgeblich ausgeweitet werden konnten, so tritt die vorliegenden Publikation beileibe nicht mit dem Anspruch an, perfekt oder abschließend zu sein. Das Buch versteht sich nicht zuletzt als Einladung an alle Interessierten, vielleicht selbst einmal auf diesem Feld zu recherchieren, die Erkenntnisse zu sammeln und auszutauschen, sich zu vernetzen, gerne auch direkt mit mir. Wer Fehler entdeckt, Ergänzungen, Lob oder Tadel anbringen will, der ist herzlich eingeladen, mich direkt zu kontaktieren.
VORGESCHICHTLICHE ZEIT
Viele Menschen gehen spontan davon aus, Krieg und Zank habe es seit Anbeginn der Zeiten gegeben, wobei sie in der Geschichte von Kain und Abel einen verblüffenden Beleg zu finden glauben, zumindest wenn man biblischen Texten einen handfesten Quellenwert beimisst. In einer nüchternen Betrachtung scheint zumindest gesichert, dass es Krieg bereits tief in prähistorischer Zeit gab. Eine der ältesten Fundstätten, die auf eine kriegerische Aktivität schließen lässt, liegt im Sudan. Zeitlich lassen sich die Funde auf zirka 12'000 - 10'000 v.Chr. datieren. Gefunden wurden Knochen und Projektile, die so eng ineinander vermengt waren, dass der Schluss naheliegt, die Projektile hätten zum Tod der Menschen geführt. Wahrscheinlich gab es aber schon weit früher Kämpfe zwischen Menschen. Allerdings blieb davon nichts übrig, was die Archäologie heute noch ans Licht befördern könnte. Es ist deshalb äußerst schwierig zu sagen, wann die ersten Kriege stattgefunden haben. Für unsere Zwecke dient die Feststellung: Krieg in der einen oder anderen Form muss es schon sehr, sehr früh gegeben haben und - vielleicht - seit immer.
Nun zur Frage, wie lange es schon Hunde gibt. Die Domestikation des Hundes setzte auf jeden Fall weit in prähistorischer Zeit ein. Entsprechende physische Nachweise sind bis zirka 12'000 Jahre alt. Die Domestizierung der ersten Hunde könnte aber viel weiter zurückliegen. Neuere Auswertungen von Schädeln deuten darauf hin, dass die Geschichte der Domestizierung bereits vor 30'000 Jahren begonnen hat. Genuntersuchung zeigen sogar, dass eine erste Typenbildung von Hunden schon vor 125'000 Jahren eingesetzt haben könnte, als sich deren Erbschaftslinien vom Wolf ablösten. Als sicher gilt, dass die Domestikation des Hundes einzig aus dem Wolf erfolgte. Ziemlich wahrscheinlich ist, dass der Hund eines der ersten domestizierten Wildtiere war. Die genauen Motive hingegen, weshalb sich der Mensch auf diese Symbiose eingelassen hat, liegen im Dunkeln. Gerade Hundeliebhaber gehen gerne davon aus, dass der Domestikation des Wolfes ein besonderes Motiv zugrunde gelegen habe. Verschiedene Funktionen werden ins Feld geführt. Womöglich haben sie als Wärmequelle gedient im Körperkontakt zum Menschen. Vielleicht hat man ihre Neigung, Kot zu fressen, genutzt. So konnten sie den Babies die Exkremente vom Popo wegfressen und einen Beitrag zur Hygiene im Lager leisten. Womöglich dienten sie als Lasttiere. Oft wird auch die Wachsamkeit ins Feld geführt. Überzeugend ist von alledem nichts. Die Domestikation des Wolfes erfolgte mit einiger Sicherheit nicht im Hinblick auf einen besonderen Verwendungszweck, sondern aus emotionalen Gründen. Die Funktionalitäten, die Hunde später einnahmen, haben sich erst lange Zeit nachher herausgebildet. Sie sind keine Ursachen, sondern Folgen der Domestikation.
Genauso war es mit den Kriegsdiensten, die der Hund dem Menschen leisten konnte. Der Mensch beobachtete das Verhalten des Hundes, der mittlerweile zu seinem treusten Begleiter geworden war. Dann fragte er sich aus der Tiefe seiner steinzeitlichen Intuition heraus: Welche seiner Eigenschaften kann ich mir am besten im Krieg und Kampf zunutze machen? Wann das zum ersten Mal geschah, lässt sich zeitlich nicht eingrenzen. Archäologische Evidenz für den Einsatz von Kriegshunden gibt es (wahrscheinlich) nicht. Es wäre auch praktisch undenkbar, die direkte Beteiligung eines Hundes an einem Krieg zweifelsfrei aus einem archäologischen Fund abzuleiten. Ein Hund, der tot bei Kämpfern auf einem Schlachtfeld liegt, muss nicht zwingend ein Kriegshund gewesen sein. Vielleicht war es nur ein Streuner, der an den Leichen knabberte und danach verendete? Vielleicht war es der Hund eines in den Kampf involvierten Mannes, der aber nicht am Kampfgeschehen teilgenommen hat. Oder er war zufällig zwischen die Fronten geraten und dann getroffen worden. Auch bildliche Darstellungen geben nicht viel her. Zum einen sind Darstellungen von Hunden sehr rar. Wenn man einen Hund zum Beispiel auf einer Malerei wahrzunehmen glaubt, so stellt sich sogleich die Frage: Handelt es sich wirklich um einen Hund oder um ein anderes Tier? Trifft man auf eine Szene, so stellt sich die Frage: Handelt es sich um die Szene eines Kampfes oder eher um eine Jagdszene? Bei allem ist man nie sicher: Wollte der Künstler überhaupt die Realität darstellen oder nur Fiktionen seiner Zeit? Kurzum: Das Spekulieren nimmt kein Ende. Wir begnügen uns daher damit, die Beteiligung von Hunden im Kampf und Krieg in den größeren Kontext der evolutionären Entwicklung zu stellen. Das können wir guten Gewissens tun, wenn wir uns einmal folgende Aspekte vor Augen führen:
BEWACHEN
Konrad Lorenz erzählt in seinem Buch Wie der Mensch auf den Hund kam eine spannende Geschichte: Schakale, so beschreibt er äußerst anschaulich, seien den menschlichen Horden gefolgt. Dabei habe sich eine Art Symbiose entwickelt. Der Nutzen für die Schakale waren abfallende Futterhappen. Der Nutzen für den Menschen bestand darin, dass er über eine Art Frühwarnsystem verfügte. Denn die Schakale heulten immer, sobald sich wilde Tiere dem Lager näherten. Ohne dieses Alarmsystem wäre an ruhigen Schlaf nicht zu denken gewesen. Raubtiere lauerten immer und überall.
So haben sich Mensch und Schakal immer mehr angenähert, bis es eines Tages zur Fütterung eines Schakals durch einen Stammesangehörigen kam. Angesichts des ständigen Nahrungsmangels war das natürlich eine Ungeheuerlichkeit. Da verfütterte einer wertvolle Fleischhappen an einen Schakal! Aber es war in der Tat eine große Weisheit. Denn die Menschen waren Nomaden und zogen ständig umher. Durch das Auslegen von Futter lockte man die Schakale hinter der Sippe her. Die Schakale folgten den Menschen und freundeten sich mit ihnen an. (vgl. Lorenz S. 7 - 9)
Zwar geht Lorenz fälschlicherweise davon aus, der Hund sei aus dem Schakal domestiziert worden. Doch das entsprach dem damaligen Wissensstand und tut dem Charme der These keinen Abbruch. Ein ähnliches Szenario wäre nicht weniger gut mit Wölfen möglich gewesen, die man durch Fütterung angelockt hätte.
Doch was hat das jetzt mit Hunden im Krieg zu tun? Mehr als man im ersten Moment denken mag: In diesem Anzeigen von Gefahren durch Wölfe, die dem Menschen folgten und langsam zu Hunden domestiziert wurden, kann man mit wenig Fantasie eine Art Wachfunktion sehen, worin man eine erste, vielleicht nicht gerade militärische, doch zumindest verteidigende Aufgabe erkennen kann.
Jetzt mag man einwenden: Hätte der Wolf überhaupt einen guten Wächter abgegeben? Hätte er beim Nahen von Gefahren auch geheult wie der Schakal in der Geschichte von Lorenz? Sicher ist, dass der Wolf über hervorragende Sinnesleistungen verfügt, die dem Menschen weit überlegen sind, was ihn befähigt, Gefahren viel früher anzuzeigen, als sie dem Menschen zu Ohr oder zu Auge kämen. Tatsächlich gehen gewisse Thesen davon aus, dass auch der Wolf eine Wachsamkeit hat, die sich der Mensch zunutze machte. Namhafte Autoren sehen das aber skeptisch. Der Kynologe Hans Räber schreibt im Buch Vom Wolf zum Rassehund: »Und was konnte der Mensch vom Wolf profitieren? Wölfe bellen nicht beim Nahen einer Gefahr; sie verziehen sich lautlos, eine Schutz- oder Wächterfunktion übten sie wohl kaum aus.« (Räber S. 21) Auch Erik Ziemen attestiert dem Wolf keine große Nützlichkeit bei der Anzeige von Gefahren. (vgl. Zimen S. 76 - 80)
Auch wenn es sich bei Räber und Zimen ohne Zweifel um Koryphäen der Kynologie handelt, nehmen wir uns die Freiheit, ihnen glatt zu widersprechen. Und weil wir uns ohnehin in einem spekulativen Terrain bewegen, schalten wir am besten den gesunden Menschenverstand ein: Wölfe oder Rudel von zutraulich gewordenen Wildhunden weilten in der Nähe des Menschen und verzogen sich, wenn sie Gefahr ahnten. Die Menschen studierten das Verhalten dieser vierbeinigen Begleiter und leiteten die Regel ab: Tiere weg. Ergo Gefahr kommt. Oder so: Tiere ziehen Schwanz ein. Ergo haben sie Angst. Ergo wittern sie eine Gefahr. Insofern konnte also durch ein feinfühliges Beobachten von - auch subtilen - Verhaltensänderungen der Tiere sehr wohl ein Nutzen für die Menschen abgeleitet werden.
Genau diesen Mechanismus hat der Kynologe Rudolf Schäme bestens erkannt und anschaulich beschrieben:
»Der eiszeitliche Mensch war ein Jäger. In kleineren oder größeren Horden schweifte er durch die Jagdgründe, um seine Nahrung zu erbeuten. Da hat er nun immer als Begleiter Wildhunde in seiner Nähe gehabt. Diese wußten, dass von der Mahlzeit der menschlichen Raubtiere meist etwas abfiel, sei es auch noch so spärlich. Wir finden heutzutage dasselbe: die Heulwölfe in Nordamerika begleiten die Indianer auf ihren Jagdzügen, und die Schakale den heutigen Reisenden auf seinen Expeditionen, wobei sie sich alle Abfälle und noch mehr aneignen. Sehr bald wird natürlich der eiszeitliche Mensch bemerkt haben, dass ihm diese kleinen Hunde nichts anhaben, nicht schaden konnten. Dagegen hatten sie eine sehr schätzbare Eigenschaft, nämlich das Herannahen ihm feindlich gesinnter Menschen oder Tiere viel früher, als er selbst es vermochte, und besonders auch bei Nacht, vermöge seiner Sinne wahrnehmen zu können. Schon aus dem Gebaren der Tiere konnte er auf diese Gefahren schließen, aber noch mehr, sie zeigten auch durch ihre Stimme, durch Hervorstoßen von kurzen, abgerissenen Lauten des Schreckens und der Warnung an, dass etwas nicht geheuer war.« (Schäme S. 10 - 11)
In anderen Worten: Selbst wenn der Mensch den Wolf oder den frühen Hund kein bisschen dressieren konnte, so war die Gegenwart solcher Tiere doch nützlich als Alarmgeber. Natürlich: Waschechte Wachhunde, so wie wir uns das heute vorstellen, waren das noch lange nicht. Es spricht einiges dafür, dass die ersten domestizierten Hunde sogar klein und ängstlich waren. Bis also ein imposanter Hund vor dem Eingang stand, der Eindringlinge durch Bellen anzeigte und diese sogar abwehrte, verging noch sehr, sehr viel Zeit. Dennoch sind die ersten Hunde in einer echten Funktion als Wächter schon weit vor dem Übergang zur landwirtschaftlichen Produktion entstanden. »Der Torfhund war während der Eiszeit zum über ganz Europa verbreiteten Haustier geworden. Bei Ausgrabungen einer steinzeitlichen Siedlung aus der Zeit um 8'000 v.Chr. in Wierde bei Bremen wurden Hundeskelette unter Türschwellen der Häuser gefunden. Der hier begrabene Hund sollte offensichtlich die bösen Geister vom Betreten des Hauses abhalten. Solch magische Vorstellungen reichen weit in die geschichtliche Zeit hinein. Daraus darf geschlossen werden, dass der Hund schon sehr früh als Haus- und Hofwächter diente.« (Räber S. 37 - 38).
Mit der Einführung der landwirtschaftlichen Lebensmittelproduktion wurde die Rolle des Hundes schlagartig viel wichtiger. Jetzt entstand etwas, was Jäger und Sammler gar nicht kannten: Vorräte. Diese Vorräte wiederum weckten die Begehrlichkeiten konkurrierender Stämme. Es kam zu Plünderungen. Auf der Gegenseite mussten sich die Gemeinschaften schützen, um die Plünderer abzuwehren. Am Anfang mögen das Keilereien gewesen sein. Doch letztendlich ist das die wichtigste Schablone, nach der Kriege bis heute ablaufen - nämlich als ein Kampf um Ressourcen. Die ersten großen militärischen Auseinandersetzungen im Zweistromland zeigten genau dieses Muster: Die Steppenvölker bedrohten die zu Stadtstaaten aufgestiegenen Gemeinschaften an den Flussläufen, weil sich dort verlockende Ressourcen konzentrierten und sich ein Angriff verlockend ausnahm. Und noch heute intervenieren Streitkräfte am liebsten dort, wo Öl aus der Erde sprudelt. Ironischerweise ist das nicht selten auch im Zweistromland, weshalb dieses verwunschene Gebiet in jüngster Zeit nicht zur Ruhe kommt.
Im Hinblick auf Hunde erkennt man sogleich eines: Wo es eine Siedlung zu verteidigen gab, da trat der Hund unvermeidlich in Aktion. Die Gabe des Hundes zum Bewachen jenes Raumes, den er als seinen Siedlungsraum ansieht, braucht weder Dressur noch eine spezielle Konditionierung. Jeder, der schon einmal an einer Haustüre geklingelt hat, hinter der sich ein oder sogar zwei, drei Hunde befanden, der weiß ganz genau, wovon die Rede ist. Hunde beschützen das Heim ihres Meisters, das auch ihr Heim ist.
In einer darwinistischen Sicht erkennt man aber noch viel mehr: Jene Gemeinschaft, die der anderen mehr Vorräte abluchsen konnte, verfügte über mehr Ressourcen und setzte sich in der Evolution durch, während die ausgeraubte Gemeinschaft ohne Nahrung verhungerte und unterging. Wenn nun aber der Hund dem Menschen dabei behilflich war, sich gegen Plünderer zu wehren, so muss seine Rolle in der Tat von evolutionsgeschichtlicher Tragweite gewesen sein. Ganz wie der englische Militärhundetrainer Richardson vor rund 100 Jahren klarsichtig erkannte: Die Gewohnheit des Bewachens wohne den Hunden seit prähistorischer Zeit instinktiv inne. Sie ist für die Menschheit so wertvoll wie die Kraft der Pferde, Lasten zu ziehen. (vgl. Richardson S. 190)
Fazit: Rudolf Schäme sagte es schon 1924 in einer Klarheit, die wir heute noch anerkennen sollten: »Es spielte also der kleine, furchtsame Hund zuerst die Rolle eines Wächters und Warners.« (Schäme S. 11)
BESCHÜTZEN
Jetzt kommt noch etwas hinzu. Der Hund verfügte nicht nur über exzellente Sinnesorgane. Darüber hinaus war er kräftiger und agiler als der Mensch. Außerdem fühlte er sich seinen menschlichen Bezugspersonen zugehörig. So kam irgendwann in ferner Vergangenheit der Tag, an dem ein Hund dazu überging, seinem Meister im Kampf aktiv beizustehen.
Wir wollen uns auf diesem ohnehin spekulativen Terrain gar nicht erst mit großen Theorien herumschlagen. Vielleicht war es profan so: Der Stamm auf dem Berg leidet an Hunger. Als Folge davon überfällt er das Lager des Stammes in der Ebene. Doch die haben Hunde. Die Keilerei zwischen den beiden Stämmen ist in vollem Gange. Da zeichnet sich ein Spektakel ab. Die Hunde der Verteidiger stürzen sich auf die Angreifer, beißen in ihre blanken Waden und ungeschützten Arme, springen sogar an ihnen hoch und reißen sie zu Boden. Die verdatterten Angreifer suchen das Weite, dicht bedrängt von den wütenden Hunden, die sie grimmig verfolgen. Dieser Vorgang dürfte weder Angreifern noch Verteidigern entgangen sein. Man hatte erkannt, dass die Hunde nicht nur aufmerksam waren, sondern überdies exzellente Kämpfer abgaben - und erst noch ganz spontan ohne Dressur.
Fazit: Wilhelm Gottschalk erkannte schön die evolutionäre Implikation des Bündnisses Mensch-Hund, als er 1920 schrieb: »Solange der Mensch auf der Erde wandelt, benutzt er den Hund als Beschützer und Gehilfen. Zumal in vorgeschichtlichen Zeiten, da der Kampf ums Dasein ein ganz anderer war als heutzutage, hätte der Mensch ohne seinen treuen Freund nicht bestehen können.« (Gottschalk S. 7)
GEMEINSAM JAGEN
Eine andere wichtige Aufgabe hatte der Hund auf der Jagd inne. Nicht selten liest man, die Jagd sei die erste Funktionalität des Hundes gewesen. Das ist aber mehr als fraglich. Die Teilnahme des Hundes an der Jagd setzte eine schon fortgeschrittene Symbiose mit dem Menschen voraus, die sich erst im Laufe eines langen Zusammenlebens ergeben haben dürfte.
Unbestritten ist aber: Der Hund wurde bereits in prähistorischer Zeit zum Jagdpartner des Menschen, was eine Ursachenkette von evolutionärer Bedeutung auslöste. Denn seine Hunde verhalfen dem Menschen zu mehr Erfolg beim Jagen. Folge eins: Er hatte mehr Nahrung. Folge zwei: Er vermehrte sich rascher und konnte sich gegen Konkurrenten besser durchsetzen.
Wie so etwas in der Praxis aussah, musste der Neandertaler am eigenen Leib erfahren. Über 10'000 Jahre lebten Homo Sapiens und Neandertaler parallel. Dann starb Letzterer aus, verdrängt durch den Homo Sapiens. Wieso war dieser dazu in der Lage? Was machte den Homo Sapiens so stark? Dazu gibt es eine faszinierende These. Und die lautet so: Der Homo Sapiens hatte Hunde, der Neandertaler dagegen nicht. Der Aufstieg des Homo Sapiens zur alles dominierenden Spezies könnte also nicht zuletzt mit dem Faktum zusammenhängen, dass er in der Lage war, den Hund zu domestizieren und auf der Jagd einzusetzen.
Wie genau der Einsatz von Jagdhunden in diesen frühen Tagen ausgesehen haben mag, ist schwer zu fassen. Ganz bestimmt hing es von vielen Parametern ab: Welche Tiere standen überhaupt als Beute zur Verfügung (groß, klein, schnell, langsam usw.)? Was war der Entwicklungsstand der Geräte? Gab es nur Äxte oder Keulen, die praktisch den Körperkontakt zur Beute erforderten? Oder gab es den Speer, der bereits eine größere Distanz zum Beutetier erlaubte? Gab es Fallen, Seile, Netze? Welche Taktik wandten die Jäger an? Große Tiere etwa wurden eingekreist und mit einer Axt oder einem Speer aus naher Distanz unter hoher Gefahr für den Jäger erlegt. Oder sie wurden über einen Felsen gehetzt, so dass sie in den Tod stürzten.
Hunde haben dabei vielleicht geholfen, indem sie die Beute einschüchterten, hetzten, bissen. Ein Hund aber, den man auf ein wildes Tier hetzten konnte, den konnte man früher oder später auch auf einen menschlichen Feind hetzen. Man mag jetzt einwenden, der Mensch passe nicht ins Beuteschema des Hundes. Mag sein, aber ein Mammut oder ein Hirsch passt wahrscheinlich auch nicht ins Beuteschema eines kleinen Jagdhundes. Trotzdem konnte man Hunde auf diese Tiere abrichten, weil man es ihnen zeigte.
Etwas anderes sollte sich indessen als viel wichtiger erweisen: Schnelles aber nicht so wehrhaftes Wild ließ sich mit Pfeil und Bogen jagen. Der Mensch konnte den Pfeil auf große Distanz abschießen und so auch wendige Tiere erreichen. Das war gut. Doch es gab einen Nachteil. Ein Pfeil verletzte nur. Die Beute floh, unerreichbar für den langsamen Menschen. Genau dieser Umstand war womöglich die große Sternstunde des Hundes. Denn nur der Hund konnte die Spur des angeschossenen Tieres aufnehmen und wurde so zum unentbehrlichen Gehilfen des Menschen. (vgl. Zimen S. 128 - 129) Gerade die Fähigkeit des Hundes, mit der Nase einer Spur zu folgen, war wohl eine der nützlichsten Fähigkeiten auf der Jagd - und ihr sollte später in einem militärischen Kontext noch ganz erhebliche Bedeutung zukommen, wie wir sehen werden. Ein Hund, den man dressieren konnte, einem fliehenden Wildtier auf der Spur zu folgen, dem konnte man früher oder später auch beibringen, einem flüchtenden oder sich zurückziehendem Feind zu folgen.
Roman Marek hat wie folgt auf den Zusammenhang zwischen Jagd und Krieg hingewiesen:
»Die Forschung ist zwar darüber uneinig, ob sich der Hund tatsächlich freiwillig dem Menschen anschloss; als gesichert gilt jedoch, dass Hunde bereits vor Entstehung der Viehzucht als Wachhunde und Jagdhelfer, aber auch als Nahrungsergänzung genutzt wurden. Die Mensch-Hund-Beziehung beruht auf zwei großen Gemeinsamkeiten: auf einem ähnlichen Jagdverhalten (Laufen und Hetzen, Treiben auf freier Bahn) sowie auf einer ähnlichen Lebensweise (im sozialen Verband, mit hierarchischen Strukturen, Aufgabenteilung und Fürsorge). Aufgrund dieser Analogien besaß der Hund natürliche Instinkte, die eine Integration in die menschliche Gemeinschaft bereits zu einem Zeitpunkt ermöglichten, bei dem man von Domestizierung in Ermangelung eines Hauses eigentlich nicht sprechen kann. Da die Jagd gewissermaßen als Urahn des Krieges angesehen werden muss, erscheint es geradezu konsequent, dass Hunde den Menschen auch in den Krieg begleiteten. So wurden aus Jagdhunden Militärhunde.« (Marek in Pöppinghege S. 266)
Fazit: Die Fähigkeiten des Hundes, die man auf der Jagd ausnutzte, konnte man auch bei der »Jagd« auf menschliche Feinde ausnutzen.
HERDEN VERTEIDIGEN
Die Einführung der Landwirtschaft brachte einschneidende Veränderungen. Wahrscheinlich trug der Hund wesentlich dazu bei, dass es überhaupt so weit kam. Die Jagdgemeinschaft von Hund und Mensch war so erfolgreich, dass die Beutetiere knapp wurden, was den Menschen zwang, zu einer ganz anderen Produktionsweise von Lebensmitteln überzugehen. Er begann, Tiere und Pflanzen zu domestizieren. Das war der Beginn der Landwirtschaft. Die erste Phase dieser folgenschweren Revolution erfolgte an den Rändern Mesopotamiens vor rund 11'000 Jahren. Mit der Domestizierung von Nutzpflanzen und -tieren konnte die Nahrungsproduktion explosionsartig gesteigert werden. Resultat: steigende Bevölkerungszahlen.
In militärischer Hinsicht war die Einführung der Landwirtschaft ebenfalls einschneidend. Jared Diamond schreibt in seinem Buch Arm und Reich: »Wie wir sehen werden, war die Einführung der Landwirtschaft eine wichtige Etappe auf dem Weg, der zur militärischen und politischen Überlegenheit einiger Völker über andere führte.« (Diamond S. 91) Jene Völker, die bereits auf die landwirtschaftliche Produktion umgestellt hatten, verfügten über mehr Ressourcen. Mit der Landwirtschaft veränderte sich zudem die soziale Organisation der Gesellschaft. Die Hierarchie wurde steiler als in Jäger- und Sammlergesellschaften. Eliten entstanden. Erstmals gab es nun auch »Berufe«, die sich nicht mehr unmittelbar um die Nahrungsbeschaffung zu kümmern hatten. Dazu zählten etwa professionelle Krieger. Wie Diamond folgert: »Diese komplizierteren politischen Gebilde sind viel eher zur Führung längerer Eroberungskriege imstande als egalitäre Scharen von Jägern und Sammlern.« (Diamond S. 96)
Ein Aspekt ist besonders spannend: Indem der Mensch nun in der Lage war, Nutztiere zu halten, geriet er in ein neues Konkurrenzverhältnis zu wilden Raubtieren. Wölfe etwa bedrohten die Schafherden, eine Problematik, die bis heute Brisanz birgt. Folglich mussten die Herden beschützt werden. Diese Aufgabe übernahm mitunter der Hund. Es entstanden kräftige Herdenschutzhunde, die Angriffe von wilden Tieren abwehren konnten. Der Übergang von solchen Herdenschutzhunden zu Militärhunden wiederum war bestimmt fließend.
Fazit: Ein Hund, der fähig war, Wölfe, Bären und anderes kräftiges Wild vom Zugriff auf eine Herde abzuhalten, der konnte auch im Krieg und Kampf gegen menschliche Angreifer eingesetzt werden.
SEIT JAHRTAUSENDEN IM EINSATZ
Das Gesamtfazit aus alldem könnten wir nicht schöner formulieren, als es schon Robert Gersbach 1922 getan hat:
»Nicht aus Liebhaberei gesellte sich der Mensch den Hund zu; allein der Selbsterhaltungstrieb bestimmte ihn. Sollte er sich erhalten und durchsetzen, wollte er sich die Tiere seiner Umgebung untertan und nutzbar machen, sich ihrer Angriffe erwehren, so brauchte er einen Gehilfen, der geeignet war, ihn und seine Fähigkeiten zu ergänzen. (...) Mit Hilfe des Hundes ist der Mensch emporgestiegen; dieser wurde bald sein unentbehrlicher Genosse.« (Gersbach S. 148)
Anfügen brauchen wir dem nichts oder nur dies: Wenn der Hund des Menschen Genosse wurde, um Tiere zu unterwerfen und sich ihrer Angriffe zu erwehren, dann konnte der Hund ebensogut sein Genosse werden, wenn es galt, andere Menschen zu unterwerfen und sich ihrer Angriffe zu erwehren. Und so etwas nennen wir Krieg, der Hund als Kriegsgenosse des Menschen also, der ihm treu durch die Jahrtausende diente.
STARKE HUNDE IN ÄGYPTEN UND MESOPOTAMIEN
»Als gegen 2000 bis 1000 v. Chr. Babylonier, Assyrer und andere Völker feindliche Dörfer und Städte überfielen und die Vorherrschaft in Vorderasien erlangten, führten sie kräftige Hunde, sogenannte ›Löwenpacker‹ mit sich, mit deren Hilfe sie die Völker aus den Stromtälern des Euphrats, Tigris und des Nils unterwarfen. Die Hunde trugen dabei nicht nur breite Lederhalsbänder, sondern auch regelrechte ›Kampfanzüge‹ aus starkem Leder, die Rücken und Bauch vor Speer- und Pfeilspitzen schützten. Oftmals trugen diese Hunde auch Halsbänder mit großen Messern oder Pechfackeln. Man leitete sie in die Kavallerie des Feindes, damit sie die Pferde durch Schnittverletzungen oder Verbrennungen in die Flucht schlugen. Vor Aufkommen der Feuerwaffen waren Kriegshunde eine bedeutende Waffengattung. Fußsoldaten hatten eine Todesangst vor ihnen, und beim Einsatz gegen Reiter waren sie oft sehr effektiv.« (Steinfeldt S. 26)
Dieser Text stammt aus der Dissertation von Andrea Steinfeldt. Sie hat viele Quellen zum Thema Kampfhunde zusammengetragen. Auf den ersten Blick klingen die Berichte sensationell. Als Hundeliebhaber ist man rasch geneigt, alles begierig zu glauben. Doch wir werden aufzuzeigen haben, dass solche Schilderungen wenig bis nichts mit der Realität zu tun haben. Vielmehr sind es Legenden, die im Laufe der Zeit als Literatur kondensierten. Was Hunde im Krieg anbelangt, so fällt die Bilanz sehr ernüchternd aus. Es gibt zwar Hinweise. Aber es sind wenige und erst noch wenig eindeutig.
Am berühmtesten sind die Malereien auf einer Holztruhe beim Grab von Tutanchamun. Das Werk entstand um zirka 1300 v.Chr. Hoch zu Ross fegt der Pharao seine Feinde gleichsam von der Bildfläche, wobei ihn die Kampfhunde aktiv unterstützen. Die Szene ist so pathetisch, dass wir ohne fackeln annehmen dürfen, da ging es nicht um die Darstellung von Realität, sondern um die Vermehrung von Ruhm. Bild S. →
Spannend ist ein beschlagener Stein aus der Zeit des Mittleren Reiches, den wir uns etwas näher anschauen. Er wurde 17 Kilometer von Luxor entfernt gefunden und dann einem Händler verkauft, der ihn nach Berlin brachte. Auf dem Stein sieht man einen Mann und eine Frau sowie fünf Hunde. Außerdem sind Hieroglyphen eingemeißelt. Ein Teil dieses Textes lautet:
Ich bin ein Jüngling des Drauflosschlagens, ein Anführer des Heeres am Tage der Bedrängnis; einer, dessen (Ausführung eines) Auftrages sein Herr lobt. Ich bin bis zur westlichen Oase gelangt, habe alle ihre Wege durchsucht und den Flüchtling zurückgebracht, den ich in ihr fand; die Truppe blieb wohlerhalten, und es gab bei ihr keinen Verlust; was mir anvertraut war, kam glücklich heim. Mein Herr bestellte mich zu ihrem Schutze, als seinen vertrauten Verwalter, weil ich den Auftrag meines Herrn so trefflich ausführte.
(aus Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde 65. Band 1930)
Rudolf Anthes interpretierte in obiger Zeitschrift die Szene so: Der Bericht lasse auf eine Polizeistreife schließen, die in den Osten gesandt wurde, um dort Ordnung zu schaffen. Dabei wurden einige Geflohene aufgegriffen und zurück in den zivilisierten Siedlungsraum gebracht. Offensichtlich diente die Oase als abgelegener Zufluchtsort für Verbrecher oder vielleicht für politisch Verfolgte. Bild S. →
Wir Hundefreunde fragen sogleich: Was zum Teufel haben die Hunde an der Seite der Patrouille getan? Und da beginnen schon wieder die Zweifel. Es ist alles andere als klar, welche Funktion sie im Gesamtwerk einnehmen. Bemerkenswert ist, dass die zweite Person eine Frau ist. Das spricht nicht unbedingt für einen robusten Einsatz, zumal sie einen Arm erkennbar zärtlich auf die Schulter des Mannes legt. Auch sind die Hunde sehr klein und schlank. Wir erkennen in ihnen Jagdhunde, keinesfalls aber kräftige Begleiter, denen man zugetraut hätte, ihren Meister zu verteidigen. Vielleicht wiesen sie die Fährte? Vielleicht waren es die privaten Jagdhunde des Patrouillenführers, der sie zum Vergnügen mitlaufen ließ? Oder haben die Hunde gar nichts mit der Patrouille zu tun? Vielleicht hat sie der Künstler einfach ins Werk eingebaut, so ähnlich wie sich heute ein Popstar oder ein Sportler gerne mit seinem privaten Hund ablichten lässt, obwohl der Hund natürlich nichts mit seiner musikalischen oder sportlichen Leistung zu tun hat. Kurzum: Wir können die Szene auf keinen Fall verallgemeinern und sagen, polizeiliche oder militärische Patrouillen seien damals regelmäßig von Hunden begleitet worden.
Einen Tick überzeugender ist eine Skulptur bei einem Tempel nahe der Stadt Palaikastro ganz im Osten Kretas. Ein Pferd zieht einen Kampfwagen, in dem ein Soldat steht. Dahinter folgen zwei weitere Soldaten mit Rundschild, Lanze und Helm. Neben dem Pferd prescht ein kräftiger Hund deutlich erkennbar nach vorne. Die Skulptur gehörte wahrscheinlich zum Zeustempel. Sie ist also (auch) eine mythologische Darstellung. Mutmaßlich ist diese Skulptur in die Bronzezeit zu verorten. Kampfwagen und runde Schilder deuten darauf hin. Es dürfte eindeutig keine Jagdszene sein, dagegen spricht der Kampfwagen und die Schilder. Außerdem springt der Hund nach vorne, was ihm eine gewisse Aggressivität verleiht. Bild S. →
Es mag durchaus noch andere ähnliche Darstellungen geben. Aber alles in allem muss man eindeutig zugeben: Es ist schwierig, dies alles richtig zu interpretieren, ja, es ist im Grunde genommen unmöglich. Folglich also: Kunstwerke und Inschriften können gewisse Anhaltspunkte liefern. Wir dürfen uns aber nicht auf sie verlassen, sonst driften wir ins Fantasieren ab.
Nicht nur Bilder, auch alte Texte geben mitunter etwas Aufschluss. Auf einem Kalksteinblock in Gizeh fand man eine erhaltene Inschrift aus der Zeit des Alten Reiches. Sie muss also um 2'000 Jahre v.Chr. entstanden sein. Darauf stand sinngemäß: Der Hund war der Bewacher seiner Majestät und begleitete den König in die Schlacht und unterstützte ihn beim Überwachen der Wüste. Offensichtlich wurde der Hund zusammen mit dem König beerdigt. (vgl. Karunanithy S. 69)
Spannend ist sodann der Brief eines ägyptischen Offiziers, der zur Zeit der 18. Dynastie (1540 - 1307 v.Chr.) in Palästina diente. Im Brief steht: Es gibt 200 große Hunde und 300 Wolfshunde, zusammen 500. Jeden Tag stehen sie an der Türe des Hauses bereit, wann immer ich herausgehe. Was wäre wohl, hätte ich nicht den kleinen Wolfshund von Nahréh bei mir im Hause, ein königlicher Spross? Er schützt mich vor ihnen. Zu jeder Stunde ist er bei mir als mein Führer auf der Straße, wo immer ich hingehe. (vgl. Brodrick S. 78) Wo der Brief genau gefunden wurde und wo er derzeit aufbewahrt ist, konnte ich leider nicht ausfindig machen. Wenn man aber davon ausgeht, dass dem Text ein Funken Realität innewohnt, so kann man daraus folgendes ableiten:
Es gab ziemlich viele und lästige Streuner. Diese Annahme ist nicht abwegig. Die Städte waren voller Pariahunde.
Die Soldaten führten eigene Hunde mit, um sich diese Streuner vom Leibe zu halten. Auch diese Annahme kann man durchgehen lassen. Hunde, die lästige Tiere von ihrem Herrn fernhielten, gab es zu jeder Zeit.
Man könnte diesen Gedankengang noch weiterspinnen und sagen: Die Begleithunde der Soldaten richteten sich nicht nur gegen Streuner, sondern gegen jede Art von Angreifer. Damit wären wir bei einer Art Patrouillenhund, wie er noch heute als Begleiter kleiner militärischer Einheiten geschätzt wird.
Schauen wir uns jetzt einmal an, welche Stellung der Hund damals in der Gesellschaft innehatte und versuchen, daraus eine schärfer gezeichnete Evidenz abzuleiten. Die Ägypter gaben den Hunden Namen und ließen die liebsten unter ihnen ins Haus. Beim Ableben ihres Meisters wurden Hunde manchmal einbalsamiert und folgten ihrem Herrn auf die Totenreise. Überschätzen darf man das zwar nicht. Die Ägypter haben ja alle möglichen Tiere einbalsamiert. Dennoch ist übers Ganze gesehen klar: Die Leute in Ägypten und mit großer Wahrscheinlichkeit auch in ähnlich entwickelten Zivilisationen liebten die Hunde gar nicht viel anders, als wir es noch heute tun. Bild S. →
Mehr als nur das: Man betrieb eine zielgerichtete Zucht. So entstanden verschiedene Hundetypen. Einer der ältesten dieser Typen war der Tesem, eine Art Windhund, der in Ägypten beliebt war und ab dem 4. Jahrtausend v.Chr. auf Abbildungen erscheint. (vgl. Zimen S. 150 - 151)
Nur wenig später erscheinen Darstellungen von schweren Doggen. Allerdings setzte die Typenbildung schon weit in prähistorischer Zeit ein. Nur sind halt davon keine archäologischen Zeugnisse übriggeblieben. Kurzum: Der Mensch war schon in tiefster Steinzeit in der Lage, bestimmte Hundetypen für wohl definierte Funktionen herauszuzüchten.
Es spricht einiges dafür, dass die großen Doggen eher die Spezialität der Menschen in Mesopotamien waren, während es die Ägypter vorzugsweise mit feinen Windhunden hielten. In einer Zeitschrift wurde das so analysiert: «Betrachten wir in den kürzesten Zügen die hauptsächlichsten Hunderassen jener alten Kulturstaaten, so lässt sich leicht feststellen, dass in Ägypten mehr die Neigung zur Züchtung kleinerer, in Assyrien und Babylonien diejenige zu schwereren Formen herrschte.« (Centralblatt vom 26.7.1901)
Uns interessieren natürlich die großen, schweren Typen. Denn sie verkörpern jenen Hundeschlag, den man sich besonders gut als deftigen Kämpfer vorstellen kann.
Dazu gibt es wunderbare Kunstwerke. Von märchenhafter Schönheit ist die Skulptur des Hundes von König Sumu-Ilum aus Larsa, einer Stadt der Sumerer südöstlich von Uruk. Heute befindet sich die Statue im Louvre in Paris. Das Kunstwerk entstand Ende des 3. Jahrtausends v.Chr. Erstaunlich ist, dass man sogar die Gestik des Hundes lesen kann. Er liegt, ist dabei sehr aufmerksam und angespannt. Es scheint, als wolle das kräftige Tier sich sogleich erheben. (vgl. Aynard in Brodrick S. 56 - 57)
Nicht weniger eindrücklich ist das Relief einer riesigen Dogge aus Assyrien, das vom britischen Archäologen Henry Rawlinson in Birs Nimrud (Irak) gefunden wurde. Der Hund ist so massig dargestellt, dass es sich ohne Zweifel um eine Übertreibung handelt. Man kann sicher sein, dass die Größe auch bei anderen Darstellungen übertrieben wurde. Imponiergehabe war damals so verbreitet wie heute. So ließ man sich halt ein Relief mit einer Riesendogge anfertigen, deren Größe künstlerisch etwas nach oben korrigiert wurde - ähnlich im Übrigen, wie es heute im Handyzeitalter üblich ist, dass man Fotografien (vorzugsweise jene von sich selbst) mit einer ausgeklügelten Software aufpeppt, auch wenn die Realität nicht ganz so wunderbar aussieht. Es sind ästhetische Tricks, auf die wir auch mit einem Zeitabstand von einigen Tausend Jahren nicht hereinfallen sollten. Bild S. →
Trotz solchen Übertreibungen dürfen wir bestimmt dieses Fazit ziehen: Die Leute in den frühen Hochkulturen waren in der Lage, Furcht einflößende, starke und wohl bissige Doggen zu züchten. Der gesunde Menschenverstand lässt den Schluss zu, dass eine solche Dogge schon mal einen Dieb oder Unhold am Kragen oder Gesäß packte. Aber hätte man diese Bestien auch im Krieg gebrauchen können? Die Antwortet lautet: womöglich, aber nur selten.
Man braucht nur den Stand der damaligen Waffentechnik anzuschauen... und schon wird man sehen, dass Hunde kaum etwas ausrichten konnten. Mit den ersten Hochkulturen bildeten sich immer größere Gemeinwesen heraus, aus denen schließlich große Reiche entstanden. Mit der nunmehr wachsenden wirtschaftlichen Potenz und der zunehmenden kulturellen Entfaltung traten durchorganisierte militärische Verbände auf. Es kam zu den ersten großen Schlachten der Geschichte. Wir befinden uns zwar noch in der Bronzezeit. Dennoch sollte man die Schlagkraft damaliger Armeen nicht unterschätzen.
Auf der berühmten Geierstele (heute im Louvre) sieht man bereits klar eine Phalanx. Die Sumerer waren also in der Lage, gut geführte, geschlossene Einheiten zu bilden, wenngleich sich ihre Phalanx noch nicht so kompakt präsentierte wie später eine griechische oder makedonische. Als Waffen setzte man Spieß, Wurfspeer, Dolch, Schwert, Pfeil und Axt ein. Daneben gab es Kampfwagen, die als Plattformen für Bogen- und Speerschützen dienten. Etwas dürftig waren die Panzerungen. Zumindest erscheinen uns Beine und Füße auf Bildern manchmal völlig ungeschützt.
Große Meister der Kriegerkunst waren die Assyrer, deren Aufstieg um 1300 v.Chr. begann. Sie stellten erstmals Reitertruppen auf. Das Pferd diente fortan nicht alleine dazu, den Kampfwagen zu ziehen. Vielmehr kämpften nun Soldaten mit Lanze oder Pfeil vom Rücken des Pferdes aus. Die Assyrer setzten auch massiv Bogenschützen ein, was ihrer Infanterie zu großer Durchschlagskraft auf weite Distanz verhalf. Außerdem verbesserten sie die Panzerung und verfügten über furchterregende Belagerungsmaschinen, sozusagen die schwere Artillerie jener Zeit.
Die Ägypter waren waffentechnisch weniger gut unterwegs, zumindest lange Zeit, danach holten sie auf. Dies hing mit der peripheren Lage des Landes zusammen. Ägypten grenzt im Süden und Westen an Steppengebiete, im Osten bildete das Rote Meer, im Norden das Mittelmeer eine schützende Front. Bleibt also nur die Landenge beim Sinai als Einfallstor, das aber gut zu verteidigen war. Ägyptische Armeen waren daher schlecht gerüstet und verfügten insbesondere über dürftige Panzerungen. Erst nach dem Einfall der Hyksos um 1700 v.Chr. rüsteten sie auf.
Vor diesem militärhistorischen Gesamtbild sehen wir eines: Es braucht wirklich viel und wilde Fantasie, um sich vorzustellen, dass damals Hunde als kämpfende Partei etwas hätten ausrichten können.
Vielleicht so: Wie wir gesehen haben, waren die Panzerungen eher dürftig. Zogen die Soldaten damals tatsächlich mit ungeschützten Gliedern in die Schlacht, so wäre das fast eine Einladung gewesen, bissige Hunde auf sie zu hetzen. Wie effizient das gewesen wäre, kann sich jeder vorstellen, der schon einmal von einem Hund gebissen oder nur von seinen Krallen traktiert wurde. Stellen wir uns vor, wie zwei feindliche Formationen in der Zeit der Sumerer aufeinander losgehen. Zuvorderst die mit Schilden bewehrte erste Reihe, dahinter mehrere Reihen, die ihre Spieße nach vorne gesenkt halten und dem Ganzen den Ausdruck eines Igels geben. Streitwagen und leichte Infanteristen treten in Aktion mit dem Ziel, die feindliche Front aufzuschlitzen. Um zusätzliche Verwirrung zu stiften, lassen jetzt die Angreifer ein Rudel Hunde los, die sofort auf die Feinde zurennen uns sie in Füße und Beine beißen. Die Verteidiger versuchen, die Hunde mit ihren Spießen abzustechen. Doch das Hantieren des langen Schaftes in der engen Formation ist sehr eingeschränkt. Daher erstechen sie die vierbeinigen Angreifer mit ihrem Dolch, den sie als Zweitwaffe unter dem Kleid tragen. Winselnd verenden die Hunde im eigenen Blut. Aber ihr Opfer war nicht umsonst. Sie haben es geschafft, Verwirrung in die feindliche Linie zu tragen. Einige Soldaten gingen sogar zu Boden. Die Front des Gegners ist angekratzt. Natürlich ist das Spekulation. Es gibt keine Beweise. Aber es ist ein leidig plausibles Gedankenspiel.
Auf der anderen Seite: Hätte es ganze Hundearmeen gegeben, die sich die schlechte Panzerung zunutze gemacht hätten, so hätte dies sofort zu einer Verstärkung der Panzerung geführt, was den Einsatz der Hunde wiederum unnütz gemacht hätte. Insofern zeigt die Schwäche der Panzerung eher, dass eben keine bissigen Hunde im Einsatz gewesen sein können.
Ein weiterer Punkt spricht gegen den Masseneinsatz von Kampfhunden: Ohne Zweifel war man in der Lage, gute Jagd- und Wachhunde zu dressieren, auch Herdenschutzhunde. Die Hundedidaktik - wenn man so will - war auf einem hohen Stand. Aber hätte man Hunde für eine groß angelegte Attacke dressieren können? Wohl kaum. Ein Hund sieht den Menschen prinzipiell als Sozialpartner und nicht als Feind. In einer konkreten Bedrohungssituation mag er zwar erkennen, wer der Angreifer ist. Er weiß genau, wen er zu beißen hat, wenn ein Feind ins Haus eindringt oder seinen Meister bedroht. Es ist aber schier unmöglich, einem Hund in einer abstrakten Art und Weise beizubringen, wer Freund oder Feind ist. Im Schlachtgetümmel mit Hunderten von Menschen kann ein Hund schlicht und einfach nicht wissen, wen er zu attackieren und wen er zu schonen hat.
Wenn wir jetzt das alles anschauen, ist klar: Für Hunde - und seien sie noch so heroisch - gab es angesichts der damaligen Waffentechnik und Taktik eigentlich nichts zu tun in einem operativen Sinn. Bestimmt aber wurden Hunde von Kriegern immer wieder ins Feld geführt, sozusagen als private Begleiter, ganz ähnlich wie die Reiter ihre Pferde aus dem Zivilleben mit ins Feld führten. So gelangten Hunde in die Nähe kämpfender Truppen. Denkbar ist sodann, dass es einzelne Hunde gab, die in spontaner Manier in einen Kampf eingriffen und dann halt bissen oder sogar töteten.
Nehmen wir zur Veranschaulichung jenes imposante Relief aus dem Assurbanipal-Palast in Ninive (7. Jahrhundert v.Chr.). Es zeigt einen Mann mit einem eindrücklichen Mastiff. In der rechten Hand hält er einen langen Spieß, in der linken die Leine, die durch den Zug des Hundes gespannt wird, der seinen Kopf charakteristisch zu einer Drohgebärde nach vorne streckt und seinen Nasenrücken in Falten legt. Solche Hunde unterstützten König Assurbanipal (und bestimmt auch andere gehobene Herrschaften jener Zeit) bei der Löwenjagd, die als besonders prestigeträchtig galt, wobei man eines sehen muss: Die Jagd erfolgte nicht auf wilde Löwen. Oft wurden Jagden in einer Arena inszeniert. Die Löwen wurden in den Ring getrieben und abgeschlachtet. Der Hund auf dem Relief war wohl ein Wachhund, der dafür zu sorgten hatte, dass die Löwen nicht aus der Arena flüchteten. Man kann sich nur allzu gut vorstellen, wie ein solches Biest reagiert hätte, wenn es sein Meister auf einen Feldzug mitgenommen hätte. Vielleicht hätte es gesehen, wie sein Herr angegriffen wurde. Ohne zu zögern hätte sich ein solcher Hund auf den Feind gestürzt und ihn arg vermöbelt. Bild S. →
Alles in allem kann man sich drei Einsatzgebiete für Hunde im Krieg der damaligen Zeit vorstellen: 1) Sie konnten die eigenen Soldaten im physischen Kampf beschützen (so wie jeder gute Hund seinen Meister spontan beschützt). 2) Dank ihren guten Sinnesorganen konnten sie die Soldaten vor Gefahren warnen, etwa bei Dunkelheit (so wie es jeder gute Hund tut, der ein Heim oder ein Nachtlager bewacht). 3) Dank ihrer guten Nase konnten sie eine Fährte aufnehmen und die Soldaten zu einem feindlichen Versteck hinführen (so wie jeder gute Jagdhund seinen Meister auf der Fährte des Wildes hält). Kurzum: Es waren dies allesamt Fähigkeiten, über die Hunde im Zivilleben ohne Zweifel verfügten. Es spricht nichts dagegen, dass man solcherlei Fähigkeiten auch in einem militärischen Umfeld zumindest dann und wann einzusetzen wusste.
INDISCHE HUNDE UND TIBETDOGGE
Allerlei Berichte von großen und kampfstarken Hunden aus dem sagenumwobenen Indien machten seit der Antike ihre Aufwartungen in der Literatur - und werden mitunter bis heute naiv zitiert. Dabei lieferte schon der griechische Geschichtenschreiber Strabon einen skurrilen Bericht ab, dem man auf den ersten Blick ansieht, dass er »so« nicht stimmen kann: Demnach gab es im Land der Prasii in Indien einst tapfere Hunde. Wenn sich diese Bestien in ein Objekt festbissen, so ließen sie erst wieder los, als ihnen Wasser in die Nüstern gespritzt wurde. Einige dieser Hunde bissen so fest zu, dass sich ihre Augen verdrehten und manchmal gar herausfielen. Sogar mit einem Löwen und einem Bullen nahmen sie es auf. Sie verbissen sich in die Nase des Bullen und ließen nicht mehr los, bis er überwältigt war. (vgl. Geographika Buch 15 Kap. 1 Abs. 37)
Aristoteles, immerhin ein Schwergewicht unter den Denkern des Westens, legte sogar noch einen oben drauf: Die indischen Hunde, so fabulierte er in seiner Tierkunde, gingen aus der Paarung von Hunden und Tigern hervor jedoch nicht bei der ersten Begattung, sondern erst bei der dritten. Man führe Hündinnen gefesselt in die Wüste. Viele würden aufgefressen, wenn das wilde Tier, das sie begatten sollte, nicht in der Brunst sei. (vgl. Buch 8.28.167).
Noch 400 Jahre später schrieb Plinius in seiner Naturkunde ähnlichen Unsinn: Die Inder trachten die Hunde von den Tigern begatten zu lassen. Deshalb binden sie die Weibchen zur Laufzeit in den Wäldern an. Die Jungen des ersten und zweiten Wurfs halten sie für zu wild. Erst den dritten Wurf ziehen sie auf. (vgl. Buch 8 Abs. 61)
Verglichen damit wirkte es schon fast bieder, was Xenophon in seinem Jagdratgeber empfahl. Für die Jagd auf Dammwild und Hirschen empfahl er, indische Hunde einzusetzen. Diese seien stark, groß und voller Leidenschaft. (vgl. Kynegetikos Kap. 9 Abs. 1 - 4)
Quintessenz all dieser Texte war die Annahme, in Indien läge der Ursprung besonders wilder Hunde, die sodann in den Westen gelangten, um sich hier weiter zu verpaaren. Die Idee einer massenhaften Einwanderung von Haustieren aus dem Osten schwang gegen Ende des 19. Jahrhunderts beim Zoologen Geoffroy Saint-Hilaire nach wie vor mit. Er meinte, alle Urrassen unserer Haustiere seien aus Asien eingewandert - und zwar im Gefolge der arischen Invasion. (vgl. Centralblatt vom 12.7.1901) Geradezu bizarr meinte noch 1924 der Kynologe Rudolf Schäme, der indische Wolf sei einer von diversen Urahnen der Schäferhunde. (vgl. Schäme S. 5)
Natürlich erscheint uns das heute absurd. Völlig unplausibel sind solche Ideen trotzdem nicht. Es gab Handelskontakte. Die Phönizier gelangten von Indien bis nach Spanien und Britannien. Schon in dieser Zeit migrierten ganze Völkerscharen. In ihrem Gefolge stießen stets auch Hunde in die neuen Siedlungsräume vor. Austausch erfolgte sodann über militärische Expeditionen. Ein gutes Beispiel ist kein Geringerer als Alexander der Große, der bekanntlich bis nach Indien vorgedrungen ist. Als er im Jahre 327 v.Chr. seinen Marsch an den Indus antrat, kam er an einer Stadt namens Arigaion vorbei. Dort wohnten ziemlich widerspenstige Leute, die sich nicht kampflos ergeben wollten. Schließlich wurden sie doch besiegt, wobei Alexanders Männer reichlich Beute machten. 40'000 Mann und 23'000 Rinder fielen in ihre Hände. Alexander pickte die besten unter den Rindern heraus und schickte sie nach Makedonien zurück, wo sie Feldarbeit leisten sollten. Es handelte sich um eine Rasse, die sich durch besondere Schönheit und Größe auszeichnete. (vgl. Arrian Alexanderzug Buch IV Kap. 25) Abgesehen davon, dass die Zahlen (wie in antiken Texten üblich) völlig überdimensioniert sind, könnte es schon sein, dass Alexander (und auch andere Kriegsherren) tatsächlich erbeutetes Vieh von weit her nach Hause schickten. Und genauso wäre es absolut denkbar gewesen, dass ein Feldherr dann und wann einen guten Jagdhund in die Heimat schickte oder vielleicht auch einen besonders exotischen Schoßhund für eine seiner Liebhaberinnen.
Allerdings muss man nüchtern bleiben: Selbst wenn Hunde weit aus dem Osten in den Westen gelangten, so waren es mit Sicherheit nur wenige Exemplare, die den weiten Weg schafften. Ihr Einfluss auf den indigenen Genpool im Westen dürfte also beschränkt gewesen sein. Wenn in der Literatur demzufolge mit viel Pomp von »indischen Hunden« die Rede ist, so müssen wir »Indien« als Metapher für Osten verstehen oder noch genereller als Metapher für fremd oder fern. Man muss sich nur einmal vergegenwärtigen, welche Weltkarte die damaligen Zeitgenossen vor ihrem geistigen Auge hatten. Alexander etwa meinte, dass der Nil aus einem riesigen Gewässer ausfloss, das seinerseits mit dem indischen Ozean verbunden sei. Daher könne man mit dem Schiff von der indischen Küste in den Nil gelangen und dann flussabwärts ins Mittelmeer schippern.
Anders gesagt: Mit solchen geographischen Prämissen im Kopf verwundert es nicht, dass sich die Leute damals dachten, Hunde aus Indien hätten eben mal locker in die westliche Welt hineinspazieren können. Die Erwähnung von Hunden indischen Ursprungs in antiken Texten besagt demnach eigentlich gar nichts, sondern meint einfach, dass kampfstarke Hunde aus fernen und fremden Ländern in den Westen gelangten.
***
Ähnlich gelagert sind die zahlreichen Legenden um die Tibetdogge, die sich unverwüstlich bis heute halten. Otto Keller zitierte 1909 eine chinesische Chronik aus dem Jahr 1121 v.Chr., wonach ein Tibethund auf Menschenjagd dressiert und dem Kaiser als Geschenk übergeben wurde. (vgl. Keller S. 108) Es ist hier wie immer: Wieder fehlt die genaue Quellenangabe. Welche Chronik war das genau, die Keller erwähnt? Und selbst wenn die Chronik zu finden wäre, dürfte man ihr keinen Quellenwert beimessen.
Als Marco Polo viel, viel später im 13. Jahrhundert nach Tibet gelangte, so begegneten ihm tatsächlich riesige Hunde, wie seinen Reiseberichten zu entnehmen ist: »Sie haben Mastiffs so groß wie Esel, die unschlagbar im Packen von wilden Biestern sind.« (Yule 2. Buch Kap. XLVI) Man darf mit gutem Recht rätseln, ob Marco Polo in der Höhenluft von Tibet einer Halluzination erlegen war. Denn Hunde von der Größe eines Esels gab es nie und nirgends. Wahrscheinlicher ist, dass ortskundige Tibeter dem Fremdling Marco Polo von solchen Hunden erzählten, wobei er die Berichte naiverweise für bare Münze nahm.
Überhaupt hat Marco Polo gerne dick aufgetragen in seinen Reiseberichten. So stand er etwa in der Gunst des Mongolenherrschers Kubilai Kaan, über dessen Jagdhunde er ohne Zweifel mit etlicher Übertreibung schrieb: Riesige Mengen an großen Mastiffs hat der Kaan besessen. Zwei Wärter am Hof waren speziell für die Hundemeuten zuständig. Wenn der Kaan zur Jagd aufbrach, so begleiteten ihn 10'000 Männer mit 5'000 Hunden zur rechten und ebenso viele zur linken Seite. In den großen Ebenen lieferten sich die Hunde einen spektakulären Kampf mit dem Wild. Eine Meute riss einen Bären nieder, eine andere Gruppe warf sich auf einen Hirsch oder andere Biester. (vgl. Yule 2. Buch Kap. XIX)
Aber es geht noch einen Tick spektakulärer: Marco Polo erwähnte eine sagenhafte Provinz im Süden Chinas. An einem Fluss (vielleicht meinte er den Mekong) griffen immer wieder Löwen Reisende an. So sprangen sie von einer Flussbank in die Boote, rissen ein Opfer heraus und verschlangen es. Doch in dieser Provinz gab es eine Hunderasse, die so groß war, dass zwei von ihnen es mit einem Löwen aufnehmen konnten. Deshalb verfügte jeder, der auf Reisen ging, über eine Koppel mit zwei dieser Hunde. Griff ein Löwe an, so konnten die Hunde mit großer Geschicklichkeit den Prankenbieben ausweichen. Die Hunde setzten dem Löwen sogar nach, wobei sie nur auf eine Gelegenheit warteten, ihn durch einen Biss zu verletzen. Oft zog sich der Löwe in den Wald zurück. Doch die Hunde folgten ihm. Wenn der Löwe so weit eingeengt war, dass er sich vor einen großen Baum stellte, um seinen Rücken zu decken, so holten die Reisenden ihre Pfeilbogen heraus und schossen ihn ab. (vgl. Yule 2. Buch Kap. LIX)
600 Jahre nach Marco Polo unternahm der österreichische Graf Bela Széchenyi eine große Expedition in den Fernen Osten (1877 - 1800). Auch er traf auf riesige Hunde in Tibet. Der Geograph der Expedition, Gustav Kreitner, schrieb:
»Schon in China hörten wir so vieles über die schönen tibetanischen Hunde erzählen, dass ich mich wirklich darauf freute, die Tiere kennen zu lernen. Und in der Tat, sie verdienen das Lob. Die tibetanischen Hunde besitzen viel Ähnlichkeit mit den schönsten Neufundländern, ihr Kopf aber ist bedeutend größer und gewinnt durch das mähnenartig emporgewachsene Nackenhaar an imponierender Wildheit. (...) Sie sind im Allgemeinen bissige Bestien, die im Hause an der Kette gehalten, mit ihrem tiefen Gebelle die Luft erzittern machen. Während einer Attacke wedeln sie ohne Unterlass mit dem Schweife. Als Schäferhunde oder bei den Yak-Karawanen verwendet, halten sie Ruhe und Ordnung aufrecht und sorgen zugleich durch ihre Wachsamkeit für die gewünschte Sicherheit.« (Kreitner S. 878)
So sehr war Graf Széchenyi von den Hunden angetan, dass er drei Stück kaufte und nach Österreich brachte. Zwei davon, beides Hündinnen, betrugen sich gut und wurden zu den verlässlichsten Wächtern auf seinem Schloss in Zinzendorf am Neusiedler-See. Anders betrug sich Dsamu, der Rüde. Wie Kreitner schrieb:
»Als entschiedener Feind aller Europäer duldete er keinen von uns in seiner Nähe, ja er biss wiederholt den Grafen, der ihn durch die Verabreichung des Futters zu zähmen versuchte, und zerfleischte ihm einmal bei einer solchen Gelegenheit in sehr bedrohlicher Weise die rechte Hand. Fast in jedem Nachtquartier sorgte der Hund für unsere Verproviantierung, indem er regelmäßig allen Hühnern und Schweinen, die sich in seine Nähe verirrten, erbarmungslos die Wirbelsäule durchbiss. Als Dsamu aber in Bamo ein armes, altes Weib, das ihn mit einem Prügel bedrohte, derartig zurichtete, dass es kurze Zeit darauf starb, da war sein Schicksal entschieden. Graf Széchenyi erschoss ihn auf der Stelle.« (Kreitner S. 878)
Ähnlich wie bei den indischen Hunden so hält sich auch bei der Tibetdogge unverwüstlich die Vermutung, die großen, schweren, bissigen Hunde, wie man sie etwa auf assyrischen Reliefs sieht, wären die Abkömmlinge von aus Tibet eingewanderten Hunden gewesen. Rudolf Schäme irrte sich noch 1924, als er über die Herkunft der assyrischen Doggen schrieb: »Auf Grund der vergleichenden Sprachforschung ist man zu der Ansicht gekommen, dass dieser Hund dieselbe Rasse ist wie die tibetanische Dogge.« (Schäme S. 19) Sogar bis in die aktuelle Gegenwart hinein lassen sich Züchter und Liebhaber dazu verleiten, ihre Zuchtprodukte im Westen als direkte Abkömmlinge jener tibetischen Hunde zu sehen, von denen in der Antike die Rede war. Doch das hat nichts mit der Realität zu tun. Erik Zimen schreibt zur Herkunft der Tibetdogge: »Ihre angebliche Abstammung von tibetanischen Hunden (...) ist ebenso haltlos wie die vielen Vorstellungen über heutige Rassen, die von ihnen direkt abstammen sollten.« (Zimen S. 156)
DER HUND IN DER ANTIKE UND SEIN POTENTIAL IM KRIEG
WELCHE ARTEN VON HUNDEN GAB ES IN DER ANTIKE?
Auch wenn damit kein Ruhmesblatt zu gewinnen war, so dürfte es in der tiefen Banalität das antiken Alltages so gewesen sein, dass von allen Hunden die Pariahunde am zahlreichsten waren. Sie lungerten in den Straßen umher, gehörten niemanden und doch blieben sie stets in der Nähe der Menschen. Wenngleich sie nicht Gegenstand inniger Verehrung waren, so hatten sie eine überaus wichtige Funktion: Sie fraßen den Abfall und trugen so zur Hygiene bei. Sie verschmähten nichts, noch nicht einmal menschliche Exkremente. Sogar Leichen fraßen sie manchmal. Von den kaspischen Völkern berichtet Strabon: Die über 70-Jährigen wurden zu Tode gehungert. Die Barren mit den Leichnamen stellte man in die Wüste. Wenn die Toten von Vögeln weggezerrt wurden, so versprach das Glück. Wenn sie hingegen von wilden Tieren oder Hunden weggezerrt wurden, so galten die Toten als verwunschen. Skurril? Sicher! Aber Strabon legte nach: Bei den Baktiern wurden jene, die wegen Alter oder Krankheit hilflos wurden, bei lebendigem Leib den speziell dafür gehaltenen Hunden vorgeworfen. (vgl. Geographika Buch 11 Kap. 11)
Oben auf der Prestigeskala standen die Jagdhunde. Es galt die Formel: Je größer das erlegte Wild, je prestigeträchtiger. Mäßigen Ruhm ergab ein erlegtes Kaninchen, wesentlich mehr ein Eber, ganz oben stand der Löwe. Der Nachwelt sind viele Hinweise erhalten geblieben, die zeigen, wie sehr die Griechen ihre Jagdhunde liebten. Im Antikenmusen Basel stehen zum Beispiel zwei Grabstelen und ein wunderbares Grabrelief mit akkurat dargestellten Jagdhunden. Man kann sich vorstellen, wie beliebt diese Hunde waren, wenn ihre Meister sie auf ihren eigenen Grabsteinen verewigen ließen. Auch in der antiken Literatur findet man Dutzende Hinweise auf die Jagd. Hier nur eine kleine Kostprobe von Plinius: Hirsche, so schreibt er, verziehen sich, sobald sie die Hunde bellen hören. Dabei gehen sie in die Richtung des Windes, so dass ihr Duft weggetragen wird. Weiter schreibt Plinius von Stachelschweinen, die es in Indien und Afrika anzutreffen gab. Diese haben so starke Stacheln, dass sie die Schnauze der Hunde durchstechen. Und die Dachse, so Plinius, plustern sich dermaßen auf, dass sie den Bissen der Hunde widerstehen können. (vgl. Naturkunde Buch 8 Abs. 61)