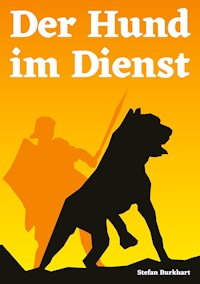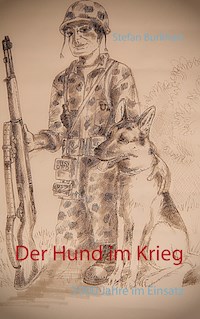
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Seit Menschengedenken lebt der Hund an der Seite des Menschen. Und seit Menschengedenken kämpft der Hund an der Seite des Menschen. Im Gegensatz zu anderen Tieren dient der Hund heute noch in Konflikten und Kriegen überall auf der Welt. Das Buch zeigt die Entwicklung von prähistorischer Zeit durch alle Epochen hinweg auf. Kamen in den frühen Tagen Hunde noch als aktive Kämpfer oder als Wächter zum Einsatz, so entstand in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein modernes Diensthundewesen. Im 1. Weltkrieg suchten Hunde nach Verletzten oder überbrachten Nachrichten durch die Kraterlandschaft der Westfront. Im 2. Weltkrieg begleiteten ausgebildete Hunde Patrouillen, spürten Feinde auf und sprangen erstmals an Fallschirmen ab. Nach dem 2. Weltkrieg erlangten Diensthunde in den nunmehr vorherrschenden Konflikten auf tieferem Intensitätsniveau eine Nützlichkeit wie kaum zuvor. Auf dem Höhepunkt des Algerienkrieges beispielsweise standen fast 2'000 französische Diensthunde im Einsatz. Aber auch in Malaysia, Vietnam, Korea, Nordirland, Irak, Afghanistan und vielen anderen Konflikten der jungen Vergangenheit nahmen Hunde viele Aufgaben war: Bewachung, Aufspüren von Sprengstoffen und Personen nebst vielen anderen. Die faszinierende Geschichte von Hunden im Krieg wird dargestellt vor dem Hintergrund der allgemeinen (Militär-) Geschichte. Daneben säumen viele rührende Episoden von treuen Begleitern auf vier Beinen den rund 3'000 jährigen Gang durch die Vergangenheit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 800
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
»Come then, let us go foreward together with our united strengh.« Winston Churchill in seiner Rede vom 13. Mai 1940 vor dem House of Commons
Zum Autor:
Stefan Burkhart wurde 1968 in Liestal bei Basel geboren. Nach einer kaufmännischen Ausbildung weilte er zunächst in Frankreich und Korea. Außerdem erwarb er ein Publizistik-Diplom in Zürich. Er hat viele Artikel über Hunde und auch andere Themen publiziert. Er ist ein großer Hundenarr – derzeit allerdings ohne eigenen Hund. Punkto Rassehunde hat er eine gewiße Präverenz für den Whippet und den Border Terrier... wohlwissend um den unendlichen Reichtum, den alle Hunde in unser aller Leben zu tragen wissen. Für Geschichte und gesellschaftliche Themen hat er sich schon immer interessiert. Und so kommen in diesem Buch drei Linien zusammen: das Flair fürs Schreiben, das Interesse an der Geschichte und die Liebe für die Hunde.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Vorgeschichtliche Zeit
Frühe Hochkulturen
Vage Hinweise auf Kriegseinsätze
Indische Hunde
Tibetdogge
Altertum
Griechenland
Perser
Hundelegenden aus den Perserkriegen
Der Retter von Korinth
Alexander der Große
Römer
Die Schande auf dem Kapitol
Die Ursprünge der Molosser
Die Kriegshunde der Barbaren
Mittelalter bis beginnende Neuzeit
Neuzeit bis 1914
Einschneidende Veränderungen
Hunde und die Zerstörung Westindiens
Die Geschichte von Becerillo
Hunde und das Schicksal der Sklaven
Die Legende von Boye
Rente auf Lebzeiten
Napoleon
Die Geschichte von Moustache
Regimentshunde
Hunde und die Entstehung der USA
Die Entstehung des modernen Diensthundewesens
Hunde im Dienste des Imperialismus
1. Weltkrieg
Frankreich
Deutschland
Großbritannien
Andere Länder
Sanitätshunde
Nachrichtenhunde
Postenhunde / Patrouillenhunde
Wachhunde
Schlittenhunde / Zughunde / Packhunde
Rattenfänger
Gashunde
Maskottchen
Der Anfang der Blindenhunde
Die Geschichte von Rags
2. Weltkrieg
Deutschland
Großbritannien
USA
Vergleich Funktionen von Hunden im 1. / 2. Weltkrieg
Patrouillenhunde
Hunde am Fallschirm
Wachhunde
Schlittenhunde / Zughunde
Nachrichtenhunde
Spürhunde
Maskottchen
Beginn der Minensuchhunde
Erste Therapiehunde
Bombenkrieg und Beginn der Trümmersuchhunde
Kampfhunde im wahrsten Sinne des Wortes
Die Minenhunde der Roten Armee
Die Geschichte von Chips
Die Geschichte von Antis
Hunde und Nationalsozialismus
Hunde in Konzentrationslagern
Frankreich: Entwicklungen 1945 bis heute
Krieg in Indochina (1948 - 1954)
Der Veterinärdienst und der Aufbau des Diensthundewesens
Hundekommandos
Wachhunde
Hunde am Fallschirm
Bilanz des Hundeeinsatzes in Indochina
Algerienkrieg (1954 - 1962)
Der Veterinärdienst und seine Aufgaben
Hundezüge (peloton cynophile)
Funktionen der Militärhunde
Die Geschichte von Gamin
Deutschland: Schule für Diensthundewesen der Bundeswehr 1958 bis heute
Großbritannien: Entwicklungen 1945 bis heute
USA: Entwicklungen 1945 bis heute
Vietnamkrieg (1961 - 1973)
Das Trauma der USA
Scout Dog – Charlie ist überall aber nirgends zu sehen
Sentry Dog – Charlie owns the night
Tracker Dog – Charlie auf den Fersen
Mine / Tunnel Dog – im Kampf gegen die Booby Traps
Die Militärhunde der Südvietnamesen
Das Veterinärkorps der US Army in Vietnam
Schlussfolgerungen und Ausblick
Literaturverzeichnis
Einleitung
Seit 15’000 Jahren gibt es Hunde. Mindestens. Womöglich gibt es sie sogar schon seit 100’000 Jahren. Wie auch immer. Eines ist klar. Wo es Menschen gab, gab es Hunde. Der Hund gehört zum Menschen. Das war in allen Epochen so. Hunde teilen mit ihren Herren die Freuden, die Leiden, das Heim, manchmal sogar das Essen und das Bett. Da kann es nicht erstaunen, dass der Hund seit prähistorischer Zeit durch alle Epochen hindurch bis in die Gegenwart auch eine der schrecklichsten und prägendsten Erfahrungen der Gattung Mensch teilte: die Erfahrung des Krieges. Gewiss, viele andere Tiere sind ebenfalls im Krieg eingesetzt worden. Doch alle wurden nach einer gewissen Zeit ausgemustert. Technische Errungenschaften machten ihre Dienste entbehrlich. Elefanten zum Beispiel kamen schon weit vor Christi Geburt zum Einsatz. Doch der kriegerische Gebrauch dieser grauen Giganten endete bereits in der Antike wieder. Das gleiche Schicksal ereilte die Tauben, die in vielen Kriegen hervorragende Dienste leisteten. Man brauchte sie im Zeitalter moderner Kommunikationsmittel nicht mehr. Pferde standen während allen Epochen im Feld. Aber selbst ihr Einsatz endete im 20. Jahrhundert. Alle Tiere wurden früher oder später aus dem Dienst entlassen. Brauchte man sie infolge der technischen Entwicklung nicht mehr, verschwanden sie ziemlich rasch aus den Streitkräften, abgesehen allenfalls von einigen folkloristischen Darbietungen, etwa der Kavallerie oder der Brieftauben, die bis heute vorzufinden sind. Das war bei allen Tieren so. Außer beim Hund.
Der Hund war in allen Zeitabschnitten im Krieg präsent, mal mehr, mal weniger. Aber zugegen war er immer, wo Menschen kämpften. Heute nimmt er mehr und wichtigere Funktionen ein als jemals. Noch nie zuvor konnte er den Menschen im Krieg so effektiv unterstützten wie heute. Hauptgrund für diese Entwicklung ist schlicht und einfach die Tatsache, dass die hündischen Sinnesorgane in Kombination mit einem immer dem Menschen zugewandten Verhalten bis in die Gegenwart unübertroffen sind. Sogar die physische Kraft des Hundes ist bis heute bei Militär und Polizei gefragt. Zwar dienen Hunde nicht mehr als kräftige Zugtiere oder flinke Überbringer von Nachrichten. Aber ihre Kraft und Agilität sind nach wie vor unverzichtbare Eigenschaften bei der Unterstützung von Soldaten, Polizisten, Wachpersonal und Sicherheitsdiensten überall auf der Welt.
Aber es kommt noch etwas anderes hinzu. Der Hund behauptet im militärischen Bereich, wie generell im Leben, eine Sonderstellung, die weit über seine Nutzfunktion hinausgeht. Irgendwo steht er zwischen der Welt der Tiere und der Welt der Menschen. Er ist natürlich kein Mensch. Aber man zögert, ihn als gewöhnliches Tier zu sehen. Der Hund mag zwar körperlich ein Tier sein. Kulturell, zivilisatorisch, in seiner ganzen Genese ist er aber durch und durch dem menschlichen Lebensraum einverleibt. Der Hund hat daher den Menschen im Krieg auch immer als schlichter Freund und Tröster begleitet. Der Mensch hatte schon immer einen Hang dazu, den Hund an allen seinen Erfahrungen teilhaben zu lassen. Gerade heute gibt es viele Leute, die sich mit Verwunderung bewusst werden, dass jenes Wesen, das am längsten an ihrer Seite ausharrt, gar nicht ihr Lebenspartner ist, dem man zwar einst Treue bis zum Tod gelobt hat, den man dann aber doch nach einem Lebensabschnitt ziehen lässt, sondern der Hund, der ein ganzes Hundeleben lang bei seinem Meister bleibt. Kurzum: Hunde waren schon immer Lebensbegleiter von uns Menschen. Da erstaunt es nicht, dass der Mensch den Hund auf jeden Fall stets bei jener Handlung dabei haben wollte, die das Wesen des Menschen mehr ausmacht, als uns oft lieb wäre, der Handlung des Krieges. Der Mensch war natürlich nie auf den Hund angewiesen, um Krieg führen zu können. Aber er wollte ihn trotzdem immer dabei haben, selbst dort, wo seine militärische Nutzfunktion fragwürdig schien... und zwar aus emotionalen Gründen, ganz so, wie man zwar ohne Hund leben kann, nur lohnt es sich nicht, wie der Schauspieler Heinz Rühmann sagte. Ausdruck dieser Neigung, Hunde ganz in die menschliche Sphäre einzubinden, sind die vielen Geschichten von Regimentshunden, Maskottchen oder Streunern, die von Soldaten mit großem Engagement gepflegt wurden.
Kommen wir noch kurz zur Systematik hinter diesem Buch. Zunächst muss man sich eines klar machen: Der Hund ist ein Randgebiet der Militärgeschichte. Als ich die Idee hatte, ein Buch über Hunde im Krieg zu schreiben, so war ich wohl auch etwas diesem Pathos verfallen, mit dem die Leistungen von Hunden im Krieg oft dargestellt werden, manchmal gewiss etwas übertrieben. Ich hatte gar nicht bedacht, dass es sich um eine Geschichte handelt, die eben Mal 3’000 Jahre und mehr umfasst. Die Quellen, die klar und explizit Hunde im Krieg erwähnen, sind relativ rar. Somit steht jeder, der sich mit dem Thema befasst, vor einem offensichtlichen Dilemma: Ein Randgebiet verteilt über eine riesige Zeitspanne. Anders gesagt: Wenig Substanz verteilt über viel Raum. Volkstümlich: Die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Mit einigem Erstaunen stellte ich fest, dass es wenig Literatur zu diesem Thema gibt, zumal im deutschsprachigen Raum. Somit erwies sich meine anfängliche, womöglich etwas naive Absicht, ein Buch zu schreiben über Kriegseinsätze von Hunden über die gesamte Länge der Geschichte, naja, doch als ziemlich ambitiös. Dennoch: Ich bin überzeugt, dass eine solche Gesamtgeschichte des Hundes im Krieg von großem Interesse ist. Angesichts der Herausforderungen entstand eine Art von Buch, das ich an dieser Stelle gleichzeitig als Pionierwerk und Stückwerk darstellen möchte. Stückwerk deshalb, weil Pionierarbeit kaum perfekt sein kann und der Verbesserung und Ergänzung bedarf.
Das Buch sehe ich als Anlauf zu einer großen Idee, nämlich die Geschichte des Hundes im Krieg möglichst komplett und möglichst tiefsinnig zu erfassen. Die Hoffnung ist denn auch, dass im Gefolge der Publikation Feedbacks eingehen durch die Leserschaft, die ohne Zweifel zur Perfektionierung beitragen können. Die Quellen sind ziemlich pedantisch ausgewiesen. Das soll zur Glaubwürdigkeit der Publikation beitragen. Einzig bei der Darstellung des Lebens berühmter, individueller Hunde habe ich auf genaue Quellenangaben verzichtet. Diese Darstellungen beginnen meist mit dem Titel: Die Geschichte von..., z.B. die Geschichte von Rags, dem berühmten amerikanischen Hund aus dem 1. Weltkrieg, oder die Geschichte von Moustache, dem berühmtesten Hund aus der Zeit Napoleons. Solcherlei Hunde waren schon zu Lebzeiten richtige Legenden. Entsprechend ist das Wissen über ihr Leben eher im legendären Bereich anzusiedeln. Daher scheint es legitim, hier ihre Legende etwas weiter zu tragen, ohne pedantisch genau auf Details achten zu müssen. Quellen in Französisch und Englisch habe ich jeweils eigenhändig ins Deutsche übersetzt, ohne dies noch besonders zu markieren.
Wer einen Fehler entdeckt oder ergänzendes Wissen besitzt, der soll doch direkt mit dem Autor in Kontakt treten. Denn eines ist klar: Die Geschichte des Hundes im Krieg ist groß und lang – die dazugehörige Geschichtsschreibung ist aber eher klein und jung. Bestimmt ist sie mit dem vorliegenden Buch noch nicht fertig geschrieben. Idealerweise entsteht ein gewisser Austausch mit vielen an diesem Thema interessierten Menschen, der den Zugang zu weiteren spannenden Fakten eröffnet. Meine Koordinaten stehen im Impressum auf der zweiten Seite dieses Buches.
Nun wünsche ich allen Lesern viele neue Erkenntnisse, viele Emotionen und trotz der Ernsthaftigkeit des Themas auch viel Spaß beim Lesen. Für Feedbacks kritischer und / oder ergänzender Art sei an dieser Stelle schon gedankt. Und natürlich ist an dieser Stelle auch ein herzlicher Dank an all jene ausgesprochen, die mich in irgendeiner Weise unterstützt haben.
Vorgeschichtliche Zeit
Viele Menschen gehen spontan davon aus, Krieg habe es schon immer gegeben. Sicher scheint, dass es Krieg bereits in prähistorischer Zeit gab. Eine der ältesten Fundstätten, die auf eine kriegerische Aktivität schließen lässt, liegt im Sudan. Zeitlich lassen sich die Funde auf zirka 12’000 - 10’000 v.Chr. datieren. Gefunden wurden Knochen und Projektile, die so eng ineinander vermengt waren, dass der Schluss nahe liegt, die Projektile hätten zum Tod der Menschen geführt. Wahrscheinlich gab es aber schon weit früher Kämpfe zwischen Menschen. Allerdings blieb davon einfach nichts übrig, was die Archäologie noch hätte zu Tage fördern können. Es ist deshalb äußerst schwierig zu sagen, wann die ersten Kriege stattgefunden haben. Für unsere Zwecke dient die Feststellung: Krieg in der einen oder anderen Form muss es schon sehr, sehr früh gegeben haben und – vielleicht – sogar seit immer.
Nun zur Frage, wie lange es schon Hunde gibt. Die Domestikation des Hundes setzte auf jeden Fall schon weit in prähistorischer Zeit ein. Entsprechende physische Nachweise sind bis zirka 12’000 Jahre alt. Die Domestizierung der ersten Hunde könnte aber noch viel weiter zurück liegen. Neuere Auswertungen von Schädeln deuten darauf hin, dass die Domestizierungsgeschichte womöglich bereits vor 30'000 Jahren begonnen hat. Genuntersuchung zeigen sogar, dass eine erste Typenbildung von Hunden schon vor 125'000 Jahren eingesetzt haben könnte, als sich deren Erbschaftslinien vom Wolf ablösten. Sicher ist, dass die Domestikation des Hundes einzig aus dem Wolf erfolgte. Ziemlich wahrscheinlich ist, dass der Hund das erste domestizierte Wildtier war. Die genauen Motive hingegen, weshalb sich der Mensch auf diese Symbiose eingelassen hat, liegen im Dunkeln. Gerade Hundeliebhaber gehen gerne davon aus, dass der Domestikation des Wolfes ein besonderes Motiv zugrunde gelegen habe. Verschiedene Funktionen werden ins Feld geführt. Vielleicht haben sie als Wärmequelle gedient im Körperkontakt zum Menschen. Vielleicht hat man ihre Neigung, Kot zu fressen, genutzt. So konnten sie den Babies die Exkremente vom Popo wegfressen und einen Beitrag zur Hygiene im Lager leisten. Womöglich dienten sie als Lasttiere. Oft wird auch die Wachsamkeit ins Feld geführt. Überzeugend ist von alledem nichts. Die Domestikation des Wolfes erfolgte mit einiger Sicherheit nicht im Hinblick auf einen besonderen Verwendungszweck, sondern aus emotionalen Gründen. Die Funktionalitäten, die Hunde später einnahmen, haben sich erst lange Zeit nachher herausgebildet. Sie sind keine Ursachen, sondern Folgen der Domestikationsgeschichte.
Genau so war es mit den Kriegsdiensten, die der Hund dem Menschen leisten konnte. Der Mensch beobachtete das Verhalten des Hundes, der mittlerweile zu seinem treusten Begleiter geworden war. Dann fragte er sich ganz pragmatisch: Welche seiner Eigenschaften kann ich mir am besten im Krieg und Kampf zunutze machen? Wann das zum ersten Mal geschah, lässt sich zeitlich nicht eingrenzen. Archäologische Evidenz für den Einsatz von Kriegshunden gibt es (wahrscheinlich) nicht. Es wäre auch praktisch undenkbar, die Beteiligung eines Hundes an einem Krieg zweifelsfrei aus einem archäologischen Fund abzuleiten. Ein Hund, der tot bei Kämpfern auf einem Schlachtfeld liegt, muss nicht zwingend ein Kriegshund gewesen sein. Vielleicht war es nur ein Streuner, der an den Leichen knabberte und danach verendete? Oder vielleicht war es der Hund eines in den Kampf involvierten Mannes, der aber nicht am Kampfgeschehen teilgenommen hat. Oder er war zufällig zwischen die Fronten geraten und dann getroffen worden. Auch bildliche Darstellungen geben nicht viel her. Zum einen sind Darstellungen von Hunden sehr rar. Wenn man einen Hund zum Beispiel auf einer Malerei wahrzunehmen glaubt, so stellt sich sogleich die Frage: Handelt es sich wirklich um einen Hund oder um ein anderes Tier? Trifft man auf eine Szene, so stellt sich die Frage: Handelt es sich um die Szene eines Kampfes oder eher um eine Jagdszene? Bei allem ist man nie sicher: Wollte der Künstler überhaupt die Realität darstellen oder nur Fiktionen seiner Zeit? Kurzum: Das Spekulieren nimmt kein Ende. Wir begnügen uns daher damit, die Beteiligung von Hunden im Kampf und Krieg in den größeren Kontext der evolutionären Entwicklung zu stellen. Das können wir guten Gewissens tun, wenn wir uns einmal folgende Aspekte vor Augen führen:
Bewachen: Konrad Lorenz erzählt in seinem Buch Wie der Mensch auf den Hund kam eine spannende Geschichte: Schakale, so beschreibt er äußerst anschaulich, seien den menschlichen Horden gefolgt. Dabei habe sich eine Art Symbiose entwickelt. Der Nutzen für die Schakale waren abfallende Futterhappen. Der Nutzen für die Menschen war eine Art Frühwarnsystem. Denn die Schakale haben immer geheult, sobald sich wilde Tiere dem Lager näherten. Ohne dieses Alarmsystem wäre an ruhigen Schlaf nicht zu denken gewesen. Raubtiere lauerten immer und überall. So haben sich Mensch und Schakal immer mehr angenähert, bis es eines Tages zur Fütterung eines Schakals durch einen Stammesangehörigen kam. Angesichts des damaligen ständigen Nahrungsmangels war das natürlich eine Ungeheuerlichkeit. Da verfütterte einer wertvolle Fleischhappen an einen Schakal! Aber es war in Tat und Wahrheit eine Weisheit. Denn die Menschen waren Nomaden und zogen ständig umher. Durch das Auslegen von Futter lockte man die Schakale hinter der Sippe her. Die Schakale folgten den Menschen und freundeten sich immer mehr mit ihnen an. Doch was hat das jetzt mit Hunden im Krieg zu tun? Mehr als man im ersten Moment denken mag. Denn in diesem Anzeigen von Gefahren durch die Schakale kann man mit wenig Fantasie eine Art Wachfunktion sehen, worin man eine erste, vielleicht nicht gerade militärische, doch zumindest verteidigende Aufgabe erkennen kann. (vgl. Lorenz 1951, S. 7 - 9)
Wie auch immer: Waschechte Wachhunde, so wie wir uns das heute vorstellen, entstanden nur sehr langsam über viele Generationen. Bis ein imposanter Hund vor dem Eingang stand, der Eindringlinge durch Bellen anzeigte und diese sogar abwehrte, verging noch sehr, sehr viel Zeit. Dennoch sind die ersten Hunde in einer echten Funktion als Wächter schon weit vor dem Übergang zur landwirtschaftlichen Produktion entstanden. »Der Torfhund war während der Eiszeit zum über ganz Europa verbreiteten Haustier geworden. Bei Ausgrabungen einer steinzeitlichen Siedlung aus der Zeit um 8’000 v.Chr. in Wierde bei Bremen wurden Hundeskelette unter Türschwellen der Häuser gefunden. Der hier begrabene Hund sollte offensichtlich die bösen Geister vom Betreten des Hauses abhalten. Solch magische Vorstellungen reichen weit in die geschichtliche Zeit hinein. Daraus darf geschlossen werden, dass der Hund schon sehr früh als Haus- und Hofwächter diente.« (Räber 1999, S. 37 - 38).
Die Gabe des Hundes zur Bewachung entfaltete auf die menschliche Evolution eine große Wirkung, die man gemeinhin unterschätzt. Einer, der das Wesen des Hundes mit Tiefsinnigkeit erkannte, war der englische Militärhunde-Trainer Edwin Richardson. Entsprechend hat er die überragende Wichtigkeit der hündischen Wachsamkeit beschrieben: »Die Gewohnheit des Bewachens, die (...) den Hunden seit prähistorischer Zeit instinktiv inne wohnt, ist für die Menschheit so wertvoll wie die Kraft der Pferde, Lasten zu ziehen.« (Richardson 1920, S. 190)
Fazit: Die Fähigkeit, Gefahren früh zu erkennen, war eine der ersten Gaben des Hundes, die sich der Mensch in militärischer bzw. kämpferischer Absicht zu Nutze machen konnte.
Beschützen: Jetzt kommt noch etwas hinzu. Der Hund verfügte nicht nur über exzellente Sinnesorgane. Darüber hinaus war er kräftiger und agiler als der Mensch. Außerdem fühlte er sich seinen menschlichen Bezugspersonen zugehörig. So kam irgendwann in ferner Vergangenheit der Tag, an dem ein Hund dazu überging, seinem Meister im Kampf aktiv beizustehen. Wir wollen uns in diesem ohnehin spekulativen Terrain nicht mit großen Theorien herumschlagen. Vielleicht war es ganz profan so: Der Stamm auf dem Berg litt an Hunger. Also überfiel er das Lager des Stammes in der Ebene. Doch die hatten Hunde. Die Keilerei zwischen den beiden Stämmen war in vollem Gange. Da zeichnete sich ein Spektakel ab. Die Hunde der Verteidiger stürzten sich auf die Angreifer, bissen in ihre blanken Waden und ungeschützten Arme, sprangen sogar an ihnen hoch und rissen sie zu Boden. Die verdatterten Angreifer suchten das Weite, dicht bedrängt von den wütenden Hunden, die sie verfolgten. Der Vorgang dürfte weder Angreifern noch Verteidigern entgangen sein. Man hatte erkannt, dass die Hunde nicht nur aufmerksam waren, sondern überdies exzellente Kämpfer abgaben – und erst noch ganz spontan ohne Dressur.
Fazit: Hunde griffen spontan in den Kampf ein, wenn ihr Meister oder ihr Rudel bedroht war. Diese Gabe konnte man auch im Kampf und Krieg ausnutzen.
Gemeinsam jagen: Eine andere wichtige Aufgabe hatte der Hund auf der Jagd inne. Nicht selten liest man, die Jagd sei die erste Funktionalität des Hundes gewesen. Das ist aber fraglich. Die Teilnahme des Hundes an der Jagd setzte eine schon fortgeschrittene Symbiose mit dem Menschen voraus, die sich erst im Laufe eines langen Zusammenlebens ergeben haben dürfte. Unbestritten ist aber: Der Hund wurde bereits in prähistorischer Zeit zum Jagdpartner des Menschen, was eine Ursachenkette von evolutionärer Bedeutung auslöste. Denn seine Hunde verhalfen dem Menschen zu mehr Erfolg beim Jagen. Ergo: Er hatte mehr Nahrung. Ergo: Er vermehrte sich rascher und konnte sich gegen Konkurrenten besser durchsetzen. Wie so etwas in der Praxis aussah, musste der Neandertaler am eigenen Leibe erfahren. Über 10’000 Jahre lebten Homo Sapiens und Neandertaler parallel. Dann starb Letzterer aus, verdrängt durch den Homo Sapiens. Wieso war dieser dazu in der Lage? Was machte den Homo Sapiens so stark? Dazu gibt es eine faszinierende These. Und die lautet so: Der Homo Sapiens hatte Hunde, der Neandertaler dagegen nicht. Der Aufstieg des Homo Sapiens zur dominierenden Spezies könnte also nicht zuletzt mit dem Faktum zusammenhängen, dass er in der Lage war, den Hund zu domestizieren und auf der Jagd einzusetzen.
Wie genau der Einsatz von Jagdhunden in diesen frühen Tagen ausgesehen haben mag, ist schwer zu fassen. Ganz bestimmt hing es von vielen Parametern ab: Welche Tiere standen überhaupt als Beute zur Verfügung (groß, klein, schnell, langsam usw.)? Was war der Entwicklungsstand der Geräte? Gab es nur Äxte oder Keulen, die praktisch den Körperkontakt zur Beute erforderten? Oder gab es den Speer, der bereits eine größere Distanz zum Beutetier erlaubte? Gab es Fallen, Seile, Netze? Große Tiere etwa wurden eingekreist und mit einer Axt oder einem Speer aus naher Distanz unter hoher Gefahr für den Jäger erlegt. Oder sie wurden über einen Felsen gehetzt, so dass sie in den Tod stürzten. Hunde haben dabei vielleicht geholfen, indem sie die Beute einschüchterten, hetzten, bissen. Schnelles aber nicht so wehrhaftes Wild ließ sich mit Pfeil und Bogen jagen. Der Mensch konnte den Pfeil auf große Distanz abschießen und so auch wendige Tiere erreichen. Doch es gab einen Nachteil. Ein Pfeil verletzte nur. Die Beute floh, unerreichbar für den langsamen Menschen. Genau dieser Umstand war womöglich die große Sternstunde des Hundes. Denn nur der Hund konnte die Spur des angeschossenen Tieres aufnehmen und wurde so zum unentbehrlichen Gehilfen des Menschen. (vgl. Zimen 2010, S. 128 - 129)
Der Übergang vom Jagd- zum Kriegshund muss dann fließend gewesen sein. Dies kann man sich gerade bei großen, doggenartigen Hunden gut vorstellen, die schon früh bei der Großwildjagd eingesetzt wurden. Anatolischen Felsmalereien (ca. 7’000 - 6’000 v.Chr.) lassen bereits schwere Hunde beim Jagen erkennen. Später bildeten sich spezialisierte Aufgaben heraus, wie etwa das Packen oder Hetzen von großem Wild. Ein Hund, der sich nützlich erwies bei der Jagd auf wehrhaftes Wild, konnte sich bestimmt auch bewähren im Kampf gegen andere Menschen. Und ein Hund, der sich willig auf gefährliches Großwild hetzen ließ, konnte man bestimmt auch auf gegnerische Kämpfer hetzen. In der Tat verweist Andrea Steinfeldt in ihrer Dissertation über »Kampfhunde« auf diesen offensichtlichen Zusammenhang: »Mit der Heranbildung mächtiger Hunderassen und deren Einsatz in der Großwildjagd zeigte sich auch der Nutzen dieser abschreckenden Tiere als Wach- und Kriegshunde.« (Steinfeldt 2002, S. 26)
Roman Marek hat ebenfalls auf den Zusammenhang zwischen Jagd und Krieg hingewiesen: »Die Forschung ist zwar darüber uneinig, ob sich der Hund tatsächlich freiwillig dem Menschen anschloss; als gesichert gilt jedoch, dass Hunde bereits vor Entstehung der Viehzucht als Wachhunde und Jagdhelfer, aber auch als Nahrungsergänzung genutzt wurden. Die Mensch-Hund-Beziehung beruht auf zwei großen Gemeinsamkeiten: auf einem ähnlichen Jagdverhalten (Laufen und Hetzen, Treiben auf freier Bahn) sowie auf einer ähnlichen Lebensweise (im sozialen Verband, mit hierarchischen Strukturen, Aufgabenteilung und Fürsorge). Aufgrund dieser Analogien besaß der Hund natürliche Instinkte, die eine Integration in die menschliche Gemeinschaft bereits zu einem Zeitpunkt ermöglichten, bei dem man von Domestizierung in Ermangelung eines Hauses eigentlich nicht sprechen kann. Da die Jagd gewissermaßen als Urahn des Krieges angesehen werden muss, erscheint es geradezu konsequent, dass Hunde den Menschen auch in den Krieg begleiteten. So wurden aus Jagdhunden Militärhunde.« (Marek in Pöppinghege 2009, S. 266)
Fazit: Die Fähigkeiten des Hundes, die man auf der Jagd ausnutzte, konnte man auch bei der »Jagd« auf menschliche Feinde ausnutzen.
Herden verteidigen: Die Einführung der Landwirtschaft brachte einschneidende Veränderungen. Wahrscheinlich trug der Hund nicht unwesentlich dazu bei, dass es überhaupt so weit kam. Wie wir oben gesehen haben, ergab sich früh eine Jagdgemeinschaft von Hund und Mensch. Diese war so erfolgreich, dass die Beutetiere in einem gewissen Stadium knapp wurden. Dies wiederum zwang den Menschen zu einer ganz anderen Produktionsweise von Lebensmitteln. Er begann, Tiere und Pflanzen zu domestizieren. Das war der Beginn der Landwirtschaft. Die erste Phase dieser wohl folgenschwersten Revolution in der Geschichte der Menschheit erfolgte an den Rändern Mesopotamiens vor rund 11’000 Jahren. Mit der Domestizierung von Nutzpflanzen und Nutztieren konnte die Nahrungsproduktion explosionsartig gesteigert werden. Resultat: steigende Bevölkerungszahlen.
In militärischer Hinsicht war die Einführung der Landwirtschaft ebenfalls einschneidend. Jared Diamond schreibt in seinem Buch Arm und Reich: »Wie wir sehen werden, war die Einführung der Landwirtschaft eine wichtige Etappe auf dem Weg, der zur militärischen und politischen Überlegenheit einiger Völker über andere führte.« (Diamond 1999, S. 91) Die Völker, die bereits auf die landwirtschaftliche Produktion umgestellt hatten, verfügten über mehr Ressourcen. Aber nicht nur das: Mit der Landwirtschaft veränderte sich auch die soziale Organisation der Gesellschaft. Die Hierarchie wurde steiler als in Jäger- und Sammlergesellschaften. Eliten entstanden. Erstmals gab es nun auch »Berufe«, die sich nicht mehr unmittelbar um die Nahrungsbeschaffung zu kümmern hatten. Dazu zählten etwa professionelle Krieger. Wie Diamond folgert: »Diese komplizierteren politischen Gebilde sind viel eher zur Führung längerer Eroberungskriege imstande als egalitäre Scharen von Jägern und Sammlern.« (Diamond 1999, S. 96)
Ein Aspekt ist in Bezug auf unsere Thematik besonders spannend: Indem der Mensch nun in der Lage war, Nutztiere zu halten, geriet er in ein ganz neues Konkurrenzverhältnis zu wilden Raubtieren. Wölfe etwa bedrohten die Schafherden, eine Problematik, die bis heute Brisanz birgt. Folglich mussten die Herden beschützt werden. Diese Aufgabe übernahm mitunter der Hund. Es entstanden kräftige Herdenschutzhunde, die Angriffe von wilden Tieren abwehren konnten. Der Übergang von solchen Herdenschutzhunden zu Militärhunden wiederum war bestimmt fließend.
Fazit: Ein Hund, der fähig war, Wölfe, Bären und anderes kräftiges Wild vom Zugriff auf eine Herde Nutztiere abzuhalten, der konnte auch im Krieg und Kampf gegen menschliche Angreifer eingesetzt werden.
Frühe Hochkulturen
Vage Hinweise auf Kriegseinsätze
Fast alle größeren Kunstwerke aus Ägypten und Mesopotamien zeigen durch alle Epochen hindurch Darstellungen von Tieren. In Mesopotamien fand man Texte auf Tontafeln in Summerisch und Akadisch. Die Texte gleiten oft ins Magische ab, enthalten aber teilweise präzise Angaben zum Alltagsleben. Hunde waren sehr beliebt und fanden Eingang in zahllose Kunstwerke. In Ägypten war die Katze das liebste unter den domestizierten Tieren, ganz im Gegensatz zu Mesopotamien, wo Katzen kaum präsent waren. Zweifelsfrei war das Verhältnis der Menschen zu Hunden sowohl in Ägypten als auch in Mesopotamien durch alle Zeiten hinweg geprägt von hoher Affektivität. Hunde trugen selbstverständlich Namen und teilten nicht selten die Behausungen mit ihren Besitzern. Die damaligen Menschen fanden offenbar großen Gefallen an Tieren. Sie haben deren Erscheinung und Bewegungen mit großer Sorgfalt in die Kunst einfließen lassen. Während Darstellungen von Menschen oft stilisiert wirken, sind Tiere mitunter verblüffend akkurat abgebildet. Kurz gesagt: Hunde waren damals sehr präsent. Doch waren sie auch im Krieg präsent? Man kann sich dazu folgenden Gedanken machen:
Geschichtliches Umfeld insgesamt: Mit der Entstehung der ersten Hochkulturen bildeten sich immer größere Gemeinwesen heraus, aus denen schließlich große Reiche entstanden. Die blühenden Stadtstaaten an den Flüssen standen in Konkurrenz zu den Nomadenvölkern an der Peripherie. Mit der wachsenden wirtschaftlichen Potenz und der zunehmenden kulturellen Entfaltung traten organisierte militärische Verbände auf. Es kam zu den ersten großen Schlachten der Geschichte. Der Hund lebte zu dieser Zeit schon viele Jahrhunderte an der Seite des Menschen. Irgendwann bezog man diesen treusten aller Begleiter in die militärische Struktur ein. Wann das war, lässt sich unmöglich datieren. Bestimmt war es kein einmaliger Vorgang. Vielmehr wuchs der Hund über einen langen Zeitraum an verschieden Orten langsam in seine militärischen Funktionen hinein, nicht anders als er in seine sonstigen Nutzfunktionen hineinwuchs.
Präsenz von kämpferischen Hundetypen: Die Präsenz von großen, kräftigen, Furcht einflößenden Hunden könnte darauf hindeuten, dass es spezielle Rassen oder Typen gab, die im Kampf und Krieg Verwendung fanden. Dazu holen wir ein wenig aus: Eine der ältesten Darstellungen mit einem klar definierbaren Hundetyp findet sich auf einem Krug. Er stammt aus dem 4. Jahrtausend v.Chr. und wurde in Ägypten gefunden. Der Hund ist selbst für das heutige Auge noch ziemlich klar als Windhund zu erkennen. Es handelt sich um den Tesem, einem der ersten, speziell gezüchteten Hundetypen. Abbildungen solcher Hunde wurden zudem auf Höhlengemälden in der Sahara gefunden. Der Tesem war verbreitet in den Trockengebieten Nordafrikas und Asiens sowie in Mesopotamien. (vgl. Zimen 2010, S. 150 - 151) Allerdings setzte eine Rassenbildung mit großer Wahrscheinlichkeit wesentlich früher und an verschiedenen Orten ein. Nur gibt es dazu keine archäologischen Funde.
Während der Tesem bestimmt kein Typ war, der mit Kampf konnotiert wurde, so entstand etwas später ein schwerer, bulliger Hundetyp, der zuerst in Ägypten und Mesopotamien zu sehen war. Dieser Typ wurde ebenfalls in künstlerischen Darstellungen abgebildet. Vom babylonischen König Nebukadnezzar ist überliefert, er solle unter dem Tempel von Gula zwei Hunde aus Gold, zwei aus Silber und zwei aus Bronze begraben haben, die über sehr starke Glieder und massige Körper verfügten. (vgl. Aynard in Brodrick 1972, S. 56) Im Prinzip ist das die perfekte Beschreibung eines Mastiffs. Die vielleicht schönste Darstellung eines Hundes aus Mesopotamien zeigt ebenfalls zweifelsfrei einen Mastiff. Es handelt sich um den Hund des Königs Sumu-Ilum aus Larsa. Das Kunstwerk entstand Ende des 3. Jahrtausends v.Chr. Erstaunlich ist, dass man sogar die Gestik des Hundes lesen kann. Er liegt, ist dabei sehr aufmerksam und angespannt. Es scheint, das kräftige Tier sei jederzeit bereit, sich zu erheben. (vgl. Aynard in Brodrick 1972, S. 56 - 57)
Ob künstlerische Darstellungen solcher starken Hunde jetzt ein Hinweis dafür sind, dass in jener Zeit Hunde im Kampf oder sogar Krieg eingesetzt wurden, lässt sich nicht beweisen – allerdings auch nicht widerlegen. Solche schweren Mastiffs konnte man jedenfalls gut zur Jagd auf wehrhaftes Großwild gebrauchen. Daneben gaben sie gute Wachhunde ab. Man kann sich leicht vorstellen, dass ein solcher Hundetyp auch als Kämpfer taugte, was den Menschen damals wohl kaum entgangen sein dürfte. Solche starken Hunde waren einfach für den Kampf prädestiniert. Wieso sonst hätte man sie so stark gezüchtet? Bringt man jetzt den Gedanken zu Ende, so kann man sagen: Es spricht wenig dagegen, dass solche starken Hunde dann und wann in den Kampf und in den Krieg getrieben wurden.
Es wäre allerdings vermessen zu meinen, dass zur Zeit der frühen Hochkulturen die Zucht, geschweige denn die Dressur von Hunden sehr systematisch erfolgte. Man muss sich das alles eher intuitiv vorstellen. Die Leute verpaarten einfach jene Hunde, die sie in ihrer Umgebung vorfanden und die jene Eigenschaften aufwiesen, die sie fördern wollten. Es entstanden große und kleine, schlanke und kräftige Typen. Die Kleinen gaben gute Kumpanen ab. Die Schnellen waren gut auf der Jagd. Die Kräftigen konnten das Haus bewachen. Und so entstand auch ein Hundetyp, bestimmt groß, agil, kräftig und imposant, der sich gut im Kampf einsetzen ließ. Die Funktionalitäten waren nicht klar voneinander abgegrenzt. Vielleicht merkte ein Herr eines Tages, dass sein Jagdhund nicht nur heiß auf Wildschweine war, sondern ganz prinzipiell alles jagte, was ihm der Meister zu jagen befahl – also auch Menschen. So mutierte der Jagdhund zum Kriegshund. Oder ein guter Wachhund wurde eines Tages mitgenommen, als sein Meister in die Schlacht zog. Denn man wusste, dass er sich wie wild auf jeden stürzte, der seinem geliebten Herrn nur ein Härchen zu krümmen gedachte. So mutierte auch der Wachhund zum Kriegshund.
Explizite Hinweise auf Teilnahme von Hunden an Kämpfen und Kriegen: Man kann natürlich auch direkter fragen: Gibt es Hinweise, die unmissverständlich auf den Einsatz von Hunden hindeuten? Doch das ist noch schwieriger. Archäologische Funde physischer Nachweise, die den Einsatz von Kriegshunden zweifelsfrei belegen könnten, gibt es wahrscheinlich keine. Dagegen gibt es Darstellungen in der Kunst oder sogar Inschriften, die aber mit Zurückhaltung zu interpretieren sind. Denn man kann nicht genau wissen, was der Künstler wirklich darstellen wollte. Vielleicht galt sein Kunstwerk gar nicht der Realität, sondern einer mehr oder weniger wilden Interpretation der Realität oder sogar der puren Fantasie. In der Literatur zirkulieren viele kaum überprüfbare Schilderungen von Kampfhunden aus diesen frühen Tagen, die aber in den wenigsten Fällen der historischen Realität entsprechen dürften, erstaunlicherweise jedoch bis heute meist unkritisch weitererzählt werden. Realistischerweise muss man solche literarischen und künstlerischen Quellen wohl bestenfalls im Bereich der Legende, vielleicht sogar der Fiktion ansiedeln.
Wirklich sichere Hinweise auf den Einsatz von Kriegshunden aus der Zeit der frühen Hochkulturen gibt es also nur sehr wenige. Wie Richard Carrington in seinem Beitrag im Buch Animals in Archaeology erwähnt, waren Hunde sehr beliebt als Eskorten, um ihren Meister zu beschützen. (vgl. Brodrick 1972, S. 78) Quellen aus der Zeit des Mittleren Reiches (2030 - 1640 v.Chr.) implizieren, dass Hunde womöglich in der lybischen Wüste Kriegsdienst leisteten. (vgl. Karunanithy 2008, S. 69)
Etwas jünger, dafür eindeutiger ist eine Grabplatte mit der Abbildung des berühmten Tut Enchamun. Das Kunstwerk entstand um zirka 1’300 v.Chr. Gezeigt wird eine Kampfszene, wobei Tut Enchamun von kräftigen Hunden begleitet wird, die offensichtlich am Kampf beteiligt sind. Tut Enchamun selbst steht in einem Kampfwagen. Die Szene spielte sich in den Feldzügen gegen Nubien ab. Die Bewohner dieser Region (im heutigen südlichen Ägypten gelegen) waren dunkelhäutig, was auf dem Bild ebenfalls zum Ausdruck gebracht wird.
Sehr interessant ist der Brief eines ägyptischen Offiziers, der zur Zeit der 18. Dynastie (1540 - 1307 v.Chr.) in Palästina diente. Im Brief steht: »Es gibt 200 große Hunde dort und 300 Wolfshunde, zusammen 500, die jeden Tag an der Tür des Hauses bereit stehen, wann immer ich heraus gehe... Was wäre auch, hätte ich nicht den kleinen Wolfshund von Nahréh, einem königlichen Spross, hier im Hause? Und er schützt mich vor ihnen. Zu jeder Stunde, wo immer ich hingehe, ist er mit mir als mein Führer auf der Strasse...« (aus Brodrick 1972, S. 78) Geht man davon aus, dass der Brief zumindest einen authentischen Kern hat, so kann man dreierlei daraus ableiten: 1) Es gab damals ziemlich viele und ziemlich lästige Streuner, von denen die Soldaten bedrängt wurden. 2) Die Soldaten führten eigene Hunde mit, um sich vor den Streunern zu schützen. 3) Die Soldaten ließen sich von Hunden begleiten, wenn sie auf Wache waren und zu einem Patrouillengang aufbrachen. Kurzum: Offensichtlich gab es damals schon eine Art Schutz- und Begleithund für Soldaten – nicht viel anders als heute noch.
Erwähnt wird sodann der assyrische König Assurbanipal. Er habe immer große, kräftige, Furcht erregende Doggen um sich gehabt, die er sowohl für den Kampf als auch für die Löwenjagd eingesetzt haben soll. Berühmt ist das Relief von Ninive. Es zeigt Assurbanipal mit einem eindrücklichen Mastiff. Er hält in der rechten Hand einen langen Spieß und in der linken Hand die Leine des Hundes. Diese ist gespannt, da der Hund an der Leine zieht. Der Körper des Tieres ist angespannt. Der Kopf ist charakteristisch zu einer Droh- oder Abwehrgebärde nach vorne gestreckt, die Schnauze geöffnet, die Lefzen gehoben, Falten auf der Nase. (vgl. Brackert / van Kleffens 1989, S. 18)
Wo es zu Kriegseinsätzen von Hunden kam, stellt sich noch die Frage, wie man sich diese konkret vorzustellen hat. Andrea Steinfeldt hat in ihrer Dissertation viele Quellen konsultiert, die mitunter ein farbiges Bild zeichnen. Wenngleich den Einzelheiten bestimmt nicht immer ein historisch gesichertes Wissen zugrunde liegt, so kann man sich doch bildlich vorstellen, wie es womöglich ausgesehen haben mag, als solche Kampfhunde in den Krieg zogen: »Als gegen 2’000 bis 1’000 v. Chr. Babylonier, Assyrer und andere Völker feindliche Dörfer und Städte überfielen und die Vorherrschaft in Vorderasien erlangten, führten sie kräftige Hunde, so genannte ‘Löwenpacker’ mit sich, mit deren Hilfe sie die Völker aus den Stromtälern des Euphrats, Tigris und des Nils unterwarfen. Die Hunde trugen dabei nicht nur breite Lederhalsbänder, sondern auch regelrechte ‘Kampfanzüge’ aus starkem Leder, die Rücken und Bauch vor Speer- und Pfeilspitzen schützten. Oftmals trugen diese Hunde auch Halsbänder mit großen Messern oder Pechfackeln. Man leitete sie in die Kavallerie des Feindes, damit sie die Pferde durch Schnittverletzungen oder Verbrennungen in die Flucht schlugen. Vor Aufkommen der Feuerwaffen waren Kriegshunde eine bedeutende Waffengattung. Fußsoldaten hatten eine Todesangst vor ihnen, und beim Einsatz gegen Reiter waren sie oft sehr effektiv.« (Steinfeldt 2002, S. 26)
Indische Hunde
Sie beflügelten die Fantasie der antiken Autoren und vieler Hundeliebhaber bis heute: Die starken, kämpferischen Hunde aus Indien, die in den Lebensraum Mesopotamiens gelangten und von hier weiter bis tief in den Westen Verbreitung fanden. Allerdings schien bereits mit Aristoteles (384 - 322 v.Chr.) die Fantasie etwas durchgebrannt zu sein. In seiner Tierkunde liest man: »Es gibt auch außerdem noch Tiere, welche aus der Paarung von Tieren verschiedener Art entstehen: So vermischen sich in Kyrene die Wölfe mit Hündinnen und erzeugen Nachkommenschaft. Und aus der Paarung des Fuchses und Hundes entstehen die lakonischen Hunde. Ebenso sollen aus dem Tiger und Hunde die indischen Hunde entstehen, jedoch nicht bei der ersten, sondern erst bei der dritten Paarung. Denn das bei der ersten Kreuzung geborene soll noch ein Tier von wilder Natur sein. Man führt Hündinnen gefesselt in die Wüsten und viele werden aufgefressen, wenn das wilde Tier nicht gerade in der Brunst ist.« (Aristoteles, Buch VIII.28.167). Plinius schwadronierte in seiner Naturkunde rund 400 Jahre später ganz ähnlich: »Die Inder trachten, sie – die Hunde – von den Tigern begatten zu lassen, und binden deshalb die Weibchen zur Laufzeit in den Wäldern an. Die Jungen des ersten und zweiten Wurfs halten sie für zu wild, erst die vom dritten ziehen sie auf.« (Plinius, Buch VIII.148)
Grundannahme all dieser Legenden ist immer die gleiche: Hunde weit aus dem Osten hätten den Grundstock der schweren Mastiffs im Westen begründet oder zu deren Genpool wesentlich beigetragen. Solche Geschichten haben ohne Zweifel ihren herben Charme. Aber mit der Realität hat all das wenig zu tun. In Wirklichkeit sind doggenartige Hunde an verschiedenen Orten dieser Welt unabhängig voneinander entstanden. Es mag bestimmt Kreuzungen von Schlägen aus unterschiedlichen Regionen gegeben haben. Dass der eine oder andere Hund tatsächlich weit aus dem Osten den Weg nach Mesopotamien oder Griechenland gefunden hat, ist nicht unplausibel. Es gab Handelskontakte. Die Phönizier gelangten von Indien bis nach Spanien und Britannien. Austausch erfolgte sodann über militärische Expeditionen. Bekanntlich ist Alexander der Große bis nach Indien vorgedrungen. Außerdem gab es Völkerwanderungen. So siedelten sich die Sumerer, ein iranisches Volk, um 2’500 v.Chr. im südlichen Mesopotamien an. In ihrem Gefolge kamen bestimmt Hunde in den neuen Siedlungsraum.
Doch selbst wenn man unterstellt, dass tatsächlich Hunde weit aus dem Osten in den Westen gelangten, so ist nicht klar, wie prägend solche Importe auf den Genpool der indigenen Populationen waren. Schließlich handelte es sich nur um wenige Exemplare, die eine so große Distanz überwinden konnten. Wenn dennoch von »indischen Hunden« die Rede ist, so müssen wir »Indien« als Metapher für Osten verstehen oder noch genereller als Metapher für fremd oder fern. Anders gesagt: Die Erwähnung von Hunden indischen Ursprungs in antiken Texten besagt einfach, dass kampfstarke Hunde aus fernen und fremden Ländern im weitesten Sinne in den Westen gelangten.
Tibetdogge
Ähnlich gelagert wie die Legenden um die indischen Hunde sind die Legenden um die Tibetdogge, die ebenfalls weit zurückreichen und sich unverwüstlich bis heute halten. Riesige Hunde aus Tibet sollen demnach bis nach Mesopotamien gelangt sein und sich von dort im ganzen Westen verbreitet haben.
Im 13. Jahrhundert erwähnte Marco Polo in seinen Reiseberichten aus Asien tatsächlich Sensationelles. In Tibet traf er auf riesige Hunde. 1926 übersetzte Henry Yule den Bericht von Marco Polo. Dort liest man: »Sie haben Mastiffs so groß wie Esel, die unschlagbar im Packen von wilden Biestern sind.« (Yule 1926, 2. Buch, Kapitel XLVI) Man darf mit gutem Recht darüber rätseln, ob Marco Polo einer Halluzination erlegen war. Denn Hunde von der Größe eines Esels gab es nie und nirgends, auch nicht in Tibet. Wahrscheinlicher ist, dass ortskundige Tibeter dem Fremdling Marco Polo von solchen Hunden erzählten, wobei er die Berichte naiverweise für bare Münze nahm.
Marco Polo stand in der Gunst des Mongolenherrschers Kubilai Kaan. So berichtete er über dessen Jagdhunde, ohne Zweifel mit etlicher Übertreibung. Riesige Mengen an großen Mastiffs hat der Kaan demnach besessen. Zwei Wärter am Hof waren speziell für die Hundemeuten zuständig. Wenn der Kaan zur Jagd aufbrach, so begleiteten ihn 10’000 Männer mit 5’000 Hunden zur rechten und ebenso viele zur linken Seite. In den großen Ebenen lieferten sich die Hunde einen spektakulären Kampf mit dem Wild. Eine Meute riss einen Bären nieder, eine andere Gruppe warf sich auf einen Hirsch oder andere Biester. (vgl. Yule 1926, 2. Buch, Kapitel XIX)
Aber es geht noch einen Tick spektakulärer. Marco Polo erwähnte eine sagenhafte Provinz im Süden Chinas. An einem Fluss (vielleicht meinte er den Mekong) griffen immer wieder Löwen Reisende an. So sprangen sie von einer Flussbank in die Boote, rissen ein Opfer heraus und verschlangen es. Doch in dieser Provinz gab es eine Hunderasse, die so groß war, dass zwei von ihnen es mit einem Löwen aufnehmen konnten. Deshalb führte jeder, der auf Reisen ging, eine Koppel mit zwei dieser Hunde bei sich. Griff ein Löwe an, so konnten die Hunde mit großer Geschicklichkeit den Prankenschlägen ausweichen. Die Hunde setzten dem Löwen sogar nach, wobei sie nur auf eine Gelegenheit warteten, ihn ihrerseits durch einen Biss zu verletzen. Oft zog sich der Löwe in den Wald zurück. Doch die Hunde folgten ihm. Wenn der Löwe so weit eingeengt war, dass er sich vor einen großen Baum stellte, um seinen Rücken zu decken, so holten die Reisenden ihre Pfeilbogen heraus und schossen ihn ab. (vgl. Yule 1926, 2. Buch, Kapitel LIX)
600 Jahre nach Marco Polo unternahm der österreichischungarische Graf Bela Széchenyi eine große Expedition in den Fernen Osten (1877 - 1800). Auch er traf auf riesige Hunde in Tibet. Der Geograph der Expedition, Gustav Kreitner, schrieb: »Schon in China hörten wir so vieles über die schönen tibetanischen Hunde erzählen, dass ich mich wirklich darauf freute, die Tiere kennen zu lernen. Und in der Tat, sie verdienen das Lob. Die tibetanischen Hunde besitzen viel Ähnlichkeit mit den schönsten Neufundländern, ihr Kopf aber ist bedeutend größer und gewinnt durch das mähnenartig emporgewachsene Nackenhaar an imponierender Wildheit. (...) Sie sind im Allgemeinen bissige Bestien, die im Hause an der Kette gehalten, mit ihrem tiefen Gebelle die Luft erzittern machen. Während einer Attacke wedeln sie ohne Unterlass mit dem Schweife. Als Schäferhunde oder bei den Yak-Karawanen verwendet, halten sie Ruhe und Ordnung aufrecht und sorgen zugleich durch ihre Wachsamkeit für die gewünschte Sicherheit.« (Kreitner 1881, S. 878)
So sehr war Graf Széchenyi von den Hunden angetan, dass er drei Exemplare kaufte und nach Europa brachte, wo sich eine Episode ergab, die Kreitner in seinem Reisebericht so beschrieb: »Graf Széchenyi brachte drei prachtvolle tibetanische Hunde, zwei Männchen namens Dschandu und Dsamu und ein Weibchen mit Namen Dsama, käuflich an sich. Dschandu und Dsama zeigten sich nicht nur – obwohl mit Aufwand aller zur Verfügung stehenden Mittel – dressurfähig, sondern ertrugen auch ohne Gefährdung ihres Wohlbefindens die See- und Landreise nach Europa. Derzeit zählen sie zu den verlässlichsten Wächtern auf dem Schloss des Grafen Széchenyi in Zinzendorf am Neusiedler-See. Anders betrug sich Dsamu. Als entschiedener Feind aller Europäer duldete er keinen von uns in seiner Nähe, ja er biss wiederholt den Grafen, der ihn durch die Verabreichung des Futters zu zähmen versuchte, und zerfleischte ihm einmal bei einer solchen Gelegenheit in sehr bedrohlicher Weise die rechte Hand. Fast in jedem Nachtquartier sorgte der Hund für unsere Verproviantierung, indem er regelmäßig allen Hühnern und Schweinen, die sich in seine Nähe verirrten, erbarmungslos die Wirbelsäule durchbiss. Als Dsamu aber in Bamo ein armes, altes Weib, das ihn mit einem Prügel bedrohte, derartig zurichtete, dass es kurze Zeit darauf starb, da war sein Schicksal entschieden. Graf Széchenyi erschoss ihn auf der Stelle.« (Kreitner 1881, S. 878)
Die Geschichte zeigt eines schön: Im 19. Jahrhundert intensivierte sich der Austausch zwischen Europa und dem Reich der Mitte. Die europäischen Mächte sicherten ihren Einfluss in China mit militärischen Expeditionen ab. Kolonien entstanden, Einflussgebiete wurden abgesteckt. Der Handel nahm Schwung auf. Im Zuge dieses Austauschs gelangten auch Tibetdoggen direkt nach Europa. Das englische Königshaus importierte solche Hunde, die als gute Wächter geachtet waren. 1847 sandte Lord Hardinge, der Vizekönig von Indien, eine Tibettdogge an Queen Victoria. Edward VII, Prinz von Wales, brachte ebenfalls zwei Tibetdoggen mit nach England. Basierend auf solchen Importen wurde langsam eine Zucht von Tibetdoggen im Westen begründet, aus der schließlich eine durch den Welthundeverband FCI anerkannte Rasse hervorging, die offiziell Do Khiy genannt wird. Bis heute lassen sich Züchter und Liebhaber immer wieder dazu verleiten, ihre Zuchtprodukte im Westen als direkte Abkömmlinge jener tibetischen Hunde zu bezeichnen, von denen in der Antike die Rede war. Doch das hat nichts mit der Realität zu tun. Erik Zimen schreibt etwa zur Herkunft der Tibetdogge: »Ihre angebliche Abstammung von tibetanischen Hunden (...) ist ebenso haltlos wie die vielen Vorstellungen über heutige Rassen, die von ihnen direkt abstammen sollten.« (Zimen 2010, S. 156)
Altertum
Griechenland
»Tiere hatten am griechischen Leben, der Kunst, Religion und Literatur einen sehr wichtigen Anteil. Unsere Kenntnis ihrer Rolle in der klassischen Welt leitet sich nicht nur aus archäologischen Funden ab, sondern auch aus der Literatur, wobei es ziemlich gewagt ist, den griechischen Lebensstil und die Manieren sowie die Sitten der Menschenmassen aus den Darstellungen in Büchern abzuleiten, die im Athen des 5. Jahrhundert geschrieben wurden. Die archäologischen Zeugnisse sind tatsächlich in einiger Hinsicht ziemlich ernüchternd für eine Zivilisation, die so wichtig und prägend war wie jene des klassischen Griechenland. Zunächst, mit der Ausnahme der bemalten Vasen, haben wir wenige Beispiele griechischer Malkunst. (...) Auch ist die griechische Skulptur womöglich nicht so aussagekräftig im Hinblick auf Tiere, wie man hoffen oder erwarten würde.« (Brodrick 1972, S. 103) Wir entnehmen diesen wenigen Zeilen, dass es – wieder einmal – schwierig ist, sich ein akkurates Bild vom Leben der Tiere und damit auch des Hundes in einer so fernen Zeit wie der Antike zu machen. Man kann alles in allem trotzdem eines annehmen: Im alten Griechenland waren Hunde im Alltagsleben gut präsent. Sie waren beliebt und in verschiedenen Nutzfunktionen tätig. Aber wie sah es mit Kriegshunden aus?
Realistischerweise muss man davon ausgehen, dass Hunde auf den Schlachtfeldern der Antike eine seltene Erscheinung waren und keinesfalls die Regel, egal wie spektakulär einzelne Berichte sein mögen. Die Soldaten jener Zeit waren bereits mit weit reichenden Waffen ausgestattet und verfügten über erhebliche Körperpanzerungen. Bereits seit dem 7. Jahrhundert v.Chr. waren die griechischen Hopliten mit Schwert, Lanze, Körperpanzer, Helm, Rundschild und Beinschienen ausgerüstet und kämpften wohl geordnet in der Phalanx. Gegen einen solcherlei aufgestellten Feind konnte ein Hund praktisch nichts ausrichten. Wenn Hunde im Krieg zum Einsatz kamen, so mit Bestimmtheit kaum im direkten Kampf gegen feindliche Soldaten, sondern vorwiegend in Hilfsfunktionen als Bewacher, Beschützer, Träger von Nachrichten, Spürhunde. Schauen wir uns dazu einige Hinweise an.
David Karunanithy erwähnt, dass es eine Reihe von Zeichnungen und Reliefs aus der Zeit um 550 - 470 v.Chr. gibt, die Hunde in Kampfszenen zeigen. Auf einer Stele aus der kleinasiatischen Stadt Dorylaion wird ein Hund dargestellt zusammen mit seinem Meister, einem voll ausgerüsteten Hopliten. Der Hund hat sogar einen Namen, Lethargos. Dies suggeriert einen nahen Bezug zum realen Leben und gibt der Darstellung große Authentizität. Ein Hinweis auf Kriegseinsätze ist womöglich auch darin zu sehen, dass Hunde gerne als Zierde auf die Schilde der Soldaten gemalt wurden. Am berühmtesten ist in dieser Hinsicht der bullige Hund auf dem Schild von Achilles. (vgl. Karunanithy 2008, S. 74)
Gewisse Darstellungen (oft auf Vasen) zeigen Herakles mit dem Hund aus dem Hades, dem berühmten vielköpfigen Zerberus. Die Tiere erscheinen als kräftig. Anders gesagt: Es handelt sich wiederum um einen starken Typ von Hund, wie er uns schon in Mesopotamien und Ägypten begegnet ist. Anscheinend gab es solche kräftigen Hunde, die für die Bewachung und den Kampf wie gemacht waren, auch in Kreta und darüber hinaus in Griechenland. »Doch auch als Haus- und Hofbeschützer sowie als Leibwächter von Königen und reichen Privatpersonen waren die Molosser geschätzt und schon die Könige der Mythenzeit ließen ihre Schlösser durch sie bewachen.« (vgl. Brackert / van Kleffens 1989, S. 23) Bewachen und Beschützen: Beides waren Aufgaben, die man in einem zivilen Umfeld gebrauchen konnte, aber fast noch besser in einem militärischen. Solcherlei Verwendungszwecke waren den damaligen Militärs bestimmt nicht entgangen, weshalb es wohl durchaus Hunde zur Bewachung militärischer Anlagen und zur Beschützung von Soldaten gab.
Aeneas Tacticus (erste Hälfte im 4. Jahrhundert v.Chr.) beschrieb in seiner berühmten Schrift Von der Verteidigung der Städte, wie sich Soldaten in einer Festung gegen Angreifer zur Wehr setzen konnten, wobei er den Einsatz von Hunden ziemlich detailreich ausführte. An einer Stelle gab Aenaeas mehr oder weniger praktikable Anweisungen für das Verhalten von Soldaten auf Wache bei Kälte und Dunkelheit. Das Beste ist es demnach, Hunde außerhalb der Mauern anzubinden. Diese sind schneller darin, einen Feind oder einen Verräter anzuzeigen, der sich der Stadt annähert. Auch kann er Deserteure anzeigen, die aus der Stadt fliehen wollen. Gleichzeitig, so meinte er offensichtlich mit wenig Glaube an die Disziplin der Soldaten, sorgt das Bellen der Hunde dafür, dass die Wachen aufgeweckt werden, falls sie einschlafen. (vgl. Aeneas, 22.14) An anderer Stelle empfahl er, mit Hunden außerhalb der Befestigungsmauern zu patrouillieren, um die Feinde oder Verräter daran zu hindern, sich zu formieren und über die Mauern zu klettern. (vgl. Aeneas, 22.20) Wenn Patrouillen die Befestigung bei Nacht verlassen, um einen außerhalb campierenden Feind anzugreifen, so muss man die Hunde und auch die Hähne unbedingt ruhig stellen, indem man ihnen das Maul zubindet. Das ist sehr wichtig, weil sonst die ganze Aktion auffliegen könnte. (vgl. Aeneas, 23.2) Wenn die Wachen in der Dunkelheit den Sichtkontakt zueinander verlieren, so können sie sich einer Pfeife bedienen, um beisammen zu bleiben. Doch soll man darauf achten, dass nicht die Hunde wegen dem Pfeifen verängstigt werden. (vgl. Aeneas, 24.18)
Sodann befasste sich Aeneas damit, wie Nachrichten verschlüsselt und überbracht werden konnten. Er empfahl wieder den Einsatz von Hunden. In Epirus seien diese bereits in großem Umfang eingesetzt worden. Man führt einen Hund von seinem gewohnten Platz an der Leine weg. Im Halsband näht man eine Nachricht ein. Dann wird der Hund losgelassen, in der Nacht oder am Tag, und er wird unfehlbar zurück zu seinem gewohnten Platz laufen. (vgl. Aeneas, 31.32)
Im unmittelbaren Kampf sah Aeneas wenig Potential für Hunde. Im Gegenteil, in der Situation des Gefechts betrachtete er sie sogar als hinderlich. Dies bekräftigt uns in der Annahme, dass Hunde nicht direkt als Kämpfer eingesetzt wurden. Aeneas meinte: Wenn ein Angriff auf die Festung erfolgt, so sollten die Hunde angekettet bleiben. Im Moment des Angriffs werden sie nicht gebraucht. Es herrscht außerdem viel Betriebsamkeit wegen den Soldaten, die zum Einsatz rennen, was dazu führen könnte, dass die Hunde die Soldaten behindern oder sogar attackieren. (vgl. Aeneas, 38.1 - 3)
Interessante Erwähnungen von Kriegshunden gibt es im Zusammenhang mit Völkern aus dem Osten, die in den Legensraum der Griechen in Kleinasien eindrangen:
Zirka 600 v.Chr. wurde König Alyattes aus Lydien von den am Schwarzen Meer beheimateten Kimmerern angegriffen. Der Makedonier Polyainos (ca. 100 v.Chr.) erwähnte in seinen
Strategika,
einer 161 / 162 n.Chr. erschienen Sammlung militärischer Listen, Kriegshunde im Dienste von Alyattes. »Als die monströsen und bestialischen Kimmerer eine Expedition gegen ihn unternahmen, ließ Alyattes seine stärksten Hunde zusammen mit dem Rest seiner Streitkraft antreten. Die Hunde stürzten sich auf die Barbaren, als ob es sich um wilde Tieren handelte, töteten viele von ihnen und zwangen den Rest, schmachvoll zu flüchten.« (Polyainos, Buch 7.2.1-2)
Eine andere, kurze Passage stammt aus den
Tiergeschichten
von Claudius Aelianus (um 170 n.Chr.) und betrifft die Völker von Hyrkanien am kaspischen Meer und von Magnesien. Man liest: »Ihre Hunde begleiteten gewöhnlich die Hyrkanier und Magnesier in den Krieg, und in der Tat waren diese Kampfgenossen ein Vorteil und eine Hilfe für sie.« (Aelianus, Buch 7.38)
Plinius wiederum erwähnt in seiner
Naturkunde
die Städte Kolophon (eine der größten Städte Ioniens) und Kastabala. »Zum Gebrauch im Kriege hielten sich die Einwohner von Kolophon und Kastabala Hundeherden; diese kämpften in der vordersten Front, ohne sich je zu weigern: sie waren die treusten Hilfstruppen und brauchten dabei keinen Sold« (Plinius, Buch VIII.143)
Der blutrünstige Ruf der kaspischen Völker war so nachhaltig, dass er bis in die beginnende Neuzeit nachwirkte. Der Autor und Mönch Magnus Olaus befasste sich in seinem 1555 erschienen Buch
Wunder des Nordens
unter anderem ausführlich mit dem Verhalten von Hunden, auch mit ihrer Kampftauglichkeit. Die Hunde der kaspischen Völker seien die Schärfsten überhaupt gewesen. Ihre Grausamkeit sei mehr gegen Menschen gerichtet gewesen als gegen wilde Tiere. Der Grund dafür habe darin bestanden, dass sie schon als Welpen mit menschlichen Leichnamen gefüttert worden seien. (vgl. Magnus Olaus, Buch 17)
Nebenbei ist ein Aspekt interessant, dessen militärische Konnotation man auf den ersten Blick gar nicht erkennt. Die Spartaner sahen in der Praxis der Jagd eine Übung, die der militärischen Ertüchtigung dienen sollte. »Von den Spartanern wissen wir, dass sie die Jagd vor allem aus Staatsräson ausübten. Lykurg hielt sie für notwendig, um die Lakedonier zu guten Soldaten auszubilden. Die spartanischen Jünglinge hatten jeden Morgen mit Lanze und Hund die Wälder zu durchstreifen, ja selbst die Magistratsbeamten sollen dieser Pflichtübung unterworfen gewesen sein, die zum festen Lebensrahmen der Spartaner ebenso strikt gehörte wie ihre so oft als ungenießbar geschmähten Speisen.« (Brackert / van Kleffens 1989, S. 25) Die Jagd mit Hund als Training für die Soldaten also.
Perser
Mit dem Aufstieg des Perserreiches um 500 v.Chr. entstand erstmals ein staatliches Gebilde, das man als Großmacht bezeichnen könnte. Im Gefolge der großen geschichtlichen Entwicklung marschierten – wie gehabt – die Hunde mit. Es gibt einige wunderbare Legenden von persischen Kriegshunden, die wir uns jetzt einmal näher anschauen.
Berühmt und immer wieder gerne zitiert ist eine Passage des griechischen Historikers Herodot aus seinen Geschichten. Er erwähnt Tritantaichmes, den persischen Statthalter von Babylon unter Xerxes I. Babylon war reich, musste aber schwere Abgaben an das Heer entrichten. Tritantaichmes, so Herodot, habe über 800 Hengste und 16’000 Stuten verfügt. Diese Zahlen dürfen wir natürlich nicht wörtlich nehmen, aber doch immerhin als Fingerzeig dafür, dass es sich um wirklich viele Pferde handelte. Sodann nennt Herodot die Hunde des Statthalters: »Und indische Hunde wurden in solcher Menge gezogen, dass vier große Dörfer in der Ebene, sonst abgabenfrei, nur das Futter für diese Hunde zu liefern hatten.« (Herodot, Buch 1.192 )Wozu die Hunde dienten, präzisiert er nicht. Die Bezeichnung »indische Hunde« lässt aber vermuten, dass es starke Tiere irgendwo aus dem Osten waren, die durchaus zu kämpferischen Zwecken eingesetzt wurden.
Polyainos erwähnt in seiner Schrift Strategika den persischen König Kambyses II. Dieser unternahm im Jahre 525 v.Chr. einen Feldzug gegen Ägypten. »Kambyses belagerte Pelusium. Die Ägypter leisteten heftigen Widerstand, indem sie die Zugänge nach Ägypten blockierten. Und indem sie viele Artillerie-Batterien in Stellung brachten, schossen sie in rascher Abfolge mit Katapulten Geschosse, Steine und Feuer. Kambyses stellte vor seiner Armee alle jene Tiere auf, die von den Ägyptern verehrt werden – Hunde, Schafe, Katzen, Steinböcke. Die Ägypter hörten auf zu schießen aus Angst, sie könnten eines der heiligen Tiere treffen. Daraufhin nahm Kambyses Pelusium und marschierte in Ägypten ein.« (Polyainos, Buch 7.9)
Über denselben Kambyses berichtet Herodot wie folgt: »Die Hellenen erzählen, Kambyses habe ein Löwenjunges und einen jungen Hund aufeinander losgelassen, und diese seine Frau habe auch zugeschaut, und als der junge Hund unterlag, habe dessen Bruder sich von der Leine losgerissen und sei ihm zur Hilfe gekommen, und so, zu zweien, hätten sie das Löwenjunge bezwungen. Und Kambyses hatte seine Freude beim Zuschauen, sie aber saß dabei und weinte. Als Kambyses das wahrnahm, fragte er, warum sie weine, sie aber sagte, wie sie gesehen, dass der junge Hund seinem Bruder zu Hilfe kam, habe sie weinen müssen, weil sie des Smerdis gedacht habe und inne geworden sei, dass nun keiner mehr da sei, der auch ihm einmal zu Hilfe kommen könne.« (Herodot, Buch 3.32)
Die Geschichte ist von tragischer Symbolik. Verschiedenes läuft zusammen: 1) Die Frau von Kambyses war gleichzeitig seine Schwester, der König betrieb also – legitimiert durch eine Finte – Inzest. 2) Während Kambyses in Ägypten weilte, wurde sein Thron in Persien usurpiert von Smerdis, seinem Bruder. 3) Smerdis wurde in Persien ermordet, vermutlich auf Geheiß von Kambyses. Nun erschließt sich die Symbolik: Die Frau sah im Hund, der seinem Bruder-Hund zu Hilfe eilte, natürlich Smerdis, den Bruder ihres Mannes, der jedoch tot war. Kambyses verstand die Anspielung und war im Übrigen ein Mann, mit dem man besser keine solchen Spielchen treiben sollte. Kurz darauf brachte er seine Frau um. Womöglich war die Anspielung während dem Hundekampf der Auslöser dafür.
Hundelegenden aus den Perserkriegen
Die Perserkriege (499 bis 448 v.Chr.) waren eine Serie von Auseinandersetzungen zwischen dem Perserreich und einer Allianz griechischer Staaten. Ausgangspunkt waren die Aufstände in einigen griechischen Städten Kleinasiens gegen die persische Obrigkeit. Die Aufstände wurden unterstützt von den Griechen im Kernland. Dies wiederum veranlasste den persischen König Darius zu einem Rachfeldzug. Er schickte einen Flotte nach Griechenland. Als er auf Athen vorstieß, setzte er seine Streitmacht bei Marathon ab, wo es zur legendären Schlacht kam, einer knallenden persischen Niederlage. In einer zweiten Phase fiel Xerxes, Darius’ Sohn und Nachfolger, erneut in Griechenland ein. Er stieß mit einer großen Landstreitkraft vor. Dazu stand ihm eine eindrückliche Flotte zur Verfügung. Nachdem die eigentlich unterlegene griechische Flotte die Perser in den engen Gewässern bei Salamis geschlagen hatte, blies auch das persische Landheer zum Rückzug. Die Griechen schlossen sich ihrerseits zusammen, um alle griechischen Städte zu befreien, die noch unter persischer Hoheit standen. Am Ende überließen die Perser das gesamte ägäische Becken den Griechen. Der Konflikt endete im so genannten Callias-Frieden.
Es gibt einige Berichte von Hunden aus den Perserkriegen. Herodot beschreibt die unglaublichen Dimensionen, die das Heer von Xerxes angenommen haben soll in seinen Geschichten. Die Stärke der Kampftruppen und Hilfstruppen veranschlagte er mit 528 mal 13’220. Das macht 6’980’160 Mann. Natürlich ist die Zahl unrealistisch und darf nicht wörtlich genommen werden. Indessen kommt Herodot auf weitere Begleiter des Heeres zu sprechen: »Doch bei den Küchenfrauen und Nebenfrauen und Eunuchen kann wohl niemand eine genaue Zahl angeben. Und auch von den Zugtieren nicht und dem andern Vieh, das Lasten trug, und den indischen Hunden, die auch dabei waren, auch von denen könnte wohl angesichts der Menge niemand eine Zahl angeben. So nimmt es mich gar nicht wunder, dass bisweilen das Wasser der Flüsse nicht ausreichte, sondern viel eher erstaunt es mich, dass die Verpflegung hinlangte für all diese Zehntausende. Denn beim Zusammenzählen komme ich zu folgendem Ergebnis: Wenn jeder pro Tag einen Choinis Weizen bekam und nicht mehr, haben sie Tag für Tag elf mal zehntausend Medimnen verbraucht und dann noch weitere dreihundertundvierzig Medimnen dazu. Den Verbrauch für Weiber und Eunuchen, Zugvieh und Hunde stelle ich dabei nicht in Rechnung.« (Herodot, Buch 7.185 - 187)
Aus dieser Passage zu folgern, Xerxes habe Zehntausende Hunde dabei gehabt, wäre natürlich abwegig. Unter der Quantifizierung Herodots ist wohl ganz simpel zu verstehen: viele, bisweilen sehr viele. Auch die Funktion der Hunde ist nicht beschrieben. Allerdings scheint es sich nicht um Streuner gehandelt zu haben, die dem Heer spontan gefolgt sind. Vielmehr wurden die Hunde ja verpflegt, wie man dem Bericht von Herodot entnimmt. Man muss nicht besonders weit spekulieren, um anzunehmen, dass die Präsenz der Hunde daher einen wohl definierten Zweck hatte. Wachhunde? Kriegshunde? Oder wurden sie mitgeführt als Geschenk für lokale Größen, die man für sich gewinnen wollte, indem man ihnen prestigeträchtige Kampfhunde überreichte? Dienten sie womöglich der Unterhaltung, indem für die Truppe Hundekämpfe ausgetragen wurden?