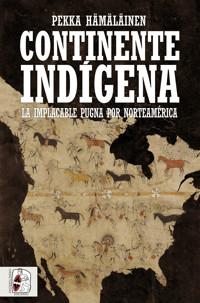Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kunstmann, A
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Pekka Hämäläinen erzählt in »Der indigene Kontinent« eine andere Geschichte Nordamerikas, die konsequent die indigenen Völker in den Mittelpunkt stellt. Ein unverzichtbares Standardwerk, das deutlich macht, dass die amerikanische Geschichte vor allem eine Geschichte des indigenen Widerstands ist. Die Geschichte Amerikas wird immer noch so erzählt: Kolumbus »entdeckt« einen fremden Kontinent und kehrt mit Geschichten über ungeahnte Reichtümer in die »alte Welt« zurück. Die europäischen Imperien stürzen sich auf den Kontinent und versuchen, so viel wie möglich von dieser erstaunlichen »Neuen Welt« zu erobern. Obwohl sich die indigenen Völker wehren, können sie den Ansturm nicht aufhalten. Mit »Der indigene Kontinent« legt Pekka Hämäläinen eine weitreichende Gegenerzählung vor, die die grundlegendsten Annahmen über die amerikanische Geschichte erschüttert. Er zeigt eine souveräne Welt indigener Völker, deren Mitglieder keineswegs hilflose Opfer kolonialer Gewalt waren, sondern den Kontinent auch nach der Ankunft der ersten Europäer jahrhundertelang beherrschten. Selbst als die weiße Bevölkerung explodierte und die Landgier der Kolonialisten immer zügelloser wurde, blühten die indigenen Völker dank ihrer ausgefeilten Diplomatie und Führungsstrukturen auf. Der Beweis für den Widerstand der Ureinwohner wird heute in den Hunderten von indigenen Nationen deutlich, die es in den Vereinigten Staaten und Kanada noch gibt. »Der indigene Kontinent« ist eine Pflichtlektüre und gibt den indigenen Völkern ihren rechtmäßigen Platz im Zentrum der amerikanischen Geschichte zurück.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1062
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PEKKA HÄMÄLÄINEN
DER INDIGENE KONTINENT
Eine andere Geschichte Amerikas
Aus dem Englischen vonHelmut Dierlamm und Werner Roller
Verlag Antje Kunstmann
INHALT
EINLEITUNGDer Mythos vom kolonialen Amerika
ERSTER TEIL
DIE MORGENDÄMMERUNG DES INDIGENEN KONTINENTS(Die ersten siebzig Jahrtausende)
1Die Welt auf dem Rücken der Schildkröte
2Der egalitäre Kontinent
3Blinde Eroberungen
ZWEITER TEIL
VON WEITEM WIE RIESEN(Das lange 16. Jahrhundert)
4Terra nullius
5Das Powhatan-Reich
6Kriege an der Küste
7Die Pequot sollen nicht mehr Pequot heißen
DRITTER TEIL
DER KAMPF UM DAS GROSSE AMERIKANISCHE BINNENLAND(Vom Beginn bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts)
8Der Aufstieg der Five Nations League
9Feinde des Glaubens
10Die Macht der Schwäche
VIERTER TEIL
DER INDIGENE GEGENSCHLAG(Spätes 17. Jahrhundert)
11Die Engländer als kleines Kind
12Metacoms Angriff
13Bürger- und andere Kriege in Virginia
14Der große Aufstand im Südwesten
FÜNFTER TEIL
DER BESTÄNDIGE INDIGENE KONTINENT(Frühes 18. Jahrhundert)
15Die Linie halten
16Sie rochen wie Alligatoren
17Unendlich viele Rancherías
SECHSTER TEIL
DAS HERZ DES KONTINENTS(Mitte bis Ende des 18. Jahrhunderts)
18Zauberhunde
19Kriege bis zum Ende der Welt
20Britisch-Amerika unter Belagerung
21Weltliche und außerweltliche Unabhängigkeitskriege
22Eine zweite Chinesische Mauer
SIEBTER TEIL
AMERIKANISCHE REVOLUTIONEN(spätes 18. bis frühes 19. Jahrhundert)
23Der amerikanische Schmelztiegel
24Versprechungen des Westens
25Der weiße Teufel mit dem weit offenen Maul
ACHTER TEIL
DAS ZEITALTER DER REITERIMPERIEN(19. Jahrhundert)
26Die lange Ära der Zwangsumsiedlung
27Der Aufstieg der Comanchen
28Der Lakota-Schild
EPILOGRache und Wiederbelebung
DANK
ANHANG
Abkürzungen
Anmerkungen
Bildnachweis
Register
EINLEITUNG
DER MYTHOS VOM KOLONIALEN AMERIKA
EINE ALTE, TIEF VERWURZELTE GESCHICHTE über Amerika geht ungefähr so: Kolumbus stolpert über einen fremden Kontinent und kehrt mit Erzählungen über unermessliche Reichtümer zurück. Die europäischen Imperien machen sich sofort auf den Weg, sie wollen sich so viel wie möglich von dieser erstaunlichen Neuen Welt unter den Nagel reißen. Obwohl sie dabei aneinandergeraten, lösen sie eine Ära kolonialer Expansion aus, die rund vier Jahrhunderte lang andauert, von der Eroberung der Insel Hispaniola im Jahr 1492 bis zum Massaker von Wounded Knee im Jahr 1890. Zwischen diesen beiden historischen Augenblicken ergreifen die europäischen Imperien und das aufkommende amerikanische Imperium Besitz von Seelen, Sklaven und Territorien, sie enteignen und zerstören Hunderte von indigenen Gesellschaften. Die Indianer wehren sich, können den Angriff aber nicht aufhalten. Es fehlt ihnen zwar nicht an Einfallsreichtum und Widerstandswillen, aber dem rohen Ehrgeiz der Neuankömmlinge, deren überlegener Technik und den eingeschleppten tödlichen Mikroben, die die Körper der Indigenen mit schockierender Mühelosigkeit zerstören, sind sie nicht gewachsen. Die Indianer sind dem Untergang geweiht; die Europäer sind zur Übernahme des Kontinents bestimmt; die Geschichte ist ein linearer Prozess, der unumkehrbar auf die Vernichtung der Indigenen zusteuert.
Der indigene Kontinent erzählt eine andere Geschichte. Dieses Buch zeigt die amerikanische Historie in neuem Licht, indem es die Ansicht infrage stellt, wonach die koloniale Expansion unvermeidlich gewesen sei und der Kolonialismus das Geschehen auf dem Kontinent ebenso bestimmt habe wie die Lebenserfahrungen der Menschen vor Ort. Dieses Buch löst sich von derart veralteten Annahmen und berichtet von einer Welt, die bis weit ins 19. Jahrhundert hinein in überwältigendem Ausmaß indigen geprägt blieb. Es vertritt den Standpunkt, dass wir nicht von einem »kolonialen Amerika«, sondern von einem indigenen Amerika sprechen sollten, das nur langsam und ungleichmäßig kolonialisiert wurde. Verschiedene europäische Kolonialmächte beanspruchten bis zum Jahr 1776 zusammengenommen fast den gesamten Kontinent für sich, aber die indigenen Völker und Mächte kontrollierten ihn. Die Karten in modernen Lehrbüchern, die einen großen Teil des frühen Nordamerika mit hübschen farbigen Markierungen darstellen, verwechseln absonderliche imperiale Ansprüche mit tatsächlichem Besitz. Die hier erzählte Geschichte der überwältigenden und anhaltenden indigenen Macht ist nach wie vor weitgehend unbekannt und ist zugleich der größte blinde Fleck im gemeinsamen Verständnis der amerikanischen Vergangenheit.
Die Realität eines indigenen Kontinents ist weitgehend verborgen geblieben, weil die europäischen Mächte und ganz besonders die Vereinigten Staaten den Staat und seine Bürokratie mit Machtbefugnissen ausgestattet haben, während indigene Nationen ihre Macht über Verwandtschaftsverhältnisse definierten und sicherten. Die europäischen Neuankömmlinge beurteilten die Indianer von Anfang an nach europäischen Maßstäben. Spätere Historiker hielten es genauso und konzentrierten sich auf die staatliche Macht als treibende Kraft des Geschehens in Amerika. Verwandtschaft konnte aber ebenso eine Quelle großer Macht sein, und indigene Nationen verfügten über entwickelte politische Systeme, die eine flexible Diplomatie und Kriegsführung ermöglichten, selbst wenn die Euroamerikaner dies oft nicht erkannten. Indianer blockierten und zerstörten immer wieder koloniale Projekte und zwangen die Kolonialisten jahrhundertelang, die indigene Lebensweise, Souveränität und Dominanz zu akzeptieren. Das können historische Überlieferungen zeigen, dafür muss sich aber die amerikanische Geschichtsschreibung von den historischen Mainstream-Erzählungen lösen, die europäische Ambitionen, Perspektiven und Quellen bevorzugen.
Die traditionelle Mustererzählung ist tief in unserer Kultur und Denkweise verankert. Man muss sich dabei nur vergegenwärtigen, wie Red Clouds Krieg und Custers »Last Stand« üblicherweise verstanden werden. Die Lakota-Indianer und ihre Cheyenne- und Arapaho-Verbündeten besiegten die Vereinigten Staaten zwischen 1866 und 1876 in zwei Kriegen – zunächst entlang des Bozeman Trails in einem Konflikt, der unter der Bezeichnung Red Clouds Krieg bekannt geworden ist, und in der Schlacht am Little Bighorn, in der sie George Armstrong Custers 7. US-Kavallerieregiment vernichteten. Beide Niederlagen werden in der herkömmlichen amerikanischen Geschichtsschreibung als Abweichungen oder – je nach Sichtweise – (un)glückliche Zufälle gesehen. Schließlich hatten sich die Vereinigten Staaten bis zu diesem Zeitraum bereits zu einer den gesamten Kontinent umfassenden militärisch-industriellen Macht entwickelt, die sich anschickte, die Expansion über die Westküste hinaus fortzusetzen. Die Lakota hatten die Vereinigten Staaten in einem geschichtsträchtigen Augenblick gedemütigt, in dem die Nation drauf und dran war, ihre Frontier-Identität abzulegen und in ein modernes Zeitalter der Wirtschaftsunternehmen, der Bürokratie und der Wissenschaft einzutreten. Die katastrophalen Niederlagen wurden schlechter militärischer Führung und einem schlauen Gegner zugeschrieben, der mit dem Kampfgebiet vertraut war.
Aus der Perspektive der Native Americans wirken Red Clouds Krieg und Custers Last Stand jedoch nicht wie historische Anomalien, sondern wie der logische Höhepunkt einer langen Geschichte indigener Macht in Nordamerika. Es handelte sich eher um erwartbare als um außergewöhnliche Ereignisse. Seit dem Beginn des Kolonialismus in Nordamerika bis zu den letzten militärischen Triumphen der Lakota kämpfte eine große Zahl von indigenen Nationen erbittert um den vollständigen Erhalt ihrer Gebiete und ihrer Kulturen und widersetzte sich den imperialen Absichten Frankreichs, Spaniens, Großbritanniens, der Niederlande und schließlich auch der Vereinigten Staaten. Zu dieser indigenen »Unendlichkeit der Nationen« (»infinity of nations«) zählten die Irokesen, Catawba, Odawa, Osage, Wyandot, Cherokee, Comanchen, Cheyenne, Apachen und viele andere. Jede einzelne Nation war und ist zwar eine charakteristische Gemeinschaft, aber die europäischen Neuankömmlinge trennte eine kulturelle Kluft von allen indigenen Bewohnern des Kontinents, und diese Kluft sorgte für Angst, Verwirrung, Zorn und Gewalt. Diese Spaltung befeuerte einen der längsten Konflikte der Geschichte, gleichzeitig war sie Ausgangspunkt für eine jahrhundertelange Suche nach gegenseitigem Verständnis und einer Beilegung des Streits – für eine Suche, die bis zum heutigen Tag andauert.1
Als große Fallstricke beim Blick auf die Native Americans erweisen sich grobe Verallgemeinerungen einerseits und eng gefasste Besonderheit andererseits. Historikerinnen und Historiker neigten lange dazu, die Indianer als menschlichen Monolithen zu betrachten, der einem einzigen – und urzeitlichen – kulturellen Geflecht entstammte, als eine Rasse, die durch ihre tragische Geschichte der Enteignung und ihren heroischen Kampf ums Überleben definiert war. Diese Tradition liegt vielen populären Büchern zugrunde, die die Geschichte des indigenen Amerika als Ideendrama gestalten, das sich oft mehr mit den Vereinigten Staaten beschäftigt als mit den Indianern selbst. In diesen Darstellungen treten Indianer als eindimensionale Klischeegestalten auf, deren Komplexität und Unterschiedlichkeit aus dramaturgischen Gründen glatt gebügelt wurden. Sie werden zu bloßen Requisiten bei der gewalttätigen Transformation der Vereinigten Staaten zu einer Weltmacht herabgestuft: Indigener Widerstand und indigene Leiden steigern die dramatische Wirkung und ermöglichen den Menschen heute einen flüchtigen Blick darauf, wie viel verloren ging und um welchen Preis.
Am anderen Ende des Spektrums befindet sich eine ehrwürdige Tradition von Stammesgeschichten, die sich jeweils auf eine einzige Nation konzentrieren und eine umfassende Darstellung ihrer Traditionen, politischen Strukturen, ihrer materiellen Kultur und historischen Erfahrungen bieten. Diese notwendige und oft hervorragende wissenschaftliche Arbeit hat Hunderte von zuvor in die Obskurität verbannte indigene Gruppen als energische, kreative und widerstandsfähige Akteure der Geschichte zu neuem Leben erweckt und einen im Halbdunkel verharrenden Kontinent mit menschlicher Struktur erfüllt. Der Nachteil dieser Vorgehensweise ist ihre Kleinteiligkeit. Jede Nation tritt uns als einzigartige Gruppe entgegen, die in ihrer jeweils eigenen Mikrowelt fest verankert ist. Wenn man sich vorstellt, dass man diese detaillierte Darstellung fünfhundert Mal wiederholen müsste, erkennt man schnell die Problematik. Eine Untersuchung des indigenen Amerika auf diese Art gleicht der Betrachtung eines pointillistischen Gemäldes aus einer Entfernung von nur wenigen Zentimetern: Sie überwältigt; sie verliert den Zusammenhang; die umfassenderen Strukturen sind nicht zu erkennen.
Durch eine leicht veränderte Perspektive kann jedoch ein neues und schärferes Bild von Nordamerika entstehen. So wählt Der indigene Kontinent einen Mittelweg zwischen der allgemeinen und der spezifischen Betrachtungsweise. Das Buch enthüllt ein breites Spektrum indigener amerikanischer Welten, die vom frühen 16. bis zum späten 19. Jahrhundert Aufstieg und Niedergang gleichermaßen erlebten. Indianer und Kolonisten konkurrierten an zahlreichen Stellen um Territorien, Ressourcen, Macht und Vorherrschaft, wobei das Überleben beider Seiten oft auf dem Spiel stand. Jedes Gebiet hatte seine besonderen Merkmale und bot ein Spiegelbild der erstaunlichen physischen Vielfalt des Kontinents: Die Risiken und die Dynamik der Kriegführung, der Diplomatie und der Zugehörigkeit wirkten sich, je nach Schauplatz des Geschehens, entlang der Küsten und Flusstäler, in Waldlandschaften oder im Grasland, unterschiedlich aus.
Dieses Buch ist zuallererst eine Geschichte der indigenen Völker, aber es ist auch eine Geschichte des Kolonialismus. Die Geschichte Nordamerikas, die dabei zum Vorschein kommt, ist die Geschichte eines Ortes und eines Zeitalters, die vor allem von der Kriegführung geprägt ist. Der Kampf um den Kontinent war im Wesentlichen ein vier Jahrhunderte andauernder Krieg, in dem fast jede indigene Nation gegen die vordringenden Kolonialmächte kämpfte – manchmal im Rahmen von Bündnissen und manchmal allein. Über die Indianerkriege in Nordamerika ist zwar schon oft geschrieben worden, doch dieses Buch bietet einen allgemeinen indigenen Blick auf den Konflikt. Der Krieg war für indigene Nationen oft ein letztes Mittel. Sie versuchten in vielen – wenn nicht sogar in den meisten – Fällen, die Europäer in ihre Gemeinschaft aufzunehmen und sie zu nützlichen Mitgliedern ihrer Gesellschaft zu machen. So handelten keine Bittsteller; die Europäer waren die Bittsteller – ihre Leben, Bewegungen und Ambitionen wurden von den indigenen Nationen bestimmt, die die Neuankömmlinge in ihre Siedlungen und verwandtschaftlichen Netzwerke einbezogen, auf der Suche nach Handelsbeziehungen und Verbündeten. Indianische Männer und Frauen waren geschickte Diplomaten, kluge Händler und energische Anführer. Die überheblichen Europäer hielten die Indianer für schwach und unzivilisiert, sahen sich schließlich dennoch gezwungen, erniedrigenden Vereinbarungen zuzustimmen – eine Umkehrung gängiger Annahmen über die Vorherrschaft der Weißen und die Enteignung der Indianer, die bis heute Bestand haben.
Wenn es zum Krieg kam, gewannen meist die Indianer. Ältere, diskreditierende und groteske Vorstellungen von »wilden« Indianern und »edlen Wilden« suggerieren ein gewisses Ausmaß an Brutalität im Kampf, aber für die meisten Gräueltaten waren die Kolonisten verantwortlich. Viele Kolonisten, vor allem die Briten, Spanier und Amerikaner, verübten ethnische Säuberungen, Genozide und andere Verbrechen. Manche von ihnen entschieden sich aber auch für einen gemäßigteren Umgang mit den indigenen Völkern. Es gab Kolonisten, die den Indianern mit völliger Verachtung begegneten und sie ausrotten wollten, aber es gab auch Kolonialregime, die eine Verständigung mit ihnen anstrebten. Es gab viele Arten des Kolonialismus – den Siedler-, den imperialen, den Missionars-, Ausbeuter-, Händler- und den juristisch unterlegten Kolonialismus; sie treten im Verlauf der hier erzählten Geschichte kumulativ auf. Von entscheidender Bedeutung ist dabei, der Entwicklung des Kolonialismus nachzuspüren: Die Tiefe und die Reichweite der indigenen Macht lässt sich nur im Kontrast zur massiven kolonialen Bedrohung aus Europa verstehen. Ich habe versucht, das umfassende »Potenzial« des Kolonialismus bei der Zerstörung von Leben, Nationen und Kulturen aufzuzeigen. Der Übersee-Kolonialismus war ein gewaltiges Unterfangen, bei dem Mut und Einsatz gefragt waren. Die europäischen Eindringlinge waren rücksichtslos, weil sie tief verwurzelte rassistische Ideologien vertraten und weil so viel auf dem Spiel stand. Für die meisten von ihnen gab es kein Zurück.
Eine Geschichte Nordamerikas in einem Band kann nicht allen indigenen Nationen, Regionen und Ereignissen die gleiche Aufmerksamkeit widmen. Große indigene Nationen und Bündnisse konnten es mit den europäischen Imperien auf Augenhöhe aufnehmen, und sie prägen einen großen Teil der Geschichte durch ihre bloße Fähigkeit, Nordamerika für die indigenen Völker zu bewahren. Aber auch die kleinen Nationen und ihr Widerstand waren für die Schaffung des indigenen Kontinents unentbehrlich. Die Erhaltung der indigenen Macht und Souveränität war eine allumfassende Anstrengung: Jeder koloniale Vorstoß, so kleinräumig er ausfallen mochte, konnte einen Dominoeffekt von indigenen Rückzügen auslösen. Dieses Buch nimmt dementsprechend immer wieder ein lokal stark begrenztes Geschehen unter die Lupe; genau dort, in unmittelbaren und persönlichen Begegnungen, spielte sich die harte Realität der Kolonisierung und des Widerstandes gegen die Kolonisierung ab. Indigene Amerikaner kämpften um ihr Land und um ihr Leben, und sie taten dies auch für zukünftige Generationen. Es kam auf jeden Zentimeter an.
Dieses Buch umfasst einen enormen historischen Zeitraum – vier Jahrhunderte und einen Kontinent –, aber ein einziges Thema gibt ihm seine Form, Richtung und Bedeutung: Macht. Macht wird hier definiert als die Fähigkeit von Menschen und ihren Gemeinschaften, einen Raum und seine Ressourcen zu kontrollieren, die Handlungen und Wahrnehmungen anderer zu beeinflussen, sich Feinde vom Leib zu halten, übernatürliche Wesen aufzubieten und Veränderungen einzuleiten oder sich ihnen zu widersetzen. Hier folgt die Geschichte eines langen und turbulenten Zeitalters, in dem in Nordamerika viele Beteiligte um die Vorherrschaft kämpften und keine Seite dominierte. Diese Erzählung versucht nachzuvollziehen, wie Menschen Macht erlangten, verloren und – in seltenen Fällen – mit Fremden teilten und im Verlauf dieses Geschehens viele neue Welten erschufen. Das Buch lässt sich wohl am besten als eine Biografie der Macht in Nordamerika beschreiben. Die Geschichte folgt wichtigen Handlungen und entscheidenden Wendepunkten quer durch den umkämpften Kontinent und zeigt, wie verschiedene Teile davon zu geopolitischen Krisenherden wurden, auf denen sich die Rivalitäten verschärften und die geschichtlichen Abläufe in Gewalt umschlugen.
Das Buch ist inklusiv und nimmt europäische Kolonisten und Native Americans gleichermaßen in den Blick, aber die üblichen Akteure, Ereignisse und Wendepunkte der amerikanischen Geschichte bleiben hier im Hintergrund. Der Stamp und der Tea Act, das Boston Massacre und die Ausarbeitung und Verabschiedung der Verfassung der Vereinigten Staaten spielen in dieser Geschichte nur eine marginale Rolle. Indianer kontrollierten den größten Teil Nordamerikas, und oft wussten sie nichts über die Taten und Leistungen der Europäer jenseits ihres eigenen Gebiets. Und wenn sie etwas wussten, war es ihnen egal. Die indigenen Völker interessierten sich stattdessen für die Ambitionen und Erfahrungen anderer indigener Völker – der Irokesen, Cherokee, Lakota, Comanchen, Shawnee und vieler anderer.
EIN HINWEIS ZU TERMINOLOGIE UND STIL
Wörtliche Zitate habe ich gelegentlich modernisiert, wenn die Schreibweise das Verständnis erschwerte. Unter Berücksichtigung eines Stichworts von Nancy Shoemaker bezeichne ich an Kriegshandlungen beteiligte indigene Männer und Frauen als »Soldaten« oder »Soldatinnen« und nicht als »Krieger«. Die Ansiedlungen eher sesshafter indigener Nationen sind »Städte«, während die Ansiedlungen eher nomadisch lebender Gruppen als »Dörfer« bezeichnet werden. Anstatt von »Häuptlingen« zu sprechen, verwende ich eher die indigenen Begriffe für Anführer, wie »Sachem« oder »Weroance«, oder spreche von »Amtsinhabern« oder »Beamten«, denn sie waren indigene Verwaltungsbeamte. Bei den Namen der indigenen Nationen habe ich die von ihnen selbst bevorzugten Bezeichnungen verwendet: Odawa anstelle von Ottawa; Lenape anstelle von Delaware; Wyandot anstelle von Huronen; Illini anstelle von Illinois; Meskwaki anstelle von Fox; Ho-Chunk anstelle von Winnebago; Muscogee anstelle von Creek; Ojibwe anstelle von Ojibwa. Die Irokesen werden auch Haudenosaunee genannt.2
ERSTER TEIL
DIE MORGENDÄMMERUNG DES INDIGENEN KONTINENTS
(Die ersten siebzig Jahrtausende)
KAPITEL 1
DIE WELT AUF DEM RÜCKEN DER SCHILDKRÖTE
KELP, SEETANG, WAR DER SCHLÜSSEL ZU AMERIKA. Während der letzten Eiszeit, die vor etwa 2,5 Millionen Jahren einsetzte, banden gewaltige Eisschichten weltweit so viel Wasser, dass der Meeresspiegel dramatisch sank und die Erdoberfläche eine völlig neue Gestalt annahm. Inseln verbanden sich zu Landengen, und Meeresböden wurden zu Wiesen. Zum folgenreichsten Wandel in Nordamerika kam es in der Beringstraße, wo vor rund 70 000 Jahren eine 1000 Kilometer breite Landbrücke trockenfiel, die Asien mit Amerika verband. Durch diesen neuen Landstreifen – Beringia – wanden sich Flüsse, er war mit Seen gesprenkelt und mit Gräsern und Buschwerk bedeckt, die Tieren als Nahrung dienten, und er lockte von Westen herkommende Menschen nach Amerika.
Die Gletscher Nordamerikas begannen vor etwa 21.000 Jahren abzuschmelzen. Die kilometerdicken Eisschichten flossen nach und nach in die Ozeane zurück, und auf der Ostseite der Rocky Mountains bildete sich ein schmaler eisfreier Korridor. Gruppen von Menschen zogen etwa 11.000 Jahre vor Beginn unserer Zeitrechnung durch diese neu entstandene Passage nach Süden und gelangten schließlich in die große kontinentale Graslandschaft, wo es von riesigen Säugetieren nur so wimmelte: Sie trafen auf imposante Mammuts, sechs Tonnen schwere Mastodons, Bisons mit knapp zweieinhalb Metern Schulterhöhe, am Boden lebende Riesenfaultiere, Kurznasenbären, Kamele, Pferde und verschiedene Antilopenarten. Größe und Zahl der Tiere verlangten den menschlichen Neuankömmlingen einen gewissen technischen Erfindergeist ab. Jägergruppen verwendeten nach und nach Feuersteine, Hornstein (Chert), Obsidian und andere formbare Gesteinsarten für die Herstellung von scharfkantigen, geschickt behauenen Speerspitzen, die auch dicke Tierhäute mit tödlicher Effizienz durchbohrten. Jäger legten Hunderte von Kilometern zurück, um in den besten Aufschlüssen erstklassige Steine aufzusammeln oder zu brechen. Weniger gefährliche Strategien der Nahrungsbeschaffung – Sammeln, Fischen und die Jagd auf kleinere Beutetiere – ergänzten den Speiseplan und sicherten den Lebensunterhalt wachsender, widerstandsfähiger menschlicher Gemeinschaften.1
Der »Kelp-Highway« (die »Seetang-Route«)
Doch die westliche Hemisphäre des Kontinents war nach wie vor nur äußerst dünn besiedelt. Weitere Migrationswellen kamen auf einer älteren und sehr wahrscheinlich häufiger genutzten maritimen Route voran, die der Pazifikküste folgte. Dort waren Menschen küstennah und in Umiaks (Robbenfellbooten) unterwegs. Sie lebten von der vielfältigen Fauna und Flora, die in den kühlen Gewässern der Offshore-Zone an der Küste und vor Flussmündungen gedieh – einem »Kelp-Highway«, der vom Nordosten Asiens bis zur Andenküste reichte. Die nährstoffreichen Tanggründe waren die Lebensgrundlage für große Fischbestände, für Schalentiere, Seevögel und Seeotter, und sie boten den Menschen eine reichhaltige Grundlage für eine abwechslungsreiche Ernährung. Für diese am und vom Meer lebenden Menschen war die Nahrungssuche sicherer und höchstwahrscheinlich auch effizienter als für die Großwildjäger im Landesinneren. In den küstennahen Mangrovenwäldern fanden sie eine große Vielfalt an Meeresfrüchten. Sie zogen von einem ertragreichen Standort zum nächsten und teilten sich auf, wann immer es nötig war. Hochgradig mobile, auf dem Seeweg weiterziehende Jäger und Sammler könnten auf diese Weise bereits um 16.500 vor Beginn unserer Zeitrechnung Monte Verde im heutigen südlichen Chile erreicht haben, einen 16.000 Kilometer südlich der Beringstraße gelegenen Ort. Die frühesten Spuren von Menschen in Nordamerika sind im Südwesten gefunden worden, wo sich die Anwesenheit von Menschen 23.000 Jahre zurückdatieren lässt.2
Die Menschen, die sich mit bemerkenswerter Geschwindigkeit über eine gesamte Hemisphäre ausgebreitet hatten, setzten sich dabei über furchterregende Widerstände hinweg. Die westliche Hemisphäre weist, im Gegensatz zu ihrem östlichen Gegenstück, eine ausgeprägte Nord-Süd-Orientierung auf, und weiterziehende Menschen mussten mit einer enormen Vielfalt von klimatischen und ökologischen Lebensumständen fertigwerden und ihre Nahrungssuche, Werkzeuge, Kleidung, Behausungen, soziale Systeme und Denkweisen immer wieder aufs Neue schwierigen Lebensbedingungen anpassen. Viele Schöpfungsgeschichten von Native Americans erzählen von steigenden Fluten und ungeheuren Wassermassen, die für schmelzende Gletscher zu stehen scheinen, die sich über das Land ergießen. Bereits zu diesem frühen Zeitpunkt war klar, dass der amerikanische Doppelkontinent durch eine erstaunliche menschliche Vielfalt und Widerstandsfähigkeit geprägt sein würde.
Vor dieser Welt hatte es noch eine andere gegeben, eine Inselwelt, die im Himmel schwebte und von glücklichen Himmelsmenschen bewohnt wurde. Aber eine unerklärliche Schwangerschaft der Himmelsfrau erzürnte ihren Ehemann. Er riss einen großen Baum aus, wodurch sich ein Loch im Himmel auftat, und stieß die Himmelsfrau hindurch, die in eine viel tiefer liegende Wasserwelt stürzte. Enten fingen die Himmelsfrau mit ihren Flügeln auf und legten sie auf den Rücken einer Schildkröte, die sie dort ausruhen ließ. Die Schildkröte deutete die Ankunft der Himmelsfrau als gutes Omen. Diese war jetzt keine Ausgestoßene mehr. Die Tiere des Wassers – der Biber, der Seetaucher und viele andere – tauchten tief hinab, um Erde vom Meeresgrund zu holen, auf der die Himmelsfrau gehen konnte, aber es misslang ihnen allen. Nur die Bisamratte war erfolgreich, sie brachte eine Handvoll Erde mit. Die Tiere verteilten sie auf dem Rücken der Schildkröte und sahen, dass die Erde die Fähigkeit hatte, sich auszubreiten. Sie wurde zuerst zu einer Insel und dann zu einem gewaltigen Stück Festland. Das war der Geburtsort und die Heimat des Volkes der Irokesen. Die Himmelsfrau bekam eine Tochter, die selbst zwei Söhne gebar: Tharonhiawagon, der gut, und Tawiskaron, der böse war. Tawiskaron kam auf die Welt, indem er ein Loch in die Flanke seiner Mutter riss und sie dadurch tötete. Aber Tharonhiawagon erschuf aus ihrem Körper die Sonne und die Seen, Flüsse und Berge. Tawiskaron versuchte, vor Neid wie von Sinnen, die Schöpfung seines Bruders zu beseitigen, und Tharonhiawagon tötete ihn. Dies war kein Zeichen der Störung, sondern des Gleichgewichts. Die Welt war weder von Grund auf böse noch grundsätzlich gut. Die Himmelsfrau hielt sie im Gleichgewicht.3
Auch das Volk der Pawnee erhielt Führung von höherer Warte, aber das Volk selbst kam von unten. Am Anfang stand Tirawa – Vater – im Mittelpunkt des Geschehens dort unten, aber die Welt hatte keine Gestalt, keine Ordnung, sie war ein einziges Durcheinander. Tirawa versammelte die himmlischen Mächte. Er tat seine Gedanken kund und schuf himmlische Götter, die für Ordnung sorgen sollten: den Abendstern im Westen, der für den Pawnee-Mann stand, und den Morgenstern im Osten, der für die Pawnee-Frau stand. Der Morgenstern gebar das erste Wesen auf Erden, und durch seine vier Helfer – Wind, Wolken, Blitz und Donner – geleitete er die Pawnee in die Prärie, wo sie den Mais und den Büffel entdeckten, die Grundlage ihrer materiellen und spirituellen Existenz. Der Schöpfungsmythos der Pawnee berichtet nicht von katastrophalem Wandel und umwälzender Bewegung, sondern von einer Suche nach gesellschaftlicher und kosmischer Bewegung an einem ganz bestimmten Ort. Für die Pawnee waren – und sind – der Platte, der Republican und der Loup River in den Great Plains der Mittelpunkt der Welt.4
Ein Schöpfungsmythos der Cherokee – die sich selbst Ani-Yun-Wiya, »wahre Menschen«, nennen – berichtet von der langsamen Erschaffung der Welt. Am Anfang war die Erde eine in einem Meer schwimmende Insel, die mit Seilen an gälûñ’lätï befestigt war, einem Himmelsgewölbe aus massivem Felsen. Die Erde war weich und nass, und die Tiere schickten den Großen Bussard los, der die Welt dort unten für sie herrichten sollte, aber er hatte Mühe, trockenes Land zu finden. Er wurde müde, und seine Flügel berührten immer wieder den Boden und schufen so eine Reihe von Tälern und Bergen. Dieses bergige Land wurde zum Cherokee-Land. Der Große Bussard schuf zuerst die Tiere und Pflanzen, erst später dann den Menschen. Zuerst waren da nur ein Bruder und eine Schwester. Er schlug die Schwester mit einem Fisch und befahl ihr, sich zu vermehren. Am Anfang gebar sie an jedem siebten Tag, und der Welt drohte eine Überbevölkerung. Deshalb bekam sie jetzt nur noch ein Kind im Jahr, und die Welt kam wieder ins Lot.5
Die Sicangu Lakota besitzen, wie auch die Cherokee, einen Schöpfungsmythos, der auf gegenseitigen Beziehungen zwischen Menschen und Tieren und Menschen und der Erde beruht: »Vor dieser Welt gab es schon eine andere, aber die Menschen in ihr wussten sich nicht zu benehmen und menschlich zu verhalten«, und Tȟuŋkášila (»Großvater«) beschloss, eine neue Welt zu erschaffen. Er riss die Erde auf, und Wasser strömte heraus und überflutete alles. Alle Menschen und Tiere starben, mit Ausnahme der Krähe. Die Krähe bat Tȟuŋkášila um einen Ort, an dem sie sich ausruhen konnte. Tȟuŋkášila bedeckte die Welt mit festem Land und vergoss Tränen, die zu Meeren, Seen und Flüssen wurden. Er öffnete seinen Pfeifenbeutel, entnahm ihm Tiere und Pflanzen und gestattete ihnen, sich über das Land zu verbreiten. Dann erst formte er aus Erde menschliche Wesen. Er versprach, die neue Welt nicht zu überfluten, wenn die Menschen seine Schöpfung mit Respekt behandeln würden. »Nun«, sagte er, »wenn ihr gelernt habt, euch wie Menschen zu benehmen und in Frieden zu leben, miteinander und mit den anderen Lebewesen – den zweibeinigen, den vierbeinigen, den vielbeinigen, den fliegenden, jenen ohne Beine und den grünen Pflanzen –, dann wird alles gut sein. Wenn ihr aber diese Welt schlecht und hässlich macht, dann werde ich auch diese Welt zerstören. Es liegt an euch.«6
Während viele Schöpfungsmythen indigener Nationen in Nordamerika die Erschaffung des Universums mit der Erschaffung eines bestimmten Volkes verbinden, erzählen die Kiowa eine Geschichte, die ihre besondere Eigenschaft erklärt: ihre geringe Zahl. Das Volk der Kiowa – Ka’igwu, »erstes Volk« – kam »einer nach dem anderen durch einen hohlen Baumstamm in diese Welt«. Aber dann kam eine schwangere Frau, und sie blieb stecken. Viele Menschen wollten immer noch aus diesem hohlen Stamm hinauskommen, aber der Ausgang war versperrt, deshalb zählten die Kiowa nie mehr als 3.000 Menschen.7
Die Navajo kamen aus einer tiefer gelegenen Welt, aber sie entwickelten sich noch, als das geschah. Der Erste Mann und die Erste Frau waren die Nebelmenschen, denen es an Disziplin mangelte und die die hózhó störten, die »Harmonie«. Sie wanderten durch verschiedene Welten, in jeder einzelnen davon kamen sie zu Wissen und Vernunft, und schließlich gelangten sie in die heutige Welt, vollständig ausgebildet und mit einem ausgeglichenen Verhältnis zwischen den Geschlechtern bei Chancen und Problemen. Der Erste Mann und die Erste Frau wussten jetzt, wie sie angemessen miteinander, mit anderen Völkern und mit allen Lebewesen umzugehen hatten. Sie wurde zur Wandelbaren Frau, heiratete die Sonne und zog gemeinsam mit ihr an den westlichen Ozean, wo sie zusammen vier Clans aufzogen und dann gemeinsam mit ihnen nach Dinétah zurückgingen, um dort ihre Welt zu vervollständigen.8
Diese und viele andere Schöpfungsmythen erklären, wie eine neue, multiethnische Welt – das indigene Amerika – Gestalt annahm. Die Schöpfungsmythen stehen im Kern nicht unbedingt im Widerspruch zu wissenschaftlichen Theorien über die Besiedlung des amerikanischen Doppelkontinents. Hinweise auf Land, das während der Eiszeit trockenfiel, und auf das Verschwinden trockenen Landes, als die Gletscher zu schmelzen begannen, sind in den indigenen Schöpfungsmythen unschwer zu erkennen. Die in den Schöpfungsmythen allgegenwärtigen – plötzlich auftretenden, verheerenden, regenerativen – Überflutungen berichten von den radikalen Veränderungen, mit denen es die Menschen in Nordamerika ab etwa 17.000 v. Chr. zu tun bekamen. Diese Geschichten erhellen ein indigenes Amerika, das alt, komplex und dynamisch ist. An der Pazifikküste Mittel- und Nordamerikas gibt es 143 verschiedene indigene Sprachen, die höchstwahrscheinlich das Ergebnis einer über einen Zeitraum von 35.000 Jahren ständig fortschreitenden Abspaltung von einer einzigen gemeinsamen Ausgangssprache sind.9
Die ersten Amerikaner teilten die Welt nicht in Hemisphären und Kontinente auf. Sie hatten weder Meere noch Ozeane überquert, um nach Amerika zu gelangen, und dachten nicht, dass sie in irgendeiner Art von neuer Welt angekommen seien. Sie hatten es während ihrer Reisen mit massiven ökologischen Umwälzungen zu tun bekommen und sie überlebt, und das oftmals, indem sie die zu bewältigenden Aufgaben auf die verschiedenen Geschlechter aufgeteilt hatten. Von alles überragender Bedeutung war dabei, dass man die Welt und ihre Unvorhersagbarkeit – ihre Gefahren und die Gaben, die sie bereithielt – verstand. Alles hing von einer angemessenen Beziehung zum Land und seinen Lebensformen ab. Diese Menschen dachten nicht, dass sie neues Land in Besitz nahmen, weil sie schon immer dort gewesen waren.10
Im Jahr 10.000 v. Chr. lebten Menschen in nahezu allen Teilen der westlichen Hemisphäre des Doppelkontinents, vom immer noch von Gletschern bedeckten Alaska und dem Yukongebiet bis nach Monte Verde in Südamerika. Nordamerika war zu einem indigenen Kontinent geworden und sollte es für einen Zeitraum von fast 12.000 Jahren bleiben. Die Menschen in beiden Amerikas lebten im Jahr 10.000 v. Chr. als Jäger und Sammler, und es ging ihnen gut. In ihrer Welt herrschte kein Mangel an großen Beutetieren. Sie entwickelten neue Jagdmethoden, jagten arbeitsteilig in kleinen Gruppen und pflegten die notwendigen Rituale, mit denen sich eine angemessene Beziehung zwischen Jäger und Beute herstellen ließ: Sie folgten den Tieren und lenkten sie zu einem Ort, an dem sie getötet werden konnten – oft geschah das in der Nähe eines Wasserlochs; sie streckten die Tiere mit koordinierten Speerstößen nieder; verarbeiteten das Fleisch und die Knochen und Felle für den unmittelbaren und zukünftigen Bedarf. Die Überfülle an Beutetieren hielt noch zwei Jahrtausende lang an, aber dann begannen die kontinentalen Eisdecken rasch zu schmelzen, und die Riesensäugetiere starben nach und nach aus, geschwächt von einem sich erwärmenden und zunehmend wechselhaften Klima. Die Menschen machten weiter Jagd auf die Großtiere, weil sie offensichtlich nicht erkannten, wie stark deren Populationen inzwischen gefährdet waren. Vielleicht versetzten sie ihnen auch durch den verstärkten Einsatz des Feuers einen unbeabsichtigten Todesstoß. Bis zum Jahr 8000 v. Chr. wurden rund drei Dutzend Arten von Großsäugetieren ausgelöscht.11
Etwa zu diesem Zeitpunkt verlegten sich viele First Americans im Westen Nordamerikas auf die Bisonjagd. Die Bisons waren selbst erst vor relativ kurzer Zeit über die Beringia-Landbrücke zugewandert. Sie waren aggressive, fruchtbare und hochgradig anpassungsfähige Tiere, die der Ausrottung entgingen, indem sie sich auf das Abweiden von Kurzgräsern spezialisierten. Im Verlauf der Jahrtausende schrumpften sie buchstäblich, wurden leichter, schneller und mobiler, passten sich so an die sich verändernden Lebensbedingungen im regenarmen Westen an und überlebten. Auch die Jäger mussten sich anpassen. Eine fein bearbeitete, eingekerbte und extrem dünne und deshalb durchschlagskräftige Speerspitze stand für den Aufstieg einer neuen Jagdkultur. Dabei agierten die Menschen in äußerst mobilen Gruppen; sie konnten die Herden über Hunderte von Meilen hinweg verfolgen, Dutzende von Tieren stellen, um sie zu töten, oder ganze Herden in einen Canyon ohne Ausgang, in einen Abgrund oder über eine Felskante treiben.12
Das Klima erwärmte sich, begünstigte das Wachstum von Gräsern und anderen Nahrungsquellen, und die Tierpopulationen breiteten sich aus und drängten die Jäger zu immer neuen Innovationen. Die Erfindung der Atlatl, der Speerschleuder, um das Jahr 7500 v. Chr. war ein Durchbruch. Die Atlatl, ein Holzstock mit einem Schaft an einem und einem Hakenwiderlager am anderen Ende, ermöglichte es einem Jäger, einen leichten Speer schneller und weiter zu werfen. Das geschah mit einer ruckartigen Bewegung, mit der die gespeicherte Energie wie bei einer Sprungfeder gebündelt wurde. Durch die Atlatl, die wie eine Verlängerung des Jägerarms wirkte, wurde die Jagd zu einer relativ sicheren und einfachen Angelegenheit. Jäger, die zu Fuß unterwegs waren, konnten ihre Beute jetzt aus einer Entfernung von bis zu 130 Metern erlegen. Für Jäger zu Wasser erwies sich die Atlatl als besonders nützlich, weil sie eine Hand für die Lenkung des Bootes frei ließ. Geriffelte Speerspitzen kamen außer Gebrauch.13
Die ersten Amerikaner töteten ihre Beutetiere zwar zu Tausenden, aber sie behandelten ihr Jagdwild mit Respekt und Sorgfalt. Sie mussten das Verhalten der Tiere ganz genau kennen, um zu erfolgreichen Jägern zu werden, und sie mussten wissen, wie man den Lebensraum der Tiere manipuliert – vor allem mit günstig platzierten Feuern –, um die Bewegungen von Herden vorhersagbar zu lenken und den Jagderfolg zu sichern. Sie mussten sich den Tieren mit den richtigen Gedanken und Zeremonien nähern, um sich des Opfers zu vergewissern, und sie mussten die Gaben der Tiere – Häute und Fell, Fleisch, Knochen, Blut – mit Ehrerbietung und Mitleid annehmen. Hätten sie das nicht getan, hätten die Geister der Tiere sich empört, und die uralten verwandtschaftlichen Bande mit den Menschen wären gelöst worden. Es war dieses an Respekt und Fürsorge orientierte Denken, das Nordamerika mehrere Jahrtausende lang zu einer Welt des Jägers machte. Erst ab etwa 4500 v. Chr. standen die Menschen vor der Notwendigkeit, andere Lebensweisen zu entwickeln.
Eicheln, die Nüsse von Eichen, enthalten viel Eisen, Kalzium, Kalium, Ballaststoffe, Kohlenhydrate, einfach ungesättigte Fettsäuren und die Vitamine A, B und E. Sie wirken außerdem stabilisierend auf den menschlichen Stoffwechsel und den Blutzuckerspiegel. Die ersten Amerikaner, die an Nordamerikas Westküste heimisch wurden, setzten bei ihrer Ernährung stark auf Eicheln und Kelp und begründeten eine ganze Kultur mithilfe dieser Nahrungsmittel. Sie entwickelten raffinierte Steinmörser und Mahlwerke, mit denen sich die Gerbsäure aus den wertvollen Nüssen herausholen ließ, und für den Transport und die Lagerung der Nüsse flochten sie leichte und geräumige Körbe. Nomadengruppen errichteten Siedlungen in der Nähe von Eichenwäldern, verbanden sich auf diese Art mit dem Land, und schon bald betrieben sie Ackerbau in kleinem Umfang unter der Anleitung lokaler Anführer, die den Brandrodungs-Feldbau und die Zuteilung von Land und Ernteerträgen koordinierten. Die Eichelernte fiel so üppig aus, dass die Gruppen an der Westküste nur ein marginales Interesse am Anbau von Mais entwickelten.14
Diese mit der Pazifikküste verbundene indigene Welt lehnte jede Art von politischer Zentralisierung ab. Die Gemeinschaften bestanden aus mehreren eng miteinander verbundenen Verwandtschaftsgruppen, die exklusive Rechte an Wildnahrung, Jagd- und Fischgründen miteinander teilten. Nahrungsmittel, Werkzeuge, Heilpflanzen und Luxusgüter kursierten über lokale und Fernhandels-Netze und schufen ein riesiges regionales Netz, das auf Reziprozität und Teilen beruhte, und die Meeresströmungen transportierten Ressourcen – Treibgut, Redwoodstämme, Bambus – buchstäblich bis zu den Siedlungen. Das Land, das später unter dem Namen Kalifornien bekannt werden sollte, war eine wohlhabende, politisch hoch entwickelte und sichere Welt. Es war eine maritime Kultur, die mit einem ungewöhnlich fruchtbaren, üppig mit Seetang bewachsenen und von großen Eichenbeständen geprägten Küstenstreifen verbunden war. Dieses Land war möglicherweise die am dichtesten besiedelte Region Nordamerikas.
Der Verlauf der Entwicklung an der indigenen Westküste verweist jedoch zugleich, bei allen spezifischen Merkmalen, auf eine umfassendere Dynamik: Überall auf dem amerikanischen Doppelkontinent bewerteten die Menschen die Möglichkeiten, die ihr Umfeld ihnen bot; die westliche Hemisphäre teilte sich in zahlreiche einzigartige Welten auf. An der Nordwestküste begünstigten der warme Kuroshio und der Nordpazifikstrom ein gemäßigtes Klima und starke Regenfälle. Der Lachs wurde zum Hauptnahrungsmittel und zum Zentrum der einzigartigen Kultur der dort lebenden Menschen. Ihnen galten die Lachse als unsterbliche Lebewesen, die während des Winters in unterirdischen Häusern lebten. Nach diesem Glauben nahmen die Lachse, wenn sie im Frühjahr mit geeigneten Gebeten angerufen wurden, ihre Fischgestalt an, tummelten sich in den Flüssen und brachten sich selbst als Opfer dar. Jäger wagten sich in Einbäumen aufs Wasser hinaus und verfolgten Wale, Robben, Meerotter und andere große Beutetiere, die in den Tangwäldern an der Küste günstige Lebensbedingungen vorfanden, und erweiterten ihre Lebenswelt – ihre wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Netzwerke und ihr spirituelles Leben – bis weit auf den Pazifik hinaus.15
Diese dramatische Ausdehnung und die gestiegenen Ambitionen erforderten Anpassungsfähigkeit, Kompromisse und Kreativität. Relativ klassenlose örtliche Gemeinschaften wichen stärker hierarchisch verfassten Ordnungssystemen, die sehr viele Arbeitskräfte mobilisieren und eine gesellschaftliche Arbeitsteilung durchsetzen konnten. Die Nordwestküste war um das Jahr 1300 christlicher Zeitrechnung herum übersät mit prächtigen, aus Zedernbrettern errichteten Häusern, die bis zu 150 Meter lang und mehr als 20 Meter breit sein konnten und zahlreichen Familien Platz boten. Diese Häuser waren mit dekorativen Blendfassaden ausgestattet und wurden mit stilisierten Tierdarstellungen geschmückt, die bestimmte Clans repräsentierten. Vor den Häusern standen kunstvoll geschnitzte, hoch aufragende Totempfähle. Die Gruppen an der Nordwestküste entwickelten sich zu hierarchisch gegliederten Gesellschaften, in denen die Einzelpersonen nach ihrem genealogischen Abstand zu den Familien der Elite eingestuft wurden. Die großen Häuser waren ein Mikrokosmos der Kultur an der Nordwestküste, sie symbolisierten und schützten sie. So wie die Haushalte auf einem System der gesellschaftlichen Rangstufen gründeten, verhielt es sich auch mit den zahlreichen Gruppen – den Tlingit, Haida, Kwakiutl, Bella Coola, Makah, Chinook und anderen –, die sich die Region teilten. Die Haushalte, die gemeinsam eine Nation bildeten, konkurrierten offen um Prestige und Macht. Den Rahmen dafür gaben die prächtigen Potlatch-Zeremonien ab, bei denen wohlhabende Familien ihre Besitztümer öffentlich mit den weniger Begüterten teilten und sich dadurch ihrer herausragenden Stellung versicherten. Was im kleinen Maßstab funktionierte, wiederholte sich auch im großen Rahmen. Die Gruppen an der Nordwestküste hatten Ambitionen, Überfluss und Rivalität in eine den Zusammenhalt fördernde gesellschaftliche Kraft verwandelt. Ein großer Teil des Landes war der Gemeinschaft vorbehalten und kein Privatbesitz, sondern eine gemeinsam genutzte Ressource. Im Jahr 1500 v. Chr. waren die indigenen Welten in Nordamerika blühende Gemeinwesen. Sie beruhten auf der Nutzung von Seetang und Eicheln, auf Jagd und Fischerei und legten die Grundlage für spätere Kulturen.16
KAPITEL 2
DER EGALITÄRE KONTINENT
MAIS IST EINE DER GRÖSSTEN ZÜCHTUNGSLEISTUNGEN der Menschheit. Er kommt in der freien Natur nicht vor; seine Körner sind zu fest mit den Kolben verbunden, deshalb ist eine Selbstvermehrung nicht möglich, und die Pflanze muss ausgesät und gepflegt werden, um zu überleben. Sie ist ein von Menschen durch systematische und kühne Manipulation geschaffenes und perfektioniertes kulturelles Artefakt. Die Wildform war die Teosinte, eine krautige, nicht essbare Berggrasart, die im Hochland Mittelamerikas heimisch war, aber der Mais hat nur wenig Ähnlichkeit mit der Teosinte. Die Teosinte hat mehrere dünne Stängel, einen kleinen Kolben und harte Hüllspelzen, während Mais nur einen einzigen, schweren Stängel hat, der mehrere schwere Kolben tragen kann.1
Hochlandvölker kultivierten den Mais vor 9000 bis 6000 Jahren. Sie verfeinerten die Pflanze immer weiter, prüften die Samenkörner und züchteten zahlreiche lokale Varianten, die sich in Geschmack, Struktur und Farbe unterschieden und in verschiedenen Klimata und Höhenlagen und auf unterschiedlichen Böden gediehen. Die Größe der Kolben variiert zwischen wenigen bis zu 50 Zentimetern, und sie konnten eine Vielzahl von Körnerreihen enthalten. Diese hochgradig anpassungsfähige Pflanzenart eignete sich, von kundiger Menschenhand gepflegt, für den Anbau in großen Teilen der Welt. Das Tehuacán-Tal war ein frühes Zentrum des systematischen Maisanbaus, und das auf landwirtschaftlicher Tätigkeit beruhende Dorfleben fasste dort um 1500 v. Chr. Fuß. Es folgte eine politische Zentralisierung, die zum Aufstieg von Imperien führte. Diese Reiche brachten Menschen durch militärische Macht, ansprechende religiöse Zeremonien und den einsetzenden Fernhandel in ihren Einflussbereich.2
Ineinandergreifende lokale Handelsnetze verbreiteten Maissamen von Mittelamerika aus nach Süden und Norden. Die Kultivierung von Mais setzte im südwestlichen Regenwaldgebiet des Amazonas um 4500 v. Chr. ein, und in das semiaride Hochland im Südwesten Nordamerikas gelangte die Pflanze um 2000 v. Chr. Zu einer wahren Revolution der Ernährung kam es später mit der Züchtung des Maiz de Ocho im ersten Jahrtausend unserer Zeitrechnung. Der Maiz de Ocho war ein großer Schritt in der langen Evolution der Maispflanze, er war robust, anpassungsfähig und leicht zu verarbeiten. Er blühte schnell, verlangte weniger Arbeitsaufwand und gedieh auch unter harten Witterungsbedingungen. Als Bauern vor etwa 1500 Jahren mit dem Anbau von Bohnen und Kürbissen gemeinsam mit dem Maiz de Ocho begannen, schufen sie damit ein ökologisch kompatibles Trio von Feldfrüchten – die »drei Schwestern« –, mit dem sie die Herstellung von Nahrungsmitteln und die Ernährungsweisen in Nordamerika revolutionierten.3
Indigene Bauern sorgten durch den gemeinsamen Anbau der drei Nutzpflanzen für eine ganze Reihe von äußerst nützlichen Synergieeffekten. Die hohen und kräftigen Maisstängel gaben eine stabile Stütze für die Bohnenranken ab, denen sie als Kletterhilfe dienten. Der große Nährstoffbedarf der Maispflanze konnte dem Ackerboden rasch den Stickstoff entziehen; dieser ist ein wichtiger Bestandteil der Fotosynthese, des Vorgangs, bei dem Lichtenergie in für das Pflanzenwachstum nützliche chemische Energie umgewandelt wird. Bei diesem Problem konnten die Bauern auf die Unterstützung der Bohnen setzen. Auf Knötchen an ihren Wurzeln leben Mikroben, die der Luft Stickstoff entnehmen, den sie in eine von der Mais- und Kürbispflanze nutzbare Form umwandeln und dann dem Boden als natürlichen Dünger zurückgeben. Während die Bohnenranken an den Maisstängeln der Sonne entgegenwachsen, sorgen Kürbispflanzen für wichtigen Schutz: Sie breiten sich in Bodennähe aus und bieten mit ihren großen Blättern viel Schatten. Das unterstützt den Boden bei der Speicherung von Feuchtigkeit und hält Unkraut fern, und die stacheligen Haare schrecken Nagetiere und andere Schädlinge ab. Das Ergebnis dieser sich gemeinschaftlich ergänzenden Pflanzmethode war ein nahezu idealer menschlicher Speiseplan: Mais hat einen hohen Anteil an Kohlenhydraten, während Bohnen, vor allem in getrockneter Form, reich an Eiweißen sind, und gemeinsam liefern die drei Gemüsesorten die meisten unentbehrlichen Vitamine und Mineralien.4
Reiche Ernten und ein Überfluss an Nahrungsmitteln förderten, wie schon in früheren Epochen in Mittelamerika, den Ehrgeiz und die Innovationsbereitschaft. In der gesamten Großregion entstanden Städte aller Größenordnungen, in denen eine große Zahl von Menschen zusammenfand, die neue Ideen und Technologien entwickelten. Schamanen – indigene Ärzte und Ritenkundige – reisten auf Straßen und Wasserwegen, sie suchten und teilten Wissen, das ihnen bei der Herstellung der kosmischen Ordnung half. In der zweiten Hälfte des ersten Jahrtausends wandten sich die Völker der Hohokam und Mogollon vom einfachen Feldbau ab und verlegten sich in ihren hoch gelegenen wüstenartigen Heimatregionen am Oberlauf des Rio Grande und westlich davon auf von Kanälen gespeiste großflächige Bewässerungssysteme und Terrassenfeldbau. Sie legten unterirdische Wasserreservoire an und bauten Bewässerungskanäle und Auffangleitungen für Flutwasser. Sie züchteten größere Maissorten durch Hybridisierung und konnten schon bald mehrere Tausend Menschen ernähren. Für die intensive landwirtschaftliche Arbeit waren hauptsächlich die Männer verantwortlich, aber in Übereinstimmung mit einer uralten Tradition gehörten das Land und der Ernteertrag den Frauen, deren verwandtschaftliche Netzwerke für die Bewahrung der öffentlichen Ordnung sorgten. Diese Völker errichteten mehrstöckige Lehmziegelbauten mit großen Innenhöfen. Die Großmütter bildeten das gesellschaftliche und moralische Zentrum dieser aufstrebenden landwirtschaftlichen Gemeinschaften, und Frauen begannen mit der Herstellung von handwerklichen Gebrauchsgegenständen und Lebensmitteln für externe Märkte, so wie es die Herkunftsmythen vorweggenommen hatten.5
Weltweit steigende Temperaturen leiteten um das Jahr 900 n. Chr. einen neuen Klimazyklus ein, die (mittelalterliche) Warmzeit, die für längere Wachstumsphasen sorgte. Die Hohokam- und Mogollon-Bauern profitierten enorm von den neuen klimatischen Bedingungen, aber den größten Nutzen zogen die Ancestral Pueblo daraus. Um das Jahr 1050 n. Chr. herum hatte sich der 16 Kilometer lange Chaco Canyon auf dem Colorado-Plateau zu einem führenden städtischen Zentrum entwickelt, das sich ein Quasi-Monopol auf den äußerst lukrativen Handel mit Türkissteinen sicherte, einem Luxusgegenstand. An diesem Ort errichteten die Ancestral Pueblo im Verlauf von drei Jahrhunderten ein monumentales, gemeinschaftliches Steingebäude, das später unter dem Namen Pueblo Bonito bekannt wurde. Es diente als politisches, Handels- und religiöses Zentrum der Welt des Chaco Canyon. Möglicherweise wurde der Pueblo Bonito unter Einsatz von Sklavenarbeitern errichtet.6
Das fünf Stockwerke hohe, sorgfältig ausgeführte und D-förmige Sandsteingebäude bestand aus Hunderten von Räumen, mehreren Treppenaufgängen und zwei großen, ganz vom Gebäude umschlossenen zentralen Plätzen mit mehr als dreißig Kivas, unterirdischen Kulträumen. Das Gebäude lag mit seinen hohen Mauern auf der Nord-, Ost- und Südseite inmitten Dutzender großer Häuser, die bescheidener ausfielen. Und dennoch lebten vielleicht nur zwanzig Familien dort. Pueblo Bonito könnte ein von einer Führungselite verwaltetes Verteilungszentrum gewesen sein, das Waren von den in Randlagen wohnenden einfachen Mitgliedern der Gemeinschaft aufnahm, die regelmäßige Pilgergänge zu den großen Häusern unternahmen. 650 kerzengerade angelegte Straßenkilometer verbanden das wie ein Magnet wirkende Zentrum mit rund 75 Gemeinschaften, und der Pueblo Bonito war mit massiven Lagerräumen für Mais, Bohnen, Kürbisse und andere importierte Güter des täglichen Bedarfs ausgestattet. Über Fernhandelsnetze wurden Luxuswaren aus Mittelamerika angeliefert, und eine rätselhafte 65 Kilometer lange Große Straße nach Norden (Great North Road) wurde möglicherweise gebaut, um Pueblo Bonitos materielle und spirituelle Vorrangstellung zu symbolisieren. Die Siedlung bestand aus zwei gleich großen Teilen, vielleicht sollte das die Dualität zwischen dem Heiligen und dem Säkularen widerspiegeln – oder den unterschiedlichen Rang der Eliten und der einfachen Menschen. Kachinas, Geistwesen, bewegten sich zwischen Unterwelt und Erde. Sie verkörperten die Dualität der Pueblo-Welt, von der in Schöpfungsmythen berichtet wird.7
Vor Tausenden von Jahren, irgendwann nach 1700 v. Chr., begannen Menschen damit, Erde zu einer schmalen, leichten Erhebung am Unterlauf des Mississippi zu schaffen. Eine Generation nach der anderen hielt an diesem Vorhaben fest, die Menschen transportierten Hunderttausende von Kubikmetern Erde, bis sie schließlich, vier Jahrhunderte später, das erreicht hatten, was sie wollten: einen gut 22 Meter hohen, vogelförmigen Erdhügel, sechs konzentrisch angeordnete, C-förmige Erdwälle, die als Wohnstätten gedient haben könnten, und einen großen, zentralen Platz, der zum Fluss hin ausgerichtet war. Die gesamte Anlage war durch Deiche vor den dramatischen jährlichen Überschwemmungen geschützt. Sie diente als Siedlung, war ein Kultzentrum und eine Drehscheibe für Handel, die große Mengen an Kupfer, Jaspis, Quarz, Pfeifenstein, Haifischzähnen und Meeresmuscheln aus allen Himmelsrichtungen aufnahm – und höchstwahrscheinlich neu verteilte. Die ursprünglichen Bewohner der Stadt waren untereinander gleichberechtigte Jäger, Fischer und Sammler, die wohl ein hierarchisches politisches System schufen, um Arbeitskräfte in größerem Umfang mobilisieren zu können.
Die Organisatoren dieses Wirtschaftssystems waren Pioniere, und ihr Experiment dauerte sechs Jahrhunderte, bis etwa ins Jahr 700 v. Chr. Andere Menschen machten dort weiter, wo sie aufgehört hatten. Adena-Hopewell, eine neue »Mound-Builder«- (»Erdhügel-Erbauer-«) Kultur, entwickelte sich am Mittellauf des Ohio, wo Menschen sich zusammentaten, um gewaltige, für Kultzwecke bestimmte Erdhügel in unterschiedlichen Formen zu errichten – kreisförmig, achteckig, quadratisch –, die als Sinnbilder für die zentrale Bedeutung, Macht und Demut ihrer Erbauer und Nutzer dienen sollten. Diese Menschen importierten Obsidian und Bärenzähne aus den Rocky Mountains, Glimmer und Quarz aus den Appalachen, Kupfer und Pfeifenstein von den Großen Seen und Schildkrötenpanzer und Haifischzähne aus der Karibik. Und sie waren selbst geschickte Handwerker, die erstaunliche Kupferbildnisse und Masken mit Darstellungen von Vögeln, Fischen, Bibern, Bären und menschlichen Gesichtern herstellten. Ihre gesellschaftliche Ordnung beruhte auf Verbindungen zwischen den einzelnen Völkern. Diese Verbindungen lösten sich schnell auf, als Mais und Bohnen im 5. Jahrhundert zu Hauptnahrungsmitteln wurden; die lebensspendenden Pflanzen machten verwandtschaftliche Netzwerke zu einzelnen Selbstversorgern. Die Bevölkerung nahm zu, die Menschen zogen in von Erdwällen umgebene Städte, und die persönlichen Verbindungen wurden durch stärker formalisierte Beziehungen ersetzt. Städte rivalisierten um landwirtschaftlich genutzte Gebiete und eine politische Vorrangstellung, und das überlieferte kollektive Ethos zerfiel. Bis zum frühen 6. Jahrhundert n. Chr. war die große Adena-Hopewell-Kultur in zahllose miteinander rivalisierende Gruppen zerfallen.8
Die indigene Geschichte Nordamerikas wurde gegen Ende des ersten und zu Beginn des zweiten Jahrtausends christlicher Zeitrechnung durch ein auffälliges Muster einer gleichzeitigen Zentralisierung und Dezentralisierung geprägt. Regionale Zentren gewannen an Macht und erregten dadurch den Unmut der ihnen untergeordneten Gruppen, die schließlich aufbegehrten oder sich abspalteten und manchmal neue Gemeinwesen gründeten. Das Muster zeigte sich deutlich in der Abfolge von den Mogollon zu den Hohokam und den Ancestral Pueblo im Südwesten, und es war besonders ausgeprägt bei der Verlagerung von Poverty Point zur Adena-Hopewell-Kultur im Mississippi-Tal. Die vielleicht dramatischste Ausprägung dieser Kultur-Transformationen entwickelte sich im 11. Jahrhundert, auf dem Höhepunkt der Warmzeit, im American Bottom, einer 100 Kilometer breiten Flussniederung am Zusammenfluss des Missouri und des Mississippi. An einer uralten Flussfurt und Wegkreuzung stand ein bescheidenes Dorf von Jägern und Sammlern. Aber um die Jahrtausendwende siedelten sich Neuankömmlinge in diesem Gebiet an. Sie bauten Mais an und rissen die bestehenden Gebäude ab, damit sie an dieser Stelle eine Stadt errichten konnten.
Die Neuankömmlinge legten in der bis dahin sumpfigen Flussniederung, die reich an sehr fruchtbarem Schwemmland war, Felder an und begannen mit dem Bau ihrer neuen Hauptstadt. Ihre äußerst ehrgeizigen Eliten mobilisierten einfache Mitglieder der Gemeinschaft und Sklaven für die Trockenlegung von Sumpfland und das Anlegen von rechteckigen, für alle Bewohner zugänglichen Plätzen. Enorme Mengen an Erde wurden bewegt, die für die Errichtung gewaltiger Erdhügel und den Bau von erhöhten, breiten Straßen zur Verbindung der einzelnen Bauten miteinander verwendet wurden. Die große Stadt wurde in einem Gittermuster angelegt, und zur größten Leistung der Neuankömmlinge sollte ein gewaltiger, zentraler Erdhügel werden – ein imposantes, pyramidenförmiges Bauwerk, das sich mit vier Terrassen dreißig Meter über die Umgebung erhob, und das auf einer Grundfläche von rund 65.000 Quadratmetern, sechseinhalb Hektar. Europäer nannten den künstlichen Hügel Jahrhunderte später Monks Mound.9
Cahokia, wie diese neue Stadt schließlich genannt wurde, wurde gebaut, um zu beeindrucken und seine Bewohner auf angemessene Art im Kosmos zu verankern; ihre Geografie war heilig. Monks Mound orientierte sich an den Haupthimmelsrichtungen, und die wichtigsten Erdhügel im Stadtzentrum waren ihrerseits am Monks Mound ausgerichtet und aufeinander bezogen. Monks Mound überragte die Grand Plaza, eine künstlich angelegte ebene Fläche von enormen Ausmaßen, die durch das Auffüllen von sumpfigen Senken mit Erde geschaffen worden war und im wörtlichen Sinn für eine vertikale Distanz zwischen den Eliten und den einfachen Mitgliedern der Gemeinschaft sorgte. Auf Monks Mound verbanden Führungspersönlichkeiten und Priester die obere und die untere Welt und herrschten über ihr Volk, von dem sie Demut und Loyalität erwarteten, die ihre Welt absicherte. Die Führungspersönlichkeiten der Stadt, vielleicht auch die einfachen Menschen, konsumierten den Koffein und das Alkaloid Theobromin enthaltenden Black Drink, von dem sie sich eine rituelle Reinigung erhofften.10
Darstellung Cahokias durch einen modernen Künstler
Cahokia war auch ein wirtschaftliches Experiment. Die Eliten der Stadt – die Führungspersönlichkeiten und die Priester – verlangten Luxusgüter, die zu ihrem eigenen ästhetischen Vergnügen und als Statussymbole dienen sollten. Die Stadt war von Satellitensiedlungen umgeben, deren Anführer dem obersten Anführer in Cahokia Loyalität schuldeten und ihre Treue durch Geschenke deutlich zu machen suchten. Zugleich war Cahokia auch ein blühendes Handelszentrum. Bedingt durch die Lage der Stadt in der Nähe der Zusammenflüsse von Mississippi, Missouri und Illinois River, reichte das Hinterland für Handel und Austausch von den Großen Seen bis zur Golfküste und zu den Appalachen. Importiert wurden Bedarfsgüter wie Salz und Sandstein und Luxuswaren wie Kupfergegenstände, Mill-Creek-Hornstein und fein gearbeitete Steinmesser.
Cahokia mag als kollektive Anstrengung von Menschen gegründet worden sein, die sich selbst als eine durch verwandtschaftliche Beziehungen verbundene Gemeinschaft verstanden, aber im Lauf der Zeit verwandelte es sich in einen von einer Elite angeführten Staat. Auslöser dieser Entwicklung waren die kolossalen Bauprojekte, für die ein ungeheurer Arbeitsaufwand zu leisten war. Der Monks Mound allein bestand aus rund 620.000 Kubikmetern Erde, die von Arbeitern in Tragkörben zur Baustelle geschafft werden mussten. Die Fertigstellung dieses einen gigantischen Bauvorhabens könnte etwa 370.000 Arbeitstage in Anspruch genommen haben; es war zwar der größte Erdhügel, allerdings nur einer von letztlich rund 200 Mounds, die über das gesamte Stadtgebiet verteilt waren. Ohne die Ausübung von Zwang war ein solches Vorhaben nicht fertigzustellen, und das begünstigte die Entstehung einer hierarchisch gegliederten Gesellschaft. Eine Aristokratie erlangte die Befehlsgewalt über die Menschen niedrigeren Ranges und deren Arbeitskraft, und das erfolgte vermutlich auch durch die Anwendung körperlicher Gewalt.
Cahokia war zu einem Schauplatz der Machtausübung geworden. Tausende von einfachen Menschen verbrachten jetzt – ob die Eliten sich dabei nun auf ein spirituelles Mandat beriefen oder auf nackte Gewalt setzten – einen großen Teil ihrer Zeit mit Erdarbeiten zu rituellen Zwecken und dem Anbau von Nahrungsmitteln für den Adel. Sie waren dabei auf die Großzügigkeit ihrer Anführer angewiesen, um wenigstens Zugang zu einem Teil der Reichtümer zu erhalten, mit denen die boomende Metropole überschwemmt wurde. Bei einem von der Elite ausgerichteten Fest wurden 4000 Stück Rotwild gezählt, 18.000 Tontöpfe und eine große Menge starken Tabaks. Ketten aus Meeresmuscheln, Muschelschalen-Anhänger und Rasseln, außerdem Figurinen von Raubvögeln, Schlangen und Göttinnen, die aus Quarzkristallen, Glimmer und Bleiglanz angefertigt wurden, gelangten aus Cahokia in die benachbarten ländlichen Siedlungen und kündeten von der Macht und Großzügigkeit der Elite.
Die Macht der Elite war nur oberflächlich politischer Natur; ihre wahren Quellen und Ausdrucksformen waren spiritueller Art. Die Anführer und Priester wussten – bzw. behaupteten zu wissen –, wie man mit nichtmenschlichen Wesen zu kommunizieren hatte, wie sich die Sonne, die Erde, die Jahreszeiten, der Regen, die Feldfrüchte und das Wild beeinflussen und beherrschen ließen. Dem obersten Anführer mussten die gewaltigen Mengen an Mais und Luxusgüter zufließen, damit er sie an die Bedürftigen weitergeben und so Verpflichtungen schaffen konnte. Außerdem mussten die nicht-menschlichen Schöpferwesen günstig gestimmt werden, Bündnisse mit äußeren Mächten geschlossen und die eigene Bedeutung kundgetan werden. Macht wurde in Cahokia hochgradig personalisiert und durch den obersten Anführer und seine Lineage verkörpert. Die Bewohner von Cahokia – zumindest ein großer Teil von ihnen – gelangten zu der Ansicht, dass die Macht eines Anführers auch auf das Leben nach dem Tod erweitert werden sollte. Im frühen 11. Jahrhundert wurden rund 270 Menschen rituell geopfert und in einer Reihe von Massengräbern bestattet, damit sie Mitgliedern der Elite im Tod Gesellschaft leisten konnten. In einem anderen Fall wurden 118 weibliche Gefangene nach Cahokia gebracht und getötet. Ein Massengrab war mit mehr als 22.000 zu einem Vogelmuster angeordneten Meeresmuschel-Ketten bedeckt worden.
Cahokias theokratische Anführer schlossen Bündnisse mit den Eliten der Mound-Builder-Dörfer der Umgebung und schufen so ein stets veränderliches Netz von Allianzen, das den Bestrebungen mittelalterlicher Barone und anderer Adliger in Europa glich, die sich um die Herrschaft über weit verstreute Burgen und umstrittene Gebiete bemühten. Zu Chunkey-Spielen versammelten sich die Menschen in riesigen Arenen und sahen den Wettkämpfern zu, die bei diesem Spiel einen scheibenförmigen Stein auf den Boden schleuderten und dann Speere mit dem Ziel hinterherwarfen, das Geschoss möglichst nah am späteren Haltepunkt des noch nicht ruhenden Steins zu platzieren. Wenn Gesandte aus Cahokia die Dörfer der Umgebung besuchten, hatten sie Kriegskeulen und Chunkey-Steine dabei, womit sie möglicherweise sowohl die wettbewerbsorientierte wie auch die kooperative Seite der wechselseitigen Beziehungen hervorzuheben suchten. Der Einfluss ihrer Diplomatie scheint im Herzen des Kontinents für eine lange Ära des Friedens und der Stabilität gesorgt zu haben – für eine Pax Cahokia. Die Stadt Cahokia könnte in ihrer Blütezeit bis zu 15.000 Einwohner gezählt haben, und hinzu kamen noch weitere 30.000 Menschen in ihrem Umkreis, die die große Stadt versorgten.
Cahokia war der Zenit – und vielleicht das Vorbild – einer weitverbreiteten Mississippi-Kultur, die für einen Zeitraum von mehr als acht Jahrhunderten in einer sich stetig verschiebenden Konstellation von regionalen Varianten einen großen Teil der Eastern Woodlands umfasste. Große Bevölkerungszentren steigerten ihre Nahrungsmittelproduktion fast bis zur Tragfähigkeit unter den Bedingungen eines ungewöhnlichen Klimas, in dem lange Sommer und lange Wachstumsperioden mit einer langen Niederschlagsperiode zusammenfielen. Aber dann, im frühen 14. Jahrhundert, veränderte sich das Klima erneut, und die Warmzeit ging zu Ende. Eine weltweite Abkühlung des Klimas, die Kleine Eiszeit, sorgte für unvorhersehbare Regenfälle, Dürrephasen und Kälteeinbrüche und zwang die Menschen zu einer grundsätzlichen Neuorientierung. Die Kleine Eiszeit schuf die Rahmenbedingungen für eine Welt, in der alles kleiner ausfallen musste: Ernten, Märkte, Siedlungen, Erdhügel, Bündnisse und Ambitionen. Die Welt der Menschen am Mississippi wurde kleinräumiger und stärker von Gleichheit geprägt; die Priester-Elite verlor ihre Autorität, weil es ihr nicht gelungen war, für Regen zu sorgen und den Wohlstand zu erhalten. Aber die Welt wurde auch gewalttätiger, als die Menschen aufbrachen, um an anderen Orten nach neuen Ressourcen und Bindungen zu suchen. Eine gewaltige Überschwemmung könnte Mitte des 14. Jahrhunderts zur endgültigen Aufgabe von Cahokia geführt haben, aber die große Stadt hatte zuvor bereits einen sich über mehrere Generationen hinziehenden Niedergang erlebt. Cahokias Dahinschwinden war symptomatisch: Als die Stadt endgültig aufgegeben wurde, waren auch alle anderen größeren Orte am Mississippi bereits unbewohnt. Die Menschen scheinen in der gesamten Osthälfte des Kontinents die tyrannische Priesterkaste abgelehnt und einer stärker an der Gemeinschaft und an Gleichberechtigung orientierten gesellschaftlichen Übereinkunft den Vorzug gegeben zu haben.11
Eine parallele Abfolge von Instabilität und Anpassung entwickelte sich im Westen des Kontinents. Eine schlimme Trockenperiode in der Region des Chaco Canyon erzwang die Aufgabe des Pueblo Bonito um das Jahr 1130. Viele Ancestral Pueblo, denen Ernteausfälle und Hungersnöte drohten, gaben ihre Dörfer und großen Häuser auf und zogen nach Süden, wo sie im Tal des Rio Grande nach und nach neue Identitäten entwickelten und zu Hopi, Zuni und Pueblo wurden. Andere wandten sich nordwärts in Richtung der Mesa-Verde-Region, wo sie mit bemerkenswerter Kreativität in einer unwirtlichen, felsigen Landschaft eine neue Kultur schufen. Dabei stützten sie sich auf ihre lange Erfahrung mit Bautechniken und errichteten unter Felsvorsprüngen erneut Häuser mit zahlreichen Räumen und Steinpaläste mit Dutzenden von Räumen, mehreren unterirdischen Kivas und Türmen auf hohen Schlafkammern. Sie passten ihren Umgang mit Wasser an die Lebensbedingungen in der Trockenwüste an und verlegten sich auf Terrassenfeldbau, bei dem Geröllsperren und Rückhaltedämme Oberflächenwasser sammelten und den Mutterboden für den Mais-, Bohnen- und Kürbisanbau vor Erosion schützten. In der Region Mesa Verde lebten im 13. Jahrhundert möglicherweise bis zu 20.000 Menschen.12
Das Einsetzen der Kleinen Eiszeit sorgte jedoch, wie im Osten des Kontinents, für Veränderungen, die schließlich zum Zerfall dieser frühen Ackerbau-Gesellschaften führten. Als die Ernteerträge immer mehr zurückgingen und die traditionellen hierarchischen autoritären Systeme zerfielen, gingen die Menschen auseinander. Das Volk der Hohokam gab nach mehreren aufeinanderfolgenden Umweltkatastrophen die meisten seiner aus Lehmziegelbauten bestehenden Dörfer und seine im Tal des Salt River angelegten Bewässerungssysteme auf. Auf eine massive, über eine Generation hinweg anhaltende Dürreperiode am Ende des 13. Jahrhunderts folgte eine sich in die Länge ziehende Periode mit spärlichen und unberechenbaren Regenfällen, und beides zusammen förderte interne wie auch nach außen wirkende Gewaltausbrüche. Die Hohokam verschwanden nicht; die Form ihrer Gemeinschaft veränderte sich, und sie wandelten sich zu einer kleineren Gruppe, die später zum Volk der Tohono O’odham werden sollte.13
Das weiter südlich lebende Volk der Mogollon scheint auf die sich wandelnden Lebensbedingungen früher und entschlossener reagiert zu haben. Irgendwann im späten 12. Jahrhundert entstand südlich des Rio Grande in den Ausläufern der Sierra Madre Occidental eine neue Stadt: Paquimé. Das von mehreren großen Flüssen umgebene Paquimé entwickelte sich rasch zu einem großen Handels- und politischen Zentrum für sein Umland, in dem etwa 10.000 Menschen in Hunderten von Siedlungen lebten. Die Erbauer der Stadt waren Maisbauern, Bewässerungstechniker und Händler, und sie errichteten eine neue, von einer Lehmziegelmauer umgebene Stadt, Erdhügel für religiöse Zwecke, Ballspielplätze und einen 2000 Räume umfassenden Wohnkomplex, der Ähnlichkeit zur Architektur der Ancestral Pueblo aufwies.14
Eine Luftaufnahme von Pueblo Bonito
Paquimé entstand in der Übergangszone von Nordamerika und Mittelamerika und verkörpert einen der größten Wendepunkte in der Geschichte des Doppelkontinents. Nordamerika schlug eine andere Richtung ein als die übrige westliche Hemisphäre. Anderenorts entwickelte sich die historische Dynamik in Richtung größerer Konzentrationen von Macht, monumentaler Kultzentren und Städte. Und Nationen, denen viele Tausend Menschen angehörten, hatten dauerhaft Bestand und erreichten Höhepunkte im großen Maya-Stadtstaat Chichén Itzá im Norden der Halbinsel Yucatán, im Reich der Inka, das im Westen Südamerikas eine Nord-Süd-Ausdehnung von mehr als 3200 Kilometern erreichte, und, im 15. Jahrhundert, in der Stadt Tenochtitlán im Tal von Mexiko, die 150.000 Einwohner hatte und von einem Aztekenherrscher und Hohepriestern regiert wurde. Zu diesem Zeitpunkt waren die Ruinen von Cahokia bereits von Gras überwachsen.15
Die Kleine Eiszeit brachte zwar für die Agrargesellschaften Nordamerikas gewaltige Probleme mit sich, aber für die Jäger des Kontinents war sie ein Segen. Das feuchtkalte Klima begünstigte das Gedeihen von Büffel- und Moskitogras, der bevorzugten Nahrung der Bisons, und der Frühling war nass und förderte das wichtige frühzeitige Wachstum von Gräsern nach den Entbehrungen des Winters. Der einzigartig anpassungsfähige und fruchtbare Bison, die einzige überlebende Spezies der Megafauna, hatte jetzt keine ernsthaften Rivalen und Fressfeinde mehr, und die Herden erweiterten ihr Verbreitungsgebiet von den Ausläufern der Rocky Mountains bis in Weidegründe, die Hunderte von Kilometern östlich des Mississippi lagen und von der Subarktis bis zum Golf von Mexiko reichten. Und dort, wo die Bisonherden kleiner wurden, rückten wachsende Rotwildherden nach, deren Lebensraum einen großen Teil der östlichen Hälfte des Kontinents umfasste.
Paquimé heute
Die Mehrheit der Indianer Nordamerikas entwickelte sich zu Generalisten, die sich als Ackerbauern, Jäger und Sammler selbst versorgten. Anstatt sich um einen maximalen landwirtschaftlichen Ertrag zu bemühen – ein Bestreben, das die Ancestral Pueblo, die Bewohner Chahokias und andere frühe Ackerbaugesellschaften angetrieben hatte –, lauteten ihre Ziele Stabilität, Sicherheit und Solidarität. Anstelle von Priester-Herrschern bevorzugten sie Anführer, deren höchste Verpflichtung der Erhalt des Konsenses und die Förderung von politischen Systemen war, die auf Teilhabe beruhten. Macht ging nicht von den Anführern aus, sondern floss gewissermaßen durch sie hindurch. Die meisten Nordamerikaner lebten in Dörfern, nicht in Städten. Die Ancestral Pawnee, Arikara, Mandan und Hidatsa waren untypische Fälle. Sie siedelten im oberen Mississippi-Tal, wo das Grundwasser durch Kapillarwirkung an die Oberfläche gelangte. Sie lebten in Dörfern mit domförmigen Erdhütten, die Einwohnerzahl lag eher bei mehreren Hundert als bei Tausenden. Sie betrieben Gartenbau und legten nur selten Befestigungen an. Diese weitreichende Abkehr von Hierarchien, Elitenherrschaft und Verstädterung im großen Stil mag aus Nordamerika – neben Australien – den egalitärsten Kontinent der damaligen Zeit gemacht haben.16