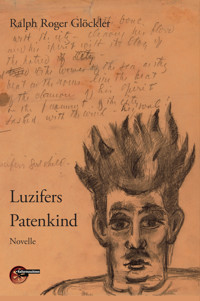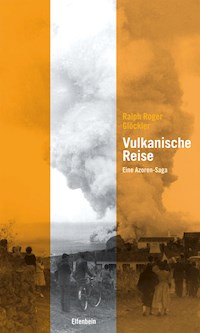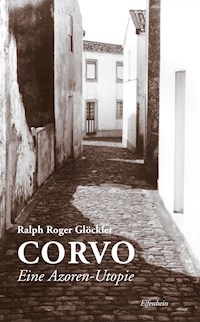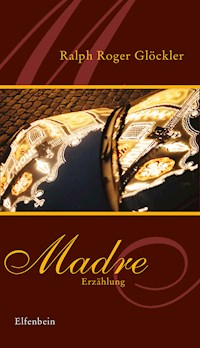Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kulturmaschinen Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Anna, Stiefkind des Diktators, zweifelt an ihrem privilegierten Leben. Eines Tages wird sie, ganz in Gedanken, von einem Unbekannten vor dem Unfalltod gerettet. Kurze Zeit darauf findet sie eine Visitenkarte in ihrer Handtasche. Daniel. Traumdeuter. Neugierig geworden, setzt sie sich mit ihm in Verbindung. Ohne ihn jemals persönlich zu treffen, wird er ihr auf geheimnisvolle Weise helfen, sich ihrer selbst bewusst zu werden. Wer dieser Daniel ist, wird auch der Diktator nicht herausfinden, dessen Horrorvisionen er deuten soll. Anklänge an das apokryphe Buch Daniel und die Erzählung von Susanna im Bade, Variationen über das wackere Selbst und die Macht der Despoten. Annas Leben wird sich radikal verändern. Wohin?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 195
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Table of Contents
KM_Gloeckler_Koenig in seinem Käfig
Impressum
Widmung
Motto
Die Glöckchen der Märtyrerkirche
Wenn ich beschreiben könnte
Die Nacht war warm
Anna
Plötzlich, flüsterte der Onkel
Heiß heute
Olaf lehnte sich
Das Licht im Esszimmer
Das Gebirge faltete sich auf
Anna nahm
Boris war eingeschlafen
Maxim, der plötzlich
Lies, sagte Maxim
Inka-Kakadu, sagte ich
Ich habe ganz vergessen
Werbung 1
Werbung 2
Ralph Roger Glöckler
Der König in seinem Käfig
Roman
Originalausgabe
September 2023
Kulturmaschinen Verlag
Ein Imprint der Kulturmaschinen Verlag UG (haftungsbeschränkt)
Ochsenfurt
www.kulturmaschinen.com
Die Kulturmaschinen Verlag UG (haftungsbeschränkt) gehört allein dem Kulturmaschinen Autoren-Verlag e. V.
Der Kulturmaschinen Autoren-Verlag e. V. gehört den AutorInnen.
Und dieses Buch gehört der Phantasie, dem Wissen und der Literatur.
Umschlaggestaltung: Sven j. Olsson
Umschlagabbildung: Teresa Balté, »Traum«
Eingestellt bei BoD
978-3-96763-282-8(kart.)
978-3-96763-283-5(geb.)
978-3-96763-284-2(.epub)
Für Günter
In derselben Stunde erschienen die Finger einer Menschenhand und schrieben gegenüber dem Leuchter etwas auf die weißgetünchte Wand des königlichen Palastes. Der König sah den Rücken der Hand, als sie schrieb. Da erbleichte er …
Daniel 5, 5 – 6
Das Geschriebene lautet aber: mene mene tekel u-parsin. Diese Worte bedeuten: Mene: Gezählt hat Gott die Tage deiner Herrschaft und macht ihr ein Ende. Tekel: Gewogen wurdest du auf der Waage und zu leicht befunden. Peres: Geteilt wird dein Reich und den Medern und Persern gegeben.
Daniel 5, 25 – 28
DIE GLÖCKCHEN DER MÄRTYRERKIRCHE unten in der Stadt schlugen an, schriller, schräger, von Dämonen gerüttelt, und sirrten, nachdem sie verstummt waren, in Annas Ohren weiter, während das Wochenende von der Kathedrale her mit sonoren Schlägen eingeläutet wurde. Anna, die ganz in Gedanken versunken war, kam wieder zu sich. Sie hob den Kopf. Sieben Uhr. Das Licht verfärbte das Geschirr auf dem Terrassentisch, ließ es rötlich schimmern, glomm in den Gläsern, verwandelte die Häuser, auf die sie hinabsah, in fremdartige, leuchtend gestaffelte Flecken, in ein Gemälde, das aufglühen und verlöschen würde, sobald die Sonne hinter den Bergen versänke. Schwalben schwirrten umher, stoben auseinander. Wenig später würden die Straßenlaternen erglühen, erste Fenster aufleuchten, um sich gegen Dämmerung, Sonnenuntergang, gegen die Nacht zu wehren. Die Hitze würde nachlassen, schon war ein Hauch zu spüren, Wind von den Bergen, sachtes, geräuschloses Heben und Senken der Luft, Atmen, das ihre Lunge, Körper und Seele belebte, hier am Tisch mit ihrem Mann, Maxim, und den beiden zu frühem Abendessen geladenen Gästen, Olaf und Mirko, Partner und Kollegen, wie sie sich nannten, Familiennamen sollte sie, wie Anna annahm, besser nicht kennen, waren sie doch in zwielichtige Organisationen eingebunden, fühlte kühlendes Streicheln in ihrem Gesicht, ließ Messer und Gabel sinken, auch die Herren schwiegen, die sich in ihrer Gegenwart leise, andeutungsweise über finanzielle Transaktionen aus der Heimat in dieses oder jenes als sicher erachtete Land unterhielten, bevor, nicht wahr, internationale Sanktionen griffen, nachdem das Militär fremdes Territorium erobert hatte, und darüber, wie sie in ihren Kreisen zu umgehen wären, also auch die Herren schwiegen, konnten sich der einfließenden Brise nicht entziehen. Erleichterung? Anna blickte umher. Eine Amsel schlug an, man drehte sich um, fast erschreckt von dem unerwarteten Gesang, die Herren lachten, verlachten die lächerliche Kreatur, bevor sie sich, nach verstohlenem Blick auf die jugendlich schöne Herrin des Hauses, wieder ihren flachen, neben den Tellern liegenden Rechnern widmeten. Diesmal Bilder von Demonstrationen, Transparente, wehende Fahnen. Aufsässige oder der Apparat? Die Nation vor einer Zerreißprobe. Offene Gesichter, gereckte Fäuste. Polizei, Milizen, Wasserwerfer. Klar, wer obsiegen würde. Oder? Wann werden es die Waffen sein? Ein anderer, unsichtbarer Vogel hob an, irgendwo in den Bäumen des parkartigen Gartens, jubelte in der Dämmerung, hielt gespannt inne, wartete auf Antwort, die nach angemessener Pause erfolgte, Wechselgesang, um den Übergang vom Tag in die Nacht zu feiern. Anna legte das Besteck weg, trank den letzten Schluck Rotwein und lauschte den verborgenen Sängern. Etwas klang schräg, war nicht ganz geheuer. Nacht, fragte sie sich, oder Untergang? Oder war es ihr Ohr, das die Töne verzerrte? Seltsame Fragen, die sie sich da stellte. Sie wäre gerne aufgestanden, um sich von diesem Tisch, diesen Männern, von ihrem Gatten zu entfernen, den Garten zu durchqueren, auf die Straße, in die Stadt, ans Ufer des Sees zu laufen, ein verwirrendes, sich unaufhaltsam ausbreitendes Gefühl, das sie versuchte abzuwehren, wohin würde es führen, diesen Impulsen nachzugeben, lehnte sich vor, bereit aufzuspringen, blickte ihren Mann an, als erwartete sie augenzwinkerndes, ihre Stimmung zerstreuendes Einvernehmen, keine Ahnung, was, das den Schauder vertreiben und sie ermutigen würde, hier, nicht nur an diesem Tisch, sondern auch in diesem Haus, diesem Land zu bleiben, das der Präsident, der sie nach dem Tod der Eltern an Kindesstatt angenommen hatte, seit Jahrzehnten eisern regierte, kein Wunder also, dass viele aufbegehrten, aber da verschwammen ihre Gedanken, sie sank in den Segeltuchstuhl zurück, was konnte sie denn erwarten … Sie musste dankbar sein, hatte erst im Ausland studieren, dann, noch vor dem Examen, diesen Rechtsanwalt heiraten dürfen, um Herrin eines privilegierten Hauses und Mutter zu werden. Der Onkel hatte verfügt und sie den Mund gehalten. Zu ihrem Besten, oder? Die Glocken schlugen eine nach der anderen an, langsam, bei den Märtyrern wurde gebetet. Sie vernahm die Stimmen der Gläubigen, ohne sie zu verstehen, ein Summen aus jahrhundertealten Mauern. Warum hatte sie eingewilligt und getan, was man von ihr verlangte?
Anna steht an der Fußgängerampel, blickt, wie sie es gewohnt ist, in beide Richtungen, um den Verkehr zu beobachten, sie würde, weil es rot und verboten ist, die Straße zu überqueren, nie stehen bleiben, wenn keine Gefahr droht, aber sie ist in Gedanken versunken, nimmt weder Autos noch Ampeln wahr, nach Hause, denkt sie, beladen mit Körben und Taschen, und fragt sich, ob dieses große, von einem Park umgebene Haus, mit Pool und Blick über die Stadt, in das sie zurückkehren will, ihr Zuhause ist, fühlt nur ein Unbehagen, als müsste sie auf eine fremde Insel zurückkehren, die weder ihr noch ihrem Mann oder sonst wem aus ihrem Leben gehört, doch, ihrem Onkel, dem Präsidenten, dem … Enklave seltsamer Gewohnheiten, Riten, Gesetze, wo ihr kleiner Sohn auf sie wartet, Boris, einziger Grund, sich nicht davonzustehlen, abzuhauen, unterzutauchen, den sie nach all den Jahren als einzigen in dieser arrangierten Ehe von Herzen liebt, ach, es geht ihr gut, das muss sie zugeben, hat alles, was eine Frau sich wünschen mag, alles außer, aber sie könnte nicht sagen, was ihr fehlt, etwas, das … da wird sie von kräftiger Hand gepackt, zurückgerissen, nimmt ein schleuderndes, mit quietschenden Reifen ausweichendes Fahrzeug wahr, Körbe und Taschen fallen hin, Früchte kullern hervor, und landet in den Armen eines Mannes, der sie festhält, offen anblickt, als wäre es selbstverständlich gewesen, sie vor dem Tod zu bewahren, einfach so, lässt sie los, hebt das am Boden liegende Fahrrad auf, nickt ihr noch einmal heiter lächelnd zu, um wortlos alles Gute zu wünschen, etwas, das … Anna will sich bedanken, aber er winkt nur, als wäre alles gesagt und getan, und radelt davon, streckt den Arm aus, um nach links abzubiegen. Sie zittert vor Schrecken, bückt sich, sammelt ein, was aus den Taschen gefallen ist, schnell, bevor Autos das Obst zermalmen. Dann überquert sie die Straße, betritt das Parkhaus, um den Wagen zu holen, schwingt Körbe und Taschen hinein, setzt sich ans Lenkrad, will den Motor starten, aber sie bringt es nicht fertig, ihn anzulassen, in die Stadt, in dieses Haus auf dem Berg zu fahren, nein, sie ist zu aufgeregt, die Finger geben nach, alles gibt nach, lässt sie über das Steuer sinken. Dann fasst sie sich, steigt aus, geht langsam, fast schwerfällig hinaus und setzt sich auf eine Bank in der Anlage hinter dem Parkhaus. Wer war dieser Mann? Wie hat er ausgesehen? Wie alt könnte er gewesen sein? War es ein Mann? Eine Frau? Sie erinnert kein Gesicht, nur diese offenen, weder Anteilnahme noch Besorgnis ausdrückenden Augen, aus denen Freude, mehr noch, Schalk geleuchtet hatte, diesen über Leben und Tod entscheidenden Augenblick gewonnen und getan zu haben, was getan werden musste, ohne Wenn und Aber, nur so, um des Daseins und seiner Wahrheit willen. Und was ist die Wahrheit? Anna schließt die Augen, folgt dem farbigen Gewölke hinter geschlossenen Lidern. Nein, sie kann sich an kein Gesicht erinnern, nur an den Blick und den Griff, mit dem sie am Arm gepackt worden ist. Je mehr sie versucht, sich an diesen Menschen zu erinnern, desto weniger kann sie ihn fassen. Mann. Frau. Das eine, das andere. Wer? Alter? Sie wird es niemals wissen, nein, erinnert sich nur an ein Rad, einen Fahrer, die auftauchten, um sie an sich zu reißen, links abgebogen und aus ihrem Leben verschwunden sind. Anna öffnet die Augen. Kinder tummeln sich im Sandkasten, klettern auf Geräten herum, gleiten die Rutschbahn hinab. Lachen. Kreischen. Heulen. Sie steht auf. Etwas, fühlt sie, ist anders geworden, aber sie weiß nicht, was.
Anna öffnet die Augen, stößt die Bettdecke weg, setzt sich auf. Das Fenster schneidet ein hohes Rechteck aus der Nacht, lässt einen schummrigen Himmel ein. Die Stadt unten lässt seine Ränder glimmen und aufflackern, wenn Autos bergan um die Kurven fahren. Anna, die sich nie an Träume erinnert, kann das anhaltende, langsam Farben wechselnde Bild nicht vergessen, aus dem sie gerade erwacht ist, ja, als würde es schillern und still in sich selbst verharren, faszinierend bewegungslose Szenerie …
Was ist, fragt Maxim benommen. Kannst du nicht schlafen?
Nein, antwortet sie leise. Ich setze mich hinaus. Mach dir keine Sorgen.
Maxim brummt zustimmend, dreht sich um und schläft leise schnarchend weiter. Anna hüllt sich in ihren Morgenmantel, tastet nach der Zigarettenschachtel, die irgendwo liegen muss, kann sie aber nicht finden und ergreift ihre Handtasche, in der sie wohl stecken muss. Sie verlässt das Schlafzimmer, geht aus dem Haus hinaus, dimmt die Poolbeleuchtung, bevor sie sich auf einen der Liegestühle am Rand des ovalen, türkisfarben schimmernden, von Zypressen, Koniferen, Lavablöcken umgebenen Beckens setzt und die Handtasche auf den Boden stellt. Sie betrachtet die aufgerichtete Bronzeschlange, Arbeit eines verfemten, regimekritischen Bildhauers, den sie schätzt und schützt, auch wenn sie nicht wagt, seinen Namen auszusprechen, weil sie des Onkels Pflegekind und die Frau eines Mannes ist, der … Schlange, aus deren Maul, wenn sie den Hahn aufdrehte, Wasser ins Becken rauschte, und deren Augen im Sonnenuntergang glimmen würden.
Anna zieht eine Zigarette hervor, zündet sie an. Da war dieses dunkel glänzende, bis in den Horizont reichende Wasser, glatte, unbewegte Oberfläche, lauwarm-flüssiges Metall, obwohl sie weder Fuß noch Finger eingetaucht, geschweige denn darin gebadet hat, Traumgewässer, aus dem die Bögen eingestürzter Brücken wuchsen, archaisch anmutende Ruinen, in gerader Linie, nah beieinander, als wären sie früher ein endlos übers Wasser führendes Bauwerk gewesen, von Rissen zersprengte, in den Horizont führende Trümmer. Und darüber hätte sie gehen sollen? Wie? Wohin?
Sie zerdrückt die angerauchte Zigarette im Aschenbecher, folgt den Wasser kräuselnden Fingerspitzen des Windes, lässt das Becken vor ihren Augen verschwimmen. Brückenbögen. Geborstene Pfeiler. Mauerreste. In einer Reihe. Bis in den Horizont. Unverrückbar aus der Tiefe emporgestoßen. Und was bedeutet das? Nichts, vermutlich. Oder?
Sie greift nach der Handtasche, fingert darin herum, weiß aber nicht, wonach sie sucht, Notizbuch, Kuli, Zigaretten, Schlüssel, wühlt und weiß nicht mehr, weshalb sie hier draußen sitzt, um Bildern nachzusinnen, die schon verloschen sind und nichts, gar nichts bedeuten wollen, oder, warum geht sie nicht zurück ins Bett, da gerät ihr ein schmaler Karton zwischen die Finger, eine, wie sie erkennen kann, Visitenkarte, vermag aber, weil es dunkel ist, weder Namen noch Adresse zu lesen noch sich daran zu erinnern, wer sie ihr gegeben hat, hält sie nah vor die Augen, Daniel, steht da in grünblauem Wasserschimmern, Traumdeuter. Wer, fragte sie sich, soll das sein, lässt die Karte sinken, starrt aufs Wasser, versucht ein Gesicht zu erinnern, jemanden, den sie zuordnen kann, aber da ist nur die wasserspeiende Schlange und ein heller werdender Himmel über der Stadt. Sie zuckt die Schultern, schüttelt den Kopf, weiß nicht, wie die Visitenkarte in ihre Tasche geraten ist.
Daniel, denkt sie, Traumdeuter, versucht Adressen und Nummern zu lesen: Festnetz. Mobil. Email. Termine nach Vereinbarung. Mehr nicht. Warum rufe ich nicht an? Nach dem Frühstück, wenn ich alleine bin, das Kind und Maxim aus dem Haus. Sie steckt die Karte weg, lehnt sich zurück, blickt in den Himmel. Ein Flugzeug startet über die Stadt hinweg. Dann geht sie auf Zehenspitzen ins Schlafzimmer zurück, schlüpft leise ins Bett, blickt in den verschatteten Raum.
Du warst eine halbe Stunde weg, sagt Maxim ruhig, als sei er die ganze Zeit wach gewesen.
Ich habe draußen gesessen, antwortet sie nach einer Weile. Sagte ich doch. Am Pool. Und habe eine geraucht.
Nur eine?
Eine.
Sie verschweigt, dass sie aus einem Traum erwacht ist, sinnlos, mit ihm darüber zu sprechen, weil es, typisch Maxim, ein Anlass für absurde Fragerei wäre, und schickt einen Seufzer ins Kissen. Außerdem, was geht es ihn an. Es wird langsam hell. Der Motor eines Müllfahrzeugs dröhnt aus der Stadt herauf, die Männer scheppern mit Containern. Unmöglich, noch einmal einzuschlafen.
Sind Sie sicher, gnädige Frau, dass diese Post nicht von anderen, unbefugten Personen gelesen wird? Danke für die Schilderung des Traumes, den ich Ihnen deuten werde, auch wenn ich einräumen muss, gelegentlich zu irren, ich, Daniel, Wahrsager, Traumdeuter, Spintisierer, wie immer Sie mich nennen mögen, einer, den Sie nicht wahrnehmen, wenn wir uns begegnen, weshalb wir nicht erörtern werden, wie meine Visitenkarte in Ihre Handtasche geraten ist, wozu auch, wichtig nur, dass wir verbunden sind, um Gedanken auszutauschen, von denen künftig einiges abhängen könnte. Sie müssen wissen, dass ich Sie zur Vermittlerin erkoren habe, mich Ihrer in Absencen, Delirien, Träumen bedienen werde, um jenen näher zu kommen, erschrecken Sie nicht, die gedeutet, aber nicht zur Rechenschaft gezogen werden wollen. Ich schweife ab, verzeihen Sie, leider nicht die einzige meiner Unarten … Lesen Sie also, heute als Email, wie ich Ihren Traum verstehe, hoffend, dass diese Post nicht ausspioniert wird, weil ich jenen misstraue, die ängstlich, neidisch, eifersüchtig oder hochmütig angekränkelt sind, Sie wissen, was ich meine, deren sich wahnhaft steigernde Befindlichkeiten und ihre Verkörperungen … Wir haben Zeit, lassen Sie sich bei der Hand nehmen und auf die Brücke hinaufführen, wir gehen langsam, schauen Sie unter sich, mit jedem Schritt gibt das tiefe Wasser Ihrer Seele ein Stück Brücke frei, baut Stufen, Pfeiler, Bögen über Bögen, lässt Ihre Füße alte Steine fühlen, als wären sie neu, das Bauwerk wächst, wächst weiter, wird Sie durch den Horizont geleiten. Sie haben Angst, versuchen sich umzudrehen, wissen nicht, worauf Sie sich einlassen, keine Ahnung, wer Sie hier hinaufgelockt hat, einer, der behauptet … Vertrauen Sie Ihrem Wunsch, mehr über sich selbst zu erfahren und blicken Sie nach vorn. Ich lasse Sie los. Gehen Sie, gehen Sie getrost, Sie wissen schon, wohin, vertrauen Sie sich Ihren Füßen an … Der langen Rede kurzer Sinn: Ich selbst habe Ihnen meine Visitenkarte in einem gedankenverlorenen Augenblick zugespielt. Löschen Sie diese Mail, als wäre sie nie empfangen worden, Vorsicht ist geboten, auch wenn ich misstrauischer als nötig bin, ein weiterer meiner Fehler, gewiss, der sechste Sinn will Überraschungen vermeiden, die vorhersehbar und, mit anderen Worten, keine sind. Noch ganz zum Schluss: Reichen Sie mich weiter, Nummern, elektronische Adressen, Sie werden verstehen, an wen, und lassen Sie mich wissen, wann wir miteinander reden sollen. Ich antworte per Spam. Sie erkennen mich an wechselnden Wort- und Zahlenkombinationen, so ich nicht durch Ihren Halbschlaf husche, in Ihr Ohr flüstere, Sie an den Zehen kitzele. Öffnen Sie mich, lesen Sie, was ich zu sagen habe, und vergessen Sie nicht, die Nachricht zu löschen. Verbleiben wir so? Ja, nicht wahr. Ich danke Ihnen.
… War sie träge, unfähig, für sich selbst zu entscheiden? Nein, weder noch. Sie war gar nicht auf den Gedanken gekommen, Widerstand zu leisten, obwohl sie gerne Ärztin geworden wäre, mit Kunst, Künstlern, Ausstellungen in ihren Praxisräumen geliebäugelt hatte. Das Studium wegen einer Heirat abbrechen? Was war damals in sie gefahren? Nichts. Es war halt so. Und außer Wehmut hatte sie wenig empfunden. Wäre der Onkel nicht einverstanden gewesen, wenn sie darauf bestanden hätte, weiterzustudieren? Wäre sie in seinen Augen nicht zu einem ernstzunehmenden Mitglied der Gesellschaft geworden? Fragen, die sie sich nie zuvor gestellt hatte. Anna sah unter sich, als wollte sie vermeiden, ihre Gedanken zu verraten.
Anna, fragte Maxim, dem das beredte Schweigen seiner Frau nicht entgangen war, woran denkst du?
Ich, stieß Anna wie erwachend hervor. An gar nichts. Weshalb?
Lassen Sie uns auf meine Frau trinken, sagte er und erhob sein Glas. Was, Anna, wäre ich ohne dich?
Auf Anna, stimmten die Gäste bei, von ganzem Herzen, ach, dachte jeder der beiden Herren, wenn ich sie haben könnte! Sie möge leben.
Anna zuckte die Schultern, verzog den Mund, zwang sich zu einem Lächeln. Sie hob das Glas, nickte den Herren zu. Plötzlich störte es sie, von Maxim nicht nur beobachtet, sondern gefragt zu werden, was sie denke, oder abgewiegelt, wie so oft, wenn sie versuchte, Gespräche zu führen, die sich nicht um Finanzen, um Geld und wie es zu verschieben wäre, drehten, sondern um Bücher, Filme, bildende Künste, sie sich offener, belesener, eloquenter zeigte, nicht nur für Maxim, sondern auch für die Einflussreichen unerwünschte, weil gefährliche Themen diskutierte, wurden die Uhren im Lande doch zurückgedreht, um abzuwehren, womit sich auseinanderzusetzen wäre, ja, sie hörte das Uhrwerk knarren, vernahm, wie es rasselte, schepperte, Zeiten verdrehte, vernahm es schon länger, bewusst erst seit einigen Tagen … hatte Maxim also Angst, dass sie, die Pflegetochter des Präsidenten, der Joker in seinen Händen, schlank, elegant, in körperbetonenden Tops und Hosen, ihn brüskieren, seine Karriere in Frage stellen, sie, mit blauen Augen, geschwungenen Lippen, mit, wenn sie lächelte oder lachte und kokett die Hand vor die Lippen hielt, vollendet schönen Zähnen, sie, Anna, mit blondem Bubikopf, von anderen Männern begehrt werden könnte, als wäre es zwischen ihr und Maxim früher anders gewesen, nur hatte es sie niemals irritiert. Wer, fragte sie sich, waren die Herren an diesem Tisch, die sie musterten, ihr zuprosteten, ohne, wie es sich gehörte, den Blick nach dem Toast zu senken, sondern, jeder auf seine Weise, anzüglich schmunzelten, Olaf, älter, mit Glatze, Brille, grauem Backenbart, Mirko, Ende dreißig, mit behaarter Brust im offenen Hemd, auf die Stirn geschobener Sonnenbrille. Welche Frauen würden der Onkel, Maxim und diese Männer haben wollen, unabhängige, selbstbewusste oder in seidene Tücher gewickelte willenlose? Anna war wie aus langem Schlaf erwacht. Wer hat gezüngelt, in ihr Ohr gezischelt? Sie? Daniel? Die Wasser speiende Schlange am Pool? Einer wird es gewesen sein. Sie hörte es rauschen. War sie dem Onkel verpflichtet, der Firma ihres Mannes, war sie der Joker eines Spiels, das sie nicht durchschaute? Wie war es mit denen, draußen auf den Straßen, die sich gegängelt fühlten, demonstrierten und ihren Gästen Angst einjagten?
Zum Wohl, sagte sie, sah erst Maxim, der ihr einen Kuss zuwarf, dann die anderen an.
Auf Sie, liebe Anna, sagte einer der Herren, hielt inne, lächelte sie vielsagend an, als suchte er nach weiteren Worten, und, stieß er schließlich hervor, Ihren Onkel, ja, fielen die anderen ein, auf dich, auf Sie und den Präsidenten, der die Nation in wahrer Größe erblühen lässt, und schon, hipp, hipp, hurra, klirrten die Gläser …
Anna beobachtete, wie sie den Sektkelch abstellte, sich langsam erhob und den Tisch verließ, wer, fragte sie sich, ist diese Frau, sie selbst oder eine Fremde, Wirklichkeit oder Halluzination, erschrak darüber, sich wie eine andere Person zu fühlen, bevor sie wieder zu sich fand und auf den See hinausblickte. Es war dämmerig geworden. Die Berge nur noch Schraffuren vor violett verblassendem Himmel. Ein erster Stern. Dann viele. Unten wurde immer noch gebetet, als zischelten die Steine. Anna fuhr das Sonnensegel ein, zündete Windlichter zwischen den Tellern an. Verschobenes Geschirr, Gläser, Flaschen wirkten wie eine niedrige, aus flackernden Schatten züngelnde Tischtuchstadt, mit abgelutschten Messern in den Gassen, Essensresten, schmierigen Flecken.
Maxim, sagte Anna, ohne ihn anzublicken, ich werde nach dem Jungen schauen, der hoffentlich schläft. Und nachsehen, aber das dachte sie nur, ob Nachrichten eingegangen sind. Emails, Voicemails, Kryptogramme. Gut, antwortete er, und gib ihm Papas Küsse.
Meine Herren, sagte sie höflich, bis später. Oder irgendwann.
WENN ICH BESCHREIBEN KÖNNTE, sagte der Onkel gehetzt, was geschehen ist, aber, du wirst es nicht glauben, mir fehlen die Worte, ja, ich weiß nicht einmal, ob ich mit eigenen Augen gesehen habe, was es gewesen ist, vielleicht, dachte ich erst, ein Traum, ein Delirium, ich gebe zu, wir waren besoffen, als ich mich erhob, um auf den Tod der Verräter anzustoßen, wir, alte Freunde aus dem Geheimdienst, die, wie du weißt, das Land in festen Händen halten, eine rauschende Feier, du darfst es wissen, niemand sonst, deine im Kloster lebende Tante würde sich die Finger lecken, wäre sie nicht fromm geworden, eine Orgie also, Lustknaben, Huren unter den Tischen, wo sie aus Hundenäpfen oder unseren Hosen fraßen, ein Raufen, Kreischen, Stöhnen, wollte also das Glas erheben, mich bei den Kämpen bedanken, ihren, nein, unseren Sieg verklären, aber dann hörte und sah ich es, wenn ich dorthin blickte, was, Onkel, fragte Anna, wohin, an die Wand, ja, an die Wand gegenüber, zuerst war es ein Schaben, Kratzen, als ritze einer Worte, Bilder, Zeichen in den Verputz, wie Verliebte es tun, du weißt, mit Herzen, Pfeilen, Kosenamen, ewigen Versprechen, und erkannte eine knochenbleiche, mit dem Zeigefinger Chiffren, Runen, zerbrochene Lettern schreibende Hand, sich zu unleserlichen Worten fügende Zeichen, und vernahm eine leise, langsam sprechende Stimme, als spräche sie verschlüsselt in meine Ohren, zischelndes Beschwören, seltsame, nie vernommene Sätze, mir stockte der Atem, verfolgte die gelenkig schreibende Hand, die alt war, voller Leberflecken, als griffe sie aus vergangenen Zeiten in unsere herüber, dann war sie weg, die Zeichen auf die Wand geschrieben, gelb, ziegelfarben, rot, als wären sie dort schon immer gewesen … ich stellte das Glas ab, verstummte, alle verstummten, selbst Knaben und Huren krochen unter den Tischen hervor, starrten mich an, der versuchte, Lettern und Hieroglyphen zu entziffern, was ist, Herr, hörte ich rufen, was, aber ich erinnerte nur dieses quietschende Schaben, sah wie Staub sich löste, auf die Tische rieselte, vernahm beschwörende Formeln in meinem Ohr, was ist dies, schrie ich, nachdem ich mich gefasst hatte, was bedeuten diese Schriften, diese, was immer sie sein mögen, Botschaften, wischte Gläser, Flaschen, Karaffen weg, die klirrend auf dem Boden zerschellten, wer, verdammt nochmal, kann das lesen, wer, bewegt euch, Idioten, lest, was dort in die Wand geschabt wurde, los, macht schon, und den, der das Rätsel entschlüsselt, werde ich mit Geld, Gold, Aktien überschütten … da traten sie näher, sahen erst mich, dann die gegenüberliegende Wand an, Herr, wagten sie leise, dann lauter zu sagen, wir sehen nichts, gar nichts, weder Buchstaben noch Worte oder Sätze, vielleicht, wendeten sie nachsichtig ein, sei es ein Gläschen zu viel gewesen, nur eines, was keiner verdenken könne, über den Durst, aber dort stehen sie doch, Idioten, schrie ich, dort, seht hin, strengt eure besoffenen Augen an, und deutete mit zittrigen Fingern auf die geheimnisvollen Schriften, nein, Herr, sagten sie bedauernd, vergib uns, wir sehen nur eine unversehrte, frisch gestrichene Wand, dass es einen Flecken gebe, verspritzten Wein, verspritzte, man schäme sich, es auszusprechen, verspritzte, nein, darüber ließe sich nur in Ekstase reden, aus der ich sie gerissen hätte