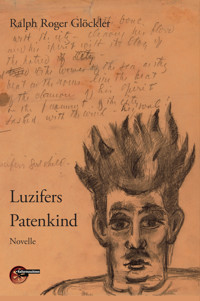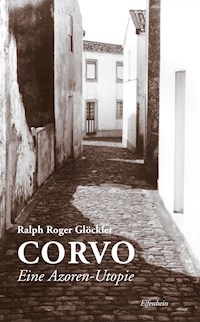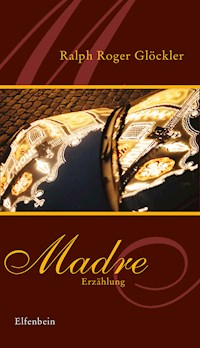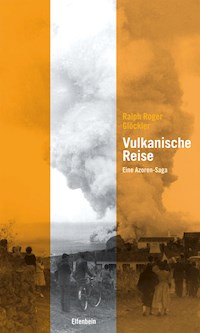
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Elfenbein Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
1957 erschüttert eine submarine Eruption die Azoren-Insel Faial. Als sich in der Folge ein Vulkan vor der Küste aufbaut und seine Aschefontänen die Insel wie einen Teppich bedecken, verändert sich das Leben dort dramatisch: Die meisten Inselbewohner, verängstigt durch die Naturgewalt, verlassen ihre Heimat in Richtung Amerika, mit dem man schon seit Jahrhunderten durch den Walfang verbunden ist. Zurück bleibt nur ein kleiner Teil der Alteingesessenen. Der Walfang ist aufgegeben, die Küste verlassen, Häuser der Natur übergeben, Ochsenkarren sind nur noch auf verblichenen Fotografien und in den Erinnerungen der Alten zu finden. Die einstige Magie des Ortes kann nur noch in der Phantasie beschworen werden. – Ralph Roger Glöckler hat auf Faial Lavafelder durchstreift und in ihnen Spuren neuen Lebens entdeckt. Er hat mit alten Leuten geredet, die die Insel nie verlassen haben und sich noch gut erinnern können; er ist den Spuren der Ausgewanderten bis nach New Bedfort in Massachusetts gefolgt und hat Naturwissenschaftliches mit Historischem verknüpft. "Vulkanische Reise" bildet zusammen mit den Erzählungen "Madre" und "Corvo" Glöcklers Azoren-Trilogie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 224
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ralph Roger Glöckler
Vulkanische Reise
Eine Azoren-Saga
Elfenbein
Ralph Roger Glöcklers Azorentrilogie besteht aus:
»Corvo. Eine Azoren-Utopie«
»Vulkanische Reise. Eine Azoren-Saga«
»Madre. Erzählung«
© 2008 Elfenbein Verlag, Berlin
Alle Rechte vorbehalten
ISBN 978-3-941184-74-9 (E-Book)
ISBN 978-3-932245-92-3 (Druckausgabe)
Götter
Das Licht des Morgens blendet. Ich blinzele benommen auf den Kanal hinaus, während ich in meinem Kaffee herumrühre und der Finsternis nachsinne, die mich das Fürchten lehrte. Das Wasser glimmt. Ich schließe die Augen, aber die Helligkeit hält an, sirrt in meinen Ohren. Nein, es war keine Furcht, vergangene Nacht. Es war etwas viel Existenzielleres.
Angst.
Böen heulen den Hang hinunter, jaulen, wahre Höllenhunde, zwischen den Häusern hindurch. Hagel knallt gegen die geschlossenen Fensterläden. Ein erboster Himmel. Ich kauere in einer Kapsel, fühle mich durch stürmische Galaxien geschleudert, ohne zu wissen wohin.
Die Azoren liegen zwischen dem fünfunddreißigsten und vierzigsten Grad nördlicher Breite. Die Westwinde sorgen in dieser planetary frontal zone für den Austausch von tropischen und polaren Luftmassen. Fließen die Westwinde im zonal flow gleichmäßig von Westen nach Osten, werden sich kalte und warme Strömungen, die zwischen südlichen Hochs und nördlichen Tiefs einherfließen, nur wenig vermengen. Schwingen sie aber im meridional flow, also in nordsüdlichen Kurven aus, wird ein stürmischer Austausch der Luftmassen zwischen Tropo- und Stratosphäre erfolgen. Es bilden sich dabei regionale Hochs und Tiefs. Dann stürzen Winde einher, fluten turbulent über die Inseln. Das weiß ich. Aber Wissen nützt mir nichts. Ich fühle mich ausgesetzt, verlassen in den Konvulsionen der Atmosphäre, verringert auf ein Sandkorn.
Ich schalte die Nachttischlampe ein. Wird das Fenster halten? Die Wände? Der Hagel wird weniger. Einzelne Körner kratzen noch über die Läden. Schwere Tropfen fallen auf die Fensterbank. Dann Stille. Sie ist atemlos, betäubend. Wie sagt man? Die Stille vor dem Sturm? Ich hielt es immer für eine Redensart. Plötzlich macht sie mir Angst. Die Lampe flackert. Erlischt. Künstliches Licht hatte einen Raum erschaffen, in dem ich mich orientieren konnte. Er umgab mich mit vertrauten Dingen, mit einem Gefühl der Sicherheit. Aber die Technik versagt gegenüber der Natur. Ich ergebe mich. Was könnte ich auch tun?
Plötzlich klappern Läden und Fensterflügel. Was für ein merkwürdiges, regelmäßiges Geräusch. Hat der Wind seine Richtung geändert? Wie und woher muss er wehen, um dieses Rappeln zu erzeugen? Der Wind verrät sich an den Ecken, Kanten, Fenstern. Aber ich höre nichts. Es ist windstill. Stockfinster. Kein Geräusch. Nur dieses Rattern. Morsezeichen. Eine befremdliche Botschaft. Ich kann sie nicht entschlüsseln. Warum bloß bin ich im Februar auf die Insel Faial geflogen? Dem winterlichsten Monat des Atlantiks? Die freche Herausforderung der Orkane.
Plötzlich Stille. Fensterflügel und Läden schweigen. Totale Stille. Atme ich noch? Das Gefühl zu schweben. Nein, ich schwebe wirklich. Mein Bett hebt sich, und immer noch kein Laut. Es bockt, schaukelt, bewegt sich fort. Es schüttelt mich. Ich habe über Erdbeben gelesen, aber noch nie eines erlebt. Ich glaubte noch an einen unruhigen Traum. Vielleicht lag das Epizentrum in mir selbst. Angstherde, deren Energien mich wachschüttelten. Nein, kein Traum. Das Bett schwankt, bockt, schlittert in der Finsternis. Etwas kippt, stürzt krachend herunter. Die Bücher rutschen vom Nachttisch, fallen, blättern sich auf. Ich taste nach der Lampe. Sie ist nicht da. Ich bin blind. Nur noch das schwankende Lager. In Panik versuche ich festen Grund zu erreichen. Ich springe aus dem Bett. Die Dielen stehen schräg, geben nach. Der Boden wird mir unter den Füßen entzogen. Ich stürze durch das Universum.
Und plötzlich Ruhe. Die Füße stehen fest. Ich bekomme wieder ein Gefühl für den Raum, spüre die vertrauten Gegenstände – Tisch, Stuhl, Bett.
Licht.
Das durchwühlte Bett. Die blaue, verschobene, halb auf den Boden gestoßene Wolldecke. Ich betrachte eine verworfene Landschaft, während ich wieder zu atmen beginne. Wollene Decken bauen sich auf, stoßen an weiße verzerrte Tücher, wölben sich. Textile Krustentektonik. Das Signal einer Alarmanlage schrillt hinter den Häusern. Die Menschheit meldet sich zurück. Moby Dick und die Briefe von Plinius dem jüngeren liegen aufgeblättert zu meinen Füßen. Crise sísmica, denke ich mit zynischer Genugtuung, jetzt, da alles vorbei ist. Die Erdbebenkrise, die im vergangenen Jahr begann, war der Grund, weshalb ich Lissabon verlassen und die Reise nach Faial unternommen habe. Erdbeben. Ich wollte wissen, wie es ist.
Der Kaffee belebt mich. Wolken gleiten heran, dämpfen das Licht. Es ist acht Uhr dreißig. Ich bin der einzige Gast im Speisesaal. Die Kellnerin blickt melancholisch vor sich hin. Deprimierend, in einem fast gästelosen Hotel zu arbeiten.
Ich entdecke den Hund auf dem Dach des Hauses, das ich von meinem Tisch aus sehen kann. Ein kleines, neu eingedecktes Haus. Die Tonpfannen heben sich rotbraun gegen das bleifarbene Wasser ab. Das Tier blickt gespannt über den Kanal zur Insel Pico hinüber. Was sieht es? Pico liegt nur wenige Meilen oder dreißig manchmal stürmische Minuten Fahrt mit dem Cruzeiro do Canal von Faial entfernt. Der Vulkan, ein atlantischer Fujiyama, beherrscht mit über zweitausenddreihundert Metern Höhe die mittleren Inseln des Archipels. Es ist der höchste Berg Portugals, der, von Faial aus gesehen, einen sich unendlich wandelnden Anblick bietet. Und es ist ein gefährlicher Berg. Magmakammern befinden sich unter Pico und Faial. Der Hund wendet den Kopf, blickt nach unten, als könnte er bis in den Keller des Hauses sehen. Der hinkende Teufel bei Lesage konnte das auch. Er sah den Bürgern unters Dach. Hier, in Faial, können das alle. Sogar die Hunde. Meine Freunde können ein Lied davon singen.
Der Wind treibt die Wolken über den Kanal. Sie plustern sich zwischen den Inseln. Sonnenlicht fällt von Südosten auf den Abhang des Pico, lässt die dunstigen Weiden in morgendlichem Grüngold erglühen. Die kleinen Nebenkegel, die ihm wie Warzen aufsitzen, treten plastisch hervor. Das sieht man selten und nur bei dieser Beleuchtung. Strahlen, die zwischen den Wolken hindurchfallen, legen flirrende Streifen auf dem Wasser aus.
Wolken faszinieren mich. Wie sie sich verformen und immer neu gegeneinander fügen. Über den Kanal getuschte Erinnerungen an den nächtlichen Sturm und Vorboten aller zukünftigen Stürme. Ihre Ränder erglühen. Der Vulkan leuchtet wie ein gigantisches Dreieck hinter ihnen auf. Dunst zeichnet seine Konturen weich, gibt ihm eine sakrale Aura. Das Symbol der Dreifaltigkeit! Ich glaube nicht an Söhne und vergebende Väter, weil ich nicht an Schuld und stellvertretendes Sterben glaube. Bin kein Christ, habe keine Dogmen. Das Symbol ist eine menschliche Erfindung. Aber das überraschende Bild ergreift mich nach dieser Nacht. Die Schöpfung leuchtet, behauptet sich majestätisch gegen die Finsternis, gerade hier, über den Azoren, wo sich neue Erde bildet. Dann verschieben sich die Wolken. Der Gipfel taucht auf. Schnee liegt auf der Asche. Goldenes Flackern.
Dann schwere Wolken, die den Berg verhüllen. Für mich gibt es nur das Strömen des Seins. Ich kenne seine Richtung nicht. Bin dem Willen unterworfen, der sich darin offenbart. Er hat viele Gesichter, die aufleuchten und wieder vergehen. Das macht ihn erahnbar. Mehr nicht. Ich suche nach den Urkräften! Da bildet sich eine verzerrte Maske. Das Maul klafft, gebündelte Strahlen schießen heraus. Das rechte Auge glüht auf, glotzt auf die Inseln. Ein anderer Gott, der mich betrachtet. Er ist nicht geometrisch, ist wechselhaft, bedrohlich. Niemand vermag ihm feste Form zu geben. Vulcanus, der die Gluten der Tiefe schürt. Die Maske hat den Glanz erkalteter Schlacken. Das Maul fletscht Zähne aus Feuer und Licht.
Eine Korvette der portugiesischen Marine fährt von Osten her in den Kanal ein. Die António Enes. Sie gleitet langsam an den Ilhéus von Madalena vorbei. Der weiße Cruzeirodas Ilhas legt von der Mole ab. Er wird am späten Nachmittag im Hafen von Angra do Heroismo auf der Insel Terceira einlaufen. Möwen fliegen auf, segeln über den Kran hinweg, dessen Schatten auf einen havarierten Fischkutter fällt. Die Möwen schwingen sich zu den im Wind auseinandertreibenden Wolken hinauf. Vulcanus ist dahin …
Ich bin nicht sicher, ob ich wirklich sah, was ich vor einigen Sekunden gesehen habe. Meine Sinne sind überreizt – die Reise, die letzte Nacht. Die Wolken sehen wie immer aus. Als ob nichts gewesen wäre. Sie ziehen nach Nordwesten, verhängen den Archipel. Plötzlich bricht ein Strahl hervor, nur einer, gleißt über das Wasser. Er blendet mich, versengt mich, zersprengt meine Gedanken. Ich verberge das Gesicht in den Händen.
Tellurische Messe
Es ist noch früh. Ein trüber Morgen. Ich sitze in der Biblioteca Pública, um Nachrichten und Reportagen über die crise sísmica in den regionalen Zeitungen zu lesen. Die Bibliothek befindet sich in der ersten Etage über dem Stadtarchiv von Horta und wirkt mit ihrem dunklen Dielenboden, den Holzregalen, den massiven, lederbespannten Mahagonitischen wie ein Institut in den ehemaligen Kolonien. Der Bibliothekar, ein junger, einsilbiger Mann, blond wie viele Azoreaner, hat mich gebeten zu warten. Er müsse die Ausgaben der vergangenen Monate aus dem Magazin holen.
Ich bin allein. Schüler, die Arbeiten für den Unterricht vorbereiten, werden später kommen. Zeitungsleser erst in der Mittagspause. Ich lasse meinen Blick über die Bücher in den Regalen wandern, über den Arbeitstisch des Bibliothekars. Ein Kartenspiel schimmert auf dem Bildschirm des Computers. Zeitungen, Zeitschriften liegen auf dem großen Tisch vor den Fenstern. Die Lehnen der Stühle sind dicht an die Platte herangeschoben.
Es ist still. Drückend. Es riecht modrig, nach feuchten Mauern, nach feuchtem Papier. Regentropfen rinnen über die Fenster, verschleiern das gegenüberliegende Gebäude der Segurança Social. Bücherregale spiegeln sich in den Scheiben.
Der Bibliothekar legt die in Horta erscheinenden Tageszeitungen O Telégrafo und O Correio da Horta, monateweise und in kräftiges braunes Papier verpackt, vor mich auf den Tisch. Ich verlange auch den Açoreano Oriental, Portugals älteste Tageszeitung, die in Ponta Delgada auf São Miguel erscheint. Er blickt mich merkwürdig aus seinen dicken Brillengläsern an, beeilt sich jedoch, die angestaubten Packen zu holen. Viele Azoreaner sind gegen São Miguel voreingenommen. Es ist die größte, bevölkerungsreichste Insel. Man wirft den Leuten dort vor, sie wollten den Archipel beherrschen.
Die crise sísmica hat vor ein paar Monaten, am fünfundzwanzigsten November, begonnen. Die Nachrichten sind bis zum einundzwanzigsten Januar recht spärlich, auch wenn O Telégrafo die auf den mittleren Inseln gemessenen Intensitätsgrade der Beben Tag für Tag dokumentiert.
Das Epizentrum liegt im Nordwesten, fünfzehn bis vierzig Kilometer vor Capelinhos, Norte Pequeno und Praia do Norte entfernt. Flugzeuge der Marine, die dieses Gebiet überflogen, haben keine außergewöhnlichen Erscheinungen wie Gasblasen, Dampf, tote Fische im Wasser beobachtet. Nichts Bedenkliches also. Was beunruhigen könnte, ist die Nähe des Epizentrums zum neunzehnhundertsiebenundfünfzig entstandenen Vulkan von Capelinhos, der die Insel um zwei Quadratkilometer vergrößert, die umliegenden Dörfer und Felder mit Asche überschüttet und tausende Existenzen vernichtet hat. Die Dörfer Norte Pequeno und Praia do Norte wurden ein Jahr später bei Erdbeben zerstört, die auf der Mercalli-Skala Intensitätsgrad »zehn« erreichten. Diese Beben leiteten neunzehnhundertachtundfünfzig die letzte effusive Phase des Vulkanausbruchs ein.
Am zwanzigsten Januar, so ergibt ein Vergleich der Zeitungsmeldungen, erfolgte ein heftiges Beben um vierzehn Uhr neunundvierzig, das die Insel Faial mit Stärke »fünf« erschütterte. Die Zeitungen widmen der crise sísmica am ein- beziehungsweise zweiundzwanzigsten Januar erste und letzte Seiten. Man ist erschreckt, alte Ängste sind wieder da. Victor Hugo Forjaz, Direktor des Zentrums für Vulkanologie der Universität der Azoren, dessen Äußerungen zitiert werden, versucht, die Leser zu beruhigen. Die crise criptovulcânica könne drei bis vier Monate dauern, da sich entlang der geologischen Brüche des Archipels immer neue Bebenherde bilden würden. Die Bevölkerung jedoch habe nichts zu befürchten, alles sei ganz normal, so sich die Erscheinungsformen der Beben nicht veränderten oder sich das Epizentrum zur Küste hin verlagerte. Im Übrigen habe die Universität einen Techniker nach Praia do Norte geschickt und damit beauftragt, eine Erdbebenstation zu installieren. Wolle man die azoreanischen Erdbebenschwärme jedoch genauer beobachten und alle Daten maximal auswerten – dies ein nicht ganz unpolitischer Hinweis in eigener Sache –, müsse das Institut endlich mit jenen Geräten ausgestattet werden, um die es schon lange nachsuche.
Ich finde eine Notiz in der Ausgabe des Telégrafo vom achtundzwanzigsten Januar, dass die Korvette António Enes, ein Schiff, das ich oft in den Häfen von Ponta Delgada und Horta gesehen habe, auf Bitten des Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica in der Region des Epizentrums kreuze, um unter Leitung von Professor Ávila Martins und zweier Techniker tiefenspezifische Messungen vorzunehmen.
»Kryptovulkanische wechselt mit typisch tektonischer Tätigkeit. Symptome für hohen Stress. In den Brüchen von Faial. Assoziierte geologische Strukturen.«
Die Notiz vom letzten Januarwochenende liest sich wie ein Fax des Instituto Nacional oder des Centro de Vulcanologia an die Redaktionen. Es muss unredigiert veröffentlicht worden sein. Ich bin vom kryptischen Vokabular fasziniert, kann mich nicht von den Wörtern losreißen. Die rhythmische Folge von hellen und dunklen Vokalen, die Stöße von »K« und »T«, das knisternde »S«, das weichere Lettern bedrängt, verwandelt sich in meiner Phantasie in das Fließen auf- und absteigender Magmamassen, die Druck auf rissiges Gestein ausüben. Es wird nachgeben, bersten, Beben auslösen. Mehr. In diesen Worten höre ich die Stimme Vulcanus’. Tellurisches Tosen. Erdklänge. Wer vermöchte sie zu notieren? Wuchtige Choräle, dissonante Kantilenen. Eine tellurische Messe. In fax.
Mein Erdbeben sorgte schließlich für Schlagzeilen: Bereits fünftausend Beben auf Faial registriert. Die Möglichkeit eines Vulkanausbruchs kann nicht mehr ausgeschlossen werden. Allein am fünfundzwanzigsten Februar wurden, so lese ich, einhundertzwölf Beben gemessen, von denen zehn die Intensitätsstärken »fünf«, »vier« beziehungsweise »zwei« erreichten. Achtzig Prozent der Bevölkerung sei davon aus den Betten geschüttelt worden. Wie wahr! Der Açoreano Oriental veröffentlichte drei Tage später eine Karte, auf der die Region des Epizentrums und seiner focos eingezeichnet ist. Pfeile markieren die Richtung der Stöße.
Ich erfahre aus einem Artikel, die Intensität habe sich verringert, doch die Zahl der Beben sei gestiegen, was auf die Bewegung von Magmaströmen hinweise. Die unterseeische Eruption, die zum Aufbau des Vulkans führen könne, bedeute aber keine Gefahr für Faial. Der Ausbruch würde sich, wenn überhaupt, weit draußen ereignen. Es wäre nicht der erste Vulkan, der im Bereich des Archipels aus der Tiefe heraufdrängt und wegen seines lockeren, schlackigen Materials von den Fluten rasch wieder abgetragen wird.
José Agostinho, einer der Wegbereiter der portugiesischen Vulkanologie, erwähnt in seinem Aufsatz über Actividade Vulcânica nos Açores, der neunzehnhundertsechzig erschienen ist, die achtzehnhundertelf aus einer submarinen Eruption entstandene Insel Sabrina. Sie war nach monatelangem Beben vor der westlichen Spitze von São Miguel aufgetaucht und bald wieder verschwunden.
Offenbar ereignen sich Eruptionen im Bereich der Azoren meistens »nordwestlich« bestehender vulkanischer Systeme. Sabrina, benannt nach einer englischen Fregatte, die sich damals in azoreanischen Gewässern aufhielt und deren Besatzung den Vulkanausbruch beobachtete, baute sich nordwestlich vor der Caldeira von Sete Cidades auf. Der Ausbruch, der im Jahre sechzehnhundertzweiundsiebzig zur Bildung des Cabeço do Fogo auf Faial führte, ereignete sich nordwestlich der Caldeira des Cabeço Gordo, und der submarine neunzehnhundertsiebenundfünfzig vor Capelinhos vergrößerte die Insel mit seinen Lava- und Schlackenmassen an der nordwestlichen Spitze. Muss man sich demnach wundern, dass sich das Zentrum vulkanischer Aktivität der gegenwärtigen crise sísmica fünfzehn bis vierzig Kilometer nordwestlich von Capelinhos befindet, in der submarinen Verlängerung der Falha da Ribeirinha, einer geologischen Verwerfung, die auf der Insel ein schmales, üppig bewachsenes, sich zur Südküste hin öffnendes Tal bildet?
Ich stelle mir das Tal vor, gerate ins Träumen: Lorbeerbäume, Incenso, Faia auf den steilen Hängen, überwuchern sie mit ihren dichten gelbgrünen Kronen. Hohes Schilf säumt die Sandpiste, die zum Meer hinunterführt. Blumen wachsen am Wegesrand, bunte, endemische Gewächse. Schmetterlinge saugen an den Blüten. Libellen fliegen vorbei, halten flügelschwirrend in der Luft an, zucken empor. Ich atme den Duft des Incenso ein, den eine morgendliche Brise aufs Meer hinausweht.
Die leisen Stimmen von Schülern, die sich in der Bibliothek eingefunden haben, lösen den Traum auf, holen mich in die Wirklichkeit zurück, zu den aufgeschlagenen Zeitungen. Das ausgefranste Loch in der Lederbespannung des Tisches schaut unter der letzten Seite des Correio da Horta hervor. Es ist eine Caldeira in flacher Landschaft. Der Riss, der sich mit verschobenen Rändern durch das Gewebe zieht, ist die Miniatur einer geologischen Verwerfung. Plötzlich denke ich an Renato Lemos. Er ist Leiter der Wetterwarte von Horta. Einer der freundlichsten Menschen, die ich kenne. Ich werde ihn anrufen und bitten, mir seine Arbeit zu erklären. Eine gute Idee.
Der Tisch bebt unter meinen Händen. Ich erschrecke. Aber es ist nur die Erschütterung eines vorbeifahrenden Lastwagens. Das weiße Band, mit dem die Zeitungspacken verschnürt waren, fällt schlaufig über die Verwerfung hinweg. Es gibt keine Schmetterlinge, keine Libellen. Sie mögen keine Bibliotheken. Ich kann das verstehen.
Der Wind hat gedreht, während ich zum Observatorium hinaufgehe, weht heftig aus Nordwesten. Die Wolken treiben niedrig über die Inseln hinweg, verhängen den Archipel. Ich habe den Himmel seit heute früh nicht mehr gesehen. Aber so ist das auf den Azoren. Die Möwen haben es gut. Sie gleiten mit ausgebreiteten Schwingen auf dem Wind, treiben über den Monte Queimado und die Bucht von Porto Pim, hinüber zum Monte da Guia. Sie kreisen, vastes oiseaux desmers, über den Leitfunkantennen, die den Flugzeugen die Richtung zur Landebahn weisen. Die Vögel brauchen keine Elektronik. Sie schweben gelassen über die vom Meer überfluteten Krater hinweg.
Die Estrada Príncipe Alberto de Mónaco führt in steiler Kurve bergauf. Hohes Schilf wächst zu beiden Seiten der Straße, wuchert in dichten Streifen hangabwärts.
Das Observatorium wurde auf einem jener Kegel erbaut, die sich wie der mächtige Vulkan Cabeço Gordo auf einem der geologischen Brüche aufreihen. Das Observatorium nahm neunzehnhundertfünfzehn seine Arbeit auf und wurde nach dem Fürsten von Monaco benannt, dessen Forschungen in azoreanischen Gewässern die Ozeanographie um wichtige Erkenntnisse bereichert hat. Es werden dort meteorologische und seismische Messungen vorgenommen.
Der niedrige, achteckige Turm, auf dem sich Antennen und ein Windrad befinden, ragt zwischen zwei im rechten Winkel zueinander liegenden Gebäuden auf. Sie bestehen aus einem Erdgeschoss mit hohen Guillotine-Fenstern und einem Ziegel-Walmdach. Es muss an der Steigung der Straße und der Veränderung des Blickwinkels liegen, dass das Observatorium immer gedrungener erscheint, je näher ich gelange. Ich zögere, bleibe stehen. Es wirkt abweisend.
Ich blicke durch das Schilfspalier auf die Stadt hinunter. Horta öffnet sich zur Bucht hin, wird von Hafen und Marina belebt. Horta war immer provinziell und kosmopolitisch. Ein Widerspruch. Ich weiß. Aber es ist eines, sich im weltoffenen Flair der Hotels zu bewegen, in den Cafés zwischen Touristen und denjenigen zu sitzen, die aus beruflichen Gründen von Insel zu Insel reisen, im Hafen zu verweilen und Schiffe aus fremden Ländern zu bestaunen. Und es ist etwas anderes, in Horta zu leben, eingefügt in eine kleine, sich gegenseitig bespitzelnde, eine, wie ich von Freunden weiß, neurotische, ja paranoide Züge entwickelnde Gesellschaft. Es herrschen strenge Normen dessen, was »man« tun und was »man« nicht tun darf, die zu heuchlerischem Verhalten führen, zu Alkoholismus, Depression, Selbstmord. Syndrome isolierter, geschlossener Gesellschaften. Das Gefühl von Weitläufigkeit wird, glaube ich, auch durch die anderen Inseln vermittelt. Sie sind immer gegenwärtig, vergrößern Faial im Bewusstsein nicht nur ihrer Nähe, sondern auch ihrer Fremdartigkeit.
Die Azoreaner der mittleren Inselgruppe waren bereits im neunzehnten Jahrhundert gesuchte Walfänger. Herman Melville spricht von den azoreanischen »Whalers« in seinem Roman, der mich auf dieser Reise begleitet. Sie galten als mutig und erfahren. Amerikanische Walfänger, die in azoreanischen Gewässern jagten, legten in Horta nicht nur an, um sich mit frischem Wasser und Lebensmitteln zu versorgen, sondern auch um Männer anzuheuern. Ich erinnere mich an eine Photographie vom Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts. Eine Flotte amerikanischer Walfängerschiffe liegt in der Bucht von Horta vor Anker. Ein Schiff neben dem anderen. Eine Armada, so scheint es, hat Faial erobert.
New Bedford in Massachusetts war im neunzehnten Jahrhundert der bedeutendste Fischerei- und Walfängerhafen der Welt. Der Erlös des begehrten Walfischöls, von Amber und Knochen, ließ die Stadt wirtschaftlich erblühen. Herman Melville, »Ismael«, fuhr von hier aus nach Nantucket, wo er auf der Pequod anheuerte, um den Walen zu folgen. Viele Azoreaner, die auf amerikanischen Schiffen arbeiteten oder sich als blinde Passagiere an Bord versteckten, um Armut und Isolation zu entfliehen, kehrten nie mehr auf die Inseln zurück. Sie ließen sich in Massachusetts und später in Rhode Island nieder, wo sich bereits im neunzehnten Jahrhundert Emigrationszentren entwickelten. Heute leben über eine Million Menschen azoreanischer Abstammung in der Neuen Welt; auf dem Archipel sind es nicht einmal dreihunderttausend. Jede Familie auf den Inseln hat Verwandte in den Vereinigten Staaten, was eine engere Beziehung zu Amerika bewirkt als zu Portugal oder dem europäischen Kontinent.
Dona Yolanda Corsépius, eine ältere deutsche Dame, die in Horta lebt und sich im Portugiesischen sicherer fühlt als in ihrer Muttersprache, Tochter des letzten Direktors der Deutschen-Transatlantischen-Telephon-Kabelgesellschaft, hat mir Photos aus ihrer Kindheit und Jugend gezeigt. Die Gebäude der Kabelgesellschaft beherbergen heute eines der Hotels, sowie die Tourismus-, Umwelt- und Fischereiämter der autonomen Region der Azoren. Aber in den dreißiger Jahren führte die Colónia Alemã ein angeregtes gesellschaftliches Leben. Es gab ein Kammerorchester, Vorträge, man spielte Tennis, ritt adäquat gekleidet in die Felder, feierte, veranstaltete Bälle in den Art-Deco-Sälen der Amor da Pátria, des Clubs der besseren Faialenser Kreise. Das Clubgebäude hat einen eleganten Treppenaufgang, der von Palmen flankiert wird. Es erinnert an koloniale Zeiten. Der schmale Fries, der sich oben an der Fassade entlangzieht, besteht aus Keramikfliesen, die blaue Hortensien darstellen. Er ist makellos erhalten. Die blaugrünen Farbtöne changieren im Licht, betonen die vegetabilen Ornamente. Die einfachen Insulaner lebten damals schlecht. Viele waren Analphabeten. Aber das ist eine andere Geschichte. Dona Yolanda führt Tagebuch. Sie könnte viele Geschichten erzählen. Ob sie je ihre Memoiren schreibt?
Es gab immer Menschen anderer Nationen, die auf Faial an Land gingen und zum weltoffenen Ambiente von Horta beitrugen. Die Ozeandampfer steuerten es bis in die fünfziger Jahre dieses Jahrhunderts auf transatlantischen Kursen an, um sich mit Brennstoff und Proviant zu versorgen. Es war für den Nordatlantikverkehr so wichtig wie Mindelo auf der Kapverden-Insel São Vicente für die Routen nach Afrika und Südamerika. Später wasserten Flugzeuge, geflügelte metallische Wale, mit dröhnenden Motoren in der Bucht. Dann wurde es still in Horta. Der Transatlantikverkehr wurde von Passagierflugzeugen übernommen, die Europa ohne Zwischenlandung mit Amerika verbanden. Die Azoren gerieten in Vergessenheit. Sie brachten sich neunzehnhundertvierundsiebzig nach der Nelkenrevolution mit dem gescheiterten Versuch in Erinnerung, unabhängig zu werden. Der Beitritt Portugals zur Europäischen Gemeinschaft sowie die Gewährung der Autonomie haben das Leben auf den Azoren verändert.
Ja, die Zeiten sind andere. Horta ist zu einem atlantischen Treffpunkt für Segler geworden. Boote aus der ganzen Welt liegen im Jachthafen dicht beieinander. Der Wind klimpert auf den Drähten der Verspannungen, lässt es im Wald der Masten rasseln. Es ist interessant, die Hafenmole entlangzugehen, oder die Mole der Marina. Die Mauern sind mit den Emblemen der Boote bemalt: Da haben sich Rudi, John und Thorsten für einige Monate verewigt, oder Brigitte und Suleika, die unter türkischer Flagge angelegt haben. Sie werden im nächsten Winter vergessen sein, weil der Sturm die Farben ausgebleicht oder weil sich andere darüber gepinselt haben. Viele von ihnen, denke ich, sind nicht an den Inseln und ihrem geheimen Leben interessiert, sondern nur an der stürmischen Fahrt vor dem Wind. Ich kann das verstehen. Sie hoffen darauf, viele Gleichgesinnte in Horta zu treffen, um Erfahrungen auszutauschen und um das Fest des Sommers zu feiern. Faial ist zu einem Mekka der Segler geworden.
Der Wind packt mich kalt an der Schulter, als wollte er mich rütteln. Ich erwache aus meinen Betrachtungen. Ein Sonnenstrahl, der zwischen den Wolken hindurchfällt, wirft den Schatten des Schilfs auf die Mauer, die das steile Gelände des Observatoriums abstützt. Feuchtigkeit hat sich in die Farbe gesogen, lässt sie kränklich erscheinen, tuberkulös, ausgewaschen über den schwarzen Blöcken. Das Schilf ist so hoch, dass es über den viereckigen Turm hinauszuwachsen scheint. Das Observatorium ändert seine Form bei jedem Schritt. Ein magischer Ort. Je näher desto ferner.
Die letzte Kurve der Straße. Ich folge der immer höher werdenden Mauer. Da sehe ich die Eingangsseite des Gebäudes. Die Tür und die beiden Fenster sind verschlossen. Eiserne Fahnenstangen, die an der Fassade angebracht sind, ragen flaggenlos empor. Sie sind rostig. Regen hat braune Streifen in den Verputz gewaschen. Fahles Licht flutet durch die Wolken, lässt das Observatorium geduckt und dunkel erscheinen. Wind gellt um die Antennen. Ich gehe weiter, schnell. Eine Stimme ruft. Oder bilde ich es mir ein?
Das Observatorium: abgeschottet. Die Klappläden des Hauptgebäudes geschlossen, um die großen Guillotine-Fenster gegen Wind, Regen, Hagel zu schützen. Die salpetrige Feuchtigkeit hat in den Lack gebissen, der grün von den Lamellen blättert. Eine graue Kordel sichert die Läden des vorderen Fensters. Der Wind heult um den Turm. Er klimpert eine Melodie auf den Baro- und Hygrometern, die auf einer kleinen, umzäunten Fläche vor dem Gebäude stehen, rasselt mit den Drähten, pfeift grell an Masten und Antennen entlang, die meinen Blick zu den dahinjagenden Wolken lenken. Stünden da nicht zwei Autos in der Auffahrt, könnte man meinen, der Ort sei verlassen.
Das Törchen quietscht in den rostigen Angeln. Es fällt krachend hinter mir ins Schloss. Ich bleibe unschlüssig stehen. Der Wind fasst mich an, schiebt mich vor sich her, drängt mich zum Eingang. Er packt meine Hand, um anzuklopfen. Ich zögere immer noch, blicke auf die Bucht hinaus, über den Kanal nach Pico hinüber. Ich würde bis nach São Jorge sehen können, wäre es kein stürmischer Tag im Februar.
Ich klopfe vergeblich. Nichts rührt sich. Habe ich mich in der Uhrzeit geirrt? Habe ich vielleicht gar nicht mit Lemos gesprochen? Ich klopfe heftiger. Nichts. Es ist drei Uhr. Das war vereinbart. Der Wind kreischt.
Senhor Doutor, sagt Renato Lemos mit um Nachsicht bittender Stimme. Er tritt mit ausgestreckter Hand aus der Tür. Sie haben schon mehrmals geklopft, nicht wahr? Verzeihen Sie. Der Wind. Wir müssen alles verschließen, um nicht davonzufliegen. Und außerdem, ich war gerade dabei, ein Blatt zu studieren.
Renato Lemos ist ein zierlicher, grauhaariger Herr. Er ist korrekt gekleidet: graue Hose, blauer Blazer, hellroter Pullover, Hemd und Krawatte a condizer. Und immer vollendet höflich. Konservativ, würde ich sagen, »alte Schule«, wäre da nicht der Ausdruck seiner Augen. Dann ist es, als würde Lemos nach innen horchen. Wenn er mich nur nicht »Senhor Doutor« nennen würde. Sicher, jeder Portugiese, der studiert hat, ist gleich »Doutor«. Trotzdem. Es stört mich. Wir reichen uns die Hand. Renato Lemos macht eine leichte Verneigung.
Wie geht es Ihnen?, frage ich.
Viel Arbeit, antwortet er.
Und die Gesundheit?
Der Blutdruck ist zu hoch, sagt er. Was kann ich machen. Das Alter kennt kein Pardon. Wenn die Musik nicht wäre!
Musik?, frage ich.
Er spiele Klavier, erzählt Lemos, während er mich durch den schmalen Korridor führt. Er wird vom Tageslicht erhellt, das durch die Fenster der Südseite fällt. Es herrscht helle weiße Nüchternheit. Aber keine kalte Nüchternheit. Sie wirkt großzügig, einladend. Ich verstehe, dass der gedrungene Bau sie nach außen hin verteidigt. Die Chronometer der Seismographen ticken leise. Ein Fax-Gerät trällert. Ja, er versuche sich an schwierigen Partituren, fährt Renato Lemos fort und bittet mich in sein Arbeitszimmer. Und später, nach der Pensionierung, wolle er komponieren: Er wisse noch nicht, für welche Instrumente.