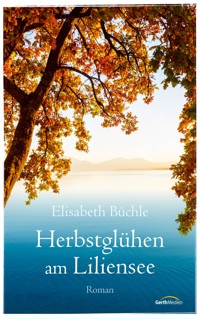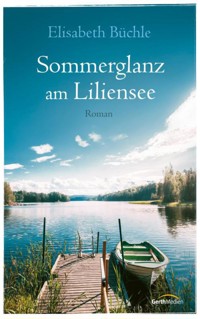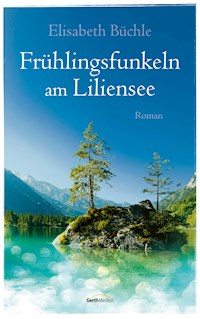13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gerth Medien
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
South Carolina, 1814: Die 17-jährige Catherine ist ein Wildfang, der Reiten, Fechten und auf Bäume klettern mehr schätzt als hübsche Kleider und Teekränzchen. Kein Wunder, hat sie doch in Ermangelung eines männlichen Erben von Kindesbeinen an die Erziehung eines solchen erhalten. Als sie und ihre Schwester Emily in den Wirren des Britisch-Amerikanischen Krieges unfreiwillig auf einer Kriegsfregatte landen, gibt sie sich erfolgreich als Schiffsjunge aus. Lennart Montiniere, der attraktive Lieutenant Commander der "Silver Eagle", findet den ungewöhnlichen jungen "Cato" gleichermaßen interessant wie verdächtig - und für Catherine wird es immer schwieriger, ihre wahre Identität und ihre Gefühle für Lennart zu verbergen. Als sie schließlich ihr Ziel in England erreicht, wo sie den Sohn eines Lords heiraten soll, überschlagen sich die Ereignisse ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 583
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags für externe Links ist stets ausgeschlossen.
© 2017 Gerth Medien GmbH, Dillerberg 1, 35614 Asslar
ISBN 978-3-96122-236-0
Umschlaggestaltung: Hanni Plato
Umschlagfoto: Masterfile, Dale Wilson
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel GmbH, Köln
www.gerth.de
Für Malin Büchle
Historische Personen
Catesby Jones, Thomas (24. April 1790–30. Mai 1858) US-amerikanischer Marineoffizier
Jackson, Andrew (15. März 1767–08. Juni 1845) Generalmajor (Krieg 1812), später: 7. Präsident der USA
Lafitte, Jean (ca. 1780–1826) Der Geburtsort der Lafitte-Brüder Jean und Pierre ist unsicher. Offenbar kamen sie irgendwann nach Haiti, später zog es sie in die USA. Bald schon waren sie gefürchtete Piraten in der Karibik. Nach der Schlacht um New Orleans wurden sie durch den Präsidenten begnadigt.
Madison, James (16. März 1751–28. Juni 1836) 4. Präsident der Vereinigten Staaten, Autor großer Teile der Verfassung der Vereinigten Staaten.
Porter, David (1. Februar 1780–03. März 1843) Kommandant der Marinestation New Orleans, Louisiana, Captain
(Im Roman musste ich zeitlich ein bisschen schummeln. Porter befand sich während des Brandes von Washington vermutlich noch auf dem Heimweg aus britischer Gefangenschaft.)
Die Mannschaft der Silver Eagle
Bonner, Dr.
Schiffsarzt
Camden
„der Weißblonde“, von Adamson verdingt
Classen
dritter Offizier, Lieutenant
Fraser
„der Bucklige“, von Adamson verdingt
Gerald
ältester Schiffsjunge
Huntley
Seemann unter Marlons Kommando
Harry Carrefour
Küchengehilfe
Jackson
verletzter Seemann in Emilys Pflege
Kern
Steuermannsmaat, Gehilfe des Steuermanns
McClellan
Mannschaftsschiffskoch
McPherson
verletzter Seemann in Emilys Pflege
Marlon Montiniere
Midshipman, Lennarts jüngerer Bruder „Midshipmen“, früher Seekadett, werden nach der Lehrzeit und bestandener Prüfung Schiffsoffiziere. „Midshipman“ deshalb, weil sie ihre Unterkunft zwischen den Mannschaften im Bug und den Offizieren im Heck hatten.
Miller
Schiffsjunge/Küchenjunge
O’Conner
Profos Für die Strafverfolgung und-vollstreckung zuständiger Militär.
Prenton
Bootsmann Verantwortlich für den Unterhalt der technischen Ausrüstung eines Schiffes, dem Kapitän bzw. dem Ersten Offizier direkt verantwortlich.
Spencer
Bootsmannsmaat Gehilfe des Bootsmanns
Sutton
Erster Offizier, Lieutenant
Tucker Thurgood
Obersteuermann, Freund von Lennart Leitendes Mitglied der Besatzung, für die Navigation des Schiffesverantwortlich. (Der Rudergänger bedient auf Anweisung dasRuder.)
Wall
Feuerwerker (früher: Büchsenmeister) Für alles verantwortlich, was mit der Bewaffnung zu tun hat.
Prolog
Februar 1797
Die junge Frau unterdrückte einen Aufschrei, indem sie sich so kräftig auf die Lippe biss, dass es schmerzte. Am Fuße der Treppe griff ihr Gast mit beiden Händen nach dem Messer, das in seinem Leib steckte, und kippte röchelnd vornüber.
Fassungslos und unfähig, sich zu bewegen, betrachtete sie den sich windenden Körper und die sich rasch ausbreitende Blutlache. Sie schimmerte im flackernden Kerzenlicht so rot wie der Rubin an ihrem Finger.
Ihr Ehemann hob den Kopf und starrte sie mit wütend zusammengezogenen Augenbrauen an. Es lag keine Spur von Erschrecken auf seinem Gesicht; nur die blanke, ihr allzu vertraute Wut.
Sie wirbelte herum, raffte ihr nachtblaues Kleid und rannte die Stufen hinauf. Ihre Rippen sandten dabei schmerzliche Signale aus – ein Andenken an die letzte Prügelattacke ihres Gatten. Die Polonaise*, die sie sich übergezogen hatte, bevor sie die Wohnräume in Richtung Weinkeller verlassen hatte, wehte hinter ihr her. Sie wollte nur noch fort. Fort von dem gewalttätigen Ehemann; fort von dem Mörder, der er an diesem kalten, dunklen Februarabend geworden war.
Ihre Schuhe klapperten über die vom Mond beschienenen, nass glänzenden Pflastersteine des Hofs, trommelten ihre Angst in die Welt hinaus. Sie flüchtete zu der Nebenpforte in der Mauer, in dem Wissen, dass sie unverschlossen war. Ihr Ehemann nutzte sie für seine heimlichen Ausflüge, ebenso gewährte sie den Unbekannten Einlass, die zu den geheimen Zusammenkünften kamen.
Ihre Hand zitterte, als sie den Knauf umgriff. Die Tür sprang lautlos auf. Wie ein Schatten huschte die junge Frau durch den Spalt und schlug, ohne sich umzusehen, die Holztür hinter sich zu. Mit hastigen Schritten, das Kleid weit hochgerafft, hetzte sie an der Mauer entlang. Lange Grashalme streiften ihre Beine, hinterließen nasse Spuren, ähnlich wie die Tränen auf ihren Wangen. Sie stolperte mehrmals über Bodenunebenheiten und Wurzeln und musste sich mit einer Hand an den kalten, rauen Mauersteinen abstützen.
Jetzt kam es ihr zugute, dass sie gern die umliegenden Berge und Hügel erklomm und selbst an Regentagen oft in den weitläufigen Treppenhäusern des Herrenhauses unterwegs war. Doch plötzlich vernahm sie hinter sich das Trommeln von Pferdehufen. Ihr Gatte folgte ihr auf dem Reittier des von ihm Ermordeten.
Gehetzt blickte sie zurück. Ihre langen Haare peitschten ihr ins Gesicht. Dennoch sah sie, wie ein riesiger Schatten bedrohlich schnell näherkam. Aus den Nüstern des Pferdes stiegen Atemwolken hervor. Vom orangefarbenen Mondlicht beschienen, erinnerten sie an den feurigen Atem eines Drachen aus alten Legenden.
Das triumphierende Lachen ihres Ehemanns jagte ihr einen Schauer über den Rücken, trieb sie gleichzeitig aber auch zu noch größerer Geschwindigkeit an.
Kräftig hob und senkte sich ihre Brust. Ihre Lungen begannen in der kalten Nachtluft zu brennen. Doch sie würde nicht aufgeben! Sie war Zeugin eines Mordes geworden. Er würde sie einsperren – oder ebenfalls umbringen!
Flink tauchte sie unter den niedrig hängenden Ästen einer uralten Linde hindurch. Gleich darauf zwängte sie sich zwischen winterkahle Zweige einer jungen Weide. Ihr Überkleid blieb hängen, dann riss es.
„Ich kriege dich!“, brüllte ihr Verfolger. Der Hass in seiner Stimme ließ sie aufstöhnen. Er würde sie quälen … Wie so oft!
Sie rannte über eine steil abfallende Wiese auf ein nahes Waldstück zu. Wenn sie nur unbehelligt dorthin gelangte! Sie hoffte, dass er ihr mit dem Pferd nicht durch das dichte Unterholz folgen würde.
Die Hufschläge wechselten zu einem schnelleren Rhythmus. Die Erde schien unter dem Trommeln zu beben. Panisch wandte sie den Kopf nach hinten. War ihre Flucht über die freie Wiese ein Fehler gewesen? Der Reiter hatte sie fast eingeholt. Erneut sah sie den orangefarbenen Atem vor den Nüstern und die weit aufgerissenen Augen des Pferdes. Das triumphierende Lachen ihres Gatten drang wie ein schmerzender Pfeil in ihr Herz.
Sie warf sich herum und stürzte zwischen zwei auf der Wiese nahe nebeneinander stehenden Eichen hindurch. Mit jedem Atemzug schickte sie ein Stoßgebet gen Himmel. Plötzlich hörte sie hinter sich einen dumpfen Schlag, dem ein Schmerzensschrei folgte.
Sie rannte weiter, ohne sich umzudrehen. Das Pferd donnerte an ihr vorbei. Ohne Reiter. Hatte er die untersten Äste der Eichen übersehen? Es war ihr gleichgültig. Beinahe hoffte sie, er hätte sich das Genick gebrochen.
„Wo willst du hin, du nichtsnutziges Stück? Du wirst als Hure enden!“, brüllte er in dem Augenblick, als sie den Wald erreichte. Das Pferd war ganz in ihrer Nähe stehen geblieben. Jetzt bedauerte sie, dass sie nie reiten gelernt hatte. Auf dem Tier könnte sie wesentlich schneller fliehen und viele Meilen zwischen sich und diesen grausamen Menschen bringen!
So aber blieb ihr nichts anderes übrig, als sich in das Unterholz zu zwängen. Niemand folgte ihr. Sie war allein. Umgeben von stoisch dastehenden schwarzen Kiefern, modriger Erde und der eisigen Nässe, die in ihre Kleidung drang.
Erst nach einer ganzen Weile blieb sie keuchend stehen und wandte sich um. Weit entfernt glaubte sie, den Lichtschein aus einem Fenster im Herrenhaus zu sehen. Es sah so einladend aus. Nach Wärme … Doch dann spürte sie wieder die Schmerzen, die er ihr zugefügt hatte, sah sein feistes Gesicht vor sich und die Szene, wie er dem Gast das Messer in den Leib rammte.
Sie drehte sich um und versuchte, sich in dem dunklen Wald in Luft aufzulösen.
* hier: „Zweite“ Polonaise: Kleid; da vorn weit geöffnet, musste darunter ein anderes Kleid getragen werden.
1814
Kapitel 1
Meterhohe Flammen schlugen zischend und brodelnd in den nachtschwarzen Augusthimmel. Sie verbreiteten neben einer fast unerträglichen Hitze, beißendem Qualm und einem hellen Lichtschein das schmerzliche Gefühl der Demütigung: Den britischen Truppen war es gelungen, ins Herz der Vereinigten Staaten vorzudringen. Gezielt hatten sie Regierungsgebäude und das Wohnhaus des Präsidenten in Brand gesteckt.
Lieutenant Lennart Montiniere kam soeben von der Marinewerft am Anacostia River. Seine Landsleute hatten dort eigenhändig Feuer gelegt, um zu verhindern, dass die bereitstehenden Ausrüstungsgegenstände sowie die US-Fregatte Columbia in die Hände des Feindes fielen.
Obwohl Lennart es eilig hatte, nahm er sich die Zeit, zwei kleine Mädchen in hübschen Sommerkleidern über ein provisorisch errichtetes Hindernis zu heben. Das eine Kind, kaum älter als 6 Jahre, sah ihn mit seinen großen, braunen Augen so ängstlich an, dass sein Herz sich zusammenzog. Er litt mit den Kindern, die auf der Flucht vor den Flammen und den britischen Soldaten waren. Seine Uniform flößte dem Kind offenbar Angst ein. Tränen, vom Feuerschein golden beschienen, kullerten über die Pausbacken, als es aus Leibeskräften nach seiner Mutter schrie.
Rasch half Lennart auch der verstörten Mutter über das nutzlose Bollwerk. Sie brachte kein Wort des Dankes hervor, nickte lediglich und ergriff ihre Töchter fest bei den Händen. Eilig folgte die kleine Familie den anderen, die ein Übergreifen des Feuers auf weitere Häuser befürchteten und das Weite suchten.
Lennart strich sich über das glattrasierte Gesicht. Sein Magen schien sich verknotet zu haben. Dieser Krieg war längst kein Kräftemessen zwischen Soldaten beider verfeindeter Nationen mehr, sondern riss Frauen und Kinder in seinen Schlund. Zornig presste er die Lippen zusammen. Er war Soldat! Ein Offizier der Vereinigten Staaten! Ihn sollte die kurze Episode an der Barrikade nicht dermaßen aus der Bahn werfen!
Der junge Lieutenant zur See straffte die Schultern und setzte seinen Weg fort; die Hand behielt er auf dem Griff seines Säbels. Grimmig betrachtete er die zersprungenen Fensterscheiben und die vom Feuer umschlungenen Überreste des Finanzministeriums. Schließlich entfernte er sich von dem wild züngelnden und laut fauchenden Flammenmeer.
Ein Trupp amerikanischer Soldaten näherte sich ihm im Marschschritt und mit knallenden Stiefelabsätzen. Die Ascheschicht auf ihren Uniformen erzählte davon, wie nahe sie den Brandherden gekommen waren, ihre Augen hingegen verrieten die Schmach, die sie über die Niederlage empfanden. Während die Städte im Umland den Angriffen der Briten standhielten, war ausgerechnet Washington D. C. von ihnen überrollt worden …
Der Anführer der kleinen Einheit, ein Mann mit Mannschaftsdienstgrad, grüßte vor dem Offizier. Lennart erwiderte den Gruß knapp, verdeutlichte dann aber mit einer Handbewegung, dass der Trupp seinetwegen nicht aufgehalten werden sollte. Die Soldaten hatten zu tun. Womöglich befanden sich noch immer Menschen in den von den Flammen bedrohten Häusern. Außerdem durften dem Versuch, wenigstens ein paar der Gebäude, die im Fokus der Briten lagen, zu retten, keine Förmlichkeiten im Weg stehen.
Lennart kletterte über weitere notdürftig von Bürgern errichtete Barrikaden, vorbei an ausgebrannten Ruinen, einem verendeten Hund und auf der Straße liegenden Möbeln. Ob hier Plünderer am Werk gewesen waren? Oder nahmen die feindlichen Truppen mit, was sie tragen konnten?
Der Lieutenant wusste um die Plünderungen in York*,der Hauptstadt Oberkanadas, durch die US-amerikanischen Soldaten. Sie hatten, entgegen des allgemeingültigen Kriegsrechts, nicht nur öffentliche Gebäude, sondern auch Privathäuser in Brand gesteckt. In diesen Tagen bekamen die US-Amerikaner wohl die Quittung für ihr ruchloses Handeln.
Das Ausmaß der Zerstörung erschreckte Lennart, wenngleich er anerkennen musste, dass die englischen Offiziere ihre Untergebenen gut im Griff hatten. Bis jetzt hatte er kein einziges brennendes Privathaus gesehen.
Bedrückt schüttelte Lennart den Kopf. Er war als Offizier Teil des Kampfes und durchaus bereit, den noch jungen Staat vor Angriffen von außen zu schützen. Aber das unvermeidlich damit einhergehende Leid drückte ihm aufs Gemüt.
Lennart trat in die Mitte einer Kreuzung. Es fiel ihm schwer, sich zu orientieren, da er sich erst das zweite Mal in Washington aufhielt. Eigentlich war er auf dem Weg in seine Heimatstadt New Orleans gewesen, als ein Bote ihn erreicht und hierher beordert hatte.
Unschlüssig nahm Lennart seinen marineblauen Zweispitz ab und versuchte herauszufinden, wo er sich befand. Die Flammen, der beißende Qualm und die abseits des orangefarbenen Lichtscheins herrschende Dunkelheit machten ihm das nahezu unmöglich. Auf See wäre es einfacher für ihn gewesen … Prüfend blickte er zum Himmel hinauf, doch die grauen Rauchwolken verhinderten einen Blick auf die Sterne.
Ohne sich sicher zu sein, ob der von ihm eingeschlagene Weg der richtige war, bog er nach links ab und schritt kräftig aus. Er ließ die brennenden Häuser hinter sich und bald wurde die Luft klarer. Ein zufriedenes Lächeln huschte über Lennarts Gesicht, als er das Gebäude, das der Bote ihm beschrieben hatte, endlich vor sich sah. Wenig später stieg er die Stufen des Backsteinhauses hinauf und klopfte sich dabei die weißen Ascheflöckchen von der blauen Uniformjacke, die vorn deutlich kürzer geschnitten war als hinten. Danach strich er sich über das schwarze Haar, um sich zu vergewissern, dass es noch ordentlich im Nacken zusammengebunden war. Unwillig knöpfte er den hohen Stehkragen zu. Die Augusthitze war drückend, auch abseits der verheerenden Brände.
Auf sein Klopfen hin wurde ihm von einem livrierten Schwarzen die Tür geöffnet. Lennart nannte seinen Rang und Namen und wurde eingelassen. Zwei Wachhabende grüßten und nahmen seine Pistole und den Säbel in Empfang, ehe sie für ihn die zweiflügelige Tür zu einem hauptsächlich in Rot gehaltenen Salon öffneten. Blauer Zigarrenrauch kräuselte sich knapp unterhalb der dunkelbraunen Kassettendecke, die Kerzen auf den Kandelabern rußten unbeachtet vor sich hin.
David Porter, ein guter Bekannter von Lennarts Vater, kam ihm mit großen Schritten entgegen. Lennart nahm eine militärisch stramme Haltung an und grüßte den Captain, unter dessen Kommando er kurze Zeit als Zweiter Offizier gedient hatte. Dieser erwiderte den Gruß und legte dann seine Rechte schwer auf Lennarts Schulter.
„Geht es dir gut, Junge?“, fragte der mit 34 Jahren nur zehn Jahre ältere Porter, der, angetan mit seinem steifen Kragen und dem weißen Halstuch, fürchterlich schwitzte. Schweißperlen liefen ihm über die Stirn, dunkle Flecken verunzierten seine Achseln.
„Bis auf den Umstand, dass mein Heimaturlaub unterbrochen wurde und die Briten da draußen aufs Übelste gewütet haben, ja. Und Ihnen, Sir?“
„Ich könnte mit deinen Worten antworten!“ Porter nickte grimmig, drehte sich halb um und deutete auf einen Mann in feinem Zwirn mit zurückgehendem Haaransatz und auffällig herabhängenden Schultern, der wie ein gefangenes Tier vor der Fensterfront auf- und abging. Sein weißes Haar war zerzaust, der schwarze Frack zerknittert.
„Ich möchte dich gern dem Präsidenten vorstellen.“
Lennart folgte Porter zu James Madison, der seinen nervösen Gang unterbrach und den Lieutenant zur See misstrauisch musterte.
„Das also ist der junge Mann, den Sie vorgeschlagen haben?“, wandte Madison sich nach einem knappen Nicken in Lennarts Richtung an Porter.
„Er mag jung sein, Mr President, aber er ist erfahren und eine geborene Führernatur, überaus gefestigt und loyal.“
Lennart kniff unwillkürlich ein Auge zu und fragte sich, zu welchem Zweck oder an wen er da gerade verschachert werden sollte.
Madison, der das Land in diesen Krieg gegen die Briten geführt hatte, schwammen allmählich die Felle davon. Die Einnahme Washingtons war ein Desaster. Lennart erinnerte sich an die aufgebrachten Worte seines sonst so ausgeglichenen Vaters, der meinte, dass Madison bei der Wahl seiner Offiziere kein gutes Händchen bewies und dass es allein der Marine zu verdanken sei, dass die USA den Krieg nicht längst verloren hätten. Und das, obwohl die Briten sich auch noch mit Napoleon hatten herumschlagen müssen.
„Meinetwegen, Porter. Klären Sie das mit der Admiralität!“ Madison wandte sich ab und nahm sein unterbrochenes nervöses Auf- und Abschreiten wieder auf.
Porter bedankte sich höflich, deutete eine Verbeugung an und winkte Lennart, ihm zu folgen. Vorbei an mehreren distinguiert aussehenden Männern, unter denen Lennart einige Abgeordnete erkannte, betraten sie einen Nebenraum, der sich durch angenehm wenig Rot auszeichnete.
„Die Flucht des Präsidenten und der Regierung nach Virginia steht kurz bevor. Vermutlich brechen die Herren in den nächsten Minuten auf“, sagte der Captain mit einer wegwerfenden Handbewegung.
Lennart verstand ihn auch ohne viele Worte. Über Washington flatterte der Union Jack, und die Regierungsbeamten versuchten, sich und wohl auch wichtige Papiere außer Reichweite der feindlichen Truppen zu bringen.
„Es sind nicht genügend britische Soldaten vor Ort, um die Stadt zu besetzen. Ich nehme an, sie wüten hier einige Tage lang und ziehen sich dann zurück“, erklärte Porter seine Sicht auf das Geschehen.
Lennart enthielt sich eines Kommentars, doch Porters Worte ließen vermuten, dass er das Wüten der Briten in der Stadt ebenfalls für eine Vergeltungsmaßnahme für York hielt.
„Kommen wir zum Grund deiner Anwesenheit.“ Porter hielt inne, als mehrere Detonationen die Scheiben in ihren Fassungen zum Klirren brachten. „Es gibt Strategen in der Admiralität, die sich eine größere Beweglichkeit auf See wünschen. Schnellere Aufklärung darüber, wo die britischen Blockadeschiffe liegen und wo sich die mit Kaperbriefen ausgestatteten englischen Privatschiffe herumtreiben. Sie suchen einen fähigen Offizier …“ Porter brach ab und drehte sich zu Lennart um. „Gratuliere. Du hast das Kommando über eine Korvette zugeteilt bekommen.“
„Danke, David“, erwiderte Lennart trocken und in Abwesenheit der Regierungsmitglieder nun gelöster. Allerdings schwirrte ihm vor Verwirrung der Kopf. Er bekam das Kommando über ein Schiff? Dazu war er doch viel zu jung, und zudem war er noch nicht einmal in den Rang eines Ersten Offiziers aufgestiegen.
Trotz seines Erstaunens unterdrückte er jede Gefühlsregung. Weder würde er seine Verwunderung zeigen noch den Kummer, den er verspürte, weil sich ihm plötzlich das verängstigte Gesicht des kleinen Mädchens an der Barrikade vor sein inneres Auge schob.
„Mir gefällt deine Euphorie!“, lachte Porter und schlug eine Ledermappe auf, die bis jetzt unbeachtet auf einem Mahagonitisch gelegen hatte. „Hier findest du deine Papiere, deine Befehle und die Namen und Empfehlungen eines Großteils der bereits mit dem Schiff vertrauten Mannschaft. Dein Auftrag ist überaus heikel und bedarf großen Fingerspitzengefühls. Falls etwas schiefgeht, wird die Admiralität leugnen, ihn erteilt zu haben.“
„Ich habe wohl nicht die Möglichkeit, das Kommando abzulehnen?“, fragte Lennart mit gezwungen heiterer Stimme nach. War er überhaupt bereit, die Verantwortung für ein Schiff und dessen Seeleute zu übernehmen?
„Doch, das steht dir frei. Aber ich kenne dich. Du brennst auf ein eigenes Kommando. Du bist der fähigste Mann für diese Aufgabe, der mir in den Sinn gekommen ist. Und ich vermute, du weißt, dass du nie wieder eine solche Chance erhalten wirst. Es gibt genug Männer in deiner Position, die sich die Finger danach lecken würden.“
„Aber ich darf sie mir verbrennen?“
„Ich traue dir genug Diplomatie zu …“ Porter brach ab, schwieg einen Augenblick und fuhr dann fort, als habe er Lennarts Einwand aus seinem Gedächtnis gestrichen: „Übrigens habe ich angeregt, dass Midshipman Marlon Montiniere auf die Silver Eagle versetzt wird.“
Lennart nickte, war sich jedoch im Unklaren darüber, ob es ihm zusagte, dass sein jüngerer Bruder unter sein Kommando gestellt wurde. Sie verstanden sich im Grunde gut, doch was ihre berufliche Laufbahn anging, hatten sie so ihre Differenzen …
Unter mein Kommando? Lennart wiederholte innerlich seinen eigenen Gedankengang. Hieß das, dass er sich bereits mit dem Angebot arrangierte, das ihm hier so unvermutet offeriert wurde? Um seine Nervosität zu verbergen, verschränkte er die Hände hinter seinem Rücken und warf einen Blick auf die noch immer lodernden Flammen über der Stadt. Im Nebenraum entstand Unruhe. Offenbar war man im Hinblick auf den weiteren Fluchtweg für Madison und seine Regierungsbeamten übereingekommen.
Lennart zwang sich gedanklich zurück zu der Mission, die man ihm unterbreitet hatte. Andere warteten Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte auf eine derartige Möglichkeit. Allerdings entnahm er der vorsichtigen Umschreibung seines Kommandos, dass die Korvette nicht in einem Flottenverbund segeln würde. Vielmehr würde er auf sich allein gestellt sein und als Spion der Meere fungieren. Das hatte durchaus seinen Reiz, barg aber gleichzeitig unzählige Gefahren. Zudem … umgab seine erste Aufgabe nicht ein Hauch von Illegalität, wenn im Zweifelsfall die Admiralität jedes Wissen um seine Mission abstreiten würde?
„Sieh dir die Liste durch und wende dich an mich, wenn du gern einen bestimmten Mann an deiner Seite hättest. Im Prinzip hast du viele Freiheiten, deine Vorgaben ähneln dem Kaperauftrag eines privaten Schiffseigentümers.“ Porter lachte wieder, schlug die Mappe zu und übergab sie Lennart. „Und wie lautet deine Entscheidung, Lieutenant Commander?“
„Lieutenant Commander?“
„Hatte ich vergessen zu erwähnen, dass dir eine Beförderung zuteilwurde?“
„Im Zusammenhang mit dem Kommando über die Korvette?“
„So könnte man es ausdrücken.“
Das aufgeregte Prickeln in Lennarts Innerem nahm an Intensität zu. Musste er tatsächlich noch abwägen, ob die Gefahr im Verhältnis zum Angebot zu groß war? Er scheute das Risiko nicht. Ohnehin war es gleichgültig, ob er seinen Dienst auf einer Kriegsfregatte oder auf einer der neuen, wendigen und schnellen Korvetten tat, ob innerhalb einer Flotte oder allein. Lennart schluckte alle Unsicherheiten hinunter.
„Ich übernehme den Auftrag, David. Danke für das in mich gesetzte Vertrauen.“
„Ich habe nichts anderes erwartet.“ Porter gefror das Lächeln auf seinem Gesicht, als einen Häuserblock entfernt ein Feuerball in den dunklen Himmel schoss.
„Ich wäre jetzt lieber auf einem Schiff“, brummte er, fuhr jedoch mit leichtem Schalk in der Stimme fort: „Wenn man bedenkt, dass dein Vater aus dem französischen Viertel von New Orleans stammt, würde ich dir jetzt gern den Spitznamen Korsar verpassen.“
„Die Korvette liegt vor der Küste Louisianas?“, fragte Lennart knapp, ohne auf die Bemerkung einzugehen.
„Richtig. So kannst du einen kurzen Heimatbesuch einschieben, bevor du wieder in See stichst und hoffentlich eine Menge britische Schiffe das Fürchten lehrst. Ich wünsche dir viel Erfolg.“ Porter reichte ihm die Hand, die Lennart kräftig drückte, ehe er militärisch grüßte und den Raum verließ, um seine Waffen wieder an sich zu nehmen.
Im Freien begrüßten ihn der beißende Gestank und der helle Lichtschein der noch immer wütenden Brände. Ein auffrischender Wind ließ ihn den Kopf heben. Vielleicht täuschte er sich, aber der Himmel sah nach einem herannahenden Sturm aus. Was das für die brennende Stadt bedeuten könnte, wagte er sich kaum auszumalen. Es drängte ihn danach, irgendetwas zu tun, und sei es nur, ein paar Wassereimer zu schleppen. Doch seine Pläne waren vor wenigen Minuten auf den Kopf gestellt worden, auch wenn dieses kurze Zusammentreffen eigentümlich surreal auf ihn nachwirkte.
Er klemmte sich die Ledermappe fest unter den Arm und verließ den Stadtteil auf demselben Weg, auf dem er ihn betreten hatte.
N
Die Fuchsstute galoppierte über die schlammige Wiese, schleuderte Dreckbrocken und Grasbüschel unter ihren Hufen hervor, die meterweit durch die von Blütenduft geschwängerte Luft flogen. Aufgeschreckt flatterten einige Amseln auf und flohen in Richtung Fluss.
Der Reiter stieß einen anfeuernden Ruf aus, hob den Säbel und griff die reglose Figur in der Mitte der Waldschneise an. Ein dumpfer Schlag ertönte, als die Waffe ihr Ziel traf. Ein paar Meter weiter machte das Pferd eine enge Wendung auf der Hinterhand und pflügte dabei die Grasnarbe auf. Der Reiter parierte das goldglänzende Tier durch, sodass es neben dem Opfer zum Stehen kam, und riss sich den Hut vom Kopf. Dabei lösten sich lange dunkle Haarsträhnen aus einem nachlässig geschlungenen Knoten. Die junge Frau betrachtete mit einem breiten Grinsen den im Gras liegenden Kopf der Strohpuppe, die ohnehin bemitleidenswert aussah.
Triumphierend steckte sie den Säbel in die Scheide und wischte sich mit dem Ärmel ihrer mit Schmutzspritzern übersäten Baumwollbluse den Schweiß von der Stirn.
Catherine Hansen, die jüngere Tochter des Plantagenbesitzers, stellte sich in die Steigbügel, warf einen belustigten Blick auf die Sklavenkinder, die sie bei ihrer täglichen Übung beobachtet hatten, und winkte ihnen zu. Die Mutigen unter ihnen winkten zurück, andere sahen sie mit bewundernd aufgerissenen Augen an, obwohl die weiße Frau in Hosen, die einen Männersattel benutzte und mit unglaublichem Geschick eine Waffe zu führen verstand, ein vertrauter Anblick für sie war.
„Jetzt kann First nicht mehr trainieren“, rief Flea ihr zu. Das achtjährige Mädchen, das Catherine in ihrer Wildheit, ihrem Eigensinn und ihrem Mut in nichts nachstand, sprang begeistert auf und ab. Catherine mochte das Kind mit der ebenholzschwarzen Haut, dem krausen kurzen Haar und der auffälligen wulstigen Narbe auf der Stirn. Fleas voriger Besitzer hatte ihr diese zugefügt. Catherines Mutter Elizabeth hatte wenige Monate vor ihrem Tod das verletzte Kind von einem nachbarschaftlichen Besuch mit nach Hause gebracht …
„Sie werden First dieses Mal also besiegen, Missi Cat!“, jubelte Flea weiter, als ob Catherines Sieg bereits feststünde.
Catherine war sich dessen nicht so sicher. Bis vor zwei Jahren war ihr First – ein Sklavenjunge, der ihr als Ausbildungspartner zur Seite stand –, bei jedem ihrer spielerischen Wettkämpfe unterlegen gewesen. Doch mit zunehmendem Alter wurde First größer und stärker, während Catherine, sehr zu ihrem Leidwesen, nur weibliche Formen annahm. So verbissen sie sich auch gegen die Veränderungen wehrte, so wusste Catherine doch, dass sie letztlich nichts dagegen tun konnte. Ihr vertrautes und geliebtes Leben würde bald ein Ende haben …
Catherine winkte den Kindern zum Abschied zu, brachte ihre Stute dazu, sich aufzubäumen, und galoppierte dann von der Lichtung in den schattigen Waldweg. Sie hörte die lachenden und johlenden Stimmen ihrer kleinen Zuschauer, die es liebten, wenn sie dieses Kunststück zeigte. Bald verschluckten die dumpfen Schläge der Pferdehufe und das Brausen der uralten Bäume im leichten Westwind jedes andere Geräusch.
Minuten später sprang Catherine vor dem langgezogenen Stallgebäude hinter dem herrschaftlichen Plantagenhaus aus dem Sattel. Einer der Stallknechte kam angerannt. Als er sie erkannte, hielt er an, zog grüßend den Strohhut und kehrte an seine unterbrochene Aufgabe zurück. Wie alle, die für die Pferde verantwortlich waren, wusste er, dass Catherine ihre Stute selbst absatteln und füttern wollte.
Nachdem Catherine das Pferd versorgt und Sattel und Zaumzeug an seinen Platz geräumt hatte, ergriff sie ihren braunen Schlapphut und schlenderte über den Kiesweg in Richtung Haus.
Noch immer brannte die Sonne von einem wolkenlosen Himmel auf South Carolina hernieder. Über den Feldern und Wiesen flimmerte die Luft. Insekten schwirrten um Catherines verschwitztes Gesicht, und sie versuchte, sie durch ein kräftiges Wedeln mit ihrem Hut zu vertreiben. Inzwischen getrocknete Matschklumpen lösten sich von ihrer Kleidung, in der sie vielmehr wie ein Stallbursche denn eine junge Dame der gehobenen Gesellschaft aussah, und fielen zu Boden. So war es wenig verwunderlich, dass Catherine, als sie mit einem übermütigen Satz auf die Holzveranda sprang, in fünf entsetzte Damengesichter blickte.
Catherine hielt erschrocken inne. Emilys Nähkränzchen hatte sie völlig vergessen. Sie war viel zu sehr in ihre Gedanken darüber versunken gewesen, wie lange sie ihr ungebundenes Leben wohl noch würde beibehalten dürfen. Immerhin war sie fast achtzehn und die meisten Gleichaltrigen waren entweder verlobt oder sogar schon verheiratet.
Ihre Schwester hob missbilligend die Brauen und verdrehte gekonnt ihre schönen hellblauen Augen. Emily kam mit Catherines Eskapaden halbwegs zurecht, aber ihre Freundinnen hatten für die unkonventionellen Erziehungsmethoden, die Catherine erfuhr, kein Verständnis.
„Catherine, du siehst aus wie ein … ein …“ Offenbar fehlte Marie-Ann ein passender Vergleich und vor Schreck war sie in die deutsche Sprache verfallen. Schnell versteckte sie ihr Gesicht hinter einem mit Monogramm bestickten Spitzentaschentuch, als müsse sie sich vor Catherines Ausdünstungen schützen.
Diese überlegte sich einen Moment lang, ob sie demonstrativ einen Arm anheben und an ihrer Achsel schnuppern sollte, ließ allerdings von dem rebellischen Einfall ab. Es führte zu nichts, wenn sie die Damen noch mehr gegen sich aufbrachte. Vielmehr bestand die Gefahr, dass sie noch vehementer auf ihren Vater eindringen würden, dass er aus ihr endlich eine anständige junge Südstaatendame formen solle. „Entschuldigt mich bitte“, murmelte sie, machte kehrt und eilte mit auf den Holzplanken knallenden Absätzen in die andere Richtung davon.
„Kein Gentleman, der etwas auf sich hält, wird sich jemals mit diesem Wildpferd abgeben wollen“, hörte sie ungewöhnlich laut Luises sonst so zartes Stimmchen.
Catherine zögerte, mit der Hand auf der Klinke der Verandatür. Ob sie der Gleichaltrigen mit dem Pferdegebiss und der Raubvogelnase sagen sollte, dass damit ja dann ihre Chancen wuchsen, einmal einen „Gentleman“ abzubekommen? Doch sie schämte sich sofort für ihre Gedanken. Luise war keine Schönheit und die Plantage ihrer Eltern war die kleinste in ihrem hauptsächlich von deutschen Auswanderern besiedelten Gebiet. Aber darauf kam es schließlich nicht an. Eines Tages würde ein junger Mann erkennen, dass Luise ein großes Herz hatte – wenn sie nicht gerade mit Marie-Ann zusammensaß und meinte, es deren Bissigkeit gleichtun zu müssen, um dazugehören zu dürfen.
Catherine warf ihrer Schwester ein entschuldigendes Lächeln zu, das Emily mit einem kaum merklichen, hoheitsvollen Nicken beantwortete, und flüchtete in ihr Zimmer. Dort hatte jemand einen Badezuber mit angenehm kühlem Wasser für sie bereitgestellt. Catherine seufzte dankbar und schälte sich aus der schmutzigen und verschwitzten Reitkleidung.
Summer trat ein, raffte die Kleidung zusammen und war bereits wieder an der Zimmertür, als sie sich zu Catherine umdrehte, die soeben in die Wanne glitt. Das dunkelhäutige Gesicht der Greisin war faltig, ihr lockiges Haar weiß, ihre Schultern und ihr Rücken waren von den Jahren harter Arbeit gebeugt. Sie hatte lange auf den Baumwollfeldern gearbeitet, bis sie zu alt dafür geworden war. Nun half sie bei leichteren Aufgaben im Haus.
„Nun, Missi Catherine?“
„Ich habe die Strohpuppe zerlegt. First wird seinen Übungsgegner erst reparieren müssen. Vielleicht verschafft mir das einen kleinen Vorteil.“
„Und?“
„Ich habe den Sattel und das Zaumzeug seines Pferdes versteckt.“
„Und?“
Catherine lachte auf und tauchte erst einmal unter. Prustend kam sie wieder an die Oberfläche und strich sich mit gemächlichen Bewegungen das tropfende Haar aus dem Gesicht. „Sein Pferd steht bei den trächtigen Stuten auf der abgelegensten Koppel, genau dort, wo er den Wallach niemals suchen wird.“
Summer kicherte und ließ die junge weiße Frau allein. Sie war eine Sklavin, die ihr Leben lang nichts anderes gekannt hatte, als für ihre Herren zu schuften. Dennoch hatte sie sich einen feinen Humor und eine große Lebensfreude bewahrt, so ungebrochen wie ihr Glaube an den Gott, der ihr eines Tages die Freiheit schenken würde, wie sie es so häufig sang.
Catherine rieb sich nachdenklich über einige schmerzende blaue Flecken, die First ihr bei Kampfübungen am Vortag zugefügt hatte. Sie war wie ein Junge aufgewachsen, verstand es aber trotzdem, auch ohne Waffen zu kämpfen. Mit den Waffen einer Frau …? First war es jedenfalls noch nie eingefallen, sie so zu sabotieren, wie sie es zuletzt gelegentlich versucht hatte.
Seufzend tauchte sie ihr erhitztes Gesicht ein zweites Mal in das angenehm kühle Nass. In ihr schlummerten zwei Seelen, und sie war alt genug, um zu ahnen, dass ihr das womöglich eines Tages Schwierigkeiten einbringen könnte. Dennoch: Um nichts in der Welt wollte sie diese ganz besonderen Jahre ihrer Kindheit und Jugend missen, auch wenn sie wohl bald der Vergangenheit angehören würden …
N
Die Aufregung um Catherine hatte sich wieder gelegt; Emilys Freundinnen nähten weiter und wandten sich anderen Themen zu. Da gab es die Pläne für Hochzeiten und Bälle zu diskutieren, die in der nahenden Wintersaison stattfinden sollten, oder den neuen Schneider, der sich unweit der deutschen Plantagen in einer kleinen Ortschaft niedergelassen hatte. Er war Schweizer, hatte jedoch einige Jahre in Paris gearbeitet. So zumindest besagten die Gerüchte. Gleichgültig, ob der Parisaufenthalt der Wahrheit entsprach oder nicht; allein das Gerücht würde dem Mann eine große Anzahl Kundinnen einbringen. Allerdings war das für Emily alles nicht mehr von Interesse.
Versonnen setzte sie einen akkuraten Stich nach dem anderen, während ihre Gedanken auf Wanderschaft gingen. Ihr Vater hatte ihr vorhin im Vorbeigehen zugeraunt, dass ihr Verlobter eingetroffen sei. Wie auch immer der Brite, der vor etwa drei Jahren um ihre Hand angehalten hatte, an den britischen Blockadeschiffen vorbeigekommen war – nun war er hier. Und er wollte sie mit sich nach London nehmen!
Aufregung, Vorfreude und eine Spur von Angst bedrängten ihr Herz in einem irritierenden Durcheinander, das sie gar nicht mochte. Sie war nur froh, dass ihr Vater sich um alle Belange rund um ihre Abreise und Vermählung kümmerte. Und um die von Catherine …
Emily legte ihre Hände in den Schoß. Catherine war ein Wildfang mit einem unmöglichen Betragen. Oft genug sahen ihre Haare aus wie ein Vogelnest und beherbergten Blätter und Zweige. Dazu diese geschmacklose Männerkleidung, die sie so gern trug …
Emily konnte ein Lächeln nicht unterdrücken. Sie liebte ihre Schwester innig, ihrem Gebaren zum Trotz, das in der deutschen Nachbarschaft auf zunehmend mehr Unverständnis traf.
In früheren Jahren war Emily bei jedem aufziehenden Gewitter in Catherines Bett geschlüpft und hatte sich dort unglaublich sicher gefühlt. Später hatte Catherine es einmal mit einem Landstreicher aufgenommen, der Emily bedroht hatte. Wie ein großer Bruder hatte sie sich zwischen sie und ihren Angreifer geworfen und hatte ihn mit ihrem Degen in die Flucht geschlagen. Diese Geschichte, die sich wie ein Lauffeuer herumgesprochen hatte, hatte in der Gesellschaft für einen Skandal gesorgt.
Emily war das egal gewesen. Catherine hatte sie vor diesem Kerl und seinen grabschenden Händen beschützt und vor Schlimmem bewahrt! Seitdem untersagte Emily sich jedes negative Wort über ihre jüngere Schwester, und meist verteidigte sie das Mädchen sogar vor anderen.
Seltsam und belustigend zugleich war nur, dass Catherine, die ihre eigenen Würmer zum Angeln sammelte und einmal einen Waschbären als Haustier gehalten hatte, eine Aversion gegen Schmetterlinge hegte. Mehr noch, sie hatte eine tiefe, irrationale Angst vor den bunten, filigranen Schönheiten. Dies war jedoch ihr gut gehütetes geschwisterliches Geheimnis.
Nach dem Tod ihrer Mutter Elizabeth, die Catherines Treiben vielleicht irgendwann Einhalt geboten hätte, sah Emily ihre unkonventionelle Erziehung und Entwicklung jedoch in einem kritischeren Licht. Emily hegte die Befürchtung, dass ihre ungestüme Schwester mit ihrem jungenhaften Verhalten und ihrem überaus großen Selbstbewusstsein, gepaart mit einer kräftigen Portion Leichtsinn, eines Tages in große Schwierigkeiten geraten könnte. Immerhin war sie trotz allem eine junge Frau.
* heute: Toronto
Kapitel 2
Das Wasser plätscherte unter dem Baum hindurch, der waagerecht über den Cooper River ragte und dessen Blätter von den Wellen umspielt wurden, als liebkosten sie das Grün. In das Gurgeln des Flusses mischten sich das unermüdliche Zirpen der Grillen und das Zwitschern der Vögel.
Catherine entledigte sich ihrer Schuhe – Strümpfe trug sie in der heißen Jahreszeit ohnehin nicht – und balancierte geschickt und schnell wie ein Seiltänzer über die aufgeworfene Rinde. Aufseufzend ließ sie sich neben First, dem gleichaltrigen Sklavenjungen, auf dem Stamm nieder. Er nickte ihr grüßend zu, ohne die Angelroute auch nur zu bewegen.
„Du verscheuchst die Fische, Cat“, brummte er, was das Mädchen zum Kichern brachte.
Catherine kannte First von Kindesbeinen an, seit ihr Vater, Frederick Hansen, ihn zu ihrem Ausbildungspartner erkoren hatte. Nachdem ihm klar geworden war, dass er neben seiner Tochter aus erster Ehe und der Tochter seiner zweiten Frau keine weiteren Kinder, vor allem aber keinen Sohn mehr bekommen würde, hatte er in Catherines fünftem Lebensjahr damit begonnen, das Mädchen im Reiten, in der Fechtkunst und dem Schießen zu unterrichten. Er ließ zu, dass sie mit First all die kleinen Abenteuer erlebte, die ein Sohn mit ihm unternommen hätte. So kam es, dass sie auf Bäume klettern und schwimmen lernte und allerhand mehr, was für ein Mädchen aus den gehobenen Kreisen South Carolinas absolut nicht angemessen war.
Elizabeth, Catherines Mutter, hatte diese ungewöhnliche Ausbildung nicht untersagt, sondern vielmehr unterstützt. Eines Tages hatte Catherine mit angehört, wie sich wieder einmal eine ihrer Nachbarinnen über die wilde und viel zu selbstständige Catherine beschwert hatte. Daraufhin hatte ihre Mutter zu Frederick gesagt, dass ihr eine wilde Tochter weitaus lieber sei als eine, die hilflos wäre, wenn sie je in eine missliche Lage geriete. Vor fünf Jahren war ihre Mutter gestorben und hatte eine große Lücke bei Catherine hinterlassen. So wie sich an jenem traurigen Tag ihre Welt verändert hatte, so würde der heutige Tag wohl als der in Catherines Geschichte eingehen, an dem sich ihr Leben erneut grundlegend verändern würde.
„Müsstest du nicht beim Dinner sein?“, fragte First leise.
„In ein paar Minuten. Ich habe mich davongeschlichen.“
First warf einen Blick auf das hellblaue Kleid mit den kurzen Ärmeln und dem dunkelblauen Band knapp unterhalb von Catherines nicht sehr üppiger Brust. Das Kleid sollte sie zur Abendmahlzeit tragen und nun saß sie auf einem feuchten und moosbewachsenen Baumstamm und ließ die nackten Füße ins Wasser baumeln.
„Was ist los, Cat?“, hakte der Sklavenjunge nach und fuhr sich mit einer Hand über den schwarzen Lockenkopf. Er holte die Angelschnur ein und drehte sich zu Catherine um.
„Emilys zukünftiger Ehemann ist eingetroffen.“
„Der Engländer? Und das während des Kriegs? Na, der traut sich was!“
„Immerhin bemüht er sich um den Kauf einer Plantage in Virginia, er könnte sich also beinahe amerikanischer Staatsbürger nennen. Ebenso unterhält er ein Anwesen auf Kuba. Seine Mutter ist übrigens Spanierin. Er ist mit einem unter spanischer Flagge segelnden Schiff gekommen.“
„Und weiter?“ First neigte den Kopf und sah sie an. Auf seiner Stirn hatten sich kleine Falten gebildet, die Catherine verrieten, dass er mit schlechten Nachrichten rechnete.
„Er möchte Emily mitnehmen. Zuerst nach Kuba, dann weiter nach England. Und er hat angeboten, dass ich sie begleiten kann, zumal mein Vater ja seit Längerem mit einem Briten über eine Eheschließung mit mir verhandelt.“
„Verhandelt?“ First zog eine Grimasse. Natürlich hatte das Wort einen schalen Beigeschmack für jemanden, der wie eine Ware ge- und verkauft werden konnte.
„Der Mann, irgendein Adeliger oder so was, hat vor vier Jahren unsere Plantage besucht und muss sich da in mich … Ich bin ihm wohl aufgefallen.“
„Aber da warst du doch höchstens dreizehn“, stieß First hervor.
Catherine zuckte mit den muskulösen Schultern. Sie war zwar schlank, entsprach sonst aber keineswegs dem zarten Idealbild einer Südstaatenschönheit. „Ich erinnere mich nicht an ihn. Weder an seinen Namen noch an sein Gesicht. Doch offenbar habe ich einen nachhaltigen Eindruck bei ihm hinterlassen. Er hatte kurz vor seiner Abreise mit Vater gesprochen und dann vor zwei Jahren wieder Briefkontakt aufgenommen und um meine Hand gebeten, sobald ich das entsprechende Alter erreicht hätte.“
„Und das hast du jetzt?“
„Ich bin bereits siebzehn, fast achtzehn. Viele Mädchen in meinem Alter sind längst jemandem versprochen oder sogar verheiratet. Bis ich über Kuba nach England gereist bin …“ Catherine zog beide Schultern hoch. Sie wusste nicht recht, was sie davon halten sollte, ihre Schwester zu begleiten, um in England einem Mann vorgestellt zu werden, der ihr Ehemann werden wollte. Allerdings reizte sie das Abenteuer, das diese Reise versprach, ebenso wie die Möglichkeit, zumindest noch eine Weile vor dem Leben zu fliehen, das die Gesellschaft für sie vorgesehen hatte.
Zudem hatte ihre Mutter ihr noch auf dem Sterbebett das Versprechen abgerungen, ihrem Vater folgsam zu sein. Und Catherine wiederum war sicher, dass ihr Vater niemals wissentlich eine Entscheidung treffen würde, die von Nachteil für sie wäre.
First riss Catherine aus ihren Überlegungen. „Und jetzt willst du mich um Rat fragen? Ich bin doch ein einfältiger Sklave.“
„Das bist du nicht!“, begehrte sie auf, schlug jedoch unverzüglich die Hand vor den Mund. Ein Entenpaar setzte empört schnatternd und flügelschlagend zur Flucht an. Dabei versetzten sie das Schilf raschelnd in Bewegung, und das Spanische Moos, das die Äste der alten Eiche zierte, unter der die Wasservögel geruht hatten, tanzte wie Elfen über das Wasser.
„Was willst du von mir hören?“, brummte First und schaute auf das im Sonnenlicht glitzernde Wasser. „Du würdest hier fehlen. Und der Gedanke, dass du einen Mann heiraten sollst, den du nicht einmal kennst …“
„Weil er ein Engländer ist und wir uns mit England im Krieg befinden? Meine Mutter stammte aus England. Sie fühlte sich zwar als Amerikanerin, blieb ihrer früheren Heimat allerdings immer verbunden.“
„Was spielt denn das für eine Rolle?“, knurrte First und legte seine dunkle Hand kurz auf ihre schlanken weißen Finger.
Catherine verstand, was er ihr verdeutlichen wollte. Sie beide verband eine innige, über die Jahre gewachsene Freundschaft. Für sie machte es keinen Unterschied, woher jemand kam und welche Hautfarbe er hatte …
„Du hast recht, ich kenne ihn nicht. Aber das ist nicht unüblich. Emily hat ihren Bräutigam auch erst einmal getroffen. Ich reise ja vorrangig als ihre Begleitung nach England und nebenbei werde ich dann dem Herrn vorgestellt. Niemand zwingt mich, ihn zu heiraten.“
„Sieht der englische Herr das ebenso?“
„Davon gehe ich aus.“
„Denkst du nicht, dass er Pläne schmieden wird, um die Frau entsprechend zu empfangen und zu beeindrucken, die seinetwegen diese weite und gefährliche Reise auf sich nimmt? Wie steht er da, wenn sie plötzlich wieder abreist?“
„Frederick wird ihm schon deutlich gemacht haben, dass mein Besuch nicht verpflichtend ist!“
First schüttelte den Kopf, ohne noch einmal zu widersprechen. Dafür sagte er: „Ich habe den Eindruck, dass du dich ohnehin schon entschieden hast.“
Catherine sprang auf, kämpfte einen Augenblick mit dem Gleichgewicht und balancierte dann auf dem Stamm noch weiter über die glucksenden grünen Wellen hinaus. Mit einem gewagten Kehrtsprung wechselte sie dann die Richtung, sodass sie ihren Freund ansehen konnte. Der Stamm wippte leicht und die Blätter raschelten, als würden sie gegen die rüde Behandlung protestieren. Catherines braune Augen blitzten übermütig und die Sonne zauberte rotgoldene Reflexe in ihr dunkelbraunes Haar. Das hellblaue Kleid flatterte um ihre nackten Beine und die dunklere Schleife in ihrem Haar tanzte auf und ab.
„Stell dir das nur vor: Ich auf einem Segelschiff! Umgeben vom endlosen Meer und einer kräftigen Brise, die die weißen Segel füllt und mich zu einem anderen Kontinent trägt.“ Sie schwieg einen Moment, während sie versonnen zu dem dichten Blätterdach hinaufblickte, ehe sie leiser und mit einem wehmütigen Unterton hinzufügte: „In das Heimatland meiner Mutter.“
„Ich wünsche dir eine gute Reise!“, sagte First trocken und erhob sich ebenfalls.
Catherine lachte unbekümmert und folgte dem Jungen vom Baumstamm auf die federnde Erde des Flussufers.
„Warte nur ab! Womöglich wirst du mich gar nicht so schnell los, sondern musst uns begleiten!“, spottete Catherine und eilte mit gerafftem Rock, die Schuhe in der Hand und mit undamenhaft großen Schritten davon. Sie ließ das üppig bewachsene Ufer hinter sich und trat zwischen die Baumwollpflanzen. Deren braune Blätter waren bereits abgefallen, und ihre knorrigen Äste reckten sich dem tiefblauen Himmel entgegen. Die weiße Baumwolle hatte die Kapseln gesprengt und thronte auf den Zweigen wie Neuschnee – wobei Catherine zugeben musste, dass sie noch nie in ihrem Leben Schnee gesehen hatte. Aber vielleicht würde sich das ja bald ändern, wenn sie nach Europa reiste!?
Die Luft flimmerte über den Feldern. Schwarze Sklavinnen, die sich zum Schutz vor der brütenden Sonne Tücher um den Kopf gebunden hatten, bewegten sich zwischen den Pflanzenreihen. Dabei sangen sie ein melancholisch klingendes Lied, in dessen Rhythmus sie die Baumwolle von den Zweigen pflückten. Etwas weiter entfernt ritt ein schwarzer Aufseher auf einem altersschwachen Pferd die Reihen ab. Aus den primitiven Holzhütten, in denen die über 40 Sklaven lebten, die ihr Vater besaß, drang der Duft von gedünsteten Tomaten.
Catherine nahm all die Gerüche tief in sich auf. Das Duftgemisch aus trockenen Baumwollpflanzen, fruchtbarer Erde und dem harzigen Geruch des Waldes war ihr so angenehm vertraut. Ihm fügte sich der deftige Modergeruch des Cooper River bei, der in Richtung Charleston floss, die Ausdünstungen schwitzender Arbeiter und ein zarter Hauch von den üppig blühenden Rosen und Prachtscharten im Garten. Womöglich würde sie all das bald schon hinter sich lassen …
Plötzlich mischte sich Wehmut in ihre freudige Erregung und setzte sich als kleiner, beißender Schmerz in ihr fest. Sie war so tief mit der Plantage verwurzelt, wie die uralten Eichen, deren mächtige Wurzeln sich teilweise sogar bis oberhalb der Wiese erstreckten.
Sie betrat die gekieste Auffahrt zum Herrenhaus und besah sich das mit acht weißen dorischen Säulen geschmückte Gebäude, als habe sie es nie zuvor gesehen. Mit seinem Giebeldreieck und der rundum verlaufenden Veranda wirkte es ehrwürdig und stolz. Dies war ihr Zuhause. Hier war sie aufgewachsen, hatte Zuneigung und Liebe erfahren und dank des unkonventionellen Zutuns ihres Vaters eine für ein Mädchen ungewöhnlich vielseitige Ausbildung genossen. Nicht nur, was den Umgang mit Waffen und Pferden betraf … Sie war unendlich wissbegierig. Deshalb hatte sie wesentlich länger und zugleich intensiveren Unterricht erhalten als Emily, die dem perfekten Ideal einer zarten und sanftmütigen, aber in Catherines Augen auch verwöhnten Dame aus den Südstaaten entsprach.
Zumindest eine Zeitlang würde sie nun noch ihre Freiheit genießen können, bis sie in der ehemaligen Heimat ihrer Mutter entscheiden musste, ob sie diesen Mann ehelichen wollte, der offenbar Gefallen an dem wilden Mädchen mit der unkonventionellen Erziehung gefunden hatte. Und das sprach doch durchaus dafür, dass er sie so annehmen würde, wie sie war, und nicht versuchen wollte, sie in das enge Korsett einer gesellschaftlichen Norm zu pressen. Allein deshalb brachte sie ihm schon einige Sympathie entgegen.
Ein traurig-schwer anmutender Klang hallte über die Plantage. Catherine, die seit Jahren den Verdacht hegte, dass diese Glocke, die zu den Mahlzeiten rief, nur ihretwegen angebracht worden war, raffte erneut den fließenden Baumwollstoff ihres Kleides. Sie rannte über den knirschenden Kies, ließ die Haupttür links liegen und hastete über die Veranda. Gewohnt stürmisch betrat sie das Speisezimmer.
Ihre Familie saß bereits an der festlich gedeckten Tafel und die Vorspeise war aufgetragen. Emily warf ihr einen warnenden Blick zu, damit Catherine nicht vergaß, vor ihrem Vater und dem Gast zu knicksen. Beide Männer erhoben sich bei ihrem Eintreten höflich.
Um die grünen Flecken auf ihrer Kehrseite und die verschmutzten Schuhe möglichst schnell unter dem Tisch zu verstecken, sank sie auf ihren Stuhl.
„Sie sehen sehr … frisch aus, Miss Hansen“, sagte Benedict Stafford angesichts ihrer geröteten Wangen, der aus der Aufsteckfrisur gelösten Haarsträhnen und ihrer leicht erhöhten Atemfrequenz.
Emilys Zukünftiger war, was die meisten Frauen einen attraktiven Mann nannten: groß, schlank, modisch gekleidet in bis zur Wade reichenden Hosen, weißem Rüschenhemd, einer zweireihig geknöpften Weste unter dem Frack und drei übereinander geschlungenen Halstüchern. Sein schwarzes Haar – das Einzige an ihm, was auf seine spanischen Vorfahren schließen ließ –, trug er kurz.
„Vielen Dank, Mr Stafford“, erwiderte Catherine und überging die versteckte Spitze in seiner Wortwahl. Die Fähigkeit, eine Rüge in Komplimente zu verpacken, beherrschten also nicht nur die Menschen aus diesem Landstrich, sondern auch Emilys Verlobter.
Catherines Augen suchten die ihres Vaters, der ihr verschwörerisch zuzwinkerte. Sie unterdrückte ein Auflachen und beugte sich etwas tiefer, als es dem guten Ton entsprach, über ihre Schildkrötensuppe. Sie würde die Plantage, die singenden Schwarzen, ihren Freund First und das wunderbare Haus vermissen. Am meisten jedoch würde ihr Vater ihr fehlen!
N
First schaute Catherine nach, bis die Sklavenunterkünfte den Blick auf sie verdeckten. Er würde sie vermissen, stellte er fest, gleichzeitig überfiel ihn eine bohrende Sorge: Was würde mit ihm geschehen, wenn Catherine die Plantage verließ?
First wusste den Sonderstatus, den er von Kindesbeinen an gehabt hatte, sehr wohl zu schätzen. Als Gefährte der Tochter seines Herrn, so ungewöhnlich das auch war, war er von der schweren Feldarbeit befreit gewesen. Sein Status war weit höher als der vieler Haussklaven, obgleich diese älter waren als er. Und er war in den ungewöhnlichen Genuss gekommen, an dem hervorragenden Unterricht der beiden Hansen-Töchter teilnehmen zu dürfen.
First bestieg den waagerechten Baumstamm und setzte sich wieder an seinen angestammten Platz, jedoch ohne die Angelschnur erneut auszuwerfen. Wie oft hatte er die Überlegung durchgespielt, eines Tages zu fliehen, immerhin besaß er die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Flucht und ein selbstständiges Leben weit im Norden des Landes. Er war jung, gesund, gebildet und intelligent, er konnte es schaffen. Doch seine Zuneigung zu Catherine, die wie eine Schwester für ihn war, und die Dankbarkeit, die er ihrem Vater gegenüber empfand, hatten ihn davon abgehalten, diesen Gedanken in die Tat umzusetzen. Was aber würde geschehen, wenn Catherine fort war? Ob man ihn dann zum Feldsklaven degradieren würde?
Bei dieser Vorstellung zog First die Beine an und stützte sein Kinn auf ein Knie. Sollte es so weit kommen, war es wohl an der Zeit, über eine Flucht nachzudenken. So schwer es ihm auch fallen würde, Massa Hansen zu enttäuschen, der ihn immer gut behandelt hatte …
Während unter dem Baumstamm das Wasser gurgelnd über die Flusskiesel strömte, gab er sich der Wunschvorstellung hin, Catherine und ihre Schwester auf ihre Reise begleiten zu dürfen. Er sah sich auf schwarzen Schiffsplanken stehen, über sich die geblähten Segel, fühlte eine steife Brise, die an seinem Körper zerrte, und sah die endlose Weite des Ozeans. Das Sinnbild für Freiheit!
First zwang sich, Ruhe zu bewahren. Geduld ist eine Tugend der Intelligenten, hatte er einmal irgendwo gelesen. Er würde sie sich zu Eigen machen und abwarten, was die nächsten Wochen mit sich brachten. Und vielleicht würde der große Traum eines einfachen Sklaven eines Tages in Erfüllung gehen: Herr über seine eigenen Entscheidungen zu sein. Frei zu sein …
N
Frederick Hansen schenkte sich einen Cognac ein, schwenkte das goldschimmernde Getränk im Glas und wandte sich dann erst zu Catherine um. Sie stand mit hinter dem Rücken ineinandergelegten Händen am Fenster – eine durch und durch männliche Haltung. Ihr Blick schweifte über die Baumwollfelder, die vor einem beeindruckenden Sonnenuntergang in weichen Farben leuchteten.
In Fredericks Augen war Catherine eine Schönheit, obwohl ihr Körper zu muskulös, ihre Bewegungen weniger anmutig als effektiv und ihr Teint viel zu dunkel waren. Besonders auffällig war das marienkäfergroße Muttermal auf ihrer rechten Kinnlinie, das ein bisschen näher am Kinn als am Ohr saß. Als sie noch ein Kleinkind gewesen war, hatte er es immer geküsst, wenn das quirlige und aufgeweckte Mädchen auf seinen Schoß geklettert war.
„Was denkst du, meine Liebe?“, sprach er sie an und sah sie zusammenzucken. Offenbar war sie mit ihren Gedanken weit fort gewesen.
„Ich werde Emily begleiten.“
„Darüber bin ich froh. Sie ist sehr zart und könnte während der langen Überfahrt und in der ersten Zeit in der Fremde ihre Schwester an ihrer Seite gebrauchen.“
„Sie meinen, sie braucht einen Beschützer!“ Lachend drehte Catherine sich um.
Frederick zwinkerte ihr zu. Er liebte ihre Unbekümmertheit, wenngleich ihr Hang zu unbedachten Entscheidungen und ihr Übermut ihm etwas Sorge bereiteten. Doch er hatte die Tochter seiner zweiten Frau, die er über alle Maßen geliebt hatte, über viele Jahre hinweg wie den Sohn erzogen, der ihm verwehrt geblieben war. Deshalb trug er eine nicht geringe Mitschuld an diesen Charaktereigenschaften.
„Ich würde euch gern je ein Mädchen mitgeben, dazu einen männlichen Begleiter …“, sagte er und trank erst einmal einen Schluck.
„Aber?“, fragte Catherine nach, setzte sich in einen bequemen Sessel und wollte wie ein Mann die Beine übereinanderschlagen. Allerdings hinderte das enggeschnittene Rockteil des hoch taillierten Kleides sie daran, sodass sie züchtig die Füße nebeneinanderstellte.
„Die Sklaverei ist in England verpönt. Außerdem kann ich hier kaum eine Hand entbehren.“
Catherine neigte den Kopf und sah ihn von unten herauf an. Eine kleine Falte hatte sich über ihrer Nasenwurzel gebildet. Ob sie ahnte, wie schlecht es um die Plantage stand? Der Krieg, die britische Blockade … er war darauf angewiesen, dass sowohl die Verbindung zwischen Emily und Stafford als auch die zwischen Catherine und dem englischen Adeligen ihm neue Märkte, neue wirtschaftliche Möglichkeiten eröffneten – spätestens, wenn der Krieg endlich vorüber war.
„Emily fühlt sich durchaus zu Mr Stafford hingezogen“, sagte Catherine in nachdenklichem Tonfall. Dies verriet Frederick, dass ihre Gedanken in die richtige Richtung gingen.
„Emily hat eine sanfte Seele. Sie ist froh, dass Mr Stafford ein zartfühlender Mann ist, der auf ihre Bedürfnisse eingeht und ihr Schutz und Halt bietet“, pflichtete Frederick bei und dachte bei sich, dass Emilys Mutter ganz ähnlich gewesen war. Seine erste Ehe war von seinen Eltern, Einwanderern aus Deutschland, und den Eltern seiner Frau, ursprünglich aus der Schweiz stammend, vereinbart worden. Aus finanziellem und machtpolitischem Kalkül. Johanna und er hatten sich nicht geliebt, jedoch hatte Emilys Mutter den Wohlstand und die damit verbundenen Sicherheiten genossen, die er ihr geboten hatte. Vermutlich hätten sie sich im Laufe der Jahre gut miteinander arrangiert, doch Johanna war nach Emilys Geburt im Wochenbett gestorben. Und dann hatte er Elizabeth kennengelernt und sich Hals über Kopf in sie verliebt.
„Darf ich Sie bitten …?“, begann Catherine, allerdings unterbrach Frederick sie mit einem Heben seiner Hand. Wie so oft verstanden sie sich ohne viele Worte. Immerhin hatte er viel Zeit mit ihr verbracht, ganz anders als mit Emily. Seine ältere Tochter war wie alle Mädchen aus ihren Kreisen von der Amme, später von einer schwarzen Mummy und von Elizabeth großgezogen worden.
„Der britische Gentleman bat in seinem letzten Schreiben um eine verpflichtende Vereinbarung, was dich betraf. Ich kann ihn gut verstehen.“ Frederick lächelte Catherine liebevoll an und sie erwiderte sein Lächeln vertrauensvoll.
„Ich bin nicht darauf eingegangen, meine Liebe. Denn gleichgültig, wie sehr ich eure Verbindung begrüßen würde, ich würde dich niemals zwingen oder auch nur darum bitten, auf sein Werben einzugehen.“
„Ich danke Ihnen dafür, Vater.“
„Allerdings scheint ihm mein kleiner Wildfang gefallen zu haben. Das … gibt es wohl nicht oft!“
„Ich weiß. Und genau deshalb reise ich zu ihm.“
Frederick nickte. Damit war die Angelegenheit besprochen. Selbst in dieser Hinsicht agierte Catherine wie ein Mann. Ohne viele Schnörkel und Worte traf sie ihre Entscheidungen. Also warf er eine nächste Überlegung auf: „Wen stelle ich dir und Emily als Begleitung zur Seite?“
„First.“
„An ihn hatte ich ebenfalls gedacht, zumal er an deiner Seite die Ausbildung durchlaufen hat. Er wäre nicht nur ein treuer Diener, sondern auch ein fähiger Beschützer für meine geliebten Töchter. Er ist klug und lässt sich nicht so leicht täuschen.“
„Sie werden ihn freilassen müssen, Vater.“
„Ich gebe dir seine Freilassungsurkunde mit. Er ist ein freier Mann, sobald du ihm das Schreiben überreichst. Dazu erhält er einen großzügigen Lohn, der es ihm ermöglichen sollte, etwas mit seinem Leben anzufangen. Ich denke, das bin ich dem Jungen ohnehin schuldig.“
„Wann plant Mr Stafford seine Abreise nach Kuba?“
„In fünf bis sechs Wochen.“
Frederick sah, wie sich ein Schatten auf Catherines Gesicht legte. Offenbar hatte sie nicht mit einem so raschen Abschied gerechnet. Doch sie straffte die Schultern und nickte. Wie ein junger Mann, der auf seine erste Geschäftsreise geschickt wurde. Oder ein Soldat, der in den Krieg zog. Stark, selbstsicher und sich der Verantwortung, die auf ihm lag, durchaus bewusst.
„First und ich bringen Emily wohlbehalten in ihr neues Zuhause, Vater“, versprach sie.
„Und du kommst zurück, falls der Herr in England dir nicht zusagt. Versprich mir das!“
„Ich verspreche es.“ Catherine erhob sich, hauchte ihm einen Kuss auf die Wange und war schnell wie ein Wirbelwind aus dem Raum.
Frederick schaute minutenlang reglos auf die geschlossene Tür und spürte dem Schmerz nach, der in ihm tobte. Ihm war immer vor Augen gestanden, dass er seine Töchter nicht dauerhaft an sich binden konnte. Einem Sohn hätte er das Anwesen vermacht, aber die beiden Mädchen … Er benötigte die neuen Geschäftsverbindungen, die finanzielle Sicherheit beider Familien, in die sie einheiraten würden, um die angeschlagene Plantage wieder auf die Beine zu bringen. Sobald der Krieg endlich zu Ende war …
Doch er fühlte schon jetzt die Einsamkeit wie einen Feind in sein Herz schleichen und ahnte, dass er als einsamer Mann auf diesem kleinen, wenn auch wunderschönen Eiland sterben würde.
N
Viscount Adam Adamson warf Camden einen prüfenden Blick zu, als der sich über das Ölgemälde beugte und das junge Mädchen darauf betrachtete. Er wirkte keineswegs irritiert darüber, dass das Kind, immerhin an der Schwelle dazu, eine Frau zu werden, ein Männerhemd trug. Auch die Fechtwaffe in der Hand des Mädchens, die es an seine Schulter gelehnt hatte, schien ihn nicht weiter zu beeindrucken. Vermutlich hatten Kreaturen wie er schon eine Menge Frauenzimmer kennengelernt, die keinen Hauch von Eleganz und Sanftmut besaßen.
„Sie sagten, das Gemälde sei einige Jahre alt?“, fragte Camden und fuhr sich dabei durch das auffällig hellblonde, fast weiße Haar.
Adamson knurrte unwillig. Er wiederholte sich ungern, doch der Kerl war ein wenig schwer von Begriff. Für ihn sprach allerdings seine Mordlust, woher auch immer die stammte. Und die Tatsache, dass Adamson ihm bereits zwei andere Angelegenheiten überlassen hatte, die der Kerl zu seiner Zufriedenheit ausgeführt hatte.
„Na gut, aber an dem Muttermal kann man sie ja erkennen“, setzte der Engländer sein Selbstgespräch fort.
Adamson nickte mit einem grimmigen Zug um den ohnehin schmalen, verbissenen Mund. Genau dieses Muttermal auf der rechten Kinnlinie war auch ihm aufgefallen. Es hatte ihm verraten, wen sein Sohn zu ehelichen gedachte.
Zum ersten Mal in seinem Leben war Adamson froh über den in seinen Augen unsinnigen Kunstunterricht, auf dem sein Sohn Henry mit zunehmendem Alter immer vehementer bestanden hatte. Ohne das Ölgemälde, das Henry ihm vorgelegt hatte, um ihm seine zukünftige Braut zu zeigen, hätte er das drohende Debakel nicht rechtzeitig erkannt. Jetzt konnte er etwas dagegen unternehmen, dass ausgerechnet diese junge Frau einen Fuß auf englischen Boden setzte!
Fassungslos schüttelte er den Kopf. Amerika war wahrlich ein großes Land. Warum musste sein Sohn unter den unzähligen Menschen dort ausgerechnet auf sie treffen? Weshalb hatte er sie zu seiner Zukünftigen erkoren? Ein Desaster drohte!
Adamson zwang sich zur Ruhe. Er war doch gerade dabei, die sich anbahnende Katastrophe abzuwenden. Es würde ihn eine Menge Geld kosten, dafür zu sorgen, dass Miss Catherine Hansen auf dem Weg nach England „verlorenging“. Immerhin musste er fünf Mann losschicken, da er nur wenige Informationen über ihre Reiseroute in Erfahrung hatte bringen können.
„Kann ich auf dich zählen?“, forderte Adamson eine Entscheidung ein und rutschte auf dem gepolsterten Stuhl hinter seinem wuchtigen Schreibtisch ein Stück nach vorn. Die Halunken, die er bisher engagiert hatte, hatten bei Weitem nicht so lange gebraucht, um sich für den lukrativen Auftrag zu begeistern.
„Derjenige, der sie erwischt und ihr mitgeführtes Hab und Gut vernichtet, bekommt noch einmal eine extra Prämie?“
Wieder knurrte Adamson zustimmend. Das hatte er doch bereits deutlich genug gesagt.
„Ich breche sofort auf!“, beschloss Camden. Adamson hätte dem Kerl am liebsten einen Fußtritt verpasst, um ihn damit auf das nächste Schiff zu befördern. Die Angst, dass keiner der fünf Handlanger rechtzeitig in den Staaten ankommen würde, um die Frau abzufangen, trieb ihm einen Schweißfilm auf die Stirn. Er überreichte dem Weißblonden eine dicke Rolle Geldscheine, die dieser nachlässig in seine ausgebeulte Hosentasche schob, ehe er durch die Hintertür in den Straßen Londons verschwand.
„Lassen Sie den Nächsten rein“, gebot Adamson lautstark einem Bediensteten und sah gleich darauf einem Mann entgegen, der, obwohl noch jung an Jahren, einen nicht zu übersehenden Buckel hatte. Er stellte sich knapp als John Fraser vor. Trotz seines körperlichen Handicaps machte er einen erfreulich aufgeweckten Eindruck auf Adamson, der befriedigt nickte.
Kapitel 3
Der Wind blähte die Segel des unter spanischer Flagge segelnden Handelsschiffs und trieb es an Shutes Folly Island vorbei aufs offene Meer. Auf der Insel thronte das neu erbaute und extra verstärkte Fort Pickney, das die Einfahrt zum Hafen von Charleston bewachte. Seit einigen Stunden war kein britisches Schiff mehr gesichtet worden, jetzt galt es, die Zeit zu nutzen!
Befehle wurden gebrüllt, und die Matrosen der Santiago de Cuba reagierten zügig. Catherine, die die vergangenen Wochen dazu genutzt hatte, sich möglichst viel Wissen über das Segeln, die Navigation und das Leben an Bord anzueignen, beobachtete anhand dessen, was die Seeleute taten, ob sie die Anweisungen richtig eingeordnet hatte.
Ohne sich von den gischtgeschmückten Wellen beeindrucken zu lassen, glitt der Dreimaster dem azurblauen Horizont entgegen. Das aufwändig verzierte Heckkastell, in dem sich auch Catherines und Emilys Kabine befand, war bei diesem Schiffstyp längst nicht mehr so hoch, wie es noch vor wenigen Jahren üblich gewesen war, was dem Segler mehr Eleganz verlieh.
In weiter Ferne tauchten helle Dreiecke und Vierecke auf, die rasch größer wurden und ein Segelschiff ankündigten, das den Hafen von Charleston anzusteuern schien. Ein britisches Blockadeschiff? Oder ein Frachtschiff, das ebenfalls die Lücke nutzte, die sich ihm zum Ansteuern des Hafens bot?
Catherine streckte sich und lehnte sich gegen die dickwandige Verschanzung. Sie ignorierte es schlicht, dass der Wind Haare aus ihrer Aufsteckfrisur zupfte und den Saum ihres Kleides aufblähte, sodass ihre Knöchel unschicklich zu sehen waren. Am liebsten hätte sie ja die Schuhe ausgezogen, um die ausgewaschenen dunklen Holzbohlen unter ihren Füßen zu spüren. Mit einem Blick auf Emily und ihren Verlobten, die sich im Schutz einer der Aufbauten mit einigen anderen Reisenden unterhielten, unterließ sie das allerdings. Emily hatte sie gebeten, sich gesittet zu benehmen, damit ihr Zukünftiger kein „falsches Bild“ von ihr erhielt.