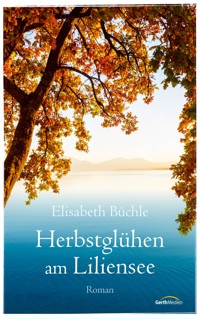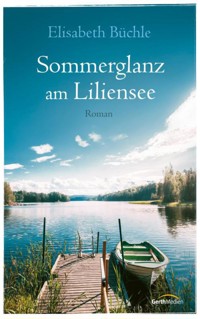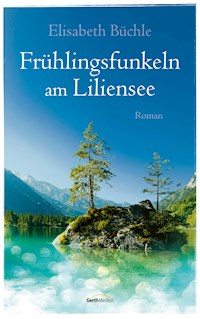13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gerth Medien
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Pattonville, Baden-Württemberg 2015: Die Eltern und Geschwister der Deutsch-Amerikanerin und ehemaligen Leistungssportlerin Hanna Jameson sind von einem Tag auf den anderen wie vom Erdboden verschluckt. Ihre Spurensuche führt Hanna in die Vereinigten Staaten. Dort trifft sie auf den charmanten Chris Thompson, der sie bei ihren Ermittlungen unterstützt. Doch kann Hanna ihm wirklich vertrauen? Denn je länger sie miteinander unterwegs sind, desto mehr Hindernisse und Gefahren stellen sich ihnen in den Weg. Schmerzlich wird der jungen Frau bewusst, dass nichts in ihrem Leben so ist, wie es scheint ... Eine spannende, rasante, aber auch romantische Geschichte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 752
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Über die Autorin
Elisabeth Büchle ist gelernte Bürokauffrau, examinierte Altenpflegerin und seit ihrer Kindheit ein Bücherwurm. Schon früh begann sie, eigene Geschichten zu Papier zu bringen. In ihren Romanen bettet sie romantische Liebesgeschichten in gründlich recherchierte historische Kontexte ein. Mit ihrem Mann und den jüngeren ihrer fünf Kinder lebt sie im süddeutschen Raum. Mehr Informationen über die Autorin unter www.elisabeth-büchle.de.
Für Jonathan Pohl
Prolog
1985
Gewonnen hat immer der, der lieben, dulden und verzeihen kann.
Hermann Hesse
Ein fernes Wetterleuchten kündigte ein Gewitter an. Der Wind schob grauschwarze Wolkentürme über den abendlichen Himmel. Für Roy Woods sah es aus, als saugten sie den letzten hellen Schimmer am Horizont auf. Schweiß lief dem Neunzehnjährigen in Strömen über das Gesicht und den Rücken. Nicht vor Angst oder Aufregung, und schon gar nicht wegen der sommerlichen Hitze, sondern vor unterdrückter Wut. Ja, er hasste sie, diese Niggerbrut! Mehr noch, seit er Matt kennengelernt hatte.
Von vorn kam ein leiser, anfeuernder Ruf. Die Truppe setzte sich gemeinsam in Bewegung. Roy war das erste Mal dabei, ebenso wie der Einundzwanzigjährige an seiner Seite. Der schlaksige Kerl keuchte laut. Offenbar hatte er Angst. Angst vor der eigenen Courage?
Roy hingegen fieberte dem Ereignis entgegen. Die weißen Gewänder und die spitz zulaufenden Kapuzen, die ihre Gesichter verdeckten, wurden vom Fackelschein schemenhaft beleuchtet. Sie waren altmodische Relikte, aber überaus wirkungsvoll. Windböen drückten die Flammen der Fackeln fauchend nach unten, verliehen der Prozession den Anschein, als würde der Todesengel sie mit seinem Atem vorantreiben.
Die Straße lag völlig verlassen vor ihnen. In dem kleinen Nest am Mississippi war um diese Uhrzeit kaum noch jemand unterwegs.
Roy wich einer Eiche und dem an ihren Ästen weit herunterhängenden spanischen Moos aus. Die Grillen im Gras verstummten, als spürten sie die Gefahr.
Ihr Ziel, das Haus eines Schwarzen, der sich zur Wahl des Bürgermeisters hatte aufstellen lassen, lag etwas abseits von den anderen Gebäuden in jener Straße. Die frisch gestrichene weiße Fassade und ein Cadillac Coupe DeVille in der kurzen Auffahrt zeugten von dem neu erlangten Wohlstand der Familie.
Roy beschleunigte seine Schritte. Sein Groll trieb ihn vorwärts. Er überholte die anderen Vermummten und gesellte sich an die Seite ihres Anführers. Heute trug auch Matt nur ein weißes Gewand, obwohl er in der Hierarchie des Klans weit über Roy stand.
Wie abgesprochen verteilten sie sich lautlos um das Haus. Roy schob mit dem Fuß ein im Gras liegendes Kinderrad beiseite. Er hatte als Kind keines besessen; dafür hatte das Geld nicht gereicht. Plötzlich richtete sich sein Hass sogar gegen das Rad. Er holte aus, wollte es am liebsten zertreten, wie man einen Käfer zertritt.
„Lass das! Sei leise!“, raunte Matt ihm zu. Er klang vielmehr belustigt als böse. „Du bist ganz heiß darauf, nicht?“
„Ich will sie brennen sehen!“, stieß Roy unkontrolliert hervor. Er wusste selbst nicht, was oder wen er meinte. Das Haus und das Auto? Oder die Schwarzen im Haus? Er spürte nur jenes lodernde Feuer in sich, das danach schrie, jemanden zu bestrafen. Irgendjemand musste leiden, sollte büßen. Für sein und Matts Leid.
Matt nahm Roy die Fackel ab, reichte sie einem anderen Klanmann und drückte ihm stattdessen etwas Kaltes in die Hand. Verzückt betrachtete Roy die Pistole. Matt gab ihm seine Waffe! So viel Vertrauen, ja, Zuneigung bekam er nicht einmal von seinem Vater … schon lange nicht mehr.
Plötzlich sprang die Haustür auf. Da stand er: Der Mann, dem all ihr Hass galt. Zumindest in dieser schwülen, gewittrigen Nacht. Er war ein großer, stämmiger Schwarzer in einem vornehmen Anzug. Roys Wunsch, ihm diesen vom Leib zu reißen, wuchs in Sekundenschnelle.
„Verschwindet!“, rief der Mann den weißen Schemen zu.
Roy wusste, dass der Schwarze ein Jagdgewehr im Haus hatte, doch das trug er nicht bei sich. Was für ein Idiot! Sah er denn nicht, dass sie in der Überzahl waren? Hinter der breiten Gestalt bewegte sich jemand. Seine Frau? Eines seiner Kinder? Roy war das egal.
„Verschwindet. Die Cops sind schon unterwegs.“ Hoch aufgerichtet stand der Schwarze da. Viel zu stolz. Roy biss vor Wut die Zähne zusammen, bis sie knirschten.
Ein Mann hinter ihm lachte glucksend auf. Vermutlich der ortsansässige Deputy. Aus dem Augenwinkel beobachtete Roy, wie sich der andere Neuling entfernte. Er huschte zwischen zwei Häuser und tauchte hinter einigen Magnolienbüschen unter, fast so, als wäre er auf der Flucht. Vor wem? Vor seiner Courage? Roy grinste hämisch. So ein Weichling!
„Schieß!“, feuerte Matt Roy an und stieß ihm auffordernd in die Seite. Roy hob die Waffe. Nun zögerte er doch. Er sollte schießen? Auf den Schwarzen?
„Feigling!“, sagte Matt mit einer Stimme, die Roy bei ihm noch nie zuvor gehört hatte. Sie war kalt wie Eis.
Ihr Anführer entwand ihm die Waffe, zielte und drückte ab. Routiniert. Es war nicht das erste Mal, dass er auf einen Menschen schoss.
Ein Feuerblitz und ein lauter Knall zerrissen die Nacht. Der Schwarze taumelte rückwärts und prallte gegen den Türrahmen. Er blieb auf den Beinen. Trotzig. Kämpferisch.
„Jetzt du. Beweise mir, wie ernst es dir ist.“ Matt legte Roy die Waffe in die Hand. Er zielte. Sein Arm zitterte.
„Ich dachte, du hasst sie.“ Matts Stimme klang frostig. Enttäuscht und vorwurfsvoll. Er würde sich von Roy abwenden. Wie es bereits sein Vater getan hatte! „Du bist –“
Roy drückte ab. Mehrmals. Wie im Rausch. Der Körper an der Tür zuckte und stürzte. Eine Frau schrie gellend auf. Ihre Silhouette erschien im orangefarbenen Fackelschein. Ein Blitz zischte über das Haus hinweg, und das anschließende Donnern brachte die Erde zum Beben. Roys nächster Schuss traf die Frau.
Neben ihm jubelte Matt schrill auf. In seinen Augen, dem Einzigen, was von ihm zu sehen war, schien ein Feuer zu lodern. Er entriss Roy die Waffe und lud sie nach. Seine Hände zitterten nicht.
Aus dem Augenwinkel heraus entdeckte Roy kleine Schattengestalten an der Tür. Es waren drei Kinder, die sich neben ihre Eltern warfen. Ein durchdringendes Sirenengeheul ließ Roy herumwirbeln. Er runzelte die schweißnasse Stirn. Kamen die Geräusche etwa aus unterschiedlichen Richtungen? Das war nicht nur ein Wagen!
Um ihn herum fielen die Fackeln zu Boden. Die weißen Gestalten huschten davon, als hätten sie dies eigens trainiert, um von einem Augenblick auf den anderen in der Dunkelheit der Nacht unterzutauchen. Immer mehr Blitze zuckten über den Himmel. Rotes Blut schimmerte in ihrem grellen Lichtschein auf. Unter die Schreie der Kinder mischte sich das Quietschen von Autoreifen. Roy war allein, die Waffe lag schwer in seiner Hand. Er hatte nicht schnell genug reagiert. Wo kamen nur all die Männer her, die ihre Schusswaffen unmissverständlich auf ihn richteten? Roys Blick streifte die Magnolienbüsche. Ob der andere Neue …? Waren sie verraten worden?
Roy hatte keinen Einblick in die Planung gehabt, schließlich war er nur ein Mitläufer gewesen …
Matt jedenfalls hatte ihn verraten!
TEIL 1
17. Juni 2015
Für einen Versuch ist es niemals zu früh, für eine Aussprache niemals zu spät.
John F. Kennedy
1. Kapitel
Die tiefen Töne der Türglocke drangen bis vor die Eingangstür. Hanna schob den Griff ihres Trolleys ein und bereitete sich auf die stürmische Begrüßung ihres achtjährigen Halbbruders Carl vor. Nichts geschah.
Irritiert betrachtete sie das kitschige Namensschild, eine Katze aus Salzteig und rosa Tüll, das an der Milchglasscheibe hing. Eigentlich sollte darauf Familie Jameson stehen, doch das Feld für den Namen war leer. Außerdem entsprach das Teil so gar nicht dem Geschmack ihrer Stiefmutter Stephanie, war unnötiger Nippes ihr doch ein Gräuel. Womöglich war die Salzteigkatze ein Willkommensgeschenk gewesen und würde hier nun so lange hängen bleiben, wie es der Anstand erforderte. Oder bis Carl sie endlich mit seinem Fußball traf.
Die Sechsundzwanzigjährige drückte ein zweites Mal auf den Klingelknopf. Offenbar waren weder Stephanie noch Carl oder die zwölfjährige Claudia zu Hause.
Und Henry, ihr Vater? Obwohl die IT-Firma, für die er arbeitete, darauf gedrängt hatte, dass er zügig auf die frei gewordene Stelle in Deutschland wechselte, war er nicht gemeinsam mit der Familie umgezogen. Irgendetwas hatte ihn in New York aufgehalten. Inzwischen, so nahm Hanna an, musste er aber nachgereist sein.
Es war ruhig in Pattonville, der Kleinstadt nördlich von Stuttgart, die einst von der US-Armee für ihre Offiziere und Soldaten erbaut worden war, nun aber zivil genutzt wurde. Trotz des reichlich überstürzten Umzugs nach Deutschland hatte die Familie Jameson von dem Konzern, für den Hannas Vater arbeitete, ein zweckmäßiges und zugleich hübsches Haus organisiert bekommen. Vor etwas mehr als einer Woche hatte Hanna ihrer Familie beim Einzug in den Neubau geholfen, ehe sie in die Einsamkeit der Alpen geflüchtet war. Sie hatte eine Auszeit ohne moderne Medien oder sonstigen Kontakt zur Außenwelt dringend nötig gehabt. Einfach mal abschalten – nur sie und die erholsame Stille der Natur. Ihre Familie schien jedoch vergessen zu haben, dass sie am heutigen Tag zurückkehren würde.
Enttäuscht runzelte Hanna die Stirn, zog das Haargummi in ihrem hellblonden Pferdeschwanz fester und lauschte auf das Rascheln der Blätter im Wind. Die Bäume auf den Grundstücken der älteren Häuser brausten kräftig, reckten sie ihre Zweige doch weit in die Höhe, wo der auffrischende Wind sie umschmeichelte.
Hanna sah sich ein wenig hilflos um. Sie hatte nicht damit gerechnet, vor verschlossenen Türen zu stehen. Ob sie ihr Gepäck hinter den Mülltonnen unter der Treppe stehen lassen konnte, um sich die Wartezeit auf dem benachbarten Golfplatz zu vertreiben?
Ein klickendes Geräusch ließ sie aufhorchen. Erfreut, weil ihr doch noch jemand öffnete, wandte sie sich zur Haustür um. Vor ihr stand eine rundliche grauhaarige Dame mit auffälligen Altersflecken im Gesicht, einer Hornbrille auf der winzigen Nase und wachen, aber misstrauisch dreinblickenden braunen Augen. Hanna vermutete in ihr eine Nachbarin, die auf Carl aufpasste. Diese musste den Kopf weit in den Nacken legen, damit sie der 1,85 Meter großen Hanna ins Gesicht sehen konnte.
„Hanna Jameson“, stellte sie sich vor. „Ich dachte schon, es wäre niemand da.“ Sie griff nach dem Trolley und wollte an der Frau vorbei in den quadratischen Flur treten. Der pinkfarbene Bodenläufer auf den schwarzen Fliesen irritierte sie nachhaltig. War dies ein weiteres Willkommensgeschenk der neuen Nachbarn oder der deutschen Arbeitskollegen ihres Vaters, das Stephanie sicher schrecklich fand, anstandshalber aber eine Zeit lang nutzen würde?
Die Frau schnalzte erbost mit der Zunge und versuchte, Hanna die Tür vor der Nase zuzudrücken.
„Was fällt Ihnen ein, einfach hier hereinzustürmen?!“, rief sie mit schriller Stimme und in einem breiten schwäbischen Dialekt, sodass Hanna erheblich Mühe hatte, ihre Worte zu einem sinnvollen Satz zusammenzufügen. Panik flackerte in dem greisen Gesicht auf. Verwirrt über die heftige Reaktion der Frau wich Hanna einen Schritt zurück.
„Entschuldigen Sie bitte. Ich bin Hanna, Henrys Tochter.“
„Ich kenne keinen Henry!“, bellte die Frau durch den Türspalt und legte dabei geräuschvoll eine Sicherheitskette vor.
Ihre Worte ergaben keinen Sinn für Hanna. Ob sie die Frau falsch verstanden hatte? „Stephanie Jameson ist meine Mutter – Stiefmutter. Carl und Claudia sind meine Halbgeschwister –“
„Kenne ich alle nicht!“
Hanna presste die Lippen zusammen und trat unwillkürlich eine Stufe tiefer. War ihr Deutsch denn so schlecht? Oder stand sie gar vor der verkehrten Tür?
Sie warf einen prüfenden Blick auf die Hausnummer, die jedoch stimmte. Zudem erinnerte sie sich gut an das moderne graue Flachdachhaus mit dem quadratischen roten Vorbau, in dem sich das Esszimmer befand. Nur dieses alberne Willkommensschild und der pinkfarbene Läufer waren Fremdkörper.
Hanna runzelte die Stirn. Sie selbst war offenbar ebenfalls ein Fremdkörper?!
„Ich …“ Angestrengt blickte sie die verlassen daliegende Straße entlang. Sie war sich sicher, hier an der richtigen Adresse zu sein. Sie erinnerte sich noch genau daran, wie das Taxi am Tag ihrer Ankunft neben der niedrigen Hecke angehalten hatte. Der Fahrer war über den Bordstein gestolpert und hatte den Koffer ihrer Stiefmutter mit den wenigen Habseligkeiten, die man im Flieger mitnehmen konnte, fallen lassen. Und Carl hatte gleich am ersten Tag einen Ball in den üppig blühenden Jasminstrauch geschossen, worauf ein Großteil der betörend duftenden Blüten zu Boden gefallen war. Claudia hatte sich ein paar Minuten später auf das Rad geschwungen, das in der Garage für sie bereitstand, um das nahe gelegene Stadionbad Ludwigsburg zu suchen. Dabei war sie vorn an der Kreuzung beinahe in einen Lkw geknallt. Stephanie war daraufhin panisch zu ihr gerannt …
„Entschuldigen Sie bitte“, wagte Hanna einen weiteren Versuch, das Missverständnis aufzuklären. „Hier wohnen doch die Jamesons. Wir –“
„Hier wohne ich! Ich kenne keine Tscheimasonns!“
Die Frau knallte ihr die Tür vor der Nase zu, und die rosafarbenen Tüllbänder flatterten protestierend auf. Hanna stutzte. Hatte die schlafende Salzteigkatze kurz geblinzelt, als wollte auch sie sehen, wer da – offenbar völlig neben der Spur – vor ihrer Tür stand?
Hanna verharrte reglos auf der Treppe. Ihre Gedanken schlugen Kapriolen und die durchtrainierten Muskeln der Siebenkämpferin, die für die USA sogar bei internationalen Wettkämpfen angetreten war, schienen zu vibrieren. Obwohl sie im Schatten stand, liefen Hanna plötzlich Schweißperlen über den Rücken.
Irgendwann griff sie mit zitternder Hand nach ihrem Trolley. Sie konnte hier ja nicht einfach Wurzeln schlagen. Also würde sie zur Bushaltestelle zurückgehen und von dort abermals den Weg zum neuen Haus ihrer Familie einschlagen. Vielleicht gab es ja eine Straße, die ganz ähnlich hieß, und womöglich stand dort ein Gebäude gleicher Bauart. Vielleicht hatte sie nur etwas verwechselt.
Unsicheren Schrittes, da sie sich eigentlich sicher war, vor dem richtigen Haus zu stehen, tapste sie die Stufen hinunter. Im Vorbau des Hauses wurde ein Fenster aufgerissen.
Hanna atmete tief durch. Würde Carl jetzt den Kopf herausstrecken und sie auslachen, weil sie auf seinen Trick hereingefallen war? Einen Spaß, den die ältere Dame mitgespielt hatte, da Carl mit seinem kindlich-fröhlichen Charme jeden um den Finger zu wickeln verstand?
Die grauhaarige Frau lehnte sich mit den Ellenbogen auf den Fenstersims. Ihre Augen blickten nach wie vor zutiefst misstrauisch drein. Aber offenbar hatte sie Mitleid mit Hanna, vermutlich, weil sie im Augenblick wie eine streunende Katze wirkte.
„Ich wohne erst seit einer Woche hier. Die Familie, die Sie suchen, hat vielleicht vor mir hier gewohnt?“
Hanna schüttelte den Kopf. Vor wenigen Tagen hatte sie genau an der gleichen Stelle gestanden und das Haus einer ersten Betrachtung unterzogen, es mit ihrem bisherigen Zuhause verglichen. Stephanie hatte unglücklich ausgesehen. Obwohl ihre Stiefmutter aus Deutschland stammte, hatte sie sich sichtlich unwohl gefühlt, zumal der in aller Hast beladene Schiffscontainer noch Wochen brauchen würde, bis er in Deutschland eintraf und ein Stückchen „Heimat“ mitbrachte …
Hannas Überlegungen flatterten wie ein Schwarm aufgescheuchter Krähen umher. Wie vor einem sportlichen Wettkampf zwang sie sich durch mehrmaliges tiefes Durchatmen zur Ruhe.
„Wann genau sind Sie eingezogen?“, wagte sie zu fragen.
„Am Dienstag, den neunten Juni. Ich weiß das so genau, weil ich einen Tag später Geburtstag hatte. Ich bin sechsundsiebzig geworden. Diese Wohngegend ist sehr beliebt. Es war ein Geschenk, das Haus zu bekommen!“
Hanna nickte, obwohl sie lieber den Kopf geschüttelt hätte. Sie waren am Samstag zuvor eingezogen. Über das Wochenende hatte Stephanie sich notdürftig einrichten und am Montag die Anmeldung im zuständigen Meldebüro ausfüllen wollen. Henry hätte inzwischen ebenfalls eintreffen sollen. Es war geplant gewesen, dass Carl und Claudia sofort zur Schule gehen sollten, um ihre neuen Klassenkameraden und Lehrer kennenzulernen und sich vor den Sommerferien schon ein wenig an das deutsche Schulsystem zu gewöhnen. Henry war, was die Schulbildung seiner Kinder anbelangte, extrem ehrgeizig.
Warum also wohnte jetzt plötzlich diese Frau hier? Hatte ihrem Vater die Gegend oder das Haus nicht zugesagt? So anspruchsvoll war er diesbezüglich nicht. Eigentlich hatte ihm der Gedanke gefallen, in Deutschland in einer Stadt zu wohnen, die vom US-Militär gegründet worden war. Und er hatte sich auf den nahe gelegenen Golfplatz gefreut. Außerdem würde er nur für ein paar Jahre bleiben, wie es auch schon bei seinem ersten Aufenthalt in Deutschland der Fall gewesen war.
Wollte er doch näher an seinem Arbeitsplatz wohnen? Vielleicht in Stuttgart, wo er damals die Mutter von Helena – Hannas Zwillingsschwester – und ihr kennengelernt hatte? Aber weshalb hatte er der Nachmieterin dann keine Nachricht für Hanna hinterlassen?
„Danke“, murmelte Hanna und wandte sich wieder ab. Sie zog den Trolley hinter sich her, der sich plötzlich anfühlte, als befände sich ihr ganzes Leben darin. Als das Haus außer Sichtweite war, blieb sie stehen. Peinlich berührt, da sie die Frau belästigt, ja, womöglich sogar verängstigt hatte, strich sie sich mit den Fingerspitzen über den Mund. Mit der anderen Hand tastete sie nach dem Mobiltelefon in ihrem Rucksack. Sie hatte es zu Beginn ihrer Auszeit, noch auf der Zugfahrt in Richtung Füssen, ausgeschaltet. Auf der Rückfahrt hatte sie es wieder einschalten wollen, doch es hatte ihr bereits nach wenigen Sekunden den Dienst versagt, da der Akku leer gewesen war.
Sie musste jetzt dringend ihr Telefon aufladen und dann ihren Vater anrufen. Irgendwo musste ihre Familie ja abgeblieben sein …
***
Hanna stützte beide Ellenbogen auf die Tischplatte und vergrub ihr Gesicht in den Händen. In der Bar roch es nach Schweiß, Alkohol und einem aggressiven Reinigungsmittel. Sie zitterte am ganzen Leib, wie damals, als sie kurz vor den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Moskau krank geworden war. Selbst der leichte Anflug eines Schwindelgefühls erinnerte sie augenblicklich an das, was sie in jenen Tagen schachmatt gesetzt und von der Teilnahme am größten Sportevent abgehalten hatte, für das sie jemals nominiert worden war.
Hanna stöhnte auf. Sie fror erbärmlich, brachte aber nicht die Kraft auf, ihren Trolley zu öffnen und eine Trainingsjacke herauszuholen. Die Bar, in der sie ihr Smartphone hatte aufladen dürfen, leerte sich allmählich. Es musste demnach weit nach Mitternacht sein.
Am dunklen Holztresen unter der indirekten Deckenbeleuchtung saßen Schulter an Schulter noch drei junge Männer. Wenn einer von ihnen vom Hocker kippte, so befürchtete Hanna, würden die beiden anderen ihm unweigerlich folgen. Wie Dominosteine, die man anstieß.
In ihrem Kopf sah es nicht besser aus. Ein verwirrender Gedanke stieß den nächsten an. Sie fielen einfach nur um. Wie leblose Steine – ergaben keinen Sinn, fanden keinen Halt.
Hanna hatte zu später Stunde in der Böblinger Niederlassung des IT-Konzerns angerufen, tatsächlich jemanden erreicht und nach ihrem Vater gefragt. Die Antwort war irritierend ausgefallen. Anscheinend hatte Henry den Flug von New York nach Stuttgart kurzfristig storniert.
Hanna schloss erschöpft die Augen. Die Zeit der Erholung in den bayrischen Alpen schien bereits Wochen zurückzuliegen, nicht erst einen einzigen Tag. Sie fragte sich, weshalb plötzlich alles nur noch im Eiltempo ablief. Das Angebot an ihren Vater, nach Deutschland zu wechseln, der Umzug hierher und der Einzug in das neue Haus. Und jetzt auch noch sein überraschender Rückzieher und dann: nichts mehr.
Offenbar hatte sich im Laufe weniger Tage ihre kleine Welt auf den Kopf gestellt – um sich nun in Luft aufzulösen? Einschließlich ihrer Familie?
Hanna hatte anschließend beim Hauptsitz des Unternehmens im US-Bundesstaat New York angerufen. Heidi, eine der bisherigen Assistentinnen ihres Vaters, hatte ihr mitgeteilt, dass Henry doch jetzt in Deutschland arbeite. Eine andere Information habe sie nicht.
Zum wiederholten Mal klickte Hanna die Liste der verpassten Anrufe auf ihrem Telefon durch. Am Montagmorgen um kurz vor acht Uhr, zwei Tage nach ihrem Umzug nach Pattonville, hatte ihre Halbschwester Claudia innerhalb einer halben Stunde 18-mal versucht, sie zu erreichen. Seitdem hatte es kein Lebenszeichen mehr von ihr gegeben. Kein entgangener Anruf. Keine SMS. Nur Schweigen.
Ihre Zwillingsschwester Helena, die in den USA geblieben war, hatte tags darauf 68-mal angerufen, einen Tag später 102-mal und am dritten Tag 209-mal. An jedem dieser Tage hatte Helena ihr auch eine SMS geschickt, allerdings gab der Inhalt nicht viel her: Ruf an! Mehr nicht.
Hanna hatte jeden einzelnen von Helenas Anrufen gezählt und ärgerte sich nun, dass sie die Mailbox nicht eingeschaltet gehabt hatte. Sie schüttelte den Kopf. Sie hatte ihrer Familie doch gesagt, dass sie nicht erreichbar sein werde – und wolle. Sie hatte ausspannen wollen, loslassen … und nun überrollte sie das Chaos. Und das nur, weil sie ihr Telefon ausgeschaltet gehabt hatte?
Tonlos las sie die einzige andere Nummer auf ihrem Display ab. Der Anruf war ebenfalls aus den Staaten gekommen, allerdings sagte ihr die Nummer nichts. Vermutlich wieder jemand, der „Enrico“, den Vorbesitzer ihrer neuen Nummer, hatte sprechen wollen.
Hanna schob das Smartphone von sich weg, als hätte sie einen Feind vor sich. Es klackte leise, als es gegen ihr längst leer getrunkenes Wasserglas stieß. Aus einer durch spiegelnde Glas- und Metallwände abgeteilten Nische war ein Kichern zu vernehmen. Dort saß ein Pärchen, das die Zeit vergessen hatte. Bis auf jenes Paar, die drei Dominosteine, den müde dreinblickenden Barkeeper und sie selbst hatte sich der in blaues Licht getauchte Raum mit dem Mix aus alten Holzmöbeln und modernen Stahlkonstruktionen inzwischen geleert. Wie lange sie hier wohl noch sitzen konnte, ehe man sie rauswarf?
Hanna riss die Augen auf, schnappte sich ihr Telefon und wählte erneut Stephanies Nummer. Nichts. Nicht einmal die Mailbox. Nur diese nervtötend freundliche Stimme, die ihr sagte, dass der gewünschte Teilnehmer nicht zu erreichen sei.
Hanna wusste nicht, wie oft sie die Nummern von Henry, Stephanie und Claudia nun schon gewählt hatte. Immer war ihr Bemühen vergeblich gewesen. Es war, als hätten die Anschlüsse nie existiert. Als hätte ihre Familie nie existiert. Bei Helena war es das Gleiche, und dabei hatte diese sie doch per SMS um einen Rückruf gebeten.
Das war einfach nur verstörend.
Hanna hatte sich niemals zuvor so hilflos und allein gefühlt. Nicht damals, als sie miterleben musste, wie ihre Teamkolleginnen nach Moskau flogen und sie – eine der Medaillenhoffnungen im Siebenkampf – zu Hause bleiben musste. Nicht, als ihr Vater ihr und Helena erklärt hatte, dass ihre Mutter unglücklich gestürzt und an ihren Verletzungen gestorben war. Nicht, als Henry kurz darauf beschlossen hatte, in die Staaten zurückzukehren, obwohl seine Frau Andrea hier beerdigt war. Und auch nicht, als Stephanie, einst Andreas beste Freundin, die sie in die Staaten begleitet hatte, um für die Zwillinge da zu sein, ihnen eines Abends offenbart hatte, dass sie und Henry heiraten wollten …
Das Klingeln ihres Mobiltelefons schreckte Hanna auf. Sie starrte mit weit aufgerissenen Augen das hell erleuchtete Display an und sah zu, wie es durch die Vibration langsam über die glatte Tischplatte rutschte. Dabei registrierte sie eine ihr unbekannte Zahlenfolge, bei der es sich jedoch nicht um diese eine fremde Nummer handelte, die sie in den vergangenen Stunden zigmal gelesen hatte.
Hastig griff sie nach dem weißen Gerät, das ihr beinahe aus den plötzlich schweißnassen Fingern glitt. Sie nahm das Gespräch an, und ihre Hand zitterte, als sie das Telefon an ihr Ohr drückte.
„Ja?“ Mehr als ein Krächzen brachte sie nicht zuwege.
„Hanna, bist du das?“
Sie runzelte die Stirn. Die männliche Stimme kam ihr vertraut und zugleich doch fremd vor. Sie hatte mit einem Anruf ihres Vaters gerechnet oder mit einem von Stephanie oder Claudia. Es hätte sie auch nicht gewundert, wenn Helena am Apparat gewesen wäre. Immerhin hatte Hanna mehrmals versucht, ihre Schwester in Charleston zu erreichen.
„Hanna?“ Der Mann klang verunsichert. Jedoch bei Weitem nicht so, wie sie es war. „Dein Vater hat mir vor drei Wochen deine Nummer –. Er meinte, du würdest nach Deutschland kommen und –.“
„Wer ist denn da?“, fragte Hanna, obwohl ihr die eigentümliche Angewohnheit des Anrufers, nur in Satzfragmenten zu sprechen, dies bereits verraten hatte. Sie kniff die Augen zusammen, als sie den Barkeeper auf sich zukommen sah. Gleich würde er sie auffordern zu gehen. In die dunkle Nacht hinaus. In die Straßen einer Stadt, der sie vor siebzehn Jahren den Rücken gekehrt hatte und die sie nicht mehr wiedererkannte, die ihr völlig fremd war. Dennoch hatte es sie von Pattonville nach Stuttgart gezogen, und dort war sie in dieser Bar gestrandet. Wie ein orientierungsloser Wal an einer Küste. Aber immerhin stammte ihre leibliche Mutter von hier, und bis zu ihrem tragischen Unfalltod hatten sie und ihr Ehemann Henry mit den Zwillingen Hanna und Helena hier in Stuttgart gelebt. Plötzlich fühlte Hanna sich wieder wie damals, wie das kleine Mädchen, dem man die Mutter genommen hatte: verraten.
***
„Ich bin es, Kevin.“
„Kevin …?“ Es war nicht so, dass Hanna nicht wusste, wer Kevin war. Sie spürte vielmehr einen Anflug von Wut in sich aufsteigen. Kevin war der Grund gewesen, weshalb sie mit dem neuen Smartphone auch eine neue Nummer hatte haben wollen. Jene Nummer, die noch immer irgendwelche Leute anriefen, weil sie „Enrico“ sprechen wollten … Wie kam ihr Vater dazu, diese Nummer an Kevin weiterzugeben – und ihm zu verraten, dass sie für einige Zeit in Pattonville leben und in Stuttgart trainieren würde? Ausgerechnet Kevin, der ebenfalls eine Stelle in Deutschland angenommen hatte – und zwar, nachdem Hanna ihm klipp und klar gesagt hatte, dass sie ihn nicht liebe und er damit aufhören solle, ihr Blumen und Schokolade zu schicken wie ein Galan aus den Zwanzigerjahren. Und dass er sie nicht länger mehrmals am Tag anrufen dürfe.
Henry hatte nie verstanden, weshalb sie Kevin eine Abfuhr erteilt hatte. Schließlich war der Dreißigjährige doch genau der Typ Mann, den er sich als Schwiegersohn wünschte: intelligent, strebsam, ihm, dem Schwiegervater in spe, treu ergeben, häuslich, … langweilig.
Und aufdringlich, fügte Hanna noch hinzu. Allerdings kam sie nicht umhin, eine Spur Erleichterung zu verspüren. Es war eine vertraute Stimme, die sie da hören durfte. Ein Stück … Heimat?
Das Gefühlschaos in ihrem Inneren nahm zu. Der Barkeeper hatte ihr Glas mitgenommen, ihr die Rechnung dagelassen und dabei gleich den Tisch abgewischt. Eine verbale Aufforderung, dass sie endlich gehen solle, hätte kaum deutlicher ausfallen können.
Das Pärchen war bereits verschwunden, die Dominosteine wankten in diesem Moment aneinandergekrallt an ihr vorbei zur Tür, wo ein Gerangel entstand, weil sie nicht nebeneinander durch den Türrahmen passten.
„Hallo, Kevin“, sagte sie lahm, gleichzeitig wühlte sie in ihrem Rucksack nach dem Geldbeutel.
„Ich weiß, es ist mitten in der –. Ich komme gerade von der Arbeit.“
Hanna verdrehte die Augen. Der IT-Spezialist hatte offenbar wieder einmal die Zeit vergessen. Genau das, was Henry an dem strebsamen Kevin so toll fand, was jedoch jede Ehefrau verärgern würde. Andererseits kannte sie den Ehrgeiz, der dahintersteckte, dieses „sich im Tun verlieren“ selbst nur zu gut. Wie oft hatte sie ihre Trainingseinheiten überzogen …?
„Eigentlich hatte ich vor, dir nur eine SMS –, weil Henry gesagt hat, du würdest heute aus dem Urlaub –.“
Hanna biss die Zähne zusammen. Das zumindest hatte ihre Familie also nicht vergessen, wenn sie schon sie selbst vergessen hatten. Hier in der Fremde.
„Doch dann ist mein Finger wie von allein –. Ich wollte einfach deine Stimme –.“ Unüberhörbar hatte Kevin seinen eigentümlichen Tick, kaum einen Satz zu Ende zu formulieren, noch immer nicht ablegen können.
Hanna hatte bis jetzt nicht wirklich viel gesagt, doch es tat ihr unendlich gut, seine Stimme zu hören. Sie war ein Teil ihrer Vergangenheit. Vertraut. Irgendwie beruhigend.
Sie war nicht allein.
„Kevin? Weißt du, wo meine Familie steckt?“
Offenbar verschlug ihre Frage dem Mann für einen Augenblick die Sprache. Seine Gegenfrage bewies jedoch die ihm eigene schnelle Auffassungsgabe: „Du warst in ihrem neuen Haus und hast sie nicht –? Obwohl sie wussten, dass du –?“
„Sie wohnen nicht mehr dort.“
Es dauerte geraume Zeit, ehe Kevin reagierte: „Sie sind schon wieder umgezogen?“
„Ich weiß es nicht. In dem Haus wohnt jetzt eine ältere Dame, die meine Familie nicht kennt. Sie ist drei Tage nach dem Einzug von Stephanie und den Kids dort eingezogen.“
„Drei …? Okay, das ist –. Du hast sicher schon versucht, sie anzurufen, oder?“
„Ich bekomme immer nur zu hören, dass die Teilnehmer nicht erreichbar sind.“
„Stimmt. Ich habe es bei Henry auch schon –. Ich dachte aber, es liegt daran, weil er entweder im Flieger –. Oder weil er zu einem deutschen Anbieter gewechselt hat.“
Der Barkeeper baute sich mit in die Hüften gestemmten Händen vor Hanna auf. Das sah nicht weiter bedrohlich aus, war der Kerl doch gut fünfzehn Zentimeter kleiner als Hanna und so mager, als ernähre er sich ausschließlich von Wasser mit Zitronenscheiben. Dennoch legte sie eilig zwei der ihr fremden Euroscheine auf den Tisch, hängte sich den Rucksack über, zerrte den Trolley hinter sich her und stand gleich darauf auf einer von Straßenlaternen erhellten, völlig verlassenen Straße. Sie war schlicht obdachlos.
„Wo bist du?“, fragte Kevin passenderweise.
„In einem Albtraum?“ Hannas Stimme klang dünn. Ihr Nervenkostüm war noch viel dünner. Die Tage der Erholung, auf der Suche nach einem Plan für die Zukunft, rückten in ihrem Empfinden noch weiter in die Vergangenheit.
„Kleines, das lässt sich sicher alles erklären und löst sich rasch –“, sagte Kevin beschwichtigend. „Sag mir, wo du bist, und ich hole dich –.“
Hanna zog die Nase kraus. Wollte sie das? Sich ausgerechnet von Kevin helfen lassen?
Das Zuknallen der Tür hinter ihr und ein energisches klackerndes Geräusch, als der Schlüssel im Schloss umgedreht wurde, machten ihr ihre Notlage nur noch bewusster. Gut, sie könnte in ein Hotel gehen … allerdings kannte sie sich hier nicht aus. Mit dem Smartphone ließe sich jedoch schnell eines finden. Sie könnte sich ein Taxi rufen …
„Hanna?“
„Ich bin noch dran.“
„Es ist eine Einladung. Ich biete dir nur meine Hilfe –. Mehr nicht. Du warst schmerzlich deutlich, als du mir gesagt hast, dass ich von dir nichts erwarten –. Glaub mir das. Trotzdem kann ich Henrys Tochter nicht allein durch die dunklen Straßen –.“
Hanna fragte sich, ob er in einem der geparkten Autos saß und ihr zusah, verwarf den Gedanken jedoch. Er war schlicht unsinnig. Die Vorstellung, dass sie ziellos umherirrte, weil ihre Familie nicht auffindbar war, war nun mal nicht von der Hand zu weisen. Obwohl sich Familien vermutlich nicht allzu häufig in Luft auflösten. Oder etwa doch?
„Ich gehe bis zur nächsten Straßenkreuzung und suche nach dem Schild mit dem Straßennamen“, gab sie schließlich nach.
„Du weißt nicht einmal, wo du –?“
„Klar, weiß ich das. Ich bin im Stuttgarter Norden.“ Nahe bei ihrer verstorbenen Mutter, doch das behielt sie lieber für sich. „Aber ich kenne den Straßennamen nicht“, erwiderte sie gezwungen freundlich. Bestimmt merkte sich Kevin selbst dahingehend jede Kleinigkeit, sie hingegen achtete nicht auf solche Details.
Gleich darauf nannte sie ihm die beiden Straßennamen an der Kreuzung.
„Rühr dich nicht von –. Ich bin in ein paar Minuten bei dir.“
„Danke, Kevin.“
Seine Antwort bestand aus einigen gebrummten Silben, die sie nicht verstand.
Zumindest etwas beruhigt bei der Aussicht, bald ein bekanntes Gesicht zu sehen, versuchte Hanna erneut vergeblich, ihren Vater, Stephanie oder Claudia zu erreichen. Jede Sekunde, die verstrich und ihr verdeutlichte, wie allein sie plötzlich dastand und wie eigenartig, ja, mysteriös das Verschwinden ihrer Lieben doch war, ließ sie dringender nach Kevin Ausschau halten. Sie war unendlich dankbar und froh über sein selbstloses Angebot. Mehr noch als damals, als sie erfahren hatte, dass er sich nach Deutschland hatte versetzen lassen und somit aus ihrem Leben verschwinden würde.
Sie warf einen Blick auf die Uhr ihres Smartphones. In Charleston war es jetzt früher Abend. Vielleicht hatte Helena inzwischen ihr Telefon eingeschaltet.
Ihre Schwester musste schließlich wissen, wo sich die anderen aufhielten, und falls nicht, war sie, Hanna, jetzt zumindest ruhig genug, um Helena nicht maßlos zu überfordern und zu erschrecken. Sie drückte das Wählzeichen, nahm das Smartphone ans Ohr und wartete.
Eine Verbindung wurde hergestellt und gleich darauf vernahm Hanna dumpfes Stimmengemurmel. Sie lachte leise auf. Glücklich. Befreit und erleichtert. Endlich ein Lebenszeichen von ihrer Schwester!
„Helena hier.“
„Schwesterherz!“ Es war mehr ein Seufzen als eine Begrüßung.
„Warte kurz. Ich bin in der Bibelstunde, gehe aber schnell nach draußen.“
„Wo bist du?“, hakte Hanna nach. Helena hegte eine Vorliebe für den Besuch außergewöhnlicher Kirchengemeinden.
„In der Mother Emanuel“, flüsterte Helena. Im Hintergrund hörte Hanna noch immer Stimmen. Sie erinnerte sich, dass ihre Schwester dort zuletzt des Öfteren gewesen war. Die Emanuel African Methodist Episcopal Church war als eine der ältesten unabhängigen afroamerikanischen Kirchengemeinden in den Südstaaten eine historisch äußerst interessante Kirche.
Hanna wartete ungeduldig darauf, dass Helena das Gebäude verließ, um frei sprechen zu können. Die Hintergrundgeräusche wurden leiser. Offenbar näherte sich ihre Schwester dem Ausgang.
„Ich bin so froh, dass du endlich anrufst. Ich muss dich dringend –“ Ein scharfer Knall ertönte, gleich darauf ein zweiter. Gellende Schreie erhoben sich zu einem surrealen Chor.
Hanna riss die Augen auf. Sie hörte Helena panisch nach Luft schnappen, dann ihren Schrei. Weitere kurze Detonationen folgten.
„Was ist los?“, brüllte Hanna in das Gerät. Die Häuser auf der gegenüberliegenden Straßenseite warfen ihren Ruf mehrfach zurück.
„Der schießt! Der schießt!“, keuchte Helena.
Über Tausende Kilometer hinweg nahm Hanna das Chaos wahr, in dem ihr Zwilling steckte. Sie schien Helenas Panik am eigenen Leib zu spüren. Ein metallischer Geschmack breitete sich in ihrem Mund aus.
„Leg dich hin!“, schrie sie ins Telefon. Die einzige Antwort war ein schwerfälliges Atmen und ein ersticktes Wimmern.
„Helena? Helena!“
„Er bringt alle um. Er hat Reverend Clementa getroffen. O Gott, er bringt sie alle um!“
„Versteck dich. Kriech unter eine Kirchenbank!“ Hanna zitterte am ganzen Leib. Sie konnte Helena nicht helfen.
Wieder ertönten Schüsse. Schreie. Gellende Rufe, von den Wänden der alten Kirche tausendfach zurückgeworfen. Als wollten alle Gläubigen, die jemals ihren Fuß in das Gotteshaus gesetzt hatten, denjenigen mit der Waffe in der Hand niederschreien.
Hanna konnte nichts anderes tun als zuhören. Ihre Gedanken formten Bitten an den, nach dem die Kirche benannt war. Immanuel – Gott ist mit uns.
Heute war das wohl nicht der Fall.
Ein eigentümliches Schleifgeräusch drang an ihr Ohr. Helenas Atem war nicht mehr zu hören. Die einzige Verbindung zu ihrer Schwester war plötzlich weg, obwohl das Telefon noch eingeschaltet war.
„Helena?!“, schrie Hanna. „Helena, sag was!“
Nichts. Nur Stille.
„Nein, sag nichts, damit du dich nicht verrätst. Atme weiter!“
Stille im Vordergrund, untermalt von Chaos, Angst, Wut und Tod.
„Helena?“ Hannas Stimme drohte zu versagen. „Atme, bitte atme weiter“, flehte sie.
Eilige, polternde Schritte waren zu hören. Hanna schloss die Augen, als könnte sie dadurch ihre Schwester unsichtbar machen. Sie bestürmte den Himmel wie niemals zuvor in ihrem Leben.
Wo war Gott? War er bei Helena?
Die Schritte verstummten. Was blieb, waren Weinen, Geschrei und Hilferufe.
Die Minuten zerrannen. Das Geheul von Sirenen wurde laut. Stiefeltritte drangen an Hannas Ohr. Sie flüsterte noch immer beschwörend, dass Helena atmen solle.
Plötzlich war die Verbindung tot.
„Helena?“, fragte Hanna. Leise. Verzagt. Ungläubig.
Sie war wieder in Stuttgart. Es war Nacht um sie herum. Nichts als Stille, und nur in der Ferne leise Motorengeräusche. Sie kauerte neben ihrem Trolley auf dem Gehweg, war klatschnass geschwitzt. Ihr T-Shirt war am Rücken weit nach oben gerutscht, weil sie an der Hauswand entlang zu Boden gesackt war. Das Telefon schmerzte an ihrem Ohr. Die freie Hand hatte sie zur Faust geballt, die Fingernägel tief in ihre Handflächen gegraben.
„Helena?“ Ein Schrei, gellend laut in Hannas Herz und gleichzeitig so leise wie der Flügelschlag eines Schmetterlings.
***
„Wie konnte das passieren?“, schrie Peter Phelps. Aufgewühlt leckte sich der Sechzigjährige mit der Zunge mehrmals über die Oberlippe, eine Angewohnheit, die Chris Thompson jetzt schon nervte, zumal er unter Kopfschmerzen litt. Und dass er Mist gebaut hatte, war ihm durchaus bewusst. Schon wieder!
Er wartete auf einen Satz wie: „Wenn das dein Vater oder deine Großväter wüssten.“ Doch dieser blieb aus, was er Phelps hoch anrechnete. Dabei war es dem Mann anzusehen, wie sehr er mit sich kämpfte, um sich zur Ruhe zu zwingen.
„Verdammter Mist!“, fluchte Phelps zum wiederholten Mal in deutlichem Südstaaten-Slang, ehe er sich schwer auf die Parkbank fallen ließ, die Ellenbogen auf die Knie stützte und vornübergebeugt auf den kleinen See starrte, an dessen Ufer sie sich getroffen hatten.
Chris, der am Baumstamm einer moosbehangenen Virginia-Eiche lehnte, stieß sich ab und setzte sich neben ihn. Das alte Holz knarrte unter seinem Gewicht. Er trieb nahezu exzessiv Sport, was man ihm ansah. Mehr noch, seit er das erste Mal Mist gebaut hatte … Er musste seinen Frust und seine Wut auf sich selbst ja irgendwo rauslassen.
Chris streckte die langen Beine von sich. Der Himmel war bedeckt und die Luftfeuchtigkeit musste bei annähernd hundert Prozent liegen. Kein Wunder, dass ihm der Schweiß aus allen Poren brach. Phelps trieb die Hitze offenbar dazu, ständig vor sich hin zu schimpfen. Chris untersagte sich jeden Verteidigungsversuch. Er war zwar nicht direkt Schuld an dem neuerlichen Desaster, aber er war vor Ort gewesen. Er war derjenige, der es hätte verhindern können … und müssen.
Der Mond kämpfte sich durch die Wolken, beschien fahl die in abendliches Blau getauchte Landschaft und entlockte den winzigen Wellen silberne Lichtblitze. Für einen Augenblick verstummten die Grillen, fast so, als zürnten sie dem Himmelsgestirn aufgrund der von ihm ausgehenden Helligkeit. Gleich darauf setzte ihr schrilles, durchdringendes Zirpen wieder ein.
Chris sah den wendigen Schatten einer nach Insekten jagenden Fledermaus über die Wasseroberfläche huschen. Vermutlich würde Phelps ihn jetzt ebenfalls auf die Jagd schicken. Und er musste als Sieger aus ihr hervorgehen, sonst sah er schwarz für sich.
„Finde ihn, Thompson. Egal, wie du es anstellst: Finde ihn!“ Aus jedem von Phelps’ Worten klang Anspannung und unterdrückte Wut.
Chris ballte die Hände zu Fäusten und setzte sich aufrechter hin. Erneut knarrte die Bank und ließ die Grillen in der unmittelbaren Nähe für einen Moment verstummen. Er spürte das Vibrieren seines Mobiltelefons, zog es aus der Tasche seiner Jeans und warf einen Blick auf das Display. Der Anruf galt ihm – und wiederum auch nicht. Stirnrunzelnd ignorierte er ihn und stand auf. Er hatte zu tun.
„Es läuft zu viel schief“, murmelte Phelps, während auch er sich erhob. „Und diese Hanna …!“ Der Mann winkte ab, schaute Chris grimmig an und joggte davon. Innerhalb von Sekunden war er im Wald verschwunden.
Chris schob seine Hände tief in die Hosentaschen und trat näher an die am Ufer auflaufenden, leise gurgelnden Wellen heran. Die im Mondlicht hell leuchtenden Kieselsteine knirschten unter seinen Laufschuhen. Allmählich verschluckte die Dunkelheit das angenehme Blau der Dämmerung, und eine neue Wolkenwand drohte damit, sich vor die einzige Lichtquelle zu schieben.
Er hatte einen Auftrag, den es möglichst schnell zu erledigen galt. Adrenalin schoss durch seinen Körper, und Chris spürte, wie neue Kraft seine Frustration vertrieb. Entschlossen drehte er dem Gewässer den Rücken zu und lief auf dem Waldweg, über den er gekommen war, zurück in die Stadt.
2. Kapitel
Kevin wendete und fuhr ein zweites Mal die Straße entlang, die Hanna ihm genannt hatte. Sie hatte verstört geklungen und erschreckend verunsichert. Vermutlich war das nicht ungewöhnlich, wenn man bedachte, dass sie ihre Familie nicht finden konnte. Dennoch: Er kannte alle Jamesons – bis auf die sanfte Helena –, immer nur selbstbewusst, tough und siegessicher. Eine Hanna, die offenbar nicht weiterwusste, irritierte ihn nachhaltig. Sie war Sportlerin durch und durch. Was sie zu leisten imstande war, imponierte ihm gewaltig. Und sie war hübsch. Sogar dann, wenn sie, was meistens der Fall war, auf Make-up verzichtete, einfache Sportkleidung trug und ihr blondes Haar zu einem Pferdeschwanz hochgebunden hatte. Genau wie ihre Zwillingsschwester hatte auch Hanna ein nahezu symmetrisches Gesicht, etwas, das selten vorkam und sie automatisch attraktiv wirken ließ.
Kevin hatte eigens für Hanna zu joggen und zu schwimmen begonnen, was ganz nebenbei auch seinen verspannten Muskeln guttat. Gleichzeitig hatte er sie mit Aufmerksamkeiten überschüttet und sich ihretwegen auf sonnenverbrannten oder im nasskalten Regen absaufenden Sportplätzen und in muffigen, ungemütlichen Sporthallen herumgetrieben. Und das nur, um sie sehen zu können und um ihr zu signalisieren, wie wichtig sie ihm war. Er hatte sie sechsmal zum Essen ausgeführt und zweimal ins Kino. Trotzdem war er bei ihr abgeblitzt.
Hannas Bitte, dass er seine Bemühungen um sie einstellen solle, war erschreckend deutlich ausgefallen, was jedoch bezeichnend für eine Jameson war. Offenbar machte keiner aus dieser Familie halbe Sachen.
Daraufhin hatte er sich gezwungen gesehen, aus ihrer unmittelbaren Nähe zu fliehen. Sein innerbetrieblicher Wechsel nach Deutschland hatte ihm geholfen, Hanna aus seinen Gedanken zu verbannen. Bis Henry, dem er in den Staaten unterstellt gewesen war, ihm während eines Telefonats gesagt hatte, dass er mit seiner Familie ebenfalls nach Deutschland zurückkehren würde und dass Hanna für einige Wochen in Stuttgart zu trainieren gedachte. Falls sie mit dem Leistungssport wirklich weitermachen wollte … Immerhin war Hanna für die Leichtathletik-WM nominiert gewesen, doch eine seltsame Magen-Darm-Erkrankung hatte sie förmlich aus den Laufschuhen gekickt. Keiner der konsultierten Ärzte hatte eine befriedigende Diagnose stellen können, und ihre Genesung hatte sich lange hingezogen. Kaum wieder auf den Beinen, hatte sie versucht, ihren Trainingsrückstand aufzuholen, um zumindest für die nachfolgenden Wettkämpfe fit zu sein. Das war ihr gelungen, allerdings nur so lange, bis sie von einem Tag auf den anderen in ein tiefes mentales Loch gestürzt war.
Kevin hatte Hannas Auf und Ab, ihre Kämpfe gegen den unsichtbaren Feind in ihrem Inneren, hautnah mitbekommen. Bis sie ihn aus ihrem Leben verbannt hatte. Nun rückte sie jedoch wieder in seine Nähe, und bis zu seinem Telefonanruf eine halbe Stunde zuvor hatte er nicht gewusst, ob er sich darüber freuen oder ärgern sollte. Selbst jetzt, auf der Suche nach ihr, spielten seine Gefühle verrückt, und er fragte sich, weshalb er sich das überhaupt antat. Warum hatte er sie kontaktiert und ihr seine Hilfe angeboten? Hatte sie ihm nicht schon genug wehgetan? Welch masochistische Veranlagung tat sich da bei ihm auf?
Kevin erreichte das Ende der Straße und bremste etwas zu ruckartig ab. Er konnte Hanna nicht finden. Hatte sie ihm den falschen Straßennamen genannt? Versehentlich oder womöglich sogar absichtlich? Vielleicht hatte es ihr zu lange gedauert, bis er von seiner Wohnung ins Parkhaus gejoggt und hierher gefahren war? Hieß das, dass sie ihn erneut hatte sitzen lassen?
Der auf diesen Gedankengang folgende Schmerz in seinem Inneren war ein alter Bekannter. Er war sanfter geworden, seit Kevin nach Stuttgart gezogen war, doch jetzt flammte er in heftiger Intensität von Neuem auf.
Wütend, obwohl er nicht wusste, auf wen – auf Hanna oder auf sich selbst? –, legte er den Rückwärtsgang ein, wendete und fuhr die Straße wieder hinab. Er würde zurückfahren in sein neues Leben. Ohne Hanna. Er musste versuchen, sie zu vergessen, sie aus seinen Gedanken und aus seinen Fantasien zu vertreiben.
Da ist sie! Ruckartig bremste Kevin ab und beugte sich nach vorn, um besser aus dem Beifahrerfenster sehen zu können. Nur schemenhaft vom Licht einer Straßenlaterne beleuchtet, kauerte eine Gestalt neben einem schwarzen Koffer. Sie rührte sich nicht, nicht einmal, als er das Fenster herunterließ. Also schaltete Kevin den Motor aus. Es war ihm gleichgültig, dass er in zweiter Reihe parkte. Hier herrschte ohnehin kaum Verkehr, schon gar nicht mitten in der Nacht. Er öffnete die Tür, lief um seinen BMW herum und ging vor dem reglosen Bündel Mensch in die Hocke.
„Hanna?“
Ihr Kopf ruckte hoch. Hatte sie geschlafen?
Hannas blaue Augen waren weit aufgerissen, sie zitterte und glich einem Kleinkind, das seine Mutter im Getümmel verloren hatte. Kevin presste die Lippen zusammen. Hanna hatte ihre Mutter tatsächlich verloren; damals und heute offenbar wieder. Das kalte Licht der Straßenlampe hob eine Tränenspur auf ihren gebräunten Wangen hervor. Sie blinzelte.
Kevins Herz fühlte sich wie eingeschnürt an, als hätte jemand Paketband darum gewickelt und zöge nun an den Enden. Diese gewöhnlich vor Energie, Kraft und Ausdauer strotzende Frau war nur noch ein Schatten ihrer selbst.
„Hanna“, wiederholte er leise ihren Namen, entsetzt und besorgt zugleich, und mit einer tiefen Stimme, die nicht zu seinem langen, dürren Körper passen wollte.
„Sie ist tot. Sie ist vielleicht tot!“, murmelte sie.
„Was? Wer?“ Kevin ließ sich neben sie fallen und lehnte sich ebenfalls an die Hauswand, die noch die Restwärme des vergangenen Tages in sich trug.
„Helena.“
„Helena ist etwas zugestoßen? Sind Henry, Steph und die Kinder deshalb in die Staaten –?“
„Nein. Was? Unmöglich!“ Hanna keuchte plötzlich, als hätte sie einen ihrer Wettkampfläufe hinter sich. „Ich habe am Telefon die Schüsse gehört. Das Geschrei. Sie hat aufgehört zu atmen.“
Kevin runzelte die Stirn. Was Hanna da erzählte, klang absolut wirr. War sie so durcheinander, weil sie ihre Familie nicht angetroffen hatte? Zweifel über ihren Geisteszustand begannen sich in ihm zu regen. Hatte sie wieder einen Zusammenbruch? War sie bei Weitem nicht so gesund, wie die Ärzte behauptet hatten?
Womöglich war sie einfach in der verkehrten Straße gewesen. Oder sie hatte die Frau falsch verstanden. Zwar konnte Hanna – im Gegensatz zu ihm – einigermaßen gut Deutsch sprechen und verstehen, aber einige der Menschen hier bedienten sich einer extrem dialektgeschwängerten Aussprache.
„Das klärt sich bestimmt alles auf“, wagte er zaghaft anzumerken. Er wusste, dass diese Worte nicht viel halfen, vielmehr Zorn bei ihr hervorrufen konnten, doch Hanna drehte den Kopf und sah ihn an. Dankbar, wie er fand.
„Ich habe furchtbare Angst um sie.“
„Du hast mit Helena –?“
„Ja, ich habe mit ihr gesprochen. Sie war in einer Kirche und plötzlich fielen Schüsse. Sie hatte Panik! Und dann war die Verbindung tot.“
„Hör zu: Wir fahren jetzt zu mir, damit du dich –. Wir versuchen herauszufinden, ob an der Sache etwas –. Vielleicht lief im Hintergrund ja nur ein Film und ihr Akku war leer oder –.“
„Ja. Ja, vielleicht“, stimmte sie ihm zu. Ihre Stimme schwankte zwischen hoffnungsfroh und zweifelnd.
Kevin sprang auf und bot ihr beide Hände an, um ihr beim Aufstehen behilflich zu sein. Er war erstaunt, weil sie das Angebot tatsächlich in Anspruch nahm. Ihre Hände waren eiskalt. Als sie stand, spürte er das Zittern, das in Wellen durch ihren Körper lief. Obwohl er groß war, überragte er sie nur um wenige Zentimeter. Heute jedoch wirkte sie klein auf ihn, ungewohnt kraftlos und zerbrechlich.
Hanna entwand ihm ihre Hände, die er weiterhin in den seinen gehalten hatte, als wollte er sie nie wieder loslassen. Ein vorwurfsvoller Blick von ihrer Seite blieb allerdings aus. Offenbar war sie viel zu durcheinander und mit sich selbst beschäftigt, um zu bemerken, dass er die Situation ein wenig ausnutzte. Vielleicht war diese eigentümliche Begebenheit, die er noch immer nicht vollständig erfasst hatte, womöglich seine Chance, sie doch für sich zu gewinnen?
Er führte Hanna zu seinem Wagen und half ihr auf den Beifahrersitz. Etwas mühsam wuchtete er ihr großes Gepäcksstück in den Kofferraum und stieg ebenfalls ein. Nach einem besorgten Blick auf Hannas fahles Gesicht ließ er den Motor an und fuhr in Richtung Innenstadt. In dem Moment, als er abbiegen wollte, jagte ein silberfarbener Mercedes CLA Sport mit überhöhter Geschwindigkeit über die Kreuzung. Sie entgingen nur deshalb einem Zusammenstoß, weil Kevin instinktiv das Steuer nach rechts riss. Er touchierte mit der Stoßstange eine Mülltonne. Diese schwankte bedenklich, blieb aber stehen.
Den Fahrer des anderen Autos kümmerte das nicht. Die Räder quietschten, als er Gas gab, und gleich darauf noch einmal, als er scharf abbremste. Der CLA stand auf der falschen Fahrbahnseite, genau an der Stelle vor der Kneipe, wo Kevin Hanna aufgelesen hatte.
Kevin schüttelte den Kopf über den offenbar betrunkenen Rüpel und fuhr weiter.
***
Hanna verließ bereits nach ein paar Minuten die Dusche. Sie konnte nicht entspannen, aber das Gefühl von Frische auf ihrer Haut tat dennoch gut. Meist war es genau anders herum: Ihr Körper, den sie geschunden hatte, fühlte sich wund und zerschlagen an, doch ihr Inneres war zur Ruhe gekommen. Nun rebellierten ihr Herz, ihr Kopf, ihre Seele und ihr Magen, während ihre Muskulatur sich eigenartig entspannt anfühlte. Oder sollte sie es eher kraftlos nennen?
Sie schlüpfte in Unterwäsche und einen Jogging-Anzug, bürstete nachlässig ihr Haar und packte ihre Duschutensilien wieder in ihre Kosmetiktasche. Sie hatte nicht vor, sie in Kevins weiß-blau gekacheltem Bad mit der überdimensionalen Spiegelwand stehen zu lassen, wollte sie ihm doch keinesfalls den Eindruck vermitteln, als breite sie sich bei ihm aus.
Ihre rigorosen Worte an ihn, dass er sich von ihr fernhalten solle, waren Hanna überdeutlich in Erinnerung. Und dennoch nahm er sie wie selbstverständlich bei sich auf, kochte für sie, umsorgte sie … Die Gewissensbisse, die sie deshalb verspürte, mischten ihr Gefühlsdesaster noch ein wenig mehr auf.
„Hanna?“ Kevins Stimme drang gepresst in den Flur, während im Hintergrund unüberhörbar ein amerikanischer Nachrichtensender lief.
Sie ließ die Tasche fallen, stieß die Tür zu dem weitläufigen und edel eingerichteten Wohnzimmer auf und blieb wie angewurzelt im Türrahmen stehen. Was sie auf dem riesigen Flachbildschirm sah, biss sich mit Vehemenz in ihrem Kopf fest: weinende Menschen, die meisten von ihnen Afroamerikaner, hielten sich in den Armen. Eine Frau war auf der Straße zusammengebrochen. Das Licht von den Warnleuchten der Einsatzfahrzeuge huschte über ein weißes Gemäuer. Polizisten rannten umher, Sanitäter und Ärzte beugten sich über auf dem Boden liegende Menschen. Eine Männerstimme berichtete von Schüssen und von einem flüchtigen Verdächtigen. Dann sprach er von Toten und Verletzten. Und immer wieder fielen vier Worte, die Hannas Herz zum Stolpern brachten: Mother Emanuel in Charleston.
Hanna konnte ihre Augen nicht vom Bildschirm abwenden, obwohl sich jedes einzelne Bild unauslöschlich in ihre Seele brannte. Sie suchte nach Helena, doch auch in Charleston war es mittlerweile dunkel geworden. Die Lichter der Fahrzeuge und Kameras überschnitten sich gegenseitig und blendeten sie. Hanna konnte nicht mehr als Umrisse, Schatten und unzulänglich beleuchtete Gesichter ausmachen. Einmal glaubte sie, eine ungewöhnlich große, schlanke Blondine zu sehen, aber es war nur der Bruchteil einer Sekunde gewesen, nur ein winziger Hoffnungsfunke, der jedoch eine Flamme des Schmerzes in ihr auflodern ließ.
Die Ungewissheit über Helenas Ergehen, ihre Angst und Verwirrung ließen Hanna kraftlos zu Boden sinken. Sie kniete nieder, als wollte sie beten, allerdings fühlte sich ihr Kopf eigentümlich leer an.
Jemand erzählte der Reporterin, dass der Schütze etwa eine Stunde lang mit ihnen in der Bibelstunde gesessen habe. Er sei jung, beschrieb ihn eine andere Augenzeugin, auf deren Bluse und Wange Blut klebte. Ihre Augen flackerten unruhig, und sie musste gestützt werden.
Die Übertragung wurde unterbrochen. Hanna überkam das Gefühl, schreien zu müssen. Sie war niemand, der Live-Bilder von Tatorten guthieß, und ihr gefielen die überfallartigen Fragen auf die Menschen, die soeben Schreckliches erlebt hatten, nicht sonderlich. Heute jedoch wollte sie am Schauplatz des Geschehens bleiben. Weil sie ohnehin dort gewesen war! Weil sie alles hatte mit anhören müssen! Weil ihre Schwester involviert war!
Kevin ergriff sie unter den Armen und zog sie hoch. Hatte er sie angesprochen? Sie gebeten, sich zu erheben?
Sie hatte es jedenfalls nicht gehört, es nicht einmal bemerkt, als er sich ihr genähert hatte. Ihre Umgebung versank in einer Art Nebel. Geräusche drangen zu ihr durch, als wäre die Welt um sie herum in Watte gepackt. Sie spürte einen weiteren Anflug von Übelkeit und hatte dem nichts mehr entgegenzusetzen. Sie übergab sich auf Kevins weißes Poloshirt.
***
Warmer Sonnenschein streichelte Hannas Gesicht, während sich der Duft von Kaffee und frischen Brötchen in ihr Bewusstsein schlich und sie einen Moment lang glauben ließ, sie wäre in einem Trainingslager. Dann brach die Realität mit Wucht in ihre Gedanken ein.
Hanna fuhr hoch. Sie lag auf einer bequemen breiten Ledercouch, eingewickelt in eine leichte Decke. Auf dem hellen Laminat lag ihr aufgeklappter Trolley, und damit alles, was sie besaß. Zumindest im Augenblick.
Mit der linken Hand tastete sie nach ihrem Smartphone auf der Lehne. Die Anzeige blinkte. Ein entgangener Anruf. Wie hatte sie ihn nur überhören können!?
Hannas Finger glitten über das Display. Gleich darauf starrte sie auf die Nummer, die schon einmal in ihrer Liste aufgetaucht war. Sie erkannte sie auf den ersten Blick, hatte sie die Zahlen doch am Vortag oft genug gelesen. Gestern Nachmittag? War es erst einige wenige Stunden her, seit ihre Welt die Umlaufbahn geändert hatte?
Obwohl sie noch immer annahm, dass jemand „Enrico“ zu erreichen versuchte, drückte sie auf „Rückruf“. Es wählte und wählte …
Hanna atmete tief durch. Kevin hatte recht mit dem, was er ihr gestern kurz vor dem Einschlafen gesagt hatte: Jetzt, an einem neuen Tag, bei Tageslicht besehen, wirkte die Angelegenheit nicht mehr ganz so bedrohlich und düster.
Bis auf die Sache mit Helena!
Gehetzt warf Hanna ihr Mobiltelefon auf das Polster, strampelte die Decke weg und sprang auf die Füße. Ihre Schritte patschten laut auf dem angenehm kühlen Boden, als sie durch den sonnendurchfluteten Raum irrte und die Fernbedienung für den Fernseher suchte.
Ihr Blick fiel auf die Uhr. Es war erst kurz nach sechs, und Kevin hatte bereits Brötchen besorgt und Kaffee gekocht? Er überschlug sich ja beinahe vor Fürsorge. Die Erinnerung an den Moment, als sie sich auf sein Shirt übergeben hatte, trieb Schamesröte in ihr Gesicht. Aber selbst darauf hatte Kevin souverän reagiert. In dem Mann steckte offenbar weit mehr, als sie geahnt hatte.
„Ich hoffe …“
Erschrocken wirbelte Hanna herum. Kevin stand im Türrahmen und zuckte ob ihrer heftigen Reaktion zurück. Nachdem er sich wieder gefangen hatte, fuhr er fort: „… ich habe dich nicht geweckt. Es ist früh und du hättest den Schlaf –.“
„Nein, es ist alles in Ordnung“, erwiderte sie zerstreut und noch immer auf der Suche nach der Fernbedienung. Sie fand sie ordentlich verstaut in einem Regalfach neben weiteren elektronischen Gerätschaften und schaltete den Flachbildschirm ein. Der amerikanische Sender brachte noch immer Bilder aus Charleston.
Hanna starrte gebannt auf den Bildschirm, ohne zu wissen, was sie erwartete, was sie zu sehen oder zu hören hoffte. Der Reporter sprach von acht, inzwischen vermutlich sogar neun Toten und einigen Verletzten. Unter den Opfern sei auch der Pastor der Gemeinde, Clementa Pinckney, der einen Sitz im Senat von South Carolina innegehabt hatte. Hanna schaltete den Fernseher wieder aus und blickte zum Fenster. Draußen schien die Sonne, als gäbe es nichts als Licht auf dieser Welt. Woher kam dann nur eine solch bösartige Dunkelheit in manchen Menschenherzen? Hanna wusste darauf keine Antwort.
Einzelne Wolkengebilde zogen träge über den Himmel. Am Nachbargebäude standen mehrere Fenster zum Lüften offen, Pflanzenkübel thronten auf einem der Simse, eine Katze saß auf einem anderen, wieder andere waren leer. Bei einem Fenster weiter oben wehte eine Gardine sanft im Wind, als winke sie Hanna zu. Im Stuttgarter Schlossgarten tummelten sich Menschen, Tauben gurrten, der Lärm einer nahe gelegenen Hauptverkehrsstraße drang verhalten zu ihr herauf. Sie vernahm Kinderstimmen, hörte, wie eine Autotür zugeschlagen wurde, und in der Ferne ein Hupen. Die Geräusche eines ganz normalen Tages. Alltag. Beschaulichkeit.
Sie hörte es, sah es und konnte es dennoch nicht fühlen.
Kevin kam mit einem Tablett herein. Darauf türmten sich Geschirr, Marmeladengläser, ein Teller mit Wurst und Käse, ein Brotkorb voller Brötchen, daneben eine Thermoskanne und ein Milchkännchen. Offenbar hatte er die deutsche Art zu frühstücken bereits lieben gelernt. Klappernd stellte er alles ab, während Hanna ihn dabei beobachtete.
Eine unterschwellige Wut stieg in ihr auf, von der sie nicht wusste, woher sie kam, und die ihr völlig fremd war. Kevin zu beobachten war, als sähe sie durch ein Fenster in eine andere Welt. Sie hatte es irgendwann gewagt, den fast schon aufdringlichen Mann wegzuschicken, doch nun hatte sie bei ihm Zuflucht gefunden. Sie hatte ihn als langweilig in Erinnerung, zwar durchaus nett, mehr aber nicht. Jetzt fühlte es sich an, als hätte er ihr das Leben gerettet. Und dabei lag die Zeit, in der sie auf Hilfe angewiesen gewesen war, doch hinter ihr. Damals, nach ihrer plötzlichen Erkrankung, nach dem harten Training, als sie versucht hatte, sich zurück an die Weltspitze zu kämpfen, und nach ihrem anschließenden Zusammenbruch.
Sie hatte sich aufgerappelt und ins Leben zurückgefunden. Erneut hatte sie zu trainieren begonnen – praktisch das zweite Mal bei null angefangen. Diesmal allerdings mit der unangenehmen Ungewissheit im Nacken, ob sich die Quälerei wirklich lohnen würde. Sie, das Sportass, die nie etwas anderes hatte tun wollen, als Sport zu treiben, Wettkämpfe zu gewinnen und einmal eine ganz Große zu sein, sah darin keinen Sinn mehr.
Vor etwa einem halben Jahr hatte sie mit ihrem Vater darüber gesprochen. Daraufhin hatte er sie fest in die Arme geschlossen und ihr zugeflüstert, dass sie doch aufhören könne. Der Sport und die Wettkämpfe sollten ihr Spaß machen, ihr guttun, keine Qual für sie sein.
Auf so viel Verständnis hatte Hanna nicht zu hoffen gewagt. Immerhin war er es gewesen, der sie als Kind und Jugendliche gefördert und gefordert hatte. Als sie älter geworden war, hatte er sich jedoch rausgezogen. Vermutlich, weil er sie zur Selbstständigkeit erziehen wollte, denn Eigenständigkeit und Eigeninitiative waren etwas, auf das er Wert legte und das er auch von seinen Mitarbeitern forderte – wie Kevin. Dass ihr Vater ihren Rückzug aus dem Leistungssport einfach akzeptiert hätte, war für sie dennoch erstaunlich. Immerhin hatte er ihr beigebracht, für ein Ziel zu kämpfen. Immer ihr Bestes zu geben und ihr Vorhaben in jedem Fall in die Tat umzusetzen. Für diese unerwartete Akzeptanz und Großzügigkeit liebte sie ihn! Und nun wusste sie nicht, wo er war.
Hanna sah zu, wie Kevin einen Stuhl für sie zurückzog. Sie drehte sich um, als wolle sie sofort die Flucht antreten, doch ihr schlechtes Gewissen hielt sie auf. Und ihre Dankbarkeit für seine Hilfe.
Weil es sie danach drängte und um Zeit zu gewinnen, ergriff sie ihr Smartphone und wählte erneut die Nummer ihres Vaters. Wieder ertönte nur die freundliche Ansage, die einmal mehr wiederholte, dass niemand zu erreichen sei. Das Gleiche bekam sie bei Stephanie und Claudia zu hören. Und bei Helena.
„Kevin, wen muss ich anrufen, um rauszufinden, wer unter den Opfern des Attentats in der Kirche ist?“ Ihre Stimme klang schrill. Aus Angst vor der Realität. Vor der Endgültigkeit, der sie sich nach einem entsprechenden Telefonat womöglich stellen musste. Dennoch wollte und konnte sie nicht länger in lähmender Passivität verharren, anstatt zu reagieren. Das war eine Lektion, die sie früh gelernt hatte: Wenn eine Gegnerin weiter warf, schneller rannte, höher oder weiter sprang als sie, durfte sie nicht in Untätigkeit verfallen. Sie musste dagegenhalten. Besser sein. Kämpfen.
Genau dieser Kampfeswille war ihr in den vergangenen Monaten verloren gegangen. Aber er musste doch noch in ihr stecken. Sie brauchte ihn. Jetzt! Nicht, um eine Ausscheidung zu gewinnen, um unter den Besten zu sein, um in einem Wettkampf zu dominieren, sondern um ihre Lieben zu finden. Dieses eine Mal würde sie sich nicht für den sportlichen Erfolg quälen, sondern weil sie der Qual in ihrem Herzen ein Ende bereiten wollte.
„Willst du nicht zuerst etwas essen?“
„Nein, danke.“ Hanna zwang sich zu einer freundlichen Reaktion. Inzwischen wusste sie wieder, was sie an Kevin störte: sein fehlendes Gespür dafür, wann seine pragmatische, stoisch gelassene und analytische Art einfach nur fehl am Platz war.
„Ja, also –.“ Er warf einen bedauernden Blick auf die Brötchen und setzte sich. „Ich denke, die Polizei in Charleston hat eine –.“
Hanna nickte, wählte die Nummer der Auskunft und hatte kurz darauf einen gereizten Officer mit dem interessanten Namen Mary Monroe am Apparat.
„Können Sie mir bitte sagen, wer bei dem Attentat –“, begann Hanna, wurde jedoch harsch unterbrochen.
„Das kann ich sicher nicht!“
„Entschuldigen Sie bitte. Natürlich dürfen Sie das nicht.“ Hanna schluckte schwer. Ihre Angst, dass die Polizistin auflegen könnte, ließ sie schnell weitersprechen: „Hören Sie: Ich rufe aus Deutschland an und kann deshalb leider nicht persönlich vorbeikommen.“
Ein genervtes Stöhnen war die Antwort. Vermutlich verbrachte die Frau bereits Stunden am Telefon, um irgendwelche Neugierigen oder Irren abzuweisen.
„Meine Schwester war gestern in der Bibelstunde in der Mother Emanuel Church“, versuchte sie es erneut. Ihre Stimme bebte, hatte sie doch die grauenhaften Hintergrundgeräusche jenes Telefonats im Kopf. Helenas panisches Flüstern, ihr Atmen und dann diese grässliche Stille.
„Name?“
„Helena Jameson.“
„Warten Sie einen Augenblick.“
Hanna nickte, ohne zu realisieren, dass die Beamtin dies nicht sehen konnte. Sie hörte im Hintergrund mehrere Telefone läuten, außerdem leises Stimmengemurmel und das Klackern einer Computertastatur.
„Ich habe weder auf der Liste mit den Toten noch auf der mit den Verwundeten eine Helena Jameson stehen.“ Die Stimme klang sachlich. Hanna störte das nicht weiter. Immerhin war ihre Schwester nicht unter den Opfern dieses Kerls, der eine Stunde lang in einer Kirche gesessen und plötzlich damit begonnen hatte, um sich zu schießen. Sie fragte sich jedoch, was die unterkühlte Antwort bei einem Anrufer anrichten würde, dem nicht das gleiche Glück wie ihr beschieden war … Allerdings würde dieser dann sicher keine Antwort erhalten, denn normalerweise wurden die Angehörigen der Opfer immer persönlich informiert.
Hanna lächelte Kevin gequält und erleichtert zugleich an.
„Warten Sie mal!“, bat die Polizistin brüsk.
Im selben Augenblick kehrte die Angst zurück. Warum hielt die Frau sie in der Leitung? Worauf sollte sie warten? Bekam die Polizistin gerade neue Informationen herein? Eine aktualisierte Liste? In dem Chaos, das nach den Schüssen entstanden war, könnte einiges untergegangen sein. Vielleicht hatte man einige Opfer nicht sofort identifizieren können? Hannas Gedanken rotierten.
„Sind Sie noch dran?“
„Ja!“ Sie keuchte mehr, als dass sie sprach.
„Meine Kollegen haben alle Zeugen des Attentats vernommen. Ich finde darunter keine Helena Jameson.“
„Aber –“
„Ich habe wirklich anderes zu tun! Was fällt Ihnen ein, hier grundlos anzurufen!?“
Hanna riss die Augen auf. Sogar Kevin musste die aufgebrachte Frau gehört haben, denn er blinzelte verwirrt.