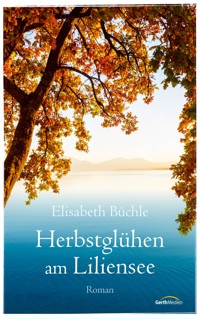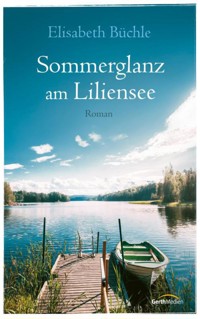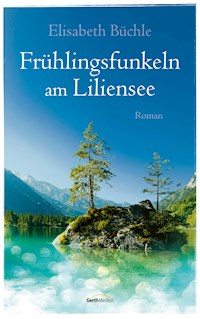Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gerth Medien
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Josefine von ihrem ehemaligen Klassenkameraden Fynn aufgesucht wird, ist sie mehr als irritiert: Der junge Mann, der inzwischen ein großer Abenteurer und erfolgreicher Schatzsucher ist, versucht sie davon zu überzeugen, dass ihr im Sterben liegender Großvater wissen könnte, wo das sagenumwobene Bernsteinzimmer versteckt ist. Tatsächlich gibt der geschwächte Mann ihnen Hinweise auf den Verbleib des von den Nationalsozialisten geraubten und seit 1945 verschollenen Bernsteinschatzes. Also begeben sich die beiden auf die nicht ungefährliche Suche nach diesem großen Mysterium ... Dieser packende Roman spielt auf zwei Zeitebenen – in der Gegenwart und zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Er erzählt eine Geschichte über Vertrauen, Mut und den Glauben an die Freiheit eines jeden Menschen, das Richtige zu tun – egal, wie schwierig die Umstände auch sind.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über die Autorin
Elisabeth Büchle hat zahlreiche Bücher veröffentlicht und wurde für ihre Arbeit schon mehrfach ausgezeichnet. Ihr Markenzeichen ist die fesselnde Mischung aus gründlich recherchiertem historischem Hintergrund, abwechslungsreicher Handlung und einem guten Schuss Romantik. Sie ist verheiratet, Mutter von fünf Kindern und lebt im süddeutschen Raum.
www.elisabeth-buechle.de
Für Malina
Inhalt
Vorwort
Prolog
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
Neunzehn
Zwanzig
Einundzwanzig
Zweiundzwanzig
Dreiundzwanzig
Vierundzwanzig
Fünfundzwanzig
Sechsundzwanzig
Siebenundzwanzig
Achtundzwanzig
Neunundzwanzig
Dreißig
Einunddreißig
Zweiunddreißig
Dreiunddreißig
Vierunddreißig
Fünfunddreißig
Epilog
Dank
Historische Personen
Anmerkungen
Vorwort
Den Roman Die Erbin des Bernsteinzimmers habe ich bereits im Jahr 2019 geplant und zu schreiben begonnen. Durch allerhand Turbulenzen musste ich jedoch frühzeitig abbrechen, denn andere Manuskripte erhielten den Vorrang. Da ich das Thema weiterhin interessant fand, habe ich den Roman nun endlich zu Ende geschrieben – auch dank des Stipendiums NEUSTART KULTUR der VG WORT. Das Ergebnis halten Sie in den Händen.
Ich persönlich mag die warme Farbe von Bernstein, und vielleicht haben Sie ja auch das eine oder andere Bernsteinschmuckstück zu Hause. Was ich im Buch leider nicht mehr untergebracht habe, waren Details zur Bearbeitung des fossilen Harzes. Aber heutzutage ist es ja nicht schwer, sich selbst ein wenig darüber zu informieren.
Ein Hinweis noch von meiner Seite: Achten Sie beim Lesen bitte genau auf die Datumsangaben, vor allem bei den Abschnitten aus den 1940er-Jahren. Dort gibt es – der Dramaturgie geschuldet – nämlich mehrere Zeitsprünge, auch mal vor und zurück.
Auch in diesem Roman habe ich einige historische Personen in meinen Text verwoben. Einen Überblick über deren Lebensdaten finden Sie am Ende des Buches.
Während des Schreibens habe ich mich mit dem Thema »Freiheit« beschäftigt und mir überlegt, ob diese wirklich immer grenzenlos ist. Bisher bin ich zu folgendem Ergebnis gekommen: Meine persönliche Freiheit endet genau dort, wo die meines Nächsten beginnt.
Vielleicht möchten Sie mir ja Ihre Gedanken zum Thema »Freiheit« mitteilen. Zuerst jedoch wünsche ich Ihnen ein spannendes Leseerlebnis!
Prolog
1837 – Zarskoje Selo
WILHELM
»Freiheit« war nach Wilhelms Auffassung etwas, was innerhalb eines eng gesteckten Rahmens stattfand. Dabei war dem Fünfzehnjährigen bewusst, dass die Begrenzungen seines Lebens durchaus enger waren als noch vor fünf Jahren. Zugleich aber bedeutend weiter als jene, mit denen die meisten anderen Menschen im russischen Reich leben mussten. Für den Sohn eines deutschen Kochs, der von der Zariza Alexandra Fjodorowna höchstpersönlich nach St. Petersburg beordert worden war, war es nun mal vorgesehen, dass er in die Fußstapfen seines Vaters trat.
Also lernte Wilhelm, die exquisitesten Speisen zuzubereiten, sowohl in überschaubaren als auch in ausufernden Mengen. Man brachte ihm bei, die Beiköche und Küchengehilfen anzuleiten und sie gelegentlich auch zurechtzuweisen, damit er einst eine gesicherte Anstellung als erster Koch der Zarenfamilie einnehmen könnte. Dabei interessierte es niemanden, dass Wilhelm den Geruch von heißem Fett hasste. Und dass er stets dagegen ankämpfte, sich nicht zu übergeben, sobald ihm das in die Nase stieg, was sein Vater und die Zarenfamilie den »delikaten Duft eines perfekt zubereiteten Fischgerichts« nannten.
Wahre Freiheit würde für Wilhelm bedeuten, nicht tagein, tagaus in der Küche stehen zu müssen, um den Anforderungen von Zar Nikolaus I. gerecht zu werden, vor allem aber denen seines Vaters. Wie gern würde er wieder zur Schule gehen. Schließlich gab es noch so viele wunderbare Geheimnisse zu ergründen, die ihm nun wohl für immer verschlossen bleiben würden.
Das laute Bellen eines Hundes, dem sich ein tiefes, grollendes Knurren entgegenstellte, ließ Wilhelm erschrocken den Kopf heben. Er hatte seine Pause dazu genutzt, sich im Lustgarten des Katharinenpalasts herumzudrücken. Versteckt hinter Schatten spendenden Bäumen und hohen Hecken war er gedankenverloren von einer Statue zur nächsten spaziert und hatte sich wieder einmal seinen unerfüllbaren Träumen hingegeben. Er hatte Traumschlösser erbaut, die größer waren als jene, in denen die Zarenfamilie abwechselnd wohnte, und die täglich von der Realität eingerissen wurden.
Da er hier keinesfalls erwischt werden wollte, spickte Wilhelm vorsichtig an einer Strauchreihe vorbei. Was er sah, brachte sein Herz zum Stolpern.
Ein großer dunkelbrauner Hund, vermutlich der eines Gastes, bedrohte das verwöhnte Windspiel von Zarewna Olga. Dem Tier troffen Sabberfäden aus dem Maul, dann schnappte es mit seinen langen, spitzen Zähnen boshaft zu. Der wendige kleine Windhund entzog sich dem Angriff durch eine schnelle Drehung, war allerdings nicht bereit, das Feld zu räumen. Vielleicht weil er zu verspielt war, vielleicht aber auch, weil er wie die Zarensprösslinge um seinen Wert und seine Freiheiten wusste. Nur dass man das dem zotteligen Angreifer nicht gesagt hatte …
Ohne über die Folgen nachzudenken, stürzte Wilhelm hinter der Hecke hervor und klatschte mehrmals kräftig in die Hände, da er die Aufmerksamkeit des angriffslustigen Tieres auf sich lenken wollte. Dann packte er den nun einigermaßen verwirrt dreinblickenden Köter im Nacken und zerrte ihn von Olgas Schoßhündchen fort, das erneut wütend kläffte, als hätte es selbst den Sieg über den unfreundlichen Artgenossen errungen.
Wilhelm hatte das raue Fell des Hundes zwar fest im Griff, wusste aber nicht, was er als Nächstes tun sollte. Vor allem weil sich die Aggression des Tieres nun gegen ihn richtete. Angst bemächtigte sich seiner. Er sah sich bereits mit zerbissener, blutüberströmter Hand.
Ein lauter Pfiff gellte durch den Garten und wurde von der türkisblauen Fassade der pompösen Sommerresidenz mit den weißen und goldenen Schmuckelementen zurückgeworfen. Der Hund hielt plötzlich ganz still und schickte sich an davonzurennen. Erleichtert ließ Wilhelm ihn gewähren, wirbelte aber herum, als er eine aufgeregte Mädchenstimme vernahm.
»Merci beaucoup.«
Keine vier Meter von ihm entfernt kauerte Olga. Die Zarewna hatte sich aus Angst vor dem fremden Hund unter einer der vielen Buchsbaumhecken versteckt. Nun erhob sie sich und schüttelte den cremefarbenen Rock ihres Kleides aus. Sie kam auf Wilhelm und ihr Schoßhündchen zu, das neugierig an Wilhelms weißer Hose schnupperte, wohl fasziniert von den Essensgerüchen, die der Dienstkleidung anhafteten.
Wilhelms Gesicht lief rot an. Von den sieben Zarenkindern war Olga ihm das liebste. Nicht nur weil sie beide gleichaltrig waren, sondern auch weil das Mädchen sanfteren Gemüts war als die übrigen Geschwister; freundlicher zu den Bediensteten. Wenn er ihr einmal zufällig begegnete – was zu Wilhelms Bedauern viel zu selten geschah –, grüßte sie ihn stets mit einem zurückhaltenden Lächeln. Seiner Meinung nach ging Olga mit weitaus weniger Arroganz durchs Leben als ihre Schwestern, und im Gegensatz zu ihren Brüdern zeigte sie keinerlei Freude an dummen Possen, die mitunter auch den Angestellten gespielt oder ihnen in die Schuhe geschoben wurden. Denn wer widersprach schon einem Zarewitsch?
Olga, von ihren Geschwistern liebevoll Olly genannt, sprach weiter auf Wilhelm ein, gleichzeitig streichelte sie das kurze graue Fell des Windspiels.
Da er kein Wort Französisch verstand, zog Wilhelm nur hilflos die Schultern hoch. Dabei fiel ihm siedend heiß ein, dass er der Großherzogin mehr Respekt erweisen sollte, also vollführte er einen ungelenken Diener.
Das Mädchen lachte glockenhell auf und redete einfach weiter. Das kannte er so nicht von ihr; immerhin beobachtete er sie und ihre Geschwister häufig, wobei sie stets in sich gekehrt, ja schüchtern wirkte. Olga war die Stille, die Sanftmütige, diejenige, über die viele Bedienstete sagten, für die Verheiratung in ein anderes Herrscherhaus habe sie entschieden zu wenig Selbstbewusstsein, Eleganz und Schönheit mit auf den Weg bekommen.
Wilhelm hingegen fand sie einfach wunderbar! Allerdings würde er wirklich gern wissen, was sie ihm da gerade erzählte, denn ihr Wortschwall ging weit über ein einfaches Dankeschön für die Rettung ihres Hundes hinaus.
»Ich kann Sie leider nicht verstehen«, wagte er, sie zu unterbrechen und bediente sich dabei der russischen Sprache. Seine Stimme klang seltsam rau.
Olga verstummte und neigte leicht den Kopf. Nun war es an ihr, die Schultern hochzuziehen.
Wilhelm geriet ins Schwitzen. War sein Russisch denn so schlecht? Er war in St. Petersburg geboren worden und zur Schule gegangen. Zu Hause hatten sie sich zwar immer auf Deutsch unterhalten, aber für den Unterricht hatte er sich die Landessprache aneignen müssen.
Olga stemmte ihre gepflegten blassen Hände in die pummelige Taille, wo eine schmale grüne Schärpe saß, und gab betont langsam einige französische Worte von sich. Jetzt erst wurde Wilhelm bewusst, dass die Zarewna seine Worte ebenso wenig verstanden hatte wie er ihren Redeschwall auf Französisch.
Irritiert trat er einen Schritt zurück. War das tatsächlich möglich? Konnte die erste Familie des Landes das russische Volk führen, ohne dessen Sprache zu sprechen? Damit erklärte sich ihm zumindest ansatzweise die Unzufriedenheit vieler Russen, die sich in gelegentlichen Gewaltakten gegen den Zarenhof entlud. Natürlich fühlten sie sich nicht ernst genommen, nicht gehört, nicht … verstanden.
Sein Vater hatte Wilhelm vor einigen Jahren dabei erwischt, wie er Olga und ihre beiden Schwestern beobachtet hatte. Die Mädchen waren bei der Grotte am Großen Teich spazieren gegangen, und Wilhelm hatte versucht, ihnen unauffällig zu folgen. Der Koch hatte ihm eine Hand auf die Schulter gelegt und von einem goldenen Käfig gesprochen, von Menschen, die trotz Macht und Reichtum unfrei waren.
Damals hatte Wilhelm nicht begriffen, was sein Vater ihm damit sagen wollte – außer dass er sich nicht von der Zarenfamilie erwischen lassen durfte und dass die Mädchen tabu für ihn waren. Als Zehnjähriger hatte er darüber nur die Augen verdreht, heute war diese Tatsache jedoch ein Teil dessen, was ihn in seiner Freiheit beschnitt.
Doch der Rahmen, in dem Olga sich bewegen konnte, war offenbar noch deutlich enger als sein eigener. Dies begriff Wilhelm in dem Augenblick, als ihm bewusst wurde, dass Olga nicht einmal die eigene Landessprache beherrschte. Sie verstand weder die Bäckersfrau oder den alten Buchhändler in Zarskoje Selo noch das Marktweib, das in St. Petersburg Obst feilbot. Und niemand dort draußen verstand sie. Außerhalb des schützenden Kokons der gewaltigen Palastmauern, in denen die Zarenfamilie residierte, war Olga verloren. Wie ein kleines Boot auf dem Meer, das von den Wellen nicht getragen, sondern vielmehr verschlungen wird.
Wilhelm hatte zwar nicht die Freiheit, Olga zu umwerben, aber er war frei, sie zu bewundern und auf sie achtzugeben, wenn sie durch den Park spazierte. Frei, ihr zu wünschen, dass sie lieben, leben und glücklich sein durfte.
»Du kommst mit? Bitte!« Ein paar Brocken Deutsch hatte Olga bei ihrer Mutter wohl doch aufgeschnappt. Wilhelm atmete erleichtert auf, sah sich dann aber voller Unbehagen um. Er stand schon viel zu lange hier allein mit der jugendlichen Großfürstin. Zudem war seine Pause zu Ende. Sein Vater würde toben, schließlich war es nicht das erste Mal in dieser Woche, dass er zu spät in die riesige, überhitzte und von unangenehmen Gerüchen vollgesogene Küche zurückkehrte.
Olga bedeutete ihm, ihr zu folgen, also tat er es. Ebenso treu und ergeben wie ihr kleiner Hund. Zwar zuckte Wilhelm unangenehm berührt zusammen, als sie die Galatreppe betraten, doch er folgte ihr weiter in einem respektvollen Abstand. Sie war die Großfürstin, und er musste gehorchen, wenn sie ihn anwies, sie zu begleiten.
Seine Augen fingen staunend ein, was sein Verstand kaum zu erfassen vermochte. Vor ihm erstreckte sich eine Flucht von Gemächern, deren Anzahl er nur erahnen konnte. Mächtige Türdurchlässe, deren Rahmen mit goldenen Ornamenten geschmückt waren, nahmen ihn auf und entließen ihn wieder. Die verschlungenen Muster auf dem mehrfarbigen Parkettboden brachten seine Schritte aus dem Takt, da Wilhelm befürchtete, versehentlich eine Stelle zu betreten, die noch nie zuvor von einem Schuh berührt worden war. Jedenfalls glänzten die Böden, als würden sie im Stundentakt gebohnert. Gemälde in goldenen Rahmen, samtene Polsterstühle mit vergoldeten Beinen und Armlehnen, Stuck, Statuen, Uhren, Vasen … Glanz, Erhabenheit, Schönheit … all das rauschte an ihm vorbei, wie Wellen an den Strand rollen und sich zurückziehen, herbeirollen, davonlaufen … Es waren zu viele Eindrücke, um sie in Gänze wahrzunehmen, jedoch zu bedeutende, um sie zu übersehen.
Als Olga sich zu ihm umwandte, schloss Wilhelm schnell den Mund. Mit dem Zeigefinger auf den Lippen bedeutete sie ihm, dass er leise sein sollte. Allerdings hätte er ohnehin keinen Laut hervorbringen können, denn dazu war er gar nicht in der Verfassung. Sein Herz raste, wilder noch als vorhin, da die Zähne des großen Hundes seinem Arm so erschreckend nahe gewesen waren.
Olga huschte durch eine riesige weiße Flügeltür und betrat den nächsten Raum. Wilhelm folgte ihr. Geblendet kniff er die Augen zusammen, und vor lauter Staunen stand ihm schon wieder der Mund offen.
Durch die oben abgerundeten bodentiefen Fenster fiel das Sonnenlicht auf Abertausende Bernsteine von unterschiedlicher Größe, Farbe und Schliffart. Diese warfen das Strahlen der Sonne nicht nur zurück, sondern verstärkten es. Wilhelm riss die Augen auf und fühlte sich wie einer jener Blinden, die Jesus damals geheilt hatte. Ich habe nie zuvor gesehen!
Langsam drehte er sich im Kreis. Er wagte es nicht, über das Muster auf dem Intarsienboden hinauszutreten, das seine Schuhe berührten. Zu sehr fürchtete er sich davor, dass sich ansonsten ein Loch auftun und ihn verschlingen könnte. Und das durfte nicht passieren, nicht bevor er dieses Wunderwerk der Bernsteinschnitzkunst ganz genau betrachtet hatte.
Er hatte soeben eine andere, ihm völlig fremde Welt betreten. Fasziniert und ehrfürchtig nahm Wilhelm die glimmende und schimmernde facettenreiche Pracht in sich auf und empfand pure Verzückung. Hatte Olga gewusst, dass er sich für Gestein und Mineralien aller Art interessierte? Er hätte gern studiert und die Welt bereist, um die verschiedenen Gesteinsschichten, ihre Entstehung, ihre Beschaffenheit zu erforschen. War nicht nur er heimlich von Olga angetan, sondern sie auch von ihm? Hatte sie ihn stets bemerkt, wenn er sich in ihrer Nähe herumdrückte? Sie musste sich nach ihm erkundigt haben. Woher sonst sollte sie wissen, welche Freude sie ihm damit bereitete, dass er diesen Raum betreten durfte; ihn nur ein einziges Mal in seinem Leben sehen!
Auch ohne mit Worten zu kommunizieren, stand völlig außer Frage, dass Olga ihm damit für die Rettung ihres Hundes dankte. Indem sie ihm einen Herzenswunsch erfüllte.
Olga trat näher und streckte die Hand aus, berührte Wilhelm aber nicht. So mutig war sie nicht. Aber sie lächelte ihn an. Mit dem Mund, mit den Augen, mit einem Strahlen, das von innen herauszukommen schien. Freute sie sich so sehr darüber, dass sie diesen Augenblick miterleben durfte? Verschenkte sie gern Freude und empfand Glück, wenn andere glücklich waren? Solche Menschen, hatte Wilhelms Mutter einmal zu ihm gesagt, sind die heimlichen Säulen der Erde.
»Fünf Minuten«, flüsterte Olga ihm in ihrem seltsam eingefärbten Deutsch zu, huschte dann zu einer anderen Tür, die ebenfalls vergoldete Rokokoelemente enthielt, und ließ ihn allein. Nun gab es nur noch ihn und das im Sonnenlicht golden strahlende Bernsteinzimmer.
Eins
April 2018 – Staigacker bei Backnang
JOSEFINE
Als das Motorengeräusch des grünen Citroën Cactus erstarb, erwachte Josefines Angst. Sie lehnte sich im Sitz zurück und stieß den Atem aus. Alles in ihr sträubte sich gegen das, was ihr nun bevorstand. Durch die Bäume hindurch, die den Parkplatz umgaben, konnte sie nur Teile der Fassade des Pflegeheims sehen, in dem sie ihren Großvater wusste; als wollten sie verhindern, dass sie schon jetzt die Wahrheit erkannte.
Graue Wolken stürmten über das Gebäude hinweg. Ob sie alles mit sich rissen, was sich ihnen in den Weg stellte? Oder nahmen sie die Seelen derer auf, die ihr Leben gelebt, die genug gelacht und gelitten hatten? So wie Josefines Großvater Johannes?
Nein, sie wollte ihn nicht ziehen lassen. Ihr war es völlig egal, dass das Pflegepersonal gern beteuerte, mit seinen 98 Jahren habe er ein wirklich außergewöhnlich langes Leben geführt. Natürlich hatten sie damit recht, aber Johannes war nun mal Josefines einziges verbliebenes Familienmitglied. Ohne ihn war sie vollkommen allein in dieser Welt.
Ihre Eltern hatten bereits damit abgeschlossen gehabt, eigene Kinder zu bekommen, als sich bei ihnen doch noch Nachwuchs angekündigt hatte. Ihr Vater war von Beruf Gärtner gewesen und hatte Josefine gern »meine kleine Nachtkerze« genannt, weil diese zart duftende Pflanze eine große Überraschung für den Betrachter bereithält: Bei Anbruch der Dämmerung öffnen sich die gelben Blüten mit einem hörbaren »Plopp«. Josefine sei, so hatte er stets beteuert, eine ebensolche Überraschung für ihn und seine Frau gewesen.
Drei Tage nach seiner Beerdigung war Josefine volljährig geworden, und Johannes hatte damals schon im Alten- und Pflegeheim Staigacker gelebt. Heute nun hatte sie einen Anruf der Pflegedienstleitung erhalten, dass es ihrem Großvater zusehends schlechter gehe und sie mit dem Schlimmsten rechnen müsse …
Josefine zitterte, als sie ihren Rucksack ergriff, den sie jeder Handtasche vorzog. Noch heftiger bebte ihre linke Hand, mit der sie nach dem Türgriff tastete. Ihr Verstand sagte ihr in einem fort, dass Johannes ein alter Mann war, lebenssatt und müde, und dass sie ihn gehen lassen musste. Ihr gepeinigtes Herz schrie jedoch vehement dagegen an. Vermutlich, so befürchtete sie, wird wieder einmal das Herz als Verlierer aus dem Duell hervorgehen.
Nachdem sie den Wagen abgeschlossen hatte, ging sie über den Parkplatz, auf dem zu dieser Abendstunde nur noch wenige Autos standen. Tief in Gedanken versunken, den Blick auf die dahinjagenden Wolken gerichtet und umgeben von den im kräftigen Wind rauschenden Bäumen, näherte sie sich dem Haupteingang des massiven Gebäudes mit den drei nach hinten versetzten Gebäudeflügeln und dem Türmchen, das keck über dem Mittelteil thronte.
Womöglich wäre alles anders gekommen, hätte Josefine nicht den Wolken nachgeschaut, in der Hoffnung, dass sie ihren Kummer und ihre Angst mit sich davontrugen. Denn dann hätte sie ihn früher gesehen. Noch bevor er sie entdecken konnte. Vielleicht wäre sie spontan genug gewesen, sich einfach umzudrehen und entweder einen anderen Eingang zu benutzen oder eiligst das Weite zu suchen und erst später nach ihrem Großvater zu sehen …
i
FYNN
Josefine eilte mit raumgreifenden Schritten genau in seine Richtung. Sie trug das blonde Haar viel kürzer als früher, doch der freche Bob stand ihr ausgezeichnet. Die Fransen betonten ihr rundes Gesicht, das aufgrund der großen braunen Augen und des spitzen Kinns immer noch etwas Kindliches hatte, obwohl Josefine inzwischen Ende zwanzig war.
Sie beide hatten einst in derselben Straße gewohnt und zusammen den Kindergarten und die Schule besucht. Erst nach dem Abitur waren sie getrennte Wege gegangen.
Bis zu ihrem elften Lebensjahr war Josefine von einigen Klassenkameraden als »dicke Nudel« belächelt worden. Doch dann war sie in die Höhe geschossen, um schließlich alle anderen Mädchen und sogar einige der Jungs in ihrer Klasse zu überragen. Heute hatte sie eine athletische Figur und sah damit deutlich gesünder aus als jene Hungerhaken, die Fynn zuletzt auf einem Klassentreffen gesehen hatte, bei dem Josefine, sehr zu seinem Bedauern, nicht zugegen gewesen war.
»Josefine Kenkel«, sprach er sie an, da er befürchtete, sie könnte durch die Eingangstür eilen, ohne ihn überhaupt bemerkt zu haben.
Sie richtete den Blick auf ihn, und sofort war es wieder um ihn geschehen. Ihre ausdrucksstarken dunklen Augen, deren Farbe ihn an geschmolzene Schokolade erinnerte, hatten Fynn in ihrem letzten gemeinsamen Schuljahr stets in ihren Bann gezogen. Nach all der Zeit, die sie sich bereits gekannt hatten, hatte er sich damals tatsächlich in Josefine verliebt, was schmerzlich gewesen war. Immerhin hatte sie keinerlei Interesse an ihm gezeigt.
»Fynn? Fynn Gröner?«
Der fragende Tonfall, mit dem Josefine seinen Namen sagte, fühlte sich an, als habe ihm jemand ein Messer ins Herz gebohrt. Hatte sie ihn in den lächerlichen zehn Jahren, seit sich ihre Wege getrennt hatten, schon vergessen? Theatralisch griff er sich mit beiden Händen an die Brust und stieß hervor: »Bitte sag mir, dass du mich wiedererkennst! Du hast mich ganz bestimmt nicht einfach aus deinem Gedächtnis gestrichen.«
»Ich wollte eigentlich sagen, dass du erwachsen geworden bist. Doch das revidiere ich auf der Stelle. Du wirkst zwar reifer als damals auf dem Abiball, allerdings scheint es, als sei es bei einer rein körperlichen Entwicklung geblieben.«
»Autsch!« Fynn lachte über ihren verbalen Seitenhieb. Das war die Josefine, die er kannte, in die er sich verliebt hatte und die es immer noch verstand, ihn mit einem einzigen Blick aus ihren Schokoladenaugen aus der Bahn zu werfen. Ihr war schon immer anzumerken gewesen, dass sie viele Jahre lang in einem reinen Männerhaushalt gelebt hatte. Sie teilte derlei Hiebe aus, steckte sie aber auch problemlos ein. Till, einer von Fynns älteren Brüdern, hatte das deutlich zu spüren bekommen, als er ihr in leicht angetrunkenem Zustand an den Po gefasst hatte. Er konnte von Glück sagen, dass er damals mit einer Standpauke davongekommen war …
Fynn wollte Josefine gern in den Arm nehmen, wie man das eben so machte, wenn man alte Bekannte traf. Doch ihre vor der Brust verschränkten Arme erinnerten ihn rechtzeitig daran, dass sie das noch nie hatte leiden können. Sie war das einzige Mädchen aus seinem Jahrgang, das er nie umarmt hatte. Nicht einmal bei der Verabschiedung nach dem Abiball. Dabei war sie die Einzige gewesen, die er wirklich in seinen Armen hatte halten wollen.
Zu seiner eigenen Verwirrung hatte sich daran bis heute nichts geändert. So zumindest signalisierte es ihm sein heftig klopfendes Herz. Gleichzeitig wurde ihm bewusst, dass Josefine mit ihrer herausfordernden Bemerkung nicht ganz falschlag. Er war offenbar nie erwachsen geworden, wenn er immer noch jener jugendlichen Schwärmerei nachhing. Immerhin wusste er nicht, was Josefine in den vergangenen Jahren getan und erlebt, in welche Richtung sie sich entwickelt hatte.
Und ja – er konnte ein Grinsen nicht unterdrücken –, es gab tatsächlich etliche Zeitgenossen, die behaupteten, er würde wohl nie erwachsen werden.
»Gibt es einen Grund, weshalb du hier bist, oder genießt du nur die Aussicht?«, fragte Josefine gegen das laute Brausen der Blätter und eine weitere kräftige Windbö an.
»Es gibt sogar einen sehr guten Grund.« Ich musste dich einfach sehen!
»Da bin ich aber beruhigt. Ich hatte schon befürchtet, dass du in diesen Gemäuern ein geheimes Zimmer mit einem Schatz vermutest.«
Fynn öffnete den Mund und schloss ihn sofort wieder – wie ein Fisch auf dem Trockenen. Demnach hatte Josefine von seinen Schatzsucher-Aktivitäten gehört und über seine Erfolge und Eskapaden in der Zeitung gelesen. Prompt fragte er sich, ob das seinem Vorhaben nun zuträglich oder eher hinderlich war.
»Ich gehe jetzt mal meinen Opa besuchen. Sobald du deine Sprache wiedergefunden hast, kannst du mir ja erzählen, was du hier tust.« Sie zuckte mit den Schultern. Versuchte sie so zu demonstrieren, dass es sie nicht interessierte, weshalb er hier war?
Zielstrebig wollte Josefine an ihm vorbei- und auf die Pforte zugehen, doch Fynn ergriff sie rasch am Unterarm. Der dünne Stoff ihres Shirts, dessen Schnitt und Farbe vermuten ließen, dass es – ebenso wie der wild um ihre Beine flatternde Rock – aus dem Ökoladen stammte, ließ die Wärme ihrer Haut durch. Der Ausdruck in ihren Augen kühlte das angenehme Gefühl, das ihn durchströmte, jedoch sofort wieder auf Normaltemperatur herunter. Schnell, wenn auch widerwillig, zog er die Hand zurück.
»Ich wollte dich fragen, ob du mich deinem Großvater vorstellen kannst.«
»Du hast ihn doch schon oft getroffen.«
»Das weiß ich. Doch ich vermute, dass er sich nicht mehr an mich erinnert.«
»Er ist alt, aber nicht –«
»Ich dachte nur, weil es ja schon viele Jahre her ist, dass wir uns zuletzt begegnet sind.«
Ihrer Andeutung, die er jäh unterbrochen hatte, entnahm Fynn, dass Josefines Großvater geistig noch vollkommen fit war. Das freute ihn, schließlich wollte er mit Johannes Korell über dessen Vergangenheit sprechen.
Josefine sah ihn prüfend an, dann huschte ein Grinsen über ihr Gesicht, das ihn eigentlich hätte warnen sollen. Davor, dass Johannes ein überaus kluger Kopf war; einer, der nicht so schnell vergaß …
i
JOSEFINE
Fynns unvermutetes Auftauchen hatte Josefines ohnehin in Aufruhr versetzte Welt noch mehr durcheinandergeworfen. So sehr, dass sie tatsächlich zugestimmt hatte, ihn zu Johannes mitzunehmen.
Erst als Fynn ihr über den langen Flur folgte und gemeinsam mit ihr an den geschlossenen Zimmertüren vorbeiging, fragte sie sich, weshalb sie ihm das eigentlich gestattete. Lag es an ihrer Furcht davor, in welcher Verfassung sie ihren Großvater antreffen würde? Dass sie ihm vielleicht ansehen könnte, dass die letzten Tage, womöglich sogar die letzten Stunden seines irdischen Daseins eingeläutet waren? Oder entstammte ihre Erleichterung über Fynns Begleitung vielmehr der Sorge, am Ende vollkommen allein zurückzubleiben?
Fynns Anwesenheit verwirrte sie. Sie konnte mit diesem Gemenge aus Überraschung, Freude und Zuneigung – und dem damit einhergehenden Misstrauen ihm gegenüber – einfach nicht umgehen. Entsprechend zögerlich blieb sie vor Johannes’ Zimmertür stehen.
Ihr Großvater würde im Bett liegen, da er seit zwei Tagen zu schwach war, um sich im Rollstuhl aufrecht zu halten. Diese Schwäche raubte ihm noch mehr von seiner Freiheit. Der Gedanke verstärkte ihre Angst um ihn und jagte einen kalten Schauer durch sie hindurch.
Als hätte Fynn dies bemerkt, legte er beschützend eine Hand in ihren Rücken. Das Gefühlspotpourri, das daraufhin wie ein Wirbelsturm durch ihr Inneres fegte, war zu viel für sie. Josefine drehte sich ruckartig zu Fynn um und zwang ihn somit, seine Hand wegzunehmen und sogar einen Schritt zurückzuweichen.
»Kannst du dich einem älteren Herrn gegenüber überhaupt angemessen benehmen?« Sie wusste, dass die Frage zutiefst unhöflich klingen musste, aber ihr Kopf wollte einfach nicht akzeptieren, dass Fynn Gröner wieder in ihr Leben getreten war. Ihr Herz fand das offenbar noch wesentlich verwirrender, wie es durch heftiges Klopfen verriet. Es fühlte sich so an, als stolperte es über sich selbst.
Eine Zeit lang hatte Josefine Fynn erfolgreich vergessen können. Den Nachbarsjungen, der früher mit jedem Mädchen geflirtet hatte, sodass Josefine ihn als uninteressant hatte abtun wollen, was ihr allerdings nicht wirklich gelungen war. Bis er endlich aus ihrem Leben verschwunden war.
»Ich bin der geborene Charmeur, das weißt du doch.«
»Fynn, ich habe dich zuletzt vor zehn Jahren gesehen. Damals warst du ein frecher Kerl und hast mir den Eindruck vermittelt, nicht aus der Pubertät herausgekommen zu sein.« Und du warst unglaublich einfühlsam, hilfsbereit, humorvoll und zielstrebig …
Er sah sie bittend an, aus Augen, deren Farbe sie nach wie vor nicht klar definieren konnte. Es fanden sich darin sowohl blaue als auch grüne Sprenkel, die je nach Lichteinfall gelegentlich sogar ins Graue changierten. In dieser undefinierbaren Augenfarbe spiegelte sich auch Fynns Charakter wider: undurchschaubar, mal leichtlebig und dennoch willensstark; schlicht nicht greifbar.
»Ich werde höflich sein, Jo. Und wenn du meinst, dass ich gehen soll, gibst du mir ein Zeichen, und ich verlasse augenblicklich das Zimmer.«
»Es geht ihm nicht gut.« Dies auszusprechen, machte den drohenden Verlust des geliebten Großvaters für Josefine erschreckend real.
»Das habe ich schon gehört«, erwiderte Fynn ungewöhnlich sanft.
Josefine runzelte dennoch die Stirn. Hatte ihn tatsächlich jemand über den Gesundheitszustand ihres Großvaters informiert?
»Ich habe zu Hause erzählt, dass ich deinen Großvater etwas fragen muss. Meine Mutter ist Mitglied der hiesigen Hospizgruppe, und sie weiß ja, dass Johannes der einzige Verwandte ist, den du noch hast. Sagen wir mal so: Sie hat ihrer Besorgnis Ausdruck verliehen und meinte, es sei an der Zeit, nach dir zu sehen. Ich musste dann nur noch eins und eins zusammenzählen, und wie du weißt, war ich in Mathe schon immer ein Genie.«
Josefine nickte zögerlich. Für eine sarkastische Entgegnung wegen seines übersteigerten Selbstbewusstseins fehlte ihr die Energie. Und außerdem: Hatte er vorhin nicht gesagt, er wolle zu Johannes? Warum ging es jetzt plötzlich um sie?
Josefine kannte Fynns Mutter Silvia seit Kindheitstagen. Sie war eine jener mütterlich-warmherzigen Frauen, die leider auszusterben drohten; eine Mutter, die sechs Kinder konsequent und mit viel Liebe zu wertvollen Mitgliedern der Gesellschaft erzogen hatte. Nur Fynn schien aus der Reihe zu tanzen, obwohl er keineswegs ein schlechter Kerl war. Eher rastlos, extrem abenteuerlustig und gelegentlich ein bisschen respektlos.
Nein, Josefine konnte Silvia nicht böse sein, dass sie ihren Sohn über Johannes’ kritischen Gesundheitszustand informiert hatte. Immerhin hatte Silvia damit auch ihre Sorge um Josefines Wohlergehen zum Ausdruck gebracht.
Als könnte Fynn ihre Gedanken lesen, sagte er: »Sie ist eine Mutter. Für sie bleibt ein Kind immer ein Kind, egal wie alt es ist.«
Darauf hoffend, dass er ihr den in ihrem Inneren leise vor sich hin gärenden Schmerz nicht ansehen konnte, nickte Josefine Fynn zu. Mütterliche Zuneigung und den liebevoll-weisen Ratschlag einer weiblichen Bezugsperson vermisste sie seit vielen, vielen Jahren. Es war ein ungewohntes, aber durchaus angenehmes Gefühl, zu wissen, dass sich wenigstens die Mutter eines anderen um sie sorgte. Dies fühlte sich so an, als lege jemand eine warme, weiche Decke um sie, in der sie sich bergen konnte.
Josefine richtete sich auf, klopfte kräftig an das Türblatt und trat dann ein. Da aufgrund des trüben Wetters nur wenig Licht in Johannes’ Zimmer drang, lag dieses in einem beklemmend anmutenden Dämmerlicht. Die Gesichtsfarbe ihres Großvaters hatte eine ähnliche Nuance angenommen wie die Sturmwolken draußen am Himmel, was Josefine erschrocken nach Luft schnappen ließ. Es war nicht zu übersehen, dass es ihm sehr schlecht ging. Seine Augen unter den buschigen grauen Augenbrauen lagen in tiefen Höhlen. Er war unrasiert, vermutlich weil das Pflegepersonal ihn in seinem Zustand nicht mit Alltagsdingen plagen wollte, die er selbst als eher unwichtig erachtete.
Kälte ergriff Besitz von ihr und brachte Josefines Beine zum Zittern. Langsam, weil sie das Gefühl überkam, lieber vor der Realität fliehen zu wollen, trat sie an das funktionale Pflegebett. Sie legte eine Hand auf die Metallstange des Kopfteils, beugte sich vor und drückte ihrem Großvater einen Kuss auf die Stirn. Diese fühlte sich angenehm warm an, und seine Haut roch so vertraut. Nach Olivenseife, seinem Aftershave und der ihm eigenen, leicht herben Note.
»Opa?«
Johannes schlug sofort die Augen auf, sah Josefine an und lächelte, wobei sein linker Mundwinkel ein wenig höher wanderte als der rechte. Das war schon immer so gewesen, und in diesem Moment empfand Josefine die Eigenheit ihres Großvaters als besonders tröstend.
»Haben sie dir Angst eingejagt?«, fragte er mit leiser Stimme, die so brüchig war wie ein Stück uraltes Pergament.
»Ein wenig«, gab Josefine zu. Sie hatte ihm nie etwas vormachen können, also würde sie heute nicht damit anfangen.
»Das tut mir leid.« Mehr sagte er nicht. Nicht einen Ton darüber, dass sie sich keine Sorgen um ihn zu machen brauche. Nichts davon, dass er sich schon wieder aufrappeln würde. Er war nicht der Typ, der die Dinge verharmloste oder seine Enkelin anlog, und sei es nur, um sie zu beruhigen. Und genau das liebte sie an ihm.
»Hast du dir endlich einen Kerl geangelt?« Mit diesen Worten blickte Johannes an Josefine vorbei in Richtung Tür, wo Fynn im Rahmen lehnte. Als sei dies sein Stichwort, stieß er sich ab und trat neben Josefine ans Pflegebett.
»Ganz sicher nicht. Ich habe ihn vor der Eingangstür aufgegabelt. Erinnerst du dich an –«
»… diesen Hallodri, der einem stets weismachen will, dass oben links ist und unten rechts? Den Lümmel, der mitten in der Nacht einen Schneeball an dein Fenster werfen wollte und stattdessen meins traf?«
Josefine zuckte zurück und bedachte Fynn mit einem irritierten Seitenblick. Die Vorstellung, dass er sie des Nachts aus dem Bett hatte holen wollen, verwirrte sie und brachte ihre Gefühlswelt mächtig durcheinander.
»Ich hoffe, du hast ihm damals ordentlich die Meinung gegeigt«, sagte sie und klang dabei wesentlich aufgebrachter, als sie es war. Je länger sie sich die Situation vorstellte, umso lustiger fand sie sie.
»Darauf kannst du wetten! Ich denke, ab der Nacht hat er keinen Versuch mehr gestartet, sich dir zu nähern.« Johannes’ Blick nagelte seinen männlichen Besucher förmlich fest, sodass der verlegen die Lippen zusammenpresste.
»Wann war das noch gleich?«, hakte Josefine nach, um Fynn zu ärgern. Er hatte nie Interesse an ihr gezeigt, aber das brauchte sie ihrem Großvater ja nicht zu verraten. Dessen Bärbeißigkeit Fynn gegenüber gefiel ihr. Ebenso wie der Glanz in Johannes’ Augen, die jetzt deutlich lebendiger wirkten als noch vor wenigen Augenblicken. Vielleicht tat ihm die Konfrontation mit dem Lümmel von damals gut.
»Nicht so wichtig«, murmelte Fynn, was Josefine zum Lachen brachte. Er schien auffällig darum bemüht zu sein, das Thema nicht unnötig breitzutreten.
Johannes runzelte die Stirn, wobei sich seine Augenbrauen missbilligend zusammenzogen, gleich darauf bedachte er Josefine mit einem Zwinkern. Sie spürte, wie sich die Sorgenwolken allmählich lichteten. Zwar ließen sie immer noch keinen heiteren Sonnenschein in ihr Herz fallen, doch das Gefühl drohenden Schmerzes begann sich zu verflüchtigen.
»Wäre es möglich, dass ich Ihnen ein paar Fragen stelle, Herr Korell?«, erkundigte sich Fynn höflich. »Wie Sie vielleicht wissen, habe ich Geschichte studiert und interessiere mich für die genauen Hintergründe zu Ereignissen einzelner Epochen, die –«
»Du bist ein Schatzsucher! Oder denkst du, ich lese keine Zeitung?«
Nun verspürte Josefine ein klein wenig Mitleid mit Fynn. Johannes schien seinem Überraschungsgast gegenüber gehörig auf Krawall gebürstet zu sein; etwas, was sie bei ihrem Großvater nur selten einmal erlebt hatte.
»Die Artefakte, die mein Team und ich in den letzten Jahren gefunden haben, haben wir stets den jeweiligen Museen zukommen lassen. Für uns ist es wichtig, dass kulturelle Wertgegenstände aus vergangenen Epochen der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden. Wir dürfen aus ihnen lernen, wie die Menschheit einst gelebt und gedacht hat. Wir –«
Wieder fiel Johannes ihm ins Wort, etwas, wofür er Josefine früher immer gemaßregelt hatte. »Das hast du schön auswendig gelernt, Lümmel! Aber jetzt holt euch endlich Stühle, damit ich nicht länger den Eindruck habe, dass ihr in ein Aquarium schaut. Wobei ich einen bezaubernd schillernden Goldfisch abgebe, das ist mal sicher!«
Ich finde, du wirkst eher wie ein Hai. Josefine lachte leise vor sich hin, während sie das einzige Sitzmöbel im Raum unter dem kleinen Tisch hervorzog und es Fynn hinschob.
»Nimm du ihn«, winkte Fynn ab, »ich besorge mir einen anderen Stuhl.«
»He, sollte dem Lümmel tatsächlich noch jemand Manieren beigebracht haben?«, stichelte Johannes prompt, was Josefine erneut auflachen ließ. Dennoch widersprach sie: »Setz dich. Ich kenne mich hier besser aus als du.«
Fynn öffnete den Mund, um zu protestieren, doch Johannes war schneller. »Sie ist kein schwaches Mädchen, das betüddelt werden muss. Die gab es in unserer Familie nie!«
»Das glaube ich gern«, murmelte Fynn und setzte sich.
Josefine ging Richtung Tür, war sich allerdings unschlüssig, ob sie den Lümmel wirklich mit ihrem Großvater allein lassen sollte.
»Und da sind wir auch schon beim Thema. Ihre Familie. Mich würde interessieren –«
Bereits im Flur angelangt, hörte Josefine, wie Johannes den Besucher anraunzte: »Genau! Meine Familie. Und in der ist Josefine der allergrößte und wertvollste Schatz. Sie ist mein Schatz und bleibt es auch. Also such du dir gefälligst einen anderen.«
Den Vergleich ihres Großvaters mit Gollum, der sich in diesem Augenblick bei ihr einnisten wollte, schob Josefine energisch beiseite. Johannes war ein ehrlicher, starker und bewundernswerter Mann, selbst jetzt noch, da er geschwächt im Bett lag. Er wollte sie beschützen. Vor dem Lümmel, der einst einen Schneeball gegen das falsche Fenster geworfen hatte?
Bei der Vorstellung, was Johannes – gekleidet in einen seiner karierten Flanellschlafanzüge – in den Garten hinuntergerufen haben könnte, um dem frechen Kerl Beine zu machen, kicherte Josefine vor sich hin.
Während sie zur nächstgelegenen Sitzecke eilte, musste sie sich eingestehen, dass sie einerseits über Fynn verärgert war, weil der offenbar vermutete, ihr Großvater könne über nützliche Informationen hinsichtlich einer seiner Schatzsuchen verfügen – was sie selbst für absoluten Blödsinn hielt! –, sie andererseits aber auch Dankbarkeit für seine Anwesenheit empfand. Vermutlich wäre ihr heutiger Besuch bei Johannes von nichts als Sorgen und düsteren Gedanken geprägt, wenn nicht dieser charmante Chaot mit dem zweifelhaften Ruf eines Schatzsuchers sie begleiten würde. Wobei das, was er sagte, stimmte: Die von ihm aufgespürten Raritäten waren Zeitzeugen vergangener Epochen. Es wäre schade, wenn sie für immer verschollen oder im Besitz einer einzelnen Familie bleiben würden, die behauptete, ein Anrecht darauf zu haben.
Bei einem kürzlich zu Ende gegangenen Gerichtsprozess ob einer solch privaten Inanspruchnahme hatte Fynns Team für jede Menge Aufsehen gesorgt. Letzten Endes waren die Gemälde, die während der 1930er-Jahre aus einem jüdischen Haushalt entwendet worden und in die Hände eines Nazis gelangt waren, zu ihrem rechtmäßigen Besitzer zurückgekehrt. Der wiederum hatte sie einem Museum zur Verfügung gestellt.
Das hieß aber noch lange nicht, dass Josefines Großvater von etwas Vergleichbarem wusste. Am besten wäre es wohl, Fynn einfach gewähren zu lassen. Dann würde er rasch zu dem Schluss kommen, dass Johannes nichts mit geraubten Familienerbstücken oder verschollenen Gemälden zu tun hatte. Genauso wenig wie mit antiken Steinkrügen und Münzen, ägyptischen Fayence-Arbeiten oder entwendeten Grabbeigaben irgendeines Pharaos, die einst unerlaubt Ägypten verlassen hatten.
Sobald ihr ehemaliger Schulkamerad akzeptierte, dass die Familien Kenkel und Korell noch nie einen historisch relevanten Gegenstand besessen hatten, würde er sicher wieder aus ihrem Leben verschwinden. Und sie könnte Fynn Gröner erneut aus ihrer Erinnerung löschen. Genauso, wie ihr das schon einmal gelungen war. Zumindest beinahe.
Zurück in Johannes’ Zimmer ließ sich Josefine neben Fynn nieder, achtete aber darauf, dass zwischen ihren Stühlen gut dreißig Zentimeter Platz blieben. Fynn war offensichtlich so schlau gewesen, die Drohung ihres Großvaters bezüglich der Enkelin ernst zu nehmen, denn die beiden Männer plauderten inzwischen entspannt über den VfB Stuttgart, wobei Johannes’ Stimme erneut ungewohnt leise und farblos klang. Seine Schwäche war ihm deutlich anzumerken.
Schließlich räusperte sich Fynn, und Josefine beugte sich gespannt nach vorn. Sie hatte keine Ahnung, welche Informationen sich der Schatzsucher von ihrem Großvater erhoffte. Allein der Gedanke, Johannes würde über ein geheimes Wissen verfügen, das sich Fynn unbedingt zu eigen machen wollte, erheiterte sie insgeheim.
Ihr Großvater hatte Medizin studiert und war bis zu seiner Pensionierung als Landarzt tätig gewesen. Im Krieg hatte er in einem Lazarett gearbeitet und sich dort für die verletzten und erkrankten Soldaten förmlich aufgerieben. Später hatte er dann ihre Großmutter Anne geheiratet. Wenn es bezüglich seiner Vergangenheit irgendetwas von Belang gäbe, wüsste Josefine davon. Denn Johannes war ein Meister darin, humorvolle oder aufregende Begebenheiten aus seinem Leben absolut fesselnd zum Besten zu geben. Dem war er mit Vergnügen nachgekommen, sodass sie bestimmt in alles eingeweiht war, was ihn jemals beschäftigt hatte.
»Sie waren bis 1945 in einem Lazarett in Kaliningrad stationiert«, begann Fynn sein Interview. Er hatte mit Johannes’ Einverständnis die Aufnahmefunktion seines Smartphones aktiviert.
Josefine verdrehte die Augen. So viel dazu, dass Fynn auch nur ansatzweise über ihren Großvater Bescheid wusste. Kaliningrad. Das war doch lächerlich!
»Das stimmt, wobei diese Perle von einer Stadt damals noch Königsberg hieß.«
Josefine riss die Augen auf. Johannes hatte in Kaliningrad gelebt? Das konnte doch unmöglich wahr sein!
Fynn nickte lächelnd, und Josefine beobachtete, wie sich seine Schultern lockerten, über die sich der Stoff seines dunkelblauen T-Shirts spannte. Er hatte sich von einem schlaksigen Jugendlichen zu einem breitschultrigen Mann entwickelt.
Offensichtlich erleichtert darüber, dass Johannes einen gesprächigen Eindruck machte, fuhr er sich durch das dunkelbraune Haar und fragte weiter: »Kannten Sie einen Mann namens Adolf Bardun?«
Ein Zischlaut vonseiten ihres Großvaters ließ Josefine hochschrecken. Sein ohnehin blasses Gesicht wurde noch eine Spur bleicher. Dann taxierte er Fynn mit einem Blick, der jeden anderen – außer diesen Abenteurer – wohl augenblicklich in die Flucht geschlagen hätte. Doch Fynn schien sich über Johannes’ Versuch, ihn mit den Augen zu erdolchen, vielmehr zu freuen. Ein wissendes Lächeln umspielte seine Lippen, und Josefine sah trotz des dunklen Dreitagebarts, wie sich die Kerbe in seinem Kinn vertiefte.
»Ja, ich kannte Bardun. Aber auf diese Bekanntschaft hätte ich gut und gerne verzichten können.« Johannes’ Stimme klang so kalt, dass sie Josefine eine Gänsehaut über die Arme schickte. Die Stimmung im Raum drohte zu kippen. War sie zuvor mit einer ordentlichen Prise Humor gewürzt gewesen, dem sich nur ein klein wenig Misstrauen beigemengt hatte, so lud sie sich nun auf und ballte sich zu einer dunklen Gewitterwolke zusammen.
Josefine rutschte auf ihrem Stuhl zurück und suchte Halt an der harten Rückenlehne. Das Gefühl zu fallen breitete sich in ihr aus. Sie stürzte aus dem sicheren Nest, das Johannes für sie gebaut hatte, hinein in – ja, was? In eine Vergangenheit, von der sie vielleicht lieber nichts wissen wollte?
Was ging hier nur vor sich? Hatte Fynn recht, und sie lag falsch? Ihr Großvater war in Königsberg stationiert gewesen? War dort irgendetwas vorgefallen, was er tief in seiner Erinnerung vergraben hatte? Hatte er gar ein Unrecht begangen? Sich illegalerweise Kulturgüter oder Wertgegenstände angeeignet?
Josefine wurde es schwindelig und sie befürchtete plötzlich, ihren Anker zu verlieren. Ihren Halt in jener stürmischen See, die sich Leben nennt. Und das noch bevor der Himmel beschloss, ihr Johannes wegzunehmen. Eiskalte Angst bemächtigte sich ihrer. Davor, dass ihr Großvater Geheimnisse vor ihr hatte, die sie ins Chaos stürzen und ihn in ein vollkommen anderes Licht rücken könnten als jenes heimelige orangefarbene Leuchten, das ihr Zufluchtsort gewesen war, ihre Heimat, einfach alles, was sie hatte.
Entrüstet über sich selbst, weil ihr Kopf die Zweifel überhaupt zuließ, ballte Josefine die Hände zu Fäusten. Nicht immer ging ein Unrecht oder gar ein Verbrechen mit dem Verschwinden von Kulturgütern und Wertgegenständen einher, ganz egal, was dieser Abenteurer da gerade andeuten wollte, der in ihre winzige Familie einzudringen versuchte wie ein Pickel ins Eis. Er würde ihre Liebe zu Johannes nicht zerschmettern!
Josefine hatte zwar nicht alle Berichte über Fynns Erfolge und Misserfolge gelesen, aber sie wusste, dass während eines der jüngeren Gerichtsverfahren ein paar widerliche Dinge im Leben eines geachteten Beamten ans Licht gezerrt worden waren. Sie wollte nicht, dass auch über der Vergangenheit ihres Großvaters eine sie hämisch angrinsende, hässliche Fratze hing.
»Muss das wirklich sein?« Ihre Stimme klang erschreckend zaghaft. Denn tief in ihrem Inneren schlummerte die Überzeugung, dass sie es wissen musste, falls es da etwas gab.
»Lass ihn, Josefine. Es ist ohnehin an der Zeit, darüber zu sprechen.«
Warum nur hätte sie sich am liebsten beide Ohren zugehalten und laut gesungen? Wie ein Kind, das sich krampfhaft darum bemüht, die Realität auszublenden …
»Wir haben in einem Archiv mehrere Schreiben von Adolf Bardun gefunden. In diesen beschuldigt er Sie und Ihren Bruder, das Bernsteinzimmer gestohlen zu haben.«
Josefine verschluckte sich und musste kräftig husten. Das war ja wirklich eine haarsträubende Anschuldigung! Erbost sprang sie auf. »Bist du noch ganz bei Trost? Das Bernsteinzimmer? Aus dem Katharinenpalast? Das Prunkzimmer, das die Wehrmacht gestohlen und in Königsberg …« Sie stolperte über ihre eigenen Worte. Denn Johannes war ja offenbar in Königsberg stationiert gewesen. Und sie hatte nichts davon gewusst.
Gewaltsam hielt sie ihre wie Schwalben davonfliegenden Gedanken beisammen. Das, was Fynn da andeutete, konnte nicht wahr sein. Es durfte nicht wahr sein. Mit der Wahrheit ist es doch wie mit der Freiheit, oder etwa nicht? Beides ist schwer zu definieren, schwierig zu erfassen.
Josefine schüttelte energisch den Kopf. Für die Freiheit mochte das zutreffen, immerhin bedeutete die persönliche Freiheit für jeden Menschen etwas völlig anderes. Aber wie war das mit der Wahrheit? Durfte sie unterschiedlich interpretiert werden? Dehnte man sie dann nicht nach eigenem Gutdünken, bog sie sich für die eigenen Zwecke zurecht? Gab es nicht einfach nur wahr und falsch?
Das Schweigen im Raum schien immer schwerer zu wiegen. Josefine atmete tief durch. Hatte sie die ganze Zeit über den Atem angehalten? Weil Fynn ihr nicht nur ihren Anker entreißen, sondern sie auch gleich über Bord stoßen wollte?
Energisch rief sie sich zur Vernunft. Ihr Großvater wusste nichts über das sagenumwobene, seit Ende des Zweiten Weltkriegs wie vom Erdboden verschluckte Bernsteinzimmer, dessen Wert auf mehr als 120 Millionen Euro geschätzt wurde – von seinem ideellen Wert einmal ganz abgesehen.
Johannes war kein Dieb! Es gab nirgends ein Versteck, in dem er das Bernsteinzimmer hätte lagern können. Die Behauptung war grotesk und unverschämt!
»Außerdem hatte Opa keinen Bruder.« Es kostete Josefine einige Mühe, nicht komplett die Beherrschung zu verlieren und Fynn anzubrüllen. Sie hob die Hand und deutete zur Tür. »Du gehst jetzt besser.«
Fynn schaute sie ernst an. Seine Augen funkelten in einem kühlen Grau, was Josefine frösteln ließ. Sie spiegelten Selbstsicherheit wider. Gewissheit. Er hielt ihren Blick eine Zeit lang fest, wobei sich ein leichter Grünton in seine Iriden schlich. Beinahe so, als wolle Fynn sie mit jener sanfteren Augenfarbe um Verzeihung bitten. Schließlich erhob er sich, bereit, das Feld zu räumen.
Josefine nahm dies erleichtert zur Kenntnis. Er hatte sicher nur einen Schuss ins Blaue gewagt und sah jetzt ein, wie unsinnig sein Ansinnen war.
»Sein Name war Helmut.«
»Wie bitte?« Josefine wirbelte zu ihrem Großvater herum.
»Mein Bruder hieß Helmut. Er war acht Jahre älter als ich.« Johannes’ Stimme klang, als ziehe jemand den Bogen über die Saiten einer nicht gestimmten Bratsche. Durchdringend und tief zugleich, disharmonisch und doch völlig klar.
Josefine fiel zurück auf den Stuhl und schüttelte fassungslos den Kopf.
»Junge, öffne mal den Kleiderschrank und hol die alte Metallkiste raus. Sie steht unten links.«
Josefine hörte am Quietschen der Schranktür, dass der Junge gehorchte. Gleich darauf stieß er sie leicht an. Da sie nicht reagierte, stellte er die Metalldose, in der einst Lebkuchen gewesen waren, einfach auf ihren Schoß.
Mit zitternden Händen hob sie den Deckel an. Das dünne Metall verzog sich, und die winzigen Scharniere quietschten, als wollten sie sich bei Josefine beschweren. Sie hätte die Dose auch lieber ungeöffnet in den Schrank zurückgestellt. Und Fynn augenblicklich aus dem Pflegeheim gejagt.
Ihre Augen weiteten sich. Auf dem dunkelblauen Samtstoff ruhte eine kleine Spieldose. Im Dämmerlicht des trüben Spätnachmittags schimmerte sie mattgolden. Josefine hob die Lebkuchendose an, um den Inhalt besser betrachten zu können. Prompt ließ der nun einfallende Lichtschein das kleine Schmuckstück in den wärmsten Farben erstrahlen. Sie kannte das fossile Harz, das zwischen hellem Gelb und lichten Brauntönen changierte. Bernstein.
Neben der filigran ausgearbeiteten Spieldose lag ein Brieföffner. Der aus dunklem, fast grünem Bernstein bestehende Griff war mit hauchzarten Gravuren versehen, über die Klinge zog sich eine Ranke mit Blättern und Weintrauben.
Erleichtert atmete Josefine auf. Woher auch immer Johannes diese beiden entzückenden Schmuckstücke hatte, sie waren definitiv nie Teil einer aus Bernstein gefertigten Wandverkleidung gewesen.
»Die Geschichte der beiden Schönheiten erzähle ich euch später«, flüsterte Johannes. Er hatte den Kopf ermattet zurückgelegt und hielt die Augen geschlossen. Saugte ihrer beider Anwesenheit jegliche Energie aus ihm heraus? Oder war sein Zustand vielmehr dem Inhalt der Metallbox geschuldet?
Josefine strich mit zitternden Fingern über den Samt und stockte. Unter dem Stoff ertastete sie noch etwas anderes. Zaghaft hob sie ihn an und legte ein seltsam geformtes Stück Bernstein frei. Instinktiv ließ sie es liegen; verbarg es vor Fynn.
Wie flüssiges Gold schimmerte das, was sie nicht zu berühren wagte. Es handelte sich um ein Bruchstück, das aussah, als habe man es mit roher Gewalt aus einem Kunstwerk herausgebrochen.
Königsberg, Bernstein … Josefine hob den Kopf und schaute ihren Großvater an, der tief atmete. Ob er vor Erschöpfung eingeschlafen war?
Fassungslos senkte sie den Blick wieder, nahm den Bernstein nun doch zur Hand und bewegte das gut zehn Zentimeter lange und an seiner breitesten Stelle etwa halb so große Bruchstück, als sei es ein Puzzleteil, das es im Gesamtbild unterzubringen galt.
Aber war es nicht genau so? Hielt sie nicht ein Stück aus Johannes’ Vergangenheit in der Hand, ohne zu wissen, wo es hingehörte, wie sie es einordnen sollte? Lag der Abenteurer Fynn richtig mit seiner Annahme, dass Johannes Korell etwas über den Verbleib des Bernsteinzimmers wusste?
Zwei
September 1941 – Sowjetunion, in einem Wald nahe Gattschina
HELMUT
Das Gesamtbild war entscheidend, dessen war sich Helmut Korell bewusst. Goebbels mochte in der Heimat über neuen Lebensraum und Freiheit für das deutsche Volk palavern, doch sie, die sie dafür sorgen sollten, meinte er damit nicht. Sie waren diejenigen, deren Freiheit beschnitten wurde. Andere bestimmten darüber, wann sie aßen und schliefen, wann sie weitermarschieren mussten oder Rast machten, und manchmal sogar, ob und wann sie pinkeln gehen durften. Während die Menschen in der Heimat jubelten, weil ihre tapferen Söhne, Brüder und Väter bereits weit in den Osten vorgedrungen waren, blickten ebenjene Tag für Tag aufs Neue der hässlichen Fratze des Todes ins Gesicht. Im Deutschen Reich hingegen bekamen sie nur Bruchstücke davon zu sehen, und zudem nicht die hässlichen schwarzen Splitter, sondern nur die glänzenden, strahlenden.
Helmut betrachtete die Ausläufer des hier vorherrschenden dunklen Mischwalds mit seinen mit Mücken verseuchten, sumpfigen Wiesen, dann richtete er den Blick auf die angrenzenden Felder links von sich, die jungfräulich unberührt dalagen. Zu seiner Rechten hingegen waren sie von Teilen der Heeresgruppe Nord, zu der er gehörte, niedergewalzt worden und sahen aufgewühlt, zerpflügt, ja regelrecht vergewaltigt aus. Als wäre es das größte Bestreben der Wehrmacht, eine möglichst tiefe Schneise der Verwüstung zu hinterlassen, damit man sich auch Jahre später noch an den rasanten Vormarsch des Deutschen Heeres Richtung Leningrad erinnern würde.
Helmut schüttelte den Kopf über seine eigenen Gedanken. Zumindest diese waren weiterhin frei, doch anstatt sie fliegen zu lassen, hielt er sie in einem Käfig aus Zerstörung, Schmerz und Zukunftsangst gefangen.
Schulterzuckend wandte er sich wieder der reinen Seele des Landstrichs zu seiner Linken zu. Er hatte nun mal Geschichte studiert, hatte Seite an Seite mit Archäologen im ägyptischen Sand gegraben und über längst vergangene Zeiten geschrieben. Also fand er es nur richtig, dass seine Gedanken jenen Weg einschlugen und sich damit auseinandersetzten, was wohl einst über diesen Feldzug in den Geschichtsbüchern stehen würde. Darüber, dass die deutsche Armee vor beinahe drei Monaten, im Morgengrauen des 22. Juni 1941, die Sowjetunion angegriffen hatte, und dies trotz eines deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakts. Über die 64 sowjetischen Flugplätze samt unzähliger am Boden stehender Flugzeuge, die bereits nach wenigen Stunden zerstört gewesen waren. Über die Luftangriffe auf größere Städte und darüber, dass die Detonationen die nichtsahnenden Einwohner aus dem Schlaf gerissen hatten. Darüber, dass man passgenau ein Jahr nach der französischen Kapitulation den Osten attackiert und dass Napoleon auf den Tag genau vor 129 Jahren den Fluss Neman in Richtung Moskau durchquert hatte …
Oder würden vielmehr Hitlers Worte aus dem Hörfunk der Nachwelt erhalten bleiben? Von schweren Sorgen bedrückt und zu monatelangem Schweigen verurteilt, ist nun die Stunde gekommen, in der ich endlich offen sprechen kann. Deutsches Volk! In diesem Augenblick vollzieht sich ein Aufmarsch, der in Ausdehnung und Umfang der größte ist, den die Welt bisher gesehen hat. Ich habe mich heute entschlossen, das Schicksal und die Zukunft des Deutschen Reichs und unseres Volkes wieder in die Hand unserer Soldaten zu legen. Möge uns der Herrgott gerade in diesem Kampfe helfen!1
Wenn Hitler den Herrgott nur ein wenig besser kennen würde …
Helmut sah auf, als er nicht weit von sich entfernt Bewegungen auf der unbefestigten, staubigen Straße wahrnahm. Zusammen mit den Wehrmachtstruppen rückte auch stets Himmlers Waffen-SS vor. Dieser folgten die Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes des Reichsführers SS.
Im ehemaligen Ferienort Ponar nahe Wilna, den sie schon lange hinter sich gelassen hatten, war ein jüdisches Getto errichtet worden, wohin nun viele sowjetische Bürger gebracht wurden. Allerdings marschierten diese Gefangenen hier in die falsche Richtung. Sie waren auf dem Weg in den jungfräulich unberührten Landstrich.
Helmut wollte sich gerade abwenden, als er eine Handvoll Frauen und Kinder zwischen den Männern entdeckte. Er runzelte die Stirn. Flankiert von Wehrmachtssoldaten, der SS und dem SD und angetrieben von einem SS-Scharführer, schleiften ihre Füße über den Boden und wirbelten Staub auf. Als hofften die Gefangenen, dass die unscheinbare Staubwolke von den Partisanen gesehen würde. Von jenen Schattengestalten, die von Nikita Chruschtschow dazu aufgerufen worden waren, sich in zehn bis zwanzig Mann starken Kommandos zu organisieren, um die Deutschen aus dem Hinterhalt zu überfallen.
Misstrauisch sah Helmut sich um. Er fürchtete die nadelstichartigen Überfälle der sowjetischen Partisanen mittlerweile so sehr, dass er sich sofort unbehaglich fühlte. Dennoch wanderte sein Blick zurück zu der Gruppe von vielleicht vierzig Gefangenen, die inzwischen an ihm vorübergezogen war.
Aus welchem Dorf nahe Gattschina sie wohl stammten? Und weshalb waren unter ihnen auch Frauen und Kinder? Diese gehörten doch nicht zu den Partisanen und politischen Kommissaren, die nach Jodels und Halders Kommissarbefehl ausgesondert werden mussten, damit sie keinen Einfluss auf die anderen Inhaftierten nehmen konnten. Ohnehin trugen zivile Hoheitsträger und politische Entscheidungsträger inzwischen einen roten Stern samt goldfarbenem Sichel- und Hammersymbol auf dem Ärmel. Ihnen blieb der völkerrechtliche Status eines Kriegsgefangenen verwehrt … Helmut wusste, was das für die Männer bedeutete. Sie wurden liquidiert.
Keine der traurigen grauen Gestalten dieser Gruppe trug ein solches Abzeichen. Als Letzter in der kleinen Kolonne ging ein etwa fünfjähriger Junge, dessen hellblondes, fast weißes Haar keck unter einer grau karierten Schiebermütze hervorspickte. Den Blick hatte er auf den großen rothaarigen SS-Mann gerichtet, der einige Schritte vor ihm ging und die Flanke absicherte, damit niemand einen Fluchtversuch wagte. Der Junge schien fasziniert zu sein von der Uniform, dem Gewehr und den blank polierten schwarzen Stiefeln des Mannes. Vermutlich gehörte er zu der Frau direkt vor ihm. Sie trug ein Kleinkind auf dem Arm, und an ihrer Hand stolperte ein etwa zweijähriges Mädchen mehr vorwärts, als dass es ging.
Helmut sah Schweiß über das Gesicht der Frau laufen. Ihr Rock hing schief um ihre Taille, und obwohl es an diesem Tag Anfang September nicht sonderlich warm war, trug sie keine Strümpfe. Es wirkte, als hätte sie sich überstürzt angekleidet. Die Männer vor ihr sahen wie Handwerker und Bauern aus, die Frauen wie Bäuerinnen und Hausfrauen. Darunter mischten sich mehrere Schulkinder, wie Helmut feststellte, ehe er sich endgültig abwandte.
Es wäre wohl besser, wenn er zu seiner Truppe zurückkehrte, bevor man ihn vermisste. Doch er brauchte diese kleinen Spaziergänge wie die Luft zum Atmen. Hin und wieder musste er weg von der lärmenden Kriegsmaschinerie und den nach Schweiß und Tod stinkenden Kameraden, die vorranging unflätige Äußerungen oder deprimierende Geschichten über die zurückgelassene Liebste zum Besten gaben. Vor allem aber benötigte er regelmäßige Verschnaufpausen von den patriotischen Schreihälsen. Und von all jenen, denen die Schrecken des Soldatendaseins bereits tiefe Spuren ins Gesicht und Narben in die Seele gegraben hatten.
Ja, sie alle waren unfrei, wenngleich die einen darum wussten, die anderen jedoch nicht. Und zu welcher Gruppe gehörte er?
Die Detonationen mehrerer Schüsse ließen Helmut zusammenzucken. Er warf sich zu Boden und schützte den Kopf mit den Armen. Todesangst rollte wie eine auf den Strand aufbrandende Welle über ihn hinweg. Er keuchte und brauchte einige Sekunden, bis ihm bewusst wurde, dass die Schüsse nicht ihm galten, sondern jenseits des bewaldeten Hügels gefallen waren. Genau dort, wohin die Gruppe gefangener Zivilisten geführt worden war. Genau dort?!
Helmut erhob sich und starrte ungläubig in Richtung der Anhöhe, auf der einige schlanke junge Birken wuchsen, deren Blätter ihm im leichten Westwind zuwinkten und dabei silbern schimmerten. Winkten sie ihn herbei oder leuchteten sie in der fahlen Abendsonne so hell auf, weil sie ihn warnen wollten?
Er gab ihrem Winken nach. Immerhin war er Historiker; einer, der den Geschehnissen auf den Grund ging. Er interessierte sich für die Menschen vergangener Epochen, für ihr Leben, ihr Streben, ihr Sterben. Denen im Hier und Jetzt galt sein Interesse für gewöhnlich nicht. Aber eine innere Stimme sagte ihm, dass er sich in diesem Fall zu interessieren hatte. Für den kleinen blonden Jungen mit der Schiebermütze, der von dem deutschen Eroberer so fasziniert gewesen war. Für die Mutter, für die Geschwister.
Helmut eilte zuerst direkt auf den Hügel zu, stürmte dann aber links daran vorbei. Seine Schritte wurden langsamer. Ihm war, als hielten unsichtbare Hände ihn zurück. Er fühlte sich wie eines der schweren Zugpferde, die ihren Tross begleiteten. Erst gestern hatten diese wieder einen Borgward-Lastkraftwagen der Nachschubkolonne, zu der Helmut gehörte, aus dem Graben ziehen müssen.
Dennoch ging Helmut weiter. Manchmal musste er sich selbst etwas beweisen. Dem Gelehrten, den man lieber nur einen Lastkraftwagen fahren ließ, statt ihm ein Gewehr in die Hand zu drücken. Weil man ihm den Mut aberkannte? Ihn für schwächlich hielt? Für zu empfindsam für den Kriegsalltag?
Mit letzterer Vermutung lagen die Entscheidungsträger durchaus richtig, und Helmut war froh, dass er normalerweise nicht auf Menschen schießen musste. Wären da nicht die Partisanen … Solche wie diese Gruppe von Dorfbewohnern, die man hinter den Hügel geführt hatte?
Zögernd nur, sich aber dennoch gewiss, dass er die letzten Schritte um das Gebüsch herum gehen musste, trat Helmut hinter den grünen Zweigen hervor. Vor ihm befand sich eine Grube, die Menschen verschlungen hatte. Sie lagen neben- und übereinander, mit dem Gesicht nach unten. Reglos, blutüberströmt, tot. Am Grubenrand standen mehrere Uniformierte, zwei davon in einer Wehrmachtsuniform, die anderen in der von SD und SS. Einer der Wehrmachtssoldaten deutete mit der Hand auf die Leiber vor sich. Der Wind trug seine Stimme zu Helmut herüber. »Der da lebt noch.«
Helmut sah die Bewegung in der Grube ebenfalls. Ein Bein streckte sich, das zweite lag unter dem eines anderen Mannes; doch auch dieses zuckte.
»Nicht mehr lange«, lachte der Rothaarige. »Schüttet die Erde wieder auf«, bellte er seinen Befehl über die Wiese, die ihre Jungfräulichkeit längst verloren hatte. Es gab sie nicht einmal hier, wo die Ketten und Räder der Fahrzeuge keine Wunden in den Boden schlugen, die Stiefel der Soldaten keine Abdrücke hinterließen.
Helmut schaute zu den Vergewaltigern der ländlichen Unschuld hinüber. Einer von ihnen, derjenige, der auf den lebenden Toten gedeutet hatte, übergab sich am Rand der Grube. Sein Körper verbog sich dabei zu einem Fragezeichen, während er versuchte, all das, was er getan und gesehen hatte – und noch sehen würde –, aus sich herauszuwürgen.
Hatte man dem Soldaten die Freiheit zugestanden, Nein zu sagen, ihm die Wahl gelassen, nicht zur Waffe zu greifen? Vermutlich schon. Aber im Deutschen Reich wollte niemand als schwächlich gelten.
Einer der SS-Männer klopfte dem menschlichen Fragezeichen lachend auf die Schulter, ein anderer näherte sich dem Graben, zückte seine Luger und erschoss den einzigen Überlebenden des Massakers. Gnade in ihrer hässlichsten Form.
Helmut wollte sich gerade abwenden, denn er glaubte, eine wabernde schwarze Wolke aus der Grube aufsteigen zu sehen. Diese drängte mit Vehemenz in sein Herz, seinen Verstand und seine Gefühle. Da entdeckte er den blonden Jungen, dem noch immer die Schiebermütze auf dem Kopf saß. Als wäre er mit ihr geboren worden, trug er sie auch im Tode.
Was war nur mit ihnen allen geschehen? Warum verrieten sie die Liebe ihrer Mütter? Indem sie die Söhne anderer Mütter töteten, Frauen und Kinder erschossen. Die dunkle Wolke ergriff Helmut, schüttelte ihn, würgte ihn. Eilig wandte er sich um und wünschte, er hätte den Fuß nie weiter von der Nachschubkolonne entfernt als bis zu dem Baum, an dem er sich erleichtert hatte. Er wünschte, er könnte sich wieder hinter Steinen und jahrhundertealten Tonscherben verstecken, wünschte, Gott würde eingreifen.
Aber eines hatte er in den 32 Jahren seines Lebens gelernt: Gott ließ jedem seiner Geschöpfe die Freiheit, das zu tun, was er oder sie für richtig hielt. Nicht weil ihm alles gleichgültig wäre, sondern weil die Menschen sich aus freien Stücken für ihn entscheiden sollten. Für die Liebe. Für die Regeln, die er zum Wohle der Menschheit aufgestellt hatte. Das war Freiheit. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus. Du sollst nicht töten. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir …
Heil Hitler.
Sie alle hatten die Regeln des menschlichen Miteinanders gebrochen, die jedem Einzelnen von ihnen Freiheit versprachen. Jetzt mussten sie mit den Folgen leben. Sie alle, auch Helmut.
Drei
April 2018 – Staigacker bei Backnang
JOSEFINE
Ihr Großvater schob den mobilen Betttisch beiseite, auf dem das Tablett mit der Abendmahlzeit stand. Mehr als ein paar Löffel Grießbrei mit Zucker und Zimt und zwei Bissen von dem mit Lyonerwurst belegten Brot hatte er nicht zu sich genommen. Doch Josefine drängte ihn nicht, mehr zu essen. Er sollte die Freiheit haben, selbst über sich und seinen Körper zu entscheiden.
Johannes nahm einen Schluck Tee und fragte: »Wusstet ihr eigentlich, dass die württembergische Königin Olga, eine gebürtige Zarentochter, dieses Pflegeheim hier gegründet hat? Als Folge der Armut im Land?«
Fynn nickte. »Sie hat eine Menge wohltätiger Einrichtungen ins Leben gerufen. So auch den württembergischen Sanitätsverein, der schließlich zur ersten nationalen Rotkreuz-Gesellschaft wurde. Dazu die Nikolauspflege, die heute noch ein Zentrum für sehbehinderte Menschen ist. Und sie übernahm die Schirmherrschaft für das Stuttgarter Kinderkrankenhaus Olgäle. Die Dame hatte ein Herz für benachteiligte Menschen, was ihr die Zuneigung der Stuttgarter, ja der ganzen württembergischen Bevölkerung einbrachte. Sie liebten ihre Königin Olga!«
»Sieh an, der Lümmel hat ja doch etwas gelernt und nicht nur Schneebälle geworfen.«
Fynn und Johannes musterten einander, dann grinsten sie, was Josefine die Augen verdrehen ließ. Sie verstand einfach nicht, warum dem Abenteurer immerzu alle Herzen zuflogen und weshalb er stets das Vertrauen seiner Mitmenschen gewann. Das war schon in der Schule so gewesen. Selbst die strengsten Lehrer hatten ihm seine Späße durchgehen lassen, vermutlich weil er trotzdem zu den Klassenbesten gehört hatte. So wie Josefine, die sich ihren Erfolg allerdings mit Fleiß und Disziplin erarbeitet hatte.