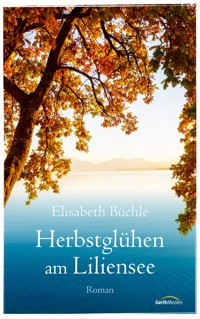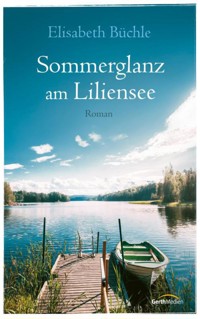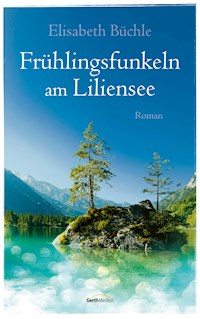8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gerth Medien
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Felicitas hat trotz ihrer jüdischer Wurzeln Nazideutschland überlebt. Ein unerwartetes Erbe führt die junge Frau Anfang der 1960er-Jahre in den Süden der Vereinigten Staaten, mitten hinein in die brodelnden Rassenunruhen. Trotz aller Warnungen freundet sie sich mit ihren farbigen Nachbarn an - und macht sich damit rasch Feinde, die bereit sind, bis zum Äußersten zu gehen. Welchem ihrer neuen Nachbarn kann sie trauen? Ein riskantes Verwirrspiel inmitten der aufgeheizten Stimmung am Mississippi nimmt seinen Lauf ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 744
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Über die Autorin
Elisabeth Büchle ist gelernte Bürokauffrau, examinierte Altenpflegerin und seit ihrer Kindheit ein Bücherwurm. Schon früh begann sie, eigene Geschichten zu Papier zu bringen. In ihren Romanen bettet sie romantische Liebesgeschichten in gründlich recherchierte historische Kontexte ein. Mit ihrem Mann und den jüngeren ihrer fünf Kinder lebt sie im süddeutschen Raum. Mehr Informationen über die Autorin unter www.elisabeth-büchle.de.
Für Jonathan
Prolog
Spätsommer 1961
Fabienne Chevalier warf zum wiederholten Mal einen Blick in den Rückspiegel. Ein Wagen folgte ihr, wie an den kreisrunden Scheinwerfern unschwer erkennbar war. Das war ungewöhnlich. Vor allem zu dieser nächtlichen Stunde.
Erschöpft strich sie sich den Schweiß von der Stirn. Ihr Gesicht war für ihre 48 Jahre erstaunlich faltenfrei, dafür hob sich die Narbe auf ihrer Wange umso deutlicher hervor.
Schwüle Hitze beherrschte die Nacht. Ein weißer Mond stand fast perfekt rund am Firmament und tauchte die Landschaft in ein blaues Licht. Der Mississippi wälzte sich brodelnd unter der alten Holzbrücke hindurch. Fabienne lenkte ihr Automobil vorsichtig über die knarrenden Holzbretter, kurz darauf rumpelte sie über die Schienen, die in Richtung des Holzfällerlagers und des Sägewerks führten.
In dem von Schwarzen bewohnten Dorf brannte kein Licht. Friedliche Stille lag über den einfachen Hütten und Anbauten. Trotz des lauten Motors hörte Fabienne eine Kuh in ihrem Verschlag brüllen, untermalt vom endlosen, schrillen Zirpen der Grillen.
Die Schlaglöcher in der nicht befestigten Straße zwangen sie, langsamer zu fahren. Hinter ihr kamen die Autoscheinwerfer näher. Sie verließ die Ansammlung der heruntergekommenen Hütten und drückte das Gaspedal durch. Das Land war durchzogen von Bodenwellen, über die die schnurgerade Piste hinwegführte. Links und rechts erhoben sich dunkle Baumriesen und ließen das Mondlicht nur sporadisch durch.
Schließlich erreichte Fabienne ihr Ziel. Sie hielt am Straßenrand, stellte den Motor ab und schaute erneut in den Innenspiegel. Das Fahrzeug, das ihr folgte, hatte ebenfalls nicht im Dorf angehalten. Soeben verschwanden seine Scheinwerfer in einer Senke und tauchten gleich darauf auf dem Hügelkamm wieder auf. Das flaue Gefühl in ihrer Magengegend nahm zu. Mühsam kurbelte sie das Fenster hoch, griff nach ihrer Handtasche und stieg aus.
Der Pick-up hielt auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Über die Melodie der Grillen und das laute Knattern des Motors hinweg hörte sie, wie ratschend die Handbremse festgestellt wurde. Der Fahrer verließ seinen Wagen. Er ließ den Motor laufen, und die Scheinwerfer beleuchteten die sandige Piste bis zur nächsten Bodenwelle.
Der schwarze Schatten, der auf Fabienne zukam, ging leicht gebeugt, als wolle er etwas verbergen.
Der Mann trat ins Mondlicht und Fabienne atmete erleichtert auf. „Sie sind es“, sagte sie und lächelte. „Kann ich etwas für Sie tun?“
„Ja. Sterben Sie.“
Fabienne taumelte unwillkürlich einen Schritt zurück. Sie tastete nach der offen stehenden Fahrertür. In den sonst so freundlichen Augen des Mannes lag ein gefährliches Glitzern. Erst jetzt bemerkte sie, dass er eine Schusswaffe in der Hand hielt.
„Was ...?“
Sie kam nicht mehr dazu, den Satz zu Ende zu bringen. Die Pistole spuckte Feuer, brachte Lärm, Schmerz und Tod.
Teil 1
Februar – April 1963
„… Neunzehnhundertdreiundsechzig ist kein Ende, sondern ein Anfang …“
Martin Luther King1
1. Kapitel
Mit einem unüberhörbaren Klatschen landeten die Fotografien auf dem Verkaufstresen und wirbelten ein paar beschriebene Notizzettel gleich einem aufgescheuchten Mückenschwarm umher. Felicitas bemühte sich, die Papiere einzufangen, stieß dabei allerdings gegen ihr Wasserglas. Es kippte und der Inhalt ergoss sich auf die polierte Holzfläche. Die 26-Jährige brachte die Bilder rasch in Sicherheit und drehte sich dann zu ihrem aufgebrachten Chef um.
„Was hast du dir nur dabei gedacht?“ Der ältere Herr mit dem gepflegten grauen Schnauzer schüttelte verständnislos den Kopf.
Felicitas drückte ihm die Fotografien, die seinen Ärger ausgelöst hatten, in die Hand und begab sich auf die Suche nach einem Tuch, um der sich ausbreitenden Wasserlache auf dem Tresen Herr zu werden.
„Ich wollte die Notizen einfangen“, rief sie dem Fotografen zu, wohl wissend, dass er nicht auf ihr Missgeschick angespielt hatte. Ihre grünen Augen blitzten vor Schalk.
„Frau Birkenbach bringt ihre beiden Buben in dunklen Anzügen, mit weißen Hemden, umgebundenen Fliegen und dazu frisch frisiert zu uns, und du hast tatsächlich angenommen, dass sie damit einverstanden ist, dass du ihnen die Fliegen entfernst, die Hemden aus den Hosen ziehst, ihre Haare zerzaust und sie auf einem Strohballen in einem Schuppen ablichtest?“ Heinz März behielt nur mühsam beherrscht die stoische Ruhe bei, die ihm sonst zu eigen war, was Felicitas jedoch nicht weiter beeindruckte. Sie würden auch diese Aufregung gemeinsam durchstehen und anschließend weiterarbeiten wie bisher.
„Sie kennen doch die Birkenbach-Jungen, Herr März? Das sind wilde Raufbolde. Das sind diejenigen, die Ihnen letzte Woche mit einem Stein im Schneeball die Scheibe eingeworfen haben.“
„Und deshalb meinst du, dass du sie und ihre Mutter bestrafen musst?“
„Nein, ich wollte die beiden so fotografieren, wie sie nun einmal sind: normale Kinder und keine snobistischen, wie Balzhähne ausstaffierten kleinen Erwachsenen!“
Heinz hob die Fotografien dicht vor die Augen und musterte die Kinder. Sie versteckten die Hände in den Hosentaschen, lehnten Rücken an Rücken und grinsten in seine Richtung. Wieder gefasster wartete er, bis Felicitas den Tresen trocken gewischt hatte, ehe er die Bilder erneut vor ihr ausbreitete. „Diese Fotos sind exzellent, und das weißt du, Fräulein. Aber Frau Birkenbach hatte bestimmt etwas anderes im Sinn, als sie die Rabauken so snobistisch ausstaffiert zu uns geschickt hat.“
Felicitas zuckte eigensinnig mit den Schultern. „Und ich dachte, die Eltern möchten ihre Kinder fotografiert haben, so wie sie wirklich sind. Wir könnten in Zukunft Puppen mit den Sonntagskleidern der Kinder ausstaffieren und …“
„Felicitas?“, fragte der Mann geduldig.
„Ja, Herr März. Bevor ich die Lausbuben in ihren Normalzustand zurückversetzt habe, habe ich selbstverständlich anständige Studioaufnahmen von ihnen gemacht“, gestand Felicitas endlich. Sie zog eine braune Papiertüte aus der Ablage und reichte ihm die Abzüge mit den steif dastehenden Jungen, die brav in die Kamera lächelten. Nach einem flüchtigen Blick auf die Bilder brummte Heinz versöhnlich.
„Dann werfe ich diese hier weg.“ Felicitas ließ die der Familie zuerst ausgehändigten Fotografien in den Papierkorb unter dem Tisch gleiten.
„Schade drum. Du solltest sie nicht wegwerfen.“
„Wozu sollte ich sie aufheben? Die will doch niemand!“
Ihr Chef hielt das Thema damit anscheinend für ausreichend diskutiert, denn er griff nach Hut und Mantel und schritt zur gläsernen Eingangstür seines Fotostudios. „Ich bringe die Bilder persönlich zu den Birkenbachs und entschuldige mich angemessen. Sieh du zu, dass das Schaufenster heute noch fertig wird.“ Vom leisen Läuten des Türglöckchens begleitet trat Heinz hinaus auf die verschneite Hauptstraße.
Felicitas räumte den nassen Lappen in die Dunkelkammer und kletterte in das beengte, fast leere Schaufenster.
Mit ihrem guten Auge für Details stellte sie die gerahmten Hochzeitsfotos in die Ecke, drapierte den Zylinder und den Schleier daneben und verließ dann ebenfalls den Laden, um die Dekoration von außen zu betrachten. Mehrere frisch angetraute Ehepaare blickten ihr von den Fotos teils ernst, teils zaghaft lächelnd entgegen, während zwei Kleinkinder mit Pausbacken sie missmutig anschauten und selbst auf der Fotografie noch um ihr Gleichgewicht zu kämpfen schienen. Einige der Bilder waren in Schwarz-weiß, andere Familien hatten sich die deutlich teureren Farbfotografien geleistet.
Die Fotografin rieb sich mit klammen Händen über die geröteten Wangen. Ihr Blick ruhte auf der Lücke zwischen den Kinderfotos und dem Zylinder mit Schleier. Nachdenklich spitzte sie ihre Lippen, ging dann entschlossen zurück in den angenehm warmen Laden und rahmte die von ihr vor wenigen Minuten im Papierkorb versenkten Bilder. Gleich darauf stellte sie die Abzüge von den Birkenbach-Jungen auf die Erhöhung inmitten des Schaufensters. Erneut setzte sie sich der Kälte im Freien aus und besah sich mit leicht schief gelegtem Kopf ihr rebellisches Werk.
In ihre Überlegungen versunken trat sie auf der Stelle, um ihre Füße warm zu halten. Ihr Blick wanderte die verschneite Hauptstraße entlang. Frauen in schwingenden Röcken und langen Mänteln eilten zwischen den Häusern hindurch, manche mit ein oder zwei ebenfalls warm gekleideten Kindern an den Händen. Mit vom Einkauf prall gefüllten Taschen und Körben verweilten sie hier und da zu einer Plauderei, bevor sie ihren Heimweg fortsetzten. Dort angekommen würden sie den Ofen anheizen und für ihre Lieben eine schmackhafte Abendmahlzeit zubereiten.
Ein Seufzen kam über Felicitas’ vor Kälte bebende Lippen. Ein Teil von ihr sehnte sich durchaus nach jenem Familienidyll, doch es gab da auch eine andere Seite in ihr, und diese rebellierte gegen die friedliche Normalität um sie herum. Man schrieb das Jahr 1963 – 18 Jahre nach Kriegsende – und Felicitas hatte zunehmend das Gefühl, nicht in die heile Welt hineinzupassen, die sich infolge des Wirtschaftsaufschwungs auch in ihrem bayrischen Heimatstädtchen entwickelt hatte.
Seit etlichen Jahren lebte sie vollkommen auf sich gestellt, wusste daher um die Vorzüge eines ungebundenen Lebens, kämpfte gelegentlich aber auch gegen seine Nachteile an. Sie arbeitete bei Heinz März, aß bei der Familie März und traf sich einmal in der Woche mit ihrer besten Freundin, die seit einem halben Jahr mit einem in Bad Tölz stationierten Hubschrauberpiloten der US-Army liiert war.
Ihre Routine beruhigte Felicitas wie das sanfte Glucksen der Isar, drohte sie aber gleichzeitig mit überhandnehmender Langeweile zu erdrücken. Bisweilen hegte Felicitas den Verdacht, dass sie im Grunde ihres Herzens auf eine Flutwelle wartete.
„Fräulein Jecklin! So nachlässig angezogen werden Sie doch krank“, wurde sie von einer freundlich mahnenden und vom Alter leicht brüchigen Frauenstimme aus ihren Überlegungen gerissen.
„Guten Abend, Frau Kroner. Ich sehe mir nur schnell die neuen Auslagen an.“
Die Frau ergriff Felicitas’ kalte Hand, während sie sich dem Schaufenster zuwandte. „Das haben Sie hübsch gemacht. Heinz kann sich glücklich schätzen, eine so begabte Angestellte zu haben. Die beiden Birkenbach-Buben gefallen mir besonders gut!“
Frau Kroner, bereits im Begriff zu gehen, drückte der überraschten Felicitas nochmals kräftig die Hand. Felicitas sah der älteren Dame zu, wie sie mit vorsichtig durch den Schnee tastenden Schritten ein Haus nach dem anderen passierte und dabei allen Passanten freundlich zunickte. War Felicitas womöglich nicht die Einzige in dem kleinen Ort, die es nach Abwechslung verlangte?
Von einer inneren Unruhe erfasst kehrte Felicitas in den Laden zurück, warf einen Blick auf die tickende Uhr an der Wand und schloss hinter sich ab. Sie musste vor der Abendmahlzeit noch aufräumen und nass aufwischen. Während sie fleißig werkelte, begaben sich ihre Gedanken auf Wanderschaft. Sie hatte es selbst in der Hand, ihrem Leben eine neue Wendung zu geben. Und diese Möglichkeit war ihr von völlig unerwarteter Seite zugetragen worden. Ob sie das Wagnis eingehen sollte?
***
Kerstin Müller warf einen intensiven Blick auf die monströse Walnussholz-Standuhr. Ihr Herz klopfte vor Vorfreude, denn nun konnte es nicht mehr lange dauern, bis Christopher kam. Obwohl sie ihn erst vor drei Tagen gesehen hatte, zeigte das sehnsüchtige Kribbeln in ihrem Inneren, wie sehr sie ihn vermisste. Lächelnd ging sie zu dem quadratischen Holzcouchtisch und arrangierte die Grünholzzweige in der Vase neu, strich mit einer flüchtigen Bewegung das bestickte Deckchen glatt, um anschließend die Kissen in einer Ecke der Couch zu drapieren.
Felicitas, ihre Freundin, runzelte die Stirn und sagte halblaut vor sich hin: „Die lagen da doch vorhin schon.“
Kerstin ließ sich nicht beirren, sondern sah sich zufrieden um, eilte dann zu ihren Eltern in die Küche und prüfte die sorgfältig vorbereitete Käse- und Wurstplatte.
„Und du willst wirklich nicht zum Essen bleiben?“, rief sie Felicitas zu.
„Wie an jedem Tag in jeder Woche …“
„… hast du beim Ehepaar März zu Abend gegessen“, vervollständigte Kerstin Felicitas’ Satz, während sie aufgeregt an ihrem aufgesteckten blonden Haar zupfte.
„Darf ich dich etwas fragen, Kerstin?“
„Natürlich!“ Kerstin gab es auf, noch eine Kleinigkeit zu finden, die sie vergessen hatte vorzubereiten. Sie ließ sich neben ihrer um wenige Jahre älteren Freundin auf der Couch nieder, wobei der soeben drapierte Kissenschmuck in sich zusammenfiel.
„Ich habe dir doch von dem Brief dieses amerikanischen Anwalts erzählt?“
„Sicher. Zwei Frauen, irgendwelche Großtanten von dir, sollten ein Haus in den Staaten erben. Die Damen lehnten ab, und jetzt bist du in der Erbfolge an der Reihe.“
„Soll ich das Erbe doch antreten?“
„Feli!“ Kerstin, die als Notariatsgehilfin arbeitete, warf Felicitas einen entsetzten Blick zu. „Darüber haben wir doch wirklich oft genug gesprochen! Nachdem alle Verwandten der Verstorbenen in den Staaten das Erbe abgelehnt haben und selbst deine unbekannten alten Großtanten so intelligent waren, es auszuschlagen, warum solltest du auf die Angelegenheit hereinfallen?“
„Aber …“
„Feli, das Erbe kann nichts Gutes beinhalten, wenn es aus den USA bis hierher weitergereicht wurde“, versuchte Kerstin erneut, die Freundin von dem Gedanken abzubringen, in den Bundesstaat Mississippi auszuwandern. „Eventuell ist das Grundstück haushoch mit Schulden belastet oder ihm hängt eine andere, uns verborgene, unangenehme Eigenheit an. Niemand will es haben, und das hat sicher einen absolut nachvollziehbaren Grund. Lehn das Erbe ab und fertig!“
Während sie sich einige vorwitzige Strähnen ihres braunen Haares aus dem Gesicht strich, murmelte Felicias: „Vermutlich hast du recht.“
„Bestimmt. Auch Christopher ist meiner Meinung.“
Felicitas schrak zusammen, als es an der Tür Sturm läutete, Kerstin hingegen sprang auf, eilte in den Flur und ließ ihren Freund herein. Dieser küsste sie flüchtig auf die Stirn, ehe er ihr seine nasse Kopfbedeckung und den klammen Mantel in die Hand drückte.
Heimlich vergrub sie ihr Gesicht in dem so herrlich nach Christopher duftenden Kleidungsstück. Mit einem nahezu berauschenden Glücksgefühl beobachtete sie, wie ihre Eltern aus der Küche kamen, den amerikanischen Soldaten herzlich begrüßten und sich mit ihm an dem gedeckten Tisch niederließen. Ihre Eltern gewöhnten sich allmählich an den Gedanken, dass sie sich in einen US-Amerikaner verliebt hatte.
„Wir sprachen soeben über Felis ominöses Erbe“, begann Kerstin eine Plauderei, während sie sich ebenfalls setzte.
„War das Thema nicht abgehakt?“, fragte Christopher in seinem leicht akzentuierten Deutsch. „Weshalb denkst du noch immer über die Erbschaft nach?“, hakte er nach, als er von der in Gedanken versunkenen Felicitas keine Antwort erhielt.
„Weil ich mir wieder unsicher geworden bin.“ Die junge Frau erhob sich schwungvoll.
„Du könntest ja rüberfliegen und dich dort präziser über das Erbe informieren“, schlug Herr Müller vor, klang aber selbst nicht überzeugt von seiner Idee.
„Diesen Plan habe ich längst verworfen. Ich besitze zwar das Geld für den Hinflug, käme allerdings nicht mehr zurück, weil mein Erspartes dafür leider nicht ausreicht. Und an mein fest angelegtes Sparguthaben komme ich eigentlich noch nicht ran.“
„Wenn du dich über einen längeren Zeitraum in den USA aufhalten willst, brauchst du ohnehin eine Aufenthaltserlaubnis“, erklärte ihr Kerstin.
„Ich dachte, Christophers Familie könnte mir bei den Formalitäten helfen. Oder dieser Anwalt.“
Christopher sah Felicitas zweifelnd an. „Aber wovon würdest du dort leben? Wer würde dich versorgen oder auf dich aufpassen?“
Felicitas hob ergeben beide Hände. „Ist schon gut. Ich lehne das Erbe ab. Was soll ich auch in Mississippi? Ihr habt sicher recht: Mit dem Haus kann etwas nicht in Ordnung sein.“
Aufmunternd lächelte Kerstin ihre Freundin an, konnte sie doch ihre Freude über diese Entscheidung nicht verhehlen. Die Angst, Felicitas könnte Deutschland verlassen, hatte sie in den letzten Tagen gehörig umgetrieben. Zumindest hoffte Kerstin, dass Felicitas’ Entschluss nun besiegelt war, denn diese hatte die aufreibende Angewohnheit, ihre Ansichten innerhalb kürzester Zeit wieder zu revidieren. Und das ohne einen ersichtlichen Anlass oder Grund.
„Ich wünsche euch einen schönen Abend“, sagte Felicitas in die Runde und wandte sich in Richtung Flur.
Kerstin erhob sich, begleitete ihre Freundin zur Tür und schloss sie fest in die Arme. „Ich bin froh, dass du dich zum Bleiben entschieden hast. Es ist für eine Frau viel zu gefährlich, allein und aufgrund einer wirklich unsicheren Angelegenheit einfach auf Reisen zu gehen. Und du kannst nicht einfach zurückkehren, sollte dir danach zumute sein.“
„Und deshalb bleibe ich!“, bestätigte Felicitas, wickelte sich den Schal um den Hals und öffnete die Tür. Sie ging über den schneebedeckten Gartenweg zur Straße. Die sanft rieselnden Schneeflocken umhüllten sie wie eine schützende Decke und bildeten rasch eine weiße Haube auf ihrem dunklen Haar.
***
Felicitas war bereits eine geraume Zeit von der Dunkelheit verschluckt worden, ehe Kerstin die Tür zuschob und sich mit dem Rücken an das Türblatt lehnte.
Vermutlich war Kerstin der einzige Mensch, dem Felicitas die Erlebnisse ihrer Kindheit und die damit verbundenen, sie noch immer plagenden Albträume anvertraut hatte. Und genau diese grauenhaften Träume waren der Grund, weshalb Kerstin ihren unbestimmten Verdacht, dass Felicitas gelegentlich beobachtet wurde, für sich behielt. Felicitas sollte endlich in Ruhe leben dürfen, zumal ihre nächtlich wiederkehrenden Erinnerungen zuletzt nachgelassen hatten. Es schien fast, als verblassten sie ebenso wie Felicitas’ Fotografien, die zu lange von den hellen Strahlen der Sonne beschienen wurden.
Kerstin wusste nicht, ob sie richtig handelte, indem sie schwieg. Doch momentan überwog ihre Sorge, dass sie durch ein Ausplaudern ihrer vermeintlichen Beobachtung Felicitas wieder in das Chaos und den Schmerz ihrer Vergangenheit zurückkatapultieren könnte. Das wollte sie unbedingt vermeiden.
***
Der Schlüsselbund rutschte aus Felicitas’ kalten Fingern und fiel genau zwischen die Stufen und den Treppenabsatz. Hastig griff sie danach, stieß sich dabei jedoch den Kopf am Metallgeländer, das daraufhin zu vibrieren begann.
„Autsch!“, entfuhr es ihr, und sie musste mit ansehen, wie die Schlüssel in die Lücke fielen und aus ihrem Blickfeld verschwanden. Ein Klirren ertönte, als der Bund Sekunden später im Erdgeschoss auf dem Steinfußboden aufschlug.
Die junge Frau verdrehte die Augen, legte ihre Handtasche und die Post vor ihrer Wohnungstür ab und stieg wieder hinunter. Missgeschicke dieser Art waren leider bezeichnend für sie. Gelegentlich fragte sie sich, ob es jemals aufhören würde, dass sie alles umwarf, fallen ließ oder über etwas stolperte.
Als sie das Erdgeschoss erreicht hatte und sich nach dem Schlüssel bückte, öffnete sich die Wohnungstür hinter ihr.
„Fräulein Jecklin, was tun Sie denn da?“, fragte eine schneidende, weibliche Stimme.
„Mir ist der Schlüsselbund heruntergefallen.“ Felicitas hielt das leise klimpernde Beweisstück hoch.
Ihre Nachbarin taxierte sie mit vorwurfsvollem Blick. „Sie haben heute die Mülltonne nicht auf die Straße gestellt.“
Felicitas biss sich verlegen auf die Unterlippe. „War ich schon wieder an der Reihe? Das tut mir leid. Ich habe es völlig vergessen.“
„Ja, Sie waren an der Reihe. Und Sie müssen noch die Treppe kehren und Schnee schieben“, erinnerte die Frau sie im Befehlston an ihre Pflichten.
„Das erledige ich sofort. Ich ziehe mir nur schnell meine warmen Stiefel an.“
„Tun Sie das!“ Die Tür wurde laut zugeschlagen.
Felicitas hastete in den zweiten Stock hinauf, schloss die Wohnungstür auf und stolperte dabei prompt über ihre Handtasche. Reaktionsschnell hielt sie sich am Türrahmen fest.
Sie warf die Post auf die Ablage in ihrem winzigen Flur und klappte den Schuhschrank auf. Dabei fiel ihr Blick auf die amerikanische Briefmarke des obersten Umschlags. Ein aufgeregtes Kribbeln perlte von ihrer Magengegend in Richtung Kopf und in ihre Finger und Zehen. Die Stiefel gerieten in Vergessenheit. Sie ergriff den Brief, betrat das Wohnzimmer und öffnete das Kuvert wenig sorgsam mit dem Zeigefinger. Aufs Neue bat man sie um Rückmeldung bezüglich des Erbes, ein Haus mit Grundstück in Wilkinson County im Staat Mississippi.
***
Mit quietschenden Reifen bremsten mehrere Autos vor dem Haus, und das dröhnende Knattern der Motoren erstarb. Die um den massiven Holztisch versammelten Personen hoben alarmiert die Köpfe. Lähmendes Schweigen breitete sich aus; ängstliche Blicke wurden ausgetauscht.
Karl Ritzenhofen, das Oberhaupt der Familie, bei der Fitzi zwei Stunden zuvor untergetaucht war, erhob sich so langsam, als drücke ein Zentnergewicht ihn nieder. Schließlich trat er an eines der Sprossenfenster, schob, darauf bedacht, jede hektische Bewegung zu vermeiden, den dunkelgelben Vorhang beiseite und blickte auf die geschotterte Straße.
„Gestapo!“, zischte er und bestätigte damit die Befürchtung aller Anwesenden. Seine im schwäbischen Dialekt hervorgestoßenen Anweisungen peitschten wie Hiebe durch den Raum: „Adolf, bring das Mädchen fort! Christine, du räumst ihr Gedeck weg!“
Dann warf er, bereits auf dem Weg zum Treppenhaus, der entsetzt dreinschauenden Siebenjährigen einen mitleidigen Blick zu.
Noch ehe der dreizehnjährige Adolf sie bei der Hand nehmen konnte, rannte Fitzi in die angrenzende Küche und verließ das an den Hang gebaute Bauernhaus über den ebenerdigen Hinterausgang. Nach ihr stolperte Adolf in den abendlichen Sonnenschein hinaus. Auf allen vieren krabbelten sie den steilen Abhang hinauf, bis sie die Scheune aus ausgebleichtem Holz erreichten. Das offen stehende Scheunentor mutete Fitzi wie ein gefräßiger schwarzer Schlund an.
„Du kannst dich zwischen den Weinfässern verstecken“, raunte Adolf ihr zu.
Fitzi folgte dem schlaksigen Jungen in den düsteren Schuppen, in dem die Weinfässer für die baldige Lese meterhoch neben- und übereinandergestapelt lagen. Sie waren allesamt mit Wasser gefüllt, damit das Holz nicht austrocknete und barst.
Adolf deutete auf eine schmale Lücke zwischen zwei liegenden Fässern in der untersten Reihe. Wiederum gaukelte Fitzis ausgeprägte Fantasie ihr vor, in das aufgerissene Maul eines Ungeheuers zu blicken, das sie zu verschlingen drohte.
In den vergangenen Jahren hatte sie sich so viele Male in ähnlich winzigen Verstecken verkrochen, dass ihr mittlerweile davor graute. Diese Monster waren gleichermaßen Feind und Freund.
Fitzis Zögern entfachte Adolfs Wut. „Mach endlich! Oder willst du wie die anderen enden und meine Familie mit hineinziehen?“
Das Mädchen holte tief Luft und schob sich mit den nackten Füßen voraus in den schwarzen Spalt. Staub, Spinnweben und ein Gemisch aus modriger und zugleich süß und bitter riechender Feuchtigkeit hüllten sie ein. Mühsam drehte Fitzi in der Enge und Dunkelheit den Kopf und sah zwischen den metallbeschlagenen Rundungen der Fässer hindurch zu, wie Adolf hinaus in den Sonnenschein trat. In die Freiheit.
Es vergingen nur Sekunden, bis eine Silhouette den sonnenüberfluteten Eingang verdeckte und einen bedrohlich langen Schatten bis zu ihrem Versteck warf. Der Mann trat zögernd ein. Eine zweite, sehr bullige Person folgte ihm. Diese hatte Adolf am Ohr gepackt und zerrte ihn mit sich in den Schuppen.
Fitzi hielt den Atem an, während sie einer lauten Wutrede lauschte, aus der sie einmal mehr erfuhr, wie minderwertig, hinterhältig und dreckig sie sei; kein Mensch im eigentlichen Sinne. Ihre Angst steigerte sich, als der imposante Schatten direkt auf sie zukam und mit dem schwarzglänzenden Stiefel gegen das Fass zu ihrer Linken trat. Er löste ein Dröhnen aus, das in ihrem Kopf zu einem schmerzhaften Donnern anschwoll. Würden die aufgestapelten Fässer nun auseinanderrutschen? Waren sie im Begriff, über Fitzi hinwegzurollen und sie zu zermalmen?
Ein Pistolenschuss löschte für einen Augenblick alle anderen Geräusche aus. Dem Knall folgte ein Pfeifen in Fitzis Ohren, in das sich das gurgelnde Glucksen von Wasser sowie das bösartig klingende Knarren der Weinfässer mischte. Drohten diese jetzt nachzugeben?
Weshalb das alles?, fragte sich Fitzi und spürte den leichten Schwindel, der sie ermahnen wollte, endlich wieder zu atmen. Doch das war nicht möglich! Die Fässer erdrückten sie! Der Platz war selbst für einen flachen Atemzug zu knapp.
Das nächste Geräusch, das zu Fitzi durchdrang, war das harte, bellende Gelächter eines der Eindringlinge. Dieser stieß Adolf derb nach draußen, und Fitzi sah neiderfüllt, wie der orangefarbene Sonnenschein den Jungen liebevoll einhüllte. Um sie hingegen herrschte Dunkelheit, die sie bald restlos verschlingen würde. Schon breitete sich vor ihren Augen eine eigentümliche Schwärze aus.
Indessen hantierten die Gestapo-Männer mit dem neben der Tür aufgeschichteten Brennholz und einem kleinen Gegenstand. Wenige Augenblicke später züngelten an mehreren Stellen winzige, aber gefräßige gelbe Flammen hoch. Die Tür wurde mit einem unüberhörbaren Knall zugeschlagen, der Riegel energisch vorgelegt.
Sie atmete noch immer nicht.
***
Felicitas fuhr im Bett hoch und schnappte nach Luft. Ihr Nachthemd klebte schweißnass an ihr, und sie zitterte am ganzen Leib. Sie waren zurück: diese grässlichen Albträume; Episoden aus ihrer Vergangenheit. Warum nur quälten diese Erinnerungen sie wieder Nacht für Nacht?
Sie schwang die Beine aus dem Bett. Eisige Kälte umfing sie. Ein fahler Mond schien durch das Fenster, beleuchtete den Linoleumboden, ihren Stuhl und den Brief aus den Vereinigten Staaten auf dem Tisch. Sie strich sich das feuchte Haar aus dem Gesicht, ohne ihre Augen von dem Umschlag zu nehmen. Aufgewühlt schüttelte sie den Kopf. Ja, sie war impulsiv. Vielleicht deshalb, weil sie sich als Kind ständig auf neue Begebenheiten hatte einstellen müssen. Wie oft hatte sie sich in letzter Zeit überlegt, einmal in den Norden zu reisen, da dort angeblich noch entfernte Verwandte von ihr lebten. Zu einer Entscheidung hatte sie sich jedoch nie durchringen können. Aber bei der Frage, ob sie das Erbe in Mississippi annehmen sollte, hatte sie sich wirklich viel Zeit gelassen und Rat bei Kerstin und Christopher eingeholt.
Waren es die Albträume, die plötzlich mit entsetzlicher Intensität wiederkehrten, die sie dazu trieben, den bereits gefassten Entschluss erneut zu überdenken?
***
Keuchend und einige Minuten zu spät kam Felicitas beim Fotostudio an. Die Glocke über der Tür klingelte Sturm, sodass Heinz hochschreckte.
„Fräulein!“, fuhr er sie unwillig an, ehe er sich die schwarze Uhrmacherlupe wieder zwischen Wange und Augenbraue klemmte und sich über eine Fotografie beugte.
„Entschuldigung, Herr März. Ich musste heute Morgen noch Schnee schieben und einen Brief zur Post bringen.“
Ihr Chef winkte ab. Es war nichts Ungewöhnliches, dass seine etwas chaotisch veranlagte Angestellte zu spät zur Arbeit erschien. „Frau Glatt und Frau Link haben vorhin hereingeschaut. Sie wünschen sich von ihren Kindern Fotos wie diejenigen, die im Schaufenster ausgestellt sind. Ich habe für heute Nachmittag Termine vereinbart.“
Felicitas’ zweifelnder Blick entging dem Fotografen, da er mit seiner Lupe und dem Bild beschäftigt war. „Kinderbilder wie die im Schaufenster?“, hakte sie ungläubig nach.
„Das sagte ich doch.“
„Wissen Sie, welche Abzüge da draußen stehen?“
„Die von den Birkenbach-Buben, nehme ich an?“
„Ja ...“ Felicitas zog das Wort in die Länge und wartete auf eine weitere Reaktion, die jedoch ausblieb. Kopfschüttelnd trat sie ins Freie, um sich zu vergewissern, dass noch immer dieselben Fotografien in der Auslage standen, die sie am Abend zuvor in einem Akt der Rebellion hineingestellt hatte. Die Vorstellung, dass es doch Familien gab, die diese Art von Kinderbildern bevorzugten, ließ sie fröhlich auflachen.
Mit einem Einkaufskorb am Arm verließ Ingeborg März kurz nach ihr den Laden und gesellte sich neben sie. Mit hochgezogenen Augenbrauen musterte sie die saloppen Bilder der beiden Jungen.
„Felicitas! Nimm bitte sofort die Aufnahmen der zerzausten Jungen aus dem Fenster. Sie könnten dem Ansehen meines Gatten schaden.“
„Wie Sie meinen.“ Felicitas gelang es nicht, ein erneutes Schmunzeln zu unterdrücken. Gut gelaunt wagte sie zu sagen, was ihr schwer im Magen lag: „Übrigens werde ich nicht mehr lange für Sie arbeiten. Ich habe ein Haus in Übersee geerbt und reise aus, sobald alle rechtlichen Angelegenheiten geklärt sind.“
Nach der Eröffnung ihrer ungewöhnlichen Zukunftspläne war ihr die ungeteilte Aufmerksamkeit der Frau sicher. „Du willst uns verlassen? Weiß mein Gatte denn schon Bescheid?“
„Nein, aber ich werde es ihm gleich erzählen.“
„Dann hoffe ich, wir finden rasch einen Ersatz für dich.“ Frau März tappte mit vorsichtigen Schritten durch den flach getretenen Schnee davon.
Nicht im Mindesten überrascht von der herzlosen Reaktion auf ihre umwälzende Nachricht kehrte Felicitas in den Laden zurück. Sie hatte sich in dieser Kleinstadt niemals zu Hause gefühlt. Nun trug sie den Traum im Herzen, dass sich das in ihrer neuen Heimat grundlegend ändern würde.
2. Kapitel
Sechs Wochen nachdem sie ihren Entschluss wieder einmal über den Haufen geworfen hatte, war Felicitas endlich in Amerika angekommen. Neugierig sah sie sich um. Eine Vielzahl der teils aus Stein, teils aus Holz erbauten Gebäude wiesen so breite Holzveranden auf, dass sie den Gehweg ersetzten. Ihre gedrechselten Säulen trugen Balkone, deren Holzgeländer sich mit Ornamenten schmückten. Entlang der Straße wuchsen gewaltige, knorrige Eichen und spendeten Schatten, wie sie es wohl bereits seit einem oder zwei Jahrhunderten taten. Die graugrünen Bärte des Spanischen Mooses hingen schaukelnd von den ausladenden Ästen, und Felicitas fragte sich, ob die im lauen Wind flüsternden Blätter einander von der Schönheit und der Bitterkeit der vergangenen Jahre erzählten.
Das Rauschen des Mississippi, der sich unweit der lang gestreckten Ortschaft vorbeiwälzte, wurde von der schnarrenden Hupe eines Pick-ups übertönt. Fred Mason, ein Farmer aus dem Umland, winkte Felicitas zum Abschied mit seiner abgearbeiteten, braun gebrannten Hand zu. Schnell stellte Felicitas ihr Gepäck in den Straßenstaub und winkte dem sympathischen, alten Herrn nach. Er war so freundlich gewesen, sie von Woodville bis hierher mitzunehmen.
In eine braune Staubwolke gehüllt fuhr der knatternde Pick-up davon, wobei Fred offenbar jedes Schlagloch suchte, das die Fahrbahn hergab.
Felicitas beschattete mit der Hand ihre Augen und versuchte sich zu orientieren. Schließlich schulterte sie ihren Rucksack und nahm ihren schweren Koffer. So beladen taumelte sie in Richtung einer hölzernen Veranda und erklomm die drei knarrenden, von der Sonne ausgebleichten Stufen. Vor einer fast blinden, offen stehenden Glastür, über der ein verwittertes, kaum noch lesbares Eingangsschild darauf hinwies, dass sich hier der „Country-Store“ befand, hielt sie inne. Obwohl der Kalender erst April anzeigte, machte ihr die schwüle Hitze zu schaffen. Als sie ihre deutsche Heimat verlassen hatte, war dort gerade der letzte Schnee des Frühjahrs gefallen.
Felicitas’ flache Schuhe klapperten über die Holzveranda und ihr sperriges Gepäckstück schlug unsanft gegen den Türpfosten, als sie sich durch die Tür zu zwängen versuchte. Angesichts des Lärms, den sie schon wieder veranstaltete, zog sie betroffen den Kopf ein. Sie musste endlich lernen, sich vorsichtiger zu bewegen.
„Wenn Sie meinen Laden abreißen und anschließend neu aufbauen wollen, dann nur weiter so“, drang eine tiefe, raue Frauenstimme zwischen den überfüllten, jedoch akkurat eingeräumten Regalen hervor. Auch ihr war die auffällig gedehnte Sprechweise zu eigen, die Felicitas schon an dem alten Fred aufgefallen war. Diese erschwerte es Felicitas zusätzlich zu ihrem nicht perfekten Englisch, die Menschen hier im Süden zu verstehen. „Entschuldigen Sie bitte, aber ich wollte mein Gepäck nicht draußen stehen lassen.“
„Bei uns kommt nichts weg, Süße! Das ist eine saubere Stadt mit ehrlichen, anständigen Bürgern!“
„Das ist gut!“ Felicitas war unbehaglich zumute, wollte sie doch keinesfalls den Eindruck erwecken, dass sie die Leute dieser Gegend für unehrenhaft hielt. Immerhin war sie jetzt Eigentümerin eines Hauses in diesem Ort und würde den Rest ihres Lebens hier verbringen! Ein wenig amüsierte sie sich allerdings über die stolze Bezeichnung „Stadt“ für die rund 30 Häuser, die entlang der Uferstraße standen. Hinzu kam wohl noch die etwa gleiche Anzahl an Gebäuden in der winzigen Querstraße und an der Route in Richtung Woodville. Wie viele Ferienhäuschen es direkt am Flussufer gab, hatte sie auf die Schnelle nicht abschätzen können.
Seufzend stellte sie ihren Koffer ab und nahm vorsichtshalber auch den Rucksack herunter, damit sie nicht an einem der Regale hängen blieb. Dann machte sie sich auf die Suche nach der Person, zu der die Stimme gehörte, und fand hinter dem mit Süßigkeitengläsern, Schnürsenkeln, Schnupftabak und Kräutertöpfen beladenen Tresen eine schlanke Frau in einem Schaukelstuhl. Ihr dunkles, von grauen Strähnen durchzogenes Haar trug die etwa Fünfzigjährige zu einem strengen Knoten zurückgebunden, und über ihren mageren Schultern lag ein Baumwolltuch. Felicitas wurde es beim Anblick des Schals noch wärmer, schwitzte sie doch trotz ihres luftigen A-Linien-Kleides seit der Fahrt in dem von der Sonne aufgeheizten Pick-up ohnehin aus allen Poren.
„Was kann ich für Sie tun? Suchen Sie etwas Bestimmtes?“, schnarrte die Ladeninhaberin nicht unfreundlich, aber auch nicht unbedingt herzlich. Fasziniert beobachtete Felicitas, dass die Frau sprechen konnte, ohne dabei den Mund nennenswert zu öffnen – sofern man diesen unsäglichen Dialekt verstand.
Felicitas trat an den Tresen und umklammerte die Kante der zerschrammten Holzfläche, deren unzählige schwarze Löcher wohl von unachtsam abgelegten Zigaretten herrührten. „Mein Name ist Felicitas Jecklin. Ich komme aus Deutschland und habe das Haus von Miss Virginia Tampico geerbt.“
Jetzt öffnete die Frau den Mund – weit und für eine lange Zeit! In Felicitas keimte der Verdacht, dass der Laden entweder nicht sonderlich viel Gewinn abwarf oder die Frau zu geizig war, um einen Teil ihres Einkommens in einen Zahnarztbesuch zu investieren, denn ihre Zahnruinen waren durchaus dazu geeignet, Kinder zu erschrecken.
„Aus Deutschland?“
„Ja.“
„Wie alt sind Sie?“
„Sechsundzwanzig.“
„Heißen Sie wirklich so?“
„Ja.“
„Und Sie haben das Haus von Miss Virginia geerbt?“
„Genau!“
„Walter! Walter! Komm mal her!“
Felicitas zuckte angesichts der Lautstärke, in der die Frau nach einem Walter rief, vor Schreck zusammen. Unruhig trat sie von einem Bein auf das andere. War ihr einen Fehler unterlaufen? Sie hatte sich doch lediglich vorstellen und nach dem Weg zu ihrem neuen Zuhause fragen wollen.
Eine grässlich knarrende Tür wurde aufgeschoben und nicht minder geräuschvoll wieder geschlossen. Gemächliche Schritte näherten sich dem Tresen. Gleichzeitig betrat jemand hinter Felicitas den Laden. Neugierig drehte sie den Kopf, konnte gegen das Sonnenlicht, das in das Gebäude flutete, aber nur eine groß gewachsene, männliche Gestalt ausmachen.
„Bill, einen Augenblick bitte“, sagte die Ladeninhaberin, und diesmal gelang ihr das erneut, ohne ihre Zähne zu zeigen, geschweige denn, ihre Lippen zu bewegen.
Die Schattengestalt, derlei Bitten offenbar gewohnt, gab einen zustimmenden Laut von sich, ergriff einen der neben der Ladentür aufgestapelten Holzstühle und setzte sich auf die Veranda hinaus, wo er sich eine dicke Zigarre anzündete.
„Was ist, Dorothy?“ Der lautstark herbeizitierte Walter brachte sich mürrisch in Erinnerung.
„Die Süße hier sagt, sie kommt aus Deutschland und hat das Tampico-Haus geerbt.“
Felicitas musterte den rundlichen Walter ebenso interessiert wie er sie. Der Mann war nicht sehr groß, hatte die Fünfzig seit ein paar Jahren überschritten, und auf seiner fortgeschrittenen Glatze spiegelte sich das Licht der Deckenlampe.
„Sie kommen aus Deutschland?“
„Ja.“
„Wie alt sind Sie?“
„Sechsundzwanzig.“
„Und wie heißen Sie?“
„Felicitas Jecklin.“
„Und Sie haben das Haus von Virginia Tampico geerbt?“
„Genau!“
„Sag ich doch!“, mischte Dorothy sich ein, wobei sie sich schwerfällig aus ihrem Schaukelstuhl erhob, ihre Arme auf den Tresen stützte und Felicitas leicht vornübergebeugt betrachtete.
„Dann ist es wohl so“, glaubte Felicitas zu verstehen, war sich aber nicht sicher, ob sie Walter richtig verstanden hatte. Der bedachte sie mit einem misstrauischen Blick, ehe er sich abwandte. Als sich die knarrende Tür hinter ihm geschlossen hatte, überlegte Felicitas, ob sie sich besser woanders nach dem Weg erkundigen sollte. Allerdings befürchtete sie, dass sie dann dieselben Fragen noch ein drittes Mal gestellt bekommen würde. Bei dieser Dorothy hatte sie zumindest einen kleinen Zeitvorteil – denn Zeit, das schienen die Menschen hier reichlich zu besitzen!
„Süße, das Haus von Miss Virginia steht seit zwei Jahren leer. Wir sind immer davon ausgegangen, dass sie überhaupt keine Verwandten hat!“
Unbekümmert zuckte Felicitas mit den Schultern. „Zwei Frauen in Deutschland wurde das Erbe angeboten, doch sie hatten kein Interesse daran. Danach bekam ich das Angebot.“
„So? Und Sie haben angenommen?“
„Wie Sie sehen.“
„Was sehe ich?“
„Ich bin hier!“
„Ach ja!“
Felicitas wischte sich mit dem Unterarm den Schweiß von der Stirn. Sie fand das Gespräch als zunehmend anstrengend, zumal sich alles in ihr nach einer Möglichkeit zum Frischmachen und einem Bett sehnte.
„Würden Sie mir bitte erklären, wie ich das Haus finden kann?“, fragte sie in dem Versuch, das Geschehen voranzutreiben, verbunden mit der Hoffnung auf eine verständliche Auskunft noch am gleichen Tag.
„Das könnte ich, Süße. Aber ich vermute mal, dass Sie da nicht wirklich hinwollen!“
„Weshalb denn nicht? Ich habe das Haus doch geerbt. Ich besitze eine beglaubigte Eigentumsurkunde und …“
„Süße, es hat sich niemand um das Gebäude gekümmert. Abgesehen von Ratten, Schlangen und Waschbären.“
Bei der Vorstellung, das Haus könne von allerlei Getier bewohnt sein, jagte ein kalter Schauer über Felicitas’ Rücken. Dennoch hob sie widerspenstig den Kopf und hoffte einfach, dass Dorothy übertrieb. „Ich werde es gründlich putzen und in Schuss bringen.“
„Wie schön, Süße!“
„Ich heiße Felicitas Jecklin.“
„Das weiß ich, Süße.“
Ein weiterer Kunde betrat den Laden. Felicitas wollte gerade erleichtert aufatmen, als sie hörte, dass dieser ebenfalls nach einem Stuhl griff und ihn zu dem rauchenden Bill hinaus auf die Veranda trug.
„Wir sind hier gleich so weit“, rief Dorothy so laut hinter der neuen Kundschaft her, dass Felicitas missbilligend die Augen zusammenkniff.
„Nur keine Eile, Miss Dorothy“, antwortete eine junge Männerstimme. „Ich habe ein paar Minuten!“
Halb belustigt, halb verärgert vermutete Felicitas, dass er vermutlich eher von Stunden sprach, behielt den Gedanken aber für sich. „Wenn Sie mir jetzt bitte erklären würden, wie ich das Haus finde, dann–“
„Das Tampico-Haus? Da können Sie nur hin, wenn Sie genau so eigensinnig sind, wie Miss Virginia es zeitlebens war.“
Mit einer für die Gegend vermutlich auffällig flinken, an Felicitas jedoch müde wirkenden Handbewegung strich sie sich ihre verschwitzten, im Gesicht klebenden Haare zurück. Dabei musterte sie die Inhaberin des Ladens erneut intensiv. Ob es überhaupt jemand gab, der eigenwilliger war als diese Dorothy?
„Da ich meine Verwandte leider nicht kannte, ist es mir unmöglich, Vergleiche zwischen uns zu ziehen. Allerdings bin ich müde und möchte–“
„Müde? Dann sollten Sie da heute wirklich nicht mehr hin, Süße.“
„Ich räume das Notwendigste auf und säubere–“
„Ich rate Ihnen dringend: Fangen Sie mit dem Badezimmer an!“
Felicitas’ fröhliches Lachen füllte den Raum mit Leben. Sie hatte beschlossen, das skurrile Gespräch nicht als Ärgernis, sondern von der humorvollen Seite zu nehmen. Und keinesfalls würde sie zuerst das Badezimmer auf Vordermann bringen, denn ein Bett und eine benutzbare Küche schienen ihr weitaus wichtiger zu sein.
„Da Sie sich nicht vom Gegenteil überzeugen lassen wollen, Süße, erkläre ich Ihnen den Weg: Sie gehen erst mal nach links. Gehen Sie so lange weiter, bis Sie die Stadt hinter sich gelassen haben. Folgen Sie dem Wegweiser in Richtung Sägewerk, über unseren größten Hügel, über die Brücke und über die Bahngleise. Nach den Bahngleisen müssen Sie an den Hütten vorbei. Dann biegen Sie am dritten Bach links ab. Dort beginnt der Fußpfad zum Haus. Der Weg ist kürzer als der zur offiziellen Auffahrt. Die befindet sich weitere zwei Meilen die Straße hinunter.“
Felicitas legte beide Hände an ihre Wangen und schaute die Frau Hilfe suchend an. Falls sie Dorothy mit ihrer schleppenden Aussprache überhaupt richtig verstanden hatte, musste ihr neues Zuhause sehr weit abseits liegen.
„Soll ich es Ihnen aufschreiben, Süße?“
„Nein, danke. Ich kann mir das schon merken. Aber ... fährt vielleicht ein Bus in die Richtung?“
„Ob da ein Bus hinfährt?“ Dorothy brachte das Kunststück fertig, mit fast geschlossenen Lippen zu lachen. Wegen ihrer tiefen Stimme glich ihr Heiterkeitsausbruch dem eines Mannes. „Süße, Sie gehören da draußen gar nicht erst hin. Doch da Sie sich diesen Unsinn in den Kopf gesetzt haben, werden Sie schauen müssen, wie Sie hinkommen.“
„Sie können sich meinen Wagen ausleihen, Miss. Morgen früh um sechs brauche ich ihn aber wieder“, ertönte die jugendliche Stimme hinter ihr, die dem ebenfalls geduldig ausharrenden Kunden gehörte.
Felicitas bedankte sich bei Dorothy, ignorierte ihren mitleidigen Blick, nahm an der Tür ihr Gepäck auf und trat in den strahlenden Sonnenschein hinaus. In dem Versuch, ihre Augen an das grelle Sonnenlicht zu gewöhnen, blinzelte sie mehrmals. Endlich konnte sie neben dem großen Herrn mit dem breitkrempigen grauen Hut einen jungen Mann ausmachen, der offenbar seinen spärlichen Bartwuchs dadurch beschleunigen wollte, dass er sich bei der noch unnötigen Rasur die Haut aufschnitt. Mehrere Krusten auf seinen Wangen, um die Mundpartie und am Hals ließen diese Vermutung aufkommen.
Die beiden Wartenden erhoben sich höflich, wobei der schlaksige Junge ihr seine ungewöhnlich große Hand entgegenstreckte.
„Mein Name ist Flip. Ich wohne mit meiner Familie am Ende der Straße.“ Er zeigte nach rechts.
„Hallo, Flip. Ich heiße Felicitas. Darf ich mir tatsächlich deinen Wagen ausleihen?“
„Aber klar doch. Du kannst unmöglich mit dem ganzen Gepäck den weiten Weg zu Fuß gehen. Nur um sechs Uhr morgens solltest du ihn wieder vor unserem Haus geparkt haben. Sonst komme ich nicht zum Holzfällerlager raus.“ Flips Worte kamen so eintönig über seine Lippen, als habe er keine Lust, ihnen irgendeine Klangfarbe zu geben.
Er drückte ihr vertrauensvoll den Schlüssel in die Hand und deutete auf einen vollkommen verdreckten, uralten Pick-up auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Zuerst den Schlüssel, dann das heruntergekommene Vehikel betrachtend, zögerte Felicitas. Flip bückte sich jedoch tatkräftig, als wolle er keinen Widerspruch gelten lassen, nahm ihren Koffer und trug ihn über die Straße. Äußerst unsanft warf er ihn auf die Ladefläche.
„Bill Phillips“, stellte sich nun der andere Mann vor. „Ich bin der Bürgermeister dieser Stadt. Wie lange wollen Sie bleiben?“
Felicitas ließ sich von dem Bürgermeister ihre Rechte quetschen, die sie daraufhin verstohlen rieb. Bill sah mit seinem kräftigen Körperbau, der Bluejeans und dem am Hals lässig offen stehenden blau karierten Flanellhemd eher wie ein körperlich schwer arbeitender Farmer denn ein Büromensch oder Politiker aus. Und auch er nannte die Ansiedlung eine Stadt. Offenbar waren die Bürger des Dorfes extrem stolz auf ihre … Stadt.
„Ich dachte, für immer“, erwiderte Felicitas zaghaft und ohne zu ahnen, wie zerbrechlich und hilflos sie dabei wirkte.
„Sind Sie aus Deutschland hierher gereist?“
Felicitas atmete tief ein. Mühsam unterdrückte sie einen aufkeimenden Groll über die sich wiederholenden Fragen, ergriff ihren Rucksack und flüchtete zu dem Fahrzeug, vor dem Flip, der intensiv auf einem Kaugummi kaute, auf sie wartete.
„Du musst beim Anlassen kräftig Gas geben! Der Motor ist ein bisschen schwach auf der Brust, bis er sich warm gefahren hat. Fahr vorsichtig bei den Hütten, damit du da nicht anhalten musst.“
„Bei den Hütten? Warum? Was ist da?“
„Da sind die Ni … die Schwarzen.“
„Aha“, erwiderte Felicitas nichtssagend und ohnehin nicht in der Lage, tief greifende Überlegungen anzustellen. Die Information, dass ihr Haus weit abseits der Ortschaft lag und sich womöglich in einem schlechteren Zustand befand, als sie befürchtet hatte, nagte an ihr. Außerdem missfiel ihr der Umstand, dass sie gleich an ihrem ersten Tag auf Hilfe angewiesen war, selbst wenn es nur einen gelangweilt erscheinenden Teenager traf. Umso größer war ihre Dankbarkeit für Flips selbstlose Geste, einer Fremden seinen Wagen zu leihen.
Felicitas benötigte drei Versuche, ehe sie die vor Schmutz starrende Tür aufreißen konnte. Im Inneren des Pick-ups sah es nicht einladender aus. Der Boden, die Armaturen und auch die Sitzbank strotzten vor getrockneter Erde, Staub und anderen undefinierbaren Flecken. Leere Coladosen und Bierflaschen lagen im Fußraum, die Seitenscheiben waren annähernd blind. Energisch drehte sie den Schlüssel im Schloss und trat, wie Flip es ihr geraten hatte, das Gaspedal vollständig durch. Es knallte laut. Erschrocken zuckte Felicitas zusammen. Im Rückspiegel sah sie, wie das Haus hinter dem Auto in einer schwarzen Rauchwolke verschwand.
„Super! Das Baby mag dich!“, lachte Flip und schlug die Tür zu, sodass eine Staubwolke sie einhüllte.
Behutsam lenkte Felicitas das Gefährt über die Kreuzung, die sogar eine Ampelanlage hatte, fuhr in Richtung Ortsausgang und gab es bereits nach wenigen Metern auf, den Schlaglöchern auszuweichen. Es gab ihrer einfach zu viele, und bei jedem sprangen die Dosen und Flaschen fröhlich klappernd hoch.
So holperte sie an dicht nebeneinanderstehenden Gebäuden vorbei, begleitet von dem ungleichmäßigen Brummen des Vehikels. Sie ließ das verschlafene Dorf mit seinem Gemisch aus Federal Style-, Palladio- und Antebellum-Häusern und den sich zwischen ihnen versteckenden alten Schuppen und Bauwerken moderneren Stils hinter sich. Der Pick-up arbeitete sich mit einem beängstigend dröhnenden Motorengeräusch den kleinen Hügel hinauf und an verstreut liegenden Fischer- und Jagdhütten vorbei. Bald eröffnete sich Felicitas ein herrlicher Blick über weite Felder, grüne Wiesen und sumpfige Wasserflächen, die von beschaulichen Hainen eingerahmt waren. Mitten hindurch zog sich die schnurgerade Straße über mehrere unterschiedlich hohe Erhebungen, die wie Wellen durch die Landschaft zu rollen schienen.
Felicitas bestaunte die satten Farben und die abwechslungsreiche Schönheit des Landstrichs wie auch das Flimmern der aufgeheizten Luft über den Feldern und der Straße. Das in ihr aufsteigende Glücksgefühl zauberte ein Lächeln auf ihr Gesicht. Sie empfand eine unbändige Freude darüber, dass sie dieses faszinierende Panorama an Farbenfülle, Weite und betörender Natur ab sofort Tag für Tag genießen durfte. In diesem Augenblick war sie sich sicher: Sie hatte die richtige Entscheidung getroffen.
Der von Dorothy erwähnte „größte Hügel“ der Umgebung lag wie ein schlafender Bär am Ende der ständig an- und absteigenden Straße, und sein Anblick verleitete Felicitas zu einem heiteren Lächeln. Aber was hatte sie erwartet? Immerhin war die höchste Erderhebung im ganzen Staat Mississippi ein Berg mit 246 Metern Höhe.
Als es dem knatternden Gefährt gelungen war, den Bär zu bezwingen, breiteten sich links und rechts der Straße weitere ausgedehnte Anpflanzungen aus. Wie ein dunkles Band zerteilte die Eisenbahnlinie die an einen Wald grenzenden Felder. Parallel zu den Schienen schlängelte sich ein Nebenarm des Mississippi durch üppige Wiesen dem weit entfernten Ozean entgegen.
Felicitas näherte sich einer zerbrechlich und alt aussehenden Holzbrücke. Das von Sonne und Wind ausgebleichte Holz wirkte brüchig, die Stellen, die den brodelnden Wellen nahe kamen, wiesen dagegen ein Unheil verkündendes Schwarz auf. Obwohl Felicitas ständig der Abgasgestank des Pick-ups um die Nase wehte, nahm sie nun deutlich den Geruch von Moder wahr. Sie flehte zu Gott, dass das fragile Gebilde dem Gewicht des Pick-ups standhalten würde, und lenkte den Wagen auf die Holzbretter, die unter den Rädern laut klackerten und dröhnten. Erst als sie die Brücke sicher passiert hatte, atmete sie wieder aus. Das Wechselbad der Gefühle, das sie seit dem Augenblick durchlebt hatte, als sie aus Freds Pick-up gestiegen war, brachte sie neben der hohen Luftfeuchtigkeit zusätzlich ins Schwitzen.
Nachdem sie auch die Bahngleise hinter sich gelassen hatte, wurde die Straße zunehmend schlechter. Felicitas fuhr zwischen hohen, ehrwürdig wirkenden Bäumen hindurch, bis im Schatten des sich weit ausdehnenden Mischwaldes links und rechts ärmliche Häuser auftauchten.
Neugierig betrachtete sie die heruntergekommenen Behausungen, Schuppen und Ställe, die aus den unterschiedlichsten Materialien zusammengezimmert waren. Weshalb Flip sie wohl vor diesem Ort und den Schwarzen gewarnt hatte? Die Menschen, die hier lebten, hatten doch lediglich eine andere Hautfarbe und waren gewiss nicht unfreundlicher oder gefährlicher als die Weißen in dem kaum größeren Dorf.
Plötzlich vollführte der Pick-up einen seltsamen Hopser und fuhr nun sehr leise eine lang gezogene Bodenwelle hinunter. Die Bremsen benötigten mehrere derbe Tritte, ehe sie griffen und Felicitas das Gefährt zu einem Tempo abbremsen konnte, das sie auf der abschüssigen und löchrigen Piste angemessen fand. Sie rollte unter den ausladenden Bäumen hindurch, die verzerrte Schatten auf die Straße warfen, und an weiteren Holzhütten vorbei, bis der Wagen von allein zum Stehen kam. Die daraufhin eintretende Stille hätte Felicitas im Grunde als angenehm empfunden, müsste sie nicht befürchten, dass mit dem Motor etwas nicht in Ordnung war.
Hilflos schaute sie durch die verdreckte Windschutzscheibe. Auf den Stufen einer hölzernen Veranda saßen zwei kleine Jungen und betrachteten die Fremde ungeniert. Felicitas musterte sie allerdings nicht minder interessiert, immerhin hatte sie noch nie zuvor Menschen mit so dunkler Hautfarbe aus der Nähe gesehen. Ihre Gesichter wirkten sanft und unschuldig wie fast alle Kindergesichter, aber die Fotografin in ihr war vor allem von den großen Augen fasziniert, die dreinschauten, als staunten sie den ganzen Tag über etwas, das sie längst kannten.
Felicitas wurde in ihrer Betrachtung gestört, als sich ihr ein Mann mit raumgreifenden Schritten näherte. Er trug eine deutlich zu kurze Jeans, die mit Hosenträgern über unbekleideten Schultern festgehalten wurde. Unwillkürlich hielt Felicitas den Atem an. Einem dermaßen muskelbepackten Hünen war sie noch nie zuvor begegnet, und seine ebenholzschwarze Hautfarbe verstärkte die beeindruckende Wirkung noch. Alles an dem Mann war erschreckend fremd für sie.
Hektisch drehte sie den Schlüssel im Zündschloss und trat mehrmals kräftig das Gaspedal durch. Bis auf ein schnell ersterbendes Röhren des Anlassers geschah jedoch nichts.
Der Schwarze verharrte in gut drei Metern Entfernung und schob seine gewaltigen Hände in die ausgebeulten Hosentaschen. Nervös strich Felicitas sich die Haare aus dem verschwitzten Gesicht. Was sollte sie jetzt tun? Ganz offensichtlich brauchte sie Hilfe, allerdings flößte ihr der breitschultrige und selbstsicher wirkende junge Mann Angst ein. Sie murmelte ein kurzes Stoßgebet, öffnete unter Zuhilfenahme ihrer Füße die klemmende Tür und stieg aus. Da sie nicht gerade mit einer imponierenden Körpergröße aufwarten konnte, fühlte sie sich neben dem Hünen nahezu winzig. Um diesen Umstand zumindest ein wenig auszugleichen, straffte sie energisch die Schultern.
„Hallo, ich bin Felicitas Jecklin“, stellte sie sich vor, wobei es ihr kaum gelang, ihrer Stimme den gewünscht festen Klang zu geben. Zudem faszinierten sie die Schweißperlen auf der dunklen Haut des Mannes. „Ich habe mir den Wagen geliehen, um zu meinem neuen Zuhause zu fahren, aber leider scheint er defekt zu sein.“
„Abner Cross“, erwiderte der Schwarze knapp und schaute an ihr vorbei auf das Automobil. „Der gehört Mr Flip!“, fuhr er gedehnt und mit verschluckten Endungen fort.
„Das stimmt.“
„Er verleiht den gern, wenn er kein Geld für Benzin hat. Haben Sie auf die Tankuhr geschaut?“, fragte Abner, und Felicitas gewann den Eindruck, als bemühe er sich sehr, seine Worte deutlich auszusprechen. Sicherlich hatte er in ihr sofort eine Ausländerin erkannt.
„Nein, das habe ich leider nicht“, gab Felicitas unumwunden zu. Suchend sah sie sich nach einer Tankstelle oder Werkstatt um, konnte in der kleinen Ortschaft jedoch nichts dergleichen entdecken. Abners Grinsen ließ sie verlegen und unschlüssig zugleich mit den Schultern zucken.
„Ich habe einen Ersatzkanister“, erklärte er knapp, drehte sich um und stapfte über die staubige Piste davon. Erleichtert sah Felicitas Abner nach, war er doch freundlich und hilfsbereit, und Hilfe konnte sie dringend gebrauchen – schon wieder!
Die beiden Jungen auf der Veranda winkten Abner vergnügt zu, bevor der im Nachbarhaus verschwand. Nur einen Augenblick später kehrte er mit einem verbeulten Metallkanister in der Hand zurück. Mit gemächlichen Bewegungen, vermutlich, weil auch hier draußen in den Wäldern die Uhren langsamer gingen, öffnete er den Tankstutzen und leerte die gemütlich glucksende gelbbraune Flüssigkeit in den Autotank. Bereits nach einigen Sekunden hob er den Kanister an, gab noch einen winzigen Spritzer nach und schraubte die Verschlüsse zurück auf den Tank und den Kanister.
„Das genügt bis zu Miss Virginias Haus und zurück in die Stadt“, erklärte er mit einem Grinsen, das er durch ein schnelles Kopfsenken zu verstecken versuchte.
Wieder versöhnt mit der Situation, schmunzelte auch Felicitas. „Wie viele Dollar bekommen Sie dafür?“
Abner stellte das Behältnis auf den Sandboden und ließ einen kurzen, aber keinesfalls aufdringlichen Blick über sie gleiten. Schließlich zuckte er mit den Schultern, was Felicitas den Eindruck vermittelte, dass er lieber verschwieg, was er gern sagen wollte. Da sie sein Verhalten nicht einordnen konnte, kramte Felicitas mit gerunzelter Stirn in ihrer Handtasche nach den fremden Geldscheinen, von denen sie Abner einen hinstreckte. Ohne den dargebotenen Schein anzusehen, nahm er ihn und schob ihn in die Gesäßtasche seiner Jeans.
Nicht mehr ganz so befangen wie zuvor öffnete Felicitas die Autotür, wandte sich dann jedoch nochmals zu dem Schwarzen um. „Woher wissen Sie, dass ich zu Virginia Tampicos Haus unterwegs bin?“
Ihr Helfer grinste und deutete mit dem Daumen in die Luft. „Die Bäume flüstern es den Vögeln zu, und die erzählen es uns!“
Felicitas hob verwundert die Augenbrauen, hinterfragte seine Worte jedoch nicht, zumal die Möglichkeit bestand, dass sie die Erklärung ebenfalls nicht verstehen würde. „Vielen Dank für Ihre Hilfe!“
„Alles klar, Ma’am.“ Abner hob kurz die Hand, ehe er sich wegdrehte, den Kanister ergriff und zu den Jungen schlenderte, die die Begegnung interessiert verfolgt hatten.
Dieses Mal gab Felicitas vorsichtiger Gas, was ausreichte, weil der Motor vom Fahren noch warm war, und passierte die links und rechts entlang der Sandpiste stehenden Gebäude. Die Türen standen allesamt zum Lüften offen, und auf den meisten der überdachten und von Sträuchern und Bäumen gesäumten Veranden saßen Familien. Sie aßen und lachten miteinander, während sie den vorbeifahrenden Wagen gelassen beobachteten. Allem Anschein nach war Flips verdreckter Pick-up in ihrer Straße ein gewohntes Bild.
***
Als Felicitas durch das dritte Rinnsal fuhr, das die Straße querte, kam ihr in den Sinn, dass sie vergessen hatte zu fragen, ob es einen Weg zu ihrem Haus gab, den sie mit einem motorisierten Untersatz befahren konnte. Sie bremste abrupt ab und blieb mit laufendem Motor mitten auf der unbefestigten Piste stehen. Stattliche Baumriesen erhoben sich in den wolkenlosen Himmel und schwankten sanft hin und her, schmale, hölzerne Strommasten standen in regelmäßigen Abständen am Straßenrand.
„Ich fahre jetzt weiter und biege die erste Abfahrt links ein“, beschloss Felicitas und schickte zum zweiten Mal an diesem Tag ein Stoßgebet zum Himmel. Hier draußen gab es keine Menschenseele, bei der sie nach dem Weg hätte fragen können. Seufzend lenkte sie den ratternden Pick-up tiefer in das undurchdringliche Grün des Waldes hinein, bis sie an eine Stelle gelangte, an der ein breiter Bachlauf die Straße überflutete. Ein weiteres Mal bremste Felicitas scharf ab. Vorsichtig fuhr sie durch das erfreulicherweise flache Wasser und entdeckte gleich darauf einen quadratischen weißen Stein am linken Straßenrand. Erneut hielt sie an. Obwohl zwischen den Bäumen ein diffuses Licht herrschte, glaubte sie, unter hohem Gras, wild wuchernden Sträuchern und zarten Kiefern Spurrillen zu erkennen. Ob sie eine befahrbare Abzweigung vor sich hatte?
Felicitas ließ den Motor laufen, trat die Tür auf und stieg aus. Neugierig betrachtete sie den Markierungsstein und suchte sein Gegenüber auf der anderen Seite des zugewachsenen Weges. Versteckt unter verschlungenen Kudzu-Pflanzen wurde sie fündig. Mühsam zerrte sie die Zweige und Blätter beiseite und fand auf dem Stein zwei eingemeißelte Buchstaben: VT. Ihre Vermutung, dass sie für die Initialen Virginia Tampicos standen, war wohl nicht aus der Luft gegriffen.
Erleichtert richtete Felicitas sich auf, allerdings verging ihr das siegessichere Lächeln schnell, als ihr Blick auf den verwilderten Pfad fiel. Dieser wirkte, als sei er seit langer Zeit von niemandem mehr benutzt worden. Sorge keimte in ihr auf. Ob sie den Weg mit Flips Wagen befahren konnte? Und was erwartete sie am Ende der Auffahrt? Ein verfallenes Gebäude in einem völlig verwahrlosten Garten, in dem es vor Schlangen, Ratten und am Ende gar Alligatoren nur so wimmelte? Schon allein die Vorstellung jagte ihr einen kalten Schauer über den Rücken.
Mit einem aufgeregten Flattern in der Magengegend, als hätten sich unzählige Nachtfalter zu einem wilden Tanz versammelt, kehrte Felicitas zu Flips Lieferwagen zurück und wuchtete sich auf den Fahrersitz. Es half nichts, grübelnd und schwitzend im Fahrzeug zu verharren, denn dadurch verbesserte sich ihre Situation nicht. Also bog sie wesentlich beherzter, als sie sich fühlte, in die Zufahrt ein. Zwischen den beiden Markierungssteinen gab sie kräftig Gas, damit es der Pick-up über die Bodenunebenheiten hinwegschaffte. Die auf dem Pfad wachsenden Sträucher und Blumen, das hochstehende Gras und die Baumschösslinge verschwanden unter der Stoßstange, als fresse der Wagen sie auf.
Der Weg führte rund fünfhundert Meter geradeaus, beschrieb daraufhin eine weite Rechtskurve und endete vor einem geschlossenen, schmiedeeisernen Tor, das zwischen zwei schmalen Sandsteinquadern gut zweieinhalb Meter hoch bis in die Zweige der Bäume reichte. Kudzu-Efeu, in diesem Landstrich üppig wuchernd, hatte von den dunklen Gusseisenstangen ebenso Besitz ergriffen wie von den Steinquadern und Baumstämmen. Durch den Bewuchs hindurch sah Felicitas einen gekiesten Platz und die Fassade eines einstmals weißen zweistöckigen Gebäudes. Umgeben von einer hohen Hecke und von Bäumen, die sich großzügig in Spanisches Moos kleideten, schien es, als habe es sie an einen gleichermaßen verwunschenen wie düsteren Ort verschlagen.
Felicitas stieg mit weichen Knien aus und näherte sich zögernd dem Tor. Ihre Unsicherheit wuchs mit jedem Meter, den sie auf dem federnden Boden zurücklegte. War es nicht völlig verrückt, was sie getan hatte?
Energisch kämpfte sie die in ihr aufkeimenden Zweifel nieder. Sie war nun einmal hier, also musste sie das Beste aus der Situation machen. Sie griff nach dem Metallriegel und kippte ihn zurück, dann drückte sie mit ihrer linken Schulter gegen die beiden Torflügel. Mit einem schrecklichen Quietschen, aber erstaunlich zügig schwangen sie auf und gaben den Weg frei. Die unheimlich anmutende Atmosphäre löste sich auf, als habe jemand in einem erhabenen Saal, der in Dämmerlicht getaucht war, die Lichter angeknipst. Hinter dem runden Vorplatz erhob sich das mit ehemals weißen Holzschindeln verkleidete Haus. Eingerahmt von einer Fülle üppig blühender Magnolien, die ihre tulpenförmigen Blüten in zartem Weiß, kräftigem Purpur und dunklem Violett der Sonne entgegenreckten, wirkte es schlichtweg bezaubernd.
Felicitas hielt den Atem an, diesmal vor Begeisterung. Das Gebäude mochte heruntergekommen aussehen, doch die Außenanlagen vermittelten auf sie einen äußert gepflegten Eindruck, vor allem für ein Anwesen, das seit zwei Jahren leer stand. Das Grundstück war ein Traum – wunderschön!
Hastig lief Felicitas zum Auto zurück, lenkte es zwischen den Torflügeln hindurch und parkte auf dem Vorplatz. Als das Knattern des Motors endlich erstarb, hüllte angenehme Stille sie ein. Sie wurde augenblicklich vom Rauschen der Bäume, dem Zwitschern der Vögel und dem Rascheln der Sträucher und Gräser gefüllt, unterstützt vom Zirpen der hier allgegenwärtigen Grillen.
Voller Elan sprang Felicitas aus dem Fahrzeug und stieß die verdreckte Tür zu. Aufmerksam, damit ihr ja kein Detail der plötzlich über sie hereinbrechenden berauschenden Farben- und Duftexplosion entging, ging sie auf das zweistöckige Gebäude mit dem steilen Giebeldach und dem weit in die Höhe reichenden, gemauerten Kamin zu. Sechs Stufen, von einem massiven hölzernen Geländer umrahmt, führten zu einer Tür, in die acht rechteckige Glasscheiben eingelassen waren. Ein zierliches Vordach, getragen von zwei schlanken runden Holzsäulen, beschattete die Treppe.
Voller Vorfreude und Neugier kramte Felicitas in ihrer Handtasche und holte einen großen Schlüssel hervor, den sie ins Schloss steckte. Die Tür ließ sich problemlos öffnen, und Felicitas wurde von einer Wolke aus Staub und einem Wald aus Spinnweben willkommen geheißen. Sie betrat einen quadratischen, durch die weißen Holzwände freundlich erscheinenden Flur, von dem aus eine dunkle Holztreppe in den ersten Stock hinaufführte und mehrere hell lasierte Türen abgingen. Prüfend warf sie einen Blick in den ersten Raum. Dieser beherbergte eine gemütliche Küche. Die erstaunlich modernen Gerätschaften deuteten darauf hin, dass ihre unbekannte Verwandte durchaus vermögend gewesen sein dürfte.
Felicitas’ Begeisterung über das zwar staubige, aber dennoch hinreißende Ambiente durchströmte sie wie perlender Champagner und ließ sie auflachen. Alle ihre Sorgen und Zweifel gerieten in Vergessenheit. Am liebsten hätte sie sich wie ein Kind mit ausgebreiteten Armen im Kreis gedreht. Doch stattdessen eilte sie in den Raum, der der Küche gegenüberlag. Hier musste sich ein Arbeitszimmer befunden haben. Eine Nähmaschine, eine Schreibmaschine und ein CB-Funkgerät standen auf zwei Tischen verteilt, ein polsterbezogener Stuhl und ein Bett waren zum Schutz vor dem Staub in Laken gehüllt worden. Ein ähnliches Bild bot sich ihr auch im Wohnzimmer: abgedeckte Polstermöbel, trotz der Staubschicht wunderschön anzusehende, robuste Tische, Kommoden, Regale, schmutzige Fenster und eine Verandatür, vor der ein vergilbter, einstmals schilffarbener Vorhang traurig auf die staubigen, dunklen Holzdielen herunterhing.
Gespannt auf den Anblick, der sich ihr hinter dieser Tür bieten würde, zog Felicitas den luftigen Stoff beiseite und öffnete die mit weißen Streben unterteilte Glastür. Eine noch intakte Fliegengittertür ließ sich problemlos nach außen aufstoßen, und so gelangte Felicitas auf eine Veranda, die sich über die gesamte Hausfront erstreckte. Ein Geländer, dessen weiße Farbe fast vollständig abgeblättert war, fasste die Veranda ein und öffnete sich an einer Stelle hinaus auf den gepflegten Rasen.
Felicitas war von der ersten Sekunde an von dem fröhlich dahinplätschernden Fluss fasziniert. Er schlängelte sich unterhalb der leicht abschüssigen Wiese durch das Grundstück und verschwand zwischen knorrigen Zypressen und schlanken Weiden. Ein Holzsteg ragte etwa bis zur Flussmitte und endete dort in einer etwa vier mal vier Meter großen Plattform. Darunter floss gemächlich das blau schattierte Wasser hindurch, das im Laufe der Jahre grüne Algengewächse an den Stützbalken hatte wachsen lassen.
„Wie schön!“, entfuhr es Felicitas begeistert. Sie lief durch das knöchelhohe Gras zum Steg und betrat die Holzplanken, während sie das Schilf am gegenüberliegenden Ufer bewunderte. Plötzlich splitterte das Holz unter ihren Füßen. Ihr rechtes Bein sackte weg. Felicitas stieß einen erstickten Schrei aus und sah sich schon im Fluss liegen. Verzweifelt suchten ihre Hände nach Halt, während Bruchstücke des Stegs auf dem Wasser davontrieben. Glücklicherweise hielten die daneben verarbeiteten Holzbohlen ihrem Gewicht stand, sodass sich nur ihr Schuh mit Wasser füllte. Es gelang ihr, sich hochzuziehen. Keuchend legte sie sich auf den Rücken, betrachtete die am blauen Himmel fliegenden Vögel und spürte überdeutlich ihren kraftvoll arbeitenden Herzschlag. Sie bemühte sich, gleichmäßig zu atmen.
Erst nach geraumer Zeit richtete sie sich auf, um den entstandenen Schaden zu begutachten. Ihr Schuh war durchnässt, der Nylonstrumpf zerrissen, und rote, teilweise blutige Striemen zierten ihren Unterschenkel. Als sie die Verletzung sah, sandte diese sogleich ein unangenehmes Brennen und einen pochenden Schmerz aus. Dennoch fand sie beim Blick auf die scharfkantige Bruchstelle, dass sie recht glimpflich davongekommen war.
Vorsichtig, um nicht noch einmal einzubrechen, tastete sie sich zurück ans Ufer. Auf der leicht ansteigenden, sowohl sandigen als auch grasbewachsenen Uferböschung angekommen, besah sie sich unwillig die nassen, dunklen Holzplanken. Weshalb hatte sie nicht daran gedacht, dass das Holz morsch sein könnte? Im gleichen Augenblick flog schnatternd ein Entenpaar aus dem Schilf auf, floh den Flusslauf entlang und verschwand zwischen den Sumpfzypressen.
Felicitas’ Herz klopfte noch immer schnell, während sie misstrauisch die schwankenden Schilfhalme betrachtete. Für den Bruchteil einer Sekunde glaubte sie zwischen den langen Halmen eine menschliche Gestalt zu sehen. Entsetzt hielt sie den Atem an. Wer versteckte sich auf ihrem Grundstück und beobachtete sie?