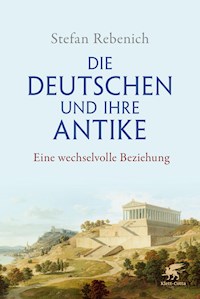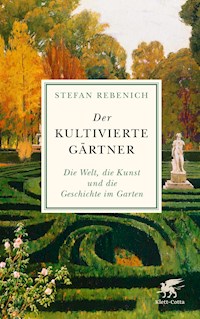
20,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 20,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Mit großer Liebe zur Gartenkunst und mit beeindruckender Kenntnis ihrer Geschichte erkundet Stefan Rebenich die grandiose Vielfalt der Gartenfreuden auf der ganzen Welt. Überzeugend würdigt er den Garten als befreienden und schöpferischen Lebensraum. Stefan Rebenich, leidenschaftlicher Gärtner und Gartenjournalist von Rang, führt uns auf eine unterhaltsame wie informative Reise durch die Welt der Gärten: Sachkundig präsentiert er elegante Pflanzenporträts und zeigt uns den ganzen Reichtum der Gartenfreuden. Unter der Führung dieses Kenners erkunden wir bekannte und weniger bekannte Gartenparadiese in Europa und Übersee. Auf höchst originelle Weise zeigt er, welche beeindruckenden Spuren die Sehnsucht nach Gartenlandschaften in der Geschichte der Menschheit hinterlassen hat – von den frühen Hochkulturen bis in unsere heutige Zeit. Und er erinnert uns daran, wie sehr Literatur und Malerei unsere Erfahrungen und Wahrnehmungen des Gartens geprägt haben. Zugleich wirft der Autor einen kritischen Blick auf aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen wie die neuen Medien und ihre Auswirkungen auf unsere Gärten. Dabei vergisst er nicht, auch manchen praktischen Rat zu geben. Ein kurzweiliges und kultiviertes Lesevergnügen über die Gartenkunst.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 214
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Stefan Rebenich
Der kultivierte Gärtner
Die Welt, die Kunst und die Geschichte im Garten
Klett-Cotta
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
© 2022 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover: Rothfos & Gabler, Hamburg
unter Verwendung einer Abbildung von © akg-images (Der alte Faun, Santiago Rusiñol, 1861–1931, Cason del Buen Retiro, Madrid)
Gesetzt von Dörlemann Satz, Lemförde
Grafiken im Inhalt: © akg-images (Teil 1); © The Stapleton Collection / Bridgeman Images (Teil 2); © Bridgeman Images (Teil 3); © Medici / Mary Evans (Teil 4); © akg-images (Teil 5)
Gedruckt und gebunden von Friedrich Pustet GmbH & Co. KG, Regensburg
ISBN 978-3-608-98634-1
E-Book ISBN 978-3-608-11844-5
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Hinführung: Gartenbildung
Erster Teil Durch das Jahr
Gärtnern im Spiegel der Jahreszeiten: Inspirationen von Vincent van Gogh
Der Garten im Frühling: Blütenpracht
Florale Nahaufnahme: Die Tulpe
Eine Pionierpflanze: Die Birke
Der Garten im Sommer: Geh aus mein Herz
Klimawandel: Vom richtigen Gießen
Der Garten im Herbst: Fest der Farben
Das Brot der Armen: Kastanien
Der Garten im Winter: Gartenfreude in der kalten Jahreszeit
Allerschönste Massenware: Der Weihnachtsstern
Zweiter Teil Um die Welt
Pflanzen auf Reisen: Botanische Gärten
Der islamische Garten: Die Alhambra in Granada
Monarchische Repräsentation: Versailles
Errungenschaft der Aufklärung: Das Gartenreich von Dessau-Wörlitz
In aller Herren Länder: Koloniale Gärten
Napoleons Erbe: Die Villa Carlotta am Comer See
Von Igor Strawinsky verewigt: Dumbarton Oaks Garden in Washington
Ein Gelehrtenparadies: Max Webers Garten in Heidelberg
Präsidiales Habitat: Der Rosengarten des Weißen Hauses
Refugium: Der Garten in Zeiten der Pandemie
Dritter Teil In der Geschichte
Der Garten in der Geschichtsschreibung: Ein Versuch
Rückzug aufs Land: Die antike Toskanafraktion
Die Entdeckung des Hochbeets: Frühe Hochkulturen
Garten und Bildung: Chinesische Gartenkunst
Spekulation mit Zwiebeln: Die Tulipomanie
Alle Jahre wieder: Die Rose von Jericho
Herrschaftszeichen: Englands Liebe zum Baum
Ein Lob auf Alteuropa: Bürgerliche Gartenkunst
Multikulti an der Atlantikküste: Portugiesische Gärten
Aus deutschen Landen: Der Siegeszug des Weihnachtsbaums
Vierter Teil Mit Feder und Pinsel
Der Garten des Alkinoos: Homer
Hortulus: Walahfrid Strabo
Der Lindenbaum: Franz Schubert
Komm in den totgesagten Park: Stefan George
Gartenimpressionen: Gustav Klimt
Ein Kräuterpfarrer: Johann Künzle
Monk’s House: Die Gärten der Virginia Woolf
Die Gartensiedlung: Paul Klee
Ratschläge in dunkler Zeit: Helmuth James von Moltke
Der leidenschaftliche Gärtner: Rudolf Borchardt
Fünfter Teil Für die Gesellschaft
Gemeinschaftlich: Gärten verpflichten
Praktisch: Der Blumentopf
Befreiend: Der Garten als Ort der Emanzipation
Professionell: Gartenakademien
Vermarktet: Die Gartenschauen
Gefährlich: Viren im Garten
Systemisch: Schädlingsbekämpfung
Hilfreich: Ratgeberliteratur
Vielfältig: Der Garten in den neuen Medien
Schließlich: Warum Mann und Frau gärtnern sollten
Nachwort
Pflanzen-, Personen- und Ortsregister
Hinführung: Gartenbildung
Ein kultivierter Gärtner – was soll man sich darunter vorstellen? Der Untertitel legt vielleicht eine Fährte: Es ist ein Gärtner, der sich nicht nur mit seinem eigenen Garten beschäftigt, sondern der diesem Thema in der Welt, in der Kunst und in der Geschichte nachspürt. Ebendiese Fährte will das vorliegende Buch aufnehmen. Die verschiedenen Beiträge sind durch eine übergreifende kulturgeschichtliche Perspektive verbunden: Der Garten wird als Lebensraum und Kulturobjekt verstanden. Die einzelnen Abschnitte sind epochenübergreifend, behandeln verschiedene Räume und berücksichtigen die globalen Implikationen des Gegenstands. Auch wenn kein streng chronologischer Durchgang und keine erschöpfende Darstellung geboten werden, also keine »klassische« Gartengeschichte, wird dem Leser und der Leserin hier mehr als ein bunter Strauß überreicht, der nur die persönlichen Vorlieben und Idiosynkrasien des Autors spiegelt. Dieses Buch erhebt den Anspruch, anhand der behandelten Fragen zwar ausgewählte, aber durchaus repräsentative Zusammenhänge der Gartengeschichte zu beschreiben. Zwischen den einzelnen Kapiteln gibt es zudem zahlreiche Querverbindungen.
Der erste Teil Durch das Jahr bietet jahreszeitspezifische Beiträge und Pflanzenporträts; der zweite Um die Welt lädt ein zum Besuch von ausgesuchten Gartendestinationen in Europa(1) und Übersee; der dritte In der Geschichte versammelt bekannte und weniger bekannte Memorabilien aus der Gartengeschichte; der vierte Mit Feder und Pinsel spürt dem Garten in Literatur, Musik und Malerei nach, und der fünfte Teil Für die Gesellschaft widmet sich schließlich sozialen, kulturellen und ökologischen Zusammenhängen und verweist auf die Aktualität des Themas.
Der Band will informative und zugleich unterhaltende Lektüre bieten. Deshalb kann er ganz, aber auch abschnitts- oder kapitelweise gelesen werden. Selbstverständlich findet sich mancher praktische Tipp, der im heimischen Garten umgesetzt werden kann. Adressiert werden sollen kultivierte Gärtnerinnen und Gärtner, die ihrer Passion in einer »vornehmen, gebildeten, zivilisierten Art« nachgehen, wie es im »Duden« unter dem Stichwort »kultiviert« heißt, »die auf einem über Generationen hin erworbenen Grad geistiger und sittlicher Verfeinerung beruht«. Wie das französische(1)cultivé verweist das deutsche(1) Pendant damit auf Bildung als zentrale Herausforderung für jeden Gärtner und jede Gärtnerin.
Der Begriff »Gartenbildung« ist verhältnismäßig jung. Das Grimmsche Wörterbuch kennt ihn nicht. In der hortologischen Literatur taucht er vereinzelt seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts auf; retrospektiv wurde er mit dem Landschaftspark englischer(1) Provenienz verbunden. Freiheit und Bildung fanden in scheinbar naturbelassenen aristokratischen Parks, aber auch in Volksgärten zusammen, in denen die starren Formen des älteren französischen(2) Stils, das heißt der nach strengen geometrischen Regeln gestalteten Barockgärten, aufgebrochen wurden und sich die Kunstregel plastischer Landschaftskunst nach der Natur orientierte.
Doch Gartenbildung als Gegenstand reicht bis in die klassische Antike zurück. Die europäischen(2) Gärten und Parks haben sich seit dem Humanismus in vielfältiger Weise immer wieder auf das antike Vorbild bezogen. Die suburbanen Villenbesitzer der italienischen(1) Renaissance beispielsweise imitierten die Ideologie eines senatorischen Lebens, das zwischen der ländlichen Villa und der Stadt oszillierte. In Tivoli(1) präsentierte sich der humanistisch gebildete Kardinal Ippolito d’Este(1) als eigentlicher Bewahrer des antiken Erbes und diffamierte das Rombild des asketischen Ordensmannes Pius V.(1), seines päpstlichen Rivalen. Gärten des Barock und Rokoko dienten als monumentale Kulisse der aristokratischen Herrschaftsinszenierung nach antiken Vorlagen. Auf den Terrassen von Sanssouci(1) schuf Friedrich II.(1) nach den literarischen Texten von Horaz(1) und Vergil(1) einen großartigen locus amoenus. Klassisch gebildeten Gentlemen verdanken wir den liberalen Landschaftsgarten; in der Gartenanlage(1) von Stowe im englischen Buckinghamshire bestimmten die römischen Tugenden, die virtutes Romanae, die der Historiker Livius(1) um die Zeitenwende kanonisiert hatte, die Thematik und Typologie der Skulpturen.
Die britischen Inseln waren der Ausgangspunkt der neuen Gartenbildung, die zumindest auf dem europäischen(3) Kontinent im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts Verbreitung fand. Der englische(2) Park distanzierte sich von der barocken Garten- und Landschaftsgestaltung. Er zelebrierte die ungebändigte Natur, in der das Individuum seine Blicke und seine Gedanken frei schweifen lassen konnte. Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts stritt man darüber, ob das formale Prinzip zu viel geometrische Abstraktion in die Gartenbildung hineintrage, die letztlich zu einer Vergewaltigung der Natur führe.
In diesem Sinne bedeutet Gartenbildung den Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten gärtnerischen Ignoranz. Diese emanzipatorische Bildung ist inzwischen demokratisiert und, zumindest im Westen, nicht allein abhängig von ökonomischen Ressourcen. Der Gärtner ist ein freier Mensch, der seine Zeit für die Gestaltung des eigenen Nutz- und Ziergartens und damit für die Entdeckung seiner selbst verwenden kann. Im heimischen Grün vermag er seine eigene Befriedigung zu finden, die wieder positiv auf seine soziale Umwelt wirkt. Das gilt auch für die traditionellen Schrebergärten und die modischen Projekte des »Urban Gardening«.
Gartenbildung verbindet theoretisches und praktisches Wissen. Man muss sich im Gestrüpp des Unterholzes und der Ratgeber sicher bewegen, die nächstjährige Staudenblüte imaginieren und die Astschere gekonnt ansetzen, die Fruchtfolge im Hochbeet vorausschauend planen und die Kompostmiete flink umsetzen, die Bodenbeschaffenheit korrekt analysieren und die Blumenzwiebeln rechtzeitig setzen. Für die visionäre Kraft der Gartenbildung ist die eigene Erfahrung durchaus wichtig. Wer erinnert sich nicht an seinen ersten Garten? Den Duft der Lieblingsrose? Die Panstunde unter dem alten Obstbaum? Doch man sollte nicht allein auf emotionale Zugänge vertrauen, die zwar bleibende Eindrücke hinterlassen, aber oft keine nachhaltige Erkenntnis bringen.
Jede kultivierte Gärtnerin und jeder kultivierte Gärtner weiß aus Erfahrung, dass Erfolg und Scheitern im Garten zusammengehören. In der schnelllebigen Zeit gemahnt die Arbeit im Garten zu Bescheidenheit, Demut und Geduld; sie ist ein ideales Mittel der körperlichen und geistigen Entschleunigung – und eine zeitgemäße Form der Kontingenzbewältigung in der modernen Gesellschaft. Hinzu tritt die Einsicht, dass die Sorge um den Garten immer den Austausch mit dem Anderen voraussetzt, die Offenheit für Neues, Fremdes, Unerhörtes. Zu dem sinnlichen Genuss tritt das intellektuelle Vergnügen; beide sind umso größer, wenn man sie in der Familie, mit Freunden, mit Nachbarn teilen kann. Garten und Leben kommen so zusammen, werden aufeinander bezogen, bedingen einander. Zugleich hat jeder Gärtner an der Gestaltung der Welt teil, denn er trägt mit seinem Garten, auch wenn er noch so klein ist, Verantwortung für das gesamte ökologische, soziale und politische System. Gärtnern bedeutet die Auseinandersetzung mit sich selbst und mit der Gesellschaft.
Heute sind wir indes in der paradoxen Situation, dass zumindest in der westlichen Hemisphäre zwar alles für den Garten verfügbar ist, aber die Unmittelbarkeit der individuellen Erfahrung mehr und mehr verloren geht. Gärtnerisches Gestalten wird an vermeintliche Experten delegiert und rasch wechselnden Moden unterworfen. Die einen sind mit dem Billigangebot aus dem Gartencenter zufrieden, die anderen ersteigern exklusive Gehölze zu horrenden Preisen. Hier legt man mit viel Geld exotische Anlagen an, dort ist die globale Massenware der monotone Schmuck der Vorgärten. Der totgesagte Park ist auf diese Weise wirklich tot. Was kann dagegen helfen? Nur Gartenbildung.
Und die beginnt einmal mehr in der klassischen Antike. Am Anfang der abendländischen(4) Literatur beschreibt Homer(1) eindrücklich im siebten Gesang der Odyssee den herrlichen Garten des gastfreundlichen Phaiaken Alkinoos(1), in dem Äpfel(1) und Birnen(1), Feigen(1) und Trauben(1), Oliven(1) und Granatäpfel(1) reiften (7, 112–132). Auch Laërtes(1)’ Landgut auf Ithaka(1) findet ausführlich Erwähnung, wo Odysseus(1) seinen betagten Vater mit einfachem Werkzeug das früchtereiche Gelände bestellen sah. Unter dem hochgewachsenen Birnbaum(2) vergoss er bittere Tränen, als er des Kummers des alten Mannes gewahr wurde (24, 219–234).
Aus dem griechischen Altertum ist aber vor allem die philosophische Begründung der Gartenbildung auf uns gekommen. Die bedeutendste antike Philosophenschule wurde von Platon(1) bald nach 387 v. Chr. in einem athenischen(1) Hain eingerichtet, der nach dem attischen Heros Akademos(2) benannt war. Die platonische Schule hieß deshalb Akademie. Von Platon(2) nehmen wir die Gewissheit mit, dass Erziehen und Gärtnern durchaus vergleichbar sind. Im Dialog Phaidros, dem der berühmte Gräzist Ulrich von Wilamowotz-Moellendorff(1) den herrlichen Titel Ein glücklicher Sommertag gab, erzählt Sokrates(1) von einem Gärtner, der den Samen, von dem er Früchte haben möchte, in der südlichen Sommerhitze in einen Kasten sät und sich daran freut, dass er in acht Tagen bereits prächtig aufgeht; aber noch schneller sind die Pflanzen wieder verwelkt. Diesem stellt Sokrates(2) den Gärtner gegenüber, der den Samen nach den Regeln der Kunst ausbringt und wässert; er wartet dann geduldig zu und freut sich schließlich, wenn er im achten Monat eine reiche Ernte einbringen kann (Phaidros 276b1–c5). Erfolg ist nicht rasch zu haben, weder in der Erziehung noch beim Gärtnern. Hier wie dort ist gewissenhafte, anstrengende Arbeit gefordert. Platon(3) verweist zugleich auf unser individuelles Potenzial, als kluge Gärtner die Verantwortung für unsere Pflanzen und damit für uns selbst zu übernehmen. Der Garten spiegelt das Individuum, das ihn erschaffen hat, und das darüber entscheidet, was schön und gut ist.
Zu Platon(4) tritt Epikur(1), der 306 v. Chr. in seinem Garten in Athen(3) eine Schule gründete und sich auf die Suche nach einem Leben machte, das frei von Schmerz und Furcht sein sollte. Körper und Geist wurden in diesem Garten gepflegt und die natürlichen Bedürfnisse wie Hunger und Durst gestillt. In der sicheren Distanz zum politischen Geschehen und im exklusiven Kreis der Freunde fand man Friede und Freude. Der Epikureismus war eine apolitische, ja antipolitische Philosophie, die auf die zeitgenössischen Verhältnisse mit Rückzug, aber nicht mit Resignation reagierte. Die Polis als bürgerliche Lebensform war in den hellenistischen Monarchien obsolet geworden. Von Epikur(2) sollten wir mithin lernen, dass der Garten dem Mensch Freiräume eröffnet, die er in der Geschäftigkeit des Alltags nicht finden kann. Dennoch ist Gärtnern in der Tradition Epikurs keine Reaktion auf den Verlust der politischen Partizipation. Dies wäre ein neuzeitliches und damit anachronistisches Missverständnis; Epikur(3) würde quasi mit den Augen Voltaire(1)s gelesen werden, der in seiner aufklärerischen und kritischen Novelle Candide den großen Gartenbauer Leibniz(1) verspottete und die satirische Maxime propagierte: Il faut cultiver notre jardin – »Man muss seinen eigenen Garten bestellen«. Epikur(4) indes verkündete keineswegs die privatistische Botschaft, nur den eigenen Garten zu pflegen und sich um den anderen nicht zu kümmern. Das Bestellen des eigenen Gartens ist vielmehr ein Bekenntnis zur sozialen Verantwortung.
Doch es bleibt die Diskrepanz zwischen individueller Selbsterkenntnis und kollektivem Stil, die unsere gärtnerische Jetztzeit charakterisiert. Hier können die Alten keine Antwort geben, aber vielleicht Georg Simmel(1), der brillante Außenseiter unter den Ahnvätern der deutschen(2) Soziologie. Der hatte zwar mit Gärten wenig am Hut. Aber seine Philosophie des Geldes kann den Ausgangspunkt für die Entwicklung einer zeitgemäßen Gartenbildung markieren. Denn die von ihm präzise erfasste Vielfalt der Stile und Strömungen verdichtet sich nicht zu einem normativen Ideal. Der Pluralismus der kapitalistischen Moderne ist im Garten angekommen, die Kultur der Dinge übersteigt auch hier die Kultur der Menschen. »Der Mangel an Definitivem im Zentrum der Seele treibt dazu, in immer neuen Anregungen, Sensationen, äußeren Aktivitäten eine momentane Befriedigung zu suchen; so verstrickt uns dieser erst einerseits in die wirre Halt- und Ratlosigkeit, die sich bald als Tumult der Großstadt, bald als Reisemanie, bald als die wilde Jagd der Konkurrenz, bald als die spezifisch moderne Treulosigkeit auf den Gebieten des Geschmacks, der Stile, der Gesinnungen, der Beziehungen offenbart« (Philosophie des Geldes, München/Leipzig(1)41922, S. 551).
Die Ambivalenz der modernen Gartenkultur könnte kaum präziser charakterisiert werden. Nur die kultivierte Gärtnerin und der kultivierte Gärtner vermögen als autonome Persönlichkeiten aus ihren schöpferischen Kräften einen individuellen Gartenstil zu kreieren. Gartenbildung bewahrt also vor dem unsteten Wechsel der Vorlieben und Moden, wie sie unsere heutige Konsumgesellschaft auch im Grünen postuliert. »Bei dem großen und schöpferischen Menschen strömt die einzelne Leistung aus einer solchen umfassenden Tiefe des eigenen Seins, dass sie in diesem eben die Festigkeit, Fundamentierung, das Mehr als Jetzt und Hier findet, das der Leistung des Geringeren aus dem von auswärts aufgenommenen Stil kommt. Hier ist das Individuelle der Fall eines individuellen Gesetzes; wer dazu nicht stark genug ist, muss sich an ein allgemeines Gesetz halten« (Georg Simmel(2), Das Problem des Stiles, zitiert nach: Gesamtausgabe, Bd. 8, Frankfurt a.M. 1993, S. 383). Die erkauften Arabesken einer nur scheinbaren Individualität sind obsolet. Dies bedeutet jedoch auch, dass Gartenbildung etwas Besonderes und Individuelles ist, keine Massenware, die man im Gartencenter um die Ecke finden kann.
Erster Teil Durch das Jahr
Gärtnern im Spiegel der Jahreszeiten: Inspirationen von Vincent van Gogh
Nähern wir uns unserem Thema mit einem ausführlichen Zitat: »Ich habe eine Reihe Farbstudien gemacht, indem ich einfach Blumen gemalt habe: roten Mohn(1), blaue Kornblumen(1) und Vergissmeinnicht(1), weiße und rosa Rosen(1), gelbe Chrysanthemen(1); ich suchte die Gegenüberstellung von Blau und Orange, Rot und Grün, Gelb und Violett, suchte gebrochene und neutrale Töne, um harte Gegensätze auszugleichen, versuchte, intensive Farben wiederzugeben und nicht etwa graue Harmonien.« Von dem genialen Maler Vincent van Gogh kann man mehr über Gärten lernen als durch redselige Ratgeberliteratur und trendige Youtube-Clips. Denn dort wird entweder das breitgetreten, was erfahrene Gärtnerinnen und Gärtner ohnehin schon wissen, oder der dernier cri der hortikulturellen Massenproduktion gepriesen, der das Portemonnaie belastet, den Garten aber nur kurzfristig aufhübscht.
Nach den dunklen und grauen Wintermonaten begeistern uns alle im Frühling die ungestüme Kraft des Wachstums und die herrliche Pracht der Blüten. Und im Sommer können wir uns an der grünenden Zier nicht satt sehen. Der Herbst wiederum fasziniert durch sein unendliches Farbenspiel. Genießen kann man die Gaben der Natur jedoch nur dann richtig, wenn die Vielfalt des Möglichen durch planende Voraussicht gestaltet wird: Es braucht individuelle Entwürfe, die nicht von der Stange zu haben sind; sie müssen selbst erarbeitet und umgesetzt werden. Dabei sind mit Vincent van Gogh(1) vier grundsätzliche Überlegungen zu berücksichtigen, um dem Garten den Schmuck zu verleihen, den er verdient.
Beginnen wir mit der Farbe. Nichts ist im Garten wichtiger! Wenn die Rabatten aussehen wie die Palette eines Schulmalkastens, wird die komplette Optik ruiniert. Eugènes Chevreuls(1) Farbtheorie ist für Anpflanzungen von Blumen und Sträuchern geradezu tödlich: Sie führt direkt in einen platten Kolorismus. Experimentieren Sie mit den Farben der blühenden Pflanzen, wie van Gogh(2) in seinem eingangs zitierten Brief an den englischen(3) Maler Horace M. Livens(1) im Sommer 1886 beschrieben hat. Wählen Sie Ihre Favoriten für den Garten oder Balkon aus, und versuchen Sie vorausschauend, die sechs Hauptfarben: Rot, Blau, Gelb, Orange, Lila und Grün in Einklang zu bringen. Sie werden in jeder Jahreszeit ihren individuell gestalteten Garten lieben und, wenn es denn sein soll, Preise gewinnen!
Nicht minder wichtig ist das Element der Bewegung. Auch hier können Sie von van Gogh(3) lernen. Räumliche Plastizität lässt sich durch eine geschwungene und kurvenreiche Linienführung herstellen. Die Linien im Beet sollten natürlich und spontan aussehen; manieristische und artifizielle Elemente sind unbedingt zu vermeiden. Unverwechselbar wird der Garten durch die dynamische Rhythmisierung von Flächen, die abwechslungsreiche Integration der Gartenräume und die vertikale Strukturierung durch verschiedene Ebenen. Kombinieren Sie zum Beispiel bänderweise gepflanzte Traubenhyazinthen(1) mit Narzissen(1) unter Laubgehölzen, die den Zwiebelblumen noch ausreichend Licht lassen.
Alle Freude auf das Gartenjahr bezweckt dabei nichts, wenn sie nicht mit einem unstillbaren Verwirklichungsdrang einhergeht. Die Lust auf den Garten muss Sie bereits am frühen Morgen mit den ersten Sonnenstrahlen erfassen, und die Leidenschaft für die Arbeit im Beet darf Sie bis zum Abend nicht verlassen. Alle Sinne sollen angesprochen werden. Der Garten muss ein Ort kreativer Selbstverwirklichung sein, in dem Sie sich im Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter von vorgegebenen Stereotypen und überkommenen Klischees emanzipieren. Das Experiment ist allgegenwärtig. Auf diese Weise wird der Garten zu einem unverwechselbaren Stück der eigenen Biographie.
Schließlich sollten Sie von van Gogh(4) lernen, sich vom Alltäglichen zu befreien und das Wichtige wahrzunehmen. Doch was ist Ihnen wichtig? Die blühenden Obstgärten im Frühjahr und die leuchtenden Sonnenblumen(1) im Sommer? Die weiten Felder mit Tulpen(1) und Mohnblumen(2)? Der blühende Mandel(1)- oder Oleanderzweig(1) in der Vase? Was immer Sie im Garten tun, halten Sie sich an (5)Vincent van Gogh: »Ich suche jetzt, das Wesentliche zu übersteigern und das Alltägliche absichtlich vage zu belassen.«
Der Garten im Frühling: Blütenpracht
Temporalität ist das Zauberwort für das Frühlingserwachen im Garten. Die Wahrnehmung und Interpretation des Zeiterlebens ist die entscheidende Grundbedingung für gärtnerisches Handeln. Schon bei Aristoteles(1) kann man nachlesen, dass Zeit nicht die bloße Abfolge von Bewegungen ist, sondern eines von Menschen geschaffenen Maßstabes bedarf, nach dem sie geordnet wird.
Der Frühling gibt vielerlei Möglichkeiten, das »Vorher« und »Nachher« zu messen. Die Kunst der Gartengestaltung besteht nach den dunklen Wintermonaten gerade darin, das subjektive Maß der Zeiterfassung mit den natürlichen und räumlichen Gegebenheiten zu harmonisieren. Dies ist eine ständige und jedes Jahr aufs Neue zu meisternde Herausforderung.
Selbstverständlich sind die Beschaffenheit des Bodens, die klimatischen Verhältnisse, die Größe und Struktur des Gartens und schließlich die Architektur des Hauses zu berücksichtigen, wenn für das Frühjahr geplant wird. Wenn Sie Ihren Garten wohlüberlegt gestaltet haben, können Sie gewiss sein: Blütenrausch folgt auf Blütenrausch. Farben und Düfte sind omnipräsent. Mancherorts beginnt die Zier bereits im Februar, wenn Schneeglöckchen (Galanthus)(1), Winterlinge (Eranthis hyemalis)(1) und Krokusse (Crocus)(1) – mitunter noch durch die Schneedecke – aus dem Boden sprießen.
Es folgen die porzellanartigen Blüten der Magnolien(1), die in keinem Garten fehlen sollten. Mein Favorit ist die relativ robuste Magnolia x soulangeana, die Tulpenmagnolie(1), deren weiße Blüten ein Hauch von Rosa schmückt. Sie liebt feuchten, aber durchlässigen und leicht sauren Boden; dieser Traum von einem Baum braucht eine Einzelstellung, um zur Geltung zu kommen, und die Magnolie(2) sollte in Ruhe ihre Schönheit entfalten können. Eine Säge richtet nur Schaden an.
An blühenden Ziergehölzen fehlt es im Frühjahr wahrlich nicht. Verzichten sollte man nicht auf die farbstarke Leuchtkraft der Forsythien(1), auch wenn diese nicht unbedingt bienenfreundlich sind. Aber jede einzelne Forsythie, und besonders die Hybride mit dem sprechenden Namen »Goldrausch«, verleiht dem Garten ein prächtiges Frühlingsgewand; und die Blütezeit gibt den untrüglichen Hinweis, wann die Rosen(2) geschnitten werden können. Unterpflanzt werden kann mit Sternhyazinthen(1) (Chionodoxa), Lungenkraut (Pulmonaria officinalis)(1) oder Blausternchen (Scilla bifolia)(1).
Der Frühling ist die Jahreszeit der strahlenden Narzissen(2) und der farbenfrohen Tulpen(2). Diese Zwiebelblumen sollten wie Stauden gepflanzt werden: nicht spießig nach Arten sortiert, sondern anarchisch gemischt! Ein beeindruckendes Frühjahrsbild entsteht allerdings nur, wenn man im Jahr zuvor pro Quadratmeter mindestens fünfzehn Narzissen oder Tulpen in die Erde bringt. Die Zwiebeln müssen bis Anfang August bestellt werden; dann gibt es noch die größte Auswahl! Im späteren Frühjahr sollten dann die welken Blüten entfernt werden, um Samenbildung zu verhindern und die Entwicklung der Zwiebeln zu fördern. Das Laub muss aber unbedingt fünf bis sechs Wochen stehen bleiben. Wer ungeduldig die Schere ansetzt, vermindert die Blütenbildung im nächsten Jahr.
Eine reichblühende gelbe Narzisse(3) (wie Narcissus cyclamineus »Téte à Téte«) lässt sich wunderbar mit einer dunkelblauen Hyazinthe(2) (etwa Hyacinthus orientalis »Delft Blue«) kombinieren. Dunkle Tulpen(3) können mit der leicht bläulichen Katzenminze (Nepeta)(1) oder aber Zierlauch (Allium)(1) vergesellschaftet werden. Im frühlingshaften Staudenbeet sollten die romantischen Vergissmeinnicht(2) (Myosotis), die sich am richtigen Standort selbst aussäen, und die unverwüstlichen Christrosen(1) (Helleborus) nicht fehlen, die allerdings wie Tulpen(4) keine Staunässe vertragen.
Voller Begeisterung können Sie dann auf die Blütenpracht im Monat Mai warten, auf den Blauregen (Wisteria floribunda(1)), der Wände und Pergolen ziert, auf die Japanische Kirsche(1) (Prunus serrulata »Kanzan«), deren doldenfömige, rosa gefüllte Blüten jedem Betrachter auffallen, und auf den Flieder(1) (Syringa vulgaris); bei letzterem bevorzuge ich nach wie vor das »Andenken an Ludwig Späth(1)«: die dunkelpurpurrot gefärbten und stark duftenden Rispen sind unübertroffen.
Die Farben und Gerüche der Pflanzen begleiten Sie in den Sommer. Ihr »Vorher« und »Nachher« schafft die Voraussetzung, den Garten in seiner Individualität zu erleben.
Florale Nahaufnahme: Die Tulpe
Die Geschichte der Tulpe(5), deren Heimat die weiten Steppen und schwer zugänglichen Gebirgstäler Zentralasiens sind, beginnt nicht in den Niederlanden(1), sondern in Persien(1) und der Türkei(1), wo zunächst zahlreiche Wildarten und später kultivierte Formen die Palastgärten der Herrscher füllten. Flämische oder französische(3) Reisende brachten Mitte des 16. Jahrhunderts die ersten Zwiebeln der fälschlich als lils rouge, rote Lilie(1), bezeichneten Blume von der Goldenen Pforte nach Westeuropa(5). 1559 sah der Züricher Arzt und Botaniker Konrad Gesner(1) zum ersten Mal eine rotblühende Tulpe(6) in dem Garten des Augsburger Patriziers Johann Heinrich Herwart(1).
Möglicherweise geht der Name »Tulpe(7)« auf das türkische Wort tülbend (»Tüllband«) zurück, da die Blütenblätter an die Farbe eines Turbantuches oder an das Aussehen eines gewickelten Turbans erinnerten. Se non è vero, è ben trovato. Während die Osmanen(2) in der Tulpe(8) jedoch die Blume Gottes erkannten, riefen die ersten Begegnungen mit den Blumenzwiebeln im Okzident nicht immer Begeisterung hervor: Da man die schrumpelige Importware zunächst für einfache Gemüsezwiebeln hielt, wurden sie geröstet und mit Essig und Öl angemacht. Doch ihr bitterer Geschmack enttäuschte, nur in Zucker eingelegt mundeten sie besser. Lieblos zwischen Kohlköpfen im Gemüsegarten verscharrt, erkannte man nur zufällig, welch’ herrliche Blume diese Zwiebel austrieb. Flämische(2) und französische(4) Flüchtlinge, die wegen ihres protestantischen Glaubens verfolgt wurden, verbreiteten dann in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts die Tulpen(9) in Europa(6): Sie trugen die wertvollen und problemlos zu transportierenden Zwiebeln als Startkapital in ihrem leichten Reisegepäck.
Bleibende Verdienste um die Einführung der Tulpe(10) in den Niederlanden(3) erwarb sich der französische(5) Humanist Carolus Clusius(1), der 1593 an der kurz zuvor gegründeten Universität Leiden(1) eine Professur antrat und seine bedeutende Sammlung von Zwiebeln in dem dortigen hortus academicus auspflanzte, wo zumindest einige Exemplare Mäusefraß und Wetterunbill überstanden. Er beschrieb die tulipa genannte Blume, katalogisierte sie und schuf die Voraussetzungen für ihren gewerbsmäßigen Anbau und die Züchtung neuer Arten (sogenannter »Hybriden«). Zu Recht wurde eine besonders schöne Wildart nach ihm benannt, die tulipa clusiana.
Bereits zu Beginn des 17. Jahrhunderts war die Tulpe(11) zum Statussymbol der Reichen und Mächtigen in ganz Europa(7) avanciert. Der Fürstbischof von Eichstätt, Johann Conrad von Gemmingen(1), begeisterte sich für die Tulpen(12) ebenso wie der Markgraf von Baden-Durlach, der jedes Jahr Tausende von Zwiebeln von siebzehn verschiedenen holländischen(4) Blumenzüchtern bezog. Europaweit(8) blühte der organisierte Diebstahl. Warum nun diente ausgerechnet die Tulpe(13) den alten wie den neuen Plutokraten als Prestigeobjekt? An ihrer Schönheit und Vielgestaltigkeit allein lag es nicht. Entscheidend war die Seltenheit einzelner begehrter Arten. Tulpen(14) vermehren sich nämlich nicht rasch: Der Samen benötigt in der Regel sieben Jahre, um sich in eine blühende Blume zu verwandeln. Eine Mutterzwiebel wiederum kann (meist zwei bis drei) Nebenwurzeln, sogenannte Brutzwiebeln, hervorbringen, die nach ein bis zwei Jahren Blüten tragen. Gerade bei Neuzüchtungen überstieg die Nachfrage das Angebot bei weitem.
Viele Tulpen(15)