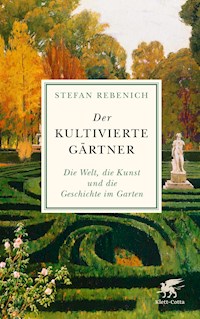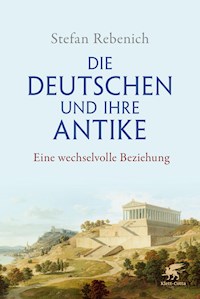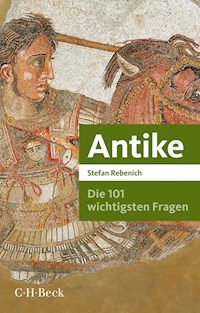
9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was ist die Antike? Wie funktionierte die athenische Demokratie? Was ist ein Mythos? Welche medizinischen Kenntnisse besaßen die Römer? Was ist der Limes? Wieso ging das Römische Reich unter? Was ist das Orakel von Delphi? Hatten die griechischen Tragödien und Komödien eine politische Funktion? Welche Faktoren begünstigten den Aufstieg des Christentums?
Stefan Rebenich erschließt mit den 101 wichtigsten Fragen und seinen – in manchen Fällen überraschenden – Antworten auf gleichermaßen informative und anregende Weise die Welt der Griechen und Römer. Dabei ist es der darstellerischen Kunst des Autors zu verdanken, dass jede einzelne seiner Antworten neugierig auf die nächste Frage macht. Die erfolgreiche Einführung wurde für die 3. Auflage überarbeitet und aktualisiert. Alles, was Sie schon immer über die Antike wissen wollten – hier werden Sie es erfahren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Stefan Rebenich
Die 101 wichtigsten Fragen
Antike
C.H.Beck
Zum Buch
«Die Kunst ist lang, doch kurz ist unser Leben.» So schreibt der römische Autor Seneca in seinem berühmten Werk Über die Kürze des Lebens (1,1). Schon in der Antike war man sich also des Phänomens der knappen Zeit bewusst. In gewisser Weise trägt auch der vorliegende Band diesem überzeitlichen Problem Rechnung: Man kann sich zwar eine ferne Epoche wie die Antike durch die Lektüre umfassender Gesamtdarstellungen oder mit Hilfe von breit angelegten Biographien bedeutender Persönlichkeiten erschließen. Aber es ist ebenso legitim, sich als Einstieg von einem Fachmann kurze, klare und kenntnisreiche Antworten auf konkrete Fragen geben zu lassen, die zentrale Aspekte der griechischen und römischen Geschichte, Gesellschaft, Politik, Kultur und Religion fokussieren. Dabei ist es die darstellerische Kunst des Autors, dass jede einzelne seiner Antworten neugierig auf die nächste Frage macht. So kann man in diesem Büchlein hin und her blättern, sich systematisch für zusammenhängende Fragenkomplexe interessieren oder es von vorne bis hinten durchlesen – in jedem Falle wird man interessante, anregende und verständlich dargebotene Informationen erhalten.
Über den Autor
Stefan Rebenich lehrt als Professor für Alte Geschichte an der Universität Bern. Die Geschichte der griechisch-römischen Antike, insbesondere die Geschichte Spartas, das Christentum im Römischen Reich, die Spätantike sowie die Rezeptionsgeschichte der Antike und die Wissenschaftsgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts bilden Schwerpunkte seiner Forschung.
Inhalt
Gebrauchsanweisung
Zur Einleitung
1. Was ist die Antike?
2. Welche Wissenschaften erforschen die griechisch-römische Antike?
Politische Institutionen
3. Was ist eine Polis?
4. Waren die griechischen Tyrannen Gewaltherrscher?
5. Wie funktionierte die athenische Demokratie?
6. War Sparta ein Kriegerstaat?
7. Was versteht man unter dem Begriff «Hellenismus»?
8. Was wissen wir über die römische Republik?
9. Wie wurde Rom zur Weltmacht?
10. War Augustus der erste römische Kaiser?
11. Wie hielten die Römer ihr Weltreich zusammen?
12. Was ist der Limes?
13. Wieso wurden die Christen verfolgt?
14. Wie veränderte sich das römische Kaisertum in der Spätantike?
Soziale Strukturen
15. Welche Bedeutung hatte die Familie?
16. Wie gestaltete sich das Verhältnis von Alten und Jungen?
17. Welche Bevölkerungsgruppen lebten in Athen?
18. Was können wir über die Rolle der Frauen in der Antike sagen?
19. Wie ging man in Griechenland mit Fremden um?
20. Wer zählte in Rom zur Oberschicht?
21. Was sind Klienten, und was ist ein Patron?
22. Wie lebten römische Sklaven und Freigelassene?
23. Welche Aufstiegsmöglichkeiten hatte ein Bewohner aus einer römischen Provinz?
24. Wer waren die ersten Christen?
25. Warum war das Zeremoniell am kaiserlichen Hof so wichtig?
26. Verstanden Christen unter Freundschaft etwas anderes als Heiden?
Religion und Kultus
27. Was ist ein Mythos?
28. Wie wurde Hochzeit gefeiert?
29. Welche Feste begleiteten die Geburt eines Kindes?
30. Wie wurden die Toten bestattet?
31. Was ist das Orakel von Delphi?
32. Wie verliefen die Olympischen Spiele der Antike?
33. Was wissen wir über die Religion der Perser?
34. Welche Bedeutung hatten Vorzeichen?
35. Wer waren die Vestalinnen?
36. Wie wurde der tote Kaiser in Rom geehrt?
37. Warum kam es zum Krieg zwischen Juden und Römern?
38. Welche Faktoren begünstigten den Aufstieg des Christentums?
Wirtschaft, Technik und Militär
39. Wie lebten Bauern in der Antike?
40. Kannte die Antike ein Umweltbewusstsein?
41. Gab es in der Antike technischen Fortschritt?
42. Welche Einstellungen hatte man gegenüber Reichtum?
43. Wer musste in Athen Steuern zahlen?
44. Gab es in der Antike Mindestlöhne?
45. Wie wurde die Metropole Rom versorgt?
46. Was ist eine Villa?
47. Wie funktionierte eine römische Heizung?
48. Wer finanzierte das römische Straßensystem?
49. Wie führte man in der Antike Krieg?
50. Wie sah eine militärische Karriere in Rom aus?
Kunst und Literatur
51. Was wissen wir über Homer und den Trojanischen Krieg?
52. Wie sah ein griechisches Heiligtum aus?
53. Hatten die griechischen Tragödien und Komödien eine politische Funktion?
54. Was ist die Akropolis?
55. Welche Bedeutung hatte die Redekunst in der athenischen Demokratie?
56. Wie entwickelte sich die griechische Geschichtsschreibung?
57. Wer waren die Etrusker?
58. Was lernten die Römer von den Griechen?
59. Wie war ein römisches Haus gebaut?
60. Warum ist Cicero berühmt?
61. Wie veränderten sich Kunst und Literatur unter der Herrschaft des Augustus?
62. Gab es in Rom literarische Kritik an gesellschaftlichen Missständen?
Bildung und Wissen
63. Kommt das Wissen der Griechen und Römer aus Afrika?
64. Was verstanden die Griechen unter Barbaren?
65. Warum waren die Sophisten verrufen?
66. Welche Philosophenschulen gab es in der Antike?
67. Warum lehnte die antike politische Theorie die Demokratie ab?
68. Was wussten Griechen und Römer von Britannien?
69. War Mehrsprachigkeit ein antikes Ideal?
70. Wie wurden in der Antike Bücher verbreitet?
71. Was wussten die Römer über ihre Frühzeit?
72. Wie sah das römische Bildungssystem aus?
73. Welche medizinischen Kenntnisse hatten die Römer?
74. Wer waren die Kirchenväter?
Lebenswelten und Lebensräume
75. Wie teilte man in Griechenland die Zeit ein?
76. Wie sah der römische Kalender aus?
77. War Reisen in der Antike eine Lust oder eine Last?
78. Wie lebte es sich in einer antiken Großstadt?
79. Wie lebte man in der römischen Provinz Germanien?
80. Wie wurde Homosexualität beurteilt?
81. Was ist die spartanische Blutsuppe?
82. Wie speiste man in Rom?
83. Was erlebte man bei einem Gladiatorenkampf?
84. Warum waren Wagenrennen so beliebt?
85. Was ist ein Triumph?
86. Wie sah ein Villengarten aus?
Frauen und Männer – und die Alte Geschichte
86. Wer war Penthesileia?
87. Wer war Leonidas?
88. Wer war Perikles?
89. Wer war Medea?
90. Wer war Alexander?
91. Wer war Lucretia?
92. Wer war Hannibal?
93. Wer waren die Gracchen?
94. Wer war Caesars größter Rivale?
95. Wer war Kleopatra?
96. Wer war Caligula?
97. Wer war Konstantin?
98. Wer war Julian Apostata?
Nachleben
99. Wieso ging das Römische Reich unter?
100. Wie wirkte die Antike fort?
101. Wann begann die wissenschaftliche Erforschung der Antike?
Wie kann ich mich weiter über die Antike informieren?
Bildnachweis
Gebrauchsanweisung
Wenn ich mit diesem Büchlein antrete, meinen Leserinnen und Lesern die 101 wichtigsten Fragen zur Antike zu präsentieren – und die Antworten gleich noch mitliefere –, so geschieht dies mit einem Augenzwinkern. Auf 160 Druckseiten kann selbstverständlich keine umfassende Einführung in die Geschichte des Altertums gegeben werden. Doch die thematisch gegliederte Auswahl, die selbstverständlich persönliche Vorlieben und Kompetenzen spiegelt, soll eine Annäherung an zentrale Aspekte der Antike ermöglichen. Vor allem aber hoffe ich, Neugierde und Interesse für diese faszinierende Epoche wecken zu können, in der die Ursprünge unserer Kultur liegen. Die Kunst des Altertums ist nur gestreift worden, weil ein eigener Band über 101 Fragen zur antiken Kunst in dieser Reihe erschienen ist.
Um ein möglichst großes Publikum zu erreichen, wurde weitgehend auf die Fachsprache verzichtet. Zentrale Begriffe der Altertumswissenschaften sind in einigen Antworten kurz erläutert. Bei Herrschern werden die Regierungsdaten, bei allen übrigen Personen die Lebensdaten angegeben.
Viele Freunde und Kollegen haben die Entstehung des Textes kritisch begleitet. Ganz besonders danke ich Rosmarie Günther, Wolfram Kinzig, Mischa Meier, Martin Ritter und Uwe Walter, die trotz zahlreicher eigener Verpflichtungen das Manuskript ganz gelesen und mich vor manchem Fehler bewahrt haben. Bei der Korrektur des Manuskriptes haben mich Astrid Habenstein und Katharina Sundermann unterstützt. Mein größter Dank gilt den Schülerinnen und Schülern am Karl-Friedrich-Gymnasium in Mannheim, die ich während meiner Tätigkeit an dieser Schule fragen konnte, was sie denn gern über die Antike wüssten. Viele der Fragen gehen auf ihre Anregungen zurück. Ihnen sei daher das Bändchen zugeeignet!
Für die dritte Auflage wurden offenkundige Versehen korrigiert und die bibliographischen Hinweise am Ende aktualisiert. Unverändert erhält der Leser aber noch immer 102 zum Preis von 101 Fragen.
Bern, im Herbst 2020
Stefan Rebenich
Zur Einleitung
1. Was ist die Antike? Eine allgemeingültige Definition des Begriffes «Antike» gibt es nicht. Schon die zeitliche Erstreckung und die räumliche Umschreibung sind strittig. Der Begriff «Antike» leitet sich von dem lateinischen Wort antiquus ab, das «alt» bedeutet. Es bezieht sich folglich auf die «Alte Geschichte» einer Kultur, und in der Tat können wir von der Antike verschiedener Kulturen, etwa in Vorderasien, in China, in Indien, in Afrika und in Lateinamerika, sprechen. Üblich ist es, die Epoche des griechisch-römischen Altertums im Mittelmeerraum als Antike zu bezeichnen. Dies hat wissenschaftshistorische Gründe: Seit der Wiederentdeckung des Altertums im Humanismus sind es der griechische und der römische Kulturkreis, die vor allem in Europa (und später auch Nordamerika) Politiker, Künstler und Intellektuelle im besonderen Maße angezogen haben. Dichtung und Philosophie der Griechen galten als vorbildlich, und an den Griechen wollte nicht nur Goethe (1749–1832) wahres Menschsein lernen. Von den Römern hingegen hoffte man die Geheimnisse politischer Stabilität und dauerhafter Macht zu erfahren, am Imperium Romanum studierte man beispielhaft Aufstieg, Vollendung und Fall eines Großreiches. Im ausgehenden 18. und 19. Jh., im Zeitalter des Neuhumanismus, galten die griechische und römische Zivilisation als ‹klassische› Norm von überzeitlicher Größe, an der alle anderen Kulturen gemessen wurden und deren Vorbildlichkeit für die eigene Gegenwart betont wurde.
Wann beginnt die Antike? Hier werden meist zwei Epochen genannt: entweder die Ägäische Bronzezeit von ca. 2500 bis 1050 v. Chr., die durch die monarchisch regierten, hoch entwickelten Palastkulturen auf Kreta (minoische Kultur), dem griechischen Festland (mykenische Kultur) und in Kleinasien (Troja) charakterisiert ist, oder die «Dark Ages» bzw. «Dunklen Jahrhunderte» von ca. 1050 bis 800 v. Chr.; der Name rührt daher, dass unsere Erkenntnismöglichkeiten aufgrund des Verlustes der Schriftlichkeit und der schlechten Überlieferungslage sehr begrenzt sind.
Wann endet die Antike? Einigkeit besteht darin, dass auch das Ende der Antike nicht exakt zu datieren ist; es gab eine Übergangszeit (4.–8. Jh. n. Chr.), die Spätantike, die nicht eindeutig vom Frühmittelalter zu scheiden ist. Markante Einschnitte sind die Absetzung des letzten weströmischen Kaisers Romulus Augustulus (476 n. Chr.) und die Erneuerung des Römischen Reiches unter Justinian (527–565 n. Chr.).
Epochen der griechischen und römischen Geschichte
Griechische Geschichte
Ägäische Bronzezeit
ca. 2500–1050 v. Chr.
«Dark Ages»
ca. 1050–800 v. Chr.
Archaische Zeit
ca. 800–508/7 v. Chr.
Klassische Zeit
508/7–338 v. Chr.
Hellenismus
338–30 v. Chr.
Römische Geschichte
Königszeit
8.–6. Jh. v. Chr.
Frühe Republik
ca. 500–367 v. Chr.
Mittlere Republik
367–13 v. Chr.
Späte Republik («Revolutionszeit»)
133–30 oder 27 v. Chr.
Kaiserzeit (Prinzipat)
30 oder 27 v. Chr.–284 n. Chr.
Spätantike
284–476 n. Chr. oder 565 n. Chr.
Die Wissenschaften vom Altertum betonen heute bei der Beschäftigung mit den Griechen und Römern eher das Fremde und Trennende («Alterität»), heben die Notwendigkeit hervor, auch den Nahen und Mittleren Orient sowie die Randgebiete des Alexanderreiches und des Römischen Reiches in die Betrachtung einzubeziehen, und warnen aus gutem Grund vor wohlfeilen Aktualisierungen. Zur Vergewisserung unseres Umganges mit dem antiken Erbe ist daher nicht nur das genaue Studium der Hinterlassenschaft selbst, sondern auch der Wirkungsgeschichte der Antike in Mittelalter und Neuzeit wichtig. Denn die Kultur Europas hat sich seit der Karolingischen Renaissance (800 n. Chr.) immer wieder im Rückgriff auf das griechische und römische Altertum entwickelt. Angesichts der herausragenden Bedeutung der griechisch-römischen Antike in der europäischen Tradition wird diesem Zeitraum in dem vorliegenden Bändchen besondere Bedeutung zugemessen.
2. Welche Wissenschaften erforschen die griechisch-römische Antike? Unterschiedliche Disziplinen beschäftigen sich mit der Antike. Die ‹Mutter› der Altertumswissenschaften ist die Klassische Philologie, von der sich im 19. Jh. die Alte Geschichte und die Klassische Archäologie abgespalten haben. Hinzu treten die sogenannten Hilfswissenschaften, die ebenfalls im 19. Jh. entstanden sind und spezielle Materialgruppen erforschen: die Epigraphik, deren Augenmerk den Inschriften gilt, die Numismatik, die nicht nur Münzen untersucht, sondern auch die Geschichte des Geldes schreibt, und die Papyrologie, die sich um Schriftzeugnisse kümmert, die auf Papyrus geschrieben wurden und meist nur noch im trockenen Wüstensand Ägyptens erhalten sind.
Die Geschichte des frühen Christentums im Römischen Staat ist ein gemeinsames Anliegen von ‹klassischen› Altertumswissenschaftlern und Kirchenhistorikern. Den Übergang von der Antike zum Mittelalter analysieren zudem die Mittelalterhistoriker (Mediävisten) und die Byzantinisten.
Für die schriftlosen Epochen Griechenlands und Roms ist auch die Vor- und Frühgeschichte zuständig, die provinzialrömische Archäologie vergrößert unser Wissen um das römische Germanien, aber auch um andere Provinzen des Römischen Reiches, und die Christliche Archäologie widmet sich den monumentalen Zeugnissen des frühen Christentums und der Spätantike.
Wichtige Aufschlüsse geben darüber hinaus die Wissenschaften, die sich mit den Kulturen im Umkreis der klassischen Antike befassen, insbesondere die Vorderasiatische Archäologie und die Ägyptologie. Diese Fächer korrigieren auch die eurozentrische Wahrnehmung des Altertums.
Zur Vertiefung allgemeiner Fragestellungen und zur Methodendiskussion ist der systematische Kontakt der Altertumswissenschaften mit anderen Kulturwissenschaften unabdingbar. Insbesondere die Sozialwissenschaften, aber auch die Religionswissenschaft, Anthropologie und Ethnologie können für theoretische Aspekte der Forschung sensibilisieren. Schließlich führen der Blick über die Mauern des eigenen Faches und der Vergleich der griechisch-römischen Antike mit anderen Epochen und – europäischen wie außereuropäischen – Kulturen zu neuen Erkenntnissen.
Einen Aufschwung erfährt seit einiger Zeit die Erforschung des Nachlebens der Antike. Die Rezeptionsgeschichte untersucht die vielfältigen Formen und Methoden der Aneignung des antiken Erbes in der bildenden Kunst, in der Musik und in der Architektur, in der Verfassungstheorie und im Recht, in der Literatur und in der Philosophie, im Film und im Comic. Dabei ist der Austausch mit Neu- und Rechtshistorikern, Literatur- und Sprachwissenschaftlern sowie Kunsthistorikern notwendig. Die Vielzahl der Themenfelder, auf dem die Auseinandersetzung mit der Antike stattfand und nach wie vor stattfindet, zeigt eindrücklich die Lebendigkeit und Aktualität der antiken Hinterlassenschaft.
Politische Institutionen
3. Was ist eine Polis? «Dies hat die Polis beschlossen» – so heißt es in einem Gesetzestext aus der Mitte des 7. Jh.s v. Chr. Seit dem frühen 8. Jh. v. Chr. entwickelte sich die Polis (Mehrzahl: Poleis) zur charakteristischen Form der politischen Organisation des griechischen Mutterlandes und der von den Griechen besiedelten Gebiete des Mittelmeerraumes. Sie trat an die Stelle kleiner Gemeinden mit nur ansatzweise ausgebildeten Organisationsstrukturen, die für die «Dark Ages» genannte Zeit von 1050 bis 800 v. Chr. typisch waren.
Ursprünglich bezeichnete das Wort pólis eine städtische Siedlung. Jede Polis übte die Kontrolle über ihr Umland aus, das durch Gebirge, Flüsse, das Meer oder durch das Territorium einer anderen Polis begrenzt wurde. Doch die Polis war zugleich ein Personenverband, der durch seine erwachsenen männlichen Bürger verwaltet und regiert wurde und der alle Entscheidungen in der Innen- und Außenpolitik auf der Grundlage von Recht und Gesetz traf. Zur Gemeinschaft der Bürger, der Politen, zählte nur, wer für die Polis in den Krieg zog und dessen Eltern bereits Bürger waren; häufig musste er auch über ein bestimmtes Mindestvermögen verfügen. Die Bürgerschaft war wiederum in Untergruppen wie die Phylen («Stämme») oder Phratrien («Bruderschaften») eingeteilt, deren Mitglieder behaupteten, seit alters miteinander verwandt und gleich zu sein.
Die Bürger gaben der Polis, ihrem «Stadtstaat», Gesetze, entwickelten eigene Institutionen (wie Volksversammlung, Rat und Ämter), organisierten das Heerwesen und achteten auf die politische Unabhängigkeit (Autonomie) des Gemeinwesens. Wirtschaftliche Selbständigkeit (Autarkie) wurde zwar gefordert, existierte aber beileibe nicht in allen Poleis. Von der politischen Teilhabe (Partizipation) ausgeschlossen waren Frauen, Unfreie und Fremde.
Herausragende Bedeutung für den inneren Zusammenhalt der Polis hatten Religion und Kultur. Die Bewohner einer Polis verehrten dieselben Götter und Heroen, sprachen denselben Dialekt, feierten gemeinsam große Feste, trafen sich regelmäßig im Zentrum des städtischen Lebens, der Agorá (dem «Marktplatz»), und gaben die Erinnerungen an die Geschichte ihrer Polis von Generation zu Generation weiter.
Das geographisch zerklüftete Griechenland war übersät von einer Vielzahl kleinräumiger Gemeinwesen. Um 500 v. Chr. gab es etwa 700 Poleis. Ihr Gebiet war in der Regel sehr überschaubar. Es umfasste zwischen 50 und 100 km2. Sparta (ca. 8400 km2) und Athen (ca. 2600 km2), aber auch Korinth (ca. 880 km2) sind Ausnahmen. Entsprechend gering war die durchschnittliche Bevölkerungszahl einer Polis; sie belief sich nach Schätzungen auf etwa 400 bis 900 Bürger; Athen hingegen hatte Mitte des 5. Jh.s um die 40.000, Sparta 8000 bis 10.000 Bürger.
Neben der Polis gab es andere Formen politischer Organisation. In Gebieten, die dünner besiedelt waren und in denen sich kaum städtische Strukturen ausgebildet hatten, wie etwa im nordwestlichen Griechenland, integrierte der «Stammesverband» (Éthnos) einzelne dörfliche Siedlungen. Die für diese Form des Zusammenlebens konstitutive Idee der gemeinsamen Abstammung war indes, wie die neuere Forschung gezeigt hat, eine späte Konstruktion, die eine fiktive Verwandtschaft in die mythische Vorzeit zurückdatierte, um in der eigenen Zeit politische Ansprüche durchzusetzen. Aus einem Ethnos konnte später auch ein föderativer «Bundesstaat» (Koinón) entstehen, in dem die einzelnen Gemeinden innenpolitisch unabhängig waren, aber ihre Außenpolitik der Kontrolle der Bundesorgane unterstellten. Ein solches Koinon gab es seit dem ausgehenden 6. Jh. v. Chr. in Böotien.
4. Waren die griechischen Tyrannen Gewaltherrscher? «Zu Dionys dem Tyrannen schlich/Damon, den Dolch im Gewande», heißt es in Schillers «Bürgschaft». Opfer des Anschlages ist Dionysios II., der seit 367 v. Chr. ein Jahrzehnt lang über die sizilische Stadt Syrakus herrschte. Das Bild des Gewaltherrschers, den zu ermorden jeder Bürger das moralische Recht und die politische Pflicht hat, kennt die Neuzeit ebenso wie die Antike. Doch im Altertum war die Vorstellung des grundsätzlich schlechten Tyrannen erst Ergebnis der Demokratisierung Athens seit dem ausgehenden 6. Jh. v. Chr. und der politischen Philosophie des 4. Jh.s v. Chr. Aus dieser Perspektive war die Tyrannis die Entartung einer guten Alleinherrschaft. Historisch gesehen, hat sie in vielen – zumal größeren – Gemeinden die Entstehung der Polis befördert; allerdings hatten wichtige Poleis wie Sparta nie einen Tyrannen.
Bei der Ausbildung stadtstaatlicher Strukturen spielten die Aristokraten eine zentrale Rolle. Sie begründeten ihre hervorgehobene Stellung nicht durch Abstammung und Herkunft, sondern durch Leistungen in der Führung der Polis, im sportlichen Wettkampf und auf dem Schlachtfeld. Ihr Wahlspruch hieß: «Immer der Erste sein und die anderen überragen» (Homer, Ilias 6,208). Die Adligen unterschieden sich von den anderen Bewohnern des Stadtstaates durch einen aufwendigen Lebensstil. Darüber hinaus pflegten sie ‹internationale Kontakte› und verkehrten mit den Aristokraten anderer griechischer Poleis. Ihr politisches Handeln war nicht auf eine Polis beschränkt. Doch gleichzeitig förderten sie die Entstehung stadtstaatlicher Einrichtungen wie Volksversammlung, Rat und Ämter, die einerseits ihren Einfluss sichern sollten, andererseits aber die Bewältigung zahlreicher Probleme in einer immer komplizierter werdenden Umwelt erleichterten und die politische Teilhabe größerer Bevölkerungsteile ermöglichten. Die neu geschaffenen Institutionen schufen unter den Angehörigen der Polis ein Gemeinschaftsgefühl, das durch eine neue Art der Kriegführung, die gemeinsame Formation von schwer bewaffneten Kämpfern (die Hoplitenphalanx), verstärkt und durch gemeinsame kultische und zivile Handlungen gefestigt wurde.
Die Tyrannis spiegelt die Konflikte der Aristokraten untereinander und die Schwierigkeit, sie in die Polisordnung einzubinden. Die Tyrannis war die extreme Steigerung aristokratischer Machtentfaltung. Ziel einzelner Aristokraten war es, aus der bestehenden Ordnung auszubrechen und eine Alleinherrschaft zu etablieren, deren Gestalt die Griechen bei den Königen und Herren im Osten kennengelernt hatten. Das griechische Wort, das diese Alleinherrschaft umschreibt – týrannos – ist wahrscheinlich lydischen Ursprungs.
Die Tyrannis ist mit keiner bestimmten Verfassung verbunden. Der athenische Tyrann Peisistratos, der von 546 bis zu seinem Tod 527 v. Chr. Athen beherrschte, ließ die von Solon 594/93 v. Chr. errichtete Ordnung bestehen. Die Tyrannis eines Adligen im 7. und 6. Jh. v. Chr. ist nicht automatisch gleichzusetzen mit einer Terrorherrschaft. Peisistratos ergriff die Macht zwar mit brutaler Gewalt, beachtete später jedoch die Gesetze, arrangierte sich mit anderen aristokratischen Familien, half armen athenischen Bauern, verstärkte den Zusammenhalt der Polisbewohner durch religiöse Kulte und Feiern und ließ Athen mit prächtigen Bauten ausschmücken.
War die ‹ältere› Tyrannis folglich eine bestimmte Form der Adelsherrschaft, so war die ‹jüngere› Tyrannis des 5. und 4. Jh.s v. Chr. (zu der Dionysios II. von Syrakus zählt) eine Militärdiktatur, die vor allem durch Söldnertruppen aufrechterhalten wurde.
5. Wie funktionierte die athenische Demokratie? Die athenische Demokratie ist Ergebnis eines Prozesses, der mit den Reformen des Kleisthenes 508/7 v. Chr. einsetzte und sich bis in die Mitte des 5. Jh.s v. Chr. erstreckte. Die entstehende demokratische Ordnung, von den Athenern zunächst Isonomie («Ordnung auf dem Prinzip der Gleichheit») genannt, überwand die Adelsrivalitäten und ließ die gesamte Bürgerschaft an der Polis teilhaben. Im 5. Jh. v. Chr. wurde die athenische Bürgerschaft an einer Vielzahl schwieriger und folgenreicher Entscheidungen beteiligt.
Der Souverän war die Gesamtheit der politisch berechtigten Bürger, die in der Ekklesie (Volksversammlung) zusammenkamen. Die Kompetenz der Ekklesie erstreckte sich auf alle Bereiche des öffentlichen Lebens: die Wahlen, die Gesetzgebung, die Entscheidung über Krieg und Frieden, die Steuern, die Kontrolle der Beamten, die Verleihung des Bürgerrechts, die Organisation der öffentlichen Kulte sowie soziale Maßnahmen für die Bevölkerung. Zutritt zu den 40 (im 4. Jh. v. Chr.) vorgeschriebenen und den zahlreichen außerordentlichen Sitzungen hatte jeder freie und volljährige athenische Mann, der in die Bürgerliste seines Heimatortes (démos) eingetragen war, dessen Vater und Mutter Athener waren und der seine zweijährige Wehrpflicht (Ephebie) geleistet hatte. Ausgeschlossen von politischer Teilhabe war indes die Mehrheit der Bevölkerung Athens: die Frauen, die Ausländer und die Sklaven.
Zwei Grundsätze prägten die Willensbildung in der Ekklesie: Jeder athenische Bürger hatte das Recht, Anträge zu stellen, und jeder Antrag musste im Rat der 500 (boulé), der die gesamte Bürgerschaft Attikas gleichmäßig repräsentierte, vorberaten werden. Ein Antrag gelangte also nur als Vorschlag des Rates (proboúleuma) vor die versammelte Bürgerschaft, die jedoch das Recht besaß, den Vorschlag abzuändern oder mit Streichungen oder Zusätzen zu verabschieden. Das Initiativrecht blieb bei der Bürgerschaft. Es gab kein eigenes Präsidium, keine institutionalisierte Amtsautorität. Im 5. Jh. v. Chr. hatte der täglich wechselnde Vorsitzende des Rates auch den Vorsitz in der Ekklesie. Der Rat war das organisatorische, nicht aber das politische Zentrum: Er koordinierte die demokratische Willensbildung, strukturierte die Diskussion aller Fragen von öffentlichem Interesse und sorgte durch seine repräsentative Besetzung für die Kommunikation der politischen Agenda.
Die athenischen Bürger waren zugleich in den Geschworenengerichten, den Dikasterien, vertreten, in denen über private und öffentliche Klagen verhandelt wurde. Zu Jahresbeginn erloste man 6000 Geschworene, aus denen dann für jeden Prozess wiederum eine bestimmte Zahl (von 201 bis 1501) Geschworener durch Los ausgewählt wurde. Die Qualifikation für die Geschworenentätigkeit war an den Bürgerstatus, nicht an juristische Kenntnisse gebunden.