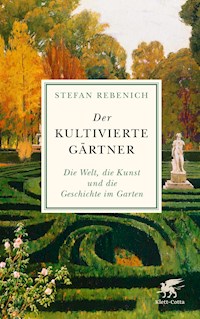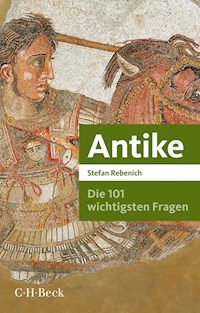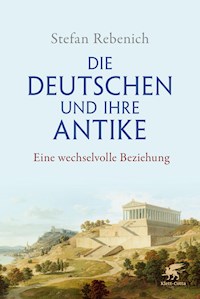
33,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
200 Jahre Antikensehnsucht und Geschichte der Altertumswissenschaft Zugänglich und spannend erzählt Stefan Rebenich pointiert die Entwicklung der deutschen Althistorie, die Weltruhm erlangte, aber auch politisch missbraucht wurde. Anhand zentraler Diskurse und wichtiger Institutionen würdigt er kritisch grandiose Leistungen wie Verfehlungen bedeutender Historiker. Ein einzigartiges Buch über die besondere Beziehung der Deutschen zur Antike. Seit mehr als 200 Jahren hat das griechisch-römische Altertum die deutsche Nationalkultur und unsere kollektive Identität mitgeprägt. Stefan Rebenich, einer der führenden deutschen Alt- und Wissenschaftshistoriker, bietet eine ebenso konzise wie glänzend geschriebene Darstellung der wechselvollen und oft kontroversen Geschichte seiner Disziplin. Dabei schildert er nicht nur die politischen und wissenschaftlichen Biographien einzelner herausragender Historiker (u. a. Mommsen, Wilamowitz, Harnack), sondern er berücksichtigt auch bedeutende Wissenschaftsinstitutionen und legt die zeitbedingten Faktoren der historischen Forschung offen. Souverän behandelt er Kontroversen und Themen, die die Entwicklung des Faches bestimmten, und zeigt schonungslos anhand ausgewählter, wenig bekannter Quellen die ideologische Vereinnahmung der Alten Geschichte und die Anpassung ihrer Vertreter im Nationalsozialismus. Was also bleibt und wo stehen wir nach dem Bedeutungsverlust der Antike als Leitbild, fragt der Autor mit einer aktuellen Wendung: Noch heute ist die Beschäftigung mit der Fremdheit der Antike eine intellektuelle emanzipatorische Übung, uns selbst in Frage zu stellen und uns selbst zu finden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 973
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Stefan Rebenich
Die Deutschenund ihre Antike
Eine wechselvolle Beziehung
Klett-Cotta
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
© 2021 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover: Rothfos & Gabler, Hamburg
unter Verwendung einer Abbildung von © akg-images
Gesetzt von C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen
Gedruckt und gebunden von Friedrich Pustet GmbH & Co. KG, Regensburg
ISBN 978-3-608-96476-9
E-Book ISBN 978-3-608-12093-6
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten
sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Zur Einleitung
1. Gegenstand und Erkenntnisinteresse
Übergreifende Fragestellungen
Das 19. Jahrhundert
2. Wilhelm von Humboldt: Die Entstehung des Bürgertums aus dem Geiste der Antike
Bildung: Ein permanenter Prozess der Selbstvervollkommnung
Unerreichbarkeit der Griechen: Zeitlose Größe und paradigmatische Geschichtlichkeit
Freiheit des Individuums: Zur Genese der bürgerlichen Gesellschaft
Hellenistische Wahlverwandtschaften: Deutsche und Griechen
Nach Humboldt: Wirkungen
3. Triumph und Krise: Die Altertumswissenschaften im 19. Jahrhundert
Der Ort: Die Universitäten
Das Ziel: Die Ordnung der Archive der Vergangenheit
Die Folge: Das verlorene Ideal
4. Vom Umgang mit toten Freunden: Johann Gustav Droysen und das Altertum
Der Altertumswissenschaftler und sein Werk
Das altertumswissenschaftliche Fundament
Der Bacon der Geschichtswissenschaft
Folgen und Folgerungen
5. Das Zentrum: Die Altertumswissenschaften an der Berliner Akademie der Wissenschaften
Am Anfang war Niebuhr
Die Erfindung der Großwissenschaft
Die Epoche der Altertumswissenschaften
Ein Blick in die Inschriftencorpora
Neue Gebiete: Das frühe Christentum und die Spätantike
Akademiepolitik nach Mommsen
6. Akteure: Theodor Mommsen, Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff und Adolf Harnack
Die Akteure: A very short introduction
Ein gemeinsames wissenschaftliches Interesse: Das frühe Christentum
Wer soll die Kirchenväter edieren?
Der Streit um Mommsens Erbe
Der Achtundvierziger, der Junker und der Vernunftrepublikaner
Der alte Meergreis und die Rose von Jericho
7. Politik für die Altertumswissenschaften: Friedrich Althoff
Zur Einleitung: Der Protagonist
Das Universitätsregiment: Die Ambivalenzen des Systems Althoff
»Die Urgeschichte unseres Vaterlandes«: Die Reichslimeskommission
»Wissenschaftliche Monstrewerke«: Internationale Kooperationen
Das Ende einer Freundschaft: Der Fall Spahn
Übergänge in ein neues Zeitalter
8. Ordnung des Wissens: Das »Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft«
Die Anfänge
Robert Pöhlmann
Karl Krumbacher
Ludwig Traube
Das Konzept des Handbuches
Walter Otto
Kontexte
9. Die Katastrophe: Der Erste Weltkrieg und seine Folgen
Auf Expansionskurs: Die Altertumswissenschaften um die Jahrhundertwende
Im Schützengraben und an der Heimatfront: Einstehen fürs Vaterland
Kooperationen und Konflikte: Die epigraphische Internationale nach 1914
Berlin und Moskau: Ein Neubeginn
Griechischer Sehnsuchtsort: Spartas Wiederentdeckung
10. Vom Los eines Außenseiters: Carl Friedrich Lehmann-Haupt
Die schwierigen Anfänge als Altertumswissenschaftler
Das Prekariat der Privatdozenten
Carl Friedrich Lehmann und die Altertumswissenschaft
Der beschwerliche Weg zum Extraordinariat
»Diese schöne Hochschule«: Ausblick
11. Die Entdeckung einer neuen Epoche: Die Spätantike
Vielfalt der Perspektiven: Innovative Impulse
Die Ausrottung der Besten: Otto Seeck
Der Untergang des Abendlandes: Oswald Spengler
12. Akteure: Adolf Erman und Eduard Schwartz
Philologische Methode und epistemologische Abstinenz I: Adolf Erman
Philologische Methode und epistemologische Abstinenz II: Eduard Schwartz
Wissenschaftsorganisation: Das Wörterbuch der ägyptischen Sprache
Der Habitus des Wissenschaftlers: Von Kärrnern und Dienern
Wissenschaft und Politik: Zwei Biographien
13. Die Antike in »Weihen-Stefan«: Platon im Georgekreis
Anfänge
Neue Ansätze
Wirkungen
Der Georgekreis und die Altertumswissenschaften
Mitten im 20. Jahrhundert
14. Zwischen Verweigerung und Anpassung: Die Altertumswissenschaften im »Dritten Reich«
Alte Geschichte in der Diktatur: Der Fall Helmut Berve
Das Deutsche Archäologische Institut
Die Berliner Akademie der Wissenschaften
Nachwuchs
Innovation
Das Altertum im gymnasialen Unterricht
Emigration und Exil
15. »Erste Briefe«: Die Wiederaufnahme wissenschaftlicher Kontakte nach 1945
First Letters – Erste Briefe
Die Härten des Exils
Die Klage über den Krieg
Die Versicherung der Freundschaft
Die apolitische Wissenschaft
Bekenntnisse in eigener Sache
Der Neuanfang
16. Ein Neustart: Die Mommsengesellschaft
Wider die alten Nazis: Das »lustrum« von Hinterzarten
Von Jena nach Gießen und Speyer: Deutsch-deutsche Verwicklungen
Von Humanisten und Vollphilologen: Bildungspolitik zwischen 1950 und 1970
17. Ost und West: Die Altertumswissenschaften im geteilten Deutschland
Die Vergangenheit, die vergehen sollte
Wiedereintritt in die internationale Gemeinschaft
Die Altertumswissenschaften an den westdeutschen Universitäten
Das europäische Menschentum
Neue Impulse: Das Spartabild nach 1945
Auferstanden aus Ruinen? Altertumswissenschaften in der DDR
Ein flüchtiger Blick Richtung Gegenwart
18. Akteure: Hermann Bengtson und Alfred Heuß
Zwischen den Kriegen: Die wissenschaftliche Sozialisation
Nach dem Krieg: Kontinuität oder Diskontinuität?
Das Münchner Ordinariat
Vitae parallelae
19. Von Worten und Werten: Begriffsgeschichte in den Altertumswissenschaften
Am Anfang war das Wort: Der »Thesaurus linguae Latinae« und die Begriffsgeschichte
Der neue Geist und alte Begriffe: Begriffs- und Wertforschung im »Dritten Reich«
Alter Wein in alten Schläuchen: Die Theorieabstinenz nach 1945
Neue Wege: Alte Geschichte und Begriffsgeschichte
Ausblick
20. Zu guter Letzt: Wo stehn wir?
Nachwort
Anmerkungen
Zur Einleitung
1. Gegenstand und Erkenntnisinteresse
Das 19. Jahrhundert
2. Wilhelm von Humboldt: Die Entstehung des Bürgertums aus dem Geiste der Antike
3. Triumph und Krise: Die Altertumswissenschaften im 19. Jahrhundert
4. Vom Umgang mit toten Freunden: Johann Gustav Droysen und das Altertum
5. Das Zentrum: Die Altertumswissenschaften an der Berliner Akademie
6. Akteure: Theodor Mommsen, Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff und Adolf Harnack
7. Politik für die Altertumswissenschaften: Friedrich Althoff
Übergänge in ein neues Zeitalter
8. Ordnung des Wissens: Das »Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft«
9. Die Katastrophe: Der Erste Weltkrieg und seine Folgen
10. Vom Los eines Außenseiters: Carl Friedrich Lehmann-Haupt
11. Die Entdeckung einer neuen Epoche: Die Spätantike
12. Akteure: Adolf Erman und Eduard Schwartz
13. Die Antike in »Weihen-Stefan«: Platon im Georgekreis
Mitten im 20. Jahrhundert
14. Zwischen Verweigerung und Anpassung: Die Altertumswissenschaften im »Dritten Reich«
15. »Erste Briefe«: Die Wiederaufnahme wissenschaftlicher Kontakte nach 1945
16. Ein Neustart: Die Mommsengesellschaft
17. Ost und West: Die Altertumswissenschaften im geteilten Deutschland
18. Akteure: Hermann Bengtson und Alfred Heuß
19. Von Worten und Werten: Begriffsgeschichte in den Altertumswissenschaften
Ausblick
20. Zu guter Letzt: Wo stehn wir?
Personenregister
Wolfram Kinzig & Christoph Riedweg
amicis carissimiscollegis doctissimissodalibus sexagenariis
Zur Einleitung
1. Gegenstand und Erkenntnisinteresse
Jacob Burckhardt(1) zeigte sich beeindruckt von dem dorischen Tempel, der den Umschlag dieses Buches ziert. Allerdings missfiel dem Basler Historiker, wie er 1877 notierte, der »infame Treppenaufgang«, der viel zu groß geraten sei und den man auf die Rückseite hätte verlegen müssen. Jetzt könne man nur noch »an den Treppenmauern Efeu pflanzen«.[1] Noch sarkastischer hatte mehr als drei Jahrzehnte früher Heinrich Heine(1) über das riesige Monument geurteilt: Er nannte es schlicht »eine marmorne Schädelstätte«, erbaut von einem »Affen« allein »für deutsche Helden«.[2]
Objekt des Spottes ist eines der bekanntesten nationalen Denkmäler Deutschlands aus dem 19. Jahrhundert: die Walhalla bei Regensburg.[3] Ihr Architekt Leo von Klenze(1) hatte 1836 die »Ansicht der Walhalla« mit Öl auf Leinwand festgehalten. 1807 vom damaligen bayerischen Kronprinzen Ludwig(1) geplant, konnte nach endlosen Diskussionen mit dem Bau erst im Jahr 1830 begonnen werden. Finanziert wurde das Projekt aus dem Privatvermögen Ludwigs, der seit 1825 auf dem bayerischen Thron saß. 1842 weihte man mit großem Pomp den »Ehrentempel für die großen Männer der Nation« ein,[4] die im Inneren durch 96 Büsten und 64 Gedenktafeln gegenwärtig waren. Der germanische Name, der sich von der »Halle der Gefallenen« in der nordischen Mythologie ableitete, stammte von dem Schweizer Johannes von Müller(1), der für die Erinnerung an den Rütlischwur gesorgt hatte und selbst durch eine Büste verewigt wurde. Ohnehin bestimmte in diesem gesamtdeutschen Denkmal die Zugehörigkeit zur deutschen Kulturnation über die Aufnahme in den hehren Kreis, und so wurden außer Eidgenossen wie Nikolaus von der Flüe(1) und Aegidius Tschudi(1) auch Wilhelm von Oranien und Katharina II.(1) berücksichtigt. Nur Luthers Büste, die bereits früh angefertigt worden war, fehlte zunächst; der reformatorische »Dickkopf«, wie Heine(2) lästerte, passte dem katholischen Monarchen nicht. Erst Ende der vierziger Jahre, als die konfessionellen Spannungen nachließen, fand er Einlass in die Ruhmeshalle.
Von Anfang an prominent vertreten waren die bekannten Gestalten der germanischen Frühzeit; ob cheruskischer, markomannischer, gotischer, vandalischer oder fränkischer Herkunft, sie alle wurden kurzerhand zu Deutschen erklärt. Natürlich begann die Reihe mit Arminius(1) alias Hermann, dessen Sieg über die Römer im Teutoburger Wald aus dem Jahr 9 n. Chr. auf einem äußeren Relief an einer Giebelwand dargestellt war. Deutschlands Kampf um Freiheit, so lautete das historische Narrativ, nahm seinen Anfang in den germanischen Wäldern. Auf dem gegenüberliegenden Giebel ist denn auch die Siegesfeier in den Befreiungskriegen gegen Napoleon(1) zu sehen. Wulfila(1), Alarich(1) und Athaulf(1) sind ebenso präsent wie Geiserich(1), Chlodwig(1) und Theoderich(1) der Große. Nicht nur Heerführer und Politiker, sondern auch Dichter und Denker, Bischöfe und Heilige haben Aufnahme gefunden. Auch einiger Frauen, die deutsche Kultur stifteten und sich durch christliche Tugenden auszeichneten, wurde gedacht; so sind im Inneren Tafeln für Hrotsvit(1) von Gandersheim, Hildegard von Bingen(1) und Elisabeth von Thüringen(1) angebracht.
Platziert wurde das Denkmal auf einer natürlichen Anhöhe in einer romantischen Landschaft. Auf dem Gemälde sind die Donau und Ausläufer des Waldes sowie die neugotische Salvatorkirche und die Ruine der Burg Donaustauf zu erkennen. Der deutsche Gedenkort liegt außerhalb des städtischen Getriebes des nahen Regensburg und grenzt sich scharf ab von urbanen Erinnerungsstätten wie dem Pantheon in Rom oder in Paris. Ein vergleichbares politisches Zentrum hatte Deutschland in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht. Also verlegte Ludwig(2) das nationale Heiligtum in die freie Natur.
Für das Monument ist jedoch keine deutsche Formensprache verwendet. Stattdessen wird die griechische Tempelarchitektur aktualisiert: Die Ruhmeshalle erhebt sich im strengen dorischen Stil und erinnert den Betrachter an den Parthenon auf der Athener Akropolis. Die mächtige Substruktion zeigt zudem Anklänge an ägyptische und vorderorientalische Bauten. Der bayerische König(3) war ein begeisterter Philhellene, der sein Königreich »Baiern« mit Hilfe des griechischen Buchstabens Ypsilon in das Königreich »Bayern« verwandelte. Seine Stararchitekten Leo von Klenze(2) und Friedrich von Gärtner(1) beauftragte er, die Residenzstadt München im Geiste des Klassizismus umzugestalten. Die Ästhetik des griechischen Tempelbaus war im bayerischen Königreich omnipräsent und bildete einen integralen Bestandteil der monarchischen Repräsentation. Die Monumentalarchitektur bei Donaustauf erinnerte an die Größe und Schönheit der griechischen Vergangenheit, die ihre Fortsetzung in deutschen Landen fand. Zugleich nobilitierte der Rekurs auf klassisch-antike Formen die geehrten Deutschen. Denn »mit der griechischen Form« wurde »an die ideale Ausprägung der Humanität erinnert«: Die Nation stand »in einer unlösbaren Beziehung zum klassischen Ideal des Griechentums«; »die Synthese von Nationalität und universaler Humanität«, welche die Griechen repräsentierten, war »hier noch ungebrochen wirklich.«[5]
Die patriotische Erinnerungskultur, die auf die großen Gestalten des Vaterlandes fokussiert war, bediente sich eines antiken Tempels, um mitten im christlichen Abendland ein säkulares Heiligtum zu schaffen, das den Kampf für die nationale, nicht die bürgerliche Freiheit für die Zeitgenossen und die folgenden Generationen rühmte. Unterschiedliche welthistorische Räume und Zeitschichten sind in diesem Heiligtum an der Donau miteinander verbunden. Frohen Mutes blickte man in die Zukunft, in der Deutschland als eine Nation hervortreten sollte, deren Fundamente die eigene Kultur, Humanität und Geschichte bildeten. Auch in Donaustauf wurde die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen »zum Grundraster, das die wachsende Einheit der Weltgeschichte seit dem 18. Jahrhundert fortschrittlich auslegte«.[6]
Voller Optimismus vertraute man auf einzelne Individuen, deren zeitloses Andenken in Stein gemeißelt war. Ihre jeweiligen Botschaften zu entschlüsseln, war nicht jedem gegeben. Es bedurfte einer umfassenden literarischen und historischen Bildung, um die vielfältigen Anspielungen und Assoziationen verstehen zu können. Nicht das Volk wurde hier angesprochen, sondern die gebildete Schicht der deutschen Nation, die auf dem Gymnasium die alten Sprachen lernte und sich den Griechen geistesverwandt fühlte. Die Nation ist hier als Kulturgemeinschaft imaginiert. Die politische Einheit des »großen Vaterlandes« Deutschland, dem Ludwig die Walhalla vererbte, lag noch in weiter Ferne. Es mag ebendiese Bestimmung als kulturelles Nationaldenkmal sein, die es ermöglicht hat, dass auch später noch neue Büsten aufgestellt wurden, darunter Sophie Scholl(1), Edith Stein(1) und Käthe Kollwitz(1). Selbst Heinrich Heine(3) hat 2010 seinen Frieden mit dem Pantheon des deutschen Geisteslebens geschlossen.
Die Walhalla steht beispielhaft für das Thema dieses Buches: die Aneignung und Anverwandlung des antiken Erbes in Deutschland seit etwa 1800. Dies ist in der Tat ein weites Feld, da das Erbe des Altertums in unterschiedlicher Weise in Literatur und Musik, in Bildung und Wissenschaft, in Kunst und Architektur, in Theater und Film, ja selbst im Landschaftsgarten und in der Gebrauchskeramik gegenwärtig war – und noch immer ist.[7] Kaum mehr zu überschauen ist die einschlägige Literatur zur ubiquitären Rezeption der Antike. Um die Rekonstruktion der produktiven »Transformationen der Antike« hat sich ein interdisziplinärer Sonderforschungsbereich bemüht, der von 2005 bis 2016 an der Berliner Humboldt-Universität angesiedelt war.[8] Statt von statischen Prozessen der Auf- und Übernahme auszugehen, hat das Projekt richtungweisend das dynamische Konzept der Transformation entwickelt, das von wechselseitigen Wirkungen ausgeht. Zum einen entsteht die Antike in den uns greifbaren, mannigfaltigen Zeugnissen und Gegenständen der Rezeption immer wieder neu und auf unterschiedliche Art, wird verändert und verändert sich, wird uneinheitlicher, differenzierter und bunter. Zum anderen konstituieren und konstruieren sich die Gesellschaften durch ihren Rückgriff auf Vergangenes aber auch selbst: »Indem die Antike zum privilegierten oder polemischen Objekt von Wissensprozessen, künstlerischen Adaptionen oder politischen Aushandlungen wird, funktioniert das dabei entworfene Antike-Bild als Selbstbeschreibung der jeweiligen Rezipientenkultur.«[9]
Die Bedeutung der europäischen Antike für die Genese politischer und kultureller Identitäten ist ebenso manifest wie ihre Funktion für die Entstehung globaler Wissensgesellschaften und Wissenschaftsinstitutionen.[10] Die interdependenten Prozesse der Entdeckung – oder Wiederentdeckung – der Antike, der ostentativen Idealisierung, der gezielten Übernahme, der bewussten Abgrenzung und der emanzipatorischen Zurückweisung ebendieser Antike sind zeit- und kulturspezifisch, wiederholen sich von Generation zu Generation und dauern bis in die heutige Zeit an.
Das Erkenntnisinteresse des vorliegenden Buches ist räumlich und zeitlich eindeutig definiert: Gegenstand der Darstellung sind die vielfältigen Beziehungen zwischen der griechisch-römischen Antike und der deutschen Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert. Dieses Altertum galt als »klassisch«, weil seit dem Renaissance-Humanismus ihre als Einheit verstandene Kultur als normativ wahrgenommen wurde. Griechische und römische Autoren bildeten einen Kanon von auctores classici, die in den höheren Schulen gelesen und auf Grund ihrer sprachlichen, stilistischen und ästhetischen Qualitäten als mustergültig angesehen wurden. Ihr Studium vermittelte sprachlich-kommunikative Kompetenzen und wurde als elementare Voraussetzung für eine umfassende, aber auch elitäre Menschenbildung verstanden. Im Griechischen war – neben den homerischen Epen – die attische Literatur des fünften und vierten vorchristlichen Jahrhunderts vorbildlich; gelesen wurden die Tragiker Aischylos(1), Sophokles(1) und Euripides(1) sowie die attischen Redner. Im Lateinischen bildeten Cicero(1), Livius und die augusteischen Dichter Vergil(1), Horaz(1) und Ovid(1) den schulischen Lektürekanon. Diese »klassische« Bildung garantierte den direkten Zugang zur Universität.
Die griechisch-römische Antike stand über viele Jahrhunderte im Zentrum der gymnasialen und universitären Curricula und prägte das Selbstverständnis sowie die Selbstdarstellung der gebildeten Schicht in Deutschland – aber auch in den Ländern der Habsburgermonarchie und der Schweiz. Die intellektuelle und wissenschaftliche Beschäftigung mit Hellas und Rom und die daraus resultierenden bildungstheoretischen und -politischen Forderungen werden daher unsere besondere Aufmerksamkeit finden. Dass andere Kulturen des Altertums – wie der Alte Orient und Ägypten – nur gestreift werden, ist folglich der Prominenz geschuldet, die zunächst das griechische, dann aber auch das römische Paradigma für das deutsche Bildungsbürgertum hatte.
Unser besonderes Interesse gilt den Wissenschaften vom Altertum, die im Unterschied etwa zu Literatur und Kunst wenn nicht nach Objektivität und Wahrheit, so doch nach Überprüfbarkeit streben und sich in aller Regel durch eine exakte Methode und argumentative Stringenz auszeichnen. Hierbei sind die zeitbedingten Faktoren der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Antike im 19. und 20. Jahrhundert aufzudecken, um ein notwendiges Korrektiv für die aktuelle und künftige Forschung sowie die öffentliche Wahrnehmung des griechischen und römischen Altertums zu bieten. Auch für die Altertumswissenschaften gilt, was für die Germanistik gesagt wurde: Eine Geschichte »historischer Disziplinen bleibt mutlos, wenn sie keinen Begriff von der wissenschaftlichen Gegenwart, keine eigenen Vorstellungen zumindest von der wissenschaftshistorischen Zukunft entwickelt«.[11] Die wissen(schaft)sgeschichtliche Traditionskritik ist die conditio sine qua non für jeden historischen Rekonstruktionsversuch. Die Geschichte einer Disziplin, ihrer Fragestellungen und Methoden, ihrer Erkenntnisse und Irrtümer sensibilisiert für die fachspezifische Methodologie nicht weniger als die theoretische Reflexion. Zudem ist die Wissenschaftsgeschichte, so sie die nostalgische, gegenwartsapologetische oder zukunftsorientierte Moralisierung und Politisierung der Geschichte aufdeckt, ein wichtiger Beitrag zur Kultur- und Ideengeschichte der jeweiligen Epoche. Der Wandel der je vorherrschenden Interpretationsmuster und Betrachtungsweisen ist in der Geschichtsschreibung zur Alten Welt besonders gut zu erkennen, da es hier eine lange Deutungsgeschichte bei annähernd konstantem Quellenbestand gibt. Schließlich hilft die Wissenschaftsgeschichte, den Verlust historischer Bildung zu verstehen, der auch Gegenstand dieser Darstellung ist und den Alfred Heuß(1) mit der Verwissenschaftlichung und Spezialisierung seit dem 19. Jahrhundert erklärte.[12]
Bei der Breite des Themas sind inhaltliche Beschränkung und exemplarische Behandlung notwendig. In drei chronologisch strukturierten, übergreifenden Kapiteln, die die Zeit vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts behandeln, werden zunächst allgemeine Entwicklungen geschildert und dann jeweils charakteristische Institutionen, herausragende Akteure und wichtige Diskurse vorgestellt. Im Vergleich zu anderen einschlägigen Monographien soll hier nicht nur eine »Wissenschaftlergeschichte« präsentiert werden, die der amerikanische Altphilologe William M. Calder(1)III. eingefordert hat.[13] Unstrittig ist indes, dass hier Männer im Mittelpunkt stehen. Die Geschichte der Frauen in den Altertumswissenschaften und überhaupt ihrer Bedeutung für die Rezeption der klassischen Antike muss erst noch geschrieben werden. Erst seit den späten 1960er Jahren wurden einige Wissenschaftlerinnen auf Professuren berufen. In den strukturkonservativen Fächern waren universitäre Besetzungsverfahren jahrzehntelang von Männerbünden dominiert und von männlichen Netzwerken kontrolliert.
Vita und Oeuvre bedeutender – und weniger bedeutender – Altertumswissenschaftler werden in die Kultur-, Sozial- und Ideengeschichte der jeweiligen Epoche integriert. In diesem Zusammenhang interessieren auch Außenseiter und – mit Pierre Bourdieu(1) gesprochen – Häretiker im wissenschaftlichen Feld, die den Wissenschaften vom Altertum neue Impulse gaben. Am Beispiel der Platonrezeption im Georgekreises(1) sollen die zahlreichen Wechselwirkungen von wissenschaftlichen und außerwissenschaftlichen Diskursen beispielhaft dargestellt werden. Der Blick ist dabei nicht nur auf die bereits breit erforschte Politisierung der altertumswissenschaftlichen Fächer in der Weimarer Republik und im »Dritten Reich« gerichtet, sondern auch auf außerwissenschaftliche Funktionalisierungen des griechisch-römischen Altertums unter fünf verschiedenen politischen Systemen in Deutschland. Die Darstellung fächerübergreifender Prozesse und grundlegender gesellschaftlicher Zustände wird immer wieder ergänzt durch die Charakterisierung einzelner Personen und die Schilderung konkreter Ereignisse. Zu diesem Zweck wird ausführlich auf archivalische Quellen zurückgegriffen, deren Orthographie und Zeichensetzung vorsichtig modernisiert sind. Schließlich ändern sich die Schauplätze: Der Leser wird in Gymnasien, Universitäten und Akademien geführt, aber auch Verlage und Ministerien, Bibliotheken und Museen werden betreten. Die Wissenschaftspolitik im Preußen der Kaiserzeit ist ebenso Gegenstand der Darstellung wie die Bedeutung verlegerischer Initiative für die Normierung unseres Wissens über das Altertum.
Übergreifende Fragestellungen
In den drei großen Abschnitten zum »19. Jahrhundert«, den »Übergängen in ein neues Zeitalter« und »Mitten im 20. Jahrhundert« geht es um Kontinuitäten und Diskontinuitäten altertumswissenschaftlicher Methoden und Theorien, um Projekte und Konzepte, Inhalte und Debatten, Institutionen und Organisationen. Insbesondere die epistemische Entwicklung der Alten Geschichte wird in diesem Kontext interessieren, ohne jedoch die Klassische Philologie und die Klassische Archäologie auszublenden. Die zunehmend polyzentrische Struktur der Wissenschaften von Altertum vervielfältigte die Zugänge und Wahrnehmungen der klassischen Antike, aber auch anderer Epochen der europäischen und der außereuropäischen Vergangenheit. Trotz der hieraus resultierenden Divergenz des Untersuchungsgegenstandes sollen übergreifende Fragestellungen verfolgt werden. Hierzu gehören die Forschungspraktiken in den Altertumswissenschaften und deren institutionelle Fundamente. Im 19. Jahrhundert bestand eine enge Verbindung zwischen einer Forschungspraxis, die auf die Sichtung, Sammlung und Ordnung der Überlieferung fokussiert war, und der wissenschaftlichen Produktion, die auf der Grundlage der in Editionsreihen, Corpora und Thesauri zusammengeführten Quellen zu historischer Erkenntnis gelangen wollte. Die Ordnung der »Archive der Vergangenheit«, wie Theodor Mommsen(1) formulierte, war die Voraussetzung altertums- und geschichtswissenschaftlicher Arbeit. Dazu bedurfte es wiederum institutioneller Grundlagen, die organisatorische, finanzielle und personelle Mittel zur Verfügung stellten, um den dynamischen Zuwachs an Wissen zu garantieren. Das Deutsche Kaiserreich sah deshalb den Siegeszug des wissenschaftlichen Großbetriebes. Die Konflikte und Kriege des 20. Jahrhunderts haben an den Forschungspraktiken der altertumswissenschaftlichen Unternehmungen nichts geändert, wie am Beispiel der epigraphischen Projekte der Berliner Akademie der Wissenschaften dargestellt ist. Aber die Voraussetzungen veränderten sich infolge der Zerschlagung internationaler Kooperationen, die für diese Vorhaben lebensnotwendig sind, zuerst durch den Ersten und dann durch den Zweiten Weltkrieg. Nach beiden Kriegen mussten zunächst die Reintegration der deutschen Wissenschaft in die internationale Gemeinschaft und die Restitution der unterbrochenen wissenschaftlichen Kontakte gesichert werden.
Das Beispiel der Mommsen-Gesellschaft erlaubt die Rekonstruktion der nationalen und internationalen Konsolidierung der (west-)deutschen Altertumswissenschaften und ihrer methodischen und inhaltlichen, ihrer epistemischen und theoretischen Entwicklungen in Ost und West nach 1945. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges führten in Westdeutschland die weitere Spezialisierung der Fächer, die Übernahme von Methoden und Theorien aus anderen Disziplinen und die Realisierung interdisziplinärer Kooperationen zu einer zunehmenden Differenzierung der Forschungspraxis in den einzelnen Fächern. Nicht betroffen hiervon war indes die akademische Qualifikation des Nachwuchses, der über zwei innovative Qualifikationsarbeiten, die im Rahmen der Promotion und der Habilitation vorzulegen waren, zum Privatdozenten ernannt wurde und auf den Ruf auf eine Professur warten musste.
Eingehend wird uns die Bestimmung des Verhältnisses von universitärer Wissenschaft und bürgerlicher Bildung beschäftigen. Am antiken Beispiel wurde die bürgerliche Gewissheit entfaltet, durch den Rekurs auf die Antike den Gang der Zeitläufte positiv beeinflussen zu können. Der Bürger konnte und musste aus seiner Beschäftigung mit dem Altertum verantwortungsvolles politisches und gesellschaftliches Handeln lernen. Historische Reflexion, die ihren Ausgang zunächst in der griechischen Antike nahm, dann aber auch das römische Erbe einschloss, wurde zu einem wesentlichen Bestandteil bürgerlicher Kultur. Im Deutschland des frühen 19. Jahrhunderts trug die Antike als historiographisches Konstrukt und als idealisierte zeitlose Projektion wesentlich zur kulturellen Homogenisierung des Bürgertums und zur Konstitution eines bürgerlichen Selbstverständnisses bei. Das neue Bildungsideal, das hier mit Wilhelm von Humboldt(1) assoziiert wird, richtete sich gegen die absolutistische Welt der Stände; denn die neue Bildungselite war radikal meritokratisch. Nicht Geburt und Herkunft, sondern Leistung und Bildung zählten.
Doch die säkulare Bildungsreligion, die die Entchristianisierung der deutschen Kulturnation beschleunigte, geriet in eine Krise, als an den deutschen Universitäten, in denen die ›klassische‹ Altertumswissenschaft zur Leitdisziplin aufgestiegen war, die Historisierung des Altertums das Ende eines normativen Verständnisses der Antike bedingte. Gegen die Relativierung der klassischen Bildung, für die disziplinäre Außenseiter wie Jacob Burckhardt(2) und Friedrich Nietzsche(1) eine professionalisierte und spezialisierte Altertumswissenschaft verantwortlich machten, suchten Wissenschaftler und Intellektuelle seit der Mitte des 19. Jahrhunderts bis weit in das 20. Jahrhundert, die europäische Antike als zeitloses Leitbild zu bewahren. Ihre Anstrengungen richteten sich auf die ›humanistische‹, d. h. eine am Menschen und seinen Bedürfnissen orientierte Bildung, die ebenso die wissenschaftliche Krise des Historismus wie die soziale Krise der als defizitär empfundenen Gegenwart überwinden sollte.
Das 20. Jahrhundert sah viele Gefechte um die Bedeutung des klassischen Altertums für Gymnasien und Universitäten. Heftig wurde um die alten Sprachen gestritten. Der Aufstieg zunächst der Naturwissenschaften und später der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften führte dazu, dass die humanistische Bildung ihre Exklusivität verlor. Sie trat in Konkurrenz mit anderen Bildungsinhalten. In Deutschland verlor das Humanistische Gymnasium bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts seine Monopolstellung. Diese Entwicklung marginalisierte das Bildungsbürgertum, nicht aber die alten Sprachen. Der Zugang zu Latein und Griechisch wurde demokratisiert. Nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Ländern Europas lernen zu Beginn des 21. Jahrhunderts mehr Schüler zumindest Latein als je zuvor. Der allgegenwärtige Bedeutungsverlust des Wissens um die Antike geht folglich nicht einher mit einem Verlust an Wissen um die Antike. Aber die Rezeptionsformen verändern sich rasant: Zu Literatur, Kunst und Musik sind Film, Comic und Internet getreten.
Auf Grund der manifesten Interdependenzen beschäftigt sich dieses Buch eingehend mit dem Verhältnis von Wissenschaft und Politik. Die Verbindungen zwischen dem Liberalismus des frühen 19. Jahrhunderts und der Entstehung der modernen Wissenschaft vom Altertum sind offenkundig. Alternative Entwürfe, die sich gegen die Lebensferne der historistischen Wissenschaft richteten, waren oft kulturpessimistischen Zeitströmungen verpflichtet und zielten auf gesellschaftliche und politische Veränderungen. Das erzieherische Vorbild der Griechen, aber auch die straffe Disziplin der Römer waren seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert Leitbilder, die bis in die Zeit des Nationalsozialismus im universitären wie im außeruniversitären Kontext dazu dienten, antimoderne Vorstellungen eines neuen, idealen Menschen zu propagieren. Nicht nur Universitätsprofessoren, sondern auch jugendbewegte Künstler popularisierten gerade nach der Katastrophe des Ersten Weltkrieges eine politisierte Wissenschaft, die gegen die offene Konkurrenz kulturell-politischer Leitsysteme polemisierte und im Rückgriff vor allem auf das antike Sparta überzeitliche Werte definierte. Die Wiederkehr des Klassizismus im »Dritten Reich« und die Griechenbegeisterung des »Führers« wurden nicht nur von einer Archäologie, die sich selbst gleichgeschaltet hatte, als Beginn eines neuen Äon gefeiert. Braune Philhellenen waren von der nun auch durch die Rassenforschung pseudo-wissenschaftlich begründeten Verwandtschaft zwischen deutschen Volksgenossen und alten Griechen überzeugt. Umgekehrt zeigten sich die Spezialisten, die sich der historistischen Altertumswissenschaft und dem epistemischen Postulat der »Wahrheitsforschung« verschrieben hatten, weniger anfällig gegen totalitäre Indoktrination – im »Dritten Reich« ebenso wie später in der Deutschen Demokratischen Republik.
Das Augenmerk darf allerdings nicht nur auf die Epoche des Nationalsozialismus und die Bewertung der politischen Biographien verschiedener Wissenschaftler gerichtet sein. Um Kontinuitäten und Diskontinuitäten in den Altertumswissenschaften herauszuarbeiten, ist es notwendig, die zeitliche Perspektive zu erweitern und die Republik von Weimar wie diejenige von Bonn (und Ostberlin) ebenfalls in den Blick zu nehmen. Nur so können die intellektuellen und wissenschaftlichen Voraussetzungen geklärt werden, die zahlreiche prominente Altertumswissenschaftler veranlassten, mit dem nationalsozialistischen Wissenschaftssystem zu kollaborieren, und nur auf diesem Weg können Inhalte und Methoden der Altertumswissenschaften, aber auch individuelle Lebensläufe nach 1945 überzeugend bewertet werden. Das Buch greift deshalb in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts aus und untersucht die Strukturbedingungen und Entwicklungsprozesse der Altertumswissenschaften einerseits im Wirtschaftswunderland und der »nivellierten Mittelstandsgesellschaft« (Helmut Schelsky(1)) der frühen Bundesrepublik und andererseits im real existierenden Sozialismus und Linkstotalitarismus der Deutschen Demokratischen Republik.
Das Ergebnis ist kein erschöpfendes Handbuch, sondern eine exemplarische Wissenschaftsgeschichte, die notwendigerweise die disziplinäre Ausrichtung, aber auch persönliche Interessen des Verfassers spiegelt. Übergreifendes Ziel ist es jedoch, wichtige Etappen der wissenschaftlichen und intellektuellen Aneignung des Altertums zu beschreiben und die überragende Bedeutung des Gegenstandes für die deutsche Kulturgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts darzulegen.
Das 19. Jahrhundert
2. Wilhelm von Humboldt: Die Entstehung des Bürgertums aus dem Geiste der Antike[*]
Am Anfang war Winckelmann(1). »Der einzige Weg für uns, groß, ja, wenn es möglich ist, unnachahmlich zu werden, ist die Nachahmung der Alten« stellte 1755 Johann Joachim Winckelmann kategorisch fest.[1] Die ›Alten‹, d. h. die Griechen und Römer, waren nicht länger zeitlose Muster, sondern historische Paradigmen für Wissenschaft, Literatur und Kunst; ihre Werke galten zwar noch immer als vollendet und von unübertrefflicher Schönheit, aber auch als geschichtlich gebunden und damit einzigartig. Die produktive Aneignung des Altertums war durch eine latente Spannung zwischen klassizistischer Ästhetik und aufklärerischem Historismus gekennzeichnet und schwankte zwischen der Kanonisierung eines idealisierten griechischen Altertums und der Akzeptanz der Eigenständigkeit anderer Kulturen. Dieses Bild der Antike, das für den deutschen Kulturraum maßgebend werden sollte, lässt sich beispielhaft am Werk Wilhelm von Humboldts(2) nachzeichnen.[2] Der preußische Aristokrat trug entscheidend dazu bei, dass das Altertum als historische Formation und ideale Projektion nachhaltig Wertvorstellungen und Bildungsinhalte der Schicht prägte, die wir als Bürgertum bezeichnen.
Es ist längst bekannt, dass klassische soziale Parameter oder ökonomische Ressourcen nicht genügen, um das Bürgertum zu definieren. Eine spezifische Art der Lebensführung, eine spezifische ›Kultur‹ muss hinzutreten, um die Differenz zwischen der Heterogenität sozialer Lagen und der Homogenität geistiger Identitäten zu überbrücken.[3] Damit ist die bürgerliche Gesellschaft ein Modell der Akkulturation, und die historische Forschung hat zahlreiche Werte und Handlungsmuster benannt, die die bürgerliche Kultur und Mentalität prägen: Bildung als »Erlösungshoffnung und Erziehungsanspruch« etwa,[4] aber auch individuelle Freiheit, die Entfaltung persönlicher Anlagen, die Orientierung auf das Gemeinwohl, das Streben nach Besitz, die Familie als private Sphäre und die Autonomie von Literatur, Musik und bildender Kunst.[5] Wertvorstellungen und Bildungsinhalte konstituierten um 1800 ein System dauerhafter Handlungsdispositionen. Trotz unterschiedlicher sozialer Basis gelangten die Repräsentanten des Bürgertums zu durchaus vergleichbaren Lebenshaltungen. Der Soziologe Friedrich H. Tenbruck(1) sprach von einer »bürgerlichen Kultur«, die nicht durch die »strukturelle Homogenität« ihrer Träger, sondern vielmehr durch »eine kulturelle Kommunität« gekennzeichnet gewesen sei.[6] Zur wichtigsten Trägerschicht bürgerlicher Kultur und Mentalität wurde im 19. Jahrhundert das Bildungsbürgertum, d. h. der Teil des Bürgertums, der seinen Anspruch auf soziale Exzellenz auf dem Besitz von Bildungswissen und auf eine daraus abgeleitete Lebensweise gründete. Bildung war nicht länger ein Relikt ständischer Privilegien, sondern ein »prozessualer Zustand, der sich durch Reflexivität ständig und aktiv veränderte«.[7] Die Bedeutung der europäischen Antike für die Formierung des Bürgertums und für die Genese einer bürgerlichen Kultur kann in diesem Zusammenhang nicht hoch genug eingeschätzt werden. Erst der Rückgriff auf die Antike schuf die Voraussetzung, dass die bürgerliche Kultur als gestaltende Kraft der Moderne eine anhaltende Wirkung zu entfalten vermochte.
Bildung: Ein permanenter Prozess der Selbstvervollkommnung
Bildung zählte für Wilhelm von Humboldt(3) zu den zentralen Werten bürgerlicher Mentalität und Kultur. Sie ermöglichte die Entwicklung des Individuums, begründete den Anspruch auf politische Partizipation und bedingte die Veränderung der Gesellschaft. Zur Bildung der eigenen Individualität diente Humboldt zunächst und vor allem die Betrachtung der griechischen Antike. Dabei forderte er nicht die Reproduktion der antiken Verhältnisse, sondern die schöpferische Auseinandersetzung mit der griechischen Welt, um an der historischen Individualität die eigene Individualität zu bilden.[8] Denn der Charakter der Griechen sei in seiner Vielseitigkeit und seiner harmonischen Ausbildung der »Idee der heilen Menschheit«, dem »Charakter des Menschen überhaupt« am nächsten gekommen, »welcher in jeder Lage, ohne Rücksicht auf individuelle Verschiedenheiten da sein kann und da sein sollte«.[9]
Das Bildungsprogramm, das Wilhelm von Humboldt(4) in Preußen entwarf, machte deshalb das seit Winckelmann(2) als edel und erhaben angesehene griechische Altertum zum zentralen Gegenstand des gymnasialen Unterrichts. Die griechische Sprache als Produkt des griechischen Geistes und als Ausdruck des griechischen Nationalcharakters besaß den absoluten Vorrang, da in ihr Einheit und Vielheit, Sinnliches und Geistiges, Objekt und Subjekt, Welt und Gemüt harmonisch verbunden seien.[10] Die Beschäftigung mit einer derart komplex strukturierten Sprache sollte nicht nur die eigene sprachliche Kompetenz fördern, sondern vielmehr dem Menschen helfen, sich umfassend zu bilden und sich die Welt zu erschließen. Die griechische Sprache wurde zu einem den Menschen formenden Instrument, das ihm den Weg wies, sich ohne utilitaristische Interessen die Vielfalt der ihn umgebenden Welt anzueignen. Das Erlernen des Griechischen diente folglich nicht mehr dazu, in Wort und Schrift die Formen eines vergangenen Äons zu imitieren, sondern zielte auf die allseitige und harmonische Entfaltung individueller Anlagen.[11] Bildung war deshalb Selbstzweck und zugleich ein permanenter Prozess der Selbstvervollkommnung.[12]
Auch die Universität, die Humboldt(5) entwarf, ruhte auf dem idealisierten Griechenbild. Sie diente der Bildung durch Wissenschaft, die wiederum durch zweckfreies Forschen, die Reflexion auf das Ganze und das permanente Bemühen um Erkenntnisfortschritt charakterisiert war. Wissenschaft, in den Worten Humboldts, war ein »noch nicht ganz Gefundenes und nie ganz Aufzufindendes«, die »als solche zu suchen war«, und musste in »Einsamkeit und Freiheit«, will sagen unabhängig von politischen und gesellschaftlichen Zwängen ausgeübt werden.[13] Die Suche nach Wahrheit und das Streben nach Erkenntnis um ihrer selbst willen verlangten Kenntnisse auf allen Gebieten menschlichen Wissens. In zeitkritischer Absicht wandte sich Humboldt gegen Spezialisierung und Fragmentierung der Bildung und der Wissenschaft, die dazu führten, dass die Welt nicht mehr als Ganzes verstanden würde.[14]
Als Gegenentwurf zu der als defizitär empfundenen Gegenwart diente Humboldt(6) – nach dem Konzept Friedrich Schillers(1) – die griechische Antike. Denn »der vorherrschende Zug« der Griechen sei gewesen, »Achtung und Freude an Ebenmaß und Gleichgewicht, auch das Edelste und Erhabenste nur da aufnehmen zu wollen, wo es mit einem ganzen zusammenstimmt«. Deshalb sei ihnen das »Missverhältnis zwischen innerem und äußerem Dasein, das die Neueren so oft quält« schlechterdings fremd gewesen.[15] Die Vielfalt der Lebensbereiche habe im antiken Hellas nicht zu Widersprüchen und Gegensätzen geführt, die den modernen Menschen so sehr verunsicherten, sondern seien zu einer Einheit verbunden worden. Ebendiese Harmonie in der Pluralität menschlicher Existenz hätten die Griechen zum »Ideal dessen« gemacht, »was wir selbst sein und hervorbringen möchten«.[16]
An den Griechen lernte man, dass das Streben nach Bildung nie abgeschlossen werden konnte, sondern ein lebenslanger Prozess der Selbsterziehung war. Es ist offenkundig, dass sich Humboldts(7) Konzept gegen die Ständewelt des Ancien Régime richtete und eine neue Bildungselite konstituierte, die nicht mehr durch Geburt und Herkunft, sondern durch Leistung und Bildung legitimiert wurde. Das Ideal einer an der griechischen Antike orientierten höheren Bildung war der Theorie nach allen Menschen zugänglich, »denn der gemeinste Tagelöhner und der am feinsten Ausgebildete muss in seinem Gemüt ursprünglich gleich gestimmt werden, wenn jener nicht unter der Menschenwürde roh und dieser nicht unter der Menschenkraft sentimental, schimärisch und verschroben werden soll«.[17] Doch diese Bildungsidee war keineswegs egalitär. Eine Bildung, die den Zweck in sich trug und den praktischen Nutzen gering schätzte, musste man sich leisten können. Es war das aufstrebende Bürgertum, das sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts Humboldts Ideal der Bildung (durch Wissenschaft) zu eigen machte. Die Verehrung der Griechen begründete die für das kulturelle Selbstverständnis der bürgerlichen Gesellschaft in Deutschland zentrale Bedeutung der Bildung für jeden einzelnen, der sein Leben lang angehalten war, an sich selbst zu arbeiten. Die ›bürgerliche‹ Welt der Griechen ersetzte zugleich die aristokratische Antikenkultur, die durch die französische Hofkultur stark lateinisch geprägt war.[18] Bildung wurde zum eigentlichen und wahren Adelsprädikat. Das Signum bürgerlicher Vornehmheit war nunmehr die souveräne Beherrschung der griechischen Sprache.
Unerreichbarkeit der Griechen: Zeitlose Größe und paradigmatische Geschichtlichkeit
Die Griechen offenbarten Humboldt(8) die »reine, um ihrer selbst willen verwirklichte Menschlichkeit des Menschen«. Sie sind »das Ideal alles Menschendaseins«. Die Griechen »sind für uns, was ihre Götter für sie waren«.[19] Die Römer wurden nur als Vermittler des griechischen Erbes wahrgenommen. Die Überhöhung der Griechen ging einher mit der Abwertung der römischen Tradition.[20]
Humboldt teilte die Grundüberzeugung des Klassizismus, das Eigene am Fremden zu verstehen. In der Auseinandersetzung mit dem Gegenüber und in der Aneignung fremden Geistes sollten der eigene Geist entdeckt und erzogen werden. Humboldt(9) warf mit der Rezeption des antiken Hellas die für das deutsche Bürgertum wichtige Frage auf, unter welchen Voraussetzungen und Bedingungen und mit welchem Ziel sich ein Individuum und eine Nation Fremdes erschließen und anverwandeln könne.[21] Immer wieder betonte er in diesem Zusammenhang die Bedeutung der griechischen Sprache, in der sich der griechische Geist in seiner Ursprünglichkeit, Kraft und Fülle manifestiere. Pointiert formulierte er, dass »alle wahrhafte Geistesbildung aus den Eigentümlichkeiten des Attischen Dialektes« hervorgehe.[22]
Doch nicht allein die Sprache sollte gelernt werden. Es hieß, die griechische Kultur in ihrer Mannigfaltigkeit und den griechischen Charakter in seiner Totalität zu erfassen. Zwar räumte Humboldt(10) prinzipiell jeder Nation die Möglichkeit ein, einen individuellen Charakter auszubilden, schränkte aber zugleich ein, dass im Grunde genommen nur die griechische Antike von Bedeutung sei.[23] Das Studium des griechischen Charakters müsse, so Humboldt, in jeder Lage und jedem Zeitalter allgemein heilsam auf die menschliche Bildung wirken, »da derselbe gleichsam die Grundlage des menschlichen Charakters überhaupt« ausmache.[24]
Humboldts(11) Idealisierung des griechischen Altertums war eine späte Variante der Querelle des Anciens et des Modernes, die im 17. Jahrhundert das Verhältnis der eigenen Zeit zur Antike zu bestimmen versuchte, allerdings ein weitgehend romanozentrisches Antikenbild vermittelt hatte. Im Anschluss an Winckelmann(3) schwelgte Humboldt im Pathos klassizistischer Griechenbegeisterung. Doch er redete nicht der Imitation des historischen Exempels das Wort, denn dies war in seinen Augen eine Unmöglichkeit: »Die Griechen sind uns nicht bloß ein nützlich historisch zu kennendes Volk, sondern ein Ideal. Ihre Vorzüge über uns sind von der Art, dass gerade ihre Unerreichbarkeit es für uns zweckmäßig macht, ihre Werke nachzubilden.«[25] Nicht die blinde Nachahmung konnte das Individuum zur harmonischen Entfaltung der eigenen Anlagen führen, sondern die stete Auseinandersetzung mit einem idealisierten Hellas-Bild, das nicht ein historischer Ort, sondern vielmehr eine Utopie, eine »notwendige Täuschung« war. Das Altertum war vergangen, und die moderne Welt konnte nicht aus der alten deduziert werden.[26] Normativität und Historizität standen nebeneinander.[27]
Humboldt(12) wollte die Griechen nicht mehr in ihrer zeitlosen Größe, sondern in ihrer paradigmatischen Geschichtlichkeit darstellen. Damit wurden sie aber auch zu einem Objekt historischer Forschung, deren Aufgabe die Beschreibung der einzigartigen Individualität des griechischen Nationalcharakters war. Für deren Erforschung war die ›moderne‹ Altertumswissenschaft zuständig, die Humboldt als Student in Göttingen bei Christian Gottlob Heyne(1), der wiederum von Winckelmanns(4) Vorstellungen beeinflusst worden war,[28] kennengelernt hatte, und für die Friedrich August Wolf(1) stand, mit dem Humboldt intensiv korrespondierte.[29] Beide reagierten mit ihren Schriften »Über das Studium des Altertums« und »Darstellung der Altertumswissenschaft« auf Heynes programmatische »Einleitung in das Studium der Antike« aus dem Jahr 1772. Man stimmte darin überein, dass es nicht mehr die einzige Aufgabe der Altertumswissenschaft sein konnte, die aus der Antike überkommenen Texte zu edieren und zu kommentieren, sie mussten vielmehr nach den Regeln der Quellenkritik der historischen Auswertung und Interpretation unterworfen werden. Die Klassische Philologie wurde damit zu einer historischen Disziplin, die die Antike als vornehmstes Objekt des historischen Interesses betrachtete und sich deshalb als das erste unter den Fächern der Philosophischen Fakultät verstand. An antiken Gegenständen wurde die Frage nach den Bedingungen der Möglichkeit objektiver Erkenntnis in der Geschichte diskutiert, und die Prinzipien der neu konstituierten Hermeneutik wurden auf die philologisch-historische Analyse griechischer und lateinischer Texte angewandt.[30]
Damit stand Humboldt(13) am Anfang einer Entwicklung, die das griechische Altertum historisierte und seine normative Funktion relativierte. Wissenschaft und Bildung drifteten im Laufe des 19. Jahrhunderts immer weiter auseinander. Humboldt selbst konzentrierte sich in späteren Jahren nicht allein auf die Erforschung der Alten Welt, sondern verfolgte universalhistorische Fragestellungen – durchaus in der Absicht, durch Vergleiche die Einzigartigkeit des griechischen Nationalcharakters und die Schönheit der griechischen Sprache zu bestätigen. In seinen späten sprachwissenschaftlichen Untersuchungen distanzierte er sich von jeder auf die europäische Antike beschränkten Forschung, richtete seine Aufmerksamkeit auf alle Sprachen der Menschheit und relativierte somit die Exzeptionalität des griechisch-römischen Altertums.[31] Hier weiß er sich einig mit seinem Bruder Alexander(1), für den die europäische Antike zwar auch die Referenz für seine Beschreibungen fremder Kulturen ist, der aber ihre exklusive Bedeutung durch den bewussten Vergleich mit außereuropäischen ›Antiken‹ relativiert und eurozentrische Stereotypen dekonstruiert.[32]
August Böckh(1) und Johann Gustav Droysen(1) gingen den von Heyne(2), Wolf(2) und Humboldt(14) vorgezeichneten Weg konsequent weiter, an dessen Ende die Erkenntnis stand, dass die Alte Welt nur eine Epoche neben anderen war. Der Beitrag der Altertumskunde, die die Griechen zunächst zu ihrem primären Erkenntnisgegenstand machte, ist für die Entwicklung eines modernen Geschichtsverständnisses und einer wissenschaftlichen Methodologie von nicht zu unterschätzender Bedeutung. In seiner Akademierede von 1821 »Über die Aufgabe des Geschichtsschreibers« begründete Humboldt(15) das Programm einer forschenden Geschichtsschreibung, die die Aufzählung der Fakten hinter sich ließ und in deren Zentrum die Einbildungskraft, die Phantasie, stand. Dieser bedarf es, um die inneren Zusammenhänge der Geschichte, die Gesetze der historischen Entwicklung erfolgreich zu erkunden. Humboldt zielte auf die Ideen, die die Geschichte strukturieren und aus dem Faktenstoff ein Gewebe machen. Diese liegen ihrer Natur nach zwar »außer dem Kreise der Endlichkeit«, aber sie durchwalten und beherrschen die Weltgeschichte »in allen ihren Teilen«.[33] Aufgabe des Historikers sei es, die transzendenten Ideen als die treibenden Kräfte der Geschichte mit Hilfe seines »Ahndungsvermögens« und seiner »Verknüpfungsgabe«[34] aufzuspüren und ihr Wirken in der Immanenz darzustellen. »Das Geschäft des Geschichtsschreibers in seiner letzten, aber einfachsten Auflösung ist Darstellung des Strebens einer Idee, Dasein in der Wirklichkeit zu gewinnen.«[35] Im Übergang von der Aufklärungshistorie zum Historismus konstituierte Humboldt die Einheit des Vergangenen nicht durch die Abbildung des Geschehenen, sondern der Ideen, die dem Historiker im Geschehenen erkennbar sind. Die schöpferische Phantasie des Historikers war nicht länger stigmatisiert, sondern wurde die Voraussetzung historischer Erkenntnis überhaupt.
Am antiken Beispiel wurde die bürgerliche Gewissheit entfaltet, durch Geschichtsschreibung den Gang der Zeitläufte beeinflussen zu können. Die exklusive Kompetenz – und Aufgabe – der Historiographie war es, »die Gegenwart über ihr Werden aufzuklären und damit über den historischen Moment, dem sie zugehört und dem sie gerecht werden muss«.[36](16) Der Bürger konnte und musste vom Altertum verantwortungsvolles politisches und gesellschaftliches Handeln lernen. Historische Reflexion, die ihren Ausgang in der griechischen Antike nahm, wurde zu einem wesentlichen Bestandteil bürgerlicher Kultur.
Die fundamentale Historisierung der Vorstellungen von Mensch und Welt und der beispiellose Aufstieg der historisch orientierten Fächer an den Universitäten und in der öffentlichen Wahrnehmung kennzeichneten Politik, Gesellschaft und Mentalität des Bürgertums im 19. Jahrhundert. Dieser dynamische Prozess nahm seinen Ausgang in der ästhetisierenden Begeisterung für die griechische Antike, dem auf individuelle Entfaltung zielenden Bildungskonzept, der rationalen Methode einer quellenkritischen Altertumswissenschaft und der Neubegründung der Geschichtsschreibung. Humboldt(17) trug zur Entwicklung einer Hermeneutik bei, die als Theoriekonzept der Geschichts- und Altertumswissenschaften der bürgerlichen Sinndeutung diente.[37]
Der Rekurs auf das antike Hellas als eines »Ideals zur Vergleichung«[38] hatte zudem eine kritische Bewertung des Christentums zur Folge, das – wie Humboldt(18) ausführte – in dem Zeitraum vom vierten bis zur Mitte des sechzehnten Jahrhunderts den Verfall des Geschmacks und der wissenschaftlichen Kultur zu verantworten habe.[39] Den »Zeiten der Barbarei«, die »mit dem sehr schicklichen Namen des Mittelalters belegt« würden, stellte Humboldt das »Ideal« der »griechischen Vorwelt« entgegen.[40] Damit verabschiedete er sich von der seit dem Humanismus herrschenden Vorstellung, dass die vorchristliche und die christliche Antike eine Einheit bildeten, und setzte an ihre Stellung eine exklusiv pagane Vergangenheit, deren Studium die Erneuerung der Gegenwart bewirken sollte. Bereits Friedrich Paulsen(1) beschrieb die Folgen eindrücklich: »Der hellenische Humanismus ist eine neue Religion, die Philologen sind ihre Priester, die Universitäten und Schulen ihre Tempel.«[41] Humboldt(19) konzipierte eine säkulare Bildungsreligion, die in der bürgerlichen Welt des 19. Jahrhunderts die Entchristianisierung der Gesellschaft beschleunigte und eine quasi-religiöse Verehrung des Griechentums zur Folge hatte.
Freiheit des Individuums: Zur Genese der bürgerlichen Gesellschaft
Die Verherrlichung der griechischen Antike hatte immer auch eine politische Dimension, denn in Übereinstimmung mit der emanzipatorischen Tradition der Aufklärung hatte schon Winckelmann(5) Athen nicht nur zum Zentrum künstlerischer und humaner Idealität, sondern zugleich zum Ort politischer Freiheit gemacht. Humboldt(20) hingegen, an Johann Gottfried Herder(1) anschließend, beschrieb in seinen Studien zur Alten Welt Hellas als den Ort, an dem der Mensch seine Individualität auf beispielhafte Weise hatte entfalten können. Individualität war ihm das »Geheimnis alles Daseins«, das in jedem Menschen zu finden war. Aus der Französischen Revolution hatte er gefolgert, dass in einer bestimmten historischen Situation alles auf die individuellen Kräfte ankomme. Seine Forderung, das Individuum zur Selbständigkeit, zur Selbsttätigkeit und zur Selbstverantwortung zu erziehen, setzte individuelle Rechte und persönliche Freiheit voraus und richtete sich an den Staat, der als einziger diese Rechte und diese Freiheit zu garantieren vermochte.[42] Humboldt bestimmte als den höchsten Zweck des modernen Staates die Befreiung des Bürgers zum selbsttätigen Menschen. Folglich durfte der Staat die Bildung des Individuums nicht behindern, durfte nicht in Erziehung, Religion und Moral eingreifen, sondern musste die Freiheit als die erste und unerlässliche Bedingung von Bildung und Wissenschaft akzeptieren. Dazu war es notwendig, die staatliche Wirksamkeit zu begrenzen. Die »Staatsverfassung« war nur »ein notwendiges Mittel« und, »da sie allemal mit Einschränkungen der Freiheit verbunden ist«, nicht mehr als »ein notwendiges Übel«.[43] Humboldt verknüpfte den neuen Staatsgedanken und den neuen Bildungsgedanken. »Der Staat wurde berufen, die Erziehung des Menschen ohne alle Nebenzwecke von Macht und Interesse, allein um des Menschen selbst willen, in die Hand zu nehmen, doch von der neuen Bildung erwartete man zugleich, dass sie kraft des ihr innewohnenden Gesetzes die Hingabe an Volk und Staat erziehen werde.«[44]
Humboldt(21) verfocht die Idee einer aktiven Teilhabe der politisch tätigen Bürger und integrierte sie in sein Modell einer Gesellschaft, die sich als eine Gemeinschaft von Bürgern konstituierte, die ihr Gemeinwesen weitgehend selbständig regelten. Der Ort der freien Wirksamkeit des Menschen war für Humboldt indes nicht der Staat, sondern die Nation. Der Staat zeichnete verantwortlich für die innere und äußere Sicherheit, während die Nation durch das freiwillige Zusammenwirken der Bürger in verschiedenen Bereichen gekennzeichnet war. Die Verbindung zwischen Staat und Nation konnte einzig der Bürger herstellen, in dem er sich selbstbewusst und politisch handelnd betätigte. Das »freie Wirken der Nation unter einander«, das »alle Güter bewahrt, deren Sehnsucht die Menschen in eine Gesellschaft führt«,[45] antizipierte die Konzeption einer bürgerlichen Gesellschaft, deren Kennzeichen die Separierung vom Staat war[46] – mit dem Ziel, den Bürgern einen vom staatlichen Einfluss weitestgehend freien Bereich zu sichern.[47]
Auch hier setzte Humboldt(22) Vergangenheit und Gegenwart in ein produktives Verhältnis zueinander. Das Altertum diente als Vergleichspunkt, eine Rückkehr zu den antiken Zuständen war jedoch nicht intendiert. Humboldt ließ in seinen staatstheoretischen Überlegungen keinen Zweifel daran, dass die griechische Polis und die römische res publica ein überkommenes Modell darstellten. Im Altertum war zwischen Staat und Gesellschaft noch nicht geschieden, und der Bürger des antiken Stadtstaates ordnete seine individuelle Freiheit dem Allgemeinwohl unter. Hier kontrastierte Humboldt die politischen Verhältnisse in den Monarchien seiner Zeit mit der historischen Situation in der Antike. Die Diskussion der Verhältnisse im Altertum führte Humboldt folglich zur reflektierten Beurteilung der zeitgenössischen Verhältnisse in Staat und Gesellschaft.[48]
Humboldts(23) Antikebild diente der Legitimation und Konstitution seiner Vorstellungen eines modernen Staates, der Bildung und Freiheit garantierte und beförderte. Die Beschäftigung mit dem Altertum hatte folglich eine zeitkritische, eminent politische Dimension. Die antiken Beispiele verdeutlichten die Notwendigkeit, in der Gegenwart bürgerliches Engagement und Patriotismus mit dem Ideal individueller Autonomie zu verbinden. Nur ein solcher Staat vermochte stark zu sein, der seinen Bürgern persönliche und institutionelle Freiheit ermöglichte und die Herrschaft des Menschen über den Menschen unterband. Freiheit, in Humboldts Worten, ist »die notwendige Bedingung, ohne welche selbst das seelenvollste Geschäft keine heilsamen Wirkungen […] hervorzubringen vermag«.[49] Der Entwurf eines politisch tätigen Bürgers und das Modell einer bürgerlichen Gesellschaft, das den Liberalismusdiskurs des 19. Jahrhunderts prägte, orientierten sich an der idealen Projektion politischen Handelns in den griechischen Stadtstaaten und der römischen Republik.
Hellenistische Wahlverwandtschaften: Deutsche und Griechen
Humboldt(24) zeigte am Beispiel des griechischen Altertums, dass das Studium einer Nation »schlechterdings alle diejenigen Vorteile« gewähre, »welche die Geschichte überhaupt« darbiete. [50] Deshalb empfahl er die Beschäftigung mit der griechischen Nation in all ihren Aspekten. Doch zunächst hatte er kaum Interesse an der politischen Geschichte, da er den Charakter einer Nation, deren Darstellung für ihn die zentrale Aufgabe der Historiographie war, eher in deren literarischen, wissenschaftlichen und künstlerischen Leistungen zu erkennen glaubte. Erst die Befreiungskriege gegen Napoleon(2) sensibilisierten ihn für das politische Geschehen in Vergangenheit und Gegenwart. Im Jahr 1807 lag Preußen nach den verlorenen Schlachten gegen das napoleonische Heer bei Jena und Auerstedt am Boden. Als Gesandter im Vatikan war Humboldt zumindest räumlich weit entfernt von der politischen Stimmung in seiner Heimat. Neben sprachwissenschaftlichen Studien, die er in Rom betrieb, widmete er sich in einem Fragment gebliebenen Text auch jener Frage, die angesichts der Zeitumstände für einen preußischen Aristokraten von bestürzender Aktualität sein musste: der »Geschichte des Verfalls und Untergangs der griechischen Freistaaten«. Doch was lehrte diese Geschichte? Makedonen und Römer, die Eroberer Griechenlands, waren Barbaren: »Der bessere und edlere Teil erlag, und die rohe Übermacht trug den Sieg davon.« Wie damals so geschehe es »fast immer«, dass »barbarische Völker« die »höher gebildeten« besiegten. Wer nicht »im Verzweiflungsmut« untergehe, der suche »die Freiheit im Inneren wieder«, die im Äußeren verloren gegangen sei.[51] Das siegreiche Rom bildete »in vielfacher Hinsicht immer den Körper, dem Griechenland die Seele einhauchen sollte«.[52]
Die Aktualisierung der griechischen Verfallsgeschichte ist augenfällig, der Vergleich zwischen Hellas-Deutschland und Rom-Frankreich drängt sich geradezu auf. Die Geschichte des nachklassischen Griechenlands spiegelte die jüngste Demütigung Preußens durch das napoleonische Frankreich. Zugleich betonte Humboldt(25) in seiner Schrift mit Nachdruck, dass sich Deutsche und Griechen besonders nahe seien: »Deutsche knüpft daher ein ungleich festeres und engeres Band an die Griechen, als an irgend eine andere, auch bei weitem näher liegende Zeit oder Nation.« Weiter heißt es, dass Deutschland »in Sprache, Vielseitigkeit der Bestrebungen, Einfachheit des Sinnes, in der föderalistischen Verfassung, und seinen neuesten Schicksalen eine unleugbare Ähnlichkeit mit Griechenland« zeige.[53] Damit waren die wesentlichen Argumente für die Verbreitung der Idee einer deutsch-griechischen Verwandtschaft benannt. Der Vielseitigkeit des griechischen wie des deutschen Nationalcharakters entsprach die Einseitigkeit des römischen und des französischen.
Zum ersten Mal hatte sich Humboldt(26) beiläufig in einem Schreiben an Schiller(2) vom 22. September 1795 über seine »Grille von der Ähnlichkeit der Griechen und Deutschen« geäußert.[54] Er wiederholte seinen Gedanken, dass eine ›Wahlverwandtschaft‹ zwischen Deutschen und Griechen bestehe, in anderen Briefen, bis er ihn dann ausführlich in seiner »Geschichte des Verfalls und Untergangs der griechischen Freistaaten« von 1807 entwickelte. Humboldt verwandelte den aus früheren Jahrhunderten geläufigen Epochenvergleich zwischen Antike und Moderne in einen doppelten Kulturvergleich: einerseits zwischen dem antiken Griechenland und dem antiken Rom und andererseits zwischen der Kulturnation Deutschland, das er mit Hellas parallelisierte, und der Staatsnation Frankreich, das er mit dem römischen Imperium verglich. Nicht nur bildungs-, sondern auch kulturpolitisch sollte eine Antwort auf die militärische Niederlage Preußens und den politischen Triumph Napoleons(3) gefunden werden. Die Botschaft, die Wilhelm von Humboldt 1807 verkündete, lautete: Der barbarische »Unterjocher« war kulturell zu überwinden.[55]
Im Anschluss an Herder(2) und die Antikerezeption des deutschen Idealismus propagierte Humboldt(27) das Konzept einer kulturell definierten Nation, die auf staatliche Integration verzichten konnte, weil sie über kulturelle Kohäsion verfügte. An die Stelle der politischen Einheit trat das Bewusstsein eines Zusammenhaltes, der auf kulturellen Gemeinsamkeiten beruhte, die wiederum die geistige Überlegenheit der politisch fragmentierten Nation begründeten. Die von Humboldt vollzogene Aktualisierung der Dichotomie, die zwischen der Kulturnation Hellas und der Staatsnation Rom bestand, kompensierte die politischen und militärischen Niederlagen Preußens und die Auflösung des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Die Ideen des preußischen Aristokraten entwickelten folglich in den preußischen Befreiungskriegen gegen Napoleon(4) eine beachtliche politische Dynamik.[56]
Humboldt(28) hatte damit eine Tradition erfunden, die eine kollektive Identität zu stiften verstand. Dem deutschen Bürgertum bot die Vergegenwärtigung der klassisch-griechischen Vergangenheit eine willkommene Alternative zur französischen-lateinischen Kulturhegemonie in Europa.[57] Die nationale Begeisterung für die alten Griechen richtete sich gegen Frankreich und die ›Gallomanie‹ des deutschen Adels, gegen den absolutistischen Staat und die Ständegesellschaft. Die ›Gräkomanie‹, die in Deutschland an Gymnasien und Universitäten, durch Bücher und Flugschriften verbreitet wurde, war zugleich ein wichtiges Instrument der nationalen Identitätssicherung und der Gegenwartsbewältigung. Der neue, in einer bestimmten historischen Situation entstandene Mythos von der Verwandtschaft zwischen Deutschen und Griechen wurde Teil der bürgerlichen Sinnstiftung und festigte die Annahme, Bürger einer überlegenen Kulturnation zu sein. Im Glauben an eine innere Verwandtschaft von Griechen und Deutschen demonstrierten in der Folge nicht wenige deutsche Intellektuelle ihr kulturelles Sendungsbewusstsein in Wort und Schrift.
Nach Humboldt: Wirkungen
Humboldts (29)Einfluss auf seine eigene Zeit nachzuzeichnen, ist ein schwieriges Unterfangen.[58] Viele seiner Schriften ließ er unveröffentlicht in der Schublade. Humboldt wirkte zu Lebzeiten viel stärker durch seine Briefe. Als er 1835 starb, stand er ganz im Schatten seines Bruders Alexander(2), der dafür Sorge trug, dass aus dem Nachlass wichtige Schriften veröffentlicht wurden. Die bekannten Abhandlungen zum Altertum fanden mehrheitlich gar erst Ende des 19. Jahrhunderts ihren Weg in die Öffentlichkeit.[59] Die Wirkung seiner beiden Denkschriften zur Reform des Schulwesens, dem »Königsberger« und dem »Litauischen Schulplan«,[60] die er als Geheimer Staatsrat und Chef der Sektion für Kultus und öffentlichen Unterricht im preußischen Innenministerium mitten im Zusammenbruch Preußens zu Papier brachte, ist jedoch ebenso umstritten wie die Bedeutung seines erfolgreichen Antrages auf Errichtung der Universität Berlin, in dem er Ideen von Schelling(1), Schleiermacher(1) und Fichte(1) aufgriff.[61] Die »Einheit von Forschung und Lehre« hat Humboldt selbst nie gefordert; sie ist eine spätere Zuschreibung. Zwischen Humboldts Ideen und ihrer Rezeption ist mithin klar zu scheiden, zumal der »Mythos Humboldt« sich in verschiedenen bildungs- und universitätspolitischen Diskussionen des ausgehenden 19. und des 20. Jahrhunderts als ungemein wirkmächtig gezeigt hat und auf das »Leitbild Humboldt« unterschiedliche Sehnsüchte, Erwartungen und Hoffnungen projiziert wurden.[62]
Doch ebenfalls unstrittig ist, dass Humboldts(30) Gedanken zu Inhalt und Aufgabe der Bildung und seine Ideen zu den verschiedenen Formen des Unterrichts in Schule und Universität nach 1810 über die Kabinettspolitik hinaus eine anhaltende Wirkung entfaltet haben. Nachdem Humboldt zum Chef der neugegründeten Sektion für Kultus und Unterricht im Ministerium des Innern ernannt worden war, konnte er die Reformeuphorie, die in dem nach der militärischen Niederlage daniederliegenden preußischen Staat herrschte, nutzen, um in seiner kaum sechzehn Monate währenden Amtszeit wichtige Impulse zum Aufbau eines einheitlichen öffentliches Schul- und Universitätssystems zu geben, das seine Ideen einer allgemeinen Menschenbildung reflektierte. Seine Vorstellungen kommunizierte er zudem einem großen Freundeskreis durch zahlreiche persönliche und briefliche Kontakte.
Humboldts(31) Überlegungen »Über das Studium des Altertums, und des griechischen insbesondere« aus dem Jahr 1793 wurden ausführlich (und anonym) von Friedrich August Wolf(3) in seiner einflussreichen Schrift über die Begründung einer umfassenden Altertumsforschung zitiert.[63] Seine Ideen wirkten hierdurch nachhaltig auf die moderne Wissenschaft vom Altertum und auf die akademische Ausbildung der Gymnasiallehrer an den Philosophischen Fakultäten. Zugleich zogen sie auch in die Unterrichtsabteilung des Kultusministeriums in Berlin ein, wo mit den Ministerialbeamten Johann Wilhelm Süvern(1) und Johannes Schulze(1) zwei Schüler von Friedrich August Wolf(4) tätig waren und maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung der Universitäten und Gymnasien nahmen.[64]
Rückblickend wurde im späten 19. Jahrhundert die ästhetisierende Begeisterung für die griechische Antike und die auf die Erziehung des Individuums ausgerichtete, philosophisch legitimierte Bildung, aber auch die rationale Methode der quellenkritischen Altertumswissenschaft und die weitreichende Neubegründung der Geschichtsschreibung mit dem Begriff »Neuhumanismus« bezeichnet, um diese Bewegung vom Humanismus der Renaissance zu unterscheiden. Dieser Neologismus hat sowohl eine zeitliche wie eine inhaltliche Dimension; er verweist auf die Epoche von ca. 1790 bis 1840 und auf das ihr inhärente Bildungskonzept. Auch wenn Humboldt als eindrucksvollster Repräsentant dieser Bewegung beschrieben werden kann, ist er keineswegs der einzige. Nach einem bekannten Wort war Winckelmann(6) der »Schöpfer« des Neuhumanismus, »Goethe(1) sein Vollender, Wilhelm von Humboldt(32) in seinen sprachwissenschaftlichen, historischen und pädagogischen Schriften sein Theoretiker«.[65] In Bayern legte der Zentralschul- und Oberkirchenrat Friedrich Immanuel Niethammer(1) wenig später ein weitreichendes Reformprogramm für den Unterricht vor, das das Erlernen der alten Sprachen in das Zentrum des Gymnasialunterrichts stellte, die antiken Texte als »vollendetste Meisterwerke der Kultur« pries, ihre Kenntnis nicht als Selbstzweck, sondern als Mittel zur Orientierung in der Welt verstand und der individuellen Begabung des einzelnen Schülers gerecht werden wollte, denn »der Wege zur Bildung sind mancherlei, und die verschiedenen Individuen sollen die verschiedenen Wege gehen«.[66] Bildung war auch hier die »allseitige und harmonische Entfaltung individueller Anlage«, die »zweckfreie Aneignung der Welt von innen heraus« und ein »unabgeschlossener Prozess«.[67] Die traditionelle Gelehrtenschule der Frühen Neuzeit, die seit der Reformation auf das Universitätsstudium vorbereitete, hatte ausgedient. Nicht mehr die aktive Beherrschung der einstigen Gelehrtensprache Latein stand im Zentrum des Lehrplanes, sondern die selbständige intellektuelle Durchdringung der behandelten Gegenstände.
Dieses neuhumanistische Bildungskonzept ist ein Spezifikum des deutschsprachigen Kulturraumes, auch wenn es zahlreiche thematische und inhaltliche Verbindungen zum Philhellenismus in Europa und den Vereinigten Staaten aufweist.[68] Die romanischen und angelsächsischen Länder öffneten sich, wenn überhaupt, nur sehr zögerlich den Ideen des deutschen Neuhumanismus. Man legte besonderen Wert auf eine sprachliche Bildung in humanistischer Tradition, die das Vorrecht der Eliten blieb. In Frankreich hielt sich trotz aller revolutionären Brüche die Dominanz des Lateinischen; bis weit in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts mussten die Abiturienten lateinische Aufsätze verfassen und lateinische Reden halten. In den italienischen Gymnasien vertraute man auf den Unterricht in lateinischer Grammatik und Rhetorik; erst nach der Einigung Italiens 1870 sollte nach deutschem Vorbild der Griechischunterricht eingeführt werden. In Großbritannien bildeten bis weit in das 20. Jahrhundert hinein Griechisch und Latein die Grundlage der schulischen Erziehung der Oberschicht; die Industrielle Revolution hatte dort das Bild des englischen Gentleman nicht verändert, der sich durch die Lektüre der antiken Klassikerausgaben auf die Verwaltung des Empire vorbereitete, formvollendet aus dem Englischen ins Lateinische übersetzte und in der Lage war, griechische Verse zu schmieden.
In Deutschland hingegen fand die bürgerliche Kultur ihren Ausgangspunkt im antiken Griechenland. Auch die Beobachtung verschiedener Kulturen zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten hatte zunächst nicht die Relativierung der Sonderrolle der alten Griechen zur Folge. Sie blieben in zeitlicher und räumlicher Perspektive einzigartig. In der produktiven Auseinandersetzung mit den Griechen wurden Selbständigkeit und Selbstvervollkommnung als individuelle Ziele und die liberale Gesellschaft als politisches Telos entwickelt. Die retrospektive Utopie des »Griechentums«, wie sie Humboldt(33) entwarf, diente den Bürgern damit als Orientierungshilfe in einer nachständischen Welt, die rasch unübersichtlicher und vielfältiger wurde und in der Erfahrungsraum und Erwartungshorizont[69] immer stärker divergierten. Bürger zu werden, hieß jetzt dieser Utopie nachzustreben und auf ihre Verheißung zu vertrauen: »Bürgerlichkeit als kulturelles System vermittelte dem einzelnen eine Zielutopie, an der er sein Leben orientieren konnte.«[70]
Diese Utopie war, pointiert gesagt, von überragender Bedeutung, um die Herausforderungen der Moderne zu meistern.[71] Sie begründete nicht die Sonderrolle einer Klasse oder eines Standes, sondern war zunächst und vor allem ein Angebot, dass der Mensch durch individuelle Bildung sich zum Menschen entwickeln, die neuen Herausforderungen meistern und eine zukunftweisende Antwort auf die Erosion der ›vormodernen‹ politischen Ordnung und religiösen Weltdeutung geben konnte. Werte und Verhaltensmuster wurden vermittelt. Kulturelle, nicht ständische Vergesellschaftung kennzeichnete in der Folge die Träger dieser Kultur, die sich nicht nur mit der Erfüllung von Sekundärtugenden begnügten, sondern sich auf die produktive Suche nach neuen Modellen zur innerweltlichen Sinnstiftung und individuellen Lebensführung machten.
Das neuhumanistische Bildungsideal um 1800 war »die adäquate gesellschaftliche Antwort auf das Problem, die nun erforderlichen individuellen Aneignungsprozesse einerseits offen und flexibel gestalten zu können, sie andrerseits aber zugleich auch zu institutionalisieren und es dem Einzelnen dadurch zu ermöglichen, in den offenen Herausforderungen der bürgerlichen Gesellschaft bestehen zu können. Nicht die Bildungsgüter und das Bildungswissen – eben nicht die Inhalte – sind das Spezifische des neuhumanistischen Bildungsideals, sondern der Prozess der Aneignung, der kreativen Ausformung als Verarbeitung. Das bedingt eine Ausrichtung auf das Allgemeine, auf die Komplexität und Vielheit des Lebens.«[72] Die neue Bildung, die exemplarisches Lernen am Beispiel der Griechen umsetzte, ermöglichte es, sich in einer kontingenten Lebenswelt zurecht zu finden, weil das, was man an den Griechen gelernt hatte, auf die eigene, aktuelle Situation übertragen konnte. Eine berufsspezifische Ausbildung erübrigte sich damit.
Gleichzeitig stiegen die Altertumswissenschaften an den Universitäten zur Leitwissenschaft auf. Die im Anschluss an Winckelmann(7) vertretene Historisierung der Altertümer knüpfte zwar in vielfältiger Weise an die antiquarische Forschung seit dem Humanismus und an die Geschichtsschreibung der Aufklärung an,[73] doch die nun entstehende neue Disziplin, die »Altertumswissenschaft«, die Christian Gottlieb Heyne(3) an der damaligen Reformuniversität Göttingen zunächst propagiert und Friedrich August Wolf(5) unter Rückgriff auf Humboldts(34) Vorstellungen konzeptualisiert hatte, machte aus einer aristokratischen Liebhaberei und elitären Nebentätigkeit von Professoren ein akademisches Fach. Aufgabe der wissenschaftlichen Forschung war es nun, wie Hegel(1) formulierte, die »Sprache und Welt der Alten« als Manifestationen des objektiven Geistes zu verstehen. Ihr Studium gleiche einem »geistigen Bad«, einer »profanen Taufe«, »welche der Seele den ersten und unverlierbaren Ton und Tinktur für Geschmack und Wissenschaft gebe«.[74] Die alten Sprachen wurden mithin nicht mehr – wie früher – als Teil der propädeutischen Ausbildung in der Artistenfakultät unterrichtet, sondern waren nun die Grundlage einer umfassenden Wissenschaft vom griechischen und römischen Altertum, die im Zentrum der erneuerten deutschen Universitäten stand. Auf der Basis der gründlichen Erfassung der Quellen wurde die Interpretation der Überlieferung als die entscheidende Erkenntnisoperation der historischen Forschung dargestellt, die Objektivität als obersten Grundsatz einforderte, an die immanente Sinnhaftigkeit des geschichtlichen Geschehens glaubte und die Rolle der Einzelpersönlichkeit betonte. Wissenschaftliche Bildung war die höchste Form bürgerlicher Bildung. Denn sie sollte »den Einzelnen dazu befähigen, in allen Lebens- und Berufsbereichen auf wissenschaftlicher Grundlage nach Lösungen für bislang ungelöste Probleme zu suchen«.[75] In Deutschland begann das Jahrhundert der Altertumswissenschaften.