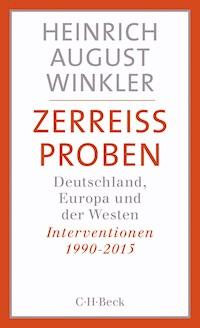16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Heinrich August Winkler hat eine dramatische, spannend zu lesende deutsche Geschichte vorgelegt. Er greift auf die Quellen zurück, um die Beweggründe der Handelnden freizulegen und die Geschichtsbilder nachzuzeichnen, von denen sie sich leiten ließen. Entstanden ist eine deutsche Geschichte, wie es sie so noch nicht gab: auf das Wesentliche ausgerichtet, anschaulich, entschieden im Urteil – und so verständlich geschrieben, daß nicht nur die Fachleute, sondern alle gefesselt sein werden, die wissen wollen, wie Deutschland wurde, was es heute ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
HEINRICH AUGUST WINKLER
Der lange Wegnach Westen
Deutsche Geschichte I
Vom Ende des Alten Reichesbis zum Untergangder Weimarer Republik
C.H.Beck
FÜR DÖRTE
Inhalt
Einleitung
1. Prägungen: Das Erbe eines Jahrtausends
2. Der Fortschritt als Fessel: 1789–1830
3. Der überforderte Liberalismus: 1830–1850
4. Einheit vor Freiheit: 1850–1871
5. Die Wandlung des Nationalismus: 1871–1890
6. Weltpolitik und Weltkrieg: 1890–1918
7. Die vorbelastete Republik: 1918–1933
Ausblick
Anhang
Abkürzungsverzeichnis
[Anmerkungen
Personenregister
Einleitung
Gab es ihn oder gab es ihn nicht, den umstrittenen «deutschen Sonderweg»? Lange Zeit wurde diese Frage vom gebildeten Deutschland bejaht: zunächst, bis zum Zusammenbruch von 1945, im Sinne des Anspruchs auf eine besondere deutsche Sendung, danach im Sinne der Kritik an der politischen Abweichung Deutschlands vom Westen. Heute überwiegen in der Wissenschaft die verneinenden Antworten. Deutschland, so lautet die herrschende Meinung, habe sich von den großen westeuropäischen Nationen nicht so stark unterschieden, daß man von einem «deutschen Sonderweg» sprechen könne, und einen «Normalweg» sei ohnehin kein Land dieser Welt gegangen.
Die Frage, ob die Besonderheiten der deutschen Geschichte es rechtfertigen, von einem «deutschen Sonderweg», vielleicht auch von mehreren «deutschen Sonderwegen» zu sprechen, ist der Ausgangspunkt dieser zweibändigen Darstellung. Folgerichtig kann der Versuch einer Antwort erst an ihrem Ende stehen. Auf dem Weg dorthin werden Probleme erörtert, die in die Antwort eingehen müssen. Ich lege also keine «Totalgeschichte», sondern eine «Problemgeschichte» vor. Im Mittelpunkt dieser deutschen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts steht das Verhältnis von Demokratie und Nation. Ich frage zum einen, wie es dazu kam, daß Deutschland sehr viel später als England und Frankreich, nämlich erst in den Jahren 1866 bis 1871, ein Nationalstaat und noch viel später, im Gefolge der Niederlage im Ersten Weltkrieg und der Revolution von 1918/19, eine Demokratie wurde. Zum anderen frage ich, welche Folgen diese doppelte Verspätung hatte und bis heute hat.
Dies ist eine politische Geschichte, aber keine der herkömmlichen Art. Von diplomatischen Haupt- und Staatsaktionen ist eher am Rande, von Schlachten so gut wie gar nicht die Rede. Ereignisse spielen eine große Rolle, aber nicht so sehr um ihrer selbst als um der Bedeutung willen, die ihnen die Zeitgenossen und die Nachlebenden beimaßen. Mein besonderes Augenmerk gilt also den Geschichtsdeutungen, die die Menschen bewegten und die in die politischen Entscheidungen einflossen. Derartige Deutungen waren und sind immer umstritten, also Gegenstand von Diskursen. Meine Darstellung ist mithin auch als Diskursgeschichte angelegt.
Zeichnen heiße weglassen, hat der Maler Max Liebermann sinngemäß bemerkt. Ich lasse vieles weg und konzentriere mich auf das, was mir im Hinblick auf die Leitfrage wichtig erscheint. Es versteht sich von selbst, daß eine andere Leitfrage eine andere Problemauswahl und eine andere Gewichtung von Tatsachen und Meinungen bewirken würde.
Historische Darstellungen bedürfen eines Fluchtpunkts. Fluchtpunkte ändern sich im Verlauf der Zeit. Für Darstellungen der jüngeren deutschen Geschichte bildeten nach dem Zweiten Weltkrieg die Jahre 1933 oder 1945 die Fluchtpunkte, auf die hin deutsche Geschichte geschrieben wurde. Inzwischen gibt es einen neuen Fluchtpunkt: das Jahr 1990. Er wird erst im zweiten Band erreicht werden, der die Zeit vom «Dritten Reich» bis zur Wiedervereinigung behandelt. Aber der Fluchtpunkt «1990» hat auch bereits Einfluß auf die Perspektive des ersten Bandes, der bis zum Untergang der ersten deutschen Demokratie, der Weimarer Republik, und damit bis zur Schwelle des «Dritten Reiches» führt.
Warum es zur Herrschaft Hitlers kam, ist immer noch die wichtigste Frage der deutschen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, wenn nicht der deutschen Geschichte überhaupt. Doch daneben steht seit 1990 eine andere Frage: Warum fand die deutsche Frage ihre Antwort in der Wiedervereinigung? Die Frage läßt sich auch anders formulieren: Warum gibt es seit 1990 und erst seit jenem Jahr keine deutsche Frage mehr?
Das Jahr 1990 als letzten Fluchtpunkt wählen heißt auch manche Deutungen überprüfen, die die deutsche Geschichte zwischen 1945 und 1990 erfahren hat. Da es mittlerweile wieder einen deutschen Nationalstaat gibt (wenn auch keinen «klassischen», sondern einen «postklassischen», fest in Europa eingebundenen), kann die deutsche Geschichte nicht länger als Widerlegung eines deutschen Nationalstaates oder gar des Nationalstaates schlechthin verstanden werden. Der erste, 1871 entstandene deutsche Nationalstaat gehört also nicht nur zur Vorgeschichte von 1933, sondern auch von 1990. Er trägt, mit anderen Worten, beides in sich: die Ursachen seines Scheiterns in der «deutschen Katastrophe» der Jahre 1933 bis 1945 und zugleich vieles von dem, was in die Grundlegung des zweiten deutschen Nationalstaates eingegangen ist. Ich nenne nur die Stichworte Rechtsstaat, Verfassungsstaat, Bundesstaat, Sozialstaat, allgemeines Wahlrecht und Parlamentskultur. Und was nur selten bedacht wird: Durch den Zwei-plus-Vier-Vertrag von 1990 wurde Bismarcks «kleindeutsche Lösung» zumindest insoweit bestätigt, als diese eine Absage an die «großdeutsche Lösung» des deutschen Problems, die Lösung mit Österreich, war.
Gegen Ende des ersten Bandes wird deutlich werden, daß die Deutschen am Vorabend der Machtübertragung an Hitler nicht nur der Demokratie von 1918/19 überdrüssig, sondern auch mit dem kleindeutschen Nationalstaat von 1871 unzufrieden waren. Das gebildete Deutschland war fasziniert von der Idee eines Reiches, das Österreich einschloß und Mitteleuropa beherrschte – eines Gebildes, das etwas anderes und mehr sein wollte als ein gewöhnlicher Nationalstaat. Die Ursachen dieses Reichsmythos reichen tief in die deutsche Vergangenheit zurück. Das erste Kapitel des ersten Bandes dieser deutschen Geschichte vom Ende des Alten Reiches bis zur Wiedervereinigung beginnt mit der Frage nach den mittelalterlichen Ursprüngen dieses Mythos. Im zweiten Band wird die Frage erörtert, was nach 1945 an die Stelle des Reichsmythos trat, nachdem dieser, zusammen mit dem Deutschen Reich, untergegangen war. War es eine bestimmte «postnationale» Idee von Europa? War es, anders gewendet, der Gedanke einer neuen deutschen Sendung: einer für ganz Europa vorbildlichen Überwindung von Nation und Nationalstaat?
In der Vorrede zu seinen «Geschichten der romanischen und germanischen Völker von 1494 bis 1535» hat Leopold von Ranke sich und damit dem Geschichtsschreiber die Aufgabe zugewiesen, er solle «bloß sagen, wie es eigentlich gewesen ist». Nach Hitler kann man Geschichte so wohl nicht mehr schreiben. Die Frage sollte eher lauten, warum es eigentlich so gekommen ist. Als Leserin oder Leser dieses und des folgenden Bandes stelle ich mir jemanden vor, der ebendies wissen möchte, also nicht nur Fachhistoriker.
Ich versuche, soweit das möglich ist, auf Quellen zurückzugreifen (und das ist nicht die einzige Hinsicht, in der Ranke durchaus noch nicht überholt ist). Ich sehe in der Erzählung keinen Gegensatz zur Erklärung, sondern deren angemessene Form. Die Anmerkungen enthalten neben Zitatbelegen auch Hinweise auf ausgewählte Literatur – ausführlicher dort, wo es um die Kernfragen des Buches geht, aber nirgendwo auf das ohnehin utopische Ziel der Vollständigkeit ausgerichtet.
Danken möchte ich an dieser Stelle Frau Teresa Löwe und Herrn Sebastian Ullrich, die an den Kolumnentiteln zu den Abschnitten der einzelnen Kapitel mitgearbeitet, Korrekturen gelesen und das Personenregister erstellt haben. Frau Gretchen Klein hat meine handschriftliche Vorlage in ein druckfertiges Manuskript verwandelt. Ihrer Umsicht und Geduld verdankt dieser Band viel. Der Cheflektor des Verlages C.H.Beck, Herr Dr. Ernst-Peter Wieckenberg, war wiederum, wie schon bei meinen früheren, bei Beck erschienenen Büchern, ein bewundernswert gründlicher und kritischer Leser des Manuskripts. Beiden danke ich herzlich.
Ich widme diesen Band meiner Frau. Im Gespräch mit ihr hat das Buch die ersten Umrisse und schließlich die fertige Gestalt angenommen. Ohne ihren Zuspruch und ihre Kritik wäre es nicht entstanden.
Berlin, im November 1999 Heinrich August Winkler
1.
Prägungen: Das Erbe eines Jahrtausends
Im Anfang war das Reich: Was die deutsche Geschichte von der Geschichte der großen westeuropäischen Nationen unterscheidet, hat hier seinen Ursprung. Im Mittelalter trennten sich die Wege. In England und Frankreich begannen sich damals Nationalstaaten herauszuformen, während sich in Deutschland der moderne Staat auf einer niedrigeren Ebene, der territorialen, entwickelte. Gleichzeitig bestand ein Gebilde fort, das mehr sein wollte als ein Königreich unter anderen: das Heilige Römische Reich. Daß Deutschland später als Frankreich und England ein Nationalstaat und noch später eine Demokratie wurde, hat Gründe, die weit in die Geschichte zurückreichen.[1]
Vom Reich und dem Mythos, der sich darum rankte, soll also zuerst die Rede sein. Das Reich ist eine von drei Grundtatsachen, die die deutsche Geschichte durch viele Jahrhunderte hindurch prägten. Die zweite ist die Glaubensspaltung des 16. Jahrhunderts, die entscheidend dazu beitrug, daß Deutschland im Jahrhundert darauf zum Schauplatz eines dreißigjährigen europäischen Krieges wurde. Die dritte Grundtatsache ist der Gegensatz zwischen Österreich und Preußen, der das Heilige Römische Reich Deutscher Nation in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts vielen nur noch als eine leere Hülse erscheinen ließ.
Ein Mythos war das Reich schon immer gewesen. Mittelalterliche Autoren bemühten sich um den Nachweis, daß das römische Reich nie aufgehört habe zu bestehen. Es war zwar im Jahre 395 nach Christi Geburt in ein ost- und ein weströmisches Reich geteilt worden. Doch als das weströmische Reich 476 in den Stürmen der Völkerwanderung unterging, gab es immer noch das oströmische Reich mit der Hauptstadt Konstantinopel, dem einstigen griechischen Byzantion. Der Anspruch des oströmischen Basileus, der römische Kaiser zu sein, wurde im Abendland allerdings immer weniger anerkannt, zumal seit dem Ende des 8. Jahrhunderts eine Frau, die Kaiserinwitwe Irene, auf dem byzantinischen Thron saß. Als Papst Leo III. am Weihnachtstag des Jahres 800 Karl den Großen, den König der Franken und Langobarden und Schutzherrn des von seinem Vater Pippin geschaffenen Kirchenstaates, unter den jubelnden Zurufen der Römer zum Kaiser krönte, ging das römische Kaisertum von den Griechen auf die Franken (oder, wie es später hieß, auf die Deutschen) über.
So jedenfalls sahen es die Verfechter der mittelalterlichen Lehre von der «translatio imperii», der Übertragung des römischen Reiches. Sie hatten einen triftigen Grund, die Kontinuität dieses Reiches zu betonen. Der frühchristlichen Tradition folgend, die sich ihrerseits auf den Propheten Daniel berief, betrachteten sie nämlich das römische Reich als das vierte und letzte der Weltreiche. Vorausgegangen waren das babylonische, das medisch-persische und das mazedonische Weltreich: eine Abfolge, die räumlich eine Verlagerung des Weltgeschehens von Ost nach West, vom Sonnenaufgang zum Sonnenuntergang, bedeutete. Solange das Imperium Romanum bestand – das westlichste der Weltreiche, das sich schon im vierten Jahrhundert nach Christus zum Imperium Christianum gewandelt hatte –, solange würde der Antichrist nicht erscheinen. Der Antichrist war laut der Offenbarung des Johannes ein Tyrann und falscher Prophet, gemäß der mittelalterlichen Lesart, die auf den Kirchenvater Hieronymus zurückging, überdies ein Jude und das Haupt der Häretiker. Seine Herrschaft bedeutete nach der neutestamentlichen Prophezeiung das Ende aller weltlichen Geschichte: Christus würde wiederkehren, den Antichrist, der sich als Gott ausgab, besiegen und das Gottesreich errichten. Dem römischen Reich fiel aus dieser endzeitlichen Sicht die Rolle des «Katechon» zu – der Kraft, die dem zweiten Kapitel des zweiten Briefes an die Thessalonicher zufolge den Widersacher Christi und damit den Weltuntergang noch aufhielt. Daß dieser Text wahrscheinlich unecht, der Apostel Paulus also nicht der Verfasser des Briefes ist: diese Erkenntnis beginnt sich erst in der modernen Theologie durchzusetzen.[2]
Im Sinne der Kontinuitätsthese war es ferner wichtig, die Kaiserkrönung des Sachsenkönigs Otto des Großen durch Papst Johann XII. im Jahre 962 nicht als eine neue Reichsgründung erscheinen zu lassen. Das Frankenreich war zwar 843 durch den Vertrag von Verdun geteilt worden, und nach der Ermordung des letzten Kaisers aus fränkischem Reichsadel im Jahre 924 hatte es fast vier Jahrzehnte lang keinen weströmischen Kaiser mehr gegeben. Aber immerhin waren die Ostfranken an der Königswahl von Ottos Vater, Heinrich I., im Jahr 919 entscheidend beteiligt gewesen. Bischof Otto von Freising, der Onkel und Berater des Stauferkaisers Friedrich Barbarossa, sprach daher um die Mitte des 12. Jahrhunderts mit Blick auf 962 von einer Rückübertragung: Das Reich der Römer sei nach den Franken und Langobarden an die Deutschen («ad Teutonicos») oder, wie es sich anderen darstelle, an die Franken, denen es gewissermaßen entglitten sei, wieder übertragen worden («retranslatum est»).[3]
Als Otto der Große zum Kaiser gekrönt wurde, war von «Deutschen» freilich noch keine Rede. Erst um die Jahrtausendwende häuften sich in den Quellen die latinisierenden Bezeichnungen «teutonici» und «teutones», mit denen nicht etwa die alten Teutonen, sondern die zeitgenössischen «Deutschen» gemeint waren: Menschen verschiedener Stammesherkunft, die zumindest das eine Merkmal gemeinsam hatten, daß sie «deutsch» sprachen. Früher als um 1000 wird man die Anfänge einer deutschen Nationsbildung also kaum ansetzen können. In der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts politisierte sich dann der Inhalt des Begriffs «deutsch». Papst Gregor VII., der Gegner König Heinrichs IV. aus dem fränkischen Haus der Salier im ersten großen Ringen zwischen geistlicher und weltlicher Macht, dem Investiturstreit um die Einsetzung der Bischöfe, nannte seinen Widersacher häufig den «rex Teutonicorum», den «König der Deutschen». Er wollte damit deutlich machen, daß ein vom Papst nicht geprüfter und gekrönter deutscher König allenfalls Herrscher über sein Volk, nicht jedoch römischer Kaiser sein könne. Das war als Demütigung gemeint und entsprach ganz dem Verhalten Gregors in Canossa: Vor dieser Burg am Nordabhang des Apennin ließ er im Januar 1077 Heinrich drei Tage lang im Büßergewand ausharren, ehe er den gegen ihn verhängten päpstlichen Bann aufhob. Nördlich der Alpen aber wurde die Bezeichnung «regnum Teutonicorum» («Königreich der Deutschen») alsbald ins Positive gewendet: ein Zeichen von wachsendem Zusammengehörigkeitsgefühl und Selbstbewußtsein.[4]
Doch begnügen wollten sich die deutschen Könige mit ihrem Königreich nicht. Der Begriff «regnum Teutonicorum» bezog sich auf einen Teil ihres Herrschaftsgebietes, die «deutschen Lande», nicht aber auf Burgund, das seit 1034 zum Reich gehörte, und Reichsitalien. Als Herrscher über das Gesamtreich benötigten die deutschen Könige den Kaisertitel. Die Bezeichnungen «Imperium» und «Imperator» schlossen keineswegs notwendigerweise einen Anspruch auf Amtsgewalt über Staaten in sich, die nicht zum Reich gehörten. Eine besondere «dignitas», eine protokollarische Vorrangstellung unter den Königen des Abendlandes, aber beanspruchten die mittelalterlichen Kaiser durchaus. Solange sie sich darauf beschränkten, wurde dieser Anspruch auch in Frankreich und England nicht bestritten: Als Schutzherr der christlichen Kirche, und nur auf Grund dieser Aufgabe, war der Kaiser ein Herrscher von höherer Würde als die anderen Herrscher.[5]
In der Stauferzeit aber gewannen westliche Beobachter den Eindruck, daß der deutsche Kaiser doch mehr sein wollte als der Erste unter Gleichen. Als Friedrich I. 1160 auf einer vom Reichsepiskopat dominierten, mithin keineswegs allgemeinen Kirchenversammlung in Pavia einen «Papst» (oder vielmehr: Gegenpapst) anerkennen ließ, für den sich zuvor im Kardinalskollegium in Rom nur eine Minderheit kaisertreuer Kardinäle ausgesprochen hatte, erhob einer der bekanntesten Kirchenmänner der Zeit Protest. «Wer hat die allgemeine Kirche dem Urteil einer Partikularkirche unterworfen?» fragte Johann von Salisbury, der Bischof von Chartres. «Wer hat die Deutschen zu Richtern der Nationen bestellt? (Quis Teutonicos constituit iudices nationum?) Wer hat diesen rohen und gewalttätigen Menschen jene Vollmacht gegeben, nach ihrem Belieben einen Fürsten zu setzen über die Häupter der Menschenkinder?»[6]
Der englische Widerspruch aus Chartres war auch ein Echo auf das, was man mit einem modernen Ausdruck die staufische Reichsideologie nennen kann. Im Jahre 1157 kam in der Kanzlei Kaiser Friedrichs I. die Formel vom «Sacrum Imperium», dem «Heiligen Reich», auf. Staufische Propagandisten wiesen den Herrschern der übrigen Königreiche den Rang bloßer Kleinkönige («reguli») zu. In den Gedichten des Archipoeta, eines Dichters aus der Umgebung des kaiserlichen Kanzlers Rainald von Dassel, und im «Spiel vom Antichrist», das um 1160 im Kloster Tegernsee entstand, wurde gar der Gedanke einer deutschen Weltherrschaft beschworen. Die Rechtfertigung dieses Anspruchs sah der unbekannte Autor in einer besonderen heilsgeschichtlichen Sendung der Deutschen: Als Kern des Gottesvolkes würden sie als letzte dem Antichrist, dem Feind des Vaterlandes, Widerstand leisten.[7]
In der praktischen Politik Friedrichs I. spielten solche Ideen noch keine Rolle. Doch unrealistisch und verhängnisvoll darf man die Machtpolitik Barbarossas gegenüber dem Papsttum, ja seine gesamte Italienpolitik durchaus nennen. Und was sein Sohn, Kaiser Heinrich VI. (1190–1197), erreichte und erstrebte, rechtfertigt es, von staufischer Weltpolitik zu sprechen. Durch Heirat fiel Heinrich der Anspruch auf die Herrschaft in Sizilien zu – ein Anspruch, den er mit militärischen Mitteln durchsetzte. Den englischen König Richard Löwenherz, den er bei dessen Rückkehr vom Dritten Kreuzzug gefangennehmen ließ, zwang er, sein Land vom Reich als Lehen zu nehmen. Er sicherte sich die Oberhoheit über Armenien, Tunis und Tripolis, erwarb staufische Erbansprüche auf Byzanz und dachte wohl an die Eroberung des oströmischen Reiches. Frankreich in ein abhängiges Verhältnis vom Reich zu bringen, gelang ihm nicht. Aber es muß offen bleiben, ob er, gestützt auf Erfolge im Osten, nicht auch im Westen den Weg der Eroberung beschritten haben würde. Sein früher Tod verweist die Frage in den Bereich der Spekulation. Ebenso muß offen bleiben, ob es Heinrich, hätte er länger gelebt, doch noch gelungen wäre, ein anderes ehrgeiziges Vorhaben zu verwirklichen: die Errichtung eines staufischen Erbkaisertums.[8]
Die kurze Regierungszeit Heinrichs VI. markiert den Umschwung der mittelalterlichen Reichsgeschichte. Hatte Heinrich das übrige Europa von sich abhängig machen wollen, so wurde über den Regierungsantritt seines Sohnes, Friedrichs II., nach einem siebzehnjährigen, von Doppelkönigtum und Bürgerkrieg geprägten Intervall von anderen europäischen Mächten entschieden: Die Würfel fielen 1214 auf dem Schlachtfeld von Bouvines, wo französische und englische Ritterheere aufeinandertrafen. Die militärische Niederlage der Engländer war zugleich die endgültige politische Niederlage ihres deutschen Verbündeten, Kaiser Ottos IV. aus dem Haus der Welfen, des Sohnes von Friedrich Barbarossas langjährigem Widersacher, Heinrich dem Löwen.
Der Staufer Friedrich II. aber, der 1215 in Aachen zum deutschen König und 1220 in Rom zum Kaiser gekrönt wurde, war sehr viel mehr ein sizilianischer als ein deutscher Herrscher. Das wichtigste Ergebnis seiner Regierungszeit war, was Deutschland angeht, der Verzicht auf die Ausübung königlicher Hoheitsrechte wie des Zoll- und Münzrechts zugunsten der geistlichen und weltlichen Fürsten, niedergelegt in der «Confoederatio cum principibus ecclesiasticis» von 1220 und dem «Statutum in favorem principum» von 1232, das sich vor allem gegen die Städte und damit gegen das durch «Stadtluft» freie, dem Zugriff der Feudalherren entzogene Bürgertum richtete.
Die Fürsten, die schon während des Investiturstreits als zeitweilige Verbündete des Papstes im Kampf gegen den deutschen König an Macht gewonnen hatten, gingen aus der Krise des hochmittelalterlichen Reiches als die eigentlichen Sieger hervor. Die Urkunden von 1220 und 1232 festigten die territorialstaatliche Entwicklung Deutschlands. Doch eingesetzt hatte diese Entwicklung früher, im 12. Jahrhundert, und zwar mehr durch Landesausbau in Gestalt von Siedlung und Verdichtung von Herrschaft als durch Übertragung königlicher Rechte. Das galt für die altdeutschen Gebiete im Westen, Süden und Norden wie für die neuen Territorien östlich der Elbe, die im Gefolge von Eroberung, Slawenmission und Ostkolonisation «eingedeutscht» wurden. Verfassungsgeschichtlich gesehen war die Schlacht von Bouvines, die Friedrichs II. Herrschaft in Deutschland ermöglichte, also nur ein Wendepunkt unter anderen.[9]
Sehr viel einschneidender waren die Konsequenzen der Schlacht für Frankreich und England. In Frankreich bedeutete der Sieg des Königs über die Engländer und ihren Verbündeten, Kaiser Otto, auch eine Stärkung seiner Position im Innern: Die bislang mächtigen Thronvasallen verloren an Einfluß zugunsten der Monarchie, die den Prozeß der nationalen Zentralisation vorantrieb. Ganz andere Auswirkungen hatte die Schlacht von 1214 für England: Der geschwächte König mußte in der Magna Charta von 1215 Adligen und Bürgern weitgehende Rechte und Freiheiten zugestehen und in einen gewählten Ausschuß der Barone einwilligen, der Kontrollbefugnisse gegenüber dem Träger der Krone hatte. Damit war der Grund für die Entwicklung Englands zum Verfassungsstaat gelegt.[10]
Das altdeutsche Kaisertum hatte seinen Höhepunkt längst überschritten, als die mittelalterliche Reichsideologie ihre Blütezeit erlebte. Der Kölner Kanoniker Alexander von Roes hielt es in seinem 1289 verfaßten «Memoriale de prerogativa Romani imperii», einem vielgelesenen und einflußreichen Traktat, für das Erfordernis einer sinnvollen und notwendigen Ordnung, daß die Römer als die Älteren das Papsttum («sacerdotium»), die Deutschen oder Franken («Germani vel Franci») als die Jüngeren das Kaisertum («imperium») und die Franzosen oder Gallier wegen ihres besonders ausgeprägten Scharfsinns das Studium der Wissenschaften («studium») als Aufgabe erhalten hätten.[11] Der Autor stellte diese Forderung aus der Defensive heraus – in Abwehr von Versuchen, einen französischen Anspruch auf das Kaisertum zu begründen. Mit der von ihm befürworteten Arbeitsteilung zwischen den Nationen sich abzufinden, kam jedoch in Frankreich niemandem in den Sinn. Es las sich fast wie eine Entgegnung auf Alexander von Roes, als ein anonymer Jurist in einem Gutachten für Philipp den Schönen um 1296 dem König von Frankreich bescheinigte, was französische Gelehrte schon im 12. Jahrhundert behauptet hatten: In seinem Königreich sei er Kaiser. «Und weil der König von Frankreich vor dem Kaiser da war, kann er um so vornehmer genannt werden.»[12]
Auf einem Gebiet aber gab es, theoretisch jedenfalls, Übereinstimmung zwischen den weltlichen Herrschern des Abendlandes: in der Zurückweisung dessen, was Eugen Rosenstock-Huessy, einer der letzten deutschen Universalhistoriker des 20. Jahrhunderts, 1931 in seinem Buch über die europäischen Revolutionen die «Papstrevolution» genannt hat. Papst Gregor VII. hatte mit dem «Dictatus Papae» von 1075 das Manifest dieser Revolution verfaßt. Gregors Postulat, daß der Papst den Kaiser absetzen könne, mochte zunächst zwar nur die Praxis der Kaiser auf den Kopf stellen. Die Behauptung, nur der Papst könne Bischöfe absetzen oder versetzen, war dagegen ebenso eine Kampfansage an die Könige von Frankreich und England wie an den Kaiser. Da die Bischöfe nicht nur geistliche Würdenträger, sondern in Personalunion auch die höchsten Beamten der Krone waren, wäre in allen drei Ländern das bisherige politische System zusammengebrochen, wenn sich der Papst durchgesetzt hätte. Tatsächlich errang die Kurie nur einen Teilerfolg. Seit dem frühen 12. Jahrhundert wurden (zuerst in Frankreich, dann in England, seit dem Wormser Konkordat von 1122 auch in Deutschland) die Bischöfe entsprechend dem kanonischen Recht, aber in Gegenwart des weltlichen Herrschers gewählt, so daß dieser seinen Einfluß weiterhin geltend machen konnte.
Der Investiturstreit war nur eine Etappe in der Auseinandersetzung zwischen geistlicher und weltlicher Macht. Im Jahre 1302 bekräftigte Papst Bonifaz VIII. den Standpunkt der Kurie, daß das Papsttum allen Herrschern übergeordnet sei. In der Hand des Papstes seien, so hieß es in der gegen König Philipp den Schönen von Frankreich gerichteten Bulle «Unam Sanctam», zwei Schwerter, ein geistliches und ein weltliches. Beide seien also in der Gewalt der Kirche, nur daß das geistliche Schwert von der Kirche, das weltliche aber für die Kirche geführt werde.[13]
Die werdenden Nationalstaaten Frankreich und England antworteten auf die päpstliche Herausforderung mit einer weitgehenden Nationalisierung der Kirche, wobei eine rigorose Beschränkung der päpstlichen Steuereinnahmen aus Kirchengut den Anfang bildete. Das römisch-deutsche Kaisertum konnte den nationalen Weg nicht beschreiten, ohne seinen eigenen universalen Anspruch zu gefährden und die deutschen Fürsten auf den Plan zu rufen, von denen manche selbst danach strebten, «Papst» in ihrem Lande zu sein, also ein Landeskirchentum auszubilden.[14] Auf den weltlichen Machtanspruch der Kirche (und ihre Instrumentalisierung durch Frankreich in der Zeit des Avignonesischen Papsttums von 1309 bis 1377) reagierte die kaiserliche «Partei» zunächst ideologisch: Der italienische Staatsdenker Marsilius von Padua und der englische Franziskaner Wilhelm von Ockham, beide publizistische Helfer Kaiser Ludwigs des Bayern (1314–1347), leiteten in gelehrten Abhandlungen die Übertragung des römischen Reiches «von den Griechen auf die Deutschen» im Jahr 800 aus dem Willen des römischen Volkes ab und stellten damit der kurialen Auffassung von der «translatio imperii» durch den Papst, «ex cathedra» formuliert von Innozenz III. in der Bulle «Venerabilem» aus dem Jahre 1202, eine demokratische Doktrin entgegen. Doch die Idee der Volkssouveränität widersprach der Wirklichkeit des «Sacrum Imperium» so radikal, daß das Konstrukt folgenlos blieb.[15]
Folgenreich war dagegen die Antwort der deutschen Mystiker, beginnend mit Meister Eckhart (um 1250–1327), auf die Verweltlichung der Kirche: die Wendung nach innen. Alois Dempf hat in seinem 1929 erschienenen Buch über das «Sacrum Imperium» den Kampf um die Vertiefung und Verlebendigung der Frömmigkeit in Deutschland als das Gegenstück zur «politischen Reformation» in Frankreich und England interpretiert und es als die weltgeschichtliche Nebenwirkung der deutschen Mystik bezeichnet, daß sie eine «Frömmigkeit ohne Priestertum zu einer weitgreifenden Frömmigkeitsbewegung» gemacht habe. Die Mystik als Wegbereiterin der Reformation: der junge Luther wußte, an welche Traditionen er anknüpfte.[16]
Die Entfremdung von Rom, die in der Mystik angelegt war, aber auf die religiöse Sphäre beschränkt blieb, steigerte sich im 15. Jahrhundert zu einer Frühform von deutschem Nationalbewußtsein. In der Abwehr kirchlicher Geldforderungen trafen sich Kaiser und Reichsstände, und es war ein Ausdruck des Bewußtseins dieser Gemeinsamkeit, daß die entsprechenden Klagen seit etwa 1440 unter dem Begriff «Gravamina nationis Germanicae» zusammengefaßt wurden. Der Name «Römisches Reich Deutscher Nation» wurde erstmals 1486 in einem Reichsgesetz, der Name «Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation» in voller Form erstmals im Kölner Reichstagsabschied von 1512 verwandt. Der Zusatz bedeutete ursprünglich keine Gleichsetzung von römischem Reich und deutscher Nation, sondern eine Einschränkung: Gemeint waren die «deutschen Lande» als Teil, freilich auch als Kern des Reiches, abgehoben von den Teilen «welscher», also italienischer Nation.
Damit bekam der Begriff «Nation» einen neuen Inhalt. Hatte er zuvor an Universitäten, auf Konzilien und bei der Organisation ausländischer Kaufleute in westeuropäischen Handelsstädten als (durchaus pragmatisch gehandhabtes) Mittel der Gruppeneinteilung gedient, so stieg er im 15. Jahrhundert zu einem allgemeinen Mittel der politischen Welteinteilung auf. Für den deutschen Begriff von «Nation» war dabei die Gemeinsamkeit der Sprache («Gezunge») der bestimmende Gesichtspunkt: ein Rückgriff, der nahe lag, wenn man bedenkt, daß die «deutsche Nation» keine irgendwie geartete Verwaltungseinheit bildete. In Frankreich und England dagegen ging die Nationsbildung von der Monarchie aus, was dem Begriff «Nation» einen in Deutschland nicht möglichen Bezug auf den Staat gab.
Den Begriff «deutsche Nation» bemühte der Kaiser, wann immer es ihm darum ging, die Reichsstände mit den Kurfürsten an der Spitze für gemeinsame Anstrengungen zu gewinnen. Doch die sieben Kurfürsten – die Erzbischöfe von Trier, Köln und Mainz, der König von Böhmen, der Pfalzgraf bei Rhein, der Herzog von Sachsen und der Markgraf von Brandenburg – hatten Grund zu der Annahme, daß nicht alles, was der von ihnen gewählte «römische König» für richtig hielt, im Interesse von Reich und Nation lag. Seit 1438 standen Herrscher aus dem Hause Habsburg an der Spitze des Reiches, und die dynastischen Interessen der Habsburger mußten keineswegs mit dem Interesse des Reiches oder der deutschen Nation übereinstimmen.[17]
Umgekehrt lag durchaus nicht notwendigerweise im Interesse des Reiches, worauf sich, was selten genug geschah, die Kurfürsten einigten. Sie waren zwar durch die Goldene Bulle, das Reichsgrundgesetz von 1356, als Mitträger des Reiches anerkannt. Aber zur «Nation» gehörten auch die anderen Fürsten und sonstigen Reichsstände, die auf Politik und Gesetzgebung des Reiches sehr viel weniger Einfluß hatten, ganz zu schweigen von den Städten, die auf den Reichstagen des 15. Jahrhunderts kein Stimmrecht hatten, aber von den Reichssteuern am stärksten belastet wurden. Daß das Reich einer grundlegenden Reform bedurfte, war Einsichtigen schon zu Beginn des 15. Jahrhunderts bewußt gewesen. Was jedoch unter den Kaisern Friedrich III. (1440–1493) und Maximilian I. (1493–1519) an Änderungen tatsächlich zustande kam, verdiente kaum den Namen «Reichsreform». Die Staatsbildung erfolgte in Deutschland nicht im Reich, sondern in den Territorien. Die Landesherren bedienten sich hierbei zunehmend des Römischen Rechts und juristisch geschulter Beamten, die dieses Recht anzuwenden verstanden. Besonders konsequente Erneuerer ihrer Herrschaft waren die Fürsten an der Spitze der größeren Territorien – jener Territorien, die durch ihr Desinteresse eine wirksame Reform des Reiches verhinderten.[18]
Der eher tristen Gegenwart des Reiches setzten die deutschen Humanisten vor und nach 1500 den Aufruf zur Wiederherstellung des alten Glanzes entgegen. Grund zur Hoffnung gab ihnen die Rückbesinnung auf eine weit zurückliegende Vergangenheit, die Zeit der «Germania magna», in der die Nationen germanischen Ursprungs sich noch nicht voneinander getrennt hatten. Unter Berufung auf Tacitus, dessen «Germania» 1455 wiederentdeckt worden war, zeichneten sie ein verklärendes Bild deutscher Tugenden, das sich vorteilhaft vom verzerrten Gegenbild abhob: der Verderbtheit der seit langem schon entarteten Römer. Vom republikanischen Rom, nicht von dem der Caesaren, konnten die Deutschen, die die Nachfolge des römischen Reiches angetreten hatten, Vaterlandsliebe lernen. Größe und Würde des Reiches rührten aus dieser Nachfolge her, die rechtens und verdient war, wobei die Autoren häufig nicht davor zurückscheuten, sich auf die Bulle «Venerabilem» von Papst Innozenz III. zu berufen, wenn es galt, die These zu belegen, daß das römische Reich im Jahr 800 von den Griechen auf die Deutschen in der Person Karls des Großen übertragen worden sei. Der Anspruch, der sich daraus ergab, nahm bei manchen der deutschen Humanisten staufische Ausmaße an: So richtete Sebastian Brant aus dem oberrheinischen Humanistenkreis 1494 in seinem «Narrenschiff» an Gott die Bitte, er möge das römische Reich so groß machen, «das im all erd sy underthon/ als es von recht und gsatz solt han.»[19]
Martin Luther war auch in dieser Hinsicht kein deutscher Humanist. Das erste römische Reich war, wie er 1520 in seiner Schrift «An den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung» darlegte, durch die Goten zerstört worden. Jenes römische Reich aber, an dessen Spitze der Kaiser zu Konstantinopel stand, hätte der Papst nie an die Deutschen übertragen dürfen. Daß er es dennoch tat, war «Gewalt und Unrecht» und hatte zur Folge, daß die Deutschen «des Papstes Knechte» wurden. Doch schon Luther kannte die List der Vernunft und die normative Kraft des Faktischen. Für ihn war gewiß, «daß Gott die Papstbosheit hierin hat gebraucht, deutscher Nation ein solch Reich zu geben und nach dem Fall des ersten Römischen Reiches ein anderes, das jetzt steht, aufzurichten». So wollte Luther denn auch nicht raten, «dasselbe fahren zu lassen, sondern in Gottesfurcht, so lange es ihm gefällt, es redlich (zu) regieren. Denn, wie gesagt, es liegt ihm nichts daran, wo ein Reich herkommt, er will’s dennoch regiert haben. Haben’s die Päpste unredlich andern genommen, so haben wir’s doch nicht unredlich gewonnen … Es ist alles Gottes Ordnung, welche eher ist geschehen, denn wir drum haben gewußt.»[20]
Wir sind bei der zweiten der Grundtatsachen angelangt, die die deutsche Geschichte prägen: der Reformation. «Die alte und durch und durch bewahrte Innigkeit des deutschen Volkes hat aus dem einfachen, schlichten Herzen diesen Umsturz zu vollbringen», erklärte Hegel um 1830 in seinen Vorlesungen zur Philosophie der Geschichte. Für Hegel war die Reformation «die Alles verklärende Sonne», das Ereignis, durch das «der subjektive Geist in der Wahrheit frei» und «die christliche Freiheit wirklich» wurde. Daraus ergab sich für ihn der «wesentliche Inhalt der Reformation; der Mensch ist durch sich selbst bestimmt, frei zu sein».[21]
Eine radikal entgegengesetzte Ortsbestimmung der Reformation nahm um die Jahreswende 1843/44 Marx in seiner Einleitung zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie vor: Luther habe «den Glauben an die Autorität gebrochen, weil er die Autorität des Glaubens restauriert hat. Er hat die Pfaffen in Laien verwandelt, weil er die Laien in Pfaffen verwandelt hat. Er hat die Menschen von der äußeren Religiosität befreit, weil er die Religiosität zum inneren Menschen gemacht hat. Er hat den Leib von der Kette emanzipiert, weil er das Herz in Ketten gelegt.»[22] Womöglich noch radikaler war die Absage, die Nietzsche 1888 im «Antichrist» der Deutung Hegels erteilte. «Die Deutschen haben Europa um die letzte große Kultur-Ernte gebracht, die es für Europa heimzubringen gab – die Renaissance.» Cesare Borgia als Papst: für Nietzsche wäre das «der Sieg», die Abschaffung des Christentums gewesen. Luther aber, «dieser Mönch, mit allen rachsüchtigen Instinkten eines verunglückten Priesters im Leibe, empörte sich in Rom gegen die Renaissance … Und Luther stellte die Kirche wieder her: er griff sie an … Die Renaissance – ein Ereignis ohne Sinn, ein großes Umsonst!»[23]
Die deutsche Reformation war beides: Befreiung von kirchlichem, zunehmend als römische Fremdherrschaft empfundenem Zwang und Begründung eines neuen, verinnerlichten, staatstragenden Zwangs. Sie bewirkte Emanzipation und Repression in einem und damit, wie Marx bemerkte, nur eine teilweise Überwindung des Mittelalters. Engels irrte fundamental, als er sie die «Revolution Nr. 1 der Bourgeoisie» nannte.[24] Sozialgeschichtlich war die Reformation sehr viel eher, am deutlichsten in der Schweiz, in Ober- und Mitteldeutschland, eine Erhebung des «gemeinen Mannes» in Land und Stadt mit dem Bauernkrieg von 1524/25 als Höhepunkt.[25]
Unter dem Gesichtspunkt der politischen Wirkungen aber trifft auf die Reformation vor allem Rosenstock-Huessys Begriff der «Fürstenrevolution» zu: «Die große Hierarchie der sichtbaren Kirche hat ihr Pathos verloren. Die Seele ist nicht mehr da, wo der Klerus sie sucht. Die Erziehungsarbeit der Kirche kann daher getrost den Bischöfen jedes Orts und Landes überlassen werden, und dieser Bischof ist die weltliche Obrigkeit. Luthers Kurfürst ersetzt den obersten Bischof … Wohl in keinem anderen Lande der Welt haben daher zwei so verschiedene Gesichtskreise übereinander bestanden wie bei uns. Oben kämpfen Fürst und Staatsmann um ihr Recht und ihre Freiheit als Obrigkeit. Unten leben und lernen Bürger und Bauern die reine Lehre und den Gehorsam gegen die Obrigkeit im Kreise ihres beschränkten Untertanenverstandes … Dies ‹Unpolitische› des Durchschnittsdeutschen liegt in der freiwilligen Arbeitsteilung zwischen Luther und seinem Landesherrn bereits angelegt.»[26]
Ein landesherrliches Kirchenregiment hatte sich schon in vorreformatorischer Zeit herausgebildet, und Luther setzte die Reformation nicht in Gang, um den Landesherrn (entsprechend einer seit langem gängigen Formel) vollends zum «Papst in seinem Lande» zu machen. Ausgegangen war Luther vom Gedanken eines allgemeinen, ebenso individualistischen wie egalitären Laienpriestertums. In der Annahme, das Ende der Welt sei nahe und der Antichrist in Gestalt des Papstes in Rom bereits erschienen, hielt Luther zunächst religiöse Erweckung für viel wichtiger als die institutionelle Verfestigung des neuen Glaubens, der ja, recht verstanden, der alte war. Nachdem die deutschen Kurfürsten 1519 Maximilians Enkel, Karl V. (und nicht den vom Papst unterstützten französischen König Franz I.), zum römischen Kaiser gewählt hatten, hoffte auch Luther eine Zeitlang auf eine umfassende Reform durch ein Nationalkonzil. Doch diese Hoffnungen zerschlugen sich schon deshalb, weil die habsburgische Universalmonarchie unter Karl ihren Schwerpunkt nicht mehr in Deutschland hatte. Dazu kamen die Aktivitäten der Bilderstürmer und Schwärmer – nach Luthers Überzeugung teuflische Anschläge auf die Sache des Evangeliums. Infolgedessen galt es nun, die wahrhaft Gläubigen zu sammeln, den Glauben zu festigen, und das hieß vor allem: verstärkt Gemeinden zu bilden und Schulen und Universitäten zu reformieren.
Bei alledem bedurften Luther und die Lutheraner der weltlichen Obrigkeit, die von Gott verordnet war und das Schwert und die Ruten führte, um die Bösen zu strafen und die Frommen zu schützen. Viele Fürsten hatten durchaus nicht nur ein religiöses, sondern auch ein materielles Interesse an der Förderung des neuen Glaubens: Durch die Reformation gewannen sie die Verfügung über Kirchengut, womit sie die staatlichen Einnahmen vermehren und ihre Herrschaft festigen konnten. Luther sah in dem, was Staat und Stadt taten, um der Kirche eine Rechtsordnung zu geben, einen Liebesdienst. Die weltlichen Obrigkeiten konnten, aber mußten sich nicht von diesem Motiv leiten lassen, wenn sie Luthers Sache zu ihrer eigenen machten.[27]
Die Entwicklung zum evangelischen Landeskirchentum begann mit der Kirchen- und Schulvisitation von Luthers Landesherrn, dem Kurfürsten Johann von Sachsen, um 1527. Dem kursächsischen Vorbild folgten bald die anderen Fürsten, die sich zum neuen Glauben bekannten. Das Ergebnis war ein rechtliches Zwangskirchentum, in dem, nach den Worten des evangelischen Theologen und Religionsphilosophen Ernst Troeltsch, das menschliche Beiwerk zur Hauptsache wurde: «Die Landesherren schufen die Einigung der Theologie zu einem einhelligen Dogma und gaben den symbolischen Büchern die Zwangsgeltung. Sie schufen kirchlich-staatliche Behörden, welche Verwaltung und kirchliches Gericht in ihre Hand nahmen, unter Beteiligung der Theologen. Sie übernahmen die christliche Glaubens- und Sittenordnung auf das weltliche Recht und gaben den geistlichen Strafen und Maßnahmen bürgerliche Rechtsfolgen. In der Theorie regierte Christus und die Schrift in der Gemeinde, praktisch regierten die Landesherrn und die Theologen.»[28]
Mochte der ehemalige Augustinermönch Luther in der Tradition von Augustinus noch so scharf zwischen den «zwei Reichen», dem irdischen und dem Gottesreich, unterscheiden, so brachte er in der Praxis doch weltliche und geistliche Gewalt, Thron und Altar, so eng zusammen, daß dem vom Staat gesetzten weltlichen Recht, wie Troeltsch es ausdrückte, «eine gewisse Halbgöttlichkeit» zuwuchs. Die politischen Wirkungen des Luthertums in Deutschland (und nur hier) waren damit radikal andere als die der anderen Hauptrichtung der Reformation, des Calvinismus, außerhalb Deutschlands. Die Verflechtung der Gemeindekirche mit der städtischen Republik Genf, wo Calvin lehrte und wirkte, begünstigte langfristig die Herausbildung demokratischer Gemeinwesen, die Verbindung von Landesherrschaft und Bischofsamt in den lutherischen Fürstenstaaten Deutschlands dagegen die Entwicklung zum Absolutismus.[29]
Zum Gegensatz zwischen Wittenberg und Rom trat damit ein weiterer: der Gegensatz zwischen dem deutschen Luthertum auf der einen und dem calvinistisch geprägten Nordwesten mit England und den Niederlanden als stärksten Bastionen auf der anderen Seite. Deutschland wurde durch die Reformation «östlicher». Franz Borkenau – ein universal gebildeter Intellektueller, der 1929 mit dem Parteikommunismus gebrochen hatte und später von Hitler in die Emigration gezwungen worden war – hat in einer 1944 zuerst auf englisch, dann 1947 in überarbeiteter Form auf deutsch erschienenen Studie über Luther die These aufgestellt, das Luthertum habe gewisse Gegensätze zwischen Ostkirche und Westkirche dogmatisch ausformuliert, die dem Gegensatz zwischen den beiden Großkirchen nur implizit zugrundegelegen hätten. «Die ausschließlich christologisch aufgebaute, Moral und Religion scharf trennende, der Tendenz nach dualistische, auf das passive innere Erleben des Glaubens und der Erlösung abgestellte lutherische Rechtfertigungslehre ist die der östlichen Kirche, aber an der Polemik mit dem westlichen Kirchentum entwickelt. Das Luthertum erscheint hier als ein im Protest gegen die westliche Glaubensreform erwachsener Zweig östlicher Glaubensweise. Hinter dem dogmatischen Gegensatz gegen Rom tut sich der kulturelle gegen das Abendland auf.»[30]
Die These ist insofern anfechtbar, als sie Luthertum und griechisch-russische Orthodoxie fast schon über einen Leisten schlägt. Doch in Luthers religiöser Innerlichkeit lag ein Moment, das ihn vom Westen trennte und mit dem Osten verband. Luthers Politikferne läßt seine vehemente Verurteilung des Bauernkriegs und seine Anlehnung an die Fürsten in sich logisch erscheinen. Der «Summepiskopat», die Übernahme des Amtes des Landesbischofs durch den Landesherrn, in den lutherischen Territorien Deutschlands brachte ein Wesensmerkmal des historischen Okzidents, das diesen vom «Cäsaropapismus» des byzantinischen Ostens abhob, fast zum Verschwinden: die Gewaltenteilung zwischen «imperium» (beziehungsweise «regnum») und «sacerdotium», die das Thema eines Jahrhunderte währenden Kampfes zwischen den Päpsten auf der einen, Kaisern und Königen auf der anderen Seite gewesen war. Wo sich die Unterscheidung behauptete oder wieder durchsetzte, war das dem Gedanken der Freiheit förderlich. Das anglikanische Staatskirchentum, das Heinrich VIII. 1534 in England einführte, war von Anfang an ständisch eingebunden; es wurde in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts parlamentarisiert und schließlich im 19. Jahrhundert liberalisiert. In Deutschland aber trug der Summepiskopat bis 1918 obrigkeitsstaatliche oder, überspitzt formuliert, cäsaropapistische Züge. Politisch betrachtet war das deutsche Luthertum ein Rückschritt.
«Die geistige Befreiung war im Luthertum mit weltlicher Knechtschaft erkauft»: In diesem Verdikt bündelt Borkenau das widersprüchliche Erbe der Reformation Martin Luthers. Beide Seiten, die kulturelle und die politische, müssen im Zusammenhang gesehen werden: «Der deutsche Geist konnte seine Schwingen entfalten, indem er praktische Erwägungen hinter sich ließ, die dort niemals beiseite gesetzt werden können, wo (wie im Calvinismus, H.A.W.) jede Leistung sich innerhalb der Welt rechtfertigen muß. Die deutsche Musik, die deutsche Metaphysik, sie hätten innerhalb einer calvinisch bestimmten Kultur nicht entstehen können. Freilich liegt in diesem Überfliegen des Praktischen auch eine furchtbare Gefahr … Das Politische ist das Reich der Verbindung von Geist und Welt, von Moral und Egoismus, von Individualismus und Bindung. Die lutherische Haltung verfehlt den Kern des Politischen. Sie hat ihren Anteil daran, daß wir das Volk der politisch stets Versagenden wurden, das Volk, das zwischen den in der Praxis gleich falschen Extremen weltferner gutmütiger Verinnerlichung und brutalsten Machttaumels hin- und hergeworfen wird.»[31]
Von der Innerlichkeit zur Brutalität war es auch bei Luther selbst nur ein Schritt: Das zeigt die zunehmende Maßlosigkeit seiner Angriffe auf den Papst, die Wiedertäufer und die Juden. Luthers Judenfeindschaft ist der Bereich seines Wirkens, wo sich Marxens Urteil, die Reformation habe das Mittelalter nur teilweise überwunden, auf besonders drastische Weise bestätigt. Enttäuschung darüber, daß die Juden sich nicht zum evangelischen Glauben bekehren ließen, verwandelte sich beim späten Luther in blinden Haß. Nur mit bösartiger Verstocktheit konnte er es sich erklären, daß die Blutsverwandten Jesu die frohe Botschaft nicht annehmen wollten. Das nahe Ende der Welt erwartend, sah Luther nunmehr in den Juden, wie zuvor schon im Papst und in den Türken, eine Erscheinungsform des Antichrist. In dem Pamphlet «Von den Juden und ihren Lügen» aus dem Jahr 1543 gab er alte Beschuldigungen wieder, von denen er wußte, daß sie nicht zu beweisen waren: Die Juden vergifteten Brunnen und raubten christliche Kinder, um sie rituell zu schlachten. An die Obrigkeiten richtete er die Aufforderung, die Synagogen anzuzünden, die Häuser der Juden zu zerstören, den Rabbinern bei Strafe für Leib und Leben das Lehren zu untersagen, den Juden das Recht auf sicheres Geleit zu nehmen, ihnen die Benutzung der Straßen und den Wucher zu verbieten, sie zu körperlicher Arbeit zu zwingen und notfalls aus dem Land zu jagen. Den Christen insgesamt aber empfahl Luther, wann immer sie einen rechten Juden sähen, sich zu bekreuzigen und frei und sicher auszusprechen: «Da geht ein leibhaftiger Teufel». Das war «finsteres Mittelalter». Es lebte nicht nur in Luther fort, sondern wesentlich auch durch ihn.[32]
In der deutschen Geschichte bildet die Reformation eine der tiefsten Zäsuren. Von «unserem wichtigstem vaterländischen Ereignis» sprach Leopold von Ranke 1839 in der Vorrede zu seiner «Deutschen Geschichte im Zeitalter der Reformation». Die Reformation hat die deutsche Nation nicht nur gespalten, sondern in gewisser Weise neu konstituiert. Da der Kaiser selbst einer der rivalisierenden Religionsparteien angehörte, stand er weniger als bisher für das Ganze. Aber auch die Kurie der Kurfürsten konnte das Ganze nicht mehr repräsentieren, da sie ebenfalls in konfessionelle Lager gespalten war. Dasselbe galt für den Reichstag. Doch die Religionsparteien selbst waren überterritoriale, ja «nationale» Gruppierungen. Aus der Sicht der Anhänger des neuen Glaubens verkörperte am ehesten die ideelle Gesamtheit der protestantischen Reichsstände, von denen sich die meisten, aber nicht alle 1531 im thüringischen Schmalkalden zu einem Verteidigungsbündnis gegen die kirchenpolitischen Bestrebungen Karls V. zusammengeschlossen hatten, die deutsche Nation. Das gemeinsame Band war kein staatliches, sondern ein kulturelles: der evangelische Glaube im Sinne der «Augsburgischen Konfession», wie er in Abstimmung mit Luther (und nicht immer zu dessen Zufriedenheit) von Philipp Melanchthon 1530 auf dem Reichstag zu Augsburg in verbindliche Form gebracht und damit in ersten Ansätzen «konfessionalisiert» worden war.
Für den Zusammenhalt der deutschen Protestanten war Luthers Bibelübersetzung schlechthin grundlegend. Sie schuf die gesamtdeutsche Hochsprache, die ihrerseits zum wichtigsten «nationalen» Kommunikationsmittel und damit zur Bedingung der Möglichkeit dafür wurde, daß sich die gebildeten Deutschen gut zwei Jahrhunderte später, als es einen deutschen Staat noch immer nicht gab, als Angehörige einer deutschen Kulturnation verstehen konnten. Das evangelische Segment spielte in diesem Prozeß der Identitätsfindung eine so starke Rolle, daß man von einer kulturellen Hegemonie des Protestantismus sprechen muß. Luthers «Volk» aber blieb bei alledem, wie Eugen Rosenstock-Huessy bemerkt, recht stumm. «Die Nation, die er erweckt hat, wurde zunächst eine Fürsten-, Professoren- und Pfarrernation, bis hin zum Professorenparlament der Paulskirche von 1848. Diese Rolle der deutschen Universitäten für die Konstituierung der deutschen Nation erwächst im 15. Jahrhundert.»[33]
Dem katholischen Deutschland half der Rückhalt, den es am Kaiser hatte, wenig. Die Kriege zwischen Karl V. und Franz I. von Frankreich und die Gefahr, die von den Türken ausging, zwangen den Kaiser und die katholischen Stände mehrfach zu Kompromissen mit den Anhängern des neuen Glaubens und damit zur Vertagung des großen Konflikts. Das geschah erstmals 1526 auf dem ersten Reichstag zu Speyer, der es jedem Reichsstand anheimstellte, ob er das Wormser Edikt von 1521, die Ächtung Luthers und die Verurteilung seiner Lehren, befolgen wollte oder nicht, dann im «Nürnberger Anstand» von 1532, der den Protestanten vorläufig die freie Ausübung ihrer Religion zusicherte. Erst nachdem Karl nicht mehr durch auswärtige Kriege gebunden war und 1546, im Todesjahr Luthers, einen der wichtigsten protestantischen Fürsten, Herzog Moritz von Sachsen (durch das Versprechen der Kurwürde, die in den Händen seines Vetters Johann Friedrich aus einer anderen Linie des sächsischen Hauses war) auf seine Seite gezogen hatte, konnte er es wagen, zum Schlag gegen den Schmalkaldischen Bund auszuholen.
Seinen militärischen Sieg im Schmalkaldischen Krieg von 1546/47 konnte der Kaiser aber nicht in einen politischen Erfolg umsetzen, da sich Moritz von Sachsen, nunmehr Kurfürst, mit der Fürstenopposition verbündete, gemeinsame Sache mit dem französischen König Heinrich II. machte (dem er das Reichsvikariat über Metz, Toul und Verdun zugestand) und den Kampf gegen Karl V. aufnahm. Der Passauer Vertrag von 1552, zu dem sich der hart bedrängte Kaiser genötigt sah, gewährte den Protestanten nochmals freie Religionsausübung bis zu einem neuen Reichstag. Dieser Reichstag, 1555 abgehalten zu Augsburg, markiert sowohl das Ende der Reformationszeit wie auch den Abschluß des Ringens um die Reichsreform. Fortan galt der von einem späteren Juristen formulierte Grundsatz «Cuius regio, eius religio» (wessen die Herrschaft, dessen der Glaube). Die Augsburgische Konfession (nicht die «reformierte» der Anhänger des Zürcher Leutpriesters Ulrich Zwingli und Calvins) war nun reichsrechtlich anerkannt. Der Augsburger Religionsfriede sicherte nicht dem einzelnen Menschen, sondern den Fürsten die freie Entscheidung zwischen dem alten und dem neuen Glauben. Andersgläubige erhielten lediglich das Recht, das Territorium zu verlassen. In Reichsstädten mit gemischter Konfession sollte das Prinzip der Parität, für geistliche Territorien ein konfliktträchtiger «geistlicher Vorbehalt» gelten: Ein Bischof oder Reichsabt, der vom katholischen zum lutherischen Glauben übertrat, sollte sein Amt sofort niederlegen, das betreffende Dom- oder Stiftskapitel das Recht haben, einen katholischen Nachfolger zu wählen. Eine Pflicht, dies zu tun, sah der Religionsfriede aber nicht vor.
Der Augsburger Reichstagsabschied von 1555 bedeutete das Scheitern von zwei konkurrierenden Entwürfen einer universalen Krisenlösung: der Erneuerung von Reich und Kirche durch den Kaiser und im Zeichen des alten Glaubens auf der einen, der Erneuerung der allgemeinen Kirche im Zeichen des neuen Glaubens auf der anderen Seite. Gescheitert war auch das Projekt eines ständisch regierten Reiches, wie es im frühen 16. Jahrhundert eine Reformergruppe um den Mainzer Kurfürsten und Erzkanzler des Reiches, Berthold von Henneberg, betrieben hatte. 1555 einigten sich, wie Heinz Schilling feststellt, «Stände und Krongewalt endgültig darauf, daß in Deutschland die Fürsten und ihre Territorien die Träger der neuzeitlichen Staatlichkeit sein sollten und daß das Reich ein vorstaatlicher politischer Verband bleiben würde».[34]
Das Heilige Römische Reich blieb also erhalten; es festigte sich sogar institutionell. Der große Fürsten- und Bürgerkrieg, der nach Lage der Dinge zugleich ein europäischer Krieg sein mußte, war nochmals abgewehrt. Der Ausgleich von 1555 sanktionierte das Recht der deutschen Territorialstaaten auf religiöse Partikularität, wenn auch noch nicht auf die Steigerung der landesherrschaftlichen Libertät zu ihrer letzten Konsequenz: der staatlichen Souveränität. Doch schon im Jahre 1555 war absehbar, wer im Konfliktfall die größeren Chancen hatte, die Loyalität der Untertanen für sich in Anspruch zu nehmen: der Fürstenstaat und nicht das Reich. Mochte das Reich der deutschen Nation auch einen letzten organisatorischen Halt bieten und, vor allem bei Bedrohungen von außen, immer wieder Wellen von «Reichspatriotismus» hervorrufen: die Territorien, und zumal die größeren unter ihnen, entwickelten die sehr viel stärkere Bindekraft. Der Idee einer deutschen Nation blieb ein anderes Reich, das keines Kaisers bedurfte: das Reich des Glaubens und des Geistes.
Der Augsburger Religionsfriede trug wesentlich dazu bei, daß sich das protestantische Deutschland über ein halbes Jahrhundert lang von den Folgen der katholischen Gegenreformation abschirmen konnte, die vom Konzil zu Trient (1545–1563) ihren Ausgang nahm. Länder, in denen die Gegenreformation triumphierte, wurden wirtschaftlich und intellektuell so nachhaltig zurückgeworfen, daß die Wirkungen bis in die Gegenwart andauern. Spanien, dank seines lateinamerikanischen Kolonialbesitzes zeitweilig die bedeutendste katholische Macht, unterlag in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts seinem gefährlichsten Rivalen, England, nicht nur militärisch, durch den Untergang der Armada im Jahre 1588. Auch ökonomisch wurden die Länder der iberischen Halbinsel, Spanien und Portugal, binnen weniger Jahrzehnte von der calvinistisch geprägten See- und Handelsmacht England auf mindere Ränge verwiesen. Frankreich hingegen blieb nach den blutigen Hugenottenkriegen der Jahre 1562 bis 1598 nationalkirchlichen Traditionen treu und widersetzte sich der Gegenreformation mit Erfolg: Als König Heinrich IV. (von Navarra) 1593 vom calvinistischen zum katholischen Glauben übertrat, war das nicht der Auftakt zur umfassenden Rekatholisierung des Landes, sondern zu jener Politik religiöser Toleranz, die 1598 im Edikt von Nantes ihren klassischen Ausdruck fand.
Wo die Gegenreformation konsequent durchgeführt wurde, vernichtete sie weitgehend, was es an modernem Kapitalismus in katholisch gebliebenen Gebieten bereits gegeben hatte. Wo sich dagegen der calvinistische Geist innerweltlicher Askese und Bewährung entfalten konnte, förderte er auch die unternehmerische Dynamik. Den lutherischen Gebieten fehlte ein solcher Antrieb. Sie verharrten in der überlieferten ständischen Ordnung, der ein konservativer Wirtschaftsstil entsprach: Nicht individueller Wagemut und ständiges Wachstum der Erträge, sondern die Befriedigung des gewohnten, standesgemäßen Bedarfs und ein gerechter Preis waren die Leitideen des Wirtschaftens. In dieser Hinsicht unterschieden sich Lutheraner und Katholiken weniger voneinander als Lutheraner und Calvinisten.[35]
Die konfessionellen Unterschiede in Sachen der inneren politischen Ordnung waren, was Deutschland angeht, eher gering: Die calvinistischen Territorien wurden so obrigkeitsstaatlich regiert wie die lutherischen und die katholischen. Daß das politische Profil des deutschen Calvinismus sich deutlich von dem des englischen und des niederländischen abhob, hing mit einer kollektiven Diskriminierung zusammen: der Nichtanerkennung der Calvinisten als Konfession durch den Augsburger Religionsfrieden. Es war denn auch kein Zufall, daß das Streben nach Änderung des konfessionellen Status quo in den ersten Jahrzehnten nach 1555 auf evangelischer Seite nicht von einem lutherischen, sondern von einem calvinistischen Fürstenstaat ausging: der Kurpfalz, die damit zum Widerpart des aktivsten katholischen Reichsstandes, des gegenreformatorischen Bayern, aufrückte.
Die Calvinisten gewannen an Boden, als sich ihnen im Zuge der sogenannten «Zweiten Reformation» einige kleinere Territorien und ein größeres, Hessen-Kassel, anschlossen. Noch stärker verschoben sich die Kräfteverhältnisse im protestantischen Deutschland, als 1613 der brandenburgische Kurfürst Johann Sigismund vom lutherischen zum reformierten Bekenntnis übertrat: ein Vorgang mit langfristigen Wirkungen, der uns noch ausführlicher beschäftigen wird. Um den Herzog von Bayern scharten sich katholische, um den pfälzischen Kurfürsten protestantische Reichsstände. 1608 wurde die «Union», ein protestantisches Verteidigungsbündnis, im Jahr darauf die katholische Gegenallianz, die «Liga», gegründet. Der konfessionelle Gegensatz konnte jederzeit in einen neuerlichen Waffengang umschlagen. Als Kaiser Matthias sich anschickte, die Religionsfreiheit aufzuheben, die sein Bruder und Vorgänger, Rudolf II., den überwiegend protestantischen Ständen Böhmens und Mährens gewährt hatte, war es soweit: In Prag begann im Mai 1618 der Dreißigjährige Krieg.[36]
Ein reiner Religionskrieg ist dieser Krieg nie gewesen – weder zur Zeit des «böhmisch-pfälzischen Krieges» von 1618 bis 1623 und des «dänischniedersächsischen Krieges» von 1625 bis 1629 noch zur Zeit des «schwedischen Krieges» von 1630 bis 1635 und der des «schwedisch-französischen Krieges» von 1635 bis 1648. Die starke Beteiligung auswärtiger Mächte rief einen reichspatriotischen Protest hervor, der sich anfangs vor allem gegen das habsburgisch regierte Spanien, den militärischen Verbündeten des habsburgischen Kaisers Ferdinand II. und der katholischen Liga, richtete. Unter Berufung auf die alte Lehre von den vier Weltreichen beschuldigte eine Flugschrift 1620 die Spanier, sie erstrebten die Errichtung einer fünften, die ganze Welt umspannenden Monarchie und handelten damit der göttlichen Weltordnung zuwider, der zufolge das Heilige Römische Reich Deutscher Nation das vierte und letzte der Weltreiche sei. Einen Höhepunkt erreichte der Reichspatriotismus zur Zeit des Prager Friedens von 1635, den der Kaiser zunächst mit Kursachsen, dann mit den meisten anderen protestantischen Reichsständen, vorwiegend Norddeutschlands, abschloß. Doch der Versuch eines «deutschen» Friedens schlug fehl. Noch im gleichen Jahr griff das katholische Frankreich auf der Seite des lutherischen Schweden, also auf der konfessionell «verkehrten» Seite, in den Krieg ein. Die Machtpolitik trug damit endgültig den Sieg über den Glaubensstreit davon.[37]
In der kollektiven Erinnerung der Deutschen lebte der Dreißigjährige Krieg Jahrhunderte lang als die nationale Katastrophe fort; erst die beiden Weltkriege des 20. Jahrhunderts und namentlich der zweite haben ihm diesen Rang streitig gemacht. Eine Katastrophe war der Krieg vornehmlich in demographischer, wirtschaftlicher, sozialer und moralischer Hinsicht. Große Teile Deutschlands haben sich erst im folgenden Jahrhundert, manche noch später oder nie von den Folgen des drei Jahrzehnte währenden Mordens und Brandschatzens erholt. Die Bauern waren verarmt; im Osten Deutschlands sanken sie vielfach in die Erbuntertänigkeit von den Rittergutsbesitzern ab. Von einem aufsteigenden Bürgertum konnte nach der Verwüstung zahlloser Städte auf lange Zeit keine Rede mehr sein. Die Kriegsgewinner waren, soziologisch betrachtet, die Landesherren, die staatsnahen Teile des Adels, staatlich geförderte Kaufleute, Unternehmer und Bankiers, das Militär und das Beamtentum: die Säulen des entstehenden Absolutismus also. Kriegsgreuel, Massensterben und Entbehrungen bewirkten bei den Überlebenden eine verstärkte Wendung nach innen: eine erneuerte Laienfrömmigkeit, die im evangelischen Deutschland dem Pietismus des späten 17. und des 18. Jahrhunderts den Boden bereitete.
Wenn man von positiven Wirkungen des Krieges sprechen kann, war es die Einsicht in die Unabdingbarkeit von religiöser Toleranz. Erzwingen konnte diese Duldsamkeit nur ein starker Staat, der bereit war, sich in gewissen Grenzen zu säkularisieren und damit in religiösen Dingen zu neutralisieren. Der fürstliche Absolutismus war nicht zuletzt eine Folge der Verabsolutierung von Glaubensfragen: Was die Untertanen an innerlicher Freiheit gewannen, bezahlten sie mit noch mehr politischer Unterordnung unter die weltlichen Obrigkeiten. Diese fanden die verläßlichste Stütze ihrer Herrschaft fortan in einer tiefsitzenden, ja traumatischen Angst, die man wohl das bleibende Ergebnis des Dreißigjährigen Krieges nennen kann: der Angst vor dem Zusammenbruch aller gewohnten Ordnung, vor Chaos und fremder Soldateska, vor Bruder- und Bürgerkrieg, vor der Apokalypse.[38]
Der Westfälische Friede, den Kaiser und Reich 1648 in Münster mit Frankreich und in Osnabrück mit Schweden abschlossen, stellte den Augsburger Religionsfrieden von 1555 wieder her und dehnte ihn auf die Reformierten aus: Sie waren nunmehr als eine gleichberechtigte Spielart des Protestantismus anerkannt. Als Normaljahr für die Festlegung der Konfessionsgrenzen und der Konfessionszugehörigkeit der Bevölkerung galt 1624; seit diesem Stichdatum mußten die Untertanen einen Religionswechsel der Obrigkeit nicht mehr mitvollziehen. Die nördlichen Niederlande und die Schweizer Eidgenossen schieden aus dem Reichsverband definitiv aus; Frankreich erhielt die österreichischen Hoheitsrechte im Elsaß, was die Position der Habsburger in Deutschland nachhaltig schwächte. Bayern wurde in der pfälzischen Kurwürde bestätigt, die es 1623 erlangt hatte, desgleichen im Besitz der Oberpfalz; eine neue, achte Kurwürde wurde für die Rheinpfalz geschaffen. Den Reichsständen erkannte der Friedensvertrag die Mitbestimmung in allen Angelegenheiten des Reiches und die volle Landeshoheit in weltlichen und geistlichen Dingen zu, dazu das Recht, Bündnisse auch mit auswärtigen Mächten zu schließen – wobei der schwer einklagbare Vorbehalt galt, daß solche Bündnisse sich nicht gegen Kaiser und Reich richten durften. Um jedwede Majorisierung auszuschließen, traten bei der Behandlung konfessioneller Fragen die evangelischen und die katholischen Reichsstände auf dem Reichstag, der sich 1663 in einen immerwährenden, in Regensburg tagenden Gesandtenkongreß verwandelte, zu gesonderten Beratungen im Corpus evangelicorum und im Corpus catholicorum zusammen. Beschlüsse kamen nur zustande, wenn aus dieser «itio in partes» eine Einigung hervorging.[39]
Außenpolitisch gesehen gingen Frankreich und Schweden als Sieger aus dem Dreißigjährigen Krieg hervor. Beide garantierten den Friedensvertrag, der zum Reichsgrundgesetz erklärt wurde; beide konnten ihr Territorium auf Kosten des Reiches ausdehnen, wobei Schweden, dem unter anderem Vorpommern mit Rügen zufiel, sogar zum Reichsstand aufrückte. Innenpolitisch betrachtet waren die Reichsstände die Gewinner: Infolge des Westfälischen Friedens konnten sie den entscheidenden Schritt zur Erlangung der vollen Souveränität tun. Ein europäischer Machtfaktor war das Heilige Römische Reich nach 1648 nicht mehr. Da es den deutschen Status quo absichern half, lag sein Fortbestand zwar sowohl im Interesse der europäischen Mächte wie auch der kleineren Reichsstände. Ein Staat aber, der sich mit Frankreich oder England, Spanien oder Schweden hätte vergleichen können, war das schwerfällige, altertümliche Gebilde nicht. Es war jener «irreguläre und einem Monstrum ähnliche Körper» (irregulare aliquod corpus et monstro simile), als den es Samuel Pufendorf 1667 in seiner berühmten Schrift über die Verfassung des Deutschen Reiches beschrieb.[40]
Wir wenden uns der dritten der prägenden Grundtatsachen der deutschen Geschichte, dem Gegensatz zwischen Österreich und Preußen, zu. Daß Österreich und Preußen, die beiden wichtigsten staatlichen Produkte der mittelalterlichen deutschen Ostsiedlung, zu europäischen Großmächten aufsteigen konnten, hatte eine gemeinsame Ursache: Beide bezogen ihren Einfluß zu guten Teilen daraus, daß sie Gebiete in sich schlossen, die nicht zum Reich gehörten. Die österreichischen Habsburger, die 1273 erstmals und seit 1438 ununterbrochen den Kaiser des Heiligen Römischen Reiches stellten, gewannen in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts durch Heirat die Niederlande und die Freigrafschaft Burgund und zu Beginn des 16. Jahrhunderts die Herrschaft über Spanien und seine Nebenlande mitsamt Neapel und den amerikanischen Kolonien. Die dynastische Verbindung mit Spanien blieb erhalten, als 1556 nach der Abdankung Kaiser Karls V. die Kaiserwürde auf seinen Bruder Ferdinand I. überging, die Herrschaft über Spanien, die Freigrafschaft Burgund und die Niederlande an seinen Sohn, König Philipp II.
Langfristig noch folgenreicher war der Erwerb der Kronen Böhmens und Ungarns im Jahre 1526. Ungarn ging zwar unter Ferdinand I. großenteils an die Türken verloren, die nach der Eroberung Konstantinopels (und damit des oströmischen Reiches) im Jahre 1453 immer weiter auf der Balkanhalbinsel vorgerückt waren. Doch es half Österreich ideell und materiell, daß es seit der ersten Belagerung Wiens durch die Türken im Jahre 1529 den Anspruch erheben konnte, das Reich, ja das Abendland insgesamt gegen die Osmanen und den Islam zu verteidigen. Nach der zweiten türkischen Belagerung Wiens im Jahre 1683 wendete sich das Blatt. Ungarn wurde den Türken entrissen und gelangte 1699 zusammen mit Siebenbürgen und großen Teilen von Slawonien und Kroatien an das Haus Habsburg. Österreich war zur Großmacht geworden.
Es konnte diesen Status auch behaupten, als nach dem Aussterben der spanischen Linie der Habsburger im Jahre 1700 der Spanische Erbfolgekrieg entbrannte. Ludwig XIV. von Frankreich gelang es zwar, die habsburgische Umklammerung aufzubrechen und seinen Enkel Philipp von Anjou auf den spanischen Königsthron zu setzen. Eine Vereinigung Frankreichs und Spaniens aber schloß 1713 der Friede von Utrecht aus. Im gleichen Jahr legte Kaiser Karl VI. in der Pragmatischen Sanktion seine eigene Nachfolge fest: Erbin des ungeteilten Hausbesitzes sollte seine älteste Tochter Maria Theresia sein. In langwierigen Verhandlungen erreichte der Kaiser die Anerkennung dieses Anspruchs durch die habsburgischen Erbländer, durch Ungarn und schließlich auch durch die europäischen Großmächte. Im Oktober 1740 trat Maria Theresia ihre Herrschaft an – fast gleichzeitig mit ihrem großen Widersacher, König Friedrich II. von Preußen.
«Preußen» (oder «Pruzzen») war ursprünglich der Name eines baltischen Stammes, der im frühen und hohen Mittelalter auf dem Gebiet des späteren Ostpreußen lebte. Die deutsche Besiedlung begann unter der Herrschaft des Deutschen Ritterordens, den der polnische Herzog Konrad von Masowien 1225 gegen die heidnischen Preußen zu Hilfe gerufen hatte. Nach dem militärischen Zusammenbruch des Ordensstaates im 15. Jahrhundert konnte dieser nur einen Teil seines Gebietes als polnisches Lehen behaupten. Die polnische Lehenshoheit blieb bestehen, als der Ordensmeister Albrecht von Brandenburg, ein Anhänger Luthers, den Ordensstaat 1525 in vertraglicher Absprache mit Polen in das weltliche Herzogtum Preußen verwandelte. 1618 fiel dieses Herzogtum durch Erbschaft an Brandenburg, wo seit 1415 die Hohenzollern als Markgrafen und Kurfürsten regierten. 1660 setzte der Große Kurfürst Friedrich Wilhelm (1640–1688) die Anerkennung seiner Souveränität im Herzogtum Preußen durch, das auch weiterhin außerhalb des Heiligen Römischen Reiches blieb. Der Sohn des Großen Kurfürsten, Friedrich III., krönte sich (als Friedrich I.) am 18. Januar 1701 in Königsberg mit Zustimmung Kaiser Leopolds I. zum «König in Preußen». Damit war Brandenburg-Preußen noch keine Großmacht. Aber es hatte einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu diesem Ziel getan.
Anders als die Habsburger hatten die Hohenzollern fast nur deutsch sprechende Untertanen (die Masuren, die einen polnischen Dialekt sprachen, waren evangelisch und fühlten sich schon deswegen nicht als Polen). Auf dem Gebiet der Konfession lag der andere augenfällige Unterschied zwischen Österreich und Preußen: Die Habsburger waren wie die meisten ihrer Untertanen Katholiken, die Hohenzollern Protestanten. Mit der Glaubenszugehörigkeit der brandenburgischen Herrscher hatte es freilich eine besondere Bewandtnis. Im Jahr 1613 war Kurfürst Johann Sigismund vom lutherischen zum reformierten Bekenntnis übergetreten. Da die Untertanen, von den Calvinisten und Katholiken am Niederrhein abgesehen, Lutheraner blieben, ergab sich für die Hohenzollern die Notwendigkeit einer toleranten Haltung in Glaubensfragen damals fast von selbst.
Doch darin erschöpfte sich die Wirkung des kurfürstlichen Religionswechsels von 1613 nicht. Bereits Johann Gustav Droysen hat um 1870 in seiner «Geschichte der preußischen Politik» darauf hingewiesen, daß der Übertritt Johann Sigismunds zum Calvinismus wohl aus religiösen Gründen erfolgt, sein neues Bekenntnis aber «nicht bloß kirchlicher Natur» gewesen sei.[41] Weiter ging Otto Hintze 1931 in seinem Aufsatz «Kalvinismus und Staatsräson in Brandenburg zu Beginn des 17. Jahrhunderts». An Max Webers berühmte Studien über die Zusammenhänge zwischen dem Calvinismus und dem «Geist des Kapitalismus» anknüpfend, fragte Hintze nach der «Wahlverwandtschaft» zwischen Calvinismus und moderner Staatsräson. Der Calvinismus, so seine Antwort, sei der «Geburtshelfer gewesen, der die moderne Staatsräson in der brandenburgischen Politik zur Welt gebracht» habe; er habe als «Brücke» gedient, «über welche die westeuropäische Staatsräson ihren Einzug in Brandenburg» halten konnte. Die langfristige Wirkung war «als Grundrichtung die politische Orientierung nach Westen», vor allem nach den Niederlanden und Frankreich hin.
Das Resultat war paradox. In Brandenburg-Preußen wirkte der Calvinismus Hintze zufolge «als ein die monarchische Macht verstärkendes Prinzip – im Gegensatz zu seiner sonst in der Weltgeschichte vielfach hervortretenden Funktion einer Belebung des ständischen Widerstandes gegen heterodoxe Fürsten. Diese Funktion fehlt aber auch keineswegs, nur muß man, um sie zu erkennen, die andere Front der territorialen Fürstengewalt, die gegenüber der Reichsgewalt, ins Auge fassen. Gegenüber dem katholischen Kaiser hat der Kalvinismus auch in Deutschland die reichsständische Opposition belebt und geführt.»
In dieser Tradition stand aus Hintzes Sicht auch noch Friedrich II. «Wenn Friedrich der Große in seinen politischen Testamenten diese religiöse Haltung mit einer rein weltlichen, realpolitischen vertauscht hat, so ist dem tieferen Blick doch wohl erkennbar, daß der kategorische Imperativ der Pflicht und die asketische Berufstreue dieses aufgeklärten Herrschers ebenso wie die transzendentale Auffassung von der über dem Herrscher stehenden Majestät des Staates aus Gemütsschichten stammt, in denen die religiösen Motive der Vorfahren sich gleichsam säkularisiert, in eine weltliche Form umgesetzt haben, ohne aber rein aus dem Rationalismus der Aufklärung abgeleitet oder erklärt werden zu können.»[42]