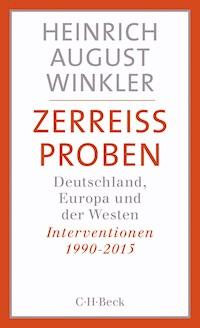28,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Heinrich August Winklers vierbändige "Geschichte des Westens" ist ein vielfach gerühmtes Meisterwerk der deutschen Geschichtsschreibung und mit rund 150.000 verkauften Exemplaren zugleich ein eindrucksvoller Bucherfolg. Doch nicht jeder kann die gewaltigen Dimensionen dieser vieltausendseitigen Gesamtdarstellung bewältigen. Deshalb hat der große Historiker diese einbändige Weltgeschichte geschrieben, die den Weg des Westens von den Anfängen in der Antike bis in unsere unmittelbare Gegenwart erzählt und zugleich die großen Deutungslinien prägnant herausarbeitet.
"Heinrich August Winkler stellt die Fragen an die Geschichte, die uns bei der Lösung der gegenwärtigen Probleme umtreiben. In einer Welt, die aus den Fugen zu geraten scheint, vermittelt uns seine monumentale Erzählung der Geschichte des Westens originelle Einblicke und Denkanstöße."
Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
HEINRICH AUGUST WINKLER
WERTE UND MÄCHTE
Eine Geschichte der westlichen Welt
C.H.BECK
ZUM BUCH
Die Geschichte der westlichen Welt führt von Antike und Mittelalter in das Zeitalter der Entdeckungen und danach in eine viele Jahrhunderte währende welthistorische Dominanz, die erst in unseren Tagen an ihr Ende zu kommen scheint. Während offener denn je ist, ob der Westen im 21. Jahrhundert noch Bestand haben wird, hilft der Blick in die Geschichte, um Orientierung zu gewinnen: Was macht den Westen und seine Werte aus? Warum hat er so oft gegen seine eigenen Maßstäbe verstoßen, an denen er sich dennoch messen lassen muss? Worin liegen die tieferen Ursachen seiner heutigen Krise? Heinrich August Winkler, der große Historiker des Westens, legt eine prägnante Gesamtschau vor, die von der ersten bis zur letzten Seite zugleich ein leidenschaftliches Plädoyer für Freiheit, Menschenrechte und Demokratie ist.
«Die intellektuelle Öffnung unseres Landes für Freiheit und Demokratie ist zu einem guten Teil auch die Leistung von Heinrich August Winkler.»
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier
ÜBER DEN AUTOR
Heinrich August Winkler, geb. 1938 in Königsberg, studierte Geschichte, Philosophie, Politische Wissenschaft und öffentliches Recht in Tübingen, Münster und Heidelberg. Er habilitierte sich 1970 in Berlin an der Freien Universität und war zunächst dort, danach von 1972 bis 1991 Professor in Freiburg. Seit 1991 war er bis zu seiner Emeritierung Professor für Neueste Geschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin. Seine Werke «Der lange Weg nach Westen» und «Geschichte des Westens» sind weithin gelesene Bestseller. 2014 erhielt er den Europapreis für politische Kultur der Hans Ringier Stiftung, 2016 den Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung und 2018 das Große Bundesverdienstkreuz. Bei C. H.Beck sind auch erschienen: «Weimar 1918–1933. Die Geschichte der ersten deutschen Demokratie» (bp 22018) sowie «Zerbricht der Westen? Über die gegenwärtige Krise in Europa und Amerika» (22017).
INHALT
VORWORT
1.: PRÄGUNGEN:DIE ENTSTEHUNG DES MODERNEN WESTENS
Von der Polis zu den Päpsten: Anfänge des Okzidents
Frühe Gewaltenteilungen: Vom Mittelalter zur Renaissance
Lutheraner, Calvinisten, Katholiken:Die Reformation und ihre Folgen
Die Zähmung des Leviathan:Vom Dreißigjährigen Krieg zur Glorious Revolution
Befreiung aus der Unmündigkeit:Die Aufklärung und ihre Grenzen
Gewaltenteilung und allgemeiner Wille:Von Montesquieu zu Rousseau
Die größte Umwälzung seit der Steinzeit:Der Beginn der Industriellen Revolution
2.: GRUNDLEGUNG EINES PROJEKTS:DIE ATLANTISCHEN REVOLUTIONEN
Im Namen der Menschenrechte: Die Amerikanische Revolution
«We the People»: Der Kampf um die amerikanische Verfassung
Eine weltgeschichtliche Zäsur:1776 und die Folgen
Radikalisierung einer Revolution:Frankreich versus Europa 1789–1793
«Die Revolution frisst ihre eigenen Kinder»: Die Schreckensherrschaft
Thermidor, Empire, Restauration:Die napoleonische Ära
«Eine vollkommene Umkehr des Prinzips»:Das Revolutionszeitalter als Epochenwende
3.: DER ALTE UND DER NEUE WESTEN:EUROPA UND AMERIKA 1815–1850
Fünf alte Großmächte und eine neue:Vom Wiener Kongress zur «Monroe-Doktrin»
Die Bourgeoisie an der Macht:Die französische Julirevolution und ihre Folgen
Reform statt Revolution:Großbritannien 1830–1847
Pauperismus und Marxismus:Europa in den «Hungry forties»
1848:Eine europäische Revolution
Verselbständigung der Exekutivgewalt:Frankreichs bonapartistische Wende
Ende eines Zyklus:Der historische Ort der europäischen Revolution von 1848
Die Mission der Expansion:1848 als Epochenjahr der amerikanischen Geschichte
4.: NATIONALSTAATEN UND IMPERIEN:DER FRAGMENTIERTE WESTEN 1850–1890
Vom Idealismus zum Materialismus:Mentalitätswandel und Globalisierungsschub um 1850
Ein Nationalstaat entsteht:Vom Krimkrieg zur Einigung Italiens
Revolution von oben:Preußen vereinigt Deutschland
Abwehr einer Sezession:Der amerikanische Bürgerkrieg
Vom linken zum rechten Nationalismus.Die Liberalen in der Defensive
Ein System der Aushilfen:Das Bismarckreich
Prekäre Stabilisierung:Die Frühzeit der Dritten Republik in Frankreich
Schrittweise Demokratisierung:Großbritannien unter Gladstone und Disraeli
Kolonialreiche und andere Kolonialmächte:Die Zeit des klassischen Imperialismus
5.: WELTPOLITIK UND WELTKRIEG:DIE ANFÄNGE DES TRANSATLANTISCHEN JAHRHUNDERTS 1890–1918
Pionierland der Moderne:Amerika wird zur Avantgarde
Transnationale Bewegungen:Die Ungleichzeitigkeit des Fortschritts
Ein dissonantes Konzert:Die europäischen Großmächte in der Zeit um 1900
Wetterleuchten im Osten:Vom russisch-japanischen Krieg zur russischen Revolution von 1905
Internationale Konflikte und innere Krisen:Europa im Jahrzehnt vor dem Ersten Weltkrieg
Sarajewo und die Folgen:Von der Julikrise zum Ersten Weltkrieg
Kriegsziele, ideologische Kriegführung, Kriegsgeschehen: 1914–1916
Epochenjahr 1917:Zwei russische Revolutionen und der Kriegseintritt der USA
Zusammenbrüche und Neuanfänge:Das letzte Kriegsjahr
Verspieltes Vertrauen und entgrenzte Gewalt:Das Erbe des Ersten Weltkrieges
6.: KATASTROPHENZEIT:DEMOKRATIEN UND DIKTATUREN 1918–1945
Die gebremste Revolution:Deutschland auf dem Weg in die Weimarer Republik
Der fragile Frieden:Vom Vertrag von Versailles zum Völkerbund
Auflösung einer Demokratie:Italien wird faschistisch
Bewährungsproben einer Republik:Deutschland 1919–1930
Die Sorgen der Sieger:Frankreich, Großbritannien und die USA in den «goldenen zwanziger Jahren»
Weltwirtschaftskrise:Amerika auf dem Weg in die Große Depression
Weimars Untergang:Das Ende der ersten deutschen Republik
Sozialismus in «einem» Lande:Die Stalinisierung der Sowjetunion
Machtergreifung und Machtausbau:Die nationalsozialistische Revolution in Deutschland
Autoritäre Transformation:Regimewandel im Europa der Zwischenkriegszeit
Volksfront, National Government, New Deal:Westliche Antworten auf die Krise
Allianz der Antipoden:Vom Münchner Abkommen zum Hitler-Stalin-Pakt
Zivilisationsbrüche:Zweiter Weltkrieg und Holocaust
7.: WEST VERSUS OST:DIE BIPOLARE WELT 1945–1975
Jalta, Potsdam, San Francisco:Weichenstellungen für die Nachkriegszeit
Emanzipation von Europa:Die Kolonialmächte geraten in Bedrängnis
Konturen einer Spaltung:Diesseits und jenseits des Eisernen Vorhangs
Kraftproben:Die Anfänge des Kalten Krieges und die Teilung Deutschlands
Gewichtsverlagerungen:Stalins Atombombe, Maos Revolution und die Renaissance der Menschenrechte
Vom Koreakrieg zum Koreaboom:Weltpolitischer Szenenwechsel 1950–1955
Gemeinsamer Markt und Europa der Staaten:Neuorientierung auf dem alten Kontinent
«Wind of change»:Die Entkolonialisierung Afrikas
Vietnam, Berlin, Kuba:Internationale Krisen 1958–1963
Der Westen fächert sich auf:Amerika und Europa in den mittsechziger Jahren
1968:Das Jahr der transatlantischen Revolte
Realpolitik im Schatten des Vietnamkriegs:Die USA im Umbruch
Die EG wächst:Der Abgang de Gaulles und seine Folgen
Machtwechsel in Bonn:Die neue Ostpolitik
Weltpolitik im Zeichen von Watergate:Von Nixon zu Ford
Von der Diktaturendämmerung zur Schlussakte von Helsinki:Europa 1974/75
Das Ende des Booms:Struktur- und Wertewandel in den siebziger Jahren
8.: AUFLÖSUNG EINER KONFRONTATION:DAS ENDE DES KALTEN KRIEGES 1975–1991
Der Klassenfeind als Gläubiger:Der Ostblock 1975–1979
Von Ford zu Carter:Westliche Weltpolitik zwischen Moral und Interesse
Zwischen Rezession und Terror:Die USA und Westeuropa 1975–1980
Von der iranischen Revolution zur sowjetischen Intervention in Afghanistan:Das Ende der Präsidentschaft Jimmy Carters
Zwischen Kabul und Warschau:Der Niedergang des Sowjetimperiums
Hochrüstung auf Pump:Die erste Amtszeit Ronald Reagans
Machtwechsel und Kontinuität:Westeuropa 1980–1985
Entfesselte Märkte:Die Globalisierung der Arbeitsteilung und die Krise des Sozialstaats
Quadratur des Kreises:Gorbatschows Versuch, die Sowjetunion zu demokratisieren
Die Weltmächte kommen sich näher (I):Das Ende der Ära Reagan
Zwang zum Wandel:Westeuropa 1985–1989
Die Weltmächte kommen sich näher (II):Frühjahr und Sommer 1989
Friedliche Revolution in Ostmitteleuropa:Ungarn und Polen von Mai bis Oktober 1989
Der Fall der Berliner Mauer:Symbol einer Zeitenwende
Von der «samtenen» Revolution zum Blutbad in Bukarest:Die Umwälzungen in der Tschechoslowakei, in Bulgarien und Rumänien
Wiedervereinigung:Die Lösung der deutschen Frage
Antwort auf eine Annexion:Der Golfkrieg von 1991
Zerfall eines Vielvölkerstaates:Der Beginn der jugoslawischen Nachfolgekriege
Untergang eines Imperiums:Die Auflösung der Sowjetunion
Das Scheitern eines Großversuchs:Rückblick auf den Sowjetkommunismus
Kein Ende der Geschichte:Die Jahre 1989–1991 als globale Zäsur
9.: TRÜGERISCHER TRIUMPH:DAS SCHWINDEN DES UNIPOLAREN MOMENTS 1991–2008
Von Maastricht nach Schengen:Die Europäische Union zwischen Vertiefung und Erweiterung
Weltmacht ohne Widerpart:Die USA unter Clinton (I)
Krisen und ein Zusammenbruch:Westeuropa nach der Epochenwende
Fortschritte und ihre Kehrseite:Die USA unter Clinton (II)
Sozialdemokraten an der Macht:Westeuropa um die Jahrtausendwende
Von Amsterdam nach Nizza:Der Euro und das Ringen um die Reform der EU
Intervention ohne Mandat:Der Kosovokrieg in der Kontroverse
«Nine-Eleven»: Die Terroranschläge vom 11. September 2001 als historische Zäsur
Spaltung des Westens:Amerikas «Krieg gegen den Terror»
Die Linke verliert an Boden:Westeuropa am Beginn des 21. Jahrhunderts
Erweiterung versus Vertiefung:Die Europäische Union 2001–2008
Multipolarität statt Machtmonopol:Die USA und die Welt in der zweiten Amtszeit von George W. Bush
Eine globale Zäsur:Vom Beginn der Weltfinanzkrise zur Wahl Barack Obamas
10.: WELT AUS DEN FUGEN: DER WESTEN AUF DEM WEG IN DIE GEGENWART
Die bedrängte Weltmacht: Obamas erste Amtszeit
Befestigungsversuche (I):Drei Staaten im Kampf mit der Finanzkrise
Befestigungsversuche (II):Die Eurozone kämpft um ihren Zusammenhalt
Moskau, Peking, Damaskus: Der Westen in der Defensive
Das Ende des liberalen Zyklus:Die multiple Krise der Europäischen Union
Asylrecht im Widerstreit: Die Migrationskrise von 2015/16
Brexit: Großbritannien im Konflikt mit sich selbst
Der Populismus an der Macht:Die Wahl Donald Trumps und ihre Folgen
Zerreißproben: Europa in der Gefahrenzone (I)
Die normative Erosion schreitet fort: Europa in der Gefahrenzone (II)
Ein vielfach gespaltener Staatenverbund:Die Europawahlen vom Mai 2019
PROJEKT VERSUS PRAXIS:RÜCKBLICK UND AUSBLICK
DANK
ANHANG
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
ANMERKUNGEN
1.Prägungen:Die Entstehung des modernen Westens
2.Grundlegung eines Projekts:Die atlantischen Revolutionen
3.Der alte und der neue Westen:Europa und Amerika 1815–1850
4.Nationalstaaten und Imperien:Der fragmentierte Westen 1850–1890
5.Weltpolitik und Weltkrieg:Die Anfänge des transatlantischen Jahrhunderts 1890–1918
6.Katastrophenzeit:Demokratien und Diktaturen 1918–1945
7.West versus Ost:Die bipolare Welt 1945–1975
8.Auflösung einer Konfrontation:Das Ende des Kalten Krieges 1975–1991
9.Trügerischer Triumph:Das Schwinden des unipolaren Moments 1991–2008
10.Welt aus den Fugen: Der Westen auf dem Weg in die Gegenwart
Projekt versus Praxis:Rückblick und Ausblick
PERSONENREGISTER
ORTSREGISTER
Für Dörte
VORWORT
Dieses Buch ist erstens der Versuch, aus den vier Bänden meiner «Geschichte des Westens», die zwischen 2009 und 2015 erschienen sind, und dem im Jahr 2017 vorgelegten ergänzenden Band «Zerbricht der Westen? Über die gegenwärtige Krise in Europa und Amerika» einen Band zu machen. Was zuvor auf 4600 Textseiten sehr viel ausführlicher dargestellt worden ist, soll hier in verdichteter Form auf weniger als 1000 Seiten nachlesbar sein. Zweitens rückt in diesem Band stärker noch als bisher die Ortsbestimmung der Gegenwart in den Vordergrund und damit der Versuch, den heutigen, unübersehbar krisenhaften Zustand des Westens historisch zu erklären.
Die Straffung erfordert den Verzicht auf eine «flächendeckende» Darstellung. Es sind vorrangig fünf Länder des transatlantischen Westens, von denen im Folgenden die Rede sein wird, nämlich die Vereinigten Staaten von Amerika, Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Italien. Dass der Westen sehr viel größer ist, dass er das heute gern, aber zu Unrecht als «Osteuropa» bezeichnete östliche Mitteleuropa ebenso umfasst wie die einstigen britischen Siedlungskolonien Kanada, Australien und Neuseeland, wird auch in diesem Band immer wieder zur Sprache kommen.
Der Westen: das ist der aus dem mittelalterlichen Okzident, dem lateinischen Europa oder dem Europa der Westkirche, hervorgegangene, durch gemeinsame kultur-, sozial- und rechtsgeschichtliche Tradition geprägte Teil der Welt, in dem im Zuge der beiden atlantischen Revolutionen des späten 18. Jahrhunderts, der Amerikanischen Revolution von 1775/76 und der Französischen Revolution von 1789, erstmals ein den modernen Westen konstituierendes normatives Projekt formuliert wurde, eine politische Ordnung, die sich auf die Ideen der unveräußerlichen Menschenrechte, der Herrschaft des Rechts, der Gewaltenteilung, der Volkssouveränität und der repräsentativen Demokratie gründet.
Die Geschichte des modernen Westens ist eine Geschichte der Widersprüche und der Ungleichzeitigkeiten. Sie war seit den beiden transatlantischen Revolutionen zu einem guten Teil eine Geschichte von Kämpfen um die Aneignung oder Verwerfung der Ideen von 1776 und 1789, von Auseinandersetzungen um verengende oder erweiternde Interpretationen der in Amerika und Frankreich verkündeten politischen Konsequenzen der Aufklärung. Die Geschichte des modernen Westens war von Anfang an immer auch eine Geschichte brutaler Verstöße gegen die damals proklamierten Prinzipien, eine Abfolge von Konflikten zwischen Normen und Interessen, ein Ausdruck des unaufhebbaren Spannungsverhältnisses zwischen der Logik der Werte und der Logik der Macht. Und sie ist eine Geschichte von Selbstkritik und Selbstkorrekturen, also von Lernprozessen. Es ist diese, in den Ideen von 1776 und 1789 angelegte Dynamik, die aus dem normativen Projekt einen normativen Prozess gemacht hat.
Die beiden radikalen Gegenentwürfe zum normativen Projekt des Westens, der faschistische beziehungsweise nationalsozialistische und der sowjetkommunistische, sind gescheitert. Der Triumph des demokratischen Westens am Ende des Ost-West-Konflikts des 20. Jahrhunderts war aber nur von kurzer Dauer. Inzwischen sind andere Herausforderer auf den Plan getreten, obenan das nominell kommunistische, tatsächlich aber staatskapitalistische, nach immer totalerer Kontrolle der Gesellschaft strebende China. Der transatlantische Westen der Gegenwart ist zutiefst gespalten, die normative Erosion der Europäischen Union weit vorangeschritten. Als «Wertegemeinschaft» können sich in ihrem derzeitigen Zustand weder das Atlantische Bündnis noch der Staatenverbund der EU bezeichnen, ohne sich dem Vorwurf auszusetzen, sie verfielen in hohle Phraseologie.
Es ist dieser Westen, von dem die letzten beiden Kapitel des Buches handeln. Kann es einen Westen ohne die Vereinigten Staaten von Amerika geben? Ist der Westen stärker durch sich selbst als durch seine weltpolitischen Kontrahenten gefährdet? Kann das politische Projekt die politische Dominanz des Westens überleben? Es sind solche Fragen, die sich heute aufdrängen. Sie lassen sich, wenn überhaupt, nur beantworten, wenn wir uns zuvor dem Studium der Geschichte des modernen Westens widmen. Eben darum geht es in diesem Buch.
1.
PRÄGUNGEN:DIE ENTSTEHUNG DES MODERNEN WESTENS
Von der Polis zu den Päpsten: Anfänge des Okzidents
Seit wann gibt es das, was wir den Westen nennen? Zum ersten Mal tauchte die Gegenüberstellung von Westen und Osten, von Abendland und Morgenland, Okzident und Orient im Sinne eines kulturellen und politischen Gegensatzes in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts vor Christus im klassischen Griechenland auf. Der Osten stand dabei für die «Barbaren», mit denen man es in den Perserkriegen zu tun zu haben glaubte. Der Westen, das waren die Hellenen, die sich den Persern in jeder Hinsicht überlegen fühlten, und das vor allem darum, weil sie freie Polisbürger, die Perser aber Untertanen eines Großkönigs waren.
Auf die antike Polis, genauer gesagt auf das Athen des Perikles, der von 443 bis zu seinem Tod 429 vor Christus ununterbrochen an der Spitze des Stadtstaates stand, führt eine einflussreiche Denkrichtung bis heute das Wesen des Westens oder Europas zurück. In Athen habe die Wiege der Demokratie gestanden, so lautet das Verdikt. Zur Begründung wird gern aus der Gefallenenrede des Perikles aus dem ersten Jahr des Peloponnesischen Krieges, dem Jahr 431, zitiert, wie sie uns der Historiker Thukydides überliefert hat. In seiner «Geschichte des Peloponnesischen Krieges» heißt es: «Die Verfassung, die wir haben, … heißt Demokratie, weil der Staat nicht auf wenige Bürger, sondern auf die Mehrheit ausgerichtet ist.»[1]
Doch Thukydides hat diese Aussage an anderer Stelle erheblich eingeschränkt. In seiner zusammenfassenden Würdigung des von ihm hochgeschätzten Perikles schreibt er, unter seiner Führung sei Athen zu einem System geworden, das zwar dem Namen nach eine Demokratie, in Wirklichkeit aber die Herrschaft des ersten Mannes (oder, wörtlich übersetzt, durch den ersten Mann) gewesen sei.[2] Spätere Historiker haben zudem darauf hingewiesen, dass von einer Mehrheitsherrschaft im perikleischen Athen auch aus anderen Gründen keine Rede sein konnte. Von den Frauen abgesehen, hatten auch die Metöken, das heißt die in der Stadt ansässigen Fremden, und die Sklaven kein Bürgerrecht. Sie konnten also auch nicht in der Volksversammlung, der ekklesía, oder im Volksgericht, der heliaia, ihre Stimme abgeben.
«Wohl keine andere Ordnung der Weltgeschichte wird mit so evident anachronistischen Maßstäben gewertet wie die athenische Demokratie»: So lautet das treffende Urteil des deutschen Althistorikers Wilfried Nippel. Die athenische Demokratie hat, wenn man die Reformen des Kleisthenes in den Jahren 508/507 als ihren Beginn und die Einführung einer Zensusverfassung im Jahr 322 vor Christus als ihr Ende nimmt, weniger als zwei Jahrhunderte bestanden und bildete, wie Nippel feststellt, einen Sonderfall in der griechischen Welt.[3] Die athenische Demokratie kannte zwar einige verbürgte individuelle Rechte derer, die das Bürgerrecht besaßen, so die Gleichheit des Rechts auf Rede und Antragstellung, die Freiheit der Rede und die Gleichheit vor dem Gesetz. Eine Vorstellung von unveräußerlichen Menschenrechten aber, auf die sich ein Nein zur Sklaverei hätte stützen können, gab es in Athen nicht.
In der athenischen Versammlungsdemokratie zeigten sich auch bereits die Gefahren eines plebiszitären Regimes ohne Trennung der Gewalten, also auch ohne den Rechtsschutz, den nur eine unabhängige Gerichtsbarkeit gewähren kann. Alles hing vom Geschick der Redner ab, was oft genug als Prämie auf Demagogie wirkte: Man denke nur an das Todesurteil, das ein Volksgericht im Jahr 399 vor Christus über den Philosophen Sokrates, den angeblichen Verderber der Jugend, aussprach und damit dazu beitrug, dass Sokrates’ Schüler Platon zu einem leidenschaftlichen Gegner der Herrschaft «der vielen» wurde. Platon und andere griechische Denker wie Aristoteles und Polybios haben aus der vergleichenden Betrachtung der antiken Welt die Folgerung abgeleitet, dass Gemeinwesen gut daran taten, über die Einführung einer Mischverfassung nachzudenken, die die Vorzüge verschiedener Regierungsformen – etwa, so Polybios, Monarchie, Aristokratie und Demokratie – miteinander verband und Übersteigerungen jeder einzelnen von ihnen vermied: eine Einsicht, die von späteren Theoretikern und Praktikern in viel höherem Maß rezipiert wurde als die angebliche athenische «Urdemokratie».
Die Herleitung der Demokratie aus dem perikleischen Athen ist wohl auch deshalb so beliebt, weil sie die Möglichkeit einer rein säkularen Genealogie der Staatsform zu bieten scheint, die heute zu Recht als eine der großen Errungenschaften des Westens gilt. Ununterbrochene Kontinuität weist diese Geschichte freilich nicht auf. Über Jahrtausende hinweg verfügte kein europäisches Land über eine politische Ordnung, auf die sich der Begriff «Demokratie» anwenden lässt. Wo es ständische oder kommunale Mitspracherechte gab, haben diese germanische, keltische, slawische oder andere volkstümliche, aber keine griechischen Wurzeln. Soweit man im nichtbyzantinischen Europa von einer Kontinuität des antiken Erbes sprechen kann, war diese kirchlich vermittelt. Mehr noch: Über Jahrhunderte hinweg blieb die römische Kirche die einzige Kontinuität und Einheit verbürgende Instanz des Okzidents.
Westen versus Osten, Westkirche versus Ostkirche, lateinisches versus griechisches, byzantinisches oder orthodoxes Europa: Wir sind bei einer bis heute nachwirkenden Grundtatsache der europäischen Geschichte Europas und der Geschichte des Westens angelangt. Zwischen beiden muss unterschieden werden. «Europa ist nicht (allein) der Westen. Der Westen geht über Europa hinaus. Aber: Europa geht auch über den Westen hinaus»: Auf diese knappe Formel hat der österreichische Historiker Gerald Stourzh das Verhältnis zwischen Europa und dem Westen gebracht.[4] Zum Westen, aber nicht zu Europa gehören die angelsächsisch geprägten Demokratien in Nordamerika, Australien und Neuseeland. Zu Europa, aber nicht zum Westen gehören die orthodox geprägten Länder des alten Kontinents, darunter Russland, Bulgarien, Rumänien, Serbien und Griechenland.
Auf den ersten Blick mutet es paradox an, dass sich die Ideen der Freiheit und der Demokratie nicht im griechischen, sondern im lateinischen Europa durchgesetzt haben – nicht dort, wo es eine unmittelbare sprachliche und kulturelle Kontinuität mit dem klassischen Hellas gab, sondern dort, wo dessen Erbe nach den Stürmen der Völkerwanderung erst wieder neu rezipiert werden musste, die Kontinuität also eine gebrochene war: im Westteil des einstigen Römischen Reiches. In Byzanz, dem ehemaligen Ostrom, herrschte ein Kaiser, dem ein Patriarch als oberster Bischof der östlichen Christenheit untergeordnet war. Im Westteil des einstigen Römischen Reiches formten sich im Übergang von der Antike zum Mittelalter mehrere Königreiche heraus, denen der Bischof von Rom, der Papst, als Oberhirte der westlichen Christenheit gegenüberstand.
Im Jahr 800 hatte Leo III. das Amt des Bischofs von Rom inne. Er war es, der in jenem Jahr den Frankenkönig Karl (den Großen) zum römischen Kaiser krönte und sich selbst demonstrativ von Byzanz lossagte. Mit dem Begriff «römischer Kaiser» stellte Leo III. klar, dass er im König der Franken nicht das Oberhaupt eines weströmischen Teilreiches oder eines fränkischen Kaisertums sah, sondern den Nachfolger der Kaiser des ungeteilten Imperium Romanum. Er suggerierte damit eine historische Kontinuität, die es in Wirklichkeit nicht gab, und legte so den Grund für den späteren Mythos von der «translatio imperii», die Legende, wonach das mittelalterliche Reich der Deutschen, das Sacrum Imperium oder Heilige Römische Reich, kein neues, sondern das alte römische Reich war, das im Jahre 800 von den Griechen auf die Franken und damit auf die Deutschen übertragen worden sei.
Mehrere Könige, zwei Kaiser, ein Papst: Diese Konstellation blieb, wenn auch nicht ohne Unterbrechungen, bis zum Untergang des byzantinischen Reiches nach der Eroberung seiner Hauptstadt Konstantinopel durch die Osmanen im Jahr 1453 bestimmend für die Geschichte Europas.
Frühe Gewaltenteilungen: Vom Mittelalter zur Renaissance
In der rein säkularen Lesart der Demokratiegeschichte kommen Kirche, Christentum und Religion kaum, es sei denn als Gegner aller freiheitlichen Bestrebungen, vor. Das vermeintlich durch und durch «finstere» Mittelalter wird dabei meist übersprungen. Auf die griechisch-römische Antike folgen ziemlich unvermittelt die Renaissance, die Aufklärung und die Französische Revolution von 1789. Doch entgegen diesem, im laizistischen Frankreich fast schon offiziellen Narrativ ist die Geschichte des Westens durch nichts so stark geprägt worden wie durch die Religion in Gestalt des erst jüdischen, dann auch christlichen Monotheismus und der auf Jesus zurückgehenden strikten Trennung der Sphären von Gott und Kaiser.
Der Gedanke der Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz hätte sich kaum durchgesetzt, wäre dem nicht der Glaube vorausgegangen, dass es nur einen Gott gibt, vor dem alle Menschen gleich sind. Die Idee der unverwechselbaren Würde jedes einzelnen Menschen ist angelegt in dem Glauben, dass Gott den Menschen nach seinem Bilde schuf. Als Jesus das von drei Evangelisten überlieferte Wort aussprach «So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist»,[5] schloss das ein Nein zu jeder Art von Theokratie oder Priesterherrschaft ein. Die christliche Unterscheidung von göttlichen und irdischen Gesetzen, zu der es keine Entsprechung im gleichfalls monotheistischen Islam gibt, ermöglichte letztlich die Säkularisierung der Welt und die Emanzipation des Menschen – eine weltgeschichtliche Wirkung, die freilich erst nach schweren Kämpfen, beginnend mit innerkirchlichen Auseinandersetzungen, eintreten konnte.
Nur in einem Teil Europas hat sich die Unterscheidung der Sphären von Gott und Kaiser über ein Jahrtausend nach Christus in einer vertraglich geregelten institutionellen Gewaltenteilung niedergeschlagen: im Europa der Westkirche, das freilich seit jeher schon das Spannungsverhältnis zwischen dem Papst und den weltlichen Herrschern kannte. Nur hier, im Okzident, kam es im 12. Jahrhundert zu jener ansatzweisen Trennung zwischen «imperium» beziehungsweise «regnum» und «sacerdotium», das heißt zwischen weltlichen Herrschern und dem Papst, die für die Entwicklung des Westens konstitutiv wurde. Wo die geistliche Gewalt der weltlichen untergeordnet blieb, wie in den Ländern des orthodoxen Christentums, fehlte ein entscheidendes Merkmal des Westens: sein «dualistischer Geist», von dem der Historiker Otto Hintze 1931 gesprochen hat.[6]
Die Ausdifferenzierung von geistlicher und weltlicher Gewalt, wie sie unter anderem im Wormser Konkordat von 1122 Gestalt annahm, war ein Ergebnis der von Gregor VII. durch den «Dictatus Papae» von 1075 ausgelösten «Papstrevolution», bei der es nicht nur um die Freiheit der Kirche, sondern um die Unterwerfung der weltlichen Herrscher unter den Willen des Stellvertreters Christi auf Erden ging. Das Ergebnis des Konflikts war ein historischer Kompromiss, der beiden Seiten, dem Papst und den weltlichen Herrschern, ihr Eigenrecht ließ.[7]
Hätte es diese grundlegende Gewaltenteilung, die Trennung von geistlicher und weltlicher Gewalt, nicht gegeben, hätte sich schwerlich der innerweltliche Dualismus entwickeln können, der den Kern korporativer und individueller Freiheit in sich barg – der Dualismus, den Hintze am Beispiel der ständischen Repräsentativverfassung und damit der Trennung von ständischer und fürstlicher Gewalt oder von Land und Herrscher untersucht hat. Das berühmteste Beispiel einer entsprechenden Vereinbarung ist die Magna Charta von 1215, auf der die Macht des englischen Parlaments und namentlich die seiner zweiten Kammer, des Unterhauses, der Vertretung des niederen Adels, der Gentry, und des städtischen Bürgertums, beruht. Wir können den «dualistischen Geist» aber auch im wechselseitigen Treueverhältnis von Lehensherren und Vasallen, dem spezifischen Merkmal des Feudalismus, erkennen, desgleichen im Neben- und Miteinander von grundherrlicher und bäuerlicher Landwirtschaft, von sich selbst verwaltender Bürgerstadt und feudalem Umland, von genossenschaftlichen und herrschaftlichen Organisationsformen, von Zusammenschlüssen der Lehrenden und der Lernenden an den mittelalterlichen Universitäten.
Die ansatzweise Trennung von geistlicher und weltlicher Gewalt im Investiturstreit um die Einsetzung von Bischöfen und Äbten im späten 11. und frühen 12. Jahrhundert wurde zur Bedingung der Möglichkeit aller weiteren Gewaltenteilungen – von der schon erwähnten Trennung von fürstlicher und ständischer Gewalt bis hin zur modernen Trennung von gesetzgebender, ausführender und rechtsprechender Gewalt. Das aber heißt nichts anderes, als dass der Dualismus, wie er sich im hohen Mittelalter herausbildete, die Gründungskonstellation und die Grundstruktur des Westens war: ohne Dualismus kein Pluralismus und kein Individualismus.
Nur im Westen Europas konnte sich in einem langen Prozess jenes Klima des bohrenden Fragens entwickeln, das im wörtlichen wie im übertragenen Sinn den Aufbruch zu neuen Ufern erlaubte. Nur im Westen formte sich, beginnend mit Klerikern wie Berengar von Tours und Petrus Abaelard, eine Tradition theologischer Selbstaufklärung heraus, die von der Kirche aufs schärfste bekämpft wurde, aber nicht ausgerottet werden konnte. Nur im Westen wurde durch die fortschreitende Ausdifferenzierung der Gewalten der Grund gelegt für eine pluralistische Zivilgesellschaft. Nur im lateinischen, nicht im byzantinischen Europa gab es den Rationalisierungsschub, der von der Rezeption des römischen Rechts ausging. Nur im Westen entstand ein städtisches Bürgertum, das wagemutige Kaufleute und Unternehmer, Erfinder und Entdecker in großer Zahl hervorbrachte. Nur im Westen konnte sich der Geist des Individualismus entfalten, der eine Bedingung allen weiteren Fortschritts in Richtung von mehr Freiheit und verbürgten Rechten war.[8]
Finster war das Mittelalter auf vielen Gebieten freilich auch. Es gab die gewaltsame Christianisierung heidnisch gebliebener und muslimisch gewordener Teile Europas und die blutigen Kreuzzüge zur Befreiung des Heiligen Landes von der muslimischen Herrschaft; es gab die gnadenlose Verfolgung aller, die von kirchlichen Dogmen abwichen, von Juden, männlichen Homosexuellen und Leprakranken; es gab primitivsten Aberglauben und, weit über das Mittelalter hinaus, die Verbrennung von Frauen, nicht selten auch Männern, die im Verdacht der Hexerei standen. Doch das «finstere Mittelalter» trug auch die Keime seiner Überwindung durch Humanismus und Renaissance, Reformation und Aufklärung in sich.
Es war letztlich der Geist des Wettbewerbs zwischen autonomen Akteuren, der diese Entwicklung ermöglichte und dem Okzident dazu verhalf, Kulturen wie der arabischen und der chinesischen, die ihm auf vielen Feldern, vor allem denen der Wissenschaft und der Technik, lange Zeit weit überlegen gewesen waren, den Rang abzulaufen. Was äußerlich wie eine Schwäche des Okzidents aussah, erwies sich als seine Stärke. Er bildete keine politische Einheit, sondern gliederte sich in viele Nationen und Herrschaften, aus denen sich allmählich Territorial- und in einigen Fällen wie etwa in England, Frankreich und Spanien auch schon Nationalstaaten herausbildeten. Der Kaiser an der Spitze des Heiligen Römischen Reiches, seit der Krönung des Sachsenkönigs Ottos des Großen durch Papst Johannes XII. in Rom im Jahr 962 der von den wahlberechtigten deutschen Fürsten gewählte Römische König, konnte zwar als Schutzherr der römischen Kirche protokollarisch den Rang des «primus inter pares» unter den europäischen Königen beanspruchen, war ihnen aber ansonsten in keiner Weise übergeordnet.
Die nationale Vielfalt bildete ein Merkmal bereits des mittelalterlichen Europa. In den Worten des Historikers Hermann Heimpel: «Dass es Nationen gibt, ist historisch das Europäische an Europa.»[9] Dem Wettbewerb zwischen den Nationen, zwischen den Staaten und den Städten entsprach der zwischen den Universitäten, die ein hohes Maß an geistiger Freiheit besaßen, zwischen Kaufleuten, Bankiers und Unternehmern, zwischen Intellektuellen und Künstlern.
Doch trotz der zahllosen nationalen und regionalen Besonderheiten, die durch diesen Wettbewerb begünstigt wurden, bildete der durch und durch pluralistische Okzident des Mittelalters eine unverwechselbare Einheit. Der romanische und der gotische Baustil breiteten sich nur im Europa der Westkirche aus, und nur hier entwickelte sich innerhalb der theologischen Scholastik eine zunehmend unabhängige Philosophie, die offen war für die Anregungen, die sie durch byzantinische und jüdische, arabische und persische Wissenschaftler und das von ihnen gepflegte antike, namentlich das aristotelische Erbe empfing.
Der Übergang vom Mittelalter zur Renaissance war sehr viel fließender, als es eine gängige Meinung wahrhaben will. Der Säkularisierungsschub, den die Renaissance seit der Mitte des 14. Jahrhunderts brachte, kam nicht unvermittelt. Die intellektuelle Produktivkraft des Zweifels entdeckte nicht erst René Descartes in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, sondern schon fünf Jahrhunderte vorher Abaelard, ein von Vernunftprinzipien geleiteter Scholastiker.[10]
Die Wiederentdeckung der Antike war ein Prozess, der mit der «karolingischen Renaissance» um 800 begann und sich über Jahrhunderte hinzog. Philosophie und Kunst der Renaissance beruhten auf Grundlagen, derer sich viele ihrer Repräsentanten nur ungern erinnerten. Die Durchsetzung der perspektivischen Darstellung in der Malerei und der Polyphonie in der Musik seit dem 15. Jahrhundert stehen für einen künstlerischen Fortschritt, den es ohne eine lange Tradition geistiger Freiheit nicht hätte geben können und der eben deshalb im byzantinisch-orthodoxen Europa lange Zeit keine Heimstatt fand. Und nur im lateinischen Europa ereignete sich im 16. Jahrhundert jene tiefe Glaubensspaltung, die fortan die Geschichte Europas und des Westens prägen sollte und die sich nur dort ausbreiten konnte, wo Kirche und Wissenschaft sich schon im Mittelalter verbriefte Freiräume zu sichern vermocht hatten.[11]
Lutheraner, Calvinisten, Katholiken:Die Reformation und ihre Folgen
Dass die Reformation binnen kurzer Zeit große Teile Europas erfassen konnte, lag vor allem an der medialen Revolution, die ihr vorausging: der Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern durch Johannes Gutenberg in Mainz um 1450. Das mühsame Kopieren von Büchern, meist ein Werk von Mönchen, die in klösterlicher Abgeschiedenheit lebten, wurde damit überflüssig; die Leserzahlen explodierten förmlich. Dazu kam, dass die meisten Reformatoren, obenan Martin Luther, sich vorzugsweise der Volkssprache bedienten. Sie erreichten damit ein Publikum, das denen verschlossen blieb, die ihre Werke nur in der «lingua franca» des gebildeten Westens, auf Lateinisch, veröffentlichten, was auch die meisten gebildeten Humanisten des 16. Jahrhunderts taten.
Ihrem Ursprung nach war die Reformation eine deutsche, ihren politischen Wirkungen nach eine angelsächsische Revolution. An Martin Luther orientierten sich alle anderen Reformatoren, soweit es um die theologischen Grundlagen der kirchlichen Erneuerung ging. Für die Entwicklung von Staat und Gesellschaft hatte hingegen Calvin eine ungleich größere Bedeutung als Luther. Kapitalismus und Demokratie sind in hohem Maß mit der Wirkung von Gedanken des Genfer Reformators verbunden. Das Luthertum enthielt demgegenüber keine Elemente, die auf eine dynamische Umwälzung des Wirtschaftslebens und eine Bindung der Regierenden an den Willen des Volkes hinausliefen. Politisch und gesellschaftlich gesehen, war Luther ein konservativer Revolutionär.
Dass im Verhältnis der Menschen zu Gott letztlich alles vom Glauben des Individuums und nicht von anderen Menschen abhing, das war ein revolutionärer Gedanke. Luther wertete damit das persönliche Gewissen und die Glaubensfreiheit des Einzelnen in einer Weise auf, die mit dem Autoritätsanspruch der katholischen Kirche unvereinbar war und zum Bruch mit ihr führte. Die neue, die evangelische Kirche hatte dafür zu sorgen, dass ihre Pfarrer das Evangelium auf die rechte Art verkündeten, die Gemeindemitglieder auf diese Weise im Glauben festigten und in einer christlichen Lebensführung bestärkten. Der evangelische Landesherr hatte die Kirche darin zu unterstützen, denn nur er besaß die Machtmittel, die nötig waren, um den neuen Glauben gegen seine Feinde zu verteidigen und seine Verächter zu züchtigen.
Politisch betrachtet, war Luthers Reformation, wie der Universalhistoriker Eugen Rosenstock-Huessy bemerkt hat, eine Fürstenrevolution.[12] Die deutschen Landesherren hatten seit dem ausgehenden Mittelalter danach gestrebt, «Papst im eigenen Lande» zu werden. Durch die Reformation, die von Wittenberg ihren Ausgang nahm, wurden sie es. Deutschland sei durch die Reformation «östlicher» geworden, urteilt Franz Borkenau, wie Rosenstock-Huessy ein von Hitler ins Exil getriebener universal gebildeter Intellektueller. Der «östlichste» Zug des Luthertums war sicherlich der Summepiskopat: Die Übernahme des Amtes des Landesbischofs durch den Landesherrn in den lutherischen Territorien Deutschlands brachte ein Wesensmerkmal des mittelalterlichen Okzidents, die Trennung von geistlicher und weltlicher Gewalt, in stärkerem Maß zum Verschwinden, als das bei katholischen Spielarten des Staatskirchentums wie dem Gallikanismus in Frankreich geschah. «Die geistige Befreiung war im Luthertum mit weltlicher Knechtschaft erkauft»: In diesem Satz bündelt Borkenau das widersprüchliche Erbe der Reformation Luthers.[13]
Das lutherische Staatskirchentum gab es in Deutschland, solange hier Fürsten regierten, also bis zum Sturz der Monarchie im November 1918. Als noch beständiger erwies sich der Summepiskopat lutherischer Prägung in Nordeuropa, wo die Reformation eindeutiger als in Deutschland von oben eingeführt wurde. In Schweden wurde die evangelische Staatskirche erst am 1. Januar 2000 in die Selbständigkeit entlassen. In Dänemark und Norwegen ist die Kirche nach wie vor eine staatliche Einrichtung mit monarchischer Spitze. Doch die Verbindung von lutherischer Kirche und absoluter Monarchie war in Skandinavien weniger dauerhaft als in den deutschen Territorialstaaten. Schweden verwandelte sich im frühen 18. Jahrhundert in eine konstitutionelle Monarchie. In Dänemark, dessen König von 1380/87 bis 1814 auch die norwegische Krone trug, gewann der Adel Ende des 18. Jahrhunderts, wenn auch nicht auf Dauer, seinen Einfluss zurück. Die lutherische Staatskirche passte sich den veränderten Verhältnissen an: Anders als in Preußen-Deutschland trat sie im 19. und 20. Jahrhundert nicht als aktive Gegnerin konstitutioneller, liberaler und demokratischer Bestrebungen auf.
Eine protestantische Staatskirche war auch die «Church of England», die anglikanische Kirche, die sich zuerst von lutherischen Theologen, später auch von den Lehren des Zürcher Reformators Ulrich Zwingli beeinflussen ließ. In der Bevölkerung fand die von «oben», nämlich von König Heinrich VIII., 1534 angeordnete Abkehr vom römischen Katholizismus viel Zustimmung, und vom hohen und niederen Adel, der wie der König selbst aus der Konfiskation des Klostergutes großen Nutzen zog, galt das erst recht. Die neue anglikanische Kirche lehnte sich in ihrer Liturgie seit Mitte des 16. Jahrhunderts mehr an Calvin und Zwingli als an Luther an. In der äußeren Form des Gottesdienstes und anderer kirchlicher Zeremonien aber blieb die Church of England so sehr der katholischen Tradition verhaftet, dass die strenggläubigen Calvinisten davon zurückgestoßen wurden. Aus ihren Reihen sollten sich seit dem späten 16. Jahrhundert die entschiedensten Kämpfer gegen das neue Staatskirchentum rekrutieren.
Der evangelische Religionsphilosoph Ernst Troeltsch hat den ursprünglichen Calvinismus eine «Tochterreligion des Luthertums» genannt und ihm zugleich bescheinigt, die «Ausbreitung der Kirchenreform über den Westen und von ihm aus über die neue Welt» sei sein Werk, so dass der Calvinismus «heute (1912, H. A. W.) als die eigentliche Hauptmacht des Protestantismus betrachtet werden» müsse.[14]
Was den Calvinismus vom Luthertum vor allem abhebt, ist der Prädestinationsgedanke des Reformators. Für Calvin ist Gottes Wille absolut souverän, seine Gnade kann nicht auf Grund vermeintlicher Verdienste erlangt werden. Es ist sein Wesen, dem einen das Heil ohne alles Verdienst freiwillig zu schenken und den anderen ihrer Sündhaftigkeit gemäß das Verderben zu bereiten. Dem auserwählten Einzelnen obliegt es, Gott in seinem Handeln zu ehren und zu verherrlichen. In Kampf und Arbeit vollzieht sich die Heiligung der Welt. Diese verlangt innerweltliche Askese: Das ist der Kerngedanke der calvinistischen Ethik, und folglich gilt ihr Trägheit als das gefährlichste Laster.
Mögen die Menschen im Verhältnis zueinander ungleich sein, so sind doch für Calvin vor Gott alle Menschen gleich. Und so wie vor Gott alle Menschen gleich sind, muss es auch eine gleiche Herrschaft des Gesetzes über alle geben. Das war zwar kein Aufruf zur Schaffung eines demokratischen Gemeinwesens, aber ungeachtet aller patriarchalischen und autoritären Züge dieses Gesellschaftsentwurfs doch ein Beitrag zur Ermöglichung einer freiheitlichen Entwicklung. In den Worten von Troeltsch: «Hier ist eine konservative Demokratie möglich, während die Demokratie auf lutherischem und katholischem Gebiet von vornherein in eine aggressive und revolutionäre Richtung gedrängt ist.»[15]
Viel ist über die klassische, im Jahr 1905 veröffentlichte These Max Webers vom engen Zusammenhang zwischen der calvinistischen Ethik und dem «Geist des Kapitalismus» gestritten worden. Es trifft zu, dass es schon vor der Reformation und in katholisch gebliebenen Gebieten, in Norditalien und in Flandern etwa, Erscheinungsformen von kapitalistischem Unternehmertum gegeben hat. Aber wo immer die Gegenreformation seit Mitte des 16. Jahrhunderts konsequent durchgeführt wurde, vernichtete sie weitgehend, was an solchen Ansätzen vorhanden war. Es war auch nicht der Calvinismus als solcher, der ohne Weiteres eine neue Wirtschaftsethik hervorbrachte. Diese Wirkung trat nicht zufällig vor allem dort ein, wo Anhänger des reformierten Glaubens besonderem politischen Druck ausgesetzt oder diesem gerade entkommen waren. Die Beispiele der englischen Dissenters und der aus Frankreich vertriebenen Hugenotten machen das deutlich.[16]
Doch es gab eine Art von Wahlverwandtschaft zwischen dem «Geist» des Calvinismus und dem «Geist» des Kapitalismus. Die Rechenhaftigkeit und Rationalität des Wirtschaftens, das Streben nach mehr Gewinn, die unablässige Suche nach neuen Absatzmärkten: Das alles ließ sich mit Calvins Gedanken der persönlichen Leistung und Bewährung, der von Max Weber so genannten «innerweltlichen Askese», gut vereinbaren. Dem Luthertum fehlte ein solcher dynamischer, am Prinzip des Wettbewerbs ausgerichteter Antrieb. Nicht individueller Wagemut und ständiges Wachstum der Erträge, sondern die Befriedigung des gewohnten, standesgemäßen Bedarfs und ein gerechter Preis waren die Leitideen des Wirtschaftens in lutherisch geprägten Territorien. In dieser Hinsicht unterschieden sich Lutheraner und Katholiken viel weniger voneinander als Lutheraner und Calvinisten.[17]
Die Reformation bedeutete nicht die endgültige Überwindung des Mittelalters. So wie das neue Staatskirchentum einen Rückfall unter ein bereits erreichtes Entwicklungsstadium bedeutete, so auch Luthers Geringschätzung der menschlichen Vernunft. In der Judenfeindschaft des späten Luther lebte das «finstere Mittelalter» fort, was verhängnisvolle Folgen vor allem im Mutterland der Reformation haben sollte. Man musste auch nicht mit der katholischen Kirche brechen, um revolutionären Gedanken zum Durchbruch zu verhelfen. Dass nicht die Erde, sondern die Sonne der Mittelpunkt des Weltalls war, entdeckte jener Thorner Kanonikus, der der «kopernikanischen Wende» den Namen gab: Nikolaus Kopernikus, ein katholischer Zeitgenosse Luthers.
Von den Humanisten des 16. Jahrhunderts, den beredten Anwälten vernunftgeleiteter Toleranz, schlossen sich viele nicht der Reformation an. Der berühmteste von ihnen, Erasmus von Rotterdam, sah sich 1524 widerstrebend genötigt, Luther wegen dessen Leugnung des freien Willens öffentlich zu widersprechen. In Spanien erlebte zur gleichen Zeit die Scholastik eine späte Blüte. Einer ihrer herausragenden Vertreter, der Begründer des modernen Völkerrechts, der Dominikaner Francisco de Vitoria, war einer der ersten, die Protest einlegten gegen die Unterdrückung, Misshandlung und massenhafte Tötung der mittel- und südamerikanischen Indios durch die spanischen Konquistadoren. Was Vitoria zum Programm erhob, klang nicht nur humanistisch. Es war vom Geist des Humanismus inspiriert.
Zugleich waren die Rechtsgrundsätze Francisco de Vitorias der Niederschlag von persönlichen Erfahrungen eines dominikanischen Ordensbruders, des «Apostels der Indios» und späteren Bischofs von Chiapas in Mexiko, Bartolomé de Las Casas, die dieser seit 1502 in Mittel- und Südamerika gemacht hatte. Die Schilderung der Grausamkeiten, die die spanischen Eroberer an den Indios begingen, durch Las Casas und die juristischen Lehren, die Vitoria daraus ableitete, blieben nicht völlig folgenlos: 1542 konnte Las Casas mit den «Neuen Gesetzen» nach Mexiko zurückkehren, die die Indios schützen und ihrer Missionierung ein menschliches Antlitz geben sollten, freilich kaum praktische Konsequenzen hatten. Die Menschlichkeit Las Casas’ ging im Übrigen zu Lasten Dritter. Um die Versklavung der Indios zu beenden, hatte er bereits 1517 bei der spanischen Krone die Erlaubnis erwirkt, schwarze Sklaven aus Afrika einzuführen, die als körperlich stärker belastbar galten: eine folgenschwere Entscheidung, die am Beginn des jahrhundertelangen transatlantischen Sklavenhandels steht.[18]
Die Zähmung des Leviathan:Vom Dreißigjährigen Krieg zur Glorious Revolution
Ein Jahrhundert nach dem Beginn der Reformation in Deutschland begann im Mai 1618 der Dreißigjährige Krieg. Er war nie nur ein Religions- und Bürgerkrieg, sondern immer auch ein Krieg der Staaten und der Staatenbündnisse. Doch es war kein Zufall, dass ein Streit um die Rechte von Glaubensgemeinschaften am Beginn des großen Mordens stand und dass der Krieg im multikonfessionellen Heiligen Römischen Reich deutscher Nation ausbrach, wo sich der Hass auf die jeweils andere Konfession schon seit langem aufgestaut hatte. Glaubensfragen waren das, was die Menschen jener Zeit am meisten bewegte. Mehr als soziale oder nationale Unterschiede eigneten sich die Gegensätze zwischen den Konfessionen zum Appell an Leidenschaften und Solidaritätsgefühle. Was für die Gläubigen galt, musste aber noch lange nicht für die Staatenlenker gelten. In der zweiten Hälfte des Großen Krieges, von 1635 bis 1648, focht das katholische Frankreich an der Seite des lutherischen Schweden gegen das katholische Haus Habsburg, das im Reich wie in Spanien den Herrscher stellte und die Macht in den Spanischen Niederlanden, dem späteren Belgien, ausübte.
In der kollektiven Erinnerung der Deutschen lebte der Dreißigjährige Krieg bis weit in das 20. Jahrhundert hinein als die nationale Katastrophe schlechthin fort. Große Teile des Reiches haben sich von den Folgen des drei Jahrzehnte währenden Brandschatzens und Mordens erst viele Jahrzehnte später erholt. Die Bauern waren verarmt; von einem aufsteigenden Bürgertum konnte angesichts der Verwüstung zahlloser, einst wohlhabender Städte auf lange Zeit keine Rede mehr sein. Das Reich war nachhaltig geschwächt, ja kaum noch ein europäischer Machtfaktor. Die gesellschaftlichen Hauptgewinner des Krieges waren die Landesherren, die staatsnahen Teile des Adels, das Militär und das Beamtentum, die Hauptsäulen des entstehenden Absolutismus. Kriegsgräuel, Massensterben und Entbehrungen bewirkten eine verstärkte Wendung nach innen: eine erneuerte Laienfrömmigkeit, die im evangelischen Deutschland dem Pietismus des 17. und 18. Jahrhunderts den Boden bereitete. Die verlässlichste Stütze ihrer Herrschaft fanden die Obrigkeiten fortan in einer tief sitzenden, ja traumatischen Angst, die man wohl das bleibende Ergebnis des Dreißigjährigen Krieges nennen kann: der Angst vor der Demütigung durch andere Mächte, vor dem Zusammenbruch aller gewohnten Ordnung, vor Chaos und fremder Soldateska, vor Bruder- und Bürgerkrieg, vor der Apokalypse.
Die wichtigste Lehre, die der Krieg abwarf, war die Einsicht in die Unabdingbarkeit von religiöser Toleranz. Erzwingen konnte diese Duldung nur ein starker Staat, der bereit war, sich in gewissen Grenzen zu säkularisieren und damit in religiösen Dingen zu neutralisieren. Der fürstliche Absolutismus war nicht zuletzt eine Folge der Verabsolutierung von Glaubensfragen. Was die Untertanen an innerer Freiheit gewannen, bezahlten sie mit noch mehr Unterordnung unter die weltlichen Obrigkeiten.
Der Friede von Münster und Osnabrück, mit dem der Dreißigjährige Krieg 1648 endete, bildete fortan das wichtigste Dokument des Jus Publicum Europaeum, des europäischen Rechts und damit des Völkerrechts. Es beruhte, sieht man vom Sonderfall des Reiches ab, auf der Souveränität der Staaten. Aus dem Prinzip der Souveränität folgte das der Nichtintervention: Kein Staat hatte das Recht, sich in die inneren Angelegenheiten eines anderen Staates, etwa unter Berufung auf eine unerträgliche religiöse oder politische Unterdrückung von Untertanen, einzumischen. Das ist die Quintessenz dessen, was man das «Westfälische System» nennt.[19]
Nicht nur auf dem europäischen Kontinent, auch in England spitzten sich im 17. Jahrhundert die religiösen Konflikte zu, und auch hier verstärkten sich die Tendenzen in Richtung der absolutistischen Herrschaft der Monarchen. In England aber setzten sich nach einem blutigen Bürgerkrieg, der sogenannten Puritanischen Revolution, der anschließenden Diktatur des radikalen Puritaners Oliver Cromwell und einer Phase der monarchischen Restauration, der niedere Adel, die Gentry, und das städtische Bürgertum, vertreten durch das Unterhaus, gegenüber der Krone durch. Zu den Ergebnissen der «Glorious Revolution» von 1688/89, der zweiten englischen Revolution des 17. Jahrhunderts, gehörte die Declaration of Rights, häufiger auch Bill of Rights genannt, vom 13. Februar 1689. Fortan war es dem König untersagt, ohne Zustimmung des Parlaments Gesetze außer Kraft zu setzen, die Untertanen vom Gehorsam gegen die Gesetze zu entbinden, Abgaben zu erheben und in Friedenszeiten ein stehendes Heer zu unterhalten. Es gab nur noch die ordentlichen und keine besonderen königlichen Gerichte mehr. Übermäßige Geldstrafen sowie grausame und ungewöhnliche Strafen waren verboten. Die Declaration of Rights verbürgte freie Parlamentswahlen, die Freiheit der parlamentarischen Rede und die häufige Einberufung des Parlaments.
Die Glorious Revolution war eine konservative Revolution. 1688/89 setzten sich die Verteidiger des guten alten Rechts, der Magna Charta und des Common Law, gegenüber den absolutistisch gesinnten Neuerern durch, die der Krone den Vorrang vor dem Parlament zuerkannt wissen wollten. Der parlamentarische Gegensatz von Whigs und Tories, den späteren Liberalen und Konservativen, war nur ein milder Abglanz der Frontstellungen, die in den vierziger Jahren zum Bürgerkrieg und zur Puritanischen Revolution geführt hatten. Nach der Glorreichen Revolution vergingen noch rund drei Jahrzehnte, bis man von einem parlamentarischen System in England sprechen konnte – einem System, in dem die Volksvertretung bestimmt, wer das Land regiert, das Parlament also der eigentliche Souverän ist. Eine konstitutionelle Monarchie aber war England, auch wenn es keine geschriebene Verfassung kannte, schon seit dem Regimewechsel von 1688/89.[20]
Die beiden englischen Revolutionen des 17. Jahrhunderts haben auch in der politischen Ideengeschichte des Westens tiefe Spuren hinterlassen. Zwei klassische Werke sind in dieser Zeit entstanden: der «Leviathan» von Thomas Hobbes und der «Second Treatise of Government» von John Locke. Hobbes, Sohn eines englischen Landgeistlichen, hatte sich 1640, kurz vor Ausbruch des offenen Bürgerkriegs, ins freiwillige Exil nach Paris begeben, um der drohenden Verfolgung der Anhänger Karls I., des neun Jahre später von den radikal calvinistischen Puritanern aufs Schafott geschickten Stuartkönigs, zu entgehen. In Frankreich entstand Hobbes’ bedeutendstes Werk, der «Leviathan», das er 1651, wenige Monate nach seiner Rückkehr nach England, zuerst auf Englisch, geraume Zeit später auch auf Lateinisch verlegen ließ. Den Namen Leviathan entnahm Hobbes dem alttestamentarischen Buch Hiob. Dort ist der Leviathan das gewaltige Seeungeheuer, das viel ausführlicher und furchterregender geschildert wird als der Behemoth, das ebenfalls riesige, aber eher gutmütige Landtier.
Für Hobbes ist der Leviathan der «sterbliche Gott, dem wir unter dem unsterblichen Gott unseren Frieden und Schutz verdanken». Seine Geburt, die Staatsgründung, fällt zusammen mit dem Entschluss der Menschen, durch einen Vertrag, den jeder mit jedem schließt, alle Macht auf Einen, den irdischen Gott oder Souverän, zu übertragen, damit dieser sie vor dem Rückfall in den Naturzustand, den Krieg aller gegen alle («bellum omnium contra omnes»), schützt. Was den Menschen nach Frieden streben lässt, sind seine Todesfurcht, sein Verlangen nach Dingen, die das Leben angenehmer machen, und die Hoffnung, diese Dinge zu erlangen. Der Vertrag, der den Souverän schafft, bindet nur die Untertanen untereinander, nicht aber den Inhaber der höchsten Gewalt. Dessen Gesetze bedürfen keiner Rechtfertigung vor einem philosophischen Anspruch auf Wahrheit. Es reicht vielmehr, dass die Autorität der höchsten Gewalt hinter ihnen steht. Sich gegenüber diesen Gesetzen auf das eigene Gewissen zu berufen, bleibt den Untertanen verwehrt.
Eine Gewaltenteilung schließt Hobbes aus: Die souveräne Gewalt teilen heißt sie auflösen. Das gilt ausdrücklich auch für die Trennung von geistlicher und weltlicher Gewalt. Der bürgerliche Souverän ist vielmehr zugleich oberster Priester. Von der Bindung des Souveräns an das Naturrecht, wie sie der französische Vordenker der Souveränität, Jean Bodin, in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts postuliert hatte, bleibt bei Hobbes nur noch die Pflicht des Herrschers übrig, das Leben der Menschen zu sichern. Daraus ergibt sich ein eng begrenztes Recht auf Gehorsamverweigerung. Was die religiösen Überzeugungen der Untertanen angeht, ist nur ein Dogma verpflichtend: der Glaubenssatz, dass Jesus der Christus ist, das heißt der König, den Gott den Menschen versprochen und geschickt hat. Mehr als ein Bekenntnis zu diesem Fundamentalsatz konnte auch der weltliche Herrscher von seinen Untertanen in religiöser Hinsicht nicht fordern. Damit gab es im Staat des Leviathan doch noch so etwas wie einen Restbestand an individueller Freiheit.
In der politischen Praxis stellte sich Hobbes jeweils auf die Seite der politischen Kraft, die er am ehesten für entschlossen und fähig hielt, den Bürgerkrieg zu verhindern. Waren dies vor seiner Flucht nach Paris die Royalisten aus dem Haus Stuart gewesen, so war es nach seiner Rückkehr nach England erst das Regime des Lord Protector Oliver Cromwell, dann, nach 1660, die wiederhergestellte Monarchie Karls II. Der Ausschluss aller Katholiken und Dissenters von öffentlichen Ämtern durch den Test Act von 1673 lag ganz auf der Linie von Hobbes’ Verteidigung des anglikanischen Staatskirchentums. 1679 starb Hobbes im Alter von 91 Jahren. Es war dasselbe Jahr, in dem das Parlament die Habeas-Corpus-Akte verabschiedete, die die Untertanen der englischen Krone vor willkürlichen Verhaftungen und Gefängnishaft ohne Gerichtsverfahren schützte. Wäre in England damals ein großer «Leviathan» an der Macht gewesen, hätte er das gewiss zu verhindern gewusst.[21]
Zehn Jahre nach dem Tod von Hobbes, 1689/90, erschien in London ein Buch mit dem Titel «Two Treatises of Government» aus der Feder des Philosophen John Locke, der die Jahre zwischen 1682 und 1689 im Exil in Holland verbracht hatte. Im ersten Teil setzte sich der Verfasser mit einer inzwischen weithin vergessenen royalistischen Kampfschrift von Sir Robert Filmer auseinander. Im zweiten Teil ging es um die ursprüngliche Form, die Ausdehnung und den Zweck der Staatsgewalt. Es war dieser zweite Essay, der «Second Treatise of Government», der nicht zuletzt dank einer 1691 erschienenen französischen Übersetzung des Gesamtbandes in Europa wie in den nordamerikanischen Kolonien der britischen Krone außerordentliche Beachtung fand und das politische Denken des Westens so nachhaltig prägen sollte wie kaum eine andere Schrift.
Der «Second Treatise» war nicht, wie man lange geglaubt hat, eine Schrift zur Rechtfertigung der Glorious Revolution, sondern ist knapp zehn Jahre früher, um 1679/80, entstanden. Die Abhandlung liest sich auf weiten Strecken wie eine Antwort auf den «Leviathan». Den Naturzustand beschreibt der jüngere Autor deutlich weniger düster als Hobbes. Der Mensch ist dem Menschen kein Wolf. Er ist der Vernunft zugänglich und fähig, Recht von Unrecht zu unterscheiden. Er verfügt über Eigentum. Solange es keinen irdischen Richter gibt, versucht der Mensch, sein Recht als Richter in eigener Sache durchzusetzen, und beruft sich dabei auf ein ungeschriebenes Gesetz, das Naturgesetz. Weil sich der Schutz des Eigentums so nicht wirksam gewährleisten lässt, schließen sich die Menschen zu einer Gemeinschaft zusammen. Sie bilden damit einen «einzigen politischen Körper, in dem die Mehrheit das Recht hat, zu handeln und die übrigen Glieder mitzuverpflichten».[22]
Die Staatsgründung ist der Akt, durch den die Gemeinschaft sich konstituiert, zugleich aber als Akteur sich zugunsten einer von ihr vertraglich und treuhänderisch legitimierten Autorität zurückzieht. Ganz im Sinne der antiken Tradition befürwortet Locke eine Mischverfassung, die die Vorzüge verschiedener Regierungsformen miteinander verbindet, und hat dabei die englische Verfassungswirklichkeit vor Augen.[23] Die höchste Exekutivgewalt steht dem König, dem obersten Repräsentanten der Monarchie, zu. Das aristokratische Element wird vom House of Lords, der Versammlung des Erbadels, verkörpert, das demokratische vom House of Commons, der gewählten Versammlung des Volkes. Ein so geordnetes «Commonwealth» dient dem Ziel, die Macht jeder dieser Gewalten zu begrenzen und zu mäßigen.
Die höchste Gewalt in einem verfassten Staatswesen ist die gesetzgebende. Aber auch deren Gewalt ist eine abgeleitete, eine vom Volk durch Vertrag verliehene, treuhänderisch handelnde Gewalt. Steuern auf das Eigentum des Volkes dürfen nur mit seiner Zustimmung oder der seiner Vertreter erhoben werden. Verwirkt die Legislative das in sie gesetzte Vertrauen (trust), muss die Gemeinschaft die Verteidigung der Rechte wieder selbst in die Hand nehmen.
Der Rechtsprechung billigt Locke nicht den Status einer eigenen Gewalt zu. Er hält es aber für unabdingbar, dass Richter anerkannt und unparteiisch sind und über die Autorität verfügen, in allen Streitfragen nach dem geltenden Recht zu entscheiden. Wenn eine Regierung systematisch die Gesetze bricht und diese Praxis mit Gewalt durchsetzt, dann, aber auch nur dann, hat das Volk das Recht auf Revolution.
Von Volkssouveränität kann man bei Locke indes noch nicht sprechen. Empirisch repräsentierte das Unterhaus zu Lebzeiten von Locke und noch lange danach nur eine winzige Minderheit begüterter Bürger und Adliger männlichen Geschlechts. Zudem war die Wahlkreiseinteilung krass ungleich: Sie privilegierte dünn besiedelte ländliche Gebiete auf Kosten der Städte und vor allem der größeren unter ihnen.
Für Locke waren zwar alle Menschen von Natur aus gleich, doch das galt nur für die Gleichheit vor dem Gesetz. Sklaven waren für ihn keine Menschen, denen irgendwelche Rechte zustanden. Der Verfasser der «Two Treatises» zog selbst großen Nutzen aus dem Sklavenhandel. Wie sein Gönner, der Earl of Shaftesbury, hatte er Anteile an der Royal Africa Company gekauft, die in diesem florierenden Erwerbszweig tätig war.[24] Von Lockes Vorstellungen von der natürlichen Gleichheit aller Menschen zu den unveräußerlichen Menschenrechten war es mithin noch ein weiter Weg. Dennoch bildet der «Second Treatise of Government» einen historischen Durchbruch. Mit seiner Lehre von der Gewaltenteilung hat Locke wie kein anderer Denker vor ihm die Verteidiger der Staatsallmacht herausgefordert und der Herausbildung eines freiheitlichen Gemeinwesens den Weg geebnet.
Befreiung aus der Unmündigkeit:Die Aufklärung und ihre Grenzen
John Locke wird aus guten Gründen als einer der frühen Aufklärer angesehen – als einer der Pioniere jener intellektuellen Revolution, die das Denken des 18. Jahrhunderts prägt. «Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit»: So beginnt der berühmte Aufsatz Immanuel Kants «Was ist Aufklärung?», mit dem der im preußischen Königsberg lebende und lehrende Philosoph 1784 die entsprechende Frage der «Berlinischen Monatsschrift» beantwortete. «Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere aude! Habe Mut, Dich Deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung … Zu dieser Aufklärung aber wird nichts erfordert als Freiheit; und zwar die unschädlichste unter allem, was nur Freiheit heißen mag, nämlich die: von seiner Vernunft in allen Stücken öffentlichen Gebrauch zu machen.»[25]
Als Kant das im vorletzten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts schrieb, war die Aufklärung sich selbst schon Geschichte und damit zu einem Gegenstand von Aufklärung geworden. Die selbstgestellte Frage, ob wir jetzt in einem aufgeklärten Zeitalter lebten, beantwortete Kant gleichwohl mit der gebotenen Zurückhaltung: «Nein, aber wohl in einem Zeitalter der Aufklärung.»[26]
Die Aufklärung war eine europäische Bewegung, die in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts in Großbritannien begonnen hatte. Der Empirismus, die Ableitung aller Erkenntnis aus der Erfahrung der Sinne, sollte zum wichtigsten Merkmal der englischen und der schottischen Aufklärung werden. Neben John Locke folgten auch der konservative politische Theoretiker und Publizist Henry St. John Viscount Bolingbroke und der schottische Philosoph David Hume diesen Ansatz. Alle drei waren Freigeister und Deisten: Sie sahen in Gott den Urgrund der Welt, aber nicht den Weltenlenker, der sich den Menschen durch Wort und Wunder offenbarte.
Für die französische Aufklärung war der Rationalismus kennzeichnend: ein Denken, für das die Vernunft die Quelle aller Erkenntnis ist. Auf die Vernunft beriefen sich in der Tradition von René Descartes (1596–1650) und Pierre Bayle (1647–1706) antiklerikale Geister wie Voltaire und Jean-Jacques Rousseau. Pantheisten wie Diderot und d’Alembert, die beiden Herausgeber der ersten großen systematischen Zusammenfassung des zeitgenössischen Wissens, der seit 1751 erscheinenden «Enzyklopädie», und materialistische Atheisten wie La Mettrie, Helvétius und der (aus der Pfalz stammende) Baron von Holbach.
Die deutsche Aufklärung war weniger erfahrungsgläubig als die englische, weniger religionskritisch als die französische und weniger politisch als beide. Dass echte Religiosität ohne kirchliche Orthodoxie möglich sei: darin stimmten die Philosophen Christian Thomasius, Christian Wolff und Immanuel Kant mit dem Dichter, Geschichtsdenker und Kritiker Gotthold Ephraim Lessing überein. Kant überwand die erkenntnistheoretischen Begrenzungen des Empirismus und des Rationalismus, indem er sich der Selbsterkenntnis der Vernunft zuwandte. In einem blieb er ein sehr deutscher Denker: Aus der Freiheit des Denkens folgte für ihn kein Recht auf Widerstand gegen die Staatsgewalt.
Wichtiger als das, was die nationalen Erscheinungsformen der Aufklärung voneinander unterschied, war das, was sie miteinander verband. Der Schlüsselbegriff war die Kritik. Kritisch gesinnt zu sein hieß alles Bestehende vor den Richterstuhl der Vernunft zu rufen. Die Vernunft maß das Überlieferte am Maßstab des möglichen Besseren. Sie hielt Fortschritt also für möglich, und weil er möglich war, für notwendig.
Oberstes Ziel des Fortschritts war das Wohl des Menschengeschlechts. Der Fortschritt verlangte Kampf gegen alles, was ihm entgegenstand: Vorurteile, Aberglaube, Schwärmerei, Intoleranz und Dogmatismus. Fortschritt ließ sich nur erreichen unter den Bedingungen von Öffentlichkeit, Freiheit und Toleranz. Diese Bedingungen waren noch nirgendwo hinreichend gesichert. Vielmehr gab es in allen Ländern des Okzidents eine mehr oder minder starke, hier mehr katholisch, dort mehr evangelisch geprägte Gegenaufklärung. Infolgedessen konnte die Aufklärung sich selbst nur als Projekt begreifen: als Kampf um die Verwirklichung der Vernunft in aller Welt.
Allgemeine Übereinstimmung gab es in der aufgeklärten Öffentlichkeit hinsichtlich besonders krasser Missstände wie Soldatenhandel, Hexenverfolgung, Inquisition und Folter. Gespalten waren die Aufklärer in ihrem Verhältnis zu den Juden. Einige, wie Montesquieu und Diderot, widersprachen der Diskriminierung der Juden im Namen der Toleranz. Andere, unter ihnen Voltaire, sahen in der jüdischen Religion ein Relikt dunkler Zeiten, noch rückständiger und intoleranter als das Christentum, und bestritten aus diesem Grund einen Anspruch der Juden auf Toleranz. Der größte Philosoph der jüdischen Aufklärung, der Haskala, Moses Mendelssohn, warf den «christlichen» Aufklärern darum zu Recht Unduldsamkeit gegenüber historisch zu erklärenden Unterschieden vor.
Auf bemerkenswert wenig Protest stießen bei vielen Klassikern der Aufklärung auch der transatlantische Sklavenhandel, der in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts seinen Höhepunkt erreichte, und die von vielen europäischen Kolonialmächten praktizierte Sklaverei. Zu ihren Kritikern gehörten Montesquieu, Rousseau, Condorcet und der schottische Moralphilosoph und Ökonom Adam Smith. Doch von Sklavenhandel und Sklaverei waren «nur» Schwarzafrikaner betroffen, und die galten den meisten, wenn auch nicht allen Aufklärern als Menschen einer primitiven Entwicklungsstufe und darum einer den Weißen kulturell weit unterlegenen Rasse.[27]
Die aufgeklärte Öffentlichkeit, die über die bestehenden Zustände diskutierte und sie kritisierte, war mehr als nur national: Sie war europäisch und westlich. Sie war auch mehr als nur bürgerlich. Sie umschloss viele Adlige und Geistliche aller Konfessionen, aber auch Teile des «einfachen Volkes», sofern sie des Lesens kundig waren (und das war in überwiegend protestantischen Ländern sehr viel häufiger der Fall als in katholischen). Es gab aufgeklärte Monarchen wie König Friedrich II., den Großen, von Preußen, Joseph II., den Kaiser des Heiligen Römischen Reiches in seiner Eigenschaft als Herrscher der habsburgischen Stammlande, seinen Bruder Leopold, den Großherzog der Toskana, und die Könige von Schweden und Spanien, Gustav III. und Karl III. – Herrscher, die durch einschneidende, mehr oder minder nachhaltige Reformen, vor allem im Bereich des Rechtswesens, in ihren Ländern gesellschaftlichen Fortschritt herbeizuführen versuchten.
Ein aufgeklärter Absolutismus konnte sich nicht entwickeln, wo der Absolutismus bereits überwunden war, wie in England, oder sich nie durchgesetzt hatte, wie in Holland. In Frankreich lagen die Dinge anders. Hier hatte sich eine aufgeklärte, überwiegend bürgerliche Gesellschaft neben der höfischen Gesellschaft bereits so stark entwickelt, dass es für eine «Aufklärung von oben» zu spät war. Aufgeklärter Absolutismus war ein Versuch von Herrschern vergleichsweise rückständiger Länder, nachzuholen, was weiter fortgeschrittene bereits erreicht hatten. Ohne einen gewissen Rückhalt in der eigenen Gesellschaft aber hatten solche Reformbestrebungen keine Chance, an dieses Ziel zu gelangen.
Eben deshalb kann man auch in Russland nicht von einem aufgeklärten Absolutismus sprechen. Die Zarin Katharina II., die Große, eine geborene Prinzessin von Anhalt-Zerbst, hatte zwar Montesquieus noch zu erörterndes Buch «Über den Geist der Gesetze» gelesen und stand mit Voltaire, Diderot und d’Alembert in brieflicher oder persönlicher Verbindung. Aber sie enttäuschte alle, die von ihr eine Umgestaltung des Zarenreiches im Sinne der Aufklärung erwarteten. Was von den neuen Ideen des Westens in die gebildete Oberschicht eindrang, war nicht durch Vermittlung der Zarin nach Russland gelangt.
Das Zurückbleiben des orthodoxen Ostens hinter dem aufgeklärten Westen hatte seinen tieferen Grund dort, wo wir ihn schon im Mittelalter geortet haben: In Byzanz, dem ehemaligen Ostrom, das dem Okzident lange Zeit kulturell und machtpolitisch weit überlegen gewesen war, konnte sich nicht jener innovative, letztlich revolutionäre Geist der Freiheit des Wettbewerbs und des Pluralismus entwickeln, der das lateinische Europa prägte.
Nach dem Fall von Konstantinopel, seiner Eroberung durch die Osmanen im Jahr 1453, fand das orthodoxe Christentum seinen neuen Mittelpunkt in Moskau, der Hauptstadt des werdenden großrussischen Reiches, die fortan den Anspruch erhob, das «Dritte Rom», der Erbe von Byzanz und damit auch des alten Rom, zu sein. Der Mythos von Moskau als dem «Dritten Rom» schrieb Russland eine heilsgeschichtliche Sendung zu, wie sie bisher nur das Heilige Römische Reich für sich reklamiert hatte. Im Zeichen dieses Mythos entwickelte sich Russland zur Antithese des Westens: Das Zarenreich fühlte sich berufen, jenem Abfall vom rechten Glauben entgegenzuwirken, wie er sich im Okzident vollzogen hatte und im Zeichen der Aufklärung immer weiter fortschritt.
Mangel an anhaltender geistiger Dynamik, an Freiräumen für unabhängiges Denken und konkurrierende Ideen: Auch im Hinblick auf zwei andere, dem lateinischen Europa lange Zeit in fast jeder Hinsicht weit überlegene Kulturräume, die islamische Welt und China, liegt hier der Grund, warum sie die Entwicklung nicht nachvollziehen konnten, die in der Aufklärung des 18. Jahrhunderts ihren vorläufigen Höhepunkt erreichte. Der Geist der intellektuellen Toleranz, der persische und arabische Gelehrte wie Avicenna (980–1037) und Averroes (1126–1198), zwei große Aristoteles-Interpreten, hervorgebracht und im Khalifat der Omaijaden von Córdoba seine Blütezeit erlebt hatte, war schon Ende des 12. Jahrhunderts, auch als Reaktion auf die Kreuzzüge, religiöser Unterdrückung gewichen: Averroes, auf arabisch Ibn Ruschd, wurde aus Córdoba nach Marokko vertrieben; sein Erbe wurde im Okzident gepflegt, nicht in der islamischen Welt.
In China hatten sich unter der mongolischen Herrschaft im 13. Jahrhundert unter der Yuan-Dynastie die Elemente repressiver Herrschaft verstärkt. Im Zeichen einer erneuten Hinwendung zu den autoritätsfixierten Lehren des Konfuzius hörte nach 1430 unter der Ming-Dynastie das zeitweilig starke Interesse an großen maritimen Expeditionen auf, das chinesische Schiffe bis nach Afrika geführt hatte; der Seehandel kam faktisch zum Erliegen; die Flotte verfiel; private Initiativen wurden über längere Zeit hinweg weitgehend unterbunden. Das «Reich der Mitte» zog sich auf sich selbst zurück. Es schottete sich gegen fremde Einflüsse ab. So wenig wie in der muslimischen Welt konnte der Geist der Aufklärung in China eine Heimstatt finden.[28]
Die großen Philosophen der Aufklärung, Kant obenan, waren sich kaum noch bewusst, in welcher Tradition sie standen. In ihrer Verachtung des «finsteren Mittelalters» ignorierten sie das Maß an Aufklärung, das bereits Theologen des 11. und 12. Jahrhunderts erkämpft hatten, indem sie einer dogmatischen, unkritischen Auslegung biblischer Texte widersprachen und Zweifel zu einer wissenschaftlichen Tugend erklärten. Die Aufklärer verkannten damit eine Bedingung der Möglichkeit ihres eigenen Wirkens: die Existenz geistiger Freiräume, auf die freies Denken angewiesen ist.[29]
So fließend die Grenzen zwischen Mittelalter und Renaissance waren, so fließend waren auch die Grenzen zwischen der Aufklärung und ihrer Vorgeschichte. Wechselseitiges Lernen über nationale, konfessionelle und kulturelle Grenzen hinweg verstand sich nicht erst für die Aufklärer von selbst, sondern auch schon für jene, die ihnen den Weg geebnet hatten: für die großen Naturwissenschaftler und Astronomen, die das Weltverständnis der Europäer revolutionierten, von Kopernikus über Galilei und Tycho Brahe bis zu Kepler und Newton. Dasselbe galt für die tonangebenden Ärzte und Theologen, für Philosophen und Universalgelehrte wie Giordano Bruno, Descartes und Leibniz.
Die Aufklärung kam nicht aus einem geschichtslosen Irgendwo. Sie hatte ihre eigene Geschichte, die in die Antike zurückreichte und Mittelalter und Renaissance entscheidende Impulse verdankte. Sie wirkte befreiend, konnte das aber nur tun, weil sie Voraussetzungen vorfand, die diese Wirkung ermöglichten. Sie stieß dort auf räumliche Grenzen, wo diese Voraussetzungen fehlten. Sie war an Bedingungen gebunden, die sie nicht selbst geschaffen hatte und deren Fortdauer sie nicht verbürgen konnte.[30]
Diese innere Grenze zu erkennen, fiel den meisten Aufklärern, vor allem den Wortführern einer konsequenten Säkularisierung aller Lebensbereiche, schwer. Darin lag eine Gefahr, wie sich im letzten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts, im Verlauf der Französischen Revolution, zeigen sollte. Der Anspruch, die Gebote der Vernunft zu vollstrecken, konnte umschlagen in fanatische Unduldsamkeit gegenüber allen, die sich diesem Anspruch der selbsternannten Anwälte der Vernunft nicht unterwerfen wollten. Wenn sie solche dialektischen Umschläge künftig vermeiden wollten, mussten die Freunde der Aufklärung vor allem eines lernen: die Bedingungen ihres Wirkens und damit sich selbst kritisch zu hinterfragen.