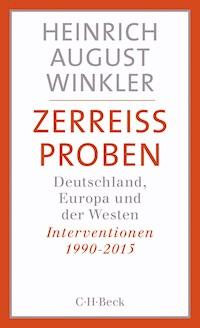16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der zweite Band von Winklers deutscher Geschichte behandelt die zwölf Jahre der nationalsozialistischen Diktatur, die über vier Jahrzehnte, in denen Deutschland in zwei Staaten geteilt war, und schließlich die Wiedervereinigung. Es ist eine Geschichte von Zusammenbrüchen und Neuanfängen, von Diktatur und Demokratie und auch des Nachdenkens über Deutschland – eine dramatische Geschichte, anschaulich und spannend dargestellt von einem Historiker und Publizisten, der auch in diesem Buch dem Motto folgt: Erzählen heißt erklären, warum es so gekommen ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
HEINRICH AUGUST WINKLER
Der lange Weg nach Westen
Deutsche Geschichte II
Vom «Dritten Reich» bis zur
Wiedervereinigung
C.H.BECK
FÜR DÖRTE
Inhalt
Einleitung
1. Die deutsche Katastrophe: 1933–1945
2. Demokratie und Diktatur: 1945–1961
3. Zwei Staaten, eine Nation: 1961–1973
4. Annäherung und Entfremdung: 1973–1989
5. Einheit in Freiheit: 1989/90
Abschied von den Sonderwegen: Rückblick und Ausblick
Anhang
Abkürzungsverzeichnis
Anmerkungen
Personenregister
Einleitung
Der erste Band dieser deutschen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts hat die Entwicklung Deutschlands vom Ende des Alten Reiches bis zum Untergang der Weimarer Republik verfolgt. Der zweite Band setzt mit der Machtübertragung an Hitler ein und endet mit der Wiedervereinigung und ihren Wirkungen. Wie der erste Band will auch der zweite keine «Totalgeschichte», sondern eine Problemgeschichte sein: Im Mittelpunkt steht das Verhältnis von Demokratie und Nation in Deutschland.
Von der Zeit des Nationalsozialismus handelt nicht nur das erste Kapitel. Die Jahre 1933 bis 1945 haben die nachfolgenden Jahrzehnte so sehr geprägt, daß die Geschichte des geteilten Deutschland auf weiten Strecken eine Geschichte der Auseinandersetzung mit der «deutschen Katastrophe» ist. Das Buch befaßt sich nicht ausschließlich, aber doch vorrangig mit Politik und politischer Kultur. Darum spielt im folgenden das Nachdenken über Deutschland und die Deutschen eine große Rolle. Wie der erste Band ist auch der zweite mindestens ebenso sehr Diskursgeschichte wie Geschichte der Abläufe, die der weiteren Entwicklung ihren Stempel aufdrückten.
Bei den Diskursen rückt, soweit es um die alte Bundesrepublik geht, seit den siebziger Jahren immer mehr die Linke in den Vordergrund. Sie verfügte seit dem ersten Bonner Machtwechsel von 1969 über die intellektuelle Hegemonie, und das zunehmend unangefochten. Der Geist weht, wo er will, aber von rechts wollte er offenbar nicht mehr wehen. Der einzige Glanz, den die intellektuelle Rechte verbreitete, war der ihrer Abwesenheit. Infolgedessen richtet sich auch meine Kritik in der Spätphase der alten Bundesrepublik vor allem an die Adresse der Linken. Die Kritik ist gelegentlich auch Selbstkritik: Der Autor war an einigen Diskursen, von denen in diesem Buch die Rede ist, beteiligt.
Die Wertmaßstäbe, von denen ich ausgehe, sind die der westlichen Demokratie. Mein Freiheitsbegriff ist nicht der relativistische, der die Auslegung der Weimarer Reichsverfassung bestimmt hat und seit einiger Zeit mancherorts seine Wiederauferstehung in Gestalt einer postmodernen, scheinliberalen Beliebigkeit erlebt, sondern der wertbetonte des Grundgesetzes – der deutschen Verfassung, in der die Erfahrungen der politischen und der Verfassungsgeschichte Deutschlands im Hegelschen Sinne «aufgehoben», also aufbewahrt und überwunden sind. Was in der DDR geschah, beurteile ich folglich nicht «systemimmanent», was auf gehobenen Positivismus hinausliefe. Aber daraus folgt nicht, daß der Historiker die Menschen, die in der DDR lebten und sich mit ihr arrangieren mußten, so beurteilen dürfte, als hätten sie unter den gleichen freiheitlichen Bedingungen gedacht und gehandelt wie die Deutschen in der Bundesrepublik.
Die Deutschen müssen sich ihre gesamte Geschichte kritisch aneignen: Das war eine Prämisse und das ist eine Folgerung aus dieser zweibändigen deutschen Geschichte der letzten zweihundert Jahre. Die Deutschen haben sich durch die Tatsache, daß es für sie so etwas wie westliche Normalität vor 1990 nicht gegeben hat, keinen Anspruch auf fortdauernde Anomalie erworben. Sie kommen nicht darum herum, über das nachzudenken, was sie zum Projekt Europa beitragen können. Ohne Klärung ihrer nationalen Identität ist dieses Ziel nicht zu erreichen.
Je näher das Buch der Gegenwart kommt, desto schwerer fällt die Grenzziehung zwischen historischen und politischen Urteilen. Auf Urteile zu verzichten konnte aber keine Alternative sein. Ich hoffe deshalb auf Leserinnen und Leser, die der Widerspruch zu manchen meiner Wertungen nicht davon abhält, weiterzulesen. Sie können ja zu anderen Schlußfolgerungen gelangen als der Autor.
Am Ende der Arbeit am zweiten und letzten Band dieser deutschen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts habe ich zu danken: an erster Stelle meiner Frau, der Mitdenkerin aller Schlüsselabschnitte; dann Ernst-Peter Wieckenberg, dem ehemaligen Cheflektor des Verlages C.H.Beck, der die einzelnen Kapitel fortlaufend und mit gleichbleibender Gründlichkeit gegengelesen hat. Frau Gretchen Klein, die den größten Teil der handschriftlichen Vorlage in ein druckfertiges Manuskript verwandelt hat, danke ich ebenso wie Frau Monika Roßteuscher, die die Druckvorlage von Teilen des letzten Kapitels angefertigt hat. Meine studentischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben mir über Jahre hinweg geholfen: durch Quellen- und Literaturbeschaffung, durch Vorschläge für die Kolumnentitel, durch Korrekturlesen und die Erstellung des Personenregisters. Ich danke Daniel Bussenius, Teresa Löwe, Sebastian Ullrich und Stephanie Zloch für alles, was sie zu diesem Band beigetragen haben.
Berlin, im Juli 2000 Heinrich August Winkler
1.Die deutsche Katastrophe1933–1945
Der Mann, der seit dem 30. Januar 1933 an der Spitze der Reichsregierung stand, betrachtete sich als den von der Vorsehung auserwählten Erlöser der Deutschen und damit zugleich der germanischen Rasse. Erlösen wollte er die Deutschen nicht nur von der Schmach des Versailler Vertrags, von Marxismus, Liberalismus und Parlamentarismus, sondern vom Bösen schlechthin, das sich der unterschiedlichsten Masken bediente, um sein Zersetzungswerk zu tarnen: dem internationalen Judentum. Der Marxismus war aus Hitlers Sicht nur eine, aber die bislang erfolgreichste Verkleidung des Juden: Sie hatte ihm zur Beherrschung der Arbeiterschaft verholfen. Die Arbeiter dem Einfluß des internationalistischen Marxismus zu entreißen und für die Sache der Nation zu gewinnen konnte folglich nur einer Bewegung und einem Führer gelingen, die zum rücksichtslosen Kampf gegen das Judentum entschlossen waren.
Hitler wußte sich als Führer einer solchen Bewegung. In «Mein Kampf» hatte er während seiner Landsberger Festungshaft 1924 den Glauben an seine Sendung in Worte gefaßt, die so apokalyptisch gemeint waren, wie sie klangen: «Siegt der Jude mit Hilfe seines marxistischen Glaubensbekenntnisses über die Völker dieser Welt, dann wird seine Krone der Totentanz der Menschheit sein, dann wird dieser Planet wieder wie einst vor Jahrmillionen menschenleer durch den Äther ziehen. Die ewige Natur rächt unerbittlich die Übertretung ihrer Gebote. So glaube ich heute im Sinne des allmächtigen Schöpfers zu handeln: Indem ich mich des Juden erwehre, kämpfe ich für das Werk des Herrn.»
Die sakrale Wendung machte deutlich, was der Nationalsozialismus nach dem Willen seines Führers sein sollte: eine innerweltliche «ecclesia militans», außerhalb deren es kein Heil gab – eine totalitäre politische Religion. Als «totalitär» hatten liberale, demokratische und sozialistische Kritiker des italienischen Faschismus das Regime Mussolinis charakterisiert, bevor der Duce selbst erstmals im Juni 1925 vom «wilden, totalitären Willen» («feroce volontà totalitaria») seiner Bewegung sprach. Als «totalitär» galt spätestens seit den dreißiger Jahren ein Regime, für das Politik im Kern der Kampf zwischen Freund und Feind war, das jede Opposition gewaltsam unterdrückte und alle Andersdenkenden durch die Allgegenwart seiner Geheimpolizei einschüchterte, das jede Art von Gewaltenteilung zugunsten des Machtmonopols einer Partei ausschaltete und mit Hilfe von Ideologie, Propaganda und Terror jene akklamatorische Zustimmung der Massen erzeugte, die es zur Legitimation seiner Herrschaft nach innen und außen benötigte. In diesem Sinn war nicht nur das faschistische Italien, sondern auch die Sowjetunion ein totalitäres Regime – eine Diktatur neuen Typs, die sich von autoritären Systemen, europäischen oder lateinamerikanischen Militärdiktaturen etwa, deutlich unterschied. Neu waren gegenüber den herkömmlichen Diktaturen vor allem die Mobilisierung der Massen und der Anspruch auf den ganzen Menschen, der zu einem «neuen Menschen» erzogen werden sollte. Ein solches System gab es in Deutschland am 30. Januar 1933 und in den ersten Wochen danach noch nicht. Aber wer Hitlers öffentliche Bekundungen aus der «Kampfzeit» ernst nahm, wußte, daß es ihm um die Errichtung eines Regimes ging, das mindestens so «totalitär» sein würde wie das Mussolinis.
Mit dem italienischen Faschismus hatte der deutsche Nationalsozialismus vieles gemein: radikalen Nationalismus, Antimarxismus und Antiliberalismus, die Militarisierung des innenpolitischen Kampfes, den Kult von Jugendlichkeit, Männlichkeit und Gewalt, die zentrale Rolle des charismatischen Führers. Beide Bewegungen hatten ihren Ursprung in der traumatischen Erfahrung der Ergebnisse des Ersten Weltkriegs: So wie die Nationalsozialisten die deutsche Niederlage auf den «Dolchstoß» der «Novemberverbrecher» zurückführten, so lasteten die italienischen Faschisten den «verstümmelten Sieg», die Durchkreuzung ehrgeiziger Annexionspläne durch die westlichen Verbündeten, der Schwächlichkeit der Liberalen und dem Internationalismus der Linken an. Beide Parteien verstanden es, eine verbreitete Angst für sich wirken zu lassen: die Angst vor einer «roten» Revolution nach dem Vorbild der russischen Bolschewiki. Beide zogen Nutzen aus der Spaltung der marxistischen Arbeiterbewegung im Gefolge von Weltkrieg und Oktoberrevolution.
Die Gemeinsamkeiten zwischen den Bewegungen Mussolinis und Hitlers waren so ausgeprägt, daß viele Zeitgenossen, vor allem auf der Linken, im Nationalsozialismus von Anfang an nur die deutsche Erscheinungsform des «Faschismus» zu erkennen vermochten. Das war er auch, sofern man den Begriff «Faschismus» zur Kennzeichnung eines neuen Typs von militanter Massenbewegung der extremen Rechten verwendet, wie es sie vor dem Ersten Weltkrieg noch nirgendwo in Europa gegeben hatte. Doch der Nationalsozialismus war nicht nur der «deutsche Faschismus». Er war in viel höherem Maß als der italienische Faschismus eine den ganzen Menschen beanspruchende politische Religion (und insofern eher seinem Antipoden, dem Bolschewismus, ähnlich). Er war in jeder Hinsicht extremer und totalitärer als das römische Vorbild, und er verfügte über ein mythologisches Feindbild, das Mussolini, seine Bewegung und sein Regime nicht besaßen: Der italienische Faschismus kannte nicht den tödlichen Haß auf die Juden, der im Mittelpunkt von Hitlers «Weltanschauung» stand.[1]
Hitler will während seiner «Wiener Lehr- und Leidensjahre» zwischen 1908 und 1913 zum überzeugten Antisemiten geworden sein: So stellt er es in «Mein Kampf» dar. In der Hauptstadt des österreichischen Vielvölkerstaates war eine scharfe Abgrenzung gegenüber den Juden der kleinste gemeinsame Nenner aller Nichtjuden, wenn sie denn einen solchen Nenner suchten. Der Antisemitismus war im späten Habsburgerreich sehr viel weiter verbreitet und «volkstümlicher» als im wilhelminischen Deutschland. Das war nicht zuletzt das Werk des Führers der Christlichsozialen Partei und langjährigen Wiener Bürgermeisters Karl Lueger, zu dessen Bewunderern der junge Hitler gehörte.
Hitler las in der Zeit, in der er als Bewohner eines Männerheims in Wien-Brigittenau sein Geld durch das Anfertigen von Bildkopien verdiente, die Schriften zahlreicher obskurer antisemitischer Autoren, unter ihnen des ehemaligen Priesters Josef Adolf Lanz, der sich als Schriftsteller Jörg Lanz von Liebenfels nannte. Zum «praktizierenden» Antisemiten aber wurde Hitler in seinen Wiener Jahren noch nicht. Er war zu jener Zeit bereits ein «Großdeutscher» im Sinne des Parteiführers Georg von Schönerer, ein Gegner des Habsburgerreiches und Befürworter der Vereinigung von Deutschland und Österreich mithin; er ließ auch schon seinem Haß auf die Sozialdemokratie freien Lauf, womit er sich vom Proletariat abheben konnte, in das der verarmte Beamtensohn aus Braunau am Inn auf keinen Fall absinken wollte. Aber er pflegte noch persönlichen Umgang mit Juden. Falls er, was möglich ist, schon in seiner Wiener Zeit antisemitische Vorurteile entwickelt hat, fielen diese nicht durch besondere Radikalität auf.
Auch aus seiner frühen Münchner Zeit, die im Mai 1913 begann, sind keine judenfeindlichen Äußerungen überliefert. Dasselbe gilt für die Jahre des Weltkriegs, in denen er als Freiwilliger in einem bayerischen Infanterieregiment an der Westfront kämpfte. Die frühesten Belege seines Antisemitismus stammen aus dem Jahr 1919. Hitlers Wandlung zum unerbittlichen Judenfeind fällt zeitlich offenbar zusammen mit seinem Entschluß, Politiker zu werden: Er brauchte einen Feind, um eine Rolle für sich zu finden und damit seinem Leben im Nachkriegsdeutschland einen Sinn zu geben. Daß Deutschland den Weltkrieg verloren hatte, war die Schuld des Marxismus und damit der Juden: Seit er dies «erkannt» hatte, wußte Hitler auch, warum die «Vorsehung» ihn, den «unbekannten Gefreiten», den Krieg hatte überleben lassen.
Im September 1919, Hitler arbeitete damals als «Vertrauensmann» des Bayerischen Reichswehrgruppenkommandos in München und war gerade in eine kleine rechtsextreme Gruppierung, die acht Monate zuvor gegründete Deutsche Arbeiterpartei, eingetreten, lag sein antisemitisches Weltbild fest: «Alles, was Menschen zu Höherem streben läßt, sei es Religion, Sozialismus, Demokratie, es ist ihm (dem Juden, H. A. W.) alles nur Mittel zum Zweck, Geld- und Herrschgier zu befriedigen. Sein Wirken wird in seinen Folgen zur Rassentuberkulose der Völker, und daraus ergibt sich folgendes: Der Antisemitismus aus rein gefühlsmäßigen Gründen wird seinen letzten Ausdruck finden in der Form von Progromen (sic!). Der Antisemitismus der Vernunft jedoch muß führen zur planmäßigen gesetzlichen Bekämpfung und Beseitigung der Vorrechte der Juden, die er zum Unterschied der anderen zwischen uns lebenden Fremden besitzt (Fremdengesetzgebung). Sein letztes Ziel aber muß unverrückbar die Entfernung der Juden überhaupt sein. Zu beidem ist nur fähig eine Regierung nationaler Kraft und niemals eine Regierung nationaler Ohnmacht.»
Die «positive» Kehrseite des Kampfes gegen die Juden war der Kampf für das rassisch reine deutsche Großreich der Zukunft, hinter dem die früheren deutschen Reiche, das mittelalterliche wie das Bismarcksche, verblassen mußten. «Die Grenzen des Jahres 1914 bedeuten für die Zukunft der deutschen Nation gar nichts. In ihnen lag weder ein Schutz der Vergangenheit, noch läge in ihnen eine Stärke für die Zukunft», heißt es in «Mein Kampf». «Deutschland wird entweder Weltmacht oder überhaupt nicht sein. Zur Weltmacht aber braucht es jene Größe, die ihm in der heutigen Zeit die notwendige Bedeutung und seinen Bürgern das Leben gibt. Damit ziehen wir Nationalsozialisten bewußt einen Strich unter die außenpolitische Richtung unserer Vorkriegszeit. Wir setzen dort an, wo man vor sechs Jahrhunderten endete. Wir stoppen den ewigen Germanenzug nach dem Süden und Westen Europas und weisen den Blick nach dem Land im Osten. Wir schließen endlich ab die Kolonial- und Handelspolitik der Vorkriegszeit und gehen über zur Bodenpolitik der Zukunft.»
Der Osten: das hieß «Rußland und die ihm untertanen Randstaaten». Es war das Schicksal selbst, das nach Hitlers Überzeugung Deutschland diesen Fingerzeig hatte geben wollen, indem es Rußland dem Bolschewismus überantwortete. Die Machtübernahme der Bolschewiken bedeutete aus seiner Sicht die Ersetzung der bisherigen, ursprünglich germanischen Führungsschicht durch die Juden, die aber das mächtige Reich auf die Dauer nicht zusammenhalten konnten. «Das Riesenreich im Osten ist reif zum Zusammenbruch. Und das Ende der Judenherrschaft in Rußland wird auch das Ende Rußlands als Staat sein. Wir sind vom Schicksal ausersehen, Zeugen einer Katastrophe zu werden, die die gewaltigste Bestätigung für die Richtigkeit der völkischen Rassentheorie sein wird.»
Als Führer der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (die Umbenennung der Deutschen Arbeiterpartei im Februar 1920 wurde bereits von ihm bekanntgegeben) war Hitler zunächst vor allem eines: ein antisemitischer Agitator. Was in München zu seinem Erfolg beitrug, verbürgte diesen aber noch nicht in ganz Deutschland. Als die NSDAP sich nach 1929 anschickte, die Macht im Reich auf «legalem» Weg zu erobern, traten die Ausfälle gegen die Juden zurück hinter Kampfansagen gegen das «System» von Weimar, gegen Marxismus, Bolschewismus und die «Versklavung» des deutschen Volkes durch den Young-Plan und die internationale «Zinsknechtschaft». Mit nationalistischen Parolen ließen sich breitere Schichten gewinnen als mit antisemitischen, und die radikalen Judenfeinde standen ohnehin schon im Lager des Nationalsozialismus. In den großen Wahlreden der letzten Weimarer Jahre hütete sich Hitler auch, das außenpolitische Programm in den Vordergrund zu rücken, das er in «Mein Kampf» (und in seinem unveröffentlichten «Zweiten Buch» von 1928) dargelegt hatte: Das Bekenntnis zum Krieg um «Lebensraum» im Osten Europas, auf dem Territorium des bolschewistischen Erzfeindes, wäre nicht dazu angetan gewesen, der NSDAP neue Wähler zuzuführen. Was Hitler zwischen 1930 und 1933 öffentlich verkündete, ließ den Kern seiner Überzeugungen kaum erkennen – und das war einer der Gründe des Massenzulaufs zu den Nationalsozialisten.
Die Verbindung von Nationalismus und Sozialismus unterschied Hitlers Bewegung von den rechten Sammlungsbewegungen des Kaiserreichs, bis hin zur Deutschen Vaterlandspartei von 1917. Die NSDAP war keine Parteigründung von Honoratioren; sie verdankte ihre Wahlerfolge mehr den demagogischen Fähigkeiten ihres Führers und dem Einsatz seiner Anhänger als der finanziellen Unterstützung durch rechtsstehende Industrielle und Bankiers. Der «Sozialismus» der Nationalsozialisten verschreckte lange Zeit viele bürgerliche Wähler, namentlich solche in den selbständigen Mittelschichten. Noch im Dezember 1932 hielt es die zuständige Parteigliederung, der neugegründete Kampfbund des gewerblichen Mittelstandes, für notwendig, den kleinen Gewerbetreibenden zu versichern, das Ziel der nationalsozialistischen Wirtschafts- und Sozialpolitik sei die «Entproletarisierung» des deutschen Arbeiters: «Sinn der sozialistischen Idee ist die Beeignung der Besitzlosen. Damit steht der Sozialismus Adolf Hitlers in schärfstem Gegensatz zu dem verlogenen Schein-Sozialismus der Marxisten, der sich die Enteignung der Besitzenden zum Ziel gesetzt hat.» Für «nationale» Arbeiter und Angestellte, für Studenten und jüngere Akademiker aber bedeutete der «nationale Sozialismus» ein Angebot: Sie konnten sich unter diesem Panier sowohl vom internationalistischen Marxismus als auch von der nationalistischen «Reaktion» absetzen und eine «dritte» Position beziehen – eine, wie es schien, zukunftsweisende Position jenseits von proletarischem Klassenkampf und bürgerlicher Besitzstandswahrung.
Der Nationalismus der NSDAP war das, was sie mit dem bürgerlichen Deutschland verband – oder doch zu verbinden schien. Es gab keine Partei, die Versailles rechtfertigte oder das Streben nach Großdeutschland ablehnte. Die Nationalsozialisten verlangten die Gleichberechtigung Deutschlands und die Vereinigung mit Österreich in einer radikaleren Tonlage als irgend jemand sonst. Aber in der Sache selbst, der Revision der Nachkriegsordnung, bestand, vordergründig jedenfalls, ein breiter nationaler Konsens. Es kam Hitler zugute, daß er, der von Schönerer geprägte Großdeutsche aus Österreich, keinerlei Schwierigkeiten hatte, die Forderung nach dem Anschluß seiner Heimat an das Deutsche Reich mit dem Bekenntnis zur preußischen Tradition, zu Friedrich dem Großen und Bismarck, zu verbinden. Es schadete ihm auch nicht, daß er von Hause aus Katholik war. Die jüngeren Deutschen, soweit sie weder Marxisten noch «kirchlich» waren, hielten den konfessionellen Gegensatz für historisch ebenso überholt wie den Klassenkampf. Hitlers Chance lag darin, daß ihm viele zutrauten, er werde miteinander versöhnen, was ehedem unvereinbar schien: nicht nur Nationalismus und Sozialismus, sondern auch das evangelische und das katholische Deutschland.
Die Zauberworte der großen Synthese waren die «Volksgemeinschaft» und das «Reich». Das Wort «Volksgemeinschaft» hat als erster wohl Schleiermacher in Randnotizen zu einem Manuskript aus dem Jahr 1809 verwendet. Durch den Juristen Friedrich Carl von Savigny fand der Begriff in den folgenden Jahrzehnten Eingang in die Rechtswissenschaft, durch den Soziologen Ferdinand Tönnies (in seinem Buch «Gemeinschaft und Gesellschaft») 1887 in die Soziologie. Seit dem Ersten Weltkrieg sprachen dann alle politischen Richtungen mit Ausnahme der erklärten Marxisten von «Volksgemeinschaft»: Konservative und Liberale bedienten sich des Wortes ebenso wie Gewerkschaftsführer und sozialdemokratische Reformisten.
Je nachdem, wer den Begriff verwendete, konnte er höchst Unterschiedliches meinen: ein Bekenntnis zum friedlichen Ausgleich sozialer Gegensätze im freien Volksstaat etwa oder den Ruf nach einer autoritären Ordnung, in der von «oben» bestimmt wurde, was dem Gemeinwohl diente und was ihm abträglich war. Die Nationalsozialisten aber waren die radikalsten Vertreter dieser Parole: Sie kündigten die Zerschlagung des Marxismus an, weil der Aufruf zum Klassenkampf die Verneinung der «Volksgemeinschaft» in sich schließe. Außerdem deuteten sie, und das unterschied sie von allen anderen Parteien der Weimarer Republik, die «Volksgemeinschaft» im Sinne ihrer rassischen Vorstellungen: In der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft hatten nur «arische» Deutsche einen Platz, nicht aber Juden, Zigeuner und Angehörige anderer, als minderwertig erachteter Rassen.
Das «Reich» war in den Jahren vor 1933 immer mehr zum rechten Kampfbegriff gegen die Republik geworden. Zugleich aber wies die Reichsidee in Vergangenheit und Zukunft. Das «Reich» war von alters her mit Heilserwartungen verknüpft. Sie traten besonders deutlich zutage, wenn im Deutschland der Weimarer Republik vom «Dritten Reich» die Rede war. Zum politischen Schlagwort wurde diese Formel im Jahre 1923, als Arthur Moeller van den Bruck, einer der Vorkämpfer der «Konservativen Revolution», sein Buch «Das dritte Reich» veröffentlichte. Nach dem ersten, dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation und dem zweiten, von Bismarck geschaffenen kleindeutschen Reich, das der Verfasser als unvollkommenes «Zwischenreich» einstufte, sollte das «Dritte Reich» der Deutschen wieder großdeutsch sein, also Österreich mit einschließen. Moeller bezeichnete den deutschen Nationalismus als «Streiter für das Endreich»: «Es ist immer verheißen. Und es wird niemals erfüllt. Es ist das Vollkommene, das nur im Unvollkommenen erreicht wird … Es gibt nur Ein Reich, wie es nur Eine Kirche gibt. Was sonst diesen Namen beansprucht, das ist Staat, oder das ist Gemeinde oder Sekte. Es gibt nur Das Reich.»
Obwohl er an anderer Stelle seines Buches ausdrücklich feststellte, daß es kein «tausendjähriges Reich», sondern nur das «Wirklichkeitsreich» gebe, das eine Nation in ihrem Lande verwirkliche, setzte Moeller auf die eschatologische Aura seines Buchtitels. Die Idee eines «Dritten Reiches» läßt sich bis zu dem italienischen Theologen Joachim von Fiore zurückverfolgen, der im 12. Jahrhundert prophezeit hatte, auf die ersten beiden Zeitalter, die Ordnungen von Gott Vater und seinem Sohn Jesus Christus, werde ein drittes, vom Heiligen Geist geprägtes, tausendjähriges Zeitalter der Vergeistigung und Vervollkommnung folgen. Die Vision eines tausendjährigen Reiches hatte ihren Ursprung im 20. Kapitel der Offenbarung des Johannes. Als Joachim von Fiore die Vorhersage aufgriff, gab er den Chiliasten der folgenden Jahrhunderte das Stichwort: Der Traum von den tausend Jahren zwischen dem Sieg über den Antichrist und dem Jüngsten Gericht, in denen der Teufel keine Macht mehr über die Menschen haben würde, beflügelte die Geißler des 13. und 14. Jahrhunderts, die böhmischen Taboriten im 15. und die Täuferbewegung im 16. Jahrhundert. Noch in Hegels Geschichtsphilosophie hat Joachims Lehre von den drei Reichen des Vaters, des Sohnes und des Geistes ihre Spuren hinterlassen (wobei die Germanen im römischen Reich für das erste, das christliche Mittelalter für das zweite und die Zeit seit der Reformation für das dritte Reich oder die dritte Epoche der germanischen Welt stehen).
Die Nationalsozialisten begannen schon bald nach dem Erscheinen von Moellers Buch sich des Schlagworts vom «Dritten Reich» zu bedienen, das ihre Bestrebungen einprägsam zu bündeln schien. Zum Führer der NSDAP gelangte der Begriff durch die Vermittlung von Gregor Strassers Bruder Otto, der im Juli 1930 mit Hitler brach, weil dieser, so lautete der Vorwurf, den «Sozialismus» des Parteiprogramms von 1920 preisgegeben habe. Erst sehr viel später kamen Hitler Bedenken. Der Begriff «Drittes Reich» konnte leicht zu Spekulationen über ein weiteres, ein viertes Reich verführen und war überdies geeignet, die Kontinuität des Reiches der Deutschen in Frage zu stellen. Im Juni 1939 teilte die Parteikanzlei den Willen des Führers mit, die Bezeichnung «Drittes Reich» nicht mehr zu verwenden. Doch zu diesem Zeitpunkt hatte der Begriff längst seine Wirkung getan: Er trug mit dazu bei, daß viele Deutschen in Hitler ihren Erlöser sahen.
Den Mythos der «tausend Jahre» hat Hitler mehr als einmal in den Dienst seiner Herrschaft zu stellen versucht. «So wie die Welt nicht von Kriegen lebt, so leben die Völker nicht von Revolutionen», erklärte er etwa am 4. September 1934 auf dem Reichsparteitag der Nationalsozialisten in Nürnberg, nach der blutigen Ausschaltung der SA-Führung. «In beiden Fällen können höchstens Voraussetzungen für ein neues Leben geschaffen werden. Wehe aber, wenn der Akt der Zerstörung nicht im Dienste einer besseren und damit höheren Idee erfolgt, sondern ausschließlich nur den nihilistischen Trieben der Vernichtung gehorcht und damit an Stelle eines besseren Neuaufbaus ewigen Haß zur Folge hat … Wahrhafte Revolutionen sind nur denkbar als Vollzug einer neuen Berufung, der der Volkswille auf diese Art seinen geschichtlichen Auftrag erteilt … Wir alle wissen, wen die Nation beauftragt hat! Wehe dem, der dies nicht weiß oder der es vergißt! Im deutschen Volk sind Revolutionen stets selten gewesen. Das nervöse Zeitalter des 19. Jahrhunderts hat bei uns endgültig seinen Abschluß gefunden. In den nächsten tausend Jahren findet in Deutschland keine Revolution mehr statt.»
Am 10. Februar 1933 eröffnete Hitler den Reichstagswahlkampf mit einer Rede im Berliner Sportpalast. Seinen Anklagen gegen die «Parteien des Zerfalls, des Novembers, der Revolution», die vierzehn Jahre lang das deutsche Volk zerstört, zersetzt und aufgelöst hätten, folgte der Aufruf an die Deutschen, der neuen Regierung vier Jahre Zeit zu geben und dann über sie zu richten. Die letzten Worte waren der Bibel und der evangelischen Fassung des Vaterunsers nachempfunden. Hitler versuchte auf diese Weise, den eigenen Willen zur Macht als Dienst am «Reich» und als Erfüllung eines göttlichen Auftrags erscheinen zu lassen: «Denn ich kann mich nicht lösen von dem Glauben an mein Volk, kann mich nicht lossagen von der Überzeugung, daß diese Nation wieder einst auferstehen wird, kann mich nicht entfernen von der Liebe zu diesem meinem Volk und hege felsenfest die Überzeugung, daß eben doch einmal die Stunde kommt, in der die Millionen, die uns heute hassen, hinter uns stehen und mit uns dann begrüßen werden das gemeinsam geschaffene, mühsam erkämpfte, bitter erworbene neue deutsche Reich der Größe und der Ehre und der Kraft und der Herrlichkeit und der Gerechtigkeit. Amen!»
Was er zu tun gedachte, wenn die Deutschen seinem Appell folgten, hatte Hitler eine Woche zuvor, am 3. Februar 1933, in einer geheimen Rede vor den Befehlshabern des Heeres und der Marine in der Wohnung des Chefs der Heeresleitung, General von Hammerstein-Equord, umfassend, wenn auch nicht vollständig dargelegt: «Ausrottung des Marxismus mit Stumpf und Stiel … Straffste autoritäre Staatsführung. Beseitigung des Krebsschadens der Demokratie! … Aufbau der Wehrmacht wichtigste Voraussetzung für Erreichung des Ziels: Wiedererringung der politischen Macht. Allgemeine Wehrpflicht muß wieder kommen … Wie soll politische Macht, wenn sie gewonnen ist, gebraucht werden? Jetzt noch nicht zu sagen. Vielleicht Erkämpfung neuer Exportmöglichkeiten, vielleicht – und wohl besser – Eroberung neuen Lebensraums im Osten und dessen rücksichtslose Germanisierung.»[2]
Der Wahlkampf im Zeichen der «nationalen Erhebung» war überschattet von zahllosen nationalsozialistischen Terrorakten, denen vor allem Kommunisten und Sozialdemokraten zum Opfer fielen. Hermann Göring, der kommissarische preußische Innenminister, forderte am 17. Februar die Polizeibeamten auf, im Zweifelsfall rücksichtslos von der Schußwaffe Gebrauch zu machen. Fünf Tage später setzte er SA, SS und Stahlhelm als freiwillige Hilfspolizei ein, um die angeblich zunehmende Gewalt von links wirksamer als bisher bekämpfen zu können. Abermals fünf Tage später, am 27. Februar, ging das Reichstagsgebäude in Flammen auf.
Ob die Brandstiftung das alleinige Werk des holländischen Anarchosyndikalisten Marinus van der Lubbe war oder ob es Mittäter aus den Reihen der Nationalsozialisten gab, ist in der Forschung bis heute umstritten; der vorherrschenden Meinung nach ist die erste Lesart richtig. Hitler, Göring und Joseph Goebbels, der Reichspropagandaleiter der NSDAP, erklärten jedoch sofort wahrheitswidrig die Kommunisten zu den Urhebern des Verbrechens und behaupteten, der Reichstagsbrand sei als «Fanal zum blutigen Aufruhr und zum Bürgerkrieg» gedacht. Noch in der Nacht zum 28. Februar ordnete Göring das Verbot der kommunistischen und, auf zwei Wochen befristet, der sozialdemokratischen Presse, die Schließung der Parteibüros der KPD und «Schutzhaft» für alle Abgeordneten und Funktionäre dieser Partei an. Am 28. Februar verabschiedete das Reichskabinett die «Notverordnung zum Schutz von Volk und Staat», die die wichtigsten Grundrechte «bis auf weiteres» außer Kraft setzte, neue Handhaben zum Vorgehen gegen die Länder schuf und für eine Reihe von Terrordelikten, darunter Brandstiftung, die Todesstrafe einführte. Die Verordnung nach Artikel 48 bedeutete nichts Geringeres als die Liquidation des Rechtsstaates in Deutschland.
Zu den ersten Opfern der Entwicklung gehörten, neben kommunistischen Funktionären, bekannte Intellektuelle. In «Schutzhaft» genommen wurden noch am 28. Februar neben anderen der Herausgeber der «Weltbühne», Carl von Ossietzky, die Schriftsteller Erich Mühsam und Ludwig Renn, der «rasende Reporter» Egon Erwin Kisch, der Sexualforscher Max Hodann und der Rechtsanwalt Hans Litten. Drei Tage später gelang der Polizei der Schlag gegen die oberste Spitze der KPD: In einem illegalen Quartier in Berlin-Charlottenburg verhaftete sie am 3. März, auf Grund einer Denunziation, den Parteivorsitzenden Ernst Thälmann und einige seiner engsten Mitarbeiter, darunter den Schriftleiter der «Roten Fahne», Werner Hirsch.
Terror und Propaganda verfehlten nicht ihre Wirkung: Aus der Reichstagswahl vom 5. März 1933 ging die Regierung Hitler als Siegerin hervor. 51,9% entfielen auf die beiden Formationen, die das neue Kabinett trugen: Die NSDAP, im Wahlkampf erstmals von der gesamten Großindustrie massiv gefördert, erzielte 43,9%, die Kampffront Schwarz-Weiß-Rot, ein Zusammenschluß von DNVP, Stahlhelm und parteimäßig nicht gebundenen konservativen Politikern, darunter Papen, 8%. Die Kommunisten, von der Verfolgung durch die Nationalsozialisten härter betroffen als alle anderen Parteien, erlitten starke, die Sozialdemokraten vergleichsweise bescheidene Verluste (4,6 beziehungsweise 2,1 Prozentpunkte). Die beiden katholischen Parteien konnten sich dagegen gut behaupten: Auf das Zentrum entfielen 11,2, auf die Bayerische Volkspartei 2,7%. Die beiden liberalen Parteien blieben Splittergruppen, wobei die «linkere» von ihnen noch schlechter abschnitt als die rechte: Die Deutsche Volkspartei verbuchte 1,1, die Deutsche Staatspartei 0,9%. Dramatisch war, neben dem Stimmenzuwachs der NSDAP (+ 10,8%), die Zunahme der Wahlbeteiligung (von 80,6 auf 88,8%). Der Zusammenhang beider Entwicklungen war offenkundig: Die Nationalsozialisten konnten aus dem Anstieg der Wahlbeteiligung den bei weitem größten Nutzen ziehen.
Hitlers Wahlsieg folgte, was die Nationalsozialisten die «nationale Revolution» nannten. Eines ihrer wichtigsten Ergebnisse war die «Gleichschaltung» der Länder: die Ersetzung rein bürgerlicher oder von den Sozialdemokraten mitgetragener Landesregierungen durch nationalsozialistisch geführte Kabinette. Die Gleichschaltung war ein Produkt kombinierten Drucks von «oben», dem Reichsinnenminister Frick, und «unten», den Sturmkolonnen der SA und SS. Am längsten dauerte der Machtwechsel in Bayern, der Hochburg des deutschen Föderalismus. Am 16. März regierten auch in München die Nationalsozialisten.
Parallel zur Gleichschaltung der Länder vollzog sich die Eroberung der Macht in Städten und Gemeinden. SA und SS besetzten die Rathäuser, nahmen vielerorts «marxistische», das heißt: sozialdemokratische Gemeinderäte fest und zwangen Bürgermeister und Oberbürgermeister, die ihnen nicht genehm waren, zum Rücktritt. Denselben Übergriffen waren Arbeitsämter und Ortskrankenhäuser ausgesetzt.
Von den festgenommenen politischen Gegnern wurden viele, aber längst nicht alle der Polizei überstellt. Häufig nahmen SA und SS den «Strafvollzug» in eigene Regie. In Berlin und Umgebung entstanden kurz nach der Reichstagswahl die ersten «wilden» Konzentrationslager, in denen gnadenlos mit den «Bolschewisten» abgerechnet wurde. Noch im März 1933 folgten, beginnend mit dem bayerischen Dachau, die ersten offiziellen Konzentrationslager. In diese, von SA und SS kontrollierten Lager wurden nicht nur Kommunisten, sondern zunehmend auch Sozialdemokraten und andere Gegner des Regimes eingeliefert. Die Zahl der Kommunisten, die im Verlauf des März in «Schutzhaft» genommen und in ein «KZ» eingewiesen wurden, bezifferte der damalige Chef der Berliner politischen Polizei, Rudolf Diels, allein für Preußen mit 20.000. Ende Juli 1933, als der Terror der SA bereits abgeflaut war, gab es nach amtlichen Angaben im ganzen Reich knapp 27.000 «Schutzhäftlinge»; in Preußen waren es noch rund 15.000. Die Zahl der Insassen «wilder» Lager, von denen auch um diese Zeit noch einige bestanden, war darin allerdings nicht enthalten. Die Zahl derer, die in den ersten Monaten des «Dritten Reiches» in den Folterkellern von SA und SS ermordet wurden, hat ebenfalls keine Statistik vermerkt.
Zur «nationalen Revolution» gehörten auch zahllose Pogrome. In Breslau veranstaltete die SA einen Putsch gegen jüdische Anwälte und Richter; vielerorts wurden beamtete jüdische Ärzte für abgesetzt erklärt sowie jüdische Theater, Kabaretts, Juweliergeschäfte, Kleiderläden, Banken und Warenhäuser gestürmt. Am 10. März sah sich Hitler auf Grund deutschnationaler Proteste genötigt, seinen Anhängern «Belästigungen einzelner Personen, Behinderungen von Autos oder Störungen des Geschäftslebens» zu untersagen. «Ihr müßt, meine Kameraden», hieß es in dem Aufruf, «dafür sorgen, daß die nationale Revolution nicht in der Geschichte verglichen werden kann mit der Revolution der Rucksack-Spartakisten im Jahre 1918. Im übrigen, laßt euch in keiner Sekunde von unserer Parole wegbringen. Sie heißt: Vernichtung des Marxismus.»
In der zweiten Märzhälfte ebbten die «wilden» Aktivitäten von SA, SS und Kampfbund des gewerblichen Mittelstandes allmählich ab. Im konservativen Bürgertum, das besorgt auf die Übergriffe reagiert hatte, kehrte wieder Ruhe ein. Dazu trug auch eine verfassungswidrige Maßnahme des Reichspräsidenten bei, die Hitler am 12. März über den Rundfunk verkündete: Vom folgenden Tag ab waren «bis zur endgültigen Regelung der Reichsfarben die schwarz-weiß-rote Fahne und die Hakenkreuzfahne gemeinsam zu hissen». Die Begründung war Balsam für die Deutschnationalen und alle, die in ihrem Herzen Monarchisten geblieben waren: «Diese Flaggen verbinden die ruhmreiche Vergangenheit des Deutschen Reiches und die kraftvolle Wiedergeburt der deutschen Nation. Vereint sollen sie die Macht des Staates und die innere Verbundenheit aller nationalen Kreise des deutschen Volkes verkörpern.»
Hindenburgs Flaggenerlaß war das Vorspiel zum «Tag von Potsdam». In der Garnisonskirche der heimlichen Hauptstadt Preußens fand am 21. März die feierliche Eröffnung des neugewählten Reichstags statt. «Marxisten» nahmen daran nicht teil: Die kommunistischen Abgeordneten waren verhaftet oder untergetaucht; die sozialdemokratische Fraktion hatte tags zuvor in Abwesenheit von neun Mitgliedern, die sich in «Schutzhaft» befanden, beschlossen, der Zeremonie fernzubleiben.
Die Feierlichkeiten waren darauf angelegt, Hitlers Bekenntnis zur Verbindung von «alter Größe» und «junger Kraft» zu unterstreichen. Unter lebhafter Beteiligung der beiden großen christlichen Kirchen wurde Weimar endgültig zu Grabe getragen. Beim evangelischen Gottesdienst in der Nikolaikirche predigte der Generalsuperintendent der Kurmark, Otto Dibelius, über dasselbe Wort aus dem Römerbrief, das der Hofprediger Ernst von Dryander am 4. August 1914 seiner Ansprache im Berliner Dom zugrunde gelegt hatte: «Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein?» Als Reichspräsident von Hindenburg in der Garnisonskirche allein in die Gruft zum Sarg Friedrichs des Großen hinunterstieg, um stumme Zwiesprache mit dem König zu halten, trat bei vielen Deutschen die gleiche patriotische Rührung ein, die seit Jahren die Fridericus-Filme aus Alfred Hugenbergs «Ufa» hervorriefen. Doch das alte Preußen erlebte am 21. März 1933 keine Auferstehung. Die neuen Machthaber nahmen nur seinen Mythos in Dienst, um ihrer Herrschaft den Schein einer noch höheren Legitimation zu verschaffen als jener, die sie am 5. März durch die Wähler empfangen hatten.
Am 23. März trat der Reichstag an seinem neuen Tagungsort, der Krolloper am Platz der Republik in Berlin, zusammen, um über den (nominell von NSDAP und DNVP vorgelegten) Entwurf eines Gesetzes zur Behebung der Not von Volk und Reich zu beraten. Das Ermächtigungsgesetz gab der Reichsregierung für die Dauer von vier Jahren pauschal das Recht, Gesetze zu beschließen, die von der Reichsverfassung abwichen. Die einzigen «Schranken» bestanden darin, daß die Gesetze nicht die Einrichtung des Reichstags und des Reichsrats als solche zum Gegenstand haben und nicht die Rechte des Reichspräsidenten berühren durften. Reichstag und Reichsrat hatten fortan keinen Anspruch mehr darauf, an der Gesetzgebung beteiligt zu werden. Das galt ausdrücklich auch für Verträge mit fremden Staaten. Für das Inkrafttreten der von der Reichsregierung beschlossenen Gesetze genügte nunmehr die Ausfertigung durch den Reichskanzler und die Verkündung im Reichsgesetzblatt.
Um die notwendige verfassungsändernde Mehrheit sicherzustellen, brach die Reichsregierung bereits vor der Verabschiedung des Gesetzes die Verfassung: Sie behandelte die kommunistischen Mandate als nicht existent, wodurch sich die «gesetzliche Mitgliederzahl» des Reichstags um 81 Mandate verminderte. Sodann änderte der Reichstag am 23. März seine Geschäftsordnung: Unentschuldigt fehlende Abgeordnete durften vom Reichstagspräsidenten bis zu sechzig Sitzungstagen von den Verhandlungen ausgeschlossen werden; die ausgeschlossenen Abgeordneten galten aber dennoch als «anwesend». Die SPD hätte also, selbst wenn sie geschlossen der Sitzung ferngeblieben wäre, nicht die beiden Voraussetzungen einer Verfassungsänderung verhindern können: Zwei Drittel der «gesetzlichen Mitglieder» mußten anwesend sein, und zwei Drittel der Anwesenden mußten zustimmen.
Die Zustimmung des Zentrums (und der Bayerischen Volkspartei) zum Ermächtigungsgesetz gewann Hitler dadurch, daß er einige Formulierungen des Zentrumsvorsitzenden, des Prälaten Kaas, zum Verhältnis von Staat und Kirche in seine Regierungserklärung aufnahm und den Unterhändlern der katholischen Partei zusätzliche mündliche Versprechungen machte (auf deren schriftliche Bestätigung das Zentrum am 23. März dann vergeblich wartete). Das Nein der 94 anwesenden Sozialdemokraten, das Otto Wels in einer eindrucksvollen Rede begründete, war einkalkuliert. Die kleineren bürgerlichen Parteien stimmten der Vorlage zu, darunter auch die fünf Abgeordneten der Deutschen Staatspartei, Hermann Dietrich, Reinhold Maier, Theodor Heuss, Ernst Lemmer und Heinrich Landahl. Mit 444 Ja-gegen 94 Nein-Stimmen wurde die verfassungsändernde Mehrheit bequem erreicht. Es hätte nicht einmal der verfassungswidrigen Manipulation der gesetzlichen Mitgliederzahl bedurft, um diese Hürde zu nehmen.
Die Zustimmung der bürgerlichen Parteien war das Ergebnis von Täuschung, Selbsttäuschung und Erpressung. Das Ja des Zentrums lag auf der Linie jener Entwicklung nach rechts, die die Partei seit der Wahl des Prälaten Kaas zu ihrem Vorsitzenden im Dezember 1928 eingeschlagen hatte. Wichtiger als die Rechte des Parlaments waren Kaas die Rechte der katholischen Kirche; mit dieser Haltung setzte er sich am 23. März 1933 gegenüber der widerstrebenden Minderheit um Brüning durch, die sich bei der Abstimmung im Plenum dem Gebot der Parteidisziplin beugte. Die Abgeordneten der Deutschen Staatspartei gaben rechtsstaatliche Prinzipien in der Annahme preis, die von der Mehrheit gewünschte legale Diktatur sei immer noch ein kleineres Übel als die illegale Diktatur, die bei Ablehnung des Gesetzes drohte. Allein die Sozialdemokraten hielten dem massiven Druck stand und retteten so nicht nur die eigene Ehre, sondern auch die Ehre der ersten deutschen Republik. Daß nicht ein einziger Abgeordneter aus den Reihen der katholischen und der liberalen Parlamentarier mit ihnen stimmte, machte nochmals deutlich, woran Weimar gescheitert war: Der Staatsgründungspartei von 1918 waren die bürgerlichen Partner abhanden gekommen, ohne die die Demokratie sich nicht gegen ihre Gegner behaupten konnte.
Die Nationalsozialisten hätten die Macht auch dann nicht mehr aus der Hand gegeben, wenn das Ermächtigungsgesetz an der Barriere der verfassungsändernden Mehrheit gescheitert wäre. Die Verabschiedung des Gesetzes aber erleichterte die Errichtung der Diktatur außerordentlich. Der Schein der Legalität förderte den Schein der Legitimität und sicherte dem Regime die Loyalität der Mehrheit, darunter, was besonders wichtig war, der Beamten. Die Legalitätstaktik, eine wesentliche Vorbedingung der Machtübertragung an Hitler, hatte ihren Zweck am 30. Januar 1933 noch nicht zur Gänze erfüllt. Sie bewährte sich ein weiteres Mal am 23. März 1933, als sie zur faktischen Abschaffung der Weimarer Reichsverfassung herangezogen wurde. Hitler konnte fortan die Ausschaltung des Reichstags als Erfüllung eines Auftrags erscheinen lassen, der ihm vom Reichstag selbst erteilt worden war.[3]
Die erste große Aktion des Regimes nach dem Ermächtigungsgesetz war der Boykott jüdischer Geschäfte am 1. April 1933. Die nationalsozialistische Führung wollte damit zum einen ein Ventil für den Druck von «unten», aus den Reihen der eigenen Anhänger, öffnen, zum anderen auf die scharfe Kritik reagieren, die jüdische Organisationen sowie liberale und sozialistische Zeitungen in aller Welt an den deutschen Märzpogromen übten. Mit der Leitung der Aktionen gegen die «Weltgreuelhetze» wurde Julius Streicher, fränkischer Gauleiter der NSDAP und Herausgeber des antisemitischen Kampfblattes «Der Stürmer», beauftragt; eigentlicher Regisseur aber war Joseph Goebbels, der am 14. März die Leitung des neuen Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda übernommen hatte. Mit dem Ablauf des eintägigen reichsweiten Boykotts unter dem Motto «Deutsche! Wehrt Euch! Kauft nicht bei Juden!» war Goebbels zufrieden. «Die Auswirkungen unseres Boykotts sind schon deutlich zu verspüren», schrieb er unter dem Datum des 2. April in sein Tagebuch. «Das Ausland kommt allmählich zur Vernunft. Die Welt wird einsehen lernen, daß es nicht gut tut, sich von den jüdischen Emigranten über Deutschland aufklären zu lassen.»
Das Urteil des Propagandaministers war voreilig. Am 22. April notierte der deutsche Gesandte in Norwegen, Ernst von Weizsäcker, ein in vielem typischer Repräsentant der «alten Eliten»: «Die anti-jüdische Aktion zu begreifen, fällt dem Ausland besonders schwer, denn es hat diese Judenüberschwemmung eben nicht am eigenen Leibe verspürt. Das Faktum besteht, daß unsere Position in der Welt darunter gelitten hat und daß die Folgen sich schon zeigen und in politische und andere Münze umsetzen.» In Deutschland selbst wurde auch nach der Boykottaktion bei Juden gekauft. Aber die Warnung an die Juden war unüberhörbar: Die Verdrängung aus dem deutschen Wirtschaftsleben schwebte fortan wie ein Damoklesschwert über ihnen. Das Regime behielt sich vor, über Zeitpunkt und Reichweite der nächsten Schritte gegen den wirtschaftlichen Einfluß des Judentums zu bestimmen: Das war die Botschaft des 1. April 1933.[4]
Der Ausschaltung der Juden aus der Wirtschaft ging ihre Verdrängung aus dem öffentlichen Dienst voraus. Am 7. April 1933 erließ die Reichsregierung das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums. Es richtete sich gegen alle Beamten, die den regierenden Nationalsozialisten als nicht zuverlässig galten: gegen sogenannte «Parteibuchbeamte» der Weimarer Republik und namentlich solche, die einer Linkspartei angehört oder nahegestanden hatten, aber auch gegen die «nichtarischen» Beamten. Sie waren in den Ruhestand zu versetzen, soweit sie nicht Frontkämpfer, Väter oder Söhne von Kriegsgefallenen oder schon vor dem 1. August 1914 verbeamtet gewesen waren. Die Ausnahmeregelungen gingen auf den Reichspräsidenten von Hindenburg zurück, der seinerseits vom Reichsbund jüdischer Frontsoldaten um einen entsprechenden Vorstoß bei Hitler gebeten worden war.
Das Gesetz vom 7. April beendete die Phase der «wilden Säuberungen» des öffentlichen Dienstes durch örtliche Aktivisten der NSDAP und leitete eine «geordnete» und umfassende Säuberung von Staats wegen ein. Zu den Betroffenen gehörten Hunderte von Hochschullehrern: Die Berliner und die Frankfurter Universität verloren fast ein Drittel des Lehrkörpers, Heidelberg ein Viertel und Breslau mehr als ein Fünftel. Unter denen, die aus dem Amt gedrängt wurden, waren mehrere Nobelpreisträger, darunter die Physiker Albert Einstein und Gustav Hertz und der Chemiker Fritz Haber. Ihre Stellung verloren, aus rassischen oder politischen Gründen oder weil beides zusammentraf, die Philosophen Theodor Adorno, Max Horkheimer und Helmuth Plessner, die Juristen Hermann Heller, Hans Kelsen und Hugo Sinzheimer, die Soziologen Karl Mannheim und Emil Lederer, die Wirtschaftswissenschaftler Moritz Julius Bonn und Wilhelm Röpke, der Psychologe Erich Fromm, der Theologe Paul Tillich und zahllose andere. Die meisten Entlassenen emigrierten; ganze Forschungsstätten wie das Frankfurter Institut für Sozialforschung und Fachrichtungen wie die Psychoanalyse Freudscher Prägung wurden ausgelöscht.
Zur Säuberung des Lehrkörpers kam die Säuberung der Studentenschaft. Am 28. April 1933 wurde im Zuge eines allgemeinen Numerus clausus der Anteil «nichtarischer» Studenten in etwa dem jüdischen Anteil an der Bevölkerung angepaßt und auf 1,5% gedrückt. Studierende, die der KPD angehört hatten oder als ihre Sympathisanten galten, mußten ihr Studium abbrechen. Mißliebige Rektoren wurden durch neue ersetzt, die dem Regime freundlich gegenüberstanden. In Freiburg wurde am 20. April 1933, dem 44. Geburtstag Adolf Hitlers, Martin Heidegger zum Rektor gewählt. Am 1. Mai trat er der NSDAP bei. Am 27. Mai schwor er Lehrende und Lernende in seiner Rektoratsrede auf den Dreiklang der Bindungen von Arbeitsdienst, Wehrdienst und Wissensdienst ein.
Der Kampf gegen alles, was die Nationalsozialisten als «undeutsch», «dekadent» und «zersetzend» empfanden, richtete sich gegen Lebende und Tote. Am 10. Mai 1933 fanden in den deutschen Haupt- und Universitätsstädten öffentliche Bücherverbrennungen statt. Mitglieder des Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbundes warfen Schriften linker, pazifistischer, liberaler und jüdischer Autoren in die Flammen, darunter Werke von Heinrich Heine, Karl Marx, Karl Kautsky, Sigmund Freud, Alfred Kerr, Heinrich Mann, Erich Kästner, Lion Feuchtwanger, Erich Maria Remarque, Arnold Zweig, Theodor Wolff, Bertolt Brecht, Kurt Tucholsky und Carl von Ossietzky. Die meisten lebenden Opfer der Aktion hatten Deutschland bereits verlassen; einer, Carl von Ossietzky, war am 28. Februar verhaftet worden; ein anderer, Erich Kästner, wohnte in Berlin unerkannt der nächtlichen Zeremonie auf dem Platz vor der Friedrich-Wilhelms-Universität bei.
Die Bücherverbrennung war der Auftakt zu Kampagnen gegen alle Formen «entarteter Kunst» in Literatur und Musik, Malerei und Architektur. Rundfunk, Film, Theater und Presse wurden 1933 binnen weniger Monate gesäubert und gleichgeschaltet, wobei das Regime bei den Zeitungen einen gewissen Sinn für Nuancen zeigte. Daß ein international angesehenes Blatt wie die «Frankfurter Zeitung» in Berichterstattung und Kommentierung einen sachlicheren Stil pflegte als der «Völkische Beobachter», ja in engen Grenzen sich sogar kritisch äußerte, lag im wohlverstandenen Interesse des «Dritten Reiches». Eine Fassade von professioneller Gediegenheit und dosierter Vielfalt im Pressewesen war aus außenpolitischen, einstweilen aber auch aus innenpolitischen Gründen zweckmäßig. Entscheidend war, daß, wo immer es um wichtige Dinge ging, die Sprachregelungen des Propagandaministeriums beachtet und so umgesetzt wurden, wie Goebbels es wünschte.
Am gleichen 7. April 1933, an dem die Reichsregierung das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums verabschiedete, stellte sie auch das Verhältnis von Reich und Ländern auf eine neue gesetzliche Grundlage. Ein erstes Gleichschaltungsgesetz vom 31. März hatte die Zusammensetzung der Landtage dem Ergebnis der Reichstagswahl vom 5. März im jeweiligen Land (natürlich ohne Berücksichtigung der kommunistischen Stimmen) angepaßt und die Landesregierungen ermächtigt, ohne Beschlußfassung der Landtage Gesetze, auch solche mit verfassungsänderndem Charakter, zu erlassen. Das Zweite Gesetz zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reich vom 7. April schuf die Institution des Reichsstatthalters, der fortan die höchste Gewalt im Land verkörperte. In den meisten Fällen betraute Hitler die Gauleiter der NSDAP mit diesem Amt. Reichsstatthalter in Preußen, wo am 5. März ein neuer Landtag gewählt worden war, wurde Hitler selbst. Am 11. April ernannte er einen neuen preußischen Ministerpräsidenten: Es war Hermann Göring, in Personalunion Reichstagspräsident und Reichsminister ohne Geschäftsbereich.[5]
Der wichtigste politische Gegner des Nationalsozialismus, der «Marxismus», war durch die Verabschiedung des Ermächtigungsgesetzes nachhaltig geschwächt worden, aber er war noch keineswegs zur Gänze ausgeschaltet. Von Ausschaltung konnte man nur im Fall der Kommunisten sprechen: Da die Mitglieder der KPD sich seit dem Reichstagsbrand nicht mehr legal betätigen konnten und die Funktionäre verhaftet, ins Ausland geflüchtet oder in den politischen Untergrund gegangen waren, hatte die Kassierung der kommunistischen Mandate am 31. März fast nur noch symbolische Bedeutung.
Die SPD aber bestand als Organisation fort. Zwar hatten drei sozialdemokratische Politiker, die von Nationalsozialisten den «Novemberverbrechern» zugerechnet wurden – Philipp Scheidemann, Wilhelm Dittmann, Arthur Crispien –, auf Weisung des Parteivorstands Deutschland bereits vor dem Reichstagsbrand verlassen. Im März folgten ihnen neben anderen Otto Braun, der frühere preußische Innenminister Albert Grzesinski und Rudolf Hilferding. Andere, unter ihnen der Lübecker Reichstagsabgeordnete Julius Leber, befanden sich, als der Reichstag zur Verabschiedung des Ermächtigungsgesetzes zusammentrat, in Haft oder, wie der Kölner Abgeordnete und frühere Reichsinnenminister Wilhelm Sollmann nach einem Überfall von SA- und SS-Männern, in einem Gefängnislazarett.
Die Parteiführung unter Otto Wels aber gab sich nach dem 23. März gleichwohl eine Zeitlang der Erwartung hin, das Regime werde sozialdemokratische Mäßigung honorieren und das von Göring nach dem Reichstagsbrand erlassene Verbot aller sozialdemokratischen Zeitungen wieder aufheben, wenn sich die SPD nur deutlich von der «antideutschen Hetze» des Auslands distanzierte. Tatsächlich fuhren Ende März namhafte deutsche Sozialdemokraten, darunter Wels, in Absprache mit Göring in die europäischen Nachbarländer, um ihre politischen Freunde über die Entwicklung in Deutschland zu informieren und einige Falschmeldungen zu korrigieren. Am 30. März trat Wels sogar aus dem «Büro», dem Leitungsgremium der Sozialistischen Arbeiter-Internationale, aus. Er protestierte damit gegen einen Aufruf vom 27. März, in dem die Zweite Internationale, ohne sich vorher mit der SPD abgestimmt zu haben, Terror und Antisemitismus im Deutschland Adolf Hitlers angeprangert hatte. Die sozialdemokratische Presse aber blieb, ungeachtet solchen Wohlverhaltens, verboten.
Während die SPD mit großer Vorsicht taktierte, paßte sich der Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund seit Februar 1933 Schritt für Schritt den neuen Verhältnissen an. Die Freien Gewerkschaften hatten schon in den letzten Jahren der Weimarer Republik und verstärkt seit dem Herbst 1932 ihre «nationale» Ausrichtung betont und auf Abstand zur Sozialdemokratischen Partei geachtet. Im Frühjahr 1933 setzte der ADGB diesen Kurs verstärkt fort, bis er am Ende von opportunistischer Anbiederung an den Nationalsozialismus nicht mehr zu unterscheiden war. Am 13. April trat die Führung der Freien Gewerkschaften erstmals mit den leitenden Funktionären der Nationalsozialistischen Betriebszellen-Organisation (NSBO) zusammen, um über die Bildung einer Einheitsgewerkschaft zu beraten, die nach Lage der Dinge nur eine nationalsozialistische oder zumindest regimefreundliche Spitze haben konnte. Zwei Tage später begrüßte der Bundesvorstand des ADGB in einer öffentlichen Erklärung die Entscheidung der Reichsregierung, den 1. Mai fortan als gesetzlichen «Feiertag der nationalen Arbeit» zu begehen. Am 19. April folgte, obwohl der Bundesvorsitzende Theodor Leipart dem Vorsitzenden der SPD, Otto Wels, das Gegenteil versprochen hatte, der Aufruf des Bundesausschusses an die Mitglieder der Gewerkschaften, «im vollen Bewußtsein ihrer Pionierdienste für den Maigedanken, für die Ehrung der schaffenden Arbeit und für die gleichberechtigte Eingliederung der Arbeiterschaft in den Staat sich allerorts an der von der Regierung veranlaßten Feier festlich zu beteiligen».
Der «Tag der nationalen Arbeit» verlief so, wie Hitler und Goebbels es geplant hatten. Die Häuser der Freien Gewerkschaften waren, einem Beschluß des Bundesausschusses entsprechend, schwarz-weiß-rot beflaggt. Bei der zentralen Kundgebung auf dem Tempelhofer Feld sah man sogar einen Gewerkschaftsführer, den Vorsitzenden des Textilarbeiterverbandes, Karl Schrader, zusammen mit Mitgliedern seines Verbandes unter einer Hakenkreuzfahne aufmarschieren. Hitlers Rede wurde über alle deutschen Sender übertragen. Sie war ein geschickter Appell an das Selbstwertgefühl der Arbeiter und entsprach dem Motto «Ehret die Arbeit und achtet den Arbeiter!» Die Nationalsozialisten wollten das «entsetzliche Vorurteil» ausrotten, daß Handarbeit minderwertig sei, sagte der Reichskanzler. Die Arbeitsdienstpflicht werde das deutsche Volk zu der Erkenntnis erziehen, daß Handarbeit nicht schände. «Wir denken nicht daran, den Marxismus nur äußerlich zu beseitigen. Wir sind entschlossen, ihm die Voraussetzungen zu entziehen … Kopf- und Handarbeiter dürfen niemals gegeneinander stehen.» Hitler versprach Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung, darunter die «gigantische Aufgabe» des Straßenbaus; er beteuerte seinen Willen zum Frieden und schloß, wie so oft, mit einer Wendung ins Sakrale: «Herr, wir lassen nicht von Dir! Nun segne unseren Kampf um unsere Freiheit und damit unser deutsches Volk und Vaterland!»
Dem «Tag der nationalen Arbeit» folgte der 2. Mai: der Tag, an dem, seit längerem generalstabsmäßig geplant, das Regime zum Schlag gegen die Freien Gewerkschaften ausholte. SA und SS besetzten überall im Reich die Gewerkschaftshäuser, die Redaktionen der Gewerkschaftszeitungen, die Bank der Arbeiter, Angestellten und Beamten mit ihren Filialen. Leipart und andere Gewerkschaftsführer wurden in «Schutzhaft» genommen, die in den meisten Fällen etwa zwei Wochen dauerte; Leipart und sein Stellvertreter Peter Grassmann wurden erst im Juni entlassen. An weniger prominente Funktionäre erging die Aufforderung, unter neuer Führung, nämlich der Nationalsozialistischen Betriebszellen-Organisation, weiterzuarbeiten.
Die anderen beiden Richtungsgewerkschaften, die christlich-nationalen und die liberalen, unterstellten sich, das Schicksal der Freien Gewerkschaften vor Augen, am 4. Mai bedingungslos der Führung Hitlers. Zwei Tage später kündigte Robert Ley, Gregor Strassers Nachfolger als Reichsorganisationsleiter der NSDAP, die Gründung der Deutschen Arbeitsfront (DAF) an. Ihr erster Kongreß fand am 10. Mai in Berlin unter der Schirmherrschaft Hitlers statt, der sich bei dieser Gelegenheit als «ehrlicher Makler» zwischen den verschiedenen Schichten des deutschen Volkes bezeichnete. Ley wurde zum Führer der DAF ernannt; die Führung der Arbeiterverbände übernahm der Leiter der NSBO, Walter Schuhmann. Das «Dritte Reich» hatte damit seine Organisation der Arbeit. Unabhängige Organisationen der Arbeiter aber gab es seit dem 4. Mai 1933 nicht mehr. Tarifliche Lohnvereinbarungen gehörten ebenfalls der Vergangenheit an: Die Bedingungen für den Abschluß von Arbeitsverträgen rechtsverbindlich zu regeln oblag auf Grund eines Gesetzes vom 19. Mai 1933 Treuhändern der Arbeit, die vom Reichskanzler ernannt wurden.
Anders als die Gewerkschaften konnten die Unternehmerverbände ihre organisatorische Selbständigkeit behaupten. Sie mußten sich zwar von ihren jüdischen und, in den Augen der Nationalsozialisten, politisch belasteten Spitzenfunktionären trennen, sicherten sich dadurch aber ein hohes Maß an korporativer Kontinuität. Im Juni 1933 schlossen sich der Reichsverband der Deutschen Industrie und die Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände zum Reichsstand der deutschen Industrie zusammen. Der Begriff «Stand» kam der Sprache der nationalsozialistischen Mittelstandsideologen entgegen. In der Sache aber erlitten diese im Sommer 1933 schwere Niederlagen: Es gelang ihnen nicht, die Großwirtschaft ihrer Kontrolle zu unterwerfen; sie mußten auf Weisung des Stellvertreters des Führers, Rudolf Heß, ihre Kampagnen gegen die «jüdischen» Warenhäuser und die «marxistischen» Konsumvereine einstellen. Wichtig waren der nationalsozialistischen Führung Erfolge in der «Arbeitsschlacht». Eine Zerschlagung von Warenhäusern und Konsumgenossenschaften hätte die Entlassung zahlreicher Arbeiter und Angestellten zur Folge gehabt, kam also nicht in Frage. Mochten die Mittelstandsfunktionäre der NSDAP auf Aussagen des Parteiprogramms von 1920 und Wahlversprechungen pochen: Nachdem die Partei an der Macht war, hatten andere Gesichtspunkte Vorrang.
Ganz anders verlief die Entwicklung im Bereich der landwirtschaftlichen Organisationen. Der Reichslandbund, der im Januar 1933 viel dazu beigetragen hatte, daß Hitler Reichskanzler werden konnte, ging im Juli 1933 im neugeschaffenen Reichsnährstand auf. An seine Spitze trat Richard Walther Darré, der Führer des Agrarpolitischen Apparates der NSDAP, der im Monat zuvor auch die Nachfolge Hugenbergs als Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft übernommen hatte. Der Machtzuwachs des nationalsozialistischen Landwirtschaftspolitikers ging mit einer Machtminderung des ostelbischen Rittergutsbesitzes einher, der über Jahre hinweg der Politik des Reichslandbundes und der Deutschnationalen Volkspartei seinen Stempel aufgedrückt hatte. Die Verlagerung der Gewichte von den Großagrariern zur bäuerlichen Landwirtschaft entsprach einer strategischen Zielsetzung Hitlers: der Herstellung größtmöglicher Autarkie als Voraussetzung eines Lebensraumkrieges, der Deutschland vollständige Autarkie in allen Bereichen der Wirtschaft verschaffen sollte. Die Neuordnung der landwirtschaftlichen Interessenorganisation war, so gesehen, ebenso «logisch» wie der Verzicht auf radikale Veränderungen im industriellen Verbandswesen.[6]
Die Zerschlagung der Freien Gewerkschaften hatte unmittelbare Auswirkungen auf die Sozialdemokratische Partei. Unter dem Eindruck der Ereignisse vom 2. Mai beschloß der Parteivorstand der SPD zwei Tage später, daß die drei hauptamtlichen Vorstandsmitglieder – der Parteivorsitzende Otto Wels, der frühere Chefredakteur des «Vorwärts», Friedrich Stampfer, und der Hauptkassierer Siegfried Crummenerl – sich außer Landes begeben sollten, um den Kampf gegen Hitler von draußen weiterzuführen. Unmittelbar danach traten die drei Parteiführer die Reise zur ersten Station des Exils an: nach Saarbrücken. Damit bahnte sich eine politische Teilung der Partei an: hier der Exil-Vorstand unter Wels, dort die Reichs-SPD, die in dem ehemaligen Reichstagspräsidenten Paul Löbe ihren, wenn auch nur inoffiziellen Sprecher fand.
Am 17. Mai kam es zum offenen Konflikt zwischen den beiden «Lagern» der Sozialdemokratie. Auf diesen Tag war der Reichstag zu einer Sitzung einberufen worden, auf der Hitler eine Regierungserklärung zur Genfer Abrüstungskonferenz abgeben wollte. Um der außenpolitischen Isolierung Deutschlands entgegenzuwirken, lag dem Kanzler an einer Demonstration nationaler Geschlossenheit. Der Parteivorstand in Saarbrücken empfahl der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion eine andere Demonstration: die Nichtbeteiligung. In der Fraktion vertrat nur eine Minderheit unter Führung des Abgeordneten Kurt Schumacher diese Position. Die Mehrheit fügte sich einer Erpressung des Reichsinnenministers Frick: Dieser hatte im Ältestenrat den Sozialdemokraten unverhohlen mit der Ermordung internierter Genossen gedroht, wenn die Fraktion nicht der gemeinsamen Erklärung zustimmen sollte, in der der Reichstag die Regierungserklärung billigte.
Hitlers Rede vom 17. Mai 1933 war die maßvollste und friedfertigste, die er je gehalten hat. Juden und Marxisten kamen in ihr mit keinem Wort vor; er sprach nicht vom «Diktat», sondern vom «Friedensvertrag» von Versailles, äußerte Verständnis für die Sicherheitsbedürfnisse der Nachbarvölker, zumal der Franzosen und Polen, und legte ein Bekenntnis zum Frieden ab, wie es eindringlicher keiner seiner Vorgänger hätte tun können. «Kein neuer europäischer Krieg wäre in der Lage, an Stelle der unbefriedigenden Zustände heute etwa bessere zu setzen», sagte der Kanzler. Nur gleiches Recht für Deutschland forderte Hitler, nicht mehr und nicht weniger. Selbst eine versteckte Drohung klang defensiv: «Als dauernd diffamiertes Volk würde es uns schwer fallen, noch weiterhin dem Völkerbunde anzugehören», erklärte der Kanzler unter stürmischem Beifall bei den Nationalsozialisten, den Deutschnationalen und der Bayerischen Volkspartei.
Im Anschluß an die Regierungserklärung verlas Reichstagspräsident Göring die gemeinsam von den Fraktionen der NSDAP, der DNVP, des Zentrums und der BVP eingebrachte Billigungsresolution und bat die Abgeordneten, die der Entschließung zustimmen wollten, sich von den Plätzen zu erheben. Die Antwort des Plenums hielt das Protokoll fest: «Alle Mitglieder des Reichstags erheben sich. – Die Versammlung singt das Deutschlandlied.» Göring würdigte das Abstimmungsergebnis als Beweis, daß das deutsche Volk einig sei, wenn es um sein Schicksal gehe. Dann stellte er, «damit es im Protokoll vermerkt wird», ausdrücklich fest, «daß die Annahme einstimmig durch sämtliche Parteien erfolgt ist» – ein Satz, der mit stürmischem Beifall quittiert wurde.
Der Applaus galt vor allem den Sozialdemokraten, denen man auf der Rechten so viel «Patriotismus» gar nicht zugetraut hatte. Ein Hauch der historischen Reichstagssitzung vom 4. August 1914 lag in der Luft: Einen Augenblick lang schien die Sozialdemokratie in die «Volksgemeinschaft» aufgenommen, und es mochte Abgeordnete der SPD geben, die wirklich glaubten, das Ja zu Hitlers «Friedensrede» werde das Ende der Unterdrückung einleiten und der Partei das legale Überleben im «Dritten Reich» erlauben.
Aber der Staat Hitlers war nicht der wilhelminische Obrigkeitsstaat. Der totale Staat konnte, anders als der autoritäre, eine selbständige Arbeiterbewegung und eine parlamentarische Opposition nicht dulden. Die SPD hatte Hitler außenpolitisch aufgewertet: Das war der einzige Nutzen, den ihre Legalität für das Regime noch besaß. Nachdem der gewünschte Effekt sich eingestellt hatte, war auch das Ende der Atempause abzusehen, die den Sozialdemokraten am 17. Mai nochmals gewährt wurde.
Das Votum für Hitler hatte den Bruch zwischen der «Reichs-SPD» und der Zweiten Internationale zur Folge. Am 18. Mai mißbilligte das Büro der SAI das Abstimmungsverhalten der sozialdemokratischen Reichstagsabgeordneten, weil es nicht die wahre Überzeugung der deutschen Arbeiterklasse ausdrücke und den Prinzipien der Internationale widerspreche. Otto Wels widerrief noch am 17. Mai seinen am 30. März erklärten Austritt aus dem Büro. Für den Parteivorsitzenden gab es nach dem 17. Mai keinen Zweifel mehr, daß mit der Reichstagssitzung ein Kampf um die Partei begonnen hatte, den der Vorstand nur mit Hilfe der Internationale gewinnen konnte. Am 21. Mai beschloß der Parteivorstand, seinen Sitz von Saarbrücken nach Prag zu verlegen. Für die Wahl der tschechoslowakischen Hauptstadt sprach ein strategisches Argument: Über die dichtbewaldeten Gebirge im Westen und Norden konnte man leicht die Grenze nach Bayern, Sachsen und Schlesien passieren – eine wichtige Voraussetzung jener illegalen Arbeit, zu der die emigrierten Parteiführer nun keine Alternative mehr sahen.
Ein paar Verständigungsversuche zwischen Berlin und Prag wurden noch unternommen, aber der Gegensatz erwies sich als unüberbrückbar. Am 18. Juni erschien in Karlsbad die erste Ausgabe des «Neuen Vorwärts» mit einem Aufruf des Exil-Vorstands unter der Überschrift «Zerbrecht die Ketten!» Es war die schärfste Kampfansage, die bisher von Sozialdemokraten gegen das Regime Hitler gerichtet worden war. «Die Geschlagenen von heute werden die Sieger von morgen sein», hieß es darin. «Der Welt die Wahrheit zu sagen und dieser Wahrheit auch noch Deutschland zu öffnen, ist unsere Aufgabe … Wir rufen zum Kampf, der dem deutschen Volk seine Ehre und seine Freiheit, der Arbeiterklasse ihre schwer errungenen und nur vorübergehend verlorengegangenen Rechte wiederbringen wird … Auf neuen Wegen zum alten sozialistischen Ziel! Zerbrecht die Ketten! Vorwärts!»
Tags darauf trat die «Löbe-SPD» im preußischen Landtag zu einer Reichskonferenz zusammen. Löbe warf dem Exil-Vorstand vor, dieser habe das Angebot zur loyalen Mitarbeit zurückgezogen, das in Wels’ Rede zum Ermächtigungsgesetz enthalten gewesen sei. Ernst Heilmann, der ehemalige Vorsitzende der preußischen Landtagsfraktion, brachte die Linie der Mehrheit auf die klassische Formel: «Wir müssen den Faden der Legalität weiterspinnen, solange er weitergesponnen werden kann.» Mit der Führung der Parteigeschäfte wurde ein sechsköpfiges Direktorium beauftragt, das rein «arisch» zusammengesetzt war. Der neue Vorstand, dem auch Löbe angehörte, stellte sogleich klar, daß nur er für die Partei sprechen könne. «Deutsche Parteigenossen, die ins Ausland gegangen sind, können keinerlei Erklärungen für die Partei abgeben. Für alle ihre Äußerungen lehnt die Partei jede Verantwortung ausdrücklich ab.»
Doch die Absage an die «Prager» half der SPD nichts mehr. Am 21. Juni ordnete Reichsinnenminister Frick unter Hinweis auf «hoch- und landesverräterische Unternehmungen gegen Deutschland», die vom Exil-Vorstand ausgingen, ein umfassendes politisches Betätigungsverbot für die SPD an. Am 22. Juni trat der Erlaß in Kraft. Am gleichen Tag wurden im Rahmen einer großangelegten Welle von Verhaftungen neben zahlreichen Funktionären, Reichstags- und Landtagsabgeordneten der SPD auch vier Mitglieder des neuen Direktoriums, darunter Löbe, festgenommen. Ein Mitglied, Erich Rinner, entkam den Häschern, weil er schon auf dem Weg nach Prag war. Das sechste Mitglied überlebte den 22. Juni nicht: SA-Leute brachten den früheren Ministerpräsidenten von Mecklenburg-Strelitz, Johannes Stelling, im Zuge der «Köpenicker Blutwoche» auf bestialische Weise um. Am 6. Juli nahm die Geheime Staatspolizei einen scharfen Kritiker des «Löbe-Kurses», den Reichstagsabgeordneten Kurt Schumacher, in Berlin fest. Im August folgte die Einlieferung in sein erstes KZ, das Konzentrationslager auf dem Heuberg bei Stuttgart. Es sollte zehn Jahre dauern, bis Schumacher wieder freikam.[7]
Die Ausschaltung der Sozialdemokratie bildete den Auftakt zur Zerschlagung des Parteiwesens überhaupt. Am gleichen 21. Juni, an dem er der SPD ein politisches Betätigungsverbot auferlegte, ordnete der Reichsinnenminister ein Verbot der Deutschnationalen Kampfringe an. Die Kampfringe waren die paramilitärische Organisation der Deutschnationalen Front, wie sich die DNVP seit Mitte Mai nannte. Die amtliche Begründung, es gebe dort eine Unterwanderung durch «kommunistische und sonstige staatsfeindliche Elemente in größtem Umfang», klang abenteuerlich. Alfred Hugenberg, der Vorsitzende der Deutschnationalen Front, hoffte zunächst auf eine Intervention Hindenburgs. Als diese ausblieb, bat er den Reichspräsidenten am 26. Juni um die Entlassung aus seinen Ämtern als Reichsminister für Wirtschaft und für Landwirtschaft. Hitler versuchte, seinem «Partner» vom 30. Januar den Rücktritt auszureden, bestand aber auf einer Auflösung der Deutschnationalen Front. Am 27. Juni trat Hugenberg als Wirtschafts- und Landwirtschaftsminister im Reich und in Preußen zurück. Die Selbstauflösung der Deutschnationalen Front wurde am gleichen Tag von seinen beiden Stellvertretern in Gestalt eines «Freundschaftsabkommens» mit der NSDAP vollzogen, das den deutschnationalen Mandatsträgern die Aufnahme in die nationalsozialistischen Fraktionen zusicherte. Der deutsche Konservativismus verlor damit seinen politischen Arm – durch Kapitulation vor der revolutionären Bewegung, die zu zähmen er sich vorgenommen hatte.
Einen Tag nach dem organisierten Konservativismus trat der linke Flügel des Liberalismus von der politischen Bühne ab: Die Deutsche Staatspartei löste sich am 28. Juni auf, um einer Auflösung von Staats wegen zuvorzukommen. Den letzten Anstoß zu diesem Schritt gab die Kassierung der preußischen Landtagsmandate, die damit begründet wurde, die Abgeordneten der Staatspartei seien auf Grund einer technischen Listenverbindung mit der SPD ins Parlament gelangt und unterlägen damit dem über die Sozialdemokratie verhängten Betätigungsverbot.
Noch weniger heroisch war das Ende des rechten Flügels des Liberalismus. Am 1. April erklärten Parteivorstand und Reichsausschuß der Deutschen Volkspartei, die DVP habe «den Kampf gegen Weimar als eine der Quellen des Niedergangs … länger als ein Jahrzehnt unter großen Opfern geführt»; jetzt sei es einer «gewaltigen nationalen Volksbewegung gelungen, dieses Hindernis deutscher Wiedergenesung hinwegzuräumen». Am 23. April forderte der Vorsitzende der DVP, Eduard Dingeldey, die Mitglieder seiner Partei zur «tätigen Mithilfe am Werk des nationalen Aufbaus auf, das unter der Führung Adolf Hitlers begonnen hat». In den Wochen darauf brach die einstige Partei Gustav Stresemanns organisatorisch zusammen. Am 4. Juli ordnete Dingeldey die Auflösung der gesamten DVP an. Seine Begründung, daß «mit dem Wesen des jetzigen nationalsozialistischen Staates Parteien im alten Sinne nicht vereinbar» seien, traf ins Schwarze. Hitlers Dank bestand darin, daß er Dingeldey am 12. Juli versprach, die Mitglieder und Wähler der DVP würden wegen ihrer Betätigung in dieser Partei «keinerlei berufliche und staatsbürgerliche Zurücksetzung erfahren».
Über das Ende des politischen Katholizismus wurde in Rom entschieden – während der Verhandlungen über ein Konkordat, die Vizekanzler von Papen seit April 1933 führte, wobei der (seit Anfang Mai nur noch nominelle) Zentrumsvorsitzende Kaas als päpstlicher Hausprälat auf kirchlicher Seite eine wichtige Rolle spielte. Gegen die Zusicherung eines kirchlichen Entfaltungsspielraums gab die Kurie die politischen, sozialen und berufsständischen Organisationen des deutschen Katholizismus preis. Am 5. Juli, drei Tage vor der Paraphierung des Konkordats, löste sich das Zentrum auf. Die Bayerische Volkspartei hatte denselben Schritt am Tag zuvor getan.