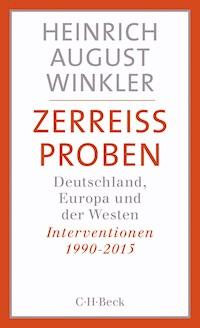19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Heinrich August Winkler hat mit "Der lange Weg nach Westen" und "Geschichte des Westens" zwei der erfolgreichsten Geschichtsbücher der letzten Jahrzehnte geschrieben. Längst ist er als brillanter Erklärer historischer Zusammenhänge auch einem großen Publikum bekannt. Doch der Berliner Historiker war zugleich immer auch ein streitbarer öffentlicher Intellektueller, der sich in die großen innen- und außenpolitischen Debatten der Nation eingemischt und damit selbst auf den Lauf der Geschichte eingewirkt hat. Dieser Band versammelt seine wichtigsten politischen Interventionen aus vier Jahrzehnten. Ob es um die deutsche Einheit geht oder Berlin als Hauptstadt, um den Umgang mit der deutschen Vergangenheit oder das Parteiensystem, den europäischen Einigungsprozess oder den deutschen Hang zur moralischen Selbstüberhöhung, unser Verhältnis zu Frankreich oder unseren Umgang mit Putin – Heinrich August Winkler nimmt kein Blatt vor den Mund. Mit seinen glänzend geschriebenen, sachlich fundierten und analytisch scharfsinnigen Beiträgen ist er einer der einflussreichsten "public intellectuals" Deutschlands geworden. Dieser spannend zu lesende Band zeigt, warum.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
HEINRICH AUGUST WINKLER
NATIONALSTAAT WIDER WILLEN
Interventionen zur deutschen und europäischen Politik
C.H.BECK
ZUM BUCH
Heinrich August Winkler hat mit «Der lange Weg nach Westen» und «Geschichte des Westens» zwei der erfolgreichsten Geschichtsbücher der letzten Jahrzehnte geschrieben. Längst ist er als brillanter Erklärer historischer Zusammenhänge auch einem großen Publikum bekannt. Doch der Berliner Historiker war zugleich immer auch ein streitbarer öffentlicher Intellektueller, der sich in die großen innen- und außenpolitischen Debatten der Nation eingemischt und damit selbst auf den Lauf der Geschichte eingewirkt hat. Dieser Band versammelt einige seiner wichtigsten politischen Interventionen aus den letzten Jahrzehnten.
«Einer der bedeutendsten Historiker des Landes.»
Timothy Garton Ash
ÜBER DEN AUTOR
Heinrich August Winkler, geboren 1938 in Königsberg, lehrte von 1991 bis 2007 Neueste Geschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin. 2014 erhielt er den Europapreis für politische Kultur der Hans-Ringier-Stiftung, 2016 den Leipziger Buchpreis für Europäische Verständigung. 2018 verlieh ihm der Bundespräsident das Große Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland. Zuletzt erschienen von ihm der Bestseller «Wie wir wurden, was wir sind. Eine kurze Geschichte der Deutschen» (32020) sowie der Band «Deutungskämpfe. Der Streit um die deutsche Geschichte» (22021).
INHALT
VORWORT
I. VON DER POSTNATIONALEN DEMOKRATIE ZUM POSTKLASSISCHEN NATIONALSTAAT
1. NATION JA – NATIONALSTAAT NEIN – EINE AUSEINANDERSETZUNG MIT THESEN VON GÜNTER GAUS UND HANS MOMMSEN
2. DIE MAUER WEGDENKEN – WAS DIE BUNDESREPUBLIK FÜR DIE DEMOKRATISIERUNG DER DDR TUN KANN
3. DER STAATENBUND ALS BEWÄHRUNGSPROBE – DAS ERREICHBARE MASS AN EINHEIT VERTRÄGT KEINEN AUFSCHUB MEHR
4. DEUTSCHLANDS ZWEITE CHANCE – ZUR HISTORISCHEN BEDEUTUNG DES 3. OKTOBER 1990
5. HAUPTSTADT BERLIN – EINE UNBEQUEME NOTWENDIGKEIT
6. WESTBINDUNG ODER WAS SONST? – EIN SAMMELBAND VERKÜNDET EINE SCHILLERNDE BOTSCHAFT
7. VON DER POSTNATIONALEN DEMOKRATIE ZUM POSTKLASSISCHEN NATIONALSTAAT
8. WOFÜR BERLIN STEHT – DIE WIDERSPRUCHSVOLLE GESCHICHTE DER DEUTSCHEN HAUPTSTADT
II. VOM ERBE EINER DIKTATUR
1. DER SCHÖNE SCHEIN DER ERNEUERUNG – EIN REKTOR IM ZWIELICHT: DER FALL FINK
2. ERNEUERUNG VERLANGT AUFARBEITUNG – DIE GESCHICHTSWISSENSCHAFT AN DER BERLINER HUMBOLDT-UNIVERSITÄT IM UMBAU
Wühlen ist unser Beruf
Notwendige Zusammenarbeit
3. DER TÄTER ALS OPFER – OTTO KÖHLER, FREIBURG UND DIE HUMBOLDT-UNIVERSITÄT
4. DANZIG STATT DIMITROFF – BERLINER STRASSENNAMEN ALS ERINNERUNGSPOLITIK
5. NACHDENKEN ÜBER ROSA L. – EIN DENKMAL ALS KAMPF UM DIE KULTURELLE HEGEMONIE
III. STREITFRAGEN DER INNEREN POLITIK
1. WOHIN TREIBT DIE SPD? – DIE BUNDESREPUBLIK BRAUCHT EINE REGIERUNGSFÄHIGE OPPOSITION
2. GYSI, DER SATTEL UND DIE KUH – DIE NACHFOLGEPARTEI DER SED STEHT VOR EINEM RICHTUNGSDILEMMA UND IHRE GALIONSFIGUR IM BUNDESTAG VOR DER MACHTFRAGE
3. SEPARATISMUS AUF FILZLATSCHEN – DER MARXISMUS-LENINISMUS IST TOT, UND DER WEG NACH EUROPA FÜHRT ÜBER BERLIN
Formt sich in Deutschland eine Lega West heraus?
Die Kritik historischer Mythen ist überfällig
4. AUCH GEISTIGES EIGENTUM VERPFLICHTET – PLÄDOYER FÜR NACHTRÄGLICHE STUDIENGEBÜHREN
Status quo der Hochschulfinanzierung sozial ungerecht
Wider den Strukturkonservatismus
Solvente Akademiker haben moralische Verpflichtung
5. DIE VERACHTETE REPUBLIK – WEIMARS SCHATTEN ÜBER BERLIN
6. MEHR REVOLUTION WAGEN? – WARUM DIE EMPFEHLUNG, DIE SPD SOLLE NACH LINKS RÜCKEN, IN DIE IRRE FÜHRT
7. GÖRLITZ, GODESBERG UND DIE GEGENWART – ÜBER DIE MÜHEN DER SPD, EINE VOLKSPARTEI ZU WERDEN UND ZU BLEIBEN
I.
II.
III.
IV. WEGE UND IRRWEGE DER EUROPÄISCHEN EINIGUNG
1. WELTMACHT DURCH ÜBERDEHNUNG? – PLÄDOYER FÜR EUROPÄISCHEN REALISMUS
Auch Trennungen können verbinden
Das Wunschdenken der Geostrategen
Grundlagenvertrag statt Verfassung
2. VOM STAATENVERBUND ZUR FÖDERATION – ZUR KRISE DES EUROPÄISCHEN EINIGUNGSPROZESSES VORTRAG VOR DER ÖSTERREICHISCHEN GESELLSCHAFT FÜR AUSSENPOLITIK UND DIE VEREINTEN NATIONEN
3. EUROPAS FALSCHE FREUNDE – WER DIE NATIONEN ABSCHAFFEN WILL, FÖRDERT DIE NATIONALISTEN
4. DIE LEGENDE VON DER EUROPÄISCHEN SOUVERÄNITÄT – WARUM MACRON IN DEUTSCHLAND MISSVERSTANDEN WIRD
5. WARNUNG VOR DEUTSCHEM WUNSCHDENKEN – EIN NIEDERLÄNDISCHES PLÄDOYER FÜR EUROPÄISCHEN REALISMUS
V. MORAL VERSUS INTERESSE
1. DIE STUNDE DER VEREINFACHER – EINHEIT DER GEGENSÄTZE: WAS RECHTE UND LINKE POPULISTEN VERBINDET
2. WER HAT DIE DEUTSCHEN ZU RICHTERN DER NATIONEN BESTELLT?
3. ES GIBT KEIN DEUTSCHES MORALMONOPOL
4. ROHR DES ANSTOSSES – DIE SPD, RUSSLAND UND EUROPA
5. DER FALSCHE CHARME DER SCHAUKELPOLITIK – EIN BEITRAG ZUR GESCHICHTE DER DEUTSCH-RUSSISCHEN BEZIEHUNGEN
6. WAS PUTIN MIT HITLER VERBINDET – DER ULTRANATIONALISMUS ALS LETZTES STADIUM DES INTERNATIONALISMUS
7. DIE LEGENDE VON DER VERSÄUMTEN CHANCE – PUTIN, DIE OSTERWEITERUNG DER NATO UND DIE UKRAINE
I.
II.
III.
IV.
8. WELCHE ZUKUNFT HAT DER WESTEN? – ZUR KRISE EINER POLITISCHEN KULTUR
I.
II.
III.
ANHANG
HELMUT SCHMIDT AN HEINRICH AUGUST WINKLER, 22. NOVEMBER 1983.
EGON BAHR AN HEINRICH AUGUST WINKLER, 21. MAI 2001.
HELMUT SCHMIDT AN HEINRICH AUGUST WINKLER 26. JUNI 2013
DANK
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
ANMERKUNGEN
I. Von der postnationalen Demokratie zum postklassischen Nationalstaat
1. Nation ja – Nationalstaat nein. Eine Kritik an Thesen von Günter Gaus und Hans Mommsen
2. Die Mauer wegdenken. Was die Bundesrepublik für die Demokratisierung der DDR tun kann
3. Der Staatenbund als Bewährungsprobe. Das erreichbare Maß an Einheit verträgt keinen Aufschub mehr
4. Deutschlands zweite Chance. Zur historischen Bedeutung des 3. Oktober 1990
5. Hauptstadt Berlin – eine unbequeme Notwendigkeit
6. Westbindung oder was sonst? Ein Sammelband verkündet eine schillernde Botschaft
7. Von der postnationalen Demokratie zum postklassischen Nationalstaat
8. Wofür Berlin steht. Die widerspruchsvolle Geschichte der deutschen Hauptstadt
II. Vom Erbe einer Diktatur
1. Der schöne Schein der Erinnerung. Ein Rektor im Zwielicht: Der Fall Fink
2. Erneuerung verlangt Aufarbeitung. Die Geschichtswissenschaft an der Berliner Humboldt-Universität im Umbau
3. Der Täter als Opfer. Otto Köhler, Freiburg und die Humboldt-Universität
4. Danzig statt Dimitroff. Berliner Straßennamen als Erinnerungspolitik
5. Nachdenken über Rosa L. Ein Denkmal als Kampf um die kulturelle Hegemonie
III. Streitfragen der inneren Politik
1. Wohin treibt die SPD? Die Bundesrepublik braucht eine regierungsfähige Opposition
2. Gysi, der Sattel und die Kuh. Die Nachfolgepartei der SED steht vor einem Richtungsdilemma und ihre Galionsfigur im Bundestag vor der Machtfrage.
3. Separatismus auf Filzlatschen. Der Marxismus-Leninismus ist tot, und der Weg nach Europa führt über Berlin
4. Auch geistiges Eigentum verpflichtet. Plädoyer für nachträgliche Studiengebühren
5. Die verachtete Republik. Weimars Schatten über Berlin
6. Mehr Revolution wagen? Warum die Empfehlung, die SPD solle nach links rücken, in die Irre führt
7. Görlitz, Godesberg und die Gegenwart. Von den Mühen der SPD, eine Volkspartei zu werden und zu bleiben
IV. Wege und Irrwege der europäischen Einigung
1. Weltmacht durch Überdehnung? Plädoyer für europäischen Realismus
2. Vom Staatenverbund zur Föderation. Zur Krise des europäischen Einigungsprozesses
3. Europas falsche Freunde. Wer die Nationen abschaffen will, fördert die Nationalisten
4. Die Legende von der europäischen Souveränität. Warum Macron in Deutschland missverstanden wird
5. Warnung vor deutschem Wunschdenken: Ein niederländisches Plädoyer für europäischen Realismus
V. Moral versus Interesse
1. Die Stunde der Vereinfacher. Einheit der Gegensätze: Was rechte und linke Populisten verbindet
2. Wer hat die Deutschen zu Richtern der Nationen bestellt?
3. Es gibt kein deutsches Moralmonopol.
4. Rohr des Anstoßes. Die SPD, Russland und Europa.
5. Der falsche Charme der Schaukelpolitik. Ein Beitrag zur Geschichte der deutsch-russischen Beziehungen
6. Was Putin mit Hitler verbindet. Der Ultranationalismus als letztes Stadium des Kommunismus
7. Die Legende von der versäumten Chance. Putin, die Osterweiterung der NATO und die Ukraine
8. Welche Zukunft hat der Westen? Zur Krise einer politischen Kultur
Anhang
PERSONENREGISTER
Für Dörte
VORWORT
Die Wiedervereinigung Deutschlands im Jahr 1990 bildet eine tiefe Zäsur nicht nur der deutschen, sondern auch der europäischen Geschichte. In der «alten» Bundesrepublik spürte man den Einschnitt des 3. Oktober 1990 freilich sehr viel weniger als in der ehemaligen DDR. Dramatische Umstellungen erforderten die Umwälzungen der Jahre 1989/90 nur von den Ost-, nicht von den Westdeutschen. Die höchst unterschiedlichen Prägungen der Deutschen in den über vier Jahrzehnten des Ost-West-Konflikts wirken bis heute nach. Nirgendwo zeigt sich das so sehr wie im Bereich der politischen Kultur und hier besonders beim Wahlverhalten. Was für Deutschland gilt, trifft ebenso auf «West» und «Ost» innerhalb der Europäischen Union zu.
Dieser Band enthält einige meiner Interventionen zu Streitfragen der deutschen und der europäischen Politik aus den Jahren 1981 bis 2022. Einige Beiträge dokumentieren auch Positionen, die ich später als irrig erkannt und korrigiert habe. Das gilt sowohl für einige meiner Stellungnahmen zur staatlichen Einheit Deutschlands als auch für solche zur europäischen Integration.
In den achtziger Jahren, in denen ich an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg im Breisgau lehrte, war ich wie viele Westdeutsche zu der Überzeugung gelangt, dass die Bundesrepublik gut beraten war, wenn sie nicht mehr auf die Wiederherstellung eines souveränen deutschen Nationalstaats drängte, sondern ihre gesamtdeutschen Anstrengungen ganz auf eine Demokratisierung der politischen Verhältnisse in der DDR konzentrierte. Erst einige Wochen nach dem Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989 wurde mir klar, dass es keine realistische Alternative zur Verwirklichung der deutschen Einheit in Form eines Bundesstaates in den Grenzen von 1945 gab.
Die Frage nach der Finalität des europäischen Einigungsprozesses beantwortete ich noch 2012 mit einem (durchaus zeittypischen) Bekenntnis zur Weiterentwicklung der Europäischen Union vom Staatenverbund zur Föderation. Wie einige der hier abgedruckten Beiträge zeigen, bin ich in diesem Punkt inzwischen sehr viel skeptischer geworden. Die heutige EU nach dem Vorbild des deutschen Föderalismus organisieren zu wollen widerspricht zutiefst den Wünschen fast aller anderen Mitgliedstaaten. Umso erstaunlicher ist es, dass die für das politische Denken der alten Bundesrepublik so bezeichnende Vision eines europäischen Bundesstaates auch heute noch ihren Niederschlag in quasi offiziellen Verlautbarungen wie Wahlprogrammen bis hin zum Koalitionsvertrag der «Ampelparteien» SPD, Grüne und FDP vom November 2021 findet. Viele altbundesdeutsch geprägte Politiker, Publizisten und Intellektuelle hadern offenbar mehr oder minder unbewusst mit der Tatsache, dass Deutschland seit 1990 wieder ein Nationalstaat ist, die Berliner Republik sich also insoweit weniger von den anderen Mitgliedstaaten der EU unterscheidet als die Bonner Republik. So sehr sich dieses Verhalten aus der katastrophalen Selbstzerstörung des ersten deutschen Nationalstaats in den Jahren 1933 bis 1945 erklären lässt, so wenig entbindet diese Geschichte die Deutschen von der Notwendigkeit, die Wahrnehmung ihrer Nachbarn ernst zu nehmen und sich vor altneuen Sonderwegen zu hüten.
Manche Schwerpunkte des vorliegenden Bandes haben einen autobiografischen Hintergrund. Die Beschäftigung mit der Entwicklung der deutschen Sozialdemokratie hat auch mit der Tatsache zu tun, dass ich seit 1962 Mitglied der SPD bin. Mit meiner Berufung an die Humboldt-Universität zu Berlin im Oktober 1991 hängt zusammen, dass diese Hochschule und diese Stadt im Mittelpunkt einiger Aufsätze stehen. Der größere Kontext ist das Zusammenwachsen des vier Jahrzehnte lang getrennten Deutschland in einem Bundesstaat: ein Prozess, der wiederum unlösbar mit einem neuen Stadium der Vereinigung Europas seit der Epochenwende von 1989/90 verknüpft ist. Gemeinsam ist allen Beiträgen die Frage nach der normativen Grundlage der politischen Entscheidungen, die das Thema des jeweiligen Aufsatzes sind. Im letzten Teil des Bandes, der dem Verhältnis von Interesse und Moral gewidmet ist, tritt dieses Erkenntnisinteresse besonders deutlich hervor. Eines der Themen ist dabei der Streit um die deutsche Russlandpolitik. Mit dem Beginn des russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ist nicht nur dieser Disput in ein neues Stadium getreten. Der 24. Februar 2022 markiert eine tiefe Zäsur: den definitiven Bruch der Großmacht Russland mit der europäischen Friedensordnung, wie sie sich nach 1990 herausgebildet hat, also das Ende der Nach-Kalte-Kriegs-Ära.
Dass einige Argumente, Zitate und Schlüsselbegriffe wie etwa «postnationale Demokratie» und «postklassischer Nationalstaat» mehrfach auftauchen, liegt in der Natur der Sache. Die Rechtschreibung ist jeweils die der Erstveröffentlichung.
I.
VON DER POSTNATIONALEN DEMOKRATIE ZUM POSTKLASSISCHEN NATIONALSTAAT
1. NATION JA – NATIONALSTAAT NEIN
EINE AUSEINANDERSETZUNG MIT THESEN VON GÜNTER GAUS UND HANS MOMMSEN
Februar 1981
Am 30. Januar 1981, kurz vor seinem Ausscheiden aus dem Amt des Ständigen Vertreters der Bundesrepublik in der DDR, beklagte es Günter Gaus in einem Interview mit der Wochenzeitung «Die Zeit», dass «wir die DDR bei uns innerlich noch nicht anerkannt» hätten, und forderte die Bundesrepublik auf, ihren «bürgerlich-klassenmäßig entstandenen» Nationsbegriff gegenüber der DDR aus dem Verkehr zu ziehen. Gaus erntete massiven Widerspruch, erhielt aber auch viel Zustimmung, unter anderem von dem Bochumer Historiker Hans Mommsen, der in der nächsten Ausgabe der «Zeit» von einem längst im Gang befindlichen Prozess der «Bi-Nationalisierung beider Teile Deutschlands» sprach.
Der folgende Text, der in der «Zeit» vom 13. Februar 1981 erschien, ist meine Erwiderung auf die Thesen von Gaus und Mommsen. Ich bejahe darin den Fortbestand einer deutschen Nation, widerspreche aber der Auffassung, daraus folge notwendigerweise das Staatsziel der Wiederherstellung eines souveränen deutschen Nationalstaates, wie das Deutsche Reich einer gewesen war: ein Plädoyer, das ich mit der überwiegend unheilvollen Rolle der Großmacht Deutschland in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts begründete. Ein fest in die europäische und atlantische Gemeinschaft eingebundener postklassischer Nationalstaat, wie er 1990 entstand, lag in den 1980er Jahren noch jenseits meines Vorstellungsvermögens.
Das Rezept klingt einfach: Wir erkennen die DDR innerlich an, verzichten ihr gegenüber auf den Begriff der Nation, pflegen ein ausschließlich auf die Bundesrepublik Deutschland bezogenes Gefühl nationaler Identität – und schon ist das deutsche Problem gelöst, das uns ja ohnehin nur von einigen reaktionären Träumern, von den letzten Epigonen der Bismarckschen Reichsgründung, eingeredet wird.
Das ist die Quintessenz dessen, was Hans Mommsen in der ZEIT vom 6. Februar zur Verteidigung des spektakulären Vorschlags von Günter Gaus geschrieben hat, wir sollten erwägen, den Begriff der Nation möglicherweise aus dem Verkehr zu ziehen. Ich melde gegen diese Empfehlung Widerspruch an, und zwar aus den folgenden Gründen:
Erstens: Ich stimme mit Hans Mommsen darin überein, daß für die in zwei Staaten organisierten Reste des Bismarckreiches weder der Begriff «Kulturnation» noch der Begriff «Staatsnation» gilt. Einen einheitlichen deutschen Staat gibt es seit 1945 nicht mehr, und kulturell umfaßt Deutschland ein viel größeres Gebiet als das des Reiches von 1871. Aber wenn denn nach den berühmten Worten von Ernest Renan eine Nation ist, was eine Nation sein will, dann ist die These von der Herausbildung einer bundesdeutschen und einer DDR-Nation überaus fragwürdig.
Daß die Deutschen in der DDR eine Nation für sich sein wollen, widerspricht allem, was wir über ihre Wünsche und Empfindungen wissen. Sie haben am Nationalsozialismus nicht mehr Schuld als die Bundesdeutschen, aber sie tragen an den Folgen des Zweiten Weltkrieges viel schwerer als wir. Da, innerdeutsch gesehen, die Bundesdeutschen die Gewinner von 1945 sind, gibt es hierzulande viel mehr Deutsche, die sich mit dem deutschen Status quo abfinden können, als dort, wo die Verlierer leben: in der DDR.
Zwar spricht Hans Mommsen von «historisch gewachsenen Bindungen zu den Deutschen in der DDR», aber ich bin ziemlich sicher: Wenn wir seinem Argument folgen, die Bundesdeutschen, zumal die jüngeren, fühlten sich längst als Nation und die offizielle Politik solle dem endlich Rechnung tragen, wird von praktischer Solidarität mit den Deutschen in der DDR nicht viel übrig bleiben. Ich bezweifle, ob Mommsens Beobachtungen über das angebliche Nationalbewußtsein der Bundesdeutschen mehr sind als flüchtige Impressionen oder Momentaufnahmen. Ich vermute eher, daß er kollektive Verdrängungen mit der Wirklichkeit verwechselt, und ich befürchte, daß eine Preisgabe des Begriffs «deutsche Nation» durch Bundesregierung und Bundestag gerade das hervorrufen würde, was er vermeiden will; einen neuen deutschen Nationalismus von rechts.
Ein einseitiger Ausstieg aus der deutschen Nation wäre ein Triumph des bundesdeutschen Egoismus. Solange die Kriegsfolgen so ungleich verteilt sind, wie es heute noch immer der Fall ist, solange fehlt den Bundesdeutschen die moralische Legitimation, die nationale Solidarität mit den Deutschen in der DDR aufzukündigen.
Zweitens: Hans Mommsen hat recht mit der These, daß das Zeitalter des souveränen Nationalstaates, in Europa jedenfalls, abgelaufen ist. Das liegt nicht zuletzt daran, daß das Deutsche Reich aller Welt bis zum bitteren Ende vorgeführt hat, was extremer Nationalismus bewirken kann. Nach den Erfahrungen, die Europa in diesem Jahrhundert mit Deutschland gemacht hat, wird es sich mit der Wiederherstellung eines deutschen Reiches, wie immer es genannt werden würde, nicht abfinden – und zwar auch nicht in den Grenzen von 1945. Die Interessen der beiden Weltmächte, der USA und der Sowjetunion, schließen eine solche Restauration ebenfalls aus.
Theoretisch denkbar wäre allenfalls ein staatlicher Zusammenschluß von Bundesrepublik und DDR im Rahmen eines europäischen Bundesstaates – also unter so weitgehenden Souveränitätsverzichten, daß ein vereinigtes Deutschland von niemandem mehr als Gefahr betrachtet würde. Aber selbst wenn beide Staaten dazu bereit wären – von ihren Nachbarn könnten sie schwerlich dasselbe Maß an «Entnationalisierung» verlangen.
Die nationalstaatliche Wiedervereinigung Deutschlands ist also kein realistisches politisches Ziel. Die nationale Solidarität mit den Deutschen in der DDR verlangt von den Bundesdeutschen, daß sie sich einsetzen für Verhältnisse, die es ihren Landsleuten jenseits der Elbe erlauben, ihren Staat innerlich zu akzeptieren. Die innerliche Anerkennung der DDR, die Günter Gaus und Hans Mommsen von der Bundesrepublik fordern, kann erst erfolgen, wenn die Deutschen in der DDR uns darin vorausgegangen sind. Dieser Gedanke ist übrigens sinngemäß in den späten fünfziger und den sechziger Jahren auch von prominenten Politikern der Union, darunter Konrad Adenauer und Franz Josef Strauß, geäußert worden.
Drittens: Sollten die Deutschen in der DDR eines Tages ihren Staat ebenso annehmen wie die Bundesdeutschen den ihren, dann – aber auch erst dann – ist das Deutschland von 1870/71 zu einem Stück abgeschlossener Geschichte geworden. Darin wäre Bismarcks «kleindeutsche Lösung» endgültig zu jener Episode geworden, als die sie sich erweisen mag. Der Begriff «Kulturnation» gewänne dann neue Aktualität, und es gäbe keine grundsätzlichen Einwände mehr dagegen, die beiden deutschen Staaten von heute als neue politische Nationen zu begreifen.
Solange das nicht so ist, können und dürfen die Bundesdeutschen sich aus ihrer besonderen nationalen Solidarität mit den Deutschen in der DDR nicht selbst entlassen. Günter Gaus und Hans Mommsen wollen das ja auch gar nicht. Warum dann aber ein Begriffsverzicht, der politisch unweigerlich genau das bewirken würde, was es zu vermeiden gilt: daß die Bundesdeutschen aufhören, sich mitverantwortlich zu fühlen für jene Deutschen, denen die innerstaatliche Freiheit immer noch vorenthalten ist?
2. DIE MAUER WEGDENKEN
WAS DIE BUNDESREPUBLIK FÜR DIE DEMOKRATISIERUNG DER DDR TUN KANN
August 1989
In dem folgenden Text spiegeln sich Eindrücke, die ich im Juni 1989 in Leipzig gewonnen hatte. Anlass der Reise war eine Einladung der Sektion Geschichte der Karl-Marx-Universität Leipzig, dort einen Vortrag zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung in der Weimarer Republik zu halten. Am 8. Juni sprach ich vor etwa 90 Zuhörern, darunter auch Historikern aus Jena, Greifswald und Berlin, über das Thema «Die Revolution von 1918/19 und das Problem der Kontinuität in der deutschen Geschichte» (abgedruckt in Band 250 der «Historischen Zeitschrift» im Juni 1990). Zu meiner Überraschung stieß meine Kritik an den Thesen des Zentralkomitees der SED zum 70. Jahrestag der Gründung der Kommunistischen Partei Deutschlands kaum auf Kritik, ebenso wenig meine These, die Spaltung der deutschen Arbeiterbewegung im Ersten Weltkrieg sei nicht nur eine Vorbelastung, sondern auch eine Vorbedingung der Weimarer Republik gewesen, und das deshalb, weil die ungespaltene, marxistische Vorkriegs-SPD nicht zu jenem Klassenkompromiss mit den gemäßigten bürgerlichen Kräften bereit gewesen wäre, der die Conditio sine qua non der parlamentarischen Demokratie war.
In den folgenden Diskussionen in kleinerem Kreis drehte sich alles um das Thema «Perestrojka in der DDR», also um eine ostdeutsche Variante einer Reformpolitik à la Gorbatschow. Die anwesenden SED-Intellektuellen ließen keinen Zweifel an ihrer Überzeugung, dass die DDR ein «sozialistischer Staat» bleiben müsse, dass es aber auch Privateigentum und Privatinitiative, eine «sozialistische Marktwirtschaft» und ein echtes Mehrparteiensystem geben solle – freilich unter Beibehaltung einer entleninisierten, am Erbe von Rosa Luxemburg ausgerichteten SED als Einheitspartei der Arbeiterklasse.
Auf diese Gespräche gründete sich meine Hoffnung, eine grundlegende demokratische Erneuerung der DDR sei nun kein Ding der Unmöglichkeit mehr, und damit auch nicht ein sehr viel engeres, vertraglich geregeltes Miteinander der beiden deutschen Staaten. Das Beharren auf der staatlichen Einheit Deutschlands erschien mir hingegen als kontraproduktiv, weil es nur dazu diene, die «Hardliner» um Erich Honecker in ihrem Anti-Reform-Kurs zu bestärken. Die folgenden Monate machten deutlich, was ich dabei ausgeblendet hatte: Die Mehrheit der DDR-Bevölkerung dachte gar nicht daran, sich mit einem «demokratischen Sozialismus» im Sinne der intellektuellen SED-Reformer zufriedenzugeben.
Nicht die staatliche Einheit Deutschlands, sondern die Freiheit der Deutschen in der DDR sollten wir anstreben, weil allein dieses Ziel politisch erreichbar sei: In diesen Appell mündete Theo Sommers Artikel in der Zeit vom 9. Juni 1989. Dergleichen möge im nächsten Jahrhundert denkbar werden, konterte Helmut Schmidt drei Wochen später.
Was Schmidt Sommer entgegenhält, sind vorrangig innenpolitische Argumente. Ein Verzicht auf die staatliche Einheit Deutschlands ließe «heute innerhalb der Bundesrepublik zwangsläufig die extreme Rechte erstarken und schürte damit erst recht das Mißtrauen unserer Nachbarn. Die mit dem Verzicht gekoppelte Freiheitsforderung an die heutige DDR-Regierung trifft dort auf taube Ohren – und jedenfalls einstweilen auch in Moskau, weil sie die Sorge vor einer Zersetzung des Warschauer Paktes auslösen muß, zumal sie natürlich auf Zustimmung bei den Bürgern der DDR rechnen kann.» Schmidt mahnt abschließend, wer «Kontroversen unter uns» schüre, der verletze unser ohnehin lädiertes Nationalbewußtsein und rufe die Gefahr eines «Umschlags in extremen Nationalismus» hervor.
Ich widerspreche mit Nachdruck. Der Diskurs über die deutsche Frage ist notwendig, um den deutschen Nationalismus, und nicht nur den extremen, geistig zu überwinden. Dieser Nationalismus hat in die deutsche Katastrophe der Jahre 1933 bis 1945 geführt. Heute wächst der Nationalismus dadurch, daß man ihm Zugeständnisse macht. Eben das tun alle jene, die die deutsche Frage, ob in den Grenzen von 1937 oder 1945, zu einem Werkzeug der bundesdeutschen Innenpolitik machen. Nicht um die Bedürfnisse der Deutschen in der DDR geht es ihnen, sondern um die Bedienung einer deutschnationalen Klientel in der Bundesrepublik. Gleichviel, ob die Gralshüter des deutschen Nationalstaates sich bei Schönhubers «Republikanern», auf dem rechten Flügel der Union oder in der konservativen Publizistik tummeln: Sie sind Nationalisten nicht aus Überzeugung, sondern aus Kalkül. Wenn wir ihnen gestatten würden, darüber zu bestimmen, was in Sachen Deutschland gedacht werden darf, wir hätten vor ihnen bereits kapituliert.
Am Beginn des Nachdenkens über die deutsche Frage muß die Einsicht stehen, daß sich der von Bismarck gegründete deutsche Nationalstaat selbst zerstört hat. Angesichts des ausschlaggebenden Anteils, den Deutschland an der Auslösung beider Weltkriege hatte, wollten die Siegermächte 1945 sich gegen die Gefahr einer Wiederholung ein für allemal absichern. In der Teilung Deutschlands sehen sie bis heute ein Mittel zur Stabilisierung Europas. Ein wiedervereinigtes Deutschland würde, wie Peter Bender in seinem jüngsten Buch «Deutsche Parallelen» mit Recht bemerkt hat, «unweigerlich zur Vormacht Europas» werden. «Und das will auch in zwanzig oder dreißig Jahren noch keiner.»
Weil dem so ist, sollten wir nicht mehr von der Wiedervereinigung Deutschlands reden, sondern etwas für die Freiheit der Deutschen in der DDR tun. Das ist leichter gesagt als getan. Aber ob Perestrojka und Glasnost sich auch in der DDR durchsetzen, das hängt nicht zuletzt von der Politik der Bundesrepublik ab.
Polen und Ungarn, so lautet eine gängige und durchaus zutreffende These, bleiben sie selbst, auch wenn ihr Regime sich radikal ändert. Was aber wird aus der DDR, wenn sie sich grundlegend demokratisiert? Würde sie durch die Preisgabe des «real existierenden Sozialismus» nicht ihre Selbstlegitimation und damit ihre «moralische» Daseinsgrundlage verlieren? Heißt Demokratisierung im Falle der DDR mithin nicht zwangsläufig Anbahnung des Anschlusses an die Bundesrepublik?
So sehen das wohl die Führung der SED und große Teile des Parteiapparates. Aber die Anzeichen mehren sich, daß es innerhalb der Staatspartei auch andere Meinungen gibt. Gorbatschows Anhänger in der SED wissen, daß sich die DDR gegen eine Politik der Perestrojka nicht mehr lange wird abschotten können. Für diese Annahme spricht schon der zunehmend desolate Zustand der Wirtschaft. Zwar ist die DDR ökonomisch immer noch erheblich stärker als Ungarn oder gar Polen, aber ihr relativer Vorsprung geht in dem Maß verloren, wie die Reformländer westliche Wirtschaftshilfe erhalten.
Die kostspielige Subventionierung von Mieten und Nahrungsmitteln treibt den anderen deutschen Staat langsam, aber sicher in den Ruin. Rettung versprechen allein die Einführung der Marktwirtschaft und die systematische Förderung von Privatinitiative. Die DDR kann zu einem solchen System übergehen, ohne aufzuhören, ihrem Selbstverständnis nach ein sozialistischer Staat zu sein. Denn eine Abschaffung des gesellschaftlichen Eigentums an den Produktionsmitteln in den Schlüsselsektoren der Wirtschaft steht auch für die konsequentesten Reformer nicht zur Diskussion.
Ein demokratischer Staat wäre die DDR freilich erst dann, wenn ihre Bürger nebst allen anderen klassischen Grundrechten auch die freie Auswahl zwischen mehreren, voneinander unabhängigen Parteien hätten, wenn also keine Partei mehr, wie Erhard Eppler es in seiner großen Rede zum 17. Juni im Bundestag formuliert hat, ein Monopol auf Macht und Wahrheit beanspruchen würde. Gesetzt den Fall, «Reformsozialisten» in der SED visierten einen solchen Zustand an, so hätten sie eine Veränderung von geradezu revolutionärer Qualität im Sinn. Eine derart demokratisierte DDR würde wohl in höherem Maß sozialistisch sein als das Ungarn und das Polen von morgen, müßte ihnen aber in Sachen Demokratie und Pluralismus nicht nachstehen.
Einstweilen ist das alles nur ein utopisches Kontrastprogramm zur tristen Gegenwart der real existierenden DDR. Aber eine konstruktive Utopie vermag als regulative Idee im Sinne Kants zu wirken. Sie kann sich als handlungsleitende Maxime zur Durchsetzung praktischer Vernunft bei der Lösung der deutschen Frage bewähren. Und nicht nur der deutschen Frage. Denn wenn die SED fortfährt, ihren Staat durch Reformverweigerung zu isolieren, beschwört sie eine explosive Situation herauf, die den Prozeß der Erneuerung in ganz Ostmitteleuropa gefährden müßte. Aus der «Insel der Stabilität», als welche die DDR von ihrer Führung gern stilisiert wird, kann binnen kurzem ein europäischer Krisenherd werden.
Was also müßte die Bundesrepublik zugunsten einer Demokratisierung der Deutschen Demokratischen Republik tun? Der erste notwendige Beitrag wäre der Verzicht auf eine nationalstaatliche Wiedervereinigungs-Rhetorik. Der DDR als Langzeitperspektive ihre Abschaffung vor Augen führen heißt, den Reformblockierern in Ost-Berlin ein Alibi frei Haus liefern. Oder anders gewendet: Wer die DDR als Staat in Frage stellt, befestigt das System, das es zu überwinden gilt.
Zweitens muß die Bundesrepublik im Rahmen des verfassungsrechtlich Möglichen alles tun, um der Gefahr einer Massenflucht aus der DDR entgegenzuwirken. In diesem Zusammenhang wäre auch zu prüfen, ob nicht mehr als bisher dem Verlangen nach einer Respektierung einer besonderen DDR-Staatsbürgerschaft Rechnung getragen werden kann. Änderungen der bundesdeutschen Rechtslage wären aber wohl nur durchsetzbar, wenn die DDR konsequent den Weg der Demokratisierung einschlägt.
Der dritte Beitrag wäre eine großangelegte, gezielte Unterstützung beim Umbau der DDR-Wirtschaft. Aktiv unterstützen kann die Bundesrepublik solche Reformen allerdings nur, wenn sie, ernsthaft in Gang gesetzt, mit einer konsequenten Verwirklichung der Menschen- und Bürgerrechte und insbesondere mit der Perspektive der Freiheit des Reisens für alle Deutschen verknüpft werden. Ohne einen Zeitplan für die Beseitigung von Mauer und Stacheldraht sind ein bundesdeutscher «Marshallplan» zugunsten einer sich reformierenden DDR und die Einbeziehung der DDR in entsprechende Bemühungen der Europäischen Gemeinschaft nicht denkbar.
Die überfällige Demokratisierung der DDR würde dem zweiten deutschen Staat jene innere Legitimität verschaffen, die er bis heute nicht besitzt. Die Bedingung der Möglichkeit einer Demokratisierung der DDR ist jedoch die Beseitigung jener traumatischen, gleichwohl objektiv durchaus begründeten Furcht vor Massenflucht und Destabilisierung, die heute noch durchgreifenden Reformen entgegensteht. Ohne Mitwirkung der Bundesrepublik kann diese Furcht nicht abgebaut werden. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, jetzt die Perspektiven zu entwickeln, die einer Politik der inneren Reformen in der DDR zugute kommen würden.
Eine Politik, die den demokratischen Errungenschaften des Westens in der DDR zur Geltung verhilft, sollte im Westen keine Angst vor «deutschen Sonderwegen» auslösen. Die Sowjetunion Gorbatschows würde eine Demokratisierung des zweiten deutschen Staates, wenn sie nicht Destabilisierung, sondern Stabilisierung bewirkt, begrüßen. Eine Deutsche Demokratische Republik, die diesen Namen verdient, könnte einige ihrer sozialen Errungenschaften ganz anders leuchten lassen als bisher. Von einem solchen, sowohl sozialistischen als auch demokratischen Staat würde vielleicht sogar die Bundesrepublik noch etwas lernen können.
Zwischen der Bundesrepublik und einer demokratisierten DDR wäre ein Maß an Zusammenarbeit und Gemeinsamkeit möglich, das über normale zwischenstaatliche Kooperation hinausgeht. Denkbar wäre ein neuer, umfassender Grundlagenvertrag, der die Beziehungen zwischen beiden deutschen Staaten und vielleicht sogar die Schaffung gemeinsamer, von beiden getragener Einrichtungen regelt. Über diesen neuen Grundlagenvertrag könnten in beiden deutschen Staaten Volksabstimmungen stattfinden, die dem geregelten Neben- und Miteinander eine unbezweifelbare demokratische Legitimation geben würden.
Wie fern das Ziel auch sein mag, es ist höchste Zeit, darauf hinzuarbeiten. Wenn wir eine bessere Lösung der deutschen Frage erreichen wollen, müssen wir uns auch den Kopf der DDR zerbrechen. Den Abriß der Berliner Mauer zu fordern, verlangt keine Gedankenarbeit. Aber die Mauer wird nicht fallen, wenn wir sie nicht zuvor, zusammen mit der DDR, weggedacht haben.
Wer uns weismachen will, die deutsche Frage ließe sich auch ohne Zustimmung unserer Nachbarn lösen, zeigt nur, daß er aus der Geschichte nichts gelernt hat. Wir müssen das deutsche Problem einfügen in die Vision eines Europa, das die Gräben des Kalten Krieges überwindet und zu einem Kontinent der Kooperation zusammenwächst. Es gibt keine realistische Alternative zu dieser Perspektive. Offensiv vertreten wird sie soviel Dynamik entfalten, daß die Wortführer der nationalstaatlichen Restauration am Ende als das dastehen werden, was sie sind: die ideenlosen Anwälte einer Vergangenheit, die sich selbst um ihre Zukunft gebracht hat.
3. DER STAATENBUND ALS BEWÄHRUNGSPROBE
DAS ERREICHBARE MASS AN EINHEIT VERTRÄGT KEINEN AUFSCHUB MEHR
Februar 1990
Auch nach dem welthistorischen Ereignis vom 9. November 1989, dem Fall der Berliner Mauer, blieb ich noch längere Zeit der Überzeugung, dass jede Art von Wiedervereinigungsrhetorik überfällige Reformen in der DDR erschwere, wenn nicht verhindere. Stattdessen befürwortete ich eine längerfristig angelegte Konföderation der beiden deutschen Staaten. Die Zehn-Punkte-Erklärung Helmut Kohls vom 28. November 1989, in der der Bundeskanzler sich zum Ziel der Wiederherstellung der staatlichen Einheit Deutschlands bekannte, erschien mir deshalb, laut Tagebucheintrag, als «Schlag ins Kontor der Vernunft».
Erst Mitte Januar 1990 kam ich aufgrund der anhaltenden inneren Krise der DDR und der weiterhin hohen Zahl von Ostdeutschen, die Tag für Tag in die Bundesrepublik übersiedelten, zu dem Schluss, dass «die bundesstaatliche Perspektive» unvermeidbar geworden sei, «wenn die DDR nicht im Chaos versinken soll». So formulierte ich es am 21. Januar 1990 auf einer vom Historischen Seminar der Universität Freiburg veranstalteten Podiumsdiskussion. Eine deutsche Konföderation erschien mir damals, vor allem wegen der ungeklärten Frage der Bündniszugehörigkeit eines wiedervereinigten Deutschland, als ein notwendiges Durchgangsstadium auf dem Weg zu einem gesamtdeutschen Bundesstaat. In dem folgenden Artikel für die «Süddeutsche Zeitung» lege ich die Gründe für die Korrektur meiner Position in der deutschen Frage dar.
Es gilt, Abschied zu nehmen – Abschied von einem ungeschriebenen Gesetz, das vier Jahrzehnte lang die große Politik bestimmt hat: Die Stabilität Europas beruht auf der Teilung Deutschlands. Gegen dieses Gesetz haben seit den Tagen Konrad Adenauers bundesdeutsche Politiker zwar immer wieder angeredet, aber durch ihre Taten haben sie es zugleich bekräftigt. Seit dem Herbst 1989 gilt dieses Gesetz nicht mehr. Denn wie sollte die Teilung Deutschlands Stabilität bewirken, wo doch inzwischen kaum noch jemand bestreitet, daß ohne Aussicht auf die Vereinigung mit der Bundesrepublik eine Stabilisierung der DDR nicht mehr möglich ist?
Bis zum Herbst 1989 hatte viel dafür gesprochen, der innerstaatlichen Freiheit in der DDR absoluten Vorrang vor der staatlichen Einheit zu geben. Die Wiedervereinigungs-Rhetorik orientierte sich nicht an den Bedürfnissen der Deutschen in der DDR, sondern an den Zwecken der bundesdeutschen Innenpolitik, darunter, ganz obenan, der Bedienung einer deutschnationalen Klientel. Den Widersachern Gorbatschows in Ostberlin kamen die nationalen Beschwörungsformeln aus Bonn durchaus zupaß. Nichts hat dem SED-Staat soviel internationalen Rückhalt verschafft wie die von ihm propagierte Alternative: «Wir oder die Wiedervereinigung». Denn nicht nur die Sowjetunion wollte kein einheitliches Deutschland. Die Furcht, daß dieses Deutschland das europäische Gleichgewicht umstürzen und zur deutschen Vorherrschaft führen könnte, bestimmte die Politik der vier Siegermächte – und es gibt keinen europäischen Staat, wo diese Furcht nicht noch lebendig wäre.
Eine DDR, die 1985, nach der großen Wachablösung in Moskau, auf Reformkurs gegangen wäre, stünde heute vermutlich ganz anders, nämlich sehr viel besser da. Die SED hat diese Chance nicht genutzt, und eine widerspruchsvolle bundesdeutsche Politik hat mancherlei getan, um die Reformblockade zu fördern. Einerseits gab die Bundesrepublik, im Interesse menschlicher Erleichterungen, der DDR eine großzügige Wirtschaftshilfe, die ungewollt das «System Honecker» befestigte. Andererseits schwächte Bonn, indem es die DDR zu einem Staat auf Widerruf erklärte, ebenso ungewollt die Gegenkräfte, deren Zukunftsvision nur die Demokratisierung, nicht aber die Beseitigung der DDR sein konnte.
Heute sind wir mit den katastrophalen Folgen der versäumten Umgestaltung der DDR konfrontiert. Der wirtschaftliche Niedergang hat Ausmaße angenommen, die die düstersten Prognosen noch weit übertreffen. Die großen Errungenschaften der friedlichen Revolution vom Herbst 1989 – Öffnung der Grenzen, Meinungsfreiheit, freie Wahlen – sind eines. Etwas anderes ist die Stimmungslage der Menschen, die von den Erfahrungen des Alltags geprägt ist. Die Zahl von mehr als 2000 Übersiedlern, die täglich in die Bundesrepublik kommen, ist das deutlichste Symptom der Misere.
Die Mehrheit der Deutschen in der DDR gibt ihrem Staat längerfristig offensichtlich keine Chance mehr. Von einem erneuerten Sozialismus wollen die meisten nichts wissen; nur ein völliger Bruch mit dem System des staatlich bewirtschafteten Mangels erscheint ihnen aussichtsreich. Wenn auf den großen Demonstrationen in Leipzig und Rostock, Dresden und Ostberlin bundesdeutsche Fahnen geschwenkt werden und Sprechchöre ein einiges Deutschland fordern, dann ist das beides: Protest gegen Verhältnisse, die unerträglich geworden sind, und Hoffnung auf Gemeinsamkeit mit den Deutschen im Westen, denen es in den letzten vier Jahrzehnten in jeder Hinsicht soviel besser ging als den Deutschen in der DDR.
Heute ist die Aussicht auf staatliche Einheit die einzige Perspektive, die eine Wende zum Besseren verspricht. Wenn wir wollen, daß möglichst viele Menschen in der DDR bleiben und sich dort für den politischen und wirtschaftlichen Neuaufbau engagieren, müssen wir auf die bundesstaatliche Vereinigung der beiden deutschen Staaten hinarbeiten. Wir müssen gleichzeitig Illusionen entgegenwirken und offen aussprechen, daß auf dem Weg zu diesem Ziel noch große Hindernisse zu überwinden sind.
Das erste und massivste Hindernis ist die Tatsache, daß die beiden deutschen Staaten unterschiedlichen Bündnissystemen angehören. Ein Vorschlag, dieses Problem zu lösen, scheidet von vornherein aus: die Neutralisierung Deutschlands. Ein neutrales Deutschland wäre für die westlichen Partner der Bundesrepublik nicht annehmbar, weil sich auf diese Weise die geopolitische Balance zu Lasten der USA und zugunsten der Sowjetunion verschieben würde. Auch die Deutschen selbst können, wenn sie nicht von den Wechselfällen der sowjetischen Politik abhängig werden wollen, eine Neutralisierung Deutschlands nicht anstreben. Eine solche Lösung wäre im übrigen ein Rückfall in das Zeitalter der Nationalstaaten, und damit ein Schritt in die falsche Richtung.
Ähnlich illusionär wäre die Forderung, das Gebiet der NATO bis zur polnischen Westgrenze auszudehnen. Die Sowjetunion muß, wenn sie als Großmacht nicht definitiv abdanken will, ein solches Ansinnen zurückweisen. Ganz ungewiß ist im Augenblick, ob Moskau bei den bevorstehenden Verhandlungen der beiden deutschen Staaten mit den vier Siegermächten des Zweiten Weltkrieges die Mitgliedschaft eines vereinten Deutschland im atlantischen Bündnis vorläufig hinnimmt, sofern das NATO-Gebiet auf das Territorium der heutigen Bundesrepublik beschränkt bleibt. Aber eine dauerhafte Lösung des Sicherheitsproblems wäre auch das nicht.
Dauerhaften Bestand kann nur eine Konstruktion haben, die den Gegensatz zwischen Ost und West aufhebt. Wenn die Wiener Verhandlungen über konventionelle Abrüstung zum Erfolg führen, und die Zeichen dafür stehen günstig, wird sich das Verhältnis der beiden Militärblöcke zueinander grundlegend ändern. Der eine, der Warschauer Pakt, ist bereits dabei, sich in seiner bisherigen Form als Militärorganisation aufzulösen. Daß die NATO hiervon unberührt bleibt, ist unwahrscheinlich. Es gibt jedoch Aufgaben, für die die beiden Bündnisse noch gebraucht werden. NATO und Warschauer Pakt werden sich künftig verstärkt um politische Aufgaben, um Rüstungskontrolle und Abrüstung kümmern. An die Stelle der Sicherheit vor- und gegeneinander wird die Organisation einer gemeinsamen Sicherheit treten. Am Ende dieses Prozesses können die beiden Allianzen in einem gemeinsamen europäischen Sicherheitssystem aufgehen, in das sowohl die Sowjetunion als auch die USA und Kanada eingebunden sind. In dieser neuen Friedensordnung würde auch ein geeintes Deutschland seinen Platz finden.
Das zweite Hindernis, das der staatlichen Einheit Deutschlands entgegensteht, sind Ängste unserer Nachbarn. Die Erinnerung, daß der deutsche Nationalstaat, das 1871 gegründete Deutsche Reich, in dem knappen Dreivierteljahrhundert seiner Existenz zweimal, 1914 und 1939, versucht hat, Europa seiner Hegemonie zu unterwerfen, ist noch überall lebendig. Einen dritten Anlauf in dieser Richtung zu verhindern, war nach 1945 ein gemeinsames Interesse der Siegermächte. Gewiß glaubt heute kaum noch jemand, daß ein geeintes Deutschland Europa und die Welt in einen neuen Krieg stürzen würde. Aber allein die Tatsache, daß ein einheitliches Deutschland mit 80 Millionen Einwohnern der bei weitem volkreichste und wirtschaftlich mächtigste Staat Europas westlich des Bug wäre, reicht aus, Furcht vor einer deutschen Hegemonie zu wecken. Das ist der Grund, weshalb das Stichwort «Wiedervereinigung» unsere Nachbarn, und nicht nur die unmittelbaren, beunruhigt.