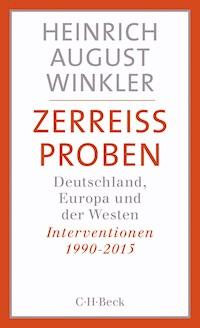11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
DIE QUINTESSENZ DER DEUTSCHEN GESCHICHTE - MEISTERHAFT DARGESTELLT VON HEINRICH AUGUST WINKLER
Heinrich August Winkler ist als Autor der Meisterwerke «Der lange Weg nach Westen» und «Geschichte des Westens» international bekannt geworden. Seine Bücher gelten als Inbegriff von historischer Sachkenntnis, klarem politischen Urteil und einer hervorragend lesbaren Sprache. Nach den großen Standardwerken, die mit einer Gesamtauflage von über 250.000 Exemplaren Bestsellerdimensionen erreicht haben, legt einer der prominentesten Historiker Deutschlands nun ein Buch von radikaler Kürze vor: Wer nicht viel Zeit hat für die deutsche Vergangenheit, der kann sich jetzt in knappster Form einen Meisterkurs genehmigen.
Es gibt bequemere Nationalgeschichten als die deutsche. Aber nicht nur die großen Katastrophen des 20. Jahrhunderts wirken bis in die aktuellen Debatten nach und prägen deutsche Politik und deutsches Selbstverständnis. Auch ältere historische Ereignisse wie die Reichsgeschichte, die Reformation oder der Konflikt zwischen Einheit und Freiheit im 19. Jahrhundert haben Deutschland tief geprägt. Es bedarf eines erfahrenen Historikers, um die Tiefenschärfe all dieser Entwicklungen konzise zu beschreiben und zugleich in greifbare politische Lektionen für die Gegenwart zu übersetzen. Heinrich August Winkler hat mit «Wie wir wurden, was wir sind» die Deutsche Geschichte für aufgeklärte Bürgerinnen und Bürger geschrieben.
- Eine Deutsche Geschichte in knappster Form
- Die Deutsche Geschichte für aufgeklärte Bürgerinnen und Bürger
- Was jeder Deutsche wissen sollte – Grundtatsachen unserer Geschichte
- "Was den Autor seit je auszeichnet: Er ist einfach ein guter Erzähler." Stephan Speicher, DIE ZEIT
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
HEINRICH AUGUST WINKLER
Wie wir wurden, was wir sind
EINE KURZE GESCHICHTE DER DEUTSCHEN
C.H.BECK
ZUM BUCH
Heinrich August Winkler ist als Autor der Werke «Der lange Weg nach Westen» und «Geschichte des Westens» international bekannt geworden. Seine Bücher gelten als Inbegriff von historischer Sachkenntnis, klarem politischen Urteil und einer hervorragend lesbaren Sprache. Nach den großen Standardwerken, die mit einer Gesamtauflage von über 250.000 Exemplaren Bestsellerdimensionen erreicht haben, legt einer der prominentesten Historiker Deutschlands nun ein Buch von radikaler Kürze vor: Wer nicht viel Zeit hat für die deutsche Vergangenheit, der kann sich jetzt in knappster Form einen Meisterkurs genehmigen.
ÜBER DEN AUTOR
Heinrich August Winkler, geb. 1938 in Königsberg, studierte Geschichte, Philosophie, Politische Wissenschaft und öffentliches Recht in Tübingen, Münster und Heidelberg. 1968 und 1970/71 war er German Kennedy Memorial Fellow an der Harvard Universität, Cambridge, MA (USA). Er habilitierte sich 1970 in Berlin an der Freien Universität und war zunächst dort, danach von 1972 bis 1991 Professor in Freiburg. Seit 1991 war er bis zu seiner Emeritierung Professor für Neueste Geschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin. 2014 erhielt er den Europapreis für politische Kultur der Hans Ringier Stiftung, 2016 den Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung und 2018 das Große Bundesverdienstkreuz. Bei C. H.Beck sind u.a. erschienen: «Weimar 1918–1933. Die Geschichte der ersten deutschen Demokratie» (bp 22018), «Zerbricht der Westen? Über die gegenwärtige Krise in Europa und Amerika»(22017) sowie «Werte und Mächte. Eine Geschichte der westlichen Welt» (2019).
INHALT
EINLEITUNG
1: DAS REICH DER DEUTSCHEN UND DER WESTEN
2: EINHEIT VOR FREIHEIT
3: EINE VORBELASTETE REPUBLIK
4: DIE DEUTSCHE KATASTROPHE
5: FREIHEIT VOR EINHEIT
6: EIN POSTNATIONALER SONDERWEG
7: VON DER DEUTSCHEN ZUR EUROPÄISCHEN FRAGE
8: EINE NEUE DEUTSCHE SENDUNG?
9: DIE GEGENWART DER DEUTSCHEN GESCHICHTE
IM ZEICHEN VON CORONA: EIN NACHWORT
DANK
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
ANMERKUNGEN
Einleitung
1 Das Reich der Deutschen und der Westen
2 Einheit vor Freiheit
3 Eine vorbelastete Republik
4 Die deutsche Katastrophe
5 Freiheit vor Einheit
6 Ein postnationaler Sonderweg
7 Von der deutschen zur europäischen Frage
8 Eine neue deutsche Sendung?
9 Die Gegenwart der deutschen Geschichte
Im Zeichen von Corona: Ein Nachwort
PERSONENREGISTER
Für Dörte
«Es gibt schwierige Vaterländer. Eines davon ist Deutschland. Aber es ist unser Vaterland.»
Bundespräsident Gustav Heinemann in seiner Antrittsrede vom 1. Juli 1969
EINLEITUNG
Am 3. Oktober 1990 gelang es dem damaligen deutschen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker in seiner Rede beim Staatsakt zur Wiedervereinigung Deutschlands in der Berliner Philharmonie, die historische Bedeutung dieses Tages in einem einzigen, inhaltsschweren Satz zu bündeln. Er lautet: «Der Tag ist gekommen, an dem zum ersten Mal in der Geschichte das ganze Deutschland seinen dauerhaften Platz im Kreis der westlichen Demokratien findet.»[1]
Weizsäcker sprach damit den langen Weg an, den die Deutschen hatten zurücklegen müssen, um eine Demokratie westlichen Typs zu werden. Einheit und Freiheit hatten die deutschen Liberalen und Demokraten schon im Vormärz, den Jahren nach 1830, und in der Revolution von 1848/49 erstrebt, aber nicht erreicht. Die staatliche Einheit erhielten die Deutschen durch eine «Revolution von oben»: die Bismarcksche Reichsgründung von 1871. Die Freiheit in Form einer parlamentarisch verantwortlichen Regierung kam erst, als es an der Niederlage des deutschen Kaiserreichs im Ersten Weltkrieg nichts mehr zu deuteln gab: im Oktober 1918. Die Koinzidenz von Niederlage und Parlamentarisierung wurde zur schwersten Vorbelastung der Weimarer Republik und einer der tieferen Gründe ihres Scheiterns: Die westliche Demokratie galt der nationalistischen Rechten von Anfang an als die Staatsform der Siegermächte und damit als undeutsches System.
Es bedurfte der bedingungslosen Kapitulation des Deutschen Reiches im Mai 1945 und der Einsicht in den verbrecherischen Charakter der nationalsozialistischen Diktatur, um ein Umdenken auf breiter Front einzuleiten. Doch nur ein Teil Deutschlands, der westliche, aus dem 1949 die Bundesrepublik Deutschland hervorging, hatte nach dem Zweiten Weltkrieg die Möglichkeit, sich der westlichen Demokratie und ihrer politischen Kultur zu öffnen. Der andere, die Sowjetische Besatzungszone und spätere Deutsche Demokratische Republik, erhielt diese Chance erst im Gefolge der friedlichen Revolution von 1989. Die Wiedervereinigung vom 3. Oktober 1990 bedeutete die Lösung der deutschen Frage in dem dreifachen Sinn, den sie seit dem frühen 19. Jahrhundert gehabt hatte: Es gab kein Spannungsverhältnis mehr von Einheit und Freiheit; als territoriales Problem wurde die deutsche Frage dadurch gelöst, dass die Grenzen von 1945 in völkerrechtlich verbindlicher Form festgeschrieben wurden; durch die Mitgliedschaft des wiedervereinigten Deutschland im Atlantischen Bündnis und die europäische Integration hörte das Land auf, ein Problem der europäischen Sicherheit zu sein.
Drei Jahrzehnte später erscheint nicht mehr so sicher, ob die deutsche Frage 1990 wirklich endgültig gelöst worden ist. Mal ist es das starke wirtschaftliche Gewicht Deutschlands in der Europäischen Union und in der Eurozone, das die Rede von einer neuen deutschen Frage aufkommen lässt, mal die Neigung vieler Deutscher, ihr Land zur moralischen Leitnation Europas zu erheben, mal der Hang deutscher Politiker, die Europäische Union auf eine sehr deutsch anmutende föderalistische und «postnationale» Vorstellung von der «Finalität» des europäischen Einigungsprozesses einzuschwören. Befindet sich Deutschland erneut auf einem «Sonderweg»? Kehrt die deutsche Frage in veränderter Gestalt zurück? Allgemeiner gewendet: Wie weit wirkt die deutsche Geschichte in der Gegenwart und auch noch im Zeichen der Corona-Pandemie nach? Wie stark prägt sie das Denken und Handeln der heutigen Deutschen?
Um diese Leitfragen beantworten zu können, bedarf es eines Rückblicks auf einige Grundtatsachen, langfristige Entwicklungslinien und Schlüsselereignisse der deutschen Geschichte. Dieser Rückblick ist bewusst knapp gehalten. Für eine ausführlichere Darstellung verweise ich auf die beiden Bände meiner deutschen Geschichte des 19. und 20, Jahrhunderts «Der lange Weg nach Westen» sowie auf den vierten und letzten Band meiner «Geschichte des Westens», der die Zeit nach 1990 behandelt.[2]
1
DAS REICH DER DEUTSCHEN UND DER WESTEN
In jeder Nationalgeschichte gibt es einige prägende Grundtatsachen. In England ist es die freiheitsfördernde Wirkung der Insellage. Von ihr profitierten niederer Adel und städtisches Bürgertum in ihrer Auseinandersetzung mit der königlichen Gewalt; die Machtstellung des Unterhauses ist eine mittelalterliche Errungenschaft, die im 17. Jahrhundert gegen absolutistische Bestrebungen der Krone verteidigt werden konnte. In Frankreich ist der staatliche Zentralismus ein Werk des frühneuzeitlichen Absolutismus: ein Erbe, an das die Revolutionäre von 1789 und ihre Nachfolger anknüpfen konnten und das sie weiterentwickelten. Zu den Grundtatsachen der deutschen Geschichte gehört der universalistische Anspruch des alten Reiches, das etwas anderes und mehr sein wollte als ein Nationalstaat, wie er sich seit dem hohen Mittelalter in England, Frankreich und Spanien herauszubilden begann. Die Staatsbildung vollzog sich in Deutschland auf territorialer Ebene, in fürstlichen Herrschaftsgebilden wie Württemberg, Bayern oder Brandenburg, den Keimzellen des deutschen Föderalismus.
Mit dem Reich, der wichtigsten Grundtatsache der älteren deutschen Geschichte, eng verbunden war der Reichsmythos, der bis ins 20. Jahrhundert fortwirken sollte. Mittelalterliche Autoren bemühten sich um den Nachweis, dass das römische Reich, das letzte der Weltreiche, nie zu bestehen aufgehört habe. Es habe, nachdem das weströmische Reich Ende des fünften nachchristlichen Jahrhunderts in den Stürmen der Völkerwanderung untergegangen war, zunächst im oströmischen Reich, in Byzanz, fortgelebt, sei dann im Zuge von dessen Niedergang im Jahr 800 vom Papst auf den Frankenkönig Karl den Großen und nach dem Zerfall des einheitlichen Frankenreiches 962 auf die Deutschen in Gestalt des Sachsenkönigs Otto des Großen übertragen worden. Solange das römische Reich bestehe, werde die Welt nicht untergehen, behaupteten mittelalterliche Theologen. Das römische Reich sei nämlich der «Katechon»: eine bewahrende Kraft, von der im zweiten Kapitel des zweiten (fälschlich dem Apostel Paulus zugeschriebenen) Briefes an die Thessalonicher die Rede war. Solange es den Katechon gebe, werde der Antichrist nicht zur Herrschaft gelangen, also das letzte Stadium der weltlichen Geschichte vor der Wiederkehr Christi nicht anbrechen. Das Reich der Deutschen, das fortbestehende römische Reich, hatte mithin einen göttlichen Auftrag. Es war das «Sacrum Imperium»: ein Begriff, der Mitte des 12. Jahrhunderts in der Kanzlei des Stauferkaisers Friedrich I. («Barbarossa») aufkam.
Die besondere «dignitas», eine protokollarische Vorrangstellung unter den Königen des Abendlandes, die die Kaiser für sich beanspruchten, waren die Könige von England und Frankreich zu respektieren bereit. Als Schutzherrn der christlichen Kirche, und nur auf Grund dieser Aufgabe, kam dem Kaiser ein gewisses Primat zu. In der Stauferzeit aber gewannen westeuropäische Beobachter den Eindruck, dass der Kaiser doch mehr sein wollte als der Erste unter Gleichen. Anlässlich der Anerkennung eines Gegenpapstes durch Friedrich I. und eine von ihm gesteuerte Versammlung kaisertreuer Kardinäle zu Pavia im Jahr 1160 protestierte einer der bekanntesten Kirchenmänner der Zeit, Johann von Salisbury, der Bischof von Chartres: «Wer hat die allgemeine Kirche dem Urteil einer Partikularkirche unterworfen? Wer hat die Deutschen zu Richtern der Nationen bestellt? Wer hat diesen rohen und gewalttätigen Menschen die Vollmacht gegeben, nach ihrem Belieben einen Fürsten zu setzen über die Häupter der Menschenkinder?»[1]
Der englische Widerspruch aus Chartres war ein Echo auf das, was man die staufische Reichsideologie nennen kann. Ihre Blütezeit erlebte diese Ideologie, als das mittelalterliche Kaisertum seinen Höhepunkt längst überschritten hatte. Ende des 13. Jahrhunderts hielt es der Kölner Kanonikus Alexander von Roes für das Erfordernis einer sinnvollen und notwendigen Ordnung, dass die Römer als die Älteren das Papsttum (sacerdotium), die Deutschen oder Franken als die Jüngeren das Kaisertum (imperium) und die Franzosen oder Gallier wegen ihres besonders ausgeprägten Scharfsinns das Studium der Wissenschaften (studium) als Aufgabe erhalten hätten.[2]
Der Autor stellte diese Forderungen aus der Defensive heraus auf – in Abwehr von Versuchen, einen französischen Anspruch auf das Kaisertum zu begründen. Mit der von ihm befürworteten Arbeitsteilung zwischen den Nationen sich abzufinden, kam jedoch in Frankreich niemandem in den Sinn. Es las sich wie eine Antwort an Alexander von Roes, als wenige Jahre später ein anonymer Pariser Jurist in einem Gutachten für Philipp den Schönen dem König von Frankreich bescheinigte, was französische Gelehrte schon im 12. Jahrhundert behauptet hatten: In seinem Königreich sei er der Kaiser. «Und weil der König von Frankreich vor dem Kaiser da war, kann er um so vornehmer genannt werden.»[3]
Auf einem wichtigen Gebiet aber stimmten die weltlichen Herrscher des Abendlandes zumindest im Grundsatz überein: in der Abwehr des Anspruch des Papstes, Kaiser und Könige absetzen zu können. Diesen Anspruch hatte erstmals Papst Gregor VII. in seinem «Dictatus Papae» von 1075 erhoben und damit die sogenannte «Papstrevolution» ausgelöst.[4] Er mochte damit zunächst nur die Praxis der Kaiser auf den Kopf stellen. Die Behauptung, nur der Papst könne Bischöfe absetzen oder versetzen, war dagegen ebenso eine Kampfansage an die Könige von Frankreich und England wie an den Kaiser.
Da die Bischöfe nicht nur geistliche Würdenträger, sondern auch die höchsten Beamten der Krone waren, wäre in allen drei Ländern das bisherige politische System zusammengebrochen, wenn sich der Papst im sogenannten «Investiturstreit» durchgesetzt hätte. Tatsächlich errang die Kurie nur einen Teilerfolg. Seit dem frühen 12. Jahrhundert wurden (zuerst in Frankreich, dann in England, seit dem Wormser Konkordat von 1122 auch in Deutschland) die Bischöfe entsprechend dem kanonischen Recht, aber in Gegenwart des weltlichen Herrschers gewählt, so dass dieser seinen Einfluss weiterhin geltend machen konnte.
Der Investiturstreit war nur eine Etappe in der Auseinandersetzung zwischen geistlicher und weltlicher Macht. Die historische Bedeutung dieses Konflikts liegt in der Herausbildung eines für den Okzident grundlegenden Pluralismus, der in seinem Kern zuerst ein institutioneller Dualismus war. Der ansatzweisen Trennung von geistlicher und weltlicher Gewalt folgte die Ausdifferenzierung von fürstlicher und ständischer Gewalt mit der englischen Magna Charta von 1215 als klassischem Dokument. Historisch betrachtet, war die Trennung von gesetzgebender, vollziehender und Recht sprechender Gewalt, die zuerst in England verwirklichte, von Montesquieu 1748 in die Form einer politischen Doktrin gegossene moderne Gewaltenteilung, die Weiterentwicklung eines Prozesses, der im hohen Mittelalter im lateinischen, dem westkirchlichen Europa begonnen und sich nur dort vollzogen hat.
Die werdenden Nationalstaaten Frankreich und England antworteten auf die päpstliche Herausforderung längerfristig mit einer weitgehenden Nationalisierung der Kirche, wobei eine rigorose Beschränkung der päpstlichen Steuereinnahmen aus Kirchengut den Anfang bildete. Das römisch-deutsche Kaisertum konnte den nationalen Weg nicht beschreiten, weil es den eigenen universalen Anspruch gefährdet und die deutschen Fürsten auf den Plan gerufen hätte, von denen manche selbst danach strebten, «Papst im eigenen Lande» zu werden und so ihre landesherrliche «Libertät» zu stärken.
Eine deutsche Antwort auf den weltlichen Machtanspruch und die äußere Machtentfaltung der Kirche gaben Mystiker wie Meister Eckhart, Johannes Tauler und Heinrich Suso: Es war eine Wendung nach innen. Der katholische Philosoph Alois Dempf hat in seinem 1929 erschienenen Buch über das «Sacrum Imperium» den Kampf um die Vertiefung und Verlebendigung der Frömmigkeit in Deutschland als das Gegenstück zur «politischen Reformation» in Frankreich und England interpretiert und es als die weltgeschichtliche Nebenwirkung der deutschen Mystik bezeichnet, dass sie eine «Frömmigkeit ohne Priestertum zu einer weitgreifenden Frömmigkeitsbewegung» gemacht habe. Die Mystik als Wegbereiterin der Reformation: Der junge Luther wusste, an welche Traditionen er anknüpfte, als er den Glauben des Individuums zur alleinigen Grundlage des Verhältnisses des Menschen zu Gott erklärte.[5]
Wir sind bei der zweiten Grundtatsache der deutschen Geschichte angelangt: der Glaubensspaltung im 16. Jahrhundert. Ihrem Ursprung nach war die Reformation eine deutsche, ihren weltgeschichtlichen Wirkungen nach eine angelsächsische Revolution. An dem einstigen Wittenberger Augustinermönch Martin Luther orientierten sich alle anderen Reformatoren, soweit es um die theologischen Grundlagen der kirchlichen Erneuerung ging. Für die Entwicklung von Gesellschaft und Staat hatte hingegen Calvin eine ungleich größere Bedeutung als Luther. Kapitalismus und Demokratie sind in hohem Maß mit der Wirkung von Gedanken des Genfer Reformators verbunden. Das Luthertum enthielt demgegenüber keine Elemente, die auf eine dynamische Umwälzung des Wirtschaftslebens und eine Bindung der Regierenden an den Willen des Volkes hinausliefen. Politisch und gesellschaftlich gesehen, war Luther ein konservativer Revolutionär.
Die deutsche Reformation war beides: Befreiung von kirchlichem, zunehmend als römische Fremdherrschaft empfundenem Zwang und Begründung eines neuen, verinnerlichten, staatstragenden Zwangs. Sie bewirkte Emanzipation und Repression in einem und damit, wie der junge Karl Marx 1843/44 bemerkte, nur eine halbe Überwindung des Mittelalters.[6] Marxens Kampfgefährte Friedrich Engels irrte fundamental, als er die Reformation die «Revolution Nr. 1 der Bourgeoisie» in Europa nannte.[7] Sozialgeschichtlich war die Reformation – am deutlichsten in der Schweiz, in Ober- und Mitteldeutschland – vielmehr eine Erhebung des «gemeinen Mannes» in Land und Stadt mit dem Bauernkrieg von 1524/25 als Höhepunkt.[8]
Unter dem Gesichtspunkt ihrer politischen Wirkungen aber trifft auf die deutsche Reformation der Begriff «Fürstenrevolution» zu. In den Worten des Universalhistorikers Eugen Rosenstock-Huessy von 1931: «Luthers Kurfürst ersetzt den obersten Bischof … Wohl in keinem anderen Lande der Welt haben daher zwei so verschiedene Gesichtskreise übereinander bestanden wie bei uns. Oben kämpften Fürst und Staatsmann um ihr Recht und ihre Freiheit als Obrigkeit. Unten leben und lernen Bürger und Bauern die reine Lehre und den Gehorsam gegen die Obrigkeit im Kreise ihres beschränkten Untertanenverstandes … Dies ‹Unpolitische› des Durchschnittsdeutschen liegt in der freiwilligen Arbeitsteilung zwischen Luther und seinem Landesherrn bereits angelegt.»[9]
Mochte Luther in der Tradition des Kirchenvaters Augustinus noch so scharf zwischen den «zwei Reichen», dem irdischen und dem Gottesreich, unterscheiden, so brachte er in der Praxis doch weltliche und geistliche Gewalt, Thron und Altar, so eng zusammen, dass dem vom Staat gesetzten weltlichen Recht, wie es der evangelische Theologe und Religionsphilosoph Ernst Troeltsch ausdrückte, «eine gewisse Halbgöttlichkeit» erwuchs.[10] Die politischen Wirkungen des Luthertums in Deutschland (und nur hier) waren damit radikal andere als die der anderen Hauptrichtung der Reformation, des Calvinismus. Die Verflechtung der Gemeindekirche mit der städtischen Republik Genf, wo Calvin lehrte und wirkte, begünstigte langfristig die Herausbildung demokratischer Gemeinwesen. Die Verbindung von Landesherrschaft und Bischofsamt in den lutherischen Fürstenstaaten Deutschlands war dagegen der Entwicklung hin zum Absolutismus förderlich.
«Die geistige Befreiung war im Luthertum mit weltlicher Knechtschaft erkauft»: In diesem Verdikt bündelte Franz Borkenau, wie Rosenstock-Huessy ein von Hitler in die Emigration getriebener Intellektueller, das widersprüchliche Erbe der Reformation Martin Luthers. Beide Seiten, die kulturelle und die politische, müssen, so Borkenau, im Zusammenhang gesehen werden. «Die deutsche Musik, die deutsche Metaphysik, sie hätten innerhalb einer calvinistisch bestimmten Kultur nicht entstehen können. Freilich liegt in diesem Überfliegen des Praktischen auch eine furchtbare Gefahr … Das Politische ist das Reich der Verbindung von Geist und Welt, von Moral und Egoismus, von Individualismus und Bindung. Die lutherische Haltung verfehlt den Kern des Politischen. Sie hat ihren Anteil daran, dass wir das Volk der politisch stets Versagenden wurden. Das Volk, das zwischen den in der Praxis gleich falschen Extremen weltferner gutmütiger Verinnerlichung und brutalsten Machttaumels hin- und hergeworfen wird.»[11]
Von der Innerlichkeit zur Brutalität war es auch bei Luther selbst nur ein Schritt: Das zeigt die zunehmende Maßlosigkeit seiner Angriffe auf den Papst, die Wiedertäufer und die Juden. Luthers Judenfeindschaft ist der Bereich seines Wirkens, wo sich Marxens Urteil, die Reformation habe das Mittelalter nur teilweise überwunden, auf besonders drastische Weise bestätigt. In dem Pamphlet «Von den Juden und ihren Lügen» gab Luther 1543, drei Jahre vor seinem Tod, alte Beschuldigungen wieder, von denen er wusste, dass sie nicht zu beweisen waren: Die Juden vergifteten Brunnen und raubten christliche Kinder, um sie rituell zu schlachten. An die Obrigkeit erging die Aufforderung, die Synagogen anzuzünden, die Häuser der Juden zu zerstören, den Rabbinern bei Strafe für Leib und Leben das Lehren zu untersagen, den Juden das Recht auf sicheres Geleit zu nehmen, ihnen die Benutzung der Straßen und den Wucher zu verbieten, sie zu körperlicher Arbeit zu zwingen und notfalls aus dem Land zu jagen. Den Christen insgesamt empfahl Luther, sich beim Anblick eines Juden zu bekreuzigen und frei und sicher auszusprechen: «Da geht ein leibhaftiger Teufel.»[12] Das war «finsteres Mittelalter». Es lebte nicht nur in Luther fort, sondern wesentlich auch durch ihn.
Welche deutschen Gebiete im 16. Jahrhundert katholisch blieben oder lutherisch oder «reformiert» (im Sinne der Lehren Calvins oder des Zürcher Leutpriesters Ulrich Zwingli) wurden, das war, von den freien Reichsstädten abgesehen, nicht eine Frage der freien Entscheidung ihrer Bewohner. «Cuius regio, eius religio» (Wessen die Herrschaft, dessen der Glaube): Die Formel, in der der Augsburger Religionsfriede von 1555 später zusammengefasst wurde, beschreibt, was die Herrscher erstrebten. Im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation (dies war seit 1512 der offizielle vollständige Reichsname) brachte der Augsburger Religionsfriede von 1555 der «Augsburger Konfession», den Lutheranern, nicht aber den Anhängern des reformierten Glaubens die reichsrechtliche Anerkennung. Nicht den einzelnen Menschen, sondern den Fürsten stand die freie Entscheidung zu, zwischen dem alten und dem neuen Glauben zu wählen. Der große Fürsten- und Bürgerkrieg, der nach Lage der Dinge nur ein europäischer Krieg sein konnte, war damit nochmals abgewehrt.
63 Jahre später, im Mai 1618, brach der Große Krieg dann doch aus. Der Dreißigjährige Krieg war nie nur ein Religions- und Bürgerkrieg, sondern immer auch ein Krieg der Staaten und der Staatenbündnisse. Doch es war kein Zufall, dass ein Streit um die Rechte von Glaubensgemeinschaften am Beginn des großen Mordens stand. Glaubensfragen bewegten die Menschen jener Zeit mehr als alles andere. Mehr noch als soziale oder nationale Unterschiede eigneten sich die Gegensätze zwischen den Konfessionen zum Appell an Leidenschaften und Solidaritätsgefühle. Was für die Gläubigen galt, musste aber noch lange nicht für die Staatenlenker gelten. In der zweiten Hälfte des Großen Krieges, von 1635 bis 1648, focht das katholische Frankreich an der Seite des lutherischen Schweden gegen das katholische Haus Habsburg, das im Reich wie in Spanien den Herrscher stellte und die Macht in den Spanischen Niederlanden, dem späteren Belgien, ausübte.
In der kollektiven Erinnerung der Deutschen lebte der Dreißigjährige Krieg jahrhundertelang als die nationale Katastrophe fort; erst die beiden Weltkriege des 20. Jahrhunderts und namentlich der zweite haben ihm diesen Rang streitig gemacht. Eine Katastrophe war der Krieg vornehmlich in demographischer, wirtschaftlicher, sozialer und moralischer Hinsicht. Die Bauern waren am Ende des Krieges verarmt; im Osten Deutschlands sanken sie vielfach in die Erbuntertänigkeit von den Rittergutsbesitzern ab. Von einem aufsteigenden Bürgertum konnte nach der Verwüstung zahlloser Städte keine Rede mehr sein. Die Kriegsgewinner waren, soziologisch betrachtet, die Landesherren, die staatsnahen Teile des Adels, das Militär und das Beamtentum, die Hauptsäulen des entstehenden Absolutismus. Kriegsgräuel, Massensterben und Entbehrungen bewirkten eine verstärkte Wendung nach innen: eine erneuerte Laienfrömmigkeit, die im evangelischen Deutschland dem Pietismus den Boden bereitete.
Wenn man von positiven Wirkungen des Krieges sprechen kann, war es die Einsicht in die Unabdingbarkeit von religiöser Toleranz. Erzwingen konnte diese Duldsamkeit nur ein starker Staat, der bereit war, sich in gewissen Grenzen zu säkularisieren und damit in religiösen Dingen zu neutralisieren. Der fürstliche Absolutismus war nicht zuletzt eine Folge der Verabsolutierung von Glaubensfragen: Was die Untertanen an innerlicher Freiheit gewannen, bezahlten sie mit noch mehr politischer Unterordnung unter die weltlichen Obrigkeiten. Diese fanden die verlässlichsten Stützen ihrer Herrschaft fortan in einer tief sitzenden Angst, die man wohl das bleibende Ergebnis des Dreißigjährigen Krieges nennen kann: der Angst vor der Demütigung durch andere Mächte, vor dem Zusammenbruch aller gewohnten Ordnung, vor Chaos und fremder Soldateska, vor Bruder- und Bürgerkrieg, vor der Apokalypse.
Der Westfälische Friede, den Kaiser und Reich 1648 in Münster mit Frankreich und in Osnabrück mit Schweden abschlossen, stellte den Augsburger Religionsfrieden von 1555 wieder her und dehnte ihn auf die Reformierten aus: Sie waren nunmehr als eine gleichberechtigte Spielart des Protestantismus anerkannt. Außenpolitisch gesehen, gingen Frankreich und Schweden als Sieger aus dem Dreißigjährigen Krieg hervor. Beide garantierten den Friedensvertrag, der zum Reichsgrundgesetz erklärt wurde; beide konnten ihr Territorium auf Kosten des Reiches ausdehnen. Innenpolitisch betrachtet, waren die Reichsstände die Gewinner: Infolge des Westfälischen Friedens konnten sie den entscheidenden Schritt zur Erlangung der vollen Souveränität tun. Das Reich war nachhaltig geschwächt. Da es den deutschen Status quo absicherte, lag sein Fortbestand sowohl im Interesse der großen europäischen Mächte als auch der kleineren Reichsstände. Ein Machtfaktor aber, der sich mit Frankreich oder England, Spanien oder Schweden hätte messen können, war das schwerfällige, altertümliche Gebilde nicht. Es war jener «irreguläre und einem Monstrum ähnliche Körper», als den es Samuel Pufendorf 1667 in seiner berühmten Schrift über die Verfassung des Deutschen Reiches beschrieb.[13]
Unter den Reichsständen war Österreich um 1648 der mächtigste. Seit 1438 kamen die Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation ununterbrochen aus der herrschenden Dynastie dieses Reichsstands, dem Hause Habsburg. Einen guten Teil ihrer Macht verdankten die Habsburger dem Erwerb der Kronen Böhmens und Ungarns im Jahr 1526, wobei von Bedeutung war, dass Böhmen seit alters her zum Reich gehörte, Ungarn hingegen weder 1526 noch später. Zum stärksten innerdeutschen Widersacher der katholischen Habsburger stiegen im 17. und 18. Jahrhundert die Hohenzollern auf. Einem Hohenzollern der fränkischen Linie, dem Nürnberger Burggrafen Friedrich, war 1415 die Kurwürde über die Mark Brandenburg übertragen worden; zwei Jahre später folgte die erbliche Belehnung. Nach dem Reich und der Glaubensspaltung sind wir bei einer dritten Grundtatsache der deutschen Geschichte angelangt: dem deutschen Dualismus, dem Gegensatz zwischen Österreich und Preußen.
Im Jahr 1539 trat der brandenburgische Kurfürst Joachim II. zum neuen, dem lutherischen Glauben über. 1613 fand ein nicht minder bedeutender Konfessionswechsel statt: Kurfürst Johann Sigismund trat vom lutherischen zum reformierten Glauben über. Damit kam es in Brandenburg zu einer, wie der Wirtschaftswissenschaftler Alfred Müller-Armack, der Vater des Begriffs «Soziale Marktwirtschaft», urteilt, «weltgeschichtlich einmaligen Verbindung von Luthertum und Calvinismus»: «Als dem lutherischen Lande eine calvinistische Spitze aufgesetzt wurde, entstand eine spezifisch neue Staatsstruktur, die weder calvinistisch noch lutherisch war. Indem der Calvinismus von oben und das Luthertum von unten eine gegenseitige Assimilationsfähigkeit bewiesen, entstand ein unvergleichlich Neues.»[14] Eine aktivistische Staatsdynamik traf auf den Resonanzboden einer im Gehorsam gegenüber der Obrigkeit geübten Bevölkerung: Auf diese Formel lassen sich, wenn man zu einer gewissen Zuspitzung bereit ist, die langfristigen Wirkungen des kurfürstlichen Konfessionswechsels von 1613 bringen.
Wenige Jahre später, 1618, fiel das weltliche Herzogtum Preußen, der unter polnischer Oberhoheit stehende ehemalige Staat des Deutschen Ritterordens mit der Hauptstadt Königsberg, an Brandenburg. 1660 setzte Friedrich Wilhelm I., der Große Kurfürst, die Anerkennung der brandenburgischen Souveränität im Herzogtum Preußen durch, das auch weiterhin außerhalb des Heiligen Römischen Reiches blieb. Der Sohn des Großen Kurfürsten, Friedrich III., konnte sich als Friedrich I. am 18. Januar 1701 mit der Zustimmung Kaiser Leopolds I. in Königsberg zum «König in Preußen» krönen. Damit war Brandenburg noch keine Großmacht. Einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu diesem Ziel aber hatte es getan. Der Sohn Friedrichs I., der «Soldatenkönig» Friedrich Wilhelm I. (1713–1740), nannte sich gelegentlich bereits «König von Preußen». Die Etablierung Preußens als Großmacht war das Werk seines Sohnes, Friedrichs II., des Großen (1740–1786). Der Gegensatz zum Haus Habsburg, mit dem Friedrich die beiden Schlesischen Kriege (1740–1742 und 1744/45) und den Siebenjährigen Krieg (1756–1763) ausfocht, wurde durch ihn für über ein Jahrhundert zu einem beherrschenden Thema der deutschen Geschichte.
Anders als die Habsburger herrschten die Hohenzollern ganz überwiegend über deutsch sprechende Untertanen. Während Österreich aus Deutschland herauswuchs, wuchs Preußen in Deutschland hinein. Es verfügte über kein zusammenhängendes Staatsgebiet, sondern über Besitzungen, die vom Niederrhein bis zur Memel reichten. Es sah seinen Status als Großmacht, ja seine Existenz als Staat ständig von außen bedroht und legte schon deshalb ein großes Gewicht auf ein starkes Heer.
Von Georg Heinrich Berenhorst, einem deutschen Militärschriftsteller des 18. Jahrhunderts, stammt das Wort, die preußische Monarchie sei «nicht ein Land, das eine Armee hat, sondern eine Armee, die ein Land hat, in welchem sie gleichsam nur einquartiert steht».[15] Zwar waren alle absolutistisch regierten Länder immer auch Militärstaaten, Preußen aber war es in besonders ausgeprägtem Maß. In Österreich war Mitte des 18. Jahrhunderts jeder sechzigste, in Preußen jeder dreizehnte Einwohner Soldat. Die Bedürfnisse des Militärs standen in der Hierarchie der öffentlichen Bedürfnisse unter Friedrich, nicht anders als unter seinem Vater, obenan. Da die Offiziere fast alle dem Junkertum entstammten, war Preußen ebenso sehr ein Soldatenstaat wie ein Staat der adligen Großgrundbesitzer. Von staatstragender Bedeutung war schließlich das Beamtentum, die überwiegend bürgerliche Säule des Königreichs Preußen.
Den Beinamen «der Große» hätte Friedrich kaum erhalten und behauptet, wäre er nicht noch anderes gewesen als ein Kriegsherr. Im Europa seiner Zeit galt er zu Recht als Repräsentant, ja als die Verkörperung eines neuen Staatstyps, des aufgeklärten Absolutismus. Vernunft von oben zu verwirklichen und religiöse und intellektuelle Toleranz zu üben: dieser Vorsatz unterschied sich grundlegend von der Selbstzweckhaftigkeit der üblichen Art absoluter Herrschaft. Der Primat des Militärischen und die damit verknüpfte Privilegierung des Adels verhinderten zwar die volle Durchsetzung des Rechtsstaats, aber das friderizianische Preußen schickte sich zumindest an, einer zu werden. Die Vereinheitlichung des Rechtswesens kam unter Friedrich ein gutes Stück voran. So sehr die Krönung des Gesetzgebungswerks, das Allgemeine Landrecht für die Preußischen Staaten von 1794, in der praktischen Durchführung hinter den fortschrittlichen Absichten der Verfasser zurückblieb, in der Summe kam der aufgeklärte Absolutismus friderizianischer Prägung einer Revolution von oben nahe. Er stiftete damit eine preußische Staatstradition, an die im frühen 19. Jahrhundert Reformer wie Stein und Hardenberg und ein halbes Jahrhundert später Otto von Bismarck mit seiner Reichseinigung anknüpfen konnten.
Zehn Jahre vor Friedrichs Tod, am 12. Juni 1776, wurde auf britischem Kolonialboden in Nordamerika die erste Menschenrechtserklärung der Geschichte, die Virginia Declaration of Rights, verabschiedet. Der Grundrechtskatalog in Artikel 1 begann mit der Feststellung: «Alle Menschen sind von Natur gleichermaßen frei und unabhängig und besitzen gewisse angeborene Rechte.» Zu diesen Rechten wurden das Recht auf Leben und Freiheit gerechnet, dazu die Möglichkeit, «Eigentum zu erwerben und zu behalten und Glück und Sicherheit zu erstreben und zu erlangen». Artikel 2 proklamierte das Prinzip der Volkssouveränität, dessen Treuhänder und Diener alle Amtspersonen seien. Die weiteren Artikel garantierten die Trennung von gesetzgebender, ausführender und Recht sprechender Gewalt, das Verbot, Gesetze ohne Zustimmung der Volksvertretung aufzuheben, die Freiheit der Wahl, den Schutz vor ungesetzlicher Freiheitsberaubung, die Presse- und die Religionsfreiheit.[16]
Drei Wochen später, am 4. Juli 1776, verabschiedete der Kontinentalkongress in Philadelphia, die Vertretung von dreizehn britischen Kolonien, die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika. Darin bekannten sich die Delegierten zu den unveräußerlichen Menschenrechten, mit denen alle Menschen von ihrem Schöpfer ausgestattet seien. Sie betonten dabei besonders das Recht auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück (life, liberty and the pursuit of happiness) und erklärten die Zustimmung der Regierten (consent of the governed) als notwendig für die Sicherung dieser Rechte durch die Regierungen.[17]
Von Amerika wanderte die Idee der unveräußerlichen Menschenrechte über den Atlantik zurück nach Europa, wo ihre geistesgeschichtlichen Ursprünge lagen. Auf die Amerikanische Revolution von 1776 folgte die Französische Revolution von 1789. Am 26. August jenes Jahres verabschiedete die französische Nationalversammlung, inspiriert unter anderen von Thomas Jefferson, dem Hauptautor der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung und späteren dritten Präsidenten der USA, der damals Sonderbotschafter seines Landes in Paris war, die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte. Sie betonte die Gleichheit der Menschen vor dem Gesetz noch schärfer als die Virginia Declaration of Rights und die Grundrechtskataloge anderer Einzelstaaten der Union. In der Hauptsache – dem Postulat, dass alle Menschen frei geboren und mit gleichen Rechten ausgestattet seien – waren sich die Autoren der Déclaration des droits de l’homme et du citoyen mit den Pionieren der vorangegangenen atlantischen Revolution, der Amerikanischen, einig.
Im gebildeten Deutschland fand die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte wie zuvor schon die Erstürmung der Bastille am 14. Juli 1789 begeisterte Zustimmung. Die Gedanken, die in Frankreich an die Macht gelangten, waren auf der anderen Seite des Rheins wohlbekannt: Montesquieu und Rousseau gehörten zu den am meisten gelesenen und gefeierten Autoren im Deutschland der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Wer aufgeklärt war, hasste den Despotismus und schwor auf die Teilung der Gewalten und die Lehre vom Gesellschaftsvertrag, auf dem alle Staatsgewalt beruhe. Weil im Frankreich des Ancien régime nach allgemeiner Einschätzung ein unaufgeklärter Absolutismus, also eine despotische Ordnung, herrschte, war das Land im Recht, als es sich auflehnte. Doch als Vorbild für das, was in Deutschland geschehen sollte, wurden die französischen Ereignisse von den wenigsten Beobachtern gewertet. Der Absolutismus galt dafür in Deutschland inzwischen als zu aufgeklärt, als dass es einer gewaltsamen Volkserhebung bedurft hätte, um Besserung zu bewirken. Der Weg friedlicher Reform oder, wie es oft hieß, der «Reformation» galt als der deutsche Weg zur Erreichung der Ziele, die die Franzosen durch eine Revolution zu verwirklichen trachteten.
Für den Weg der Reform sprach in den Augen aufgeklärter Deutscher aber auch der Verlauf, den die Revolution in Frankreich nahm. Schon bevor die Jakobiner ihre Schreckensherrschaft errichteten, schwenkte die öffentliche Meinung Deutschlands um. Die schrittweise Entmachtung des Königs reichte aus, um rechts des Rheins erste intellektuelle Proteste auszulösen. «Was in Frankreich geschehen ist, kann und soll uns nicht zum Muster, sondern Fürsten zur Warnung dienen», schrieb Christoph Martin Wieland, einer der scharfsinnigsten und einflussreichsten Publizisten der Zeit im Januar 1793.[18] Es war der Monat, in dem der Pariser Nationalkonvent mit einer Stimme Mehrheit Ludwig XVI. zum Tode verurteilte und auf die Guillotine schickte.
Eine Minderheit deutscher Intellektueller brachte den Jakobinern ein gewisses Maß an Verständnis entgegen. Doch selbst unter den (mit fragwürdigem Recht so genannten) «deutschen Jakobinern» lehnten es die meisten ab, dem revolutionären Frankreich nachzueifern. So bekannte der radikale Schriftsteller Georg Friedrich Rebmann 1796, er habe «nie an eine deutsche Revoluzion (sic!), nach dem Muster der französischen, im Ernste gedacht. In protestantischen Ländern ist sie durchaus unmöglich, und in unseren katholischen fast ebenso sehr.»[19] Die geistliche Reformation als Unterpfand dafür, dass es in Deutschland eine politische Revolution nicht geben müsse: Das war ein gemeinsames Credo der protestantischen deutschen Spätaufklärung. Deutschland konnte sich politisch reformieren, weil es kirchlich schon reformiert war. Es musste nach Meinung der Spätaufklärer diesen Weg beschreiten, wenn es nicht Frankreichs Schicksal erleiden wollte.
Letztlich dachte auch der größte Denker der Zeit, Immanuel Kant, nicht anders. Er bewahrte den Ideen der Französischen Revolution über die Schreckensherrschaft hinaus öffentlich bekundete Sympathie, bestand aber auf gesetzlichen Reformen, um einer gewaltsamen Revolution tunlichst vorzubeugen. Wenn er 1797 in der «Rechtslehre» der «Metaphysik der Sitten» ein «repräsentatives System des Volkes» und eine Staatsverfassung forderte, «wo das Gesetz selbstherrschend ist und an keiner besonderen Person hängt», ging er zwar einen entscheidenden Schritt über den aufgeklärten Absolutismus hinaus. Der Adressat seiner Postulate aber blieb wie bei den anderen Spätaufklärern der bestehende Staat des aufgeklärten Absolutismus.[20]
Was das revolutionäre Frankreich dem gebildeten Deutschland fremd werden ließ, war aber nicht nur die Gewaltsamkeit der Selbstbefreiung. Auch die Parole von der «nation une et indivisible», die Quintessenz des modernen, rein säkularen, auf die Mobilisierung der Massen zielenden Nationalismus der Franzosen der Jahre nach 1789, stieß in Deutschland auf Abwehr. Frankreich hatte schon unter dem Absolutismus den Weg der staatlichen Zentralisierung eingeschlagen; das Reich war ein föderatives Gebilde; es war kein Staat im westlichen Sinn, und schon gar kein souveräner Staat. Patriotismus artikulierte sich in Deutschland auf unterschiedliche Weise: als Bindung an den einzelnen Staat und oft an den Fürsten und das Fürstenhaus (ein Zusammengehörigkeitsgefühl, das Ende des 18. Jahrhunderts nirgendwo so stark ausgeprägt war wie in Preußen); als Reichspatriotismus, der seine Heimstatt vor allem in den kleineren Reichsständen und besonders in den Freien Reichsstädten fand; als literarischer Patriotismus, der sich in der Pflege der deutschen Sprache und Kultur äußerte, also dem, was die Deutschen über alle territorialen Grenzen hinweg verband.
Wichtiger als alle Varianten von deutschem Patriotismus aber war der Elite des «Volkes der Dichter und Denker» ein Gefühl der Berufung zum Weltbürgertum. Noch 1796 warnten Goethe und Schiller in den «Xenien»:
Zur Nation euch zu bilden, ihr hoffet es, Deutsche, vergebens; Bildet, ihr könnt es, dafür freier zu Menschen euch aus![21]
Es war ein Weltbürgertum eigener Art, das deutschen Dichtern und Denkern in den letzten drei Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts vorschwebte: kein aus eigener Anschauung gewonnenes, im Wortsinn erfahrenes, sondern ein erdachtes, eine erfundene Gemeinschaft. Ob in der Weltunmittelbarkeit nicht eine nationale Anmaßung liegen könnte, fragte sich kaum einer derer, die den Deutschen von der Nationswerdung, jedenfalls im politischen Sinn, abrieten.
Dass sich in Deutschland im frühen 19. Jahrhundert ein dem französischen in manchem vergleichbarer, moderner Nationalismus herausbildete, war zu einem großen Teil das Werk eines Franzosen: Napoleons. Nach der Niederlage der Österreicher im zweiten Koalitionskrieg gegen das revolutionäre Frankreich im Jahr 1802 mussten es diese wie die übrigen Reichsstände hinnehmen, dass sich der Mann an der Spitze Frankreichs zum Schiedsrichter über Deutschland aufwarf. Der von ihm erzwungene, vom Reichstag in Regensburg verabschiedete Reichsdeputationshauptschluss vom Februar 1803 brachte dem Reich eine radikale Gebietsreform, die dem Zweck diente, die vom Verlust linksrheinischer Gebiete betroffenen Reichsstände zu entschädigen. Durch die «Säkularisierung» gingen fast alle geistlichen Fürsten ihrer Besitzungen verlustig, was vor allem für die katholische Kirche eine einschneidende Machtminderung mit sich brachte. Durch die «Mediatisierung» büßten zahlreiche kleine Fürsten und Grafen und alle bis auf sechs Freie Reichsstädte den Status der Reichsunmittelbarkeit ein. Preußen, Bayern, Württemberg und Baden konnten ihr Territorium erheblich vergrößern. Die Zahl der knapp 300 Reichsstände verringerte sich um 112.
Ein Jahr darauf forderte Frankreichs Erster Konsul das Reich aufs Neue heraus. Im Mai 1804 leitete Napoleon Bonaparte durch einen Senatsbeschluss, der im November in einem Plebiszit bestätigt wurde, die Umwandlung der Französischen Republik in ein erbliches Kaisertum ein. Am 2. Dezember 1804 krönte er sich selbst in Notre Dame in Paris zum Kaiser der Franzosen. Wien, das seit der Senatsentscheidung mit der Auflösung des Römischen Reiches rechnete, antwortete im August 1804 mit der Proklamation eines Kaisertums Österreich für das Gesamtgebiet der Habsburgermonarchie, was einen klaren Bruch der Reichsverfassung bedeutete. Der Versuch Österreichs, zusammen mit Russland, England und Schweden Frankreich im Dritten Koalitionskrieg in die Schranken zu weisen, scheiterte nach vier Monaten in der Dreikaiserschlacht von Austerlitz am 2. Dezember 1805.