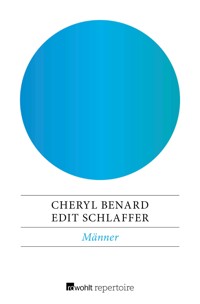10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Mann ist ein wissenschaftlich unerschlossenes Gebiet; man weiß beinahe nichts über ihn. Die Vielfalt des männlichen Charakterbildes macht es der Forschung schwer. Männer beherrschen diszipliniert die Vorstandssitzungen, machen lebensrettende Erfindungen und lassen sich zum Mond katapultieren. Männer unter sich verstummen und zeigen nur die Spur eines anzüglichen Grinsens, wenn «Damen» den Raum betreten. Sie öffnen Frauen die Tür, helfen ihnen in den Mantel, bezahlen ihnen kleine Mokkas und flüstern ihnen im Vorübergehen Obszönes zu. Ob das alles noch normal ist?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 522
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Cheryl Benard • Edit Schlaffer
Der Mann auf der Straße
Über das merkwürdige Verhalten von Männern in ganz alltäglichen Situationen
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Der Mann ist ein wissenschaftlich unerschlossenes Gebiet; man weiß beinahe nichts über ihn. Die Vielfalt des männlichen Charakterbildes macht es der Forschung schwer. Männer beherrschen diszipliniert die Vorstandssitzungen, machen lebensrettende Erfindungen und lassen sich zum Mond katapultieren.
Über Cheryl Benard • Edit Schlaffer
Cheryl Benard (geb. 1953) und Edit Schlaffer (geb. 1950) leiteten als Sozialwissenschaftlerinnen die «Ludwig Boltzmann-Forschungsstelle für Politik und zwischenmenschliche Beziehungen» in Wien. Sie haben 1981 die Menschenrechtsorganisation «Amnesty for Women» ins Leben gerufen.
Bei Rowohlt veröffentlichten sie:
«Die ganz gewöhnliche Gewalt in der Ehe»
«Notizen über Besuche auf dem Lande»
«Die Grenzen des Geschlechts. Anleitungen zum Sturz des Internationalen Patriarchats»
«Liebesgeschichten aus dem Patriarchat»
«Viel erlebt und nichts begriffen. Die Männer und die Frauenbewegung»
«Im Dschungel der Gefühle. Expeditionen in die Niederungen der Leidenschaft»
Inhaltsübersicht
«Und sehr, sehr behutsam (denn wohl kenne ich die Strafen, die davor warnen) flüsterte ich ihr zu, daß sie lernen müsse, über die Überheblichkeiten – oder sagen wir lieber die merkwürdigen Gewohnheiten, denn das ist ein neutralerer Ausdruck – des anderen Geschlechts zu lachen, wenn möglich ohne Bitterkeit. Denn jeder Mensch hat am Hinterkopf einen Punkt, in Schillingsgröße, den er selbst nicht sehen kann. Das ist einer der guten Dienste, den ein Geschlecht für das andere vollbringen kann: diesen Punkt in Schillingsgröße zu beschreiben. Denk nur, wie sehr die Frauen profitiert haben von den Anmerkungen eines Juvenal, von der Kritik eines Strindberg! Denk an die Hilfsbereitschaft und den Scharfblick, mit der Männer in allen Zeitaltern die Frau über diesen makelhaften Punkt an ihrem Hinterkopf aufgeklärt haben! Und wenn du sehr tapfer und sehr ehrlich bist, dann stell dich hinter das andere Geschlecht und sag uns, was du dort siehst. Ein wahres Bild des Mannes in seiner Ganzheit wird niemals vorliegen, solange eine Frau diesen Punkt am Hinter köpf nicht beschrieben hat … Natürlich sollst du nicht spotten oder zürnen – aus solchen Stimmungen entsteht keine gute Literatur. Sei aufrichtig, und das Ergebnis wird unglaublich spannend sein. Die Welt der Komik wird unendlich bereichert werden. Neue Tatsachen werden unweigerlich ans Licht kommen.»
Virginia Woolf A Room of Ones Own (deutsch: Ein Zimmer für sich allein. Gerhardt, Berlin 1978)
Ein Mann, ein (Vor-)Wort
Dieses Buch handelt von einem Phantom.
Denn den «Mann auf der Straße», den gibt es nicht, oder vielmehr, es gibt ihn nur in den Mythen unserer Vorstellung. In den Mythen unserer Vorstellung gibt es den Menschen, der zwei Kinder, eine Ehefrau und ein kleines Heim hat, der bei den Wahlen seine Stimme abgibt und in Kriegen sein Leben, der den Rasen mäht, eine Wochenkarte für die Straßenbahn besitzt und ein guter Bürger, ein guter Mensch, ein guter Nachbar ist.
Er blickt voll der mitleidigen Verachtung auf die Schwachen, die am Leben scheitern. Seine Einstellungen sind gesund, manchmal irrig, aber immer mit einem Kern von Lebensnähe. Den Sumpf des städtischen Nachtlebens kennt er nur aus Erzählungen und aus jugendlichen Abenteuern, Teil seines Reifungsprozesses. Er ist aufrecht, männlich-resolut, gutherzig gegenüber Kleintieren, kampflustig gegenüber Schwiegermüttern und feindlichen Fußballmannschaften, ein Vorbild für seine Kinder, manchmal bigott, manchmal unbeherrscht, trinkt manchmal ein Bier zuviel vor dem Fernseher oder in der Kneipe, aber insgesamt ein richtiger Mann, ein Familienvater, ein … Phantom.
Der Mann auf der Straße ist zugleich überall und nirgends. Meinungsforscher berufen sich auf ihn, um Tendenzwenden anzudrohen. Dokumentarfilme werden über ihn gedreht. In den Nachrichten wird er zitiert. Modemacher und Volkshelden beschwören ihn. Und dennoch gibt es ihn nicht. Wir haben ihn überall gesucht, und wir können es mit Zuversicht sagen.
Dieses sollte nicht ein Buch über Männer ganz allgemein werden, denn das wäre ja vermessen, sie in ihrer Vielfalt auf 250 Seiten bannen zu wollen. Vielmehr sollte es eine Beschreibung der Normalität werden. Des normalen Mannes, wie er arbeitet und spricht, singt und lacht, geht und steht. Wir mußten jedoch feststellen: den Mann auf der Straße, den Durchschnittsmann, den Mann als solchen, gibt es gar nicht. Den Mann gibt es, sozusagen, nur als Idee. Nicht als wirkliche, lebende Person. Es gibt Menschen, die sich gerne so verhalten möchten, wie es sich für Einen Mann gebührt, aber Den Mann gibt es nur als unzulängliches Imitat und als Sagengestalt. Es gibt ihn höchstens als Mitglied einer Gruppe – fast möchte man sagen – eines Ordens, eines Glaubenssystems, mit eigenen Kultpraktiken und einem großen Netz an Laienbrüdern. Die Anhänger dieses Ordens beschrieb Hedwig Dohm schon zur Jahrhundertwende:
«Sie treiben einen Gedanken-Ahnenkultus, die Taktik jener alten Spanier befolgend, die den toten Cid[*], aufrecht aufs Pferd gebunden, mit in die Schlacht führten, um mit dem Glauben an seine siegende Kraft den Feind zu schlagen.»[1]
In diesem Buch begegnen wir dem Phantom der Männlichkeit, das, von den Gläubigen aufrecht aufs Pferd gebunden, überallhin mitgenommen wird. Denn wenn er auch ein Phantom ist, dieser stolze und aufrechte (tote) Cid, er läßt sich doch an die Leine legen und mitnehmen, in die Sitzungssäle, in die Büros, in die Verhandlungsräume, in die Wohnzimmer. Wo immer mit Fäusten auf Tische geknallt wird, da nickt im Hintergrund der tote Volksheld. Wo immer mit gegenseitigen Verbeugungen zwei Funktionäre ihre Krawatten kampfbereit zurechtrücken, da wird eine Geste der Ehrerbietung vor dem Schutzpatron geleistet. Und so wurde unser Buch zu einem metaphysischen Buch, denn es berichtet vom Geist der Männlichkeit, wie er über allem Seienden schwebt.
Im Alltag sind Frauen und Männer unentwegt konfrontiert mit den irrationalen Ordnungssystemen sexueller Zuweisung. Sätze drücken anscheinend Selbstverständlichkeiten aus, die einem überlegten Nachdenken nicht standhalten, sich aber trotzdem in jedem Dialog wiederholen und in jedem Streit durchsetzen. Die Interaktionen zwischen Männern und Frauen laufen in vorgegebenem Rahmen ab, selbst dann, wenn sie aus dem Rahmen fallen. Als uns Frauen und Männer ihre alltäglichen Erfahrungen erzählten, drängte sich die Feststellung auf: jeder Fall fällt aus dem Rahmen, ist ein Extremfall. Die gesellschaftlichen Vorstellungen über den Alltag, über die Normalität, über den Umgang mit Mitmenschen entsprechen nicht der Realität und lassen sich nur aufrechterhalten, solange die einzelnen nicht offen miteinander reden. Jedesmal, wenn etwas geschieht, was eigentlich nicht geschehen sollte, was nicht den gesellschaftlichen Vorstellungen entspricht, jedesmal, wenn eine Krise eintritt, jedesmal, wenn es zu Entgleisungen kommt, glaubt man: dies ist eine Ausnahme. Ein Unfall. Man hat sich falsch verhalten. Man hat es irgendwie herausgefordert. Man hat versagt.
Wenn man die Erfahrungen vieler Leute sammelt und ansieht, kommt man jedoch zur Schlußfolgerung: die Ausnahmen bestätigen nicht die Regel, sie sind die Regel.
Sehr viele Leute, sowohl Frauen als auch Männer, glauben, daß sie allein und nur sie aus dem wohlfunktionierenden System gutangepaßter Personen herausfallen. Sie sprechen mit keinem anderen Menschen über dieses Gefühl der Unangepaßtheit, weil sie nicht noch mehr als nötig die Aufmerksamkeit der Umwelt auf ihr vermeintliches Herausfallen aus den Standards lenken wollen.
Dadurch bleibt das Mißverständnis unaufgeklärt.
Was wir feststellten, ist folgendes: die Normalität gibt es nicht. Sie existiert als Befehl, als Vorschrift, in den Vorstellungen der einzelnen. Sie versuchen, ihr gerecht zu werden, und fühlen sich meist nicht besonders zufrieden dabei.
Wir kannten zu Beginn unserer Recherchen mindestens eine existentielle Aussage: Ich denke, also bin ich. Doch wenn Descartes in seiner Suche nach der Wahrheit alles Zweifelhafte erst einmal wegstrich, bis er schließlich diesen Kernsatz aufstellen konnte, so war er zu bescheiden. Denn wenn auch alles andere in Zweifel steht, so kennt man in der Regel immerhin noch das Geschlecht dieses denkenden Ichs. Und man weiß schon sehr früh, daß daraus eine ganze Menge folgt. Daß sich dieses für einen schickt und jenes nicht. Daß man Mitglied einer Gruppe ist, der eine andere Gruppe gegenübersteht. Dieses Wissen vertieft sich im Lauf der Jahre.
Von dieser Tatsache ausgehend, beschlossen wir, die Zusammensetzung des normalen Selbstbilds, der normalen Verhaltensweisen in normalen Situationen, der normalen Existenz des normalen Mannes zu untersuchen und zu beschreiben.
Die ersten Ergebnisse waren überraschend.
Zunächst dachten wir, daß es schwierig sein würde, unbefangene Männer zu Beobachtungszwecken zu finden. Wir näherten uns sorgsam und leise, wie bei der Suche nach einem besonders raren Schmetterling. Diese Vorsicht erwies sich als unbegründet. Die von uns angesprochenen Männer waren alle sehr bereit, über sich zu sprechen.
Schwierig gestaltete es sich hingegen, Männer in bestimmten Kategorien zusammenzufassen. Jeder Mann, und wenn er auf den ersten Blick noch so unscheinbar und harmlos gewirkt hatte, erwies sich als Besitzer eines (mindestens) Doppellebens. Nehmen wir als Beispiel den Herrn T., 42, höherer Angestellter. Kaum hatte man seine Lebensgeschichte und seine Selbstdarstellung erfaßt, kam schon seine Sekretärin und schilderte einen ganz anderen Herrn T.: einen Herrn T., der randalierend durchs Büro zog, wenn auf einem getippten Brief das Wasserzeichen oben statt unten am Papier sichtbar wurde, wenn man es gegen ein Licht hielt. Und wiederum einen vollständig anderen Herrn T. beschrieben uns Frau T. und Willi T. (Junior): die eine einen lieben, schüchternen Melancholiker, der bei Berufsstreß immer Migräne bekommt und Sonntagnacht aus Angst vor einer erneuten Bürowoche kaum schlafen kann; der andere einen abweisenden, distanzierten Fremden, der kaum zu Hause ist und dann, wenn er es ist, ihn (Willi) unter Drohungen zwingt, seinen (Herrn T.s) Anteil der Hausarbeit zu verrichten.
Ganz anders die Schilderung des Chefs von Herrn T., der diesen als «g’standenen Burschen» beschrieb und ihm jovial eine Zukunft als Manager voraussagte.
Noch verwirrender jedoch waren die Aussagen unserer Informanten im Bereich des Nachtlebens. Wir hatten natürlich erwartet, daß der Mann auf der Straße nachts nicht mehr auf derselben, sondern im familiären Kreis zu Hause sein würde. Falsch. Wir hatten gedacht, daß in den gewissen Etablissements vorwiegend die Dekadenz der Männlichkeit verkehrt, die eher herabgekommenen Gestalten. Falsch. In den Beschreibungen auskunftsgebender Prostituierter erkannten wir zu unserem Erstaunen viele bekannte Gesichter, ja, auch allgemein bekannte Persönlichkeiten. Fast gewannen wir den Eindruck, daß der resolute und knallharte Manager, der gewandte und imposante Politiker direkt von Vorstands- oder Parlamentssitzung zu Elfi S. hasten, um sich für 2000 Schilling von dieser sachgerecht fesseln und schlagen zu lassen. Denn Masochismus, so beteuerten unsere Auskunftspersonen verschiedentlich, ist in den Kreisen der mächtigen Männer ein weit verbreitetes Amüsement. Unsere Konfusion angesichts dieser Information müssen wir dem geneigten Leser nicht weiter schildern.
Wir beschlossen, uns dem Gegenstand erneut und von verschiedenen Seiten zu nähern. Wir ließen Töchter, Söhne, Ehefrauen, Geliebte jeweils ihre eigene Skizze vom Mann anfertigen. Wir verglichen. Wir stellten gegenüber. Wir bemühten uns, die Bereiche der männlichen Existenz, soweit sie uns zugänglich waren, zu beleuchten: die Straße, den Arbeitsplatz, gesellige Zusammenkünfte, Klubs. Wir suchten die Männer überall, bei Tag und bei Nacht; von den Roulette-Tischen des Playboy-Klubs bis zu den Schulbänken ihrer Söhne beschatteten wir jede ihrer Bewegungen. Wir lasen, was sie lesen, von politischen Kommentaren über SALT-Gipfeltreffen bis zu Folterungsszenen in «Geschichte der O».
Wir bewegten uns bei unseren Ermittlungen vorwiegend auf Neuland. Denn die traditionelle Sozialwissenschaft untersucht zwar pausenlos Männer, und vorwiegend Männer, aber nicht als Männer, sondern als: Staatsbürger. Arbeitnehmer. Umweltschützer. Daß in all diesen Bevölkerungskategorien zwei Geschlechter vertreten sind, blieb ihnen dabei unbekannt. Sie untersuchten Frauen niemals als: Staatsbürger. Arbeitnehmer. Umweltschützer. Sondern immer als Frauen. «Das Wahlverhalten von Frauen.» «Berufsaussichten von Frauen.» «Frauen in der Alternativbewegung.» Denn der normale Mensch ist männlich, der Spezialfall weiblich.
Und so kommt es, daß wir hier, am Beginn unserer Untersuchung über den Mann, ratlos stehen und von der Sozialwissenschaft keine Hilfe und keine Informationen erhalten. Über den Mann weiß die Sozialwissenschaft nichts. Nur sehr gelegentlich kamen Männer als eigene Kategorie vor, und dann verhielten sich die verantwortlichen Soziologen wie die Hofmaler absolutistischer Monarchen, die um ihren Kopf fürchten mußten, wenn der Prinz auf dem Gemälde nicht in strahlender Schönheit, sondern in realitätsgetreuer Mittelmäßigkeit zu sehen war. Sie beschrieben nicht und analysierten nicht, sondern lächelten verständnisvoll und retuschierten großzügig. Die Porträts von Dorfältesten, Männervereinen in französischen Dörfern und sogar Zuhältern, die von unseren männlichen Kollegen angefertigt worden sind, sind nicht sehr lebensgetreu.
Die Porträts, die wir im Lauf unserer Erhebungen sammelten, waren von sehr unterschiedlicher Art. Viele waren Selbstporträts, andere wurden angefertigt von Frau und Kindern. Soziale Beschreibungen hängen dabei vom Standpunkt des Betrachters ab, wie bei Fotografien. Nicht jede Perspektive ist in gleichem Maße ansprechend. Bei Profilaufnahmen sieht man das Doppelkinn. Wenn man unverhofft fotografiert wird, sieht man anders aus, als wenn man sich in Positur wirft. Aber wir haben schon so viele Bilder von uniformiert posierenden Männern, da dachten wir, daß ein paar Schnappschüsse aus anderen Gesichtswinkeln als Ergänzung, als Abrundung ganz interessant sein müßten.
Die Männlichkeit, stellten wir immer mehr fest, ist im wesentlichen keine Eigenschaft, sondern eher eine Ausrüstung. Sie ist nicht nur ein toter Cid, an die Leine genommen. Sie ist auch eine japanische, eine balinesische, eine afrikanische Maske. Sie ist ein Schattenspiel und ein Drama. Der Mann auf der Straße ist ein Laiendarsteller. Er ist engagiert worden, um sich selbst zu spielen; jemand hat ihm nicht einen, sondern viele verschiedene Texte in die Hand gedrückt, und er liest sie vor, manchmal zu den passenden und manchmal zu den unpassenden Gelegenheiten. Auf der Bühne wirkt er manchmal etwas unbeholfen. Er ist nicht immer sehr professionell. Er vergißt seinen Text. Er vergißt die Rolle, die er spielen soll, und winkt zwischendurch freundlich zur Tante Martha herunter. Das stört seinen Auftritt als stolzer Napoleon empfindlich.
Vor allem aber, er versäumt seinen Abgang. Denn das Stück spielt schon unendlich lange. Es ist staatlich subventioniert. Es spielt immer nur, unabhängig von Saison, Besetzung oder Publikum, dieselbe alte Männlichkeit.
Die Schauspieler fühlen sich in ihren Rollen nicht wohl. Das spricht für sie. Sie sind nicht eins mit ihrer Rolle. Spricht man z.B. die Männer direkt an, die einem auf der Straße nachpfeifen, dann sind sie blitzartig höflich, freundlich und hilfsbereit. Wenn man sie nach ihrem kurz zuvor manifestierten Verhalten befragt, ist ihnen dies peinlich. Nur die Anonymität der Szene («Drei Männer begegnen einer Frau») hat es ihnen möglich gemacht, in dieser Weise aggressiv zu sein, zudringlich, anstößig. Nur die Vorstellung eines männlichen Publikums, dem sie durch ihr Vorgehen imponieren können, hat sie motiviert. Stehen sie der Frau gegenüber, die sie unaufgefordert geduzt, als «Mitzi» angesprochen und zu intimen Beschäftigungen eingeladen haben, sind sie schlagartig wieder zurückverwandelt in den Harry, den Robert, den Richard, der sie sonst sind; der mit seinen Mitmenschen meist freundlich und korrekt verkehrt, der keine Gewalttaten verübt und der eher schüchtern ist.
Der aber dazu bewegt wurde, kurz ein Phantom darzustellen. Das Phantom des Draufgängers. Das Phantom des Erfolgsmannes. Das Phantom des Helden. Das Phantom des verehrten und geachteten, ein wenig gefürchteten Familienvaters. Das Phantom des hart verhandelnden, scharf denkenden Karrieremannes. Das Phantom der Männlichkeit. In diesem Buch zeichnen wir Szenen auf, in denen Männer als Männer auftreten, als das Phantombild vom Mann auf der Straße. Unsere Fahndung lief mit vollem Einsatz.
Das Männerbild vieler Frauen ist ausgesprochen unerfreulich. Noch schlimmer, es beruht auf unerfreulichen Erfahrungen, stützt sich auf eine Tradition überlieferter unerfreulicher Erzählungen und fügt sich zu einer Theorie über das andere Geschlecht zusammen, die insgesamt wenig attraktiv ist. Das Männerbild vieler Frauen kann man wie folgt charakterisieren: resigniertes, nicht einmal mehr enttäuschtes Abfinden damit, daß einem diejenigen, mit denen man am engsten zusammenlebt, immer fremd sind und bleiben.
Echte Kommunikation wird deshalb ersetzt durch ein Repertoire an Verhaltensweisen und Signalen, die zur Vermeidung von Konflikten und zur Erreichung der gewünschten Ziele beitragen sollen.
Gerade das leisten diese Verhaltensweisen und Signale häufig nicht. Doch selbst das Scheitern trägt noch zur Beibehaltung der Muster bei. Wir, Frauen und Männer, haben einander konditioniert wie experimentelle Kleintiere; wir reagieren auf die Signale nicht mit den gewünschten, aber doch mit den erwarteten Verhaltensweisen.
Frauen, z.B., glauben folgendes: wenn man einen Mann in die Wohnung mitnimmt, wird man bedrängt. Wenn man das nicht will und ihm das sagt, wird er es nicht glauben. Wenn man es hingegen auch will, kann man es nicht sofort sagen, denn dann bekommt man einen schlechten Ruf, die Männer erzählen einander davon, und der betroffene Mann selbst verliert etwas, was als «Achtung» bezeichnet wird. (Den Anspruch auf Achtung verliert man also dann, wenn man sich so verhält wie die Männer selbst?)
Die Männer glauben folgendes: wenn eine Frau einen in die Wohnung mitnimmt, ist ihre Aussage eindeutig. Sie mag das noch so sehr abstreiten, es handelt sich bei diesen Beteuerungen nur um rituelle Demonstrationen weiblicher Tugendhaftigkeit, die den Wert der dann doch folgenden Episode steigern sollen.
Und Frauen glauben folgendes: wenn man einen Mann kritisiert, nimmt er nicht nur die Kritik wahr, sondern auch die Tatsache, daß sie von einer Frau kommt. Das ist ein solcher Schlag, daß er in seinem Schock manchmal die Inhalte der Kritik selbst vergißt.
Und Männer glauben folgendes: Ein (reales oder hypothetisches) männliches Gremium beobachtet ihren Umgang mit Frauen, selbst wenn sie mit diesen allein sind, und urteilt über ihre Haltung. Versagen sie, so wird ihnen die Männlichkeit abgesprochen. Sie wird aberkannt wie der akademische Grad dem sittlich verderbten Professor.
Und Frauen glauben über Männer: auf dem langen Kommunikationsweg zwischen den Geschlechtern gehen viele Bedeutungen verloren, nicht nur die manifesten, sondern vor allem auch die subtileren Feinheiten der Intonation. Das muß man beim Sprechen schon mitberechnen; wenn man A mitteilen will, muß man möglicherweise C rufen, und der Mann hört dann wahrscheinlich B. Lautstärke, Formulierung und Gesichtsausdruck müssen sorgfältig komponiert werden zu einer Choreographie der Mitteilung, und selbst dann ist die Verständigung schwierig. Und Männer glauben über Frauen: dasselbe.
Ach, sagt seufzend, aber nicht unzufrieden die Frauenrunde, mit Männern kann man über solche Dinge ja nicht reden. Ach, mein Mann interessiert sich für so etwas überhaupt nicht. Ach, mein Mann hat ja nur seine Arbeit im Kopf. Ach, die sind schon wieder am Sportplatz. Ja ja, sagt zustimmend und verächtlich die Männerrunde, davon verstehen die Weiber nichts.
In manchen Kreisen sind die Formulierungen weniger kraß, in manchen sind sie gar nicht nötig; z.B. in wissenschaftlichen, wo die Abwesenheit des weiblichen, oder in sekretäriellen, wo das Nichtvorhandensein des männlichen Geschlechts von so großer Selbstverständlichkeit ist, daß nichts vermerkt oder diskutiert werden muß.
Männer und Frauen werden darauf vorbereitet, sich aufeinander hin zu bewegen, jedoch scheint die vorbereitete Bewegung eher auf eine frontale Kollision zuzusteuern, oder man verfehlt sich um mehrere Meter. Solange man nicht darüber nachdenkt, daß es auch anders sein könnte, erscheint einem die Disharmonie als naturgegeben; sobald man darüber nachdenkt, fragt man sich, wo sie ihre Ursache hat. Wo ihren Nutznießer.
Die Gespräche mit Gleichgeschlechtlichen haben häufig einen anderen Charakter, sie sind geruhsamer, selbst dort, wo sie von Rivalitäten, Feindseligkeiten und Bosheit geprägt sind; was vielleicht fehlt, ist die Enttäuschbarkeit. Die Botschaften sind halbwegs klar.
Die Beziehungen zwischen den Geschlechtern sind durch Ungleichheit gekennzeichnet und auf Macht begründet. Wo immer es den Menschen schlecht geht, geht es den Frauen unter ihnen noch um einiges schlechter als den Männern. Gegenüber ihren eigenen Frauen haben selbst die armen, die unterdrückten, die ausgebeuteten Männer, selbst die Männer, die infolge ihrer rassischen oder ethnischen Herkunft selber Opfer von Vorurteilen sind, noch Anspruch auf gewisse Privilegien, auf ein Gefühl der Überlegenheit. Die Männer profitieren von der Unterordnung der Frauen, zumindest auf den Oberflächen ihres Selbstgefühls. Es gibt immerhin noch jemanden, der etwas tiefer steht, dem man sich überlegen fühlen kann; das hebt die Selbstzufriedenheit und macht den Alltag erträglicher. Wenn sich also viele Männer (waghalsig könnten wir an dieser Stelle auch schreiben: alle Männer) in irgendeiner Weise in Alltag, Arbeitswelt und Privatleben an der symbolischen oder faktischen, der verbalen oder materiellen Bestätigung und Festigung des relativen Stellenwertes von Frauen und Männern beteiligen, dann können wir gleich dazu sagen: dies liegt in ihrem Interesse.
Auf den eigenen Nutzen zu achten ist eine verbreitete Eigenschaft der Menschen. Denn scheinbar liegt es immer in unserem Interesse, daß uns andere Menschen untergeordnet sind. Sie müssen die Arbeiten verrichten, die wir selbst ablehnen. Sie müssen uns geben, was wir wollen. Aus den Kolonien kamen Tee, Zucker und Gewürze. Gastarbeiter. Sie machen die schmutzige, schlecht bezahlte und unangenehme Arbeit. Als Hitler damit begann, die Juden zu verfolgen, zur Flucht zu zwingen und in Lager zu schicken, wurden ihre Wohnungen und ihre beruflichen Positionen frei. Darüber freuten sich die Deutschen und Österreicher, die ihre Plätze einnahmen.
Das schlechte Gewissen, das dabei erzeugt wird, muß besänftigt und beruhigt werden mit Erklärungen. Hier zeigte sich der menschliche Geist stets sehr erfindungsreich. Eine Vielfalt von Theorien, Glaubenssystemen, Fakten und Erörterungen kann unweigerlich aufgeboten werden, um zu zeigen, warum gerade diese Form der Ungleichheit eine natürliche, eine richtige, eine notwendige, ja eine gottgewollte, eine fortschrittsdienende, eine begrüßenswerte, zumindest aber eine unausweichliche, eine bedauernswerterweise, aber zu diesem historischen Zeitpunkt unvermeidbare ist.
Ein Glanzstück dieser intellektuellen Akrobatik waren stets die Werke zur «Stellung der Frau». In unermüdlicher Arbeit wurden Begründungen für weibliche Unterordnung angesammelt. Die mittlerweile generell bekannte Tatsache, daß Frauen nicht deshalb gesellschaftlich benachteiligt sind, weil sie a) den Hinausschmiß aus dem Paradies maßgeblich verschuldeten, indem sie die Willensschwäche ihres männlichen Komplizen ausnutzten und die Erbsünde verursachten (Verführung willensmäßig Minderbemittelter als biblisches Delikt der Frau), weil sie b) von den männlichen Hordenmitgliedern vor Dinosauriern und randalierenden Nomadenbanden beschützt werden müssen, oder weil c) die weiblichen Angehörigen diverser Vogelgattungen von den männlichen Mitgliedern der Spezies dominiert werden, hat lediglich anderen, nicht viel sinnigeren Erklärungen Platz gemacht.
Die Verbreitung solcher Denk- und Verhaltensweisen in Raum und Zeit läßt ein Komplott vermuten, eine Art patriarchalische Internationale, die sich auf die Gemeinsamkeit von Interessen begründet. Verschwörungstheorien sind jedoch immer problematisch. Auch die Erklärung sozialer Muster durch den Verweis auf Interessenslagen macht häufig den Fehler, kurzschlüssig im Kreis zu argumentieren. Denn sicherlich versuchen einzelne und Gruppen, ihre Interessen durchzusetzen, auch auf Kosten ihrer Umgebung. Daraus folgt aber noch nicht, daß ein anderes Arrangement als das der Unterdrückung nicht für alle Beteiligten sinnvoller, befriedigender, adäquater wäre. Die absolute Intelligenz des Unterdrückers ist merkwürdiges Postulat sowohl konservativer als auch linker Theorien. Wir glauben: nicht nur aus dämonischer Bosheit, totalisierter Selbstsucht und imperialistischer Charakterstruktur verhalten sich die Übergeordneten unterdrückerisch, sondern auch: aus Angst. Aus Kurzsicht. Aus mangelnder Phantasie. Weil sie es so gelernt haben. Weil sie keine anderen Möglichkeiten sehen. Weil sie sich vor Veränderungen fürchten. Aus Unsicherheit. Weil ihre Umgebung, ihre Vorgesetzten, der Staat es von ihnen verlangen.
Die Männlichkeit ist im wesentlichen ein Handlungsimperativ. Der Gedanke, kein «richtiger Mann» zu sein oder nicht für einen solchen gehalten zu werden, versetzt große Bevölkerungsteile (bzw.: fast die Hälfte) in Panik. Bei dem Gedanken daran stehen sie vor dem Abgrund des Nichts; ohne Identität und staatenlos, als Vertriebene, als Verstoßene, stünden sie einer feindlichen Welt gegenüber. Sie brauchen einen alttestamentarischen Gott hinter sich, einen (toten) Cid, zumindest aber ihre Zugehörigkeit zu einer mächtigen und überlegenen hypothetischen Bevölkerungsgruppe.
Diese Männlichkeit, glauben wir, ist ein Relikt, archäologisch interessant, wenngleich die Fossilien nach wie vor unter uns weilen. Sie ist überholt, wie die französische Fremdenlegion, nur daß letztere sich konsequenzhaft auflöste. Ob sie jemals funktional war, können wir an anderer Stelle diskutieren. Jetzt, so glauben wir, ist sie es nicht mehr.
Liebe Brüder, Freunde, Männer: die Zeiten, in denen es angebracht war, sich von den Lianen zu schwingen, sind vorüber. Es ist nunmehr möglich, eine Frau zu bekommen, ohne sie dem Nachbarstamm zu entführen. Legt euer Fell ab, die Temperaturen sind milder geworden. Stürzt die Götzenbilder der Männlichkeit, das Goldene Kalb, in diesem Fall wohl eher den Goldenen Stier.
Legt den toten Cid in ein unmarkiertes Grab.
Niemand wird ihn betrauern.
Not am Mann – erste Begegnungen mit dem starken Geschlecht
Leider gibt es nicht nur gute Menschen, sondern auch böse.
Deshalb:
Laß dir von Leuten, die du nicht kennst, keine Süßigkeiten schenken!
Laß dich von ihnen in keine Konditorei einladen!
Geh mit niemanden in eine fremde Wohnung, in einen Neubau, ein Gebüsch oder in einen Wald!
Steig in kein fremdes Auto! Geh mit keinem fremden Menschen, der dir etwas verspricht oder zeigen will, mit!
Hilf keinem Unbekannten etwas suchen!
Fange mit unbekannten Menschen keine Gespräche an!
Laß keinen Fremden in die Wohnung, wenn du allein zu Hause bist!
Laß dich von niemanden angreifen!
Bei Einbruch der Dunkelheit mußt du immer daheim sein!
Wenn etwas Besonderes war, erzähle es auf jeden Fall deinen Eltern!
Merkblatt «Wie warne ich mein Kind»
Kirchenzeitung der Diözese Eisenstadt, Juni 1978
(Lehrstoff der ersten Schulklasse)
Vor Männern wird gewarnt.
Für viele von uns ist das eine der ersten Informationen, die wir über das andere Geschlecht erhalten.
Dieses Geschlecht ist durchsetzt von bösen und gefährlichen Gestalten. Es ist ihnen nicht zu trauen. Sie bieten einem Bonbons, Autofahrten und Zirkusbesuche an, alles nur mit dem Ziel, einem Böses zuzufügen. Niemals darf man einem fremden Mann trauen. Das prägen einem Eltern und Verwandte, Lehrer und wohlmeinende Ratgeber ein.
Zwischen dem lieben Onkel, der Schokolade bringt, und dem bösen Onkel, der einen mit ähnlicher Schokolade ins Unglück locken will, bestehen keine erkennbaren Unterschiede. Der einzige Schutz liegt darin, mißtrauisch zu sein. Wovor, wird nicht sehr präzise erklärt. Das grauenhafte Schicksal der Kinder, die von fremden Männern verschleppt werden, bleibt mysteriös in vernebelter Schrecklichkeit. Genauere Informationen erhält man hingegen über die geradezu unglaubliche taktische Geschicklichkeit, mit der diese bösen Männer ihre kleinen Opfer einfangen. So erzählen sie z.B. den Kindern, daß ihre Eltern sie geschickt haben, oder sogar, daß ihre Mutter im Krankenhaus ist und sie beauftragt worden sind, sie zu ihr zu bringen; sie warten nach der Schule auf ihre ahnungslosen Opfer, und man darf ihnen nichts glauben. Man hört auch gelegentlich Ausrufe der Empörung und des Entsetzens über einen Zeitungsbericht; diese Schweine gehören aufgehängt, ruft dann oft ein Erwachsener.
Auch später erhält man häufig den Rat, Männern kein einziges Wort zu glauben. Sie lügen, erzählen Eltern und andere Ratgeber, sie sagen, daß sie einen lieben, und kein Wort davon ist wahr; sie wollen alle nur ihr Ziel erreichen, und wenn man das nicht verhindert, bekommt man später keinen guten Mann. Auch hier ist die Trennungslinie zwischen guten Männern und bösen, lügenden Männern schwer erkennbar, es werden einem keine Kriterien oder Merkmale mit auf den Weg gegeben. Die ersten Jugendfreunde jedenfalls sind nicht den guten Männern zuzuordnen; in der Regel werden sie von den Eltern für Idioten gehalten, für mopedfahrende Kretins, zukunftslose Versager und skrupellose Verführer. (Wehe, man macht sich jedoch später diese Einschätzungen des männlichen Geschlechts zu eigen, wie man sie von Kindheit auf serviert bekommt, dann ist man eine männerhassende Feministin, die keinen gekriegt hat.)
Die Unterscheidung ist schwierig. Das System scheint nicht ganz einsichtig. Wie ist das nun wirklich, mit den guten Männern und den bösen Männern?
Wenn ein berühmter Rennfahrer auf den Titelseiten der Boulevardblätter umherstolziert, demonstrativ nichts im Kopf hat als schnelle Maschinen und blonde Mädchen im Disco-Look, dann ist er ein klasse Typ, und die Herzen der Nation hängen an ihm. Kommt man mit einem ähnlichen, allerdings nicht so berühmten Exemplar nach Hause, spricht der entsetzte Vater von Rockern, schlechtem Umgang und Hausarrest.
«Daß du uns ja kein Kind nach Hause bringst», rufen viele Eltern ihren zu einem Rendezvous gehenden Töchtern nach, häufig ohne jemals erläutert zu haben, wie man in den Besitz dieses unerwünschten Guts kommt, das einem offenbar nachlaufen kann wie ein herrenloser Hund oder in einem Moment der Unüberlegtheit angenommen werden kann wie ein geschenkter Goldhamster.
Das herzhafte Lachen der häuslichen Männerrunde verstummt vor weiblichem Publikum; Damen ist solcher Humor nicht zuzumuten, und nur mehr der Funken eines konspiratorischen Amusements bleibt zurück; verbindende Anflüge eines Lachens. Schon gar nicht dürfen Mädchen und Frauen ein derart fragwürdiges Vokabular benutzen. Die Schonung jedoch ist sehr lückenhaft; Tageszeitungen und Zeitschriften füllen ihre Seiten mit Witzen, Illustrationen und Andeutungen, Wortspielen, Ratschlägen und Berichten, die auch ohne feministische Empfindsamkeit als frauenfeindlich und häufig als aggressiv gegen den weiblichen Körper oder die weibliche Sexualität erkannt werden müssen. Dumme Sekretärinnen, grauenhafte Schwiegermütter, unerträgliche Ehefrauen und abstoßende Frauenspersonen jeder Alters- und Berufsgruppe bevölkern die Witzblätter, wo ihnen stets das gerechte Schicksal des Spotts, Versagens oder Niedergangs zugeteilt wird. Dumm wie Untermenschen, schrecklich wie Furien; diese Leitbilder geben Aufschluß darüber, daß die männliche Phantasie in hohem Maße extrem und irrational, weil angstbesetzt auf Frauen reagiert.
Im Alter von 12, 14, 16, je nach Kulturkreis und Wachstumstempo, macht man plötzlich eine meist unliebsame, immer aber unerwartete Entdeckung. Die Regeln der Interaktion, des alltäglichen Umgangs mit anderen Menschen, die man bisher gelernt hat, verlieren plötzlich ihre allgemeine Gültigkeit. Sie bestehen zwar fort, und man muß sich weiterhin an sie halten, aber unter ihnen eröffnet sich plötzlich eine Schicht anderer Umgangsformen, von zunächst überraschenden, dann aber sich immer wiederholenden, zu einem System werdenden Verstößen gegen diese Regeln. Die Höflichkeiten, die Anredeformen, Haltungen, Begrüßungen, die man gelernt hat, die sorgfältigen Unterscheidungen zwischen Du und Sie und zwischen Bekannten, Fremden, guten Freunden, die Personenkategorien, jeweils mit dazugehörigen Erwartungen an Gesprächsabläufen und Themen, die jeweils angemessene Distanz zwischen Personen in der Gesellschaft, die jeweils korrekte Einschätzung von Zugehörigkeiten, bildeten bisher ein mehr oder minder vertrautes Terrain. Man weiß, daß man in bestimmten Situationen reden soll und in anderen nicht, aufstehen oder sitzenbleiben soll, daß man anderen in der erwarteten Weise begegnen muß, weil es sonst Probleme gibt; Vorwürfe, Kritik, Strafen.
In diesem System von manchmal lästigen und nicht ganz einsichtigen, immerhin aber wohlvertrauten Umgangsweisen treten plötzlich Störungen auf, verwirrend und unverständlich. Man muß, das hat man gelernt, in Anwesenheit des anderen Geschlechts in einer bestimmten Weise sitzen, auf bestimmte Bedeckungen achten, man nähert sich ihnen in geselligen Zusammentreffen lächelnd, man wird in der Schule regelmäßig von ihnen getrennt, vor allem, wenn die Gefahr besteht, daß visuell oder berührungsmäßig Barrieren und Regeln übertreten werden könnten, z.B. im Turnunterricht. Ähnliche Vorsichtsmaßnahmen gelten meist auch in der Familie, wo sie schwieriger aufrechtzuerhalten sind, was ihre Notwendigkeit eindrucksvoll unterstreicht; in der Regel bemühen sich verschiedengeschlechtliche Verwandte, einander nur in bekleidetem Zustand zu begegnen. In dieses geordnete Universum brechen sehr unerwartet Zwischenfälle ein.
Drei Jugendliche drücken einen gegen eine Hauswand und fassen einen an, sie lachen dabei wie im Fernsehen die stereotypen Nazis bei einer Durchsuchung oder wie die stereotypen dicken amerikanischen Südländer bei Lynchaktionen gegen die Neger; plötzlich sieht man sich selbst sekundenlang mit schreckgeweiteten Augen in paralysierten Haltungen gegen die Wand gedrückt, sie lachen, sie laufen davon; hat das wirklich stattgefunden, am selben Samstagnachmittag, an dem man Onkel Ludwig die Hand gibt und hört, wie groß man schon geworden ist?
Das erste Mal ist man vielleicht noch unbefangen wütend, man beschwert sich und erlebt die Irrealität der Reaktion; die Beschwerdestelle ist nicht empört, sondern peinlich berührt; sie überlegt, ob man sich falsch verhalten hat, auf der falschen Straße ging, falsch angezogen war, auf dem Heimweg getrödelt hat, ob man die «jungen Männer» herausfordernd angelächelt hat oder herausfordernd ignoriert hat oder sie gar nicht sah, was wiederum als Herausforderung interpretiert wird. Das nächste Mal beschwert man sich nicht mehr, um diesen peinlichen Überlegungen zu entgehen.
Bei diesen Ereignissen, die aus dem Rahmen des öffentlich anerkannten Verhaltens fallen, spürt man Emotionen und nimmt Mitteilungen wahr, die insgesamt beunruhigend sind. Man erlebt Aggression, wie sie sonst nicht erlaubt ist, aber von anderen mit Betretenheit übergangen wird. Man erlebt Spott, der unentrinnbar wird, da er sowohl die Einhaltung als auch die Nichteinhaltung der Regeln weiblichen Verhaltens zu seinem Gegenstand hat; sowohl die gelernten Sittsamkeiten als auch ihre Mißachtung fordern ihn heraus. Diese Paradoxie ist universaler Bestandteil der weiblichen Erfahrung und in erstaunlichem Maße übertragbar über kulturelle Grenzen hinweg. So erzählt z.B. Badr al-Moluk Bamdad von ihrer Jugendzeit in Persien, als Mädchen und Frauen auf der Straße angepöbelt und zurechtgewiesen wurden, wenn ihre Schleier nach Ansicht irgendwelcher zufällig vorbeigehender Männer nicht ordnungsgemäß zurechtgezogen waren; daß aber andrerseits verschleierte Mädchen von Buben und jungen Männern verspottet wurden, die ihnen auf der Straße nachriefen, sie «sähen in den schwarzen Tüchern aus wie schwarze Raben oder Tintenfässer».[1]
Die Heimlichkeit und Peinlichkeit der Aggressionen ist um so verstörender, weil in ihnen eine Vierschichtigkeit von Bedeutung enthalten ist:
eine Abwertung der weiblichen Personen, die Gegenstände dieses Verhaltens sind;
●eine Bestätigung ihrer weiblichen Attraktivität, denn – so lautet der Konsens – restlos unattraktive Frauen können nicht einmal hoffen, zu Gegenständen sexuellen Spotts zu werden;
●der Wunsch nach einer männlichen Person, die sich infolge einer stabileren Beziehung verpflichtet sieht, dieses Verhalten selbst nicht auszuüben und bei anderen Männern zu unterbinden;
●das sich daraus ergebende Klima von Abneigung, Ressentiment und Notwendigkeit gegenüber den Männern, die als Gruppe solches Verhalten zeigen, als einzelne wissen, daß es gestattet ist, und die mit uns leben in den Ambivalenzen und Verlogenheiten der Erklärungen, die den Zustand von Aggression und Attraktion definieren sollen.
Wir haben sechzig Studentinnen, Sozialarbeiterinnen, Hausfrauen und Sekretärinnen nach ihren Erinnerungen und Empfindungen in diesem Bereich gefragt; die Ähnlichkeit der Erlebnisse und Formulierungen war überraschend. Fast jede Frau konnte sich an mütterliche Warnungen vor «fremden Männern» erinnern, und die meisten beeindruckten diese unklaren Gefahren zutiefst. Eine 20jährige Studentin schildert die Warnungen, nicht mit fremden Männern mitzugehen:
«Es hieß, die tun mir sonst ‹was›. Später, als ich dieses WAS aufgrund meines Wissens schon deuten konnte, war mir diese Warnung immer sehr unangenehm, da sie in mir auch gleich ein Schuldgefühl auslöste: wenn ich mitgehe, bin ich selbst schuld, daß mir was passiert; wenn mich also auch so – wenn ich bloß auf der Straße gehe – Männer anzüglich ansprechen, bin ich wohl selbst auch irgendwie schuld …»
Und eine 24jährige Sekretärin erinnerte sich an das Gefühl,
«durch die widersprüchlichen Anforderungen irgendwie paralysiert zu sein. Denn einerseits stand man unter Druck, ‹herzig› zu wirken, auf die Blödeleien von männlichen Verwandten freundlich und fast im Flirt-Ton zu erwidern, andrerseits hatte man aber das Gefühl, damit in einen gefährlichen und unvorteilhaften Bereich abzusinken. Es kam einem irgendwie unaufrichtig vor, dieses harmlose und naive Mädchen zu spielen, das dann ja doch nur ein Opfer für die Schauergeschichten in ‹XY› abgeben könnte.»
Das Straßenverhalten von Männern wurde von allen Frauen als «Verstoß» – gegen das bisher gewohnte Verhalten, gegen die Alltagsroutine, gegen das sonst so vorsichtig eingehaltene Berührungsverbot, gegen ihr Wohlbefinden und ihr Selbstgefühl – wahrgenommen. Das Unbehagen enthielt immer ein Moment der Unsicherheit: war man wirklich zu sensibel, vielleicht zu prüde? Sollte man sich vielleicht, wie andere Frauen es angeblich taten, durch diese aggressiven und unerwünschten Aufmerksamkeiten gar geschmeichelt fühlen? Hatte man den Überfall provoziert? War man minderwertig, weil man sich weder dagegen wehren noch auf allgemeines Verständnis hoffen konnte? Keiner der Frauen, mit denen wir sprachen, waren solche Erwägungen erspart geblieben.
Die berufstätigen Frauen empfanden oft den krassen Widerspruch in ihrer Situation, daß sie am Arbeitsplatz noch eine halbwegs sachliche Behandlung erfuhren, als kompetente Individuen geschätzt wurden und auf dem Heimweg beliebig als verfügbares Objekt kommentiert und angefaßt wurden. Jüngere Mädchen gaben an, öfters Beklemmungszustände zu bekommen, wenn sie sich plötzlich einer aggressiv-witzelnden Männergruppe gegenübersahen und wußten, daß sie ohne «Behandlung» nicht entkommen würden.
Eine Studentin schrieb,
«Es passiert mir so gut wie jedesmal, wenn ich auf der Straße gehe (allein), daß ich von fremden Männern angesprochen werde. Und das, obwohl ich keineswegs ein Weibchen-Typ bin oder eine ‹Sexbombe›. Zumeist halte ich dann den Mund, da ich schon sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht habe, meine Würde (soweit ich als Frau halt eine habe!) auch nur verbal zu verteidigen.»
In den Antworten kam meist eine – notgedrungen unterdrückte – Wut der Frauen zum Ausdruck. Viele berichteten von gescheiterten Versuchen, sich zu wehren; die Erfahrung, daß die Zudringlichkeit der Männer bei einer defensiven Reaktion der Frau in Aggressivität umschlägt, während sie meist «sich zwar beleidigt fühlen, aber nicht gefährdet» sind, wenn sie das Verhalten der Männer ignorieren oder dulden, führt bei vielen Frauen zu äußerlich passiven Haltungen, aber auch zu tiefen Ressentiments. Eine 21jährige Studentin der Soziologie schreibt, daß sie «fast jeden Tag irgendein Erlebnis dieser Art hat». Sie hat gelernt,
«äußerlich nicht darauf zu reagieren, aber innerlich würde ich am liebsten vor Wut über diese Gemeinheit und meine Schwäche zerspringen. Manchmal bin ich danach lange deprimiert».
Eine andere Studentin beschrieb einen typischen Zwischenfall:
«Ich gehe in die Universität. Ich habe gerade meine Seminararbeit fertiggeschrieben und trage zwei Einkaufsnetze voll von Büchern in die Bibliothek zurück. Ich gehe die Währingerstraße hinunter, es ist Sommer. Plötzlich wankt ein Mann aus einer Bar heraus, hält mich am Arm fest umklammert und besteht darauf, daß ich mit ihm ‹einen Drink› nehme. Ich versuche, weiterzugehen, aber er hält mich freundlich, aber bestimmt, fest und redet auf mich ein, mit betrunkener Entschlossenheit. Die vorübergehenden Leute wenden peinlich berührt die Blicke ab. Es scheint, als wäre er bereit, den ganzen Nachmittag so stehen zu bleiben, auf mich einzureden, taub gegen meine Widerreden. Ich bin durch die Einkaufstaschen mit den Büchern nicht kampffähig, will sie aber nicht abstellen, um nicht den Eindruck des Verweilens zu vermitteln. Lassen Sie mich gehen, sage ich. Ich muß in die Universität. Hilfesuchend schaue ich zu den Passanten, aber alle sehen gezielt weg. Sie werden denken, daß ich seine Freundin bin, und wollen sich nicht einmischen, denke ich. Schließlich wird er des Redens müde und läßt mich gehen. In den darauffolgenden Wochen ärgere ich mich immer wieder über diese Szene. Ich ärgere mich darüber, daß ich ein Ziel angeben mußte, ehe ich losgelassen wurde. Ich ärgere mich, daß ich dazu bereit war.»
Die Reaktion richtet sich oftmals nach innen; eine 27jährige Sozialarbeiterin schrieb:
«Ich spüre, wie sich mein ganzer Körper verkrampft, manchmal schon in der Erwartung auf den verbalen Angriff. Man wird irgendwie total unsicher, denn wenn einen ein Mann auf einer unbelebten Straße anspricht, weiß man nicht, ob er nach einer Adresse fragen will oder ob er etwas Ordinäres sagen wird. Dadurch bekommt man schon eine defensiv abwartende Haltung, und das ist ja auch wiederum unakzeptabel.»
Nach typischen Erlebnissen dieser Art gefragt, zählten die Frauen deprimierende Listen auf; bei den Schilderungen kam der Ärger und häufig auch die Verwirrung über diese stetigen Angriffe während des Alltags deutlich zum Ausdruck.
«Von der Einladung ‹auf einen Kaffee› bis zur Aufforderung ‹gemma pudern› kommt so ziemlich alles, was frau sich zu diesem Thema nicht vorstellen kann. Aufgrund der Häufigkeit müßte ich es als normal empfinden, daß z.B. Straßenarbeiter, Männer auf dem Bau (Männer in Gruppen) meinen Körper lautstark kommentieren. Ich fühle mich ausgeliefert und hilflos.»
«Einmal wartete ich am Abend auf die Straßenbahn. Da kam ein Mann und hat mir Geld angeboten, wenn ich mit ihm schlafen würde. Einmal fragte mich ein Mann auf der Straße, ob ich bei einem Pornofilm mitwirken wolle. Manchmal denke ich, ob an mir etwas nicht stimmt, weil sich immer solche Individuen auf mich stürzen.»
Die meisten Frauen können sich gar nicht daran erinnern, wann ihnen solche Erfahrungen zuerst zuteil wurden; sie sind Bestandteil ihres Erwachsenwerdens und reichen in die frühe Jugendzeit zurück. «Als junges Mädchen ist es mir oft passiert», schreibt eine Studentin. «Es hat mich Männern gegenüber sehr verunsichert.»
«Es war so unvorhersehbar», schreibt eine Sekretärin, «als ich ungefähr 16 oder 17 war, bekam ich manchmal Angstzustände gegenüber Männern, z.B. in der U-Bahn oder im Aufzug, denn manchmal kam es vor, daß sie einen dort lang und herausfordernd anstarrten, daß sie einen bewußt musterten von oben bis unten. Es war ein Gefühl, als ob sie einen körperlich angefaßt hätten; es war wie ein Überfall, nur zusätzlich sehr peinlich. Ich war wütend und ich schämte mich zugleich, irgendwie haben diese beiden Gefühle sich gegenseitig aufgewogen und mich ganz gelähmt.»
Eine Studentin schrieb,
«Soweit ich mich zurückerinnern kann und seitdem ich mich langsam mit meinem Geschlecht identifizierte, habe ich diese Erlebnisse auf der Straße gehabt. Ich fühl(t)e mich gedemütigt und ohnmächtig, ich haßte mich selbst für meine eigene Unzulänglichkeit, die sich darin ausdrückte, mich gegen diese entwürdigende Behandlung nicht zur Wehr setzen zu können.»
Wir fragten die Frauen auch, ob sie sich vorstellen können, was sich ein Mann während einer solchen Szene denkt. Fast alle Frauen glaubten, daß Männer diese Konfrontationen entweder nur als unpersönliches Amusement oder als Bestätigung ihrer Macht, nicht aber als sexuelle Interessensbekundung verstehen. Auch in diesen Antworten kam eine deutliche Wut zum Ausdruck. «Ich glaube nicht, daß die Männer sehr viel darüber nachdenken» und «sie denken sich gar nichts dabei» waren häufige Formulierungen. Es hieß z.B.,
«Ich glaube, viele Männer denken nicht dabei, sondern behandeln Frauen nach dem Grundsatz, ‹der Stärkere (= Muskeln) hat immer recht›. Sie empfinden Frauen als Objekte, die sie eben auch wie Dinge behandeln. Ausschlaggebend für den Kaufwert sind die Fähigkeiten, am besten die männlichen Bedürfnisse zu befriedigen.»
«Eigentlich ist dieses Verhalten sehr kindisch», meinte eine andere. «Sie sind wie die Kinder, die im Supermarkt alles anfassen müssen und anfangen zu weinen und zu schreien, wenn sie es nicht haben können.»
Als weitere Beweise für männliche Gedankenlosigkeit, für eine fast unbewußte Aggression gegenüber Frauen, sehen viele der befragten Frauen die männliche Gewohnheit, abwertende Bemerkungen oder Witze auf Kosten von Frauen zu machen. Das «kommt überall vor, in der Uni, in Lokalen, in der Straßenbahn, im ‹Freundeskreis›», merkte eine Studentin an. Einige gaben an, in diesen Situationen «Bewußtseinsarbeit» im kleinen zu leisten, mit gemischtem Erfolg. «In meinem Bekanntenkreis kommt das oft vor. Ich reagiere meist wütend und beleidigt und versuche sie von der Unnötigkeit und Frechheit dieser Witze zu überzeugen. Meistens sehen sie es auch ein.» Sie fügt hinzu: «Ich glaube, sie denken sich nichts dabei, denn als denkender Mensch kann man so nicht reden.» Die meisten Frauen vermuteten hinter diesen Witzen eine bewußte oder unbewußte Verachtung, sogar eine gewisse Feindseligkeit. Sie bedauerten diese Erfahrungen nicht nur deshalb, weil sie sich dadurch beleidigt oder verletzt fühlten, sondern auch, weil sie sahen, daß ihre eigenen Einstellungen zu Männern und ihre Verhaltensweisen in Beziehungen negativ durch solche Erlebnisse geprägt wurden.
Denn es handelt sich nicht um «einmalige» unangenehme Erlebnisse; diese Erfahrungen werden charakteristisch dadurch, daß sie sich regelmäßig wiederholen und jederzeit stattfinden können. Die häufige Konfrontierung mit Bedrohungen und mit Situationen, die nach allgemeinen Vorstellungen über gesellschaftliches Zusammenleben eigentlich nicht vorkommen sollten, macht diese Ereignisse so beunruhigend.
Eine 27jährige Sekretärin:
«Diese Erfahrungen hinterließen bei mir ein Gefühl der Unsicherheit, auch gegenüber meinem Körper. In manchen dieser Situationen versuchte ich, Nichtbetroffenheit zu demonstrieren. Wenn die Männer mich aggressiv ansprachen oder Kommentare über mein Aussehen austauschten, tat ich so, als hätte ich mit der Situation (und mit meinem Körper) gar nichts zu tun. Ich versuchte, nichts zu hören, oder zumindest diesen Eindruck zu vermitteln. Wenn ich es gehört hätte, hätte ich ja irgendwie reagieren müssen. Das hätte ich nicht einfach unerwidert lassen können, es war ja doch beleidigend, wie sie mit mir redeten. Aber erwidern konnte ich auch nicht. Das wäre vielleicht riskant gewesen.»
Eine 25jährige Sozialarbeiterin:
«Jetzt ist es nicht mehr so, aber ein paar Jahre lang, als ich so 14 oder 15 war, kam alles auf einmal zusammen, um mich zu verunsichern. In meinen Kleidern fühlte ich mich gar nicht wohl. Es war ihnen nicht zu trauen, man konnte nie wissen, ob sie z.B. im Sonnenlicht plötzlich durchsichtig wurden. Wenn man von einem Mann angequatscht oder belästigt wurde, kontrollierte man immer zuerst, ob an dem Kleid irgend etwas nicht stimmte. Zu kurz, Stoff zu dünn, etc. Früher hatte ich beim Gehen immer vor mich hingeträumt. Jetzt mußte ich ständig an meine Garderobe denken.»
Das Gefühl, auf die Aggressivitäten oder Zudringlichkeiten, auf die Verletzungen der Privatsphäre nicht reagieren zu können, wurde von vielen Frauen als besonders ärgerlich empfunden. Eine 30jährige Verlagsassistentin schrieb,
«Als junges Mädchen passierte es mir mehrmals, daß ich von einer Gruppe von Männern herumgestoßen oder abgetatscht wurde. Ich habe das gehaßt, ich fühlte mich dabei wütend und hilflos zugleich. Ich habe es nie jemandem erzählt, weder mit Freundinnen noch mit meiner Mutter habe ich eigentlich jemals darüber gesprochen. Vielleicht war es mir peinlich, es ist schwer zu sagen. Ich hatte das Gefühl, daß man ‹darüber nicht spricht›. Einmal ging ich mit meiner Großmutter die Straße entlang, ich war damals 16 und sie war schon 80. Zwei Männer kamen uns entgegen und haben wie üblich so dahergeredet, wie süß und komm doch mit uns … Weil ich nicht allein war, fühlte ich mich sicherer als sonst, vielleicht hatte ich auch das Gefühl, vor einer ‹Zeugin› etwas unternehmen zu müssen gegen diese Behandlung, ich habe sie also angeschrien, sie sollen mich loslassen und verschwinden. Und meine Großmutter hat mitgeschimpft, sie hat sich noch nach ihnen umgedreht und ihnen nachgeflucht. Die waren ganz sprachlos vor Überraschung. Mir hat das etwas gegeben, auch wenn sich in der Folge nichts geändert hat und ich weiterhin solche Szenen erlebte, ohne mich jemals wieder zu wehren.»
Daß es jedoch klüger sein kann, sich im Zweifel nicht zu wehren, lernten viele Frauen aus der Erfahrung. Eine 22jährige Studentin schrieb,
«Ich ging mit meiner Freundin Babs in einer Seitenstraße von der Fußgängerzone spazieren. 2 Männer sprachen uns an, machten Witze, griffen nach unserem Arm und wollten uns wo hinziehen. Babs hat ihnen gesagt, sie sollen uns loslassen. Da hat der eine sie gegen die Mauer gedrückt und geschüttelt, er hat sie gegen die Mauer gestoßen, mehrere Male. Dann sind sie schimpfend und fluchend weitergegangen. Es sind Leute auf der Straße gewesen, es war Nachmittag, niemand hat etwas gesagt. Ich war damals 17. Sicher habe ich daraus gelernt, daß es besser ist, wenn man die Episode ignoriert, als wenn man es auf einen Konflikt ankommen läßt. Wenn man so tut, als würde man sie (die Männer) gar nicht beachten, lassen sie einen meist nach kurzer Zeit weitergehen. Jetzt finde ich diese Überlegung eigentlich sehr schlimm.»
Viele Frauen konnten sich daran erinnern, ähnliche Erlebnisse gehabt zu haben, die aus dem gleichmäßigen Maß an «alltäglichen» Zwischenfällen noch herausragten. Karin S., Dolmetscherin bei einer internationalen Organisation, erinnerte sich an eine Reihe von «Episoden», die «für mein inneres Gleichgewicht sicherlich nicht sehr zuträglich waren». Sie rekonstruierte:
«Ich bin 11 Jahre alt. Meine Eltern haben 3 befreundete Ehepaare eingeladen, ich darf noch kurz dabeisein. Wie bei solchen Zusammenkünften üblich, wird mäßig getrunken; wie bei Hans T. üblich, konsumiert er die dreifache Menge und verschwindet kurz ins Schlafzimmer, um sich ein wenig auszuruhen. Nach einer halben Stunde werde ich entsandt, um nach seinem Zustand zu sehen. ‹Wie fühlen Sie sich?› frage ich. Er sitzt am Rand des Betts, sieht mich an. ‹Du kannst doch ruhig Hans zu mir sagen›, sagt er. ‹Du mußt nicht Herr T. sagen.› Diese Information bewegt mich nicht sonderlich. ‹Kommen Sie jetzt hinaus oder soll ich den anderen sagen, daß Sie sich noch ausruhen wollen?› frage ich. Er zieht mich am Arm zu sich, klopft mir väterlich auf die Schulter und murmelt etwas über mein erstaunliches Groß-Werden. Ich ziehe mich zurück, aber nicht sehr abrupt, sondern höflich. Er murmelt noch immer, in einem zwar ruhigen und freundlichen, trotzdem irgendwie beunruhigenden Ton. Ich denke mir, daß er sehr betrunken ist. Er schiebt seine Hand unter meinen Pullover und fährt meinen Rücken hinauf von der Taille bis zu den Schultern. Das kann doch nichts sein als Freundlichkeit, denke ich mir in einer kalten, etwas neugierigen Analytik, die mir jetzt rückblickend überraschend vorkommt; ich kenne ihn seit Jahren, und er bewohnt bei mir die Kategorie der Erwachsenen, der onkelähnlichen Freunde meines Vaters. Seine Hand bewegt sich weiter, verschafft mir Klarheit. Ich springe auf und laufe hinaus. Ich sage in der Folge nie Hans zu ihm, sondern immer Herr T., aber ich erzählte niemandem etwas. Er fährt geschäftlich nach Japan und bringt mir eine Perle auf einer Kette mit. Meine Mutter findet das nett, aber sie findet es komisch, daß er meiner kleinen Schwester nichts mitbringt. Ich schenke die Kette meiner Freundin.»
«Ich bin 15 und gehe manchmal mit Robert aus. Wir kennen uns seit 7 Jahren, sind eigentlich mehr wie Geschwister. Seit kurzem ist er verändert, in seiner Freundesgruppe haben die meisten schon ‹eine Freundin›, und er möchte, daß ich mich auch in diese Kategorie einfüge, damit er hineinpaßt. Ein paarmal gehe ich mit seiner Clique mit, mehr ihm zuliebe, aber ich falle aus dem Rahmen. Die anderen Mädchen, die echte Freundinnen sind und nicht nur Jugendfreundschaften, hängen an den Armen ihrer Freunde, lachen aufmerksam über ihre Witze, während Robert und ich den kameradschaftlichen Umgang unserer früheren Jahre demonstrieren und auffällig unverliebt sind. Am Wochenende nach einem solchen Ausflug in ein Tanzlokal gehen wir im Schnee spazieren und streiten in altgewohnter Manier, bewerfen uns mit Schnee, stoßen uns herum. Irgendwie wird der Streit ernster. Worum es ging, weiß ich heute nicht mehr. Plötzlich hält er mich fest, hält meinen Kopf fest in einem Würgegriff und küßt mich. Es ist kein Begehren dabei, er könnte mir genausogut, wie früher, einen Schneeball nachwerfen, es ist eine Kraftdemonstration. Ich kann mich nicht bewegen, stehe in regungsloser Verachtung da. Das freut ihn; nun? sagt er herausfordernd und hält mich fest. Er küßt mich, weil er zwei Köpfe größer und verärgert ist. Sobald er mich losläßt, drehe ich mich um und gehe nach Hause. Wir sprechen nie darüber. Es ist das Ende unserer Freundschaft.»
«Ich bin 17 und habe ein Stipendium, um ein Jahr in einem lateinamerikanischen Land Spanisch zu studieren. Es ist Sommer, und es ist kurz vor dem politischen Zusammenbruch der Regierung. Am Wochenende ist die Stadt wie ausgestorben, besonders in den Geschäftsvierteln, die um die Universität liegen. Ich bin mit meinem Freund in der Bibliothek verabredet, besuche vorher noch eine Freundin in der Stadt und gehe dann zur Universität zurück. Aus Rücksicht auf kulturelle Unterschiede habe ich ein langes Baumwollkleid mit kurzen Ärmeln an; ärmellose Touristinnen in Shorts oder kurzen Röcken erregen selbst in der liberaleren Hauptstadt noch die Gemüter. Drei Straßen vor dem Universitätsgelände sehe ich, daß mir drei Männer nachgehen. Sie sprechen mich an, rufen mir zu, daß ich mit ihnen in ihre Wohnung kommen soll, sie geben mir dort einen Drink. Ich gehe etwas schneller und beachte sie nicht. Sie holen mich ein, wiederholen ihre Aufforderung, sie umkreisen mich, so daß ich nicht mehr so tun kann, als würde ich nichts hören und sehen. Nein danke, sage ich. Lassen Sie mich bitte in Ruhe, und ärgere mich über das bitte. Sie schieben mich in einen Hauseingang, drücken mich gegen die Wand, machen die Tür zur Straße zu, fassen mich an, lachen. Sie sagen, ich soll besser freiwillig mitkommen. Ich kann nicht klar denken, versuche, die Situation einzuschätzen. Mein Hauptgedanke: das ist jetzt ernst. Zum erstenmal befinde ich mich in einer ernsten Situation. Mein zweiter Gedanke ist: drei zu eins ist ungerecht. Am schlimmsten ist ihr Lachen, wenn sie nicht lachen würden, wäre es irgendwie nicht so beängstigend. Ich löse mich aus einer kurzen Lähmung und beginne mich zu wehren. Ein altes Ehepaar im ersten Stock kommt in den Gang, entweder durch Zufall oder weil sie etwas gehört haben, die Männer treten einen Moment zurück, und ich laufe davon, ich laufe zur Universität und setze mich auf die Steinstufen vor dem Eingang. Ich sitze in der Sonne und denke an überhaupt nichts, aber ich zittere zwischendurch. Später hole ich mein Buch heraus und versuche zu lesen, aber alle paar Seiten schlage ich es zu und warte, bis das Zittern vorübergeht. Mein Freund kommt, er fragt mich, was mir fehlt, aber ich erzähle es ihm nicht. Erstens, weil er mir vielleicht in der üblichen Reaktion irgendwelche Vorwürfe machen wird, warum bin ich allein gegangen, warum bin ich gerade durch dieses Viertel gegangen, warum bin ich nicht vorsichtiger. Zweitens, weil er sich verpflichtet fühlen wird, mich überallhin zu begleiten. Drittens, weil mir im Augenblick der Unterschied zwischen den drei Männern im Hausflur und den vielen Männern bei abendlichen Rendezvous entfallen ist, die einen auch gegen Wände drücken und auch anfassen, wenn man nicht will, und auch lachen. Wir lesen gemeinsam unsere Aufgabe für das Seminar der nächsten Woche, Wittfogel, Die orientalische Despotie. Der Titel kommt mir irgendwie bezeichnend vor für meine Situation, ich weiß nicht genau warum, im Buch geht es um Kanalisierungen und ihre Regelung. Ja, vielleicht doch passend. Und um Machtverhältnisse. Ich sitze unter einer Hecke aus Oleander und denke mir, daß der Wittfogel, den ich lese, noch leicht zitternd und wütend, und der Wittfogel, den mein Freund liest, seelenruhig und aufmerksam, niemals derselbe Wittfogel sein wird. Es erscheint mir unmöglich, daß auf den Seiten unserer Bücher dieselben Worte stehen.»
«Ich bin 14. Auf dem Schulweg begegnet mir, in klassischer Manier, ein Exhibitionist. Ich sehe ihn aus dem Augenwinkel schon ein paar Meter, bevor ich zu der Hecke komme, an der ich vorbei muß. Daher bleibe ich stehen und suche nach einem Ausweg; zwar ist es Vormittag und die Straße gegenüber ist relativ belebt, aber der Park ist leer, und ich will nicht an ihm vorüber. Während ich zögere, kommt er hervor und auf mich zu, er flüstert mir mit gerötetem Gesicht etwas zu, ich sehe zwar weg, aber es entgeht mir nicht, daß er in unmißverständlicher Weise an sich herumfummelt. Als er auf mich zukommt, drehe ich mich um und laufe auf die Straße hinaus, ich will auf die andere Seite, wo andere Menschen sind. ‹Vorsicht›, ruft er ganz erschrocken, ‹paß auf die Autos auf.› Bremsen quietschen, Autofahrer fluchen. Plötzlich kommt mir die Episode absurd vor, ich würde sie gerne sofort vergessen, aber er ist noch immer hinter mir, er geht knapp hinter mir und flüstert friedlich, aber obszön, seine Wünsche, ich gehe schneller, laufe eigentlich schon, denke darüber nach, daß er sich Gedanken über meine Sicherheit gemacht hat und mich jetzt nach wie vor verfolgt, ich überlege, ob ich jemanden anhalten und um Intervention bitten soll, aber mir fällt keine Formulierung ein, entschuldigen Sie, dieser Mann hier ist Exhibitionist und sagt mir dauernd Dinge in einem beunruhigenden und ordinären Vokabular. Dann sehe ich in der Ferne einen Polizisten, wie er gemächlichen Schrittes unrechtmäßig geparkte Autos besichtigt, ich überlege, ob ich ihn rufen soll, der Mann ist immer noch hinter mir, redet pausenlos pornographisch auf mich ein, ich laufe, statt den Polizisten zu rufen, in ein Lebensmittelgeschäft auf dem nächsten Straßeneck und bleibe dort lange vor den Regalen stehen, bevor ich den Blick auf die Straße wage, der Mann scheint weg zu sein, ich warte noch einmal sehr lange und gehe dann vorsichtig, mich sehr oft umdrehend, weiter. Während der nächsten 3 Monate bewege ich mich ausschließlich auf Hauptstraßen. Ich gehe umständlich auf Umwegen in die Schule und trage bis in den Sommer hinein einen Mantel. Ich werfe mir vor, gegenüber anderen Frauen schuldig zu sein, weil ich den Polizisten nicht eingeschaltet und damit den Tätigkeiten des Mannes freien Lauf gelassen habe. Wenn er mir nicht die Warnung beim Straßenüberkreuzen zugerufen hätte, könnte ich ihn vergessen, aber statt dessen verfolgt es mich, daß er mich zuerst vor die Autos jagen und sich dann Sorgen um mich machen kann. Er zwingt mich damit, ihn als Person zu sehen, statt als ‹den Exhibitionisten im Park›. Ich entwerfe alternative Szenen, in denen ich besser abschneide, mich klüger verhalte; in denen ich z.B. zu ihm sage, daß er krank ist und ich das verstehe und ihm rate, einen Arzt aufzusuchen.»
Die Frau eines mittleren Angestellten schreibt:
«Ich war 12, als mich meine Eltern das erste Mal davor warnten, ein Kind nach Hause zu bringen. Ich habe lange darüber nachgedacht, wie ich in diese Situation kommen könne, und habe schließlich meine Mutter gefragt. Ich erfuhr bei der Gelegenheit, daß dieses Ereignis eintritt, wenn man einen Mann oder einen Burschen liebt. Ich habe mir geschworen, das nie zu tun. Von diesem Moment der umfassenden Aufklärung hatte ich einen panischen Schrecken, im Schulbus neben einem Buben stehen zu müssen, ich klammerte mich verzweifelt an meine Freundinnen und entwickelte richtige Berührungsängste in bezug auf das andere Geschlecht.
Mit 13 habe ich in einem Abbruchhaus gespielt, mit den älteren Jugendlichen Räuber und Gendarm spielen zu dürfen, war für mich der Inbegriff von Glück. Die 15-, 16jährigen Buben machten sich einen Spaß daraus, die Mädchen zu fangen, und so bin auch ich schließlich gefangengenommen worden. Ich konnte mich aber nicht wie bei früheren Spielen wieder befreien, die Buben legten mich aufs Wellblechdach und versprachen mir 2 Schillinge, wenn ich freiwillig meine Hose ausziehe. Ich hatte dabei immer die Stimme meiner Mutter im Ohr, die sagte, man zeigt ‹das› nicht her. Über mögliche Konsequenzen war ich mir nicht im klaren, weil ich keine Ahnung hatte, was mir bei dieser Aktion passieren könnte. Man wollte mich – offensichtlich unter dem literarischen Einfluß von Karl May – ‹foltern›, aufgrund meines entschlossenen Widerstands wurde ich nach einiger Zeit, die mir endlos erschien, schließlich ‹entlassen›. Die Situation und die Akteure waren mir unangenehm, in späteren Jahren habe ich erst begriffen, was eigentlich vorgefallen ist, als meine Aufklärung durch die Zwänge des Alltags rapide Fortschritte machte.
Ich studierte Jus, ein Fach, das mehr und mehr auch von Frauen belegt wird. Zu meinen männlichen Studienkollegen hatte ich seit dem Semester, in dem praktische Fälle diskutiert wurden, ein gebrochenes Verhältnis. Der Professor hat mit aller Ausführlichkeit Sexualdelikte vorgetragen, oft mit ‹cleveren› Anmerkungen versehen, oft mit einigen Scherzen begleitet, die sich in der Regel gegen die betroffenen Frauen richteten, und ließ es an der angebrachten Sachlichkeit, um die er sich auf den Gebieten des Pfand- und Wechselrechts stets sehr bemühte, völlig ermangeln. Als er zur Erheiterung seines Publikums wieder einmal mit einer genußvollen Fallschilderung begann, empörte ich mich in meiner Kollegengruppe, mit der ich öfters lernte; die einzige Reaktion war: ‹Ziemlich prüde für dein Alter. Laß dem Alten seinen Spaß.›
Ich habe früh geheiratet, um von zu Hause wegzukommen, den Normen und Ansprüchen einer Tochter aus gutem Haus nicht mehr gerecht werden zu müssen. Die traditionsverbundene Einstellung meiner Eltern hatte auch gewisse Vorteile, ich bekam eine Mitgift und konnte mir eine Wohnung leisten. Jeden Mann hätte ich natürlich nicht genommen, aber sehr überlegt war meine Ehe nicht. Es war nicht gerade eine Liebesheirat, und am Anfang sah meine Ehe recht kritisch aus. Es ist ja auch eine riskante Methode: Man nimmt sich einen Mann, um von daheim wegzukommen, und kann damit total einfahren. Aber die Beziehung hat sich eingependelt, oft habe ich das Gefühl, irgendwie Glück gehabt zu haben, ‹den Männern› durch diese Form des Arrangements entronnen zu sein.»