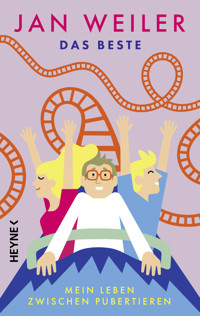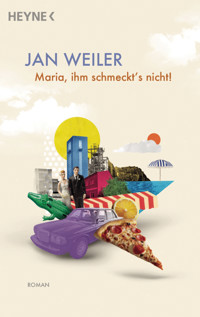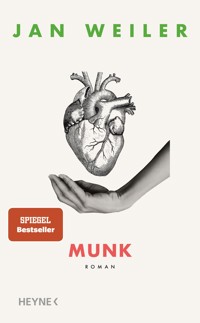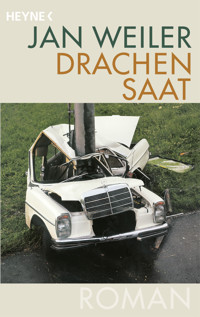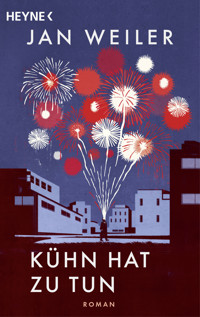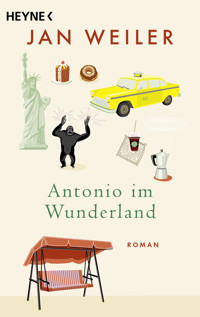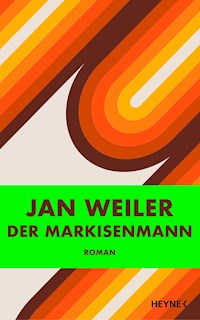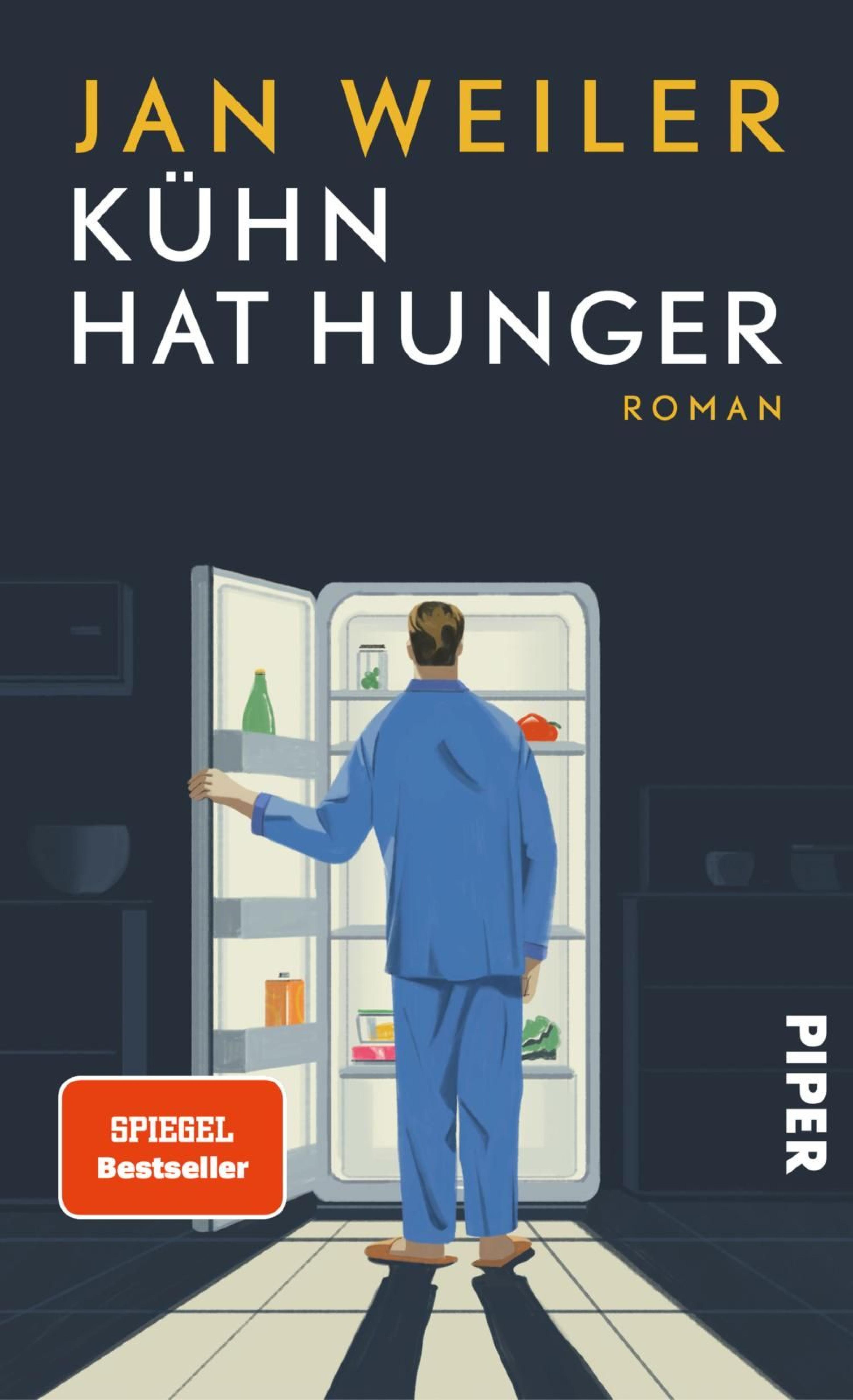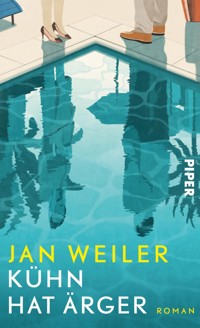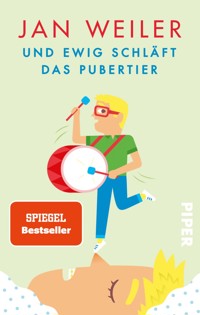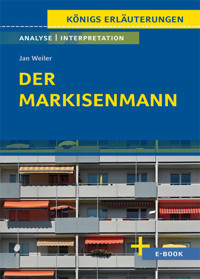
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bange, C
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Königs Erläuterungen Spezial
- Sprache: Deutsch
Spare Zeitund verzichte auf lästige Recherche!
In diesem Band zu Jan Weiler, Der Markisenmann findest dualles, was du zurVorbereitung auf Referat, Klausur und den Realschulabschlussbenötigst –ohne das Buch komplett gelesen zu haben.
Alle wichtigen Infoszur Interpretation sowohlkurz(Kapitelzusammenfassungen) als auchausführlichund klar strukturiert.
Inhalt:
- Schnellübersicht
- Autor: Leben und Werk
- ausführliche Inhaltsangabe
- Aufbau
- Personenkonstellationen
- Sachliche und sprachliche Erläuterungen
- Stil und Sprache
- Interpretationsansätze
- 6 Pruefungsaufgaben mit Musterlösungen
NEU:exemplarische Schlüsselszenenanalysen
NEU:Lernskizzen zur schnellen Wiederholung
Layout:
- Randspalten mit Schlüsselbegriffen
- übersichtliche Schaubilder
NEU:vierfarbiges Layout
In Jan WeilersDer Markisenmannwird die 15-jährige Kim von ihrer Mutter zu ihrem bislang unbekannten Vater geschickt, der als Markisenverkäufer in einer beschaulichen Kleinstadt lebt. Zunächst skeptisch und distanziert, entdeckt Kim im Laufe des gemeinsamen Sommers nicht nur die wahren Gründe für die Trennung ihrer Eltern, sondern auch eine unerwartete Verbindung zu ihrem Vater. Durch ihre Erfahrungen und die Enthüllung lang gehüteter Familiengeheimnisse gewinnt Kim neue Einsichten in ihr eigenes Leben und ihre Beziehung zur Familie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 126
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
KÖNIGS ERLÄUTERUNGEN SPEZIAL
Textanalyse und Interpretation zu
Jan Weiler
Der Markisenmann
Ein Bericht
Volker Krischel
Alle erforderlichen Infos zur Analyse und Interpretation plus Musteraufgaben mit Lösungsansätzen
Zitierte Ausgabe: Weiler, Jan: Der Markisenmann. Taschenbuchausgabe. 10. Auflage. München: Heyne Verlag, 2023.
Über den Autor dieser Erläuterung: Volker Krischel, geb. 1954, arbeitete nach dem Studium der Germanistik, Geschichte, Katholischen Theologie, Erziehungswissenschaften, Klassischen Archäologie, Kunstgeschichte und Geografie mehrere Jahre als Wissenschaftlicher Mitarbeiter – besonders im Bereich der Museumspädagogik – am Württembergischen Landesmuseum Stuttgart. Bis zu seiner Pensionierung war er als Oberstudienrat in Gerolstein, Eifel tätig. Er hat mehrere Arbeiten zu Autoren der neueren deutschen Literatur, zur Jugend- und Unterhaltungsliteratur sowie zur Museums- und Unterrichtsdidaktik veröffentlicht.
1. Auflage 2025
978-3-8044-4152-1
© 2025 by Bange Verlag GmbH, Am Graben 2, 96142 [email protected] – www.bange-verlag.de Alle Rechte vorbehalten, darunter fällt auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von §44b UrhG! Titelabbildung: © picture alliance / ZB | Volkmar Heinz
Hinweise zur Bedienung
Inhaltsverzeichnis Das Inhaltsverzeichnis ist vollständig mit dem Inhalt dieses Buches verknüpft. Tippen Sie auf einen Eintrag und Sie gelangen zum entsprechenden Inhalt.
Fußnoten Fußnoten sind im Text in eckigen Klammern mit fortlaufender Nummerierung angegeben. Tippen Sie auf eine Fußnote und Sie gelangen zum entsprechenden Fußnotentext. Tippen Sie im aufgerufenen Fußnotentext auf die Ziffer zu Beginn der Zeile, und Sie gelangen wieder zum Ursprung. Sie können auch die Rücksprungfunktion Ihres ePub-Readers verwenden (sofern verfügbar).
Verknüpfungen zu Textstellen innerhalb des Textes (Querverweise) Querverweise, z. B. „s. S. 26 f.“, können durch Tippen auf den Verweis aufgerufen werden. Verwenden Sie die „Zurück“-Funktion Ihres ePub-Readers, um wieder zum Ursprung des Querverweises zu gelangen.
Verknüpfungen zu Inhalten aus dem Internet Verknüpfungen zu Inhalten aus dem Internet werden durch eine Webadresse gekennzeichnet, z.B. www.wikipedia.de. Tippen Sie auf die Webadresse und Sie werden direkt zu der Internetseite geführt. Dazu wird in den Web-Browser Ihres ePub-Readers gewechselt – sofern Ihr ePub-Reader eine Verbindung zum Internet unterstützt und über einen Web-Browser verfügt. Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Webadressen nach Erscheinen dieses ePubs gegebenenfalls nicht mehr aufrufbar sind!
Inhaltsverzeichnis
1. Das Wichtigste auf einen Blick – Schnellübersicht
2. Jan Weiler: Leben und Werk
2.1 Biografie
2.2 Zeitgeschichtlicher Hintergrund
Das Ruhrgebiet – ein ehemaliges Industriezentrum
Die DDR – Sozialismus und Repression
2.3 Angaben und Erläuterungen zu wesentlichen Werken
3. Textanalyse und -Interpretation
3.1 Entstehung und Quellen
3.2 Inhaltsangabe
Prolog (S. 7–29)
Teil 1: Der Sommer mit meinem Vater (S. 31–298)
Tag 1 (S. 33–52)
Tag 2 (S. 53–72)
Tag 3 (S. 75–87)
Tag 8 (S. 88–109)
Tag 9 (S. 110–134)
Tag 10 (S. 135–144)
Tag 12 (S. 145–164)
Tag 26 (S. 165–188)
Tag 30 (S. 189–198)
Tag 37 (S. 199–224)
Tag 41 (S. 225–243)
Tag 43 (S. 244–279)
Tag 44 (S. 280–298)
Teil 2: Der Frühling ohne meinen Vater (S. 299–333)
Fidel Gasto (S. 301–320)
Die Halle (S. 321–333)
3.3 Aufbau
Formale und inhaltliche Struktur
Schauplätze und Chronologie
3.4 Personenkonstellation und Charakteristiken
Kim Papen
Ronald Papen
Susanne Mikulla
Heiko Mikulla
Geoffrey Mikulla
Alik Cherif
Die Ruhrpott-Clique
Oktopus
Lütz
Achim
3.5 Sachliche und sprachliche Erläuterungen
3.6 Stil und Sprache
Sprachstil und Satzbau
Sprachliche Mittel
Erzähler und Erzählperspektive
Handlungsbestimmende Motive
Markisen
Die Pfütze
Musik/Lieder
3.7 Interpretationsansätze
Coming-of-Age-Roman
Road Novel
Vater-und-Tochter-Geschichte
Historische Geschichte
Geschichte von Schuld und Sühne
Humoristischer Roman
4. Rezeptionsgeschichte
5. Materialien
Ist Der Markisenmann nur Retro-Charme?
Spardosen-Terzett: Glück auf, Ruhrgebiet
Das Stasi-Gefängnis Berlin-Hohenschönhausen
6. Prüfungsaufgaben mit Musterlösungen
Aufgabe 1 *
Aufgabe 2 **
Aufgabe 3 **
Aufgabe 4 **
Aufgabe 5*
Aufgabe 6**
Lernskizzen und Schaubilder
Literatur
Zitierte Ausgabe
Über den Autor
Über Der Markisenmann
Geschichtlicher Hintergrund
Über das Ruhrgebiet
Sonstige Literatur
1. Das Wichtigste auf einen Blick – Schnellübersicht
Damit sich die Leserinnen und Leser in diesem Band schnell zurechtfinden und das für sie Interessante gleich entdecken, hier eine kurze Übersicht.
Das 2. Kapitel beschreibt Jan Weilers Leben und stellt den zeitgeschichtlichen Hintergrund vor:
Jan Weiler wird 1967 in Düsseldorf geboren. Nach Abitur und Zivildienst arbeitet er zunächst als Werbetexter, schließlich wird er Autor und Redakteur. Sein 2003 erschienener Debütroman Maria, ihm schmeckt’s nicht! wird ein Bestseller und macht Weiler schlagartig bekannt.
Der Markisenmann ist ein Coming-of-Age-Roman und spielt im Sommer des Jahres 2005 im deutschen Ruhrgebiet. Der zeitgeschichtliche Hintergrund des Romans reicht vom Leben in der DDR (1949–1990), der deutschen Wiedervereinigung bis in die erzählerische Gegenwart (2021).
Im 3. Kapitel bieten wir eine Textanalyse und -interpretation.
Der Markisenmann – Entstehung und Quellen:
Der Roman verdankt seine Entstehung einer Anregung von Jan Weilers Tochter Milla, die ein interessantes Buch nur für sich selbst in Auftrag gab. Das Schreiben selbst hat sich dann über zehn Jahre hingezogen.
2021 erschien Der Markisenmann im Heyne Verlag, München.
Inhalt:
Die 15-jährige rebellische, wohlstandsverwahrloste Kim Papen fühlt sich in ihrer Patchwork-Familie als emotional vernachlässigte Außenseiterin. Als sie einen katastrophalen Unfall verursacht, wird sie in den Sommerferien zu ihrem leiblichen Vater nach Duisburg abgeschoben. Hier erlebt sie eine Kontrastwelt zu ihrem bisherigen Wohlstandsleben in Köln-Hahnwald, erlebt aber auch eine Coming-of-Age-Zeit, die ihr einen neuen Blick auf ihre Familie beschert.
Aufbau, Chronologie und Schauplätze:
Neben einem Prolog und einem Epilog spielt die Geschichte, die von der Protagonistin Kim Papen rückblickend aus dem Jahr 2021 erzählt wird, während ihrer sechswöchigen Sommerferien 2005 im Ruhrgebiet. Eingestreut sind zwei Erinnerungen ihrer Väter an deren Zeit in der DDR.
Hauptfiguren:
Kim Papen
15-jährige Tochter von Ronald Papen und Susanne Mikulla
aufsässig, wohlstandsverwahrlost, aber lernfähig
Ronald Papen
leiblicher Vater von Kim
melancholisch, schuldbewusst, freundlich
lebt in einem Fabrikgebäude in Duisburg
Susanne, Heiko und Geoffrey Mikulla
Kims Mutter, Stiefvater und Halbbruder
leben in einer Villa in Köln-Hahnwald
verreisen ohne Kim in den Sommerurlaub
Alik Cherif
14-jähriger Jugendlicher aus Duisburg
selbstbewusst, mitfühlend und zurückhaltend
Oktopus, Lütz und Achim
Kumpel von Ronald Papen
leben bzw. arbeiten in der Nachbarschaft der Fabrikhalle
Die Personen werden ausführlich und in ihrer Beziehung zueinander vorgestellt.
Stil und Sprache:
Jan Weiler …
nutzt zumeist parataktischen Satzbau; die Sprache ist leicht verständlich;
verwendet dabei unterschiedliche Sprach- und Stilmerkmale;
erzählt aus der Ich-Perspektive von Kim: personales Erzählen;
verwendet handlungsbestimmende Motive (u.a. Markisen).
Auf folgende Interpretationsansätze gehen wir näher ein:
Der Markisenmann – ein Coming-of-Age Roman
Der Markisenmann – eine Road Novel
Der Markisenmann – eine Vater-Tochter-Geschichte
Der Markisenmann – eine historische Geschichte
Der Markisenmann – eine Geschichte von Schuld und Sühne
Der Markisenmann – ein humoristischer Roman
2. Jan Weiler: Leben und Werk
2.1 Biografie[1]
Jan Weiler
(* 1967)© picture alliance / zb | Kirsten Nijhof
Jahr
Ort
Ereignis
Alter
1967
Düsseldorf
Jan Weiler wird am 28. Oktober geboren.
1970
Meerbusch
Umzug der Familie in den Düsseldorfer Vorort Meerbusch
3
1988
Meerbusch
Abitur am Städtischen Meerbusch-Gymnasium; schon während seiner Schulzeit Arbeit als freier Mitarbeiter für den Meerbuscher Lokalteil der Westdeutschen Zeitung.
21
1988–1990
Zivildienst beim Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband im mobilen Hilfsdienst.
21/22
1990–1992
Düsseldorf
Werbetexter bei zwei renommierten Agenturen.
23–25
1993
München
Besuch der Deutschen Journalistenschule.
26
1994
München
Praktikum beim Magazin der Süddeutschen Zeitung; Moderator in der TV-Sendung Live aus dem Schlachthof im Bayerischen Fernsehen.
27
1995–1998
München
Redakteur beim SZ-Magazin.
28–31
1996
Weiler heiratet die deutsch-italienische Journalistin Sandra Limoncini.
29
1998
München
Weiler kündigt seine Festanstellung und arbeitet mit Autorenvertrag beim SZ-Magazin; Mitgründer der Agentur AWWR, Autor für verschiedene andere Publikationen.
31
1999
München
Geburt der Tochter Milla.
32
2000–2005
München
Chefredakteur des SZ-Magazins (gemeinsam mit Dominik Wiechmann), Aufgabe des Gesellschaftervertrags bei AWWR.
33–38
2003
München
Weilers Debütroman Maria, ihm schmeckt’s nicht! erscheint beim Ullmann Verlag, Geburt des Sohnes Tim.
36
2005
München
Weiler wird freier Schriftsteller; Dozent an der Deutschen Journalistenschule; ausgedehnte Lesereise durch deutsche Städte; Antonio im Wunderland wird publiziert.
38
2006
Veröffentlichung des Reisetagebuchs In meinem kleinen Land und Gibt es einen Fußballgott?
39
2007
Hörspiel Liebe Sabine mit Schauspielerin Annette Frier.
40
Seit 2007
Mein Leben als Mensch: wöchentliche Kolumne im Stern, seit 2009 für die Welt am Sonntag.
40
2007–2013
Münsing
Betreiber der Vinoteca Marcipane in Münsing, gemeinsam mit Küchenchef Corbinian Kohn; Land in Sicht. Eine Deutschlandreise.
40–46
2008
Der Roman Drachensaat erscheint.
41
2009
Düsseldorf
Die besten Texte seiner Kolumne Mein Leben als Mensch erscheinen als Buch; Gastmoderator des Kulturmagazins West.Art beim WDR; Kinderbuch Hier kommt Max; Verfilmung von Maria, ihm schmeckt’s nicht! kommt ins Kino (Drehbuch Jan Weiler und Daniel Speck); Hörspiel MS Romantik (Fortsetzung von Liebe Sabine).
42
2010
Moderation seiner eigenen Sendung Weilers Welt bei 3sat; Max im Schnee; Hörspiel Uwes letzte Chance (Fortsetzung).
43
2011
München
Verleihung des Ernst-Hoferichter-Preises des Stadt München; Das Buch der 39 Kostbarkeiten; Mein neues Leben als Mensch.
44
2013
Musicalfassung von Maria, ihm schmeckt’s nicht!; Hörspiel Das Baby-Projekt (Fortsetzung).
46
2014
Das Pubertier erscheint als Buch und CD.
47
2015–2017
Große deutsche Städtetournee mit dem Bühnenprogramm Mein Leben mit Pubertieren und andere Geschichten.
48–50
2015
Kühn hat zu tun erscheint als Buch und CD.
48
2016
Nicks Sammelsurium (Buch und CD); Premiere der Theaterfassung von Maria,ihm schmeckt’s nicht! am Westfälischen Landestheater; Im Reich der Pubertiere; Verfilmung von Antonio im Wunderland.
49
2017
Und ewig schläft das Pubertier (Buch und Live-CD); Kinofilm Das Pubertier; ZDF-Familienserie Das Pubertier; große Lesetour mit dem Programm Und ewig schläft das Pubertier.
50
2018
Original-Hörspiel Eingeschlossene Gesellschaft; Aufführung als Live-Hörspiel am Schauspielhaus Düsseldorf und auf der LitCologne; Kühn hat Ärger erscheint.
51
2019
Verfilmung von Kühn hat zu tun in der ARD; Kühn hat Hunger erscheint; Lesetour.
52
2020
Kolumnenband Die Ältern plus CD erscheint, geplantes Bühnenprogramm muss wegen der Coronamaßnahmen nach zwei Auftritten beendet werden.
53
2021
Der Markisenmann erscheint.
2022
München
Bühnenprogramm Die Ältern; Der Markisenmann(Hörbuch); Kinofilm Eingeschlossene Gesellschaft (Drehbuch Jan Weiler); Jan Weiler und seine Frau trennen sich: der Sohn lebt mit dem Vater in München; Max – Memoiren eines Schulanfängers.
55
2023
Älternzeit; Fortsetzungsroman Die Summe aller Frauen in der NZZ.
56
2024
Die umfangreichere Romanfassung von Die Summe aller Frauen erscheint unter dem Titel Munk.
57
2025
München und Umbrien
Dreharbeiten zu Der Markisenmann und Die Ältern; Jan Weiler lebt in München und in Umbrien/Italien.
58
2.2 Zeitgeschichtlicher Hintergrund
Zusammenfassung
Jan Weilers Roman Der Maskenmann spielt im Sommer des Jahres 2005 und beschäftigt sich mit dem Erwachsenwerden der Hauptfigur Kim.
Der Roman wirft dabei einen Blick auf das Leben in der damaligen DDR und die Machenschaften der Stasi, die das Leben vieler Menschen auch lange nach der Wendezeit noch prägen.
Schauplatz ist dabei das deutsche Ruhrgebiet: Das ehemalige Industriezentrum ist immer noch Deutschlands größter Ballungsraum.
Jan Weilers Roman Der Markisenmann ist eine Coming-of-Age-Geschichte und spielt in seinem Hauptteil im Sommer des Jahres 2005. Mit seiner Darstellung von Ich-Findung und Identitätsbildung in der Entwicklung der jugendlichen Protagonistin Kim – vom rebellischen, emotional vernachlässigten, egozentrischen, wohlstandsverwöhnten Teenager zur empathischen selbstbewussten jungen Frau – sowie der Thematisierung der Probleme von Trennungskindern und Patchwork-Familien spricht der Roman gerade in der heutigen Zeit aktuelle Themen an (vgl. auch Kapitel 3.7 Interpretation).
Das Ruhrgebiet – ein ehemaliges Industriezentrum
Das Ruhrgebiet mit seinen Industrieruinen und den dort ansässigen bodenständigen und offenen Menschen ist noch immer der größte Ballungsraum Deutschlands. Mit seinen etwa 5,1 Millionen Einwohnern und einer Fläche von rund 4.400 Quadratkilometern ist es nach Moskau und London zudem der drittgrößte Ballungsraum Europas.[2]
Seinen Namen verdankt die in Nordrhein-Westfalen liegende dicht besiedelte Region dem an ihrem südlichen Rand verlaufenden Fluss Ruhr. Von anderen traditionell gewachsenen Ballungsräumen unterscheidet sich das Ruhrgebiet dadurch, dass es aus vielen nahezu gleichgroßen Städten zusammengewachsenen ist, die irgendwann mit ihren Stadtgrenzen an ihre Nachbarstädte stießen.
Der Aufstieg der Region vom Agrarland zur Industrieregion begann mit der Entdeckung reicher Kohlevorkommen und der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert. Bergwerke und Stahlwerke entstanden und in kurzer Zeit wuchs das Gebiet zwischen Ruhr, Rhein, Emscher und Lippe zu einer riesigen Industrieregion zusammen. Das Ruhrgebiet entwickelte sich zu einer von der Schwerindustrie geprägten Landschaft, die von zahllosen Fördertürmen, Abraumhalden, Zechengebäuden, Kanälen und Verkehrswegen sowie von wahllos eingestreuten Wohngebieten geprägt war. Die Bevölkerung wuchs allein in den Jahren 1850 bis 1905 um ein Zehnfaches. Trotzdem fanden die Fabrikbesitzer und Zechenbetreiber nicht genug Arbeitnehmer in der Region und mussten Menschen aus dem deutschsprachigen Osten anwerben. Viele Familiennamen, die auf -czek, -anski, oder -owski enden, zeugen noch heute davon. Arbeitersiedlungen entstanden um die Hochöfen und Zechen, ehemalige Dörfer wie Gelsenkirchen, Bochum oder Essen wurden zu Großstädten. Die Arbeiter bildeten bald die größte Bevölkerungsschicht, die sich ihre Rechte durch eigene Gewerkschaften und Parteien erkämpften. Das Ruhrgebiet wurde zum „Revier“ oder zum „Ruhrpott“ bzw. „Kohlenpott“. Die Begriffe stehen für die besondere Identität und den unverwechselbaren Charakter des Ruhrgebiets.
Zum Ruhrgebiet gehören aber auch die Schrebergärten, die Brieftaubenzucht sowie der Treffpunkt Trinkhalle und der Identitätsstifter Fußball. In der Trinkhalle, ursprünglich ein Verkaufskiosk mit Getränkeausschank, trifft man sich zum abendlichen Plausch, aber mit seinem Fußballverein identifizierte man sich.
„Die Menschen im Revier glühen für ihre Fußballvereine, sei es für den FC Schalke, Borussia Dortmund, den VfL Bochum, den MSV Duisburg, Rot-Weiß Essen, RWO aus Oberhausen oder eine der zahlreichen Mannschaften aus den übrigen Ligen.“[3]
Das kann auch Kim im Markisenmann erfahren, als sie mit Lütz, Achim und ihrem Vater nach Dinslaken zum Fußballspiel fährt (vgl. S. 138 ff.): Lütz und Achim sind glühende Fußball-Fans der „Zebras“, wie die Spieler des MSV[4] Duisburg wegen ihrer gestreiften Trikots genannt werden.
„Die weitgehende monostrukturelle Ausrichtung auf Kohle und Stahl blieb trotz zahlreicher wirtschaftlicher, sozialer Krisen und politischer Umbrüche bis in die [19]50er-Jahre dominierend. Die Steinkohlenförderung sowie die Roheisen- und Stahlproduktion galten über einen langen Zeitraum hinweg als die Indikatoren des wirtschaftlichen Wachstums und der Prosperität der Ruhr- und darüber hinaus der gesamten deutschen Wirtschaft. […] Eine grundlegende Neuorientierung der Wirtschaftsstruktur des Ruhrgebietes erfolgte weder nach dem Ende des Ersten noch nach dem des Zweiten Weltkrieges.“[5]
Das sollte sich bald rächen, denn in den 1950er-Jahren begann ein neuer Energieträger den Markt zu erobern: Das Erdöl verdrängte die Kohle in vielen Bereichen als Energielieferant. Dazu kam, dass die Ruhrgebietskohle aus immer größerer Tiefe heraufgeholt werden musste, was ihre Förderung aufwendiger und teurer machte. Der Bergbau im Ruhrgebiet konnte schließlich nur noch mit staatlichen Subventionen aufrechterhalten werden. Trotzdem mussten immer mehr Zechen schließen. Die Bochumer Zeche Lieselotte war 1958 die erste und mit Prosper-Haniel in Bottrop schloss 2018 das letzte Kohlebergwerk im Ruhrgebiet. Neben der Kohlekrise traf aber auch die weltweite Stahlkrise das Ruhrgebiet ab den 1960er-Jahren schwer. Immer mehr Arbeitsplätze gingen verloren und im ehemaligen Industriezentrum griff die Arbeitslosigkeit um sich.
„In Nordrhein-Westfalen ist die Armutsquote von 2006 bis 2010 von 13,9 auf 15,4 Prozent gestiegen. Besonders alarmierend ist die Entwicklung im Ruhrgebiet, dem größten Ballungsgebiet in Deutschland. In Dortmund stieg die Armutsquote zwischen 2005 und 2011 von 18,6 auf 23 Prozent. In Duisburg von 17 auf 21,5 Prozent.“[6]
Nach einem Bericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes lebte 2015 jeder Fünfte im Ruhrgebiet in Armut