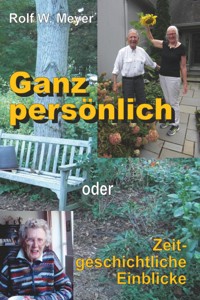Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Seit der Sesshaftigkeit des anatomisch modernen Menschen im Zusammenhang mit der Neolithischen Evolution in der Jungsteinzeit hat sich sein Verhalten gegenüber der Umwelt und im Zusammenleben mit anderen Menschen ganz entscheidend verändert. Seit dieser Zeit wurde die natürliche Umwelt durch den Menschen immer mehr nach seinen Vorstellungen verändert. Mit zunehmender Bevölkerungsdichte entwickelten sich kriegerische Auseinandersetzungen, wobei der Krieg ein Ergebnis der kulturellen Entwicklung ist. Ein Themenbereich des Buches behandelt die beiden größten militärisch geführten globalen Auseinandersetzungen im 20. Jahrhundert anhand von Einzelschicksalen. Dass die Entwicklung des menschlichen Gehirns aber auch kognitive Kapazitäten hervorbrachte, belegt ein Kapitel zum Thema Kunst. Mit der Urbanisierung ist in kultur-technisch modernen Sozialverbänden ein bedeutender sozialer Wandel eingetreten. Mit dem Alltagsleben heutiger Menschen setzt sich ein Kapitel auseinander, allerdings unter dem Gesichtspunkt einer humorvollen aber auch nachdenklichen Betrachtungsweise. Das Kapitel "Wohin gehen wir?" vermittelt, welche Einsichten, Fähigkeiten und Strategien zukünftig für die Menschen der Weltgemeinschaft wichtig sein werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 387
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rolf W. Meyer
Der MenschEin Spiegelbild seiner Zeit
oder
Wohin uns der Zeitgeist treibt
Impressum
Die Namen der Personen, die im 7. Kapitel (Solange man lernfähig bleibt) verwendet wurden, sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind rein zufällig.
Rolf W. Meyer Der Mensch – Ein Spiegelbild seiner Zeit Copyright: © 2019 Rolf W. Meyer Umschlagfoto: Rolf W. Meyer
Konvertierung: sabine abels | e-book-erstellung.de
Druck: epubli, ein Service der neopubli GmbH, Berlin
Dieses Buch ist den indigenen Völkern auf unserem Planeten Erde gewidmet. Von ihnen können wir gerade im Zeitalter der wirtschaftspolitischen Globalisierung viel lernen, da sie ein Spiegelbild unserer stammesgeschichtlichen Wurzeln sind.
„Es ist das Schicksal jeder Generation, in einer Welt unter Bedin-gungen leben zu müssen, die sie nicht geschaffen hat.“
John F. Kennedy, 35. Präsidentder Vereinigten Staaten von Amerika
Vorwort
Betrachtet man in einem Zeitraffer die demographische Entwicklung der Menschheit von der Mittleren Altsteinzeit bis heute, so ergibt sich folgendes Bild: Vor 100.000 Jahren, als auf dem afrikanischen Kontinent eine extreme Dürre herrschte, lebten auf der Erde etwa 2 – 3 Millionen Menschen der Unterart Homo sapiens sapiens, auch anatomisch moderner Mensch genannt. Als Jäger und Sammler existierten sie vor 40.000 bis 10.000 Jahren in kleinen, beweglichen Gruppen, die über ein weiträumiges Kommunikationsnetz miteinander verbunden waren.
Am Ende der letzten Eiszeit vor 10.000 Jahren entwickelten zuerst einige Gruppen des anatomisch modernen Menschen im Vorderen Orient neue Überlebensstrategien in Form von Ackerbau und Viehzucht. Weitere Gruppen in anderen Regionen der Erde folgten unabhängig davon. Diese neuen Lebensstrategien ermöglichten die Sesshaftwerdung. Die Menschen wurden territorial und nutzten die Umwelt viel intensiver. Dadurch stieg die globale Population auf bis zu 20 Millionen Menschen an. Die sesshafte Lebensweise, die sich über einen relativ großen Zeitraum allmählich entwickelt hatte, bewirkte im Neolithikum (Jungsteinzeit) viele Veränderungen im sozialen Bereich („Neolithische Evolution“).
Die Größe der Weltbevölkerung vor 2.000 Jahren schätzt man auf 170 bis 400 Millionen Menschen. Im Jahr 1750, dem Maximum der agrikulturellen Phase, umfasste die Weltbevölkerung etwa 750 Millionen Menschen. Im Zusammenhang mit der Industriellen Revolution (ein relativ schnell erfolgender Übergang von der Agrar- zur Industriegesellschaft) stieg 1850 die Anzahl der Menschen auf der Erde auf 1,26 Milliarden an. Als der Autor dieses Buches im Februar 1942 geboren wurde, war er der 2.337.062.674ste Erdenbürger. Im Jahr 2019 umfasst die Weltbevölkerung 7,71 Milliarden Menschen.
In allen angesprochenen kulturhistorischen Zeiträumen wurden die Menschen in ihrer Entwicklungsgeschichte entscheidend beeinflusst, was sich auch auf ihr Verhalten auswirkte. Als frühzeitliche Jäger und Sammler konnten die Menschen ihre Umwelt optimal nutzen, ohne dauerhafte Spuren zu hinterlassen. Mit der Sesshaftwerdung hinterließen die Menschen oftmals Spuren, die von der Natur nicht mehr beseitigt werden konnten. Im Zusammenhang mit der Urbanisierung in kultur-technisch modern ausgerichteten Sozialverbänden ist ein bedeutender sozialer Wandel eingetreten. Dies zeigt sich besonders in Rechtssystemen und in bürokratischen Hierarchiemustern. Im Hinblick darauf ist eine legale, aber unpersönliche und bürokratische Kontrolle der Mitglieder in den Sozialverbänden wirksam. Inzwischen haben sich weltweit „Mega-Sozialverbände“ entwickelt, in denen die sozialen Balance- und Kontrollmechanismen in der Anonymität städtischer Massengesellschaften kaum noch funktionieren. Historisch gesehen ist eine kontinuierliche Zunahme des Anteils der Stadtbevölkerung festzustellen. Im Jahr 2008 lebten weltweit erstmals in der Menschheitsgeschichte mehr Menschen in Städten als auf dem Land.
Dass in der Kulturgeschichte des Menschen Bauern mit ihrer Arbeit in der Landwirtschaft und handwerkliche Tätigkeiten die Grundlage dafür schufen, dass Städte wachsen und Kulturen sich entfalten konnten, wird im ersten Buchkapitel „Zurück zu den familiären Wurzeln“ anhand ausgewählter Beispiele aufgezeigt. Die Erfahrung zeigt, dass sich in der dichten Atmosphäre der Städte die kulturelle Entwicklung sehr schnell beschleunigt. Diese Wohn- und Lebensbereiche werden immer mehr zum „Anziehungsmagneten“ für Menschen aus der ganzen Welt.
Das Thema „Der Erste Weltkrieg und seine Folgen“ im zweiten Buchkapitel spricht die erste militärisch geführte globale Auseinandersetzung in der Menschheitsgeschichte an, die von 1914 bis 1918 in Europa, im Nahen Osten, in Afrika, Ostasien und auf den Ozeanen ausgeführt wurde. Der Erste Weltkrieg war der Nährboden für den Faschismus in Italien, den Nationalsozialismus in Deutschland und wurde so zum Vorläufer des Zweiten Weltkrieges. Auf Grund der Verwerfungen, die durch den Ersten Weltkrieg in allen Lebensbereichen entstanden, und seiner bis in die jüngste Vergangenheit nachwirkenden Folgen betrachtet man ihn als die „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“ (George F. Kennan). Der Erste Weltkrieg markierte das Ende des Hochimperialismus. Im Zusammenhang mit „Krieg“ ist folgende Erkenntnis bemerkenswert: Der Krieg als destruktive, mit Waffen geführte und strategisch geplante Gruppenaggression ist ein Ergebnis der kulturellen Entwicklung. Krieg kann daher auch kulturell überwunden werden. Der Krieg ist nicht in unseren Genen verankert. Er hat jedoch insofern mit den Genen zu tun, als er die Eignung (Fitness, gleichbedeutend mit Fortpflanzungserfolg) der Sieger fördert. Der Mensch ist seiner Motivationsstruktur nach zweifellos friedensfähig. Will man den Frieden, dann muss man allerdings zur Kenntnis nehmen, dass der Krieg Funktionen wie jene der Ressourcensicherung und Erhaltung der Gruppenidentität erfüllt, die es dann auf andere, unblutige Weise zu erfüllen gilt. Aus soziobiologischer Sicht werden Kriege nicht so sehr durch Aggressivität sondern mehr durch ein Übermaß an Hingabebereitschaft des Menschen ermöglicht. Dies lässt in beeindruckender Weise sein altes Primatenerbe erkennen. Eine weitere Eigenschaft des Menschen, nämlich seine Bereitschaft zur Loyalität wurde schon immer zu politischen Zwecken missbraucht. Diese angesprochene Neigung ist eine weitere Erklärung für die Mobilisierbarkeit von Menschen zum gemeinsamen Kampf.
In dem dritten Buchkapitel „Auf dem Weg zum Zweiten Weltkrieg“ wird die Erfahrung eines Kriegsteilnehmers dokumentiert, der die Invasion 1944 in der Normandie und die letzten Kriegswochen in Norditalien miterlebt hat. Im Mai 1945 geriet er in britische Kriegsgefangenschaft. Der Zweite Weltkrieg, der von 1939 bis 1945 geführt wurde, war der zweite global geführte Krieg sämtlicher Großmächte des 20. Jahrhunderts und stellte den größten militärischen Konflikt in der Geschichte der Menschheit dar. Er bestand in Europa aus Blitzkriegen, Eroberungsfeldzügen gegen die deutschen Nachbarländer mit Eingliederung eroberter Gebiete, der Einsetzung von Marionettenregierungen, Flächenbombardements sowie im letzten Kriegsjahr dem wiederholten Einsatz von Atomwaffen in Japan (Hiroshima und Nagasaki).
Das im vierten Buchkapitel „Kriegsgefangenschaft – Zukunft ungewiss“ erwähnte Kriegsgefangenenlager Bellaria bei Rimini in Italien war im Mai 1945 für die kapitulierenden Soldaten der deutschen Wehrmacht durch die britische Armee und die US-Armee eingerichtet worden. 1947 wurde das Lager nach Entlassung der Kriegsgefangenen (POWs, „Prisoners of War“) wieder aufgelöst.
Die Nachkriegszeit in Deutschland, die thematisch im fünften Buchkapitel „Überlebensstrategien in der Nachkriegszeit“ behandelt wird, war sehr oft von Hunger und Mangel an Gütern aller Art gekennzeichnet. Sie stellte die Bevölkerung vor hohe Herausforderungen.
Das sechste Buchkapitel „Für das Können ist Handeln der beste Beweis“ widmet sich dem Thema Kunst, speziell der Malerei. Im Mittelpunkt steht die informelle Malerei einer Künstlerin aus dem 20. Jahrhundert, die sich in vielseitigen Ausdrucksformen widerspiegelt und das deutliche Ergebnis ausgedehnter Reflexionen ist. Denn das, was Menschen mit den Händen schaffen, ist ein Ausdruck geistiger Vorgänge. Der Philosoph Immanuel Kant hat es so formuliert: „Die Hand ist das äußere Gehirn des Menschen.“
Bemerkenswert ist, dass die ältesten Belege der Malerei in der Menschheitsgeschichte Höhlenmalereien aus der letzten Eiszeit und aus dem Jungpaläolithikum sind. Interessanterweise sind Malereien in drei spanischen Höhlen mit einem Alter von 65.000 Jahren BP auf Neanderthaler zurückzuführen. Kunstwerke von Menschen belegen eine intensive intellektuelle Auseinandersetzung von ihnen mit der Welt (nach Wikipedia: „Gesamtheit der bezogenen Objekte und als Ganzes der geteilten Beziehungen“). Sie sind ein Ausdruck eines reichen spirituellen Lebens.
Das siebte Buchkapitel „Solange man lernfähig bleibt“ setzt sich mit dem Alltagsleben heutiger Menschen auseinander – allerdings unter dem Gesichtspunkt einer humorvollen aber auch nachdenklichen Betrachtungsweise. In der Alltags-Realität lässt sich allerdings immer wieder beobachten, dass das Leben von Menschen in den modernen Gesellschaftsformen und in einer technisierten Umwelt vielfach extreme soziale Lebensformen zeigen: Allein sein („Single-Dasein“), anonymes Leben, oberflächliche soziale Kontakte, soziale Kontakte auf der Grundlage der telekommunikativen Technik, Patchwork-Familien. Die Dauer und Reihenfolge unterschiedlicher Tätigkeiten im Alltag werden oft vorgeschrieben. Bürokratische Hierarchiemuster verhindern vorteilhafte Adaptationen der Sozialsysteme gegenüber sich verändernden gesellschaftspolitischen Bedingungen. Viele Menschen fühlen sich durch die Anforderungen ihrer sozialen Umwelt gegenüber überfordert. Trotz allem wird nicht nur in der Gegenwart sondern auch in der Zukunft eine fundierte Bildung für die Menschen überlebensnotwendig sein. In Verbindung damit ist lebenslanges Lernen erforderlich. Aber man muss sich auch immer wieder bewusst machen, dass es die „Affennatur“ ist, die die Besonderheiten des Menschen ausmacht. Jürgen Lethmate bringt es folgendermaßen auf den Punkt: „Der Mensch ist körperlich, sozial-emotional und geistig nur als Produkt der Primatenevolution zu begreifen.“
Im achten Buchkapitel wird der Frage nachgegangen: „Wohin gehen wir?“ Der Mensch als „Homo technicus“ bzw. „Homo digitalicus“ neigt dazu, seinen kulturellen Fortschritt stets als technischen Fortschritt darzustellen. Jedoch: Ohne technische Ausrüstung hätten heutzutage viele Menschen Probleme, überhaupt zu überleben. Da der Mensch von seiner Stammesgeschichte her Jäger und Sammler ist und an ein Leben in überschaubaren individualisierten Gruppen angepasst ist, kommt er in den heutigen modernen Gesellschaftsformen mit seinem stammesgeschichtlichen Erbe nicht mehr ohne weiteres zurecht. Um zukünftigen gesellschaftspolitischen Entwicklungen besser begegnen zu können, ist ein Umdenken im Hinblick auf sozialpolitische Strategien erforderlich. Überlebensstrategien unserer frühzeitlichen Vorfahren könnten die Grundlagen für Überlebensstrategien im 21. Jahrhundert darstellen.
Die Großeltern Friedrich Otto und Emma, Elise Meyer mit ihren sechs Kindern in Plauen – Haselbrunn
„Nur wer seine Wurzeln kennt, kann wachsen.“
Anselm Grün (deutscher
Benediktinerpater und Betriebswirt)
1. Zurück zu den familiären Wurzeln
Die Vorfahren meines Großvaters väterlicher Linie kamen aus dem Niederland des Kurfürstentums Sachsen. Sie waren Bauern, Handwerker und Schäfer in den Dörfern um Leipzig und im 17. Jahrhundert im Mansfeldischen Kreis. Das Land ist flach und weitsichtig. Der Blick findet keinen Anhalt im Raum, den die Horizontale beherrscht. Im Dunst und Schatten der Ferne scheint die Erde in den Raum überzugehen. Der Blick hängt an den wenigen Pappeln und Kirchtürmen und unendlich fern an den Wolkenbänken über der Ebene.
Wasser fließt hier. Braun, trüb, langsam und schwer fließt es unter den hängenden Weiden hinweg zwischen fetten Wiesen von einem Dorf zum anderen. So sind auch die Menschen, die in das dunkle Wasser sehen und in die ziellose Ferne. Sie sehen dem trägen Wasser zu und lassen die ferne Welt dahinter vergehen. Ein langsamer Menschenschlag, konservativ und an der Scholle hängend.
Der älteste Vorfahre und Namensträger Meyer, der ermittelt werden konnte, ist „Meister Andreas Meyer, der Schäfer“, auch „Kesslerischer Schäfer“ genannt. Er ist um 1700 geboren, lebte in Ritteburg bei Artern an der Unstrut und erwarb 1731 in Ritteburg [1] Landbesitz und Grundstücke. Die Vernichtung der Kirchenbücher schließt weitere Nachforschungen aus. „Meister“ ist eine allgemeine Bezeichnung und nicht im Sinne des modernen Gewerberechts zu verstehen.
Die Schäferei hatte im 17. und 18. Jahrhundert eine andere Bedeutung als heutzutage oder auch zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Schon vor dem dreißigjährigen Krieg (1618 – 1648) stand die Schafwirtschaft in Deutschland in hoher Blüte. Sie war bedeutungsvoller als etwa die Pferde- und Rinderzucht. Infolgedessen genoss der Schäfer, weil er zumeist einen größeren Viehbestand hatte, ein höheres Ansehen als die übrigen Hirten. Sein Wissen um verborgene Heilkräfte stärkte sein Ansehen. Dennoch war der Beruf des Schäfers nicht „ehrbar“ im Sinne des mittelalterlichen Rechts.
In der Mitte des 19. Jahrhunderts war in Mitteldeutschland der Niedergang der Großschäfereien aus folgenden Gründen nicht mehr aufzuhalten: Die überkommenen Weiderechte wurden aufgehoben und durch die Einrichtung staatlicher Forsten, in denen nicht mehr geweidet werden durfte, abgelöst. Für die Feldwirtschaft wurde der künstliche Dünger eingeführt. Der Chemiker Justus von Liebig (1803 – 1873) hatte damals die Agrikulturchemie gegründet. Seine Befürwortung der Mineraldüngung ermöglichte die Verbesserung der menschlichen Ernährung. Weiterhin verfielen die Wollpreise durch den Verkauf von Baumwolle auf den Märkten.
Die Vorfahren meiner Großmutter väterlicher Linie lebten im mittleren Teil Obersachsens und im Erzgebirge. In kleinen Häuschen wohnten sie, einsam und verstreut an den Berglehnen. Sie führten ein ärmliches, kärgliches Leben in schwerer Arbeit und im steten Kampf mit der Natur. Davon wurden sie hart und fest. Sie hatten es in ihrem Leben schwer, aber sie führten ihre Arbeit gern aus. Eckige Gestalten waren darunter. Auch in dieser Gegend ist Wasser. Es sprudelt frisch ins Tal, springt von Stein zu Stein, murmelt und erzählt. Es erzählt lange Geschichten. Der Himmel da oben über den Waldbergen ist klar. Der Blick geht weit, aber er hat ein Ziel. Man schaut über Täler und Höhen und über dunkle Wälder.
Die Vorfahren waren durch viele Generationen hinweg Blech- und Eisenwarenhändler und Schmiede. Mehrere Generationen saßen in Schönheide am Kuhberg oder, wie meine Urgroßeltern sagten, „droben in der Scheeheid“. Ihre Heimarbeit trugen sie weit fort ins Niederland. Dann sehnten sie sich im dunstigen Flachland wohl zurück in die heimatlichen Höhen. Einige brachten Frauen aus dem Niederland mit: Töchter der Schmiede, bei denen sie einkehrten. Einige waren Papiermüller im Schwarzbachtal bei Lößnitz, die lange Jahre ihr Papier zu dem bekannten Musikverlag Breitkopf und Härtel [2] in Leipzig lieferten.
Die Familien gingen nach Eibenstock bzw. nach Elterlein im mittleren Erzgebirge, aber auch in das Hammerwerk Thannenbergsthal im oberen Vogtland. Tapfer und ehrlich erkämpften sie ihr einfaches Leben, arbeitsam und anspruchslos in einer kargen Umwelt. Einfache Menschen … so war auch meine Großmutter.
Zwei Eigenschaften aus den verwandtschaftlichen Linien wurden meinem Vater mitgegeben: Die Liebe zur heimatlichen Scholle und die Bindung an Grund und Boden. Erst die Wurzellosigkeit des selbst gewählten Berufs eines Juristen mit dem Leben in der erdrückenden Enge der Stadt haben meinem Vater gezeigt, wie sehr sein eigentliches Wesen und Fühlen an seiner vogtländischen Heimat hing. Das Schicksal zwang ihn aber auf einen anderen Weg.
Die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg
Das Leben in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg lief für die Menschen in Deutschland in ruhigen Bahnen. Es war, so wie es mein Vater aus seiner Sicht sah, ein Leben ohne große Probleme. Sein Elternhaus und die Umgebung hatten den Lebenszuschnitt des mittelständischen Bürgers. Man lebte einfach, ohne Luxus und großen Aufwand, aber in der Sicherheit einer festen Lebensgrundlage. Mein Großvater wurde in seiner Umgebung für wohlhabend gehalten, was aus Sicht von Außenstehenden sicherlich auf seinen Grundbesitz zurückzuführen war. Und doch bestand nie das Gefühl, dass nicht immer gespart werden müsste. Der Zwang zur „Bescheidenheit“ in der Lebensführung wurde meinem Vater und seinen Geschwistern von den Eltern ständig vorgehalten, zum einen unter dem Hinweis auf die eigene erfahrene Erziehung zur Bescheidenheit, zum anderen war es die Belehrung, dass es anderen Mitmenschen nicht so gut ginge. Es war aber für die Kinder nicht immer einzusehen. Mancher Mitschüler meines Vaters fuhr mit der Straßenbahn zur Schule, mein Vater hingegen musste laufen. Von allen Geschwistern hatte nur seine Schwester Annemarie Mathilde einmal für einige Zeit eine Monatskarte für die Straßenbahn. Ein Fahrrad, der sehnliche Wunsch meines Vaters, wurde ihm oft versprochen. Bekommen hat er es nie. Als im Gymnasium mancher Mitschüler als Sohn eines vermögenden Fabrikanten oder eines höheren Beamten einen besseren Lebensstil erkennen ließ, wuchs in meinem Vater das Gefühl, einen besseren Lebensstandard nur durch eigene Leistung erreichen zu können. Dabei hatte sein Vater 1913 bei der Erhebung des Wehrbeitrages ein Vermögen von 250 000 Mark versteuert.
Sonntags gab es einen Braten, in der Woche ein- bis zweimal Fleisch. Das Abendbrot war einfach. Reste vom Mittagessen wurden „aufgewärmt“ oder Wurst und Brot gegessen. Mein Vater hat nie erlebt, dass auf das Brot außer der Butter auch noch etwas Marmelade aufgestrichen wurde. Kuchen für den Sonntag wurde zu Hause gebacken. Meistens gab es den überlieferten „Hefenkloß“, je nach Jahreszeit wurden aber auch andere, flache Kuchen gebacken. In den Zeiten der Entbehrlichkeit steckten übrigens die hölzernen Kuchendeckel zum Schutz gegen das nächtliche Herausfallen in den Kinderbetten zwischen Bettgestell und Matratze.
Wein für die Eltern hat mein Vater auf dem Mittagstisch nur einige Male zum Weihnachtsbraten erlebt. Bier wurde zuweilen im Krug aus einer der Wirtschaften in der näheren Umgebung geholt. Wenn mein Vater losgeschickt wurde, um Zigarren zu holen, dann waren es immer sechs Stück zu acht Pfennigen. Wurde auf einem Spaziergang eingekehrt, z.B. in die Pfaffenmühle, dann gab es höchstens ein Würstchen und eine Brauselimonade, die, je nach Auswahl, grellgrün, rot oder gelb war. Im Herbst wurden Äpfel und Birnen eingelagert und Preiselbeeren sowie Heidelbeeren eingekocht. Die Beerenhändler zogen mit kleinen Wagen durch die Straßen und man hörte von weitem ihr Rufen „Heedelbeer, Heedelbeer!“ Kirschen und Pflaumen wurden von vorbeifahrenden Händlern im Korb erstanden. Sauerkraut und Gurken legte die Hausfrau selbst ein. Südfrüchte wurden selten gekauft. Die erste Banane hat mein Vater um 1912 gegessen. Apfelsinen, die sehr sauer waren, wurden vor dem Genuss in Zucker gelegt. Anschließend wurde eine Apfelsine für die ganze Familie aufgeteilt. Spargel hat mein Vater erst als Student in Leipzig um 1920 das erste Mal mit Bewusstsein gegessen. Tomaten, die sein Onkel Ernst Philipp Kießig (1868 – 1929) in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts selbst angebaut hatte, wurden als etwas Besonderes betrachtet und „Paradiesäpfel“ genannt. Sein Onkel hatte die Tomate während seines Aufenthaltes in USA kennen gelernt. Mein Großvater hat nach Beginn des Ersten Weltkrieges begonnen, Tomaten in seinem Garten anzubauen. Pfirsiche waren meinem Vater in seiner Jugend ganz unbekannt. Der Grund: Der Pfirsichbaum gedieh nicht in dem rauen Klima des Vogtlandes. Den Nussbaum hat er erst als Student kennen gelernt. Die Massenanfuhr von Erdbeeren, Spargel und Pfirsich aus den Obstanbaugebieten der Elbe in das Vogtland und Erzgebirge wurde erst möglich, als das Lastauto den Verkehr beherrschte. Kartoffeln wurden für das ganze Wirtschaftsjahr eingekellert. Die Wäsche wurde im Garten hinter dem Haus auf dem Rasen gebleicht. In der Waschküche im Kellerbereich befanden sich der beheizbare Waschkessel, das Waschbrett und ein Wäschewringer. 1911 legten sich meine Großeltern eine elektrische Waschmaschine zu. Sie wurde, gegen Entgelt, nicht nur von den Hausbewohnern, sondern sogar von Nachbarn benutzt.
Die Arbeiter in allen Betrieben arbeiteten von 6 Uhr bis 18 Uhr mit 3 Pausen täglich 10 Stunden. Am Sonnabend wurde bis 17 Uhr gearbeitet. Die Schule begann vom dritten Schuljahr an regelmäßig um 7 Uhr während des Sommers und um 8 Uhr im Winter. In den Oberklassen hatten die Schüler zweimal wöchentlich nachmittags Unterricht.
In Haselbrunn gab es auch einen Kramladen, der „Colonialwarenladen“ genannt wurde. Er führte alles in seinem Angebot, vom Petroleum über Holzpantoffel, Pferdepeitschen und Schnupftabak bis zum Bückling, der Leberwurst, Brot, Mehl und Bleichsoda. Wenn die Kutscher Frühstückspause machten und ihr Bier tranken, war der Kramladen auch gleichzeitig Frühstücksstube. Das Duftgemisch in einem solchen Kramladen war bemerkenswert. Oft genug schmeckte der Harzer Käse nach Petroleum. Viele Händler kamen aber auch noch ins Haus. Haushaltsgeräte aus Blech und Holz wurden in Wagen umhergefahren oder in die Häuser getragen. Der „Lettermann“ mit Leitern, Wannen und Besen war ein Ereignis auf der stillen Straße. Seine Ankunft verriet „ander Wetter“. Kroaten mit Blech und Mausefallen, Italiener mit Gipsfiguren, andere Händler mit Stoffen oder englischem Heftpflaster waren ständige Gäste. Das Schild an der Haustür „Betteln und Hausieren verboten“ hatte eine echte Bedeutung. Auch arbeitsscheue Bettler, ja sogar Zigeuner [3], zogen durch das Land. Scherenschleifer und Kesselflicker verrichteten ihre Arbeit im Hof oder auf der Straße. Man konnte darauf warten. Manches gesprungene Tongeschirr wurde von einem Kesselflicker mit einem Drahtnetz versehen. Mancher Bettler bekam ein Essen. Andere Bettler ließen das Brot vor der Tür liegen.
Im Herbst wurden Schafherden und Gänseherden aus Pommern und Schlesien durch Haselbrunn getrieben. Die Tiere wurden unterwegs zum Mästen für den Winter abgesetzt. Gemächlich zogen sie mit Lärm und viel Staub ihres Weges. Der Fußweg vor dem Haus auf der Haselbrunner Straße musste zweimal wöchentlich gekehrt werden. Im Winter musste bis 8 Uhr vor dem Haus „Bahn gemacht“ werden, das heißt, bis dahin musste der Gehweg schneefrei sein. Das war schon bald die Aufgabe für meinen Vater.
Wie stand es um die Preise in jener fernen Zeit? Zwei Semmeln kosteten 5 Pfennige, das Dreierbrot einen Dreier (Drei-Pfennig-Stück). Zwölf Stahlfedern kosteten einen Groschen [4], ein Schulheft 5 Pfennige. Das Schulgeld für das Gymnasium machte mit 150 Mark schon eine Menge Geld aus. Ein Glas Bier kostete 12 Pfennige, die billigste Zigarre 4 Pfennige und 12 der billigsten Zigaretten 10 Pfennige. Eine damals gängige Zigarettenmarke war „Luccas“, die ein langes Papphohlmundstück trug. Der Straßenbahnfahrpreis lag bei 10 oder 15 Pfennigen. Der Schneiderlohn für einen Anzug betrug 70 Mark. Die Arbeiter in der Ziegelei gingen mit einem Wochenlohn von 15 Mark nach Hause. Die direkten Steuern waren minimal.
Meyer’s Ziegelwerke im Heidenreich in Plauen – Haselbrunn: Die Aufbauarbeit einer Generation
„Ihr werdet wieder zu Hause sein, ehe noch das Laub von den Bäumen fällt.“
(Kaiser Wilhelm II. zu den im August 1914
in Richtung Belgien ausrückenden Truppen)
„Um nichts auf der Welt möchte ich diesen herrlich aufregenden Krieg missen.“
(Britischer Marineminister und späterer
Premierminister Winston Churchill im Herbst 1914)
2. Der Erste Weltkrieg und seine Folgen
Als am 1. August 1914 der Erste Weltkrieg begann, war mein Vater Quartaner. Im Juni dieses Jahres hatte er noch den jährlichen Schulausflug nach Schloss Burgk an der Saale und nach Saalfeld gemacht. Das Wichtigste an dieser Fahrt war für die Schüler das Abkochen im Freien. Aluminiumkocher mit Hartspiritus waren eine Neuigkeit zu dieser Zeit. Kochgemeinschaften wurden gebildet, in denen jeder etwas zum gemeinsamen Essen beisteuern musste. Für seine Gruppe lieferte mein Vater die Erbsensuppe. Auf einem Feld unweit der Saale wurden die Mahlzeiten zubereitet. Es war für alle Anwesenden wesentlich fesselnder als die Besichtigung des Schlosses.
Als die Schüler aus den Sommerferien zurückkehrten, war die Welt und auch die Schule verändert. Der Krieg ging durch Europa und bestimmte nun das Leben der Menschen. Das bürgerliche Zeitalter war endgültig vorüber.
Die Sommerferien hatte mein Vater in Elsterberg bei den Verwandten Paul Oswald Anlauft (1870 – 1939) und seiner Frau Clara Mathilde (1877 – 1960), eine Schwester seiner Mutter, verlebt. Dort spielte er mit seinem Vetter Fritz Paul Anlauft (1900 – 1978) auf dem Fabrikgelände der Weberei oder am Uferbereich der Elster. Zuweilen nahm ihn auch sein Onkel Otto Baumann (1869 – 1935), der älteste Bruder seiner Mutter, mit, wenn er auf Kundenbesuch „über Land ging“.
Doch mit einem Male wurde nach dem Mord von Sarajewo, [5] der am 28. Juni 1914 geschah, und nach der Mobilmachung in Österreich die Eisenbahnstrecke, die durch Elsterberg führte, von Sonderzügen mit österreichischen Reservisten befahren. Der 1. August 1914 war ein Sonnabend gewesen, ein heißer Hochsommertag in einer Welt, die seit der Ermordung des österreichischen Thronfolgers Franz Ferdinand an jenem 28. Juni 1914 voller Anspannung und Sorge um den Frieden war. An diesem Tag wurde mein Vater gegen sechs Uhr abends von Tante Clara zur „Fürstenhalle“, einer Gastwirtschaft unweit des kleinen Bahnhofes von Elsterberg geschickt, um Onkel Paul von seinem Abendschoppen zum Abendbrot heimzuholen. Sein Onkel saß zu diesem Zeitpunkt mit anderen Männern auf der Veranda beim Bier. Die Ereignisse in Europa gaben genug Gesprächsstoff. Da kam plötzlich aus der gegenüberliegenden Post ein Beamter und heftete einen Zettel an das Anschlagbrett. Einer der Tischgenossen, die dem abendlichen Verkehr zum Kleinstadtbahnhof zusahen, sagte scherzhaft: „Der Richard hängt’s gute Wetter raus.“ Er meinte den Wetterbericht der Post. Doch immer mehr Neugierige blieben vor dem Anschlagbrett stehen. Im Nu entstand ein großer Menschenauflauf. Es wurde gerufen, laute Stimmen waren zu hören, man redete wild durcheinander und viele aus der Menschenmasse entfernten sich eilig, um schnell nach Hause zu gelangen. Auf dem Anschlag war zu lesen: „Seine Majestät der deutsche Kaiser hat wegen drohender Kriegsgefahr die Mobilmachung befohlen. Erster Mobilmachungstag ist der 1. August 1914.“ Das bedeutete, dass schon am nächsten Morgen die ersten Reservisten einrücken mussten. Der Krieg stand vor der Tür. Betroffen liefen mein Vater und sein Onkel heim. Die Umwelt war plötzlich wie ein zerstörter Ameisenhaufen. Diesem Augustabend sollten noch Jahrzehnte von Not und Elend folgen.
Schon am nächsten Tag war der Zugverkehr eingeschränkt. Am Sonntag erschien überraschend mein Großvater, um seinen Sohn heimzuholen. Er hatte einen überzeugenden Grund. Zum einen war der Landsturm aufgerufen worden, so dass mein Großvater mit seiner Einberufung rechnen musste. Zum anderen vertrat er die Ansicht, dass sein Sohn solch eine Mobilmachung, wie sie sich in Plauen abspielte, in seinem Leben nicht wieder erleben würde. Schon am Nachmittag fuhren sie nach Haselbrunn. Der Zug war von den letzten Reisenden überfüllt. In der Innenstadt von Plauen drängte sich eine große Menschenmasse. Einberufene Reservisten zogen in Gruppen durch die Straßen. Es wurde laut gesungen. Von überall her erklang „Die Wacht am Rhein“. [6] Einige Personen auf dem Dach der Hauptpost erregten die Aufmerksamkeit von Hunderten von Zuschauern. Mit einem Mal war die Angst vor Spionen da. Einzelne Soldaten mit der neuen feldgrauen Uniform und dem gelben Lederzeug verursachten Menschenaufläufe. Die Ausrüstung wurde bewundert und der „gediente“ Mann war stolz auf seine Sachkenntnisse. Wichtig war die Erkenntnis, dass es an dieser Uniform keine Knöpfe mehr gab, die man hätte blank putzen müssen. Mein Vater und mein Großvater kehrten in die Örtlichkeit „Reichshallen“ ein, wo ein großer Trubel herrschte. Unentwegt wurden Extrablätter ausgerufen. Die erste Kriegserklärung hatte eine überschwängliche Begeisterung ausgelöst. Von den Tischen herunter wurden Reden gehalten, es wurde gesungen und immer wieder erklang ein „Hoch lebe“ auf den Kaiser und den König. Für den Feind hatte man nur Spott und Hohn übrig. Jeder Soldat, dessen man habhaft werden konnte, wurde wie ein Held gefeiert. Aus spärlichen Meldungen von der Grenze wurden Siegesnachrichten. Mein Vater stand in all dem Wirbel und plötzlich war er nicht mehr ein Kind. Sein Vater erklärte ihm alles mit dem Hinweis, diese denkwürdigen Ereignisse gut in Erinnerung zu bewahren. Und er fügte hinzu:“ Wir werden noch viel erleben.“ Wie Recht hatte er!
2.1 Der Erste Weltkrieg verändert die Gesellschaft
Die heimatliche Umgebung empfand mein Vater als verändert. Die Ziegelei stand still. So wie die Arbeit an jenem denkwürdigen Sonnabend unterbrochen worden war, so blieben Kalköfen, Maschinenhaus, Trockenschauer und Lehmgrube liegen – für Jahre. Überall waren am nachfolgenden Montag die Reservisten schon eingezogen worden und auf dem Weg zur Front. Plötzlich war da eine neue Gemeinschaft. Jeder nahm Anteil am Schicksal des anderen. Freund und Nachbar wurden nach ihrer militärischen Stellung bewertet. Der „Gediente“ war ein angesehener Mann, auch wenn seine Einberufung erst noch bevorstand. Lehrer Werner war der erste Soldat in der Nachbarschaft, den mein Vater sah. Er fiel bald. Die Eisenbahn diente nur noch für den Transport von Soldaten und von militärischen Gerätschaften. Alle Viertelstunde rollte ein militärischer Transport in Richtung Hof in Bayern. Schon bald konnte man am Ton des Zugrollens den Truppenzug vom Materialzug unterscheiden. In der warmen Augustsonne lagen die Soldaten in den offenen Waggons auf den Geschützen und Fahrzeugen und bei den Waggons, die die Soldaten transportierten, sogar auf den Dächern. Die Waggons waren bekränzt und mit übermütigen Aufschriften versehen. Die ganze Welt wollten die begeisterten „Helden“ erobern. Auf allen Bahnhofstationen wurden sie durch Wohltätigkeitsausschüsse und aus der Bevölkerung mit Erfrischungen und Geschenken überhäuft. Oft liefen mein Vater und seine Freunde vom Heidenreich hinüber zum Essigsteig, um denselben Zug nach der der Durchfahrt auf der Strecke nach Hof ein zweites Mal zu begrüßen. Man brüllte unentwegt „Hurra“. Alle Eisenbahnbrücken waren bewacht. Am Pietzschebach und am Heidenreich standen Posten. Dicke Landwehrmänner mit Bärten lagen in ihren blauroten Uniformen neben den Zelten im Gras und ließen sich bestaunen und bewirten. Unentwegt brachte man ihnen Zigarren, Brötchen und Kaffee. Gönnerhaft ließen die „verhinderten Helden“ die Besucher in ihre Zelte kriechen.
Am fünften Kriegstag rückte Onkel Friedrich Albert Meyer (1877 – 1949), der Bruder meines Großvaters, ein. Mein Großvater begleitete ihn zum Stellplatz, dem Schulhof des Realgymnasiums. Hunderte von Angehörigen standen am Schultor, ohne eingelassen zu werden. Als der Sohn des Ziegelbrenners Wessel als schmucker Ulan [7] am Tor erschien, ließ er meinen Vater, der etwas später seinem Vater zur Schule gefolgt war, auf gutes Zureden hin durchschlüpfen. Bald hatte er in den aufgestellten Gruppen seinen Onkel gefunden. Er entdeckte auch Herrn Reichelt, den zweiten Brenner, der acht Kinder zu Hause hatte. Dieser holte seine silberne Uhr aus der Tasche und vertraute sie meinem Vater an. Er sollte sie, da Herr Reichelt an die russische Front verlegt wurde, zu seiner Frau zurückbringen. Er kam übrigens 1917 mit einem zerschossenen Bein zurück.
In strammer Marschanordnung verließen die Soldaten mit Gesang den Schulhof. Manchem schien nicht ganz wohl zu sein. Mein Großvater und mein Vater begleiteten die Marschkolonne bis zum Bahnhof, wo schon der bekränzte Zug stand. Mein Vater sah die Brüder Abschied nehmen, Frauen weinten und Männer mit traurigen Gesichtern versteckten ihren Abschiedskummer hinter gespielter Begeisterung. Immer wieder spielte man Marschmusik, und Hurrarufe und Gesänge begleiteten den qualmenden Zug mit den winkenden Männern, der sich in Bewegung gesetzt hatte.
Eine unerklärliche Furcht vor Spionen hatte das Volk ergriffen. Das Gerücht beherrschte das Geschehen. Die Masse gehorchte ihm. Überall wurden Fremde als Spione festgenommen und „Goldtransporte“ wurden gejagt. Jüdische Mitmenschen, die seit Jahrzehnten als friedliche Händler gelebt hatten, waren plötzlich russische Agenten. Die Nachrichten von den „Kriegsschauplätzen“ flossen spärlich. Man war auf Extrablätter angewiesen. Onkel Georg Friedrich Barthel (1867 – 1934), der Schwager meines Großvaters, ließ am Bretterzaun an der Haselbrunner Straße eine Anschlagtafel anbringen, an der nun jedes Extrablatt ausgehängt wurde. Bald kamen Siegesmeldungen, aber mit ihnen auch die Verlustlisten der Regimenter. Die ersten Schatten fielen mit dem scheidenden Sommer über das Land. In den Tageszeitungen erschienen mit dickem schwarzem Rand die ersten Todesnachrichten.
2.2 „Im Westen, da liegt manch stilles Grab …“
Mit den jungen Lehrern war auch der Klassenlehrer meines Vaters Soldat geworden. Die Primaner hatten sich kriegsfreiwillig gemeldet. Der Unterricht kam nur langsam in Gang. Bald trafen Feldpostbriefe von Lehrern und Schülern ein. Sie wurden in der Morgenandacht vorgelesen. Dann wurde ein besonderes Klingelzeichen an der Schule eingeführt, das den Unterricht unterbrach und Lehrer und Schüler aufforderte, sich in der Aula zu versammeln. Dort wurden dann die Siegesmeldungen verkündet oder Ausschnitte aus Briefen von Kriegsteilnehmern vorgetragen. Und eines Tages waren die ersten Todesnachrichten da. Ein Schüler und ein Lehrer waren im Feld gefallen. Bald darauf fiel auch der einzige Sohn des alten Rektors. Von diesem Tage an schloss er jede Todesnachricht mit dem Gedicht „Für uns“ ab: „Im Westen, da liegt manch stilles Grab …“ Er las es mit bebender Stimme. Bald sprach er es auswendig. Immer wieder rannen ihm beim Gedenken an seine toten Lehrer und Schüler die Tränen in den weißen Bart. Um das zu verbergen, zog er immer wieder sein Taschentuch. Hatten die Schüler erst mit bangem Herzen und wirklicher Ergriffenheit dem Gedicht gelauscht, so gab bald die Rohheit der Jugend den Spott über den sich schnäuzenden Alten frei. Es dauerte nicht allzu lange und die Gedenkstunden fielen für den einzelnen Fall aus. Die Anzahl derer, die ihr Leben für das Vaterland ließen, wurde zu groß. Die anfänglich begeisterten Briefe der Lehrer hatten sich in Berichte über das Grauen und die Not der Soldaten in den Stellungsschlachten des Krieges verwandelt. Die Schüler, zu denen sie nach vier Wochen zurückzukehren gehofft hatten, kamen ihnen aus den Augen. Kaiser Wilhelm II. [8]hatte in jener historischen Reichstagssitzung im August 1914 mit den Worten „Ich kenne keine Parteien mehr. Ich kenne nur noch Deutsche.“ eine Welle nationaler Begeisterung hervorgerufen. Im 19. Jahrhundert waren Kriege immer mit Chauvinismus [9] verbunden gewesen. Jetzt aber äußerte er sich in vielseitiger Form. Dass sich jeder eine schwarz-weiß-rote Fahne besorgte und bei jedem Sieg die Fahnen in den Straßen wehten, war ebenso selbstverständlich wie der ganze Kitsch von Heldenbildern, Fotografien von Kaiser und König und den „großen Deutschen“ sowie der Erhebung der aufregenden Gegenwart zu „Deutschlands großer Zeit.“ So wie mit einem Schlag Gemeinschaft und Kameradschaft in der Sattheit des abtretenden bürgerlichen Zeitalters, das kaum menschliche Probleme gehabt hatte, eine unerwartete Auferstehung feierten, so war manche Bestrebung mit einem Male erfolgreich, die sonst keinen Anklang gefunden hatte. In wenigen Tagen verschwanden bisher nur von Deutschtümlern bekämpfte Fremdworte aus der Öffentlichkeit, wie z.B. Trottoir, Perron, Billet, Coupé, Chauffeur, Bureau, Etage. Kleine Schilder mit den Nationalfarben und der Aufforderung „Deutscher, sprich deutsch!“ machten dem „Adieu“ mit einem Schlag den Garaus und führten stattdessen „Auf Wiedersehen“ ein. Aufrufe zur Abgabe von Gold, in Verbindung mit historischen Vergleichen zu den Opfern der Freiheitskriege, holten viel von diesem Edelmetall aus dem Volk. [10] Der Nachteil war, dass damit die Goldmünzen für immer aus dem Zahlungsverkehr verschwanden. Mit Stolz trugen viele Bürger eine eiserne Uhrkette als Ersatz für die abgelieferte goldene Kette über der Weste. Trotzdem brachten diese Sammlungen unter der Bevölkerung und die Aufrufe, die bald auch für andere Sachobjekte folgten, keinesfalls den Gewinn, der unter größerem politischem Druck der Öffentlichkeit in den Jahren nach 1933 aus dem Volk herausgeholt wurde. Der moderne Massenstaat, der heute das Denken der Menschen leitet, war erst im Aufbruch. Die eifrigsten Sammler waren die Schulkinder. Für abgelieferte Goldstücke gab es Diplome. Der Ehrgeiz der Jugend holte manchen „Goldfuchs“ aus dem großmütterlichen Sparstrumpf. Mein Vater hatte beispielsweise seiner Tante Minna Helene Kießig ihre letzten zwei 10-Markstücke in Gold abgeknöpft. Noch Jahrzehnte nach dem verlorenen Krieg und nach der Inflation von 1923 hat sie es ihrem Neffen missbilligend vorgehalten.
Im Oktober 1914 bekamen meine Großeltern zwei Soldaten zur Einquartierung zugewiesen. Sie wurden im Dachgeschoss des großelterlichen Hauses untergebracht. Diese beiden Soldaten waren beim Vormarsch mit dem aktiven Plauener Regiment in Frankreich verwundet worden. Als die Einquartierungszeit dieser beiden Unteroffiziere, die nun Ausbilder beim Ersatzbataillon waren, vorüber war, bot ihnen mein Großvater die zwei Zimmer im Dachgeschoss kostenfrei zum Weiterwohnen an. Mit dem Kriegsausbruch und dem Rückgang der Spitzenindustrie ergaben sich für viele Familien wirtschaftliche Schwierigkeiten. Überall in den Straßenzügen leuchteten in den schwarzen Fensterhöhlen die gelben Schilder, die freie Wohnungen anboten. Man hatte nicht mit einer so langen Dauer des Krieges gerechnet und trotzdem lebte mancher unbeschwert im alten Stil weiter. Über die englische Drohung einer Blockade der Schiffzufahrtswege lachte man nur. Viel zu spät kam man auf den Gedanken, die Lebensmittel und Gebrauchsgüter zu bewirtschaften. Unerwartet wurden zunächst Fleischmarken eingeführt. Dann folgte die Brotrationierung. Das war aber erst der Anfang. Dichtbesiedelte Gebiete hatten die ersten Schwierigkeiten. Sachsen litt bereits Not, als weite Teile Bayerns und die Ostprovinzen von Preußen noch kaum etwas vom Krieg gemerkt hatten. Die Zeit des „Ersatzes“, der „Friedensware“, der Kriegsgewinnler und Warenschieber nahm ihren Aufschwung. Als der Krieg 1918 zu Ende war, waren die Menschen ausgehungert und in der Kleidung heruntergekommen. Das Land war leer und verarmt. Der Reichtum von Generationen verfiel in der Inflation.[11] Wie anpassungsfähig die Menschen der damaligen Zeit sein mussten, zeigte sich auch in der Familie meiner Großeltern und deren Verwandten. Die Lebenserinnerungen meines Vaters geben dafür sehr anschaulich Beispiele.
2.3 Die Familien passen sich der neuen Lebenssituation an
Gegen den Fleischmangel hielt sich die Familie meiner Großeltern zunächst Karnickel, die auch „Kuhhasen“ genannt wurden. Die Zucht meines Vaters umfasste zeitweise bis zu 25 Tiere, die er in vier Ställen und zum Teil auch im Ziegenstall untergebracht hatte. 1914 hatte die Familie zunächst mit den Verwandten zusammen einige Schafe gehalten, die im Gut standen. Dann baute mein Großvater einen Schweine- und Ziegenstall, wobei ihm mein Vater tatkräftig mithalf. Kartoffeln und Rüben wurden auf den Feldern mit angebaut. Da die Bewirtschaftung drohte (die staatliche Lenkung der Gütererzeugung und Güterverteilung), war der Garten zusätzlich von großer Bedeutung. Heu holte die Familie von ihren Wiesen. Bald wurde aber auch das knapp, da Futtermittel mit unter Markenzwang kamen. Später zogen die Lehrer mit ihren Schülern zum Laubsammeln in die Wälder, streiften junge Blätter von den Bäumen und schafften so neuen „Ersatz“. Außerdem wurden Kastanien und Eicheln gesammelt, was auch mit der Zeit für die eigene familiäre Landwirtschaft erforderlich wurde. Zuerst schaffte man sich zwei Läuferschweine an und dann eine Ziege. Wie sich bald zeigte, war sie eine alte Großmutter und gab daher nicht genug Milch. Sie wurde von zwei weißen, hornlosen Saanerziegen, die aus einer Schweizer Zucht stammten, abgelöst. Die Hühnerzucht wurde mit dem Ankauf einer „Glucke“ bei der Nachbarin Schenkern begonnen. Sie brachte zunächst eine muntere Schar von „Mistkratzern“ hervor, denen in den folgenden Jahren erst gelbe Italiener und dann die großen, schweren Langshanhühner folgten. Die alte „Glucke“ hat, hoch geehrt als die Stammmutter der Zucht, viele Generation überdauert. Die Hühner verwüsteten bald den Garten, kratzten überall herum, fraßen die Äpfel und zwangen die Familie, einen hohen Drahtzaun um den Gemüsegarten zu errichten. Aber es kam Leben auf den Hof. Für die Kinder brachte das Suchen entlaufener Hühner, das Gackern beim Eierlegen, das Überwachen der brütenden Hennen und die Aufzucht der Küken viel Freude und eine Bindung an die Tiere. Viele Jungtiere stolzierten bis in die Küche hinein. Die Aufzucht und Fütterung der Hühner gehörten bald zu den Pflichten der Kinder. Bald übernahm mein Vater die Einrichtung der Brutnester und die Überwachung des Brütens bis zur Hilfe beim Schlüpfen der Küken. Dazu kam das Heranholen der Futtermittel. Die Zuteilungen mussten in der Altstadt mit dem Handwagen geholt werden. Als das Futtermittel mit der Länge des Krieges immer weniger wurde, beherrschte das kleine Rittergut noch mehr das Leben der großelterlichen Familie. Täglich wurden Schweine, Ziegen, Hühner und Karnickel dreimal gefüttert. Solche Pflichten brachten für die Kinder eine feste Tageseinteilung. Die Ställe mussten gerichtet werden, im Winter gegen Kälte geschützt und jede Woche ausgemistet werden. Auf dem Küchenherd standen oft übelriechende Kessel mit Futterkartoffeln und Rüben. In der kalten Jahreszeit wurde das Futter auch in der Küche oder im Keller zubereitet. Morgens vor dem Schulgang musste mein Vater mit beim Füttern helfen und Heu sowie Grünfutter herbeischaffen. Seine Schwestern halfen beim Ziegenhüten. Annemarie Mathilde zog, Vokabel lernend, mit der alten bockigen Ziege bis zur Ziegelei und kam oft genug aufgeregt und weinend zurück, wenn die Ziege ausgerissen war. Wenn an Winterabenden Arbeiten in den Ställen zu verrichten waren, band sich mein Vater eine rußende und stinkende Petroleumlampe vor den Bauch, stieg in die Holzpantoffeln und patschte durch Schlamm und Schnee oder bei Frost und Regen mit den vollen Futtereimern hinaus in den finsteren Garten. Oft musste in stürmischen Wintertagen der Weg erst freigeschaufelt werden und Türen und Fenster der Ställe wurden mit Stroh und Säcken gegen die Kälte verbaut. Mein Vater hatte als Ältester der Kinder seinen festen Pflichtenkreis, der ihn nicht mehr freigab, aber auch in vielem seine Entwicklung still mitbestimmte. Das Gleichmaß und die Unerbittlichkeit der Pflichten zwangen meinen Vater zum Pflichtbewusstsein. Die Arbeiten schränkten seine Freizeit ein und fast täglich musste er das Handwerkszeug in die Hand nehmen. Immer war etwas zu bauen oder auszubessern. Das steigerte seine Handfertigkeit und seine Achtung vor dem Handwerk.
1916 wurde mein Großvater einberufen. Er kam als Unteroffizier zu einem Landsturmbataillon nach Wurzen. Da war nun mein Vater mit 15 Jahren tatsächlich der „Große“, der seiner Mutter zur Seite gestellt wurde und von dem man die „Verständigkeit“ eines Erwachsenen erwartete. Bevor mein Großvater in die Kaserne einrückte, hat er in aller Eindringlichkeit meinem Vater dies „auf die Seele gebunden“. Mein Vater hat diese Mahnung immer ernst genommen, besonders, als später in den Briefen seines Vaters aus dem Kriegsgebiet in Rumänien nie die Ermahnung an die Kinder fehlte, der Mutter zu folgen, und die Ermahnung an den „Großen“ gerichtet war, ihr beizustehen.
An diesem Beispiel zeigt sich wieder einmal: Die ersten Kinder bekommen frühzeitig und ungewollt einen besonderen Pflichtenkreis zugewiesen. Man fragt sie nicht. Man fordert einfach von ihnen, dass sie pflichteifriger, verständiger und zuverlässiger sind als ihre Geschwister. Sie müssen die Kleinen hüten, im Haushalt helfen und die Welt mit den Augen der Erwachsenen sehen, die doch selbst ihre Sorgen damit haben. Eigentlich ist es kein Wunder, wenn sie die jüngeren Geschwister bevormunden oder tyrannisieren oder gegen das Unrecht der ungleichen Lastenverteilung mit der Forderung nach größerem Recht reagieren.
2.4 Die Verantwortung für die Familie wächst
Als mein Großvater im Jahre 1916 Soldat wurde, begannen die spürbaren Einschränkungen. Er kam zum Landsturmbataillion XIX/27 in Wurzen an der Mulde. Als er das erste Mal auf Urlaub kam, bestaunte seine Familie alle Stücke der Uniform. Als mein Vater 20 Jahre später selbst Soldat wurde, roch die Uniform noch genauso. Der Kantor Hense, der genauso alt war wie mein Großvater, war schon vorher einberufen worden. Auch der Nachbar Schwartner, Vater von 8 Kindern, war Landsturmmann. Nun gab es beim Urlaubszusammentreffen hochpolitische Gespräche über die Siegesaussichten, wobei Nachbar Schwartner seine Ansichten vehement vertrat. Die älteren Kinder vernahmen es mit Ehrfurcht.
Im Laufe des Sommers besuchte mein Vater seinen Vater in Wurzen. Es war seine erste selbständige Reise und eine sichtbare Anerkennung seiner werdenden Großjährigkeit. Mit einem genauen Reiseplan und einem Paket für seinen Vater reiste er über Leipzig nach Wurzen. Bis Leipzig war mein Vater schon einmal mit 12 Jahren in Begleitung anlässlich der Internationalen Baufachausstellung gekommen. Es war damals das größte Erlebnis dieser Art in seiner Jugend gewesen. Seine Patentante Elisabeth Marie Meyer hatte ihn mitgenommen. Für meinen Vater war es das erste Mal, dass er in einem Schnellzug fuhr, der ihn in der Großstadt Leipzig zum damals größten Bahnhof Europas brachte. Dann betrat er zum ersten Mal ein Hotel und hatte die freie Wahl zwischen Kaffee und Schokolade. Das Angebot von zwei Sorten Marmelade neben der Butter und von Milchbrötchen, zu denen man Butter und Marmelade essen konnte, waren für ihn eine Offenbarung aus einer fremden Welt. Bei ähnlichen Anlässen pflegte mein Großvater zu sagen: „In solch eine Welt kann man gelangen, wenn man gut in der Schule lernt.“
Im Jahre 1913 hatte Leipzig mit der Einweihung des Völkerschlachtdenkmales [12] und der anschließenden internationalen Ausstellung zwei bedeutende Ereignisse gefeiert. Mein Vater hatte das alles aufmerksam in der Zeitung verfolgt. Mein Großvater pflegte das Interesse meines Vaters mit dem Hinweis zu vertiefen, dass er einmal Jahrzehnte später von diesem historischen Ereignis aus eigener Erfahrung werde sprechen können. Auf einmal konnte mein Vater unverhofft an Ort und Stelle alles selbst sehen. Zwei Tage lang wandelte er mit seiner Tante durch die Ausstellungshallen, sah und staunte, erlebte den Vergnügungspark, die Gartenanlagen, die Musterbauten, das Völkerschlachtdenkmal und nicht zuletzt den Verkehr einer Großstadt. Nun fuhr er allein nach Wurzen. In der Tasche trug er eine Skizze seines Vaters, nach der er vom Bahnhof durch den Stadtkern von Wurzen dorthin pilgerte, wo die Straße nach Leipzig die Mulde überquert. Dort lag in den Muldenwiesen das Schützenhaus. Überall auf den Wiesen sah er Soldaten herumlaufen und exerzieren. Es war ein heißer Sommertag. Im Norden zeichnete sich über dem Flachland die „Eilenburger Schweiz“ im Dunst ab. Der Wachposten am Eingangstor, der über den Besuch meines Vaters informiert war, forderte meinen Vater auf, sich neben dem Tor niederzusetzen und zu warten. Nicht allzu weit war in den Wiesen ein Grabenstück ausgebaut, in dem Soldaten umherkrochen. Auf dem Grabenwall stand breitbeinig ein Befehlshaber, der die Gruppe kommandierte. Von Zeit zu Zeit brüllte er: „Reißt --- puff!“ Dann flogen einige Übungshandgranaten aus dem Graben. Als mein Vater diesem Treiben eine Weile zugesehen hatte, winkte ihm der Ausbilder zu. Und dann erkannte mein Vater seinen Vater. Bald rückte die Kompanie ein und sein Vater kam auf ihn zu. Da stand er mit staubigen Stiefeln und braungebranntem Gesicht vor seinem Sohn. Als er die Feldmütze abnahm, war die obere Hälfte der Stirn weiß. Sie gingen in eine Baracke, in der einige Unteroffiziere auf Feldbetten lagen. Erstaunt sah mein Vater dem Treiben zu, wie die Kompanie zum Essensempfang antrat und wie ein junger Unteroffizier von der Tür aus einige Männer anpfiff. Als der Dienst vorbei war, gingen Vater und Sohn in das Stadtzentrum von Wurzen, wo für meinen Vater ein Zimmer gemietet worden war. Am nächsten Tag, einem Sonntag, spazierte er mit seinem Vater durch Wurzen und über die Muldenwiesen am Schützenhaus. Es war für ihn alles sehr beeindruckend.
1917 kam mein Großvater als Soldat ins Feld. Wegen seiner Schwerhörigkeit und seiner sechs Kinder war er mehrmals zurückgestellt worden. Aber nun brauchte man auch die alten Landsturmjahrgänge. Eines Tages standen meine Großmutter und ihre sechs Kinder mit der Familie eines Kameraden meines Großvaters auf dem Plauener Bahnhof, um meinen Großvater nach seinem letzten Sonntagsurlaub zu verabschieden. Meinem Vater war die Bedeutung dieser Stunde sehr wohl bewusst. Sein Vater gab sich sehr unbefangen, während sein Kamerad sehr traurig war. Als es dann hieß „Einsteigen!“ und die beiden Frauen anfingen zu weinen, bekam auch mein Großvater feuchte Augen. Er sagte mit fester Stimme: „Wir kommen ja wieder.“ Dann gab er seiner Familie noch schnell gute Ermahnungen mit, bevor der Zug sich in Bewegung setzte. Ein letztes Winken und der Zug verschwandt aus den Blicken der Zurückgebliebenen. In diesem Augenblick hatte mein Vater das Gefühl einer neuen Aufgabe und Verpflichtung. Er nahm einen neuen Platz in der Familiengemeinschaft ein. Mit einem Male stand mein Vater in der Pflicht, abends das Haus zu verschließen, vor dem Schlafengehen die Türen noch einmal zu überprüfen und sie morgens wieder zu öffnen. Er nahm die Mietzahlungen der Mieter an und führte darüber Listen, die sein Vater angelegt hatte. Er übernahm die Zahlung der Hypothekenzinsen und führte Verwaltungsaufgaben für die großelterlichen Häuser aus. Kurzum, er stand mit der bescheidenen Erfahrung eines Sechzehnjährigen mit einem Male in einem festen Pflichtenkreis. Doch damit wuchs auch sein Selbstvertrauen.
Ein Erlebnis aus dieser Zeit blieb ihm besonders in Erinnerung. Im Herbst 1917 fuhr er mit dem Einspänner, dem guten, alten Pferd, das noch im Stall des Gutes stand, nach der einsam liegenden Radrennbahn in Kauschwitz, um Holz zu holen. Es war nicht leicht, aus dem schmalen Zufahrtsweg durch das Tor ins Grundstück einzubiegen. Es war schon spät am Nachmittag. In der Ferne bahnte sich ein Gewitter an. Das Pferd wurde unruhig und wollte heim. Als mein Vater es beim Holzaufladen für einen Moment losließ, zog es unversehens an und der Wagen verkeilte sich an einem Baum. Das Tier konnte sich weder vorwärts noch rückwärts bewegen. Kein Zureden half. Mein Vater verlor in dieser Situation allen Mut. Er war hilflos. Das störrische Pferd am Zügel fing er an zu weinen. Doch dann machte er sich bewusst, welche Pflicht er hatte. Er hörte seinen Vater sagen, dass er doch nun ein „großer Kerl“ sein müsste. Und mit einem Male klappte es. Das Pferd parierte wieder, mein Vater kam mit der Fuhre trotz des drohenden Gewitters gut durch das Tor und fuhr auf der Pausaer Straße in Richtung Haselbrunner Straße Trab. Das Pferd zog es nach dem Stall.
2.5 Das Kriegsjahr 1917
Das Jahr 1917 war das Hungerjahr des Ersten Weltkrieges. Die Kartoffeln reichten für die Ernährung der Bevölkerung nicht aus. Kohlrüben wurden mehr und mehr zur Ernährung eingesetzt. Der „Kohlrübenwinter“ [13] wurde in den dicht besiedelten Gebieten Deutschlands zu einer traurigen Berühmtheit. Auch für die siebenköpfige Familie meiner Großmutter reichten die Kartoffeln nicht mehr aus. Immer öfter wurden sie mit den ekelhaft schmeckenden Rüben vermischt. Die Lebensmittelzuteilungen wurden immer geringer. Die Marmelade bestand nur noch aus gefärbtem Rübenbrei. Die Margarine glich dem Schuhfett. Die merkwürdigsten Rezepte wurden erfunden und weitergegeben, um alles essbar zu machen. Das Brot langte nicht vorne und nicht hinten.