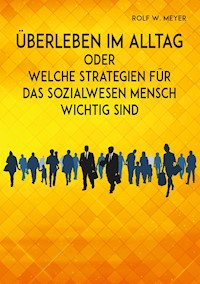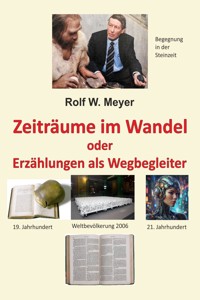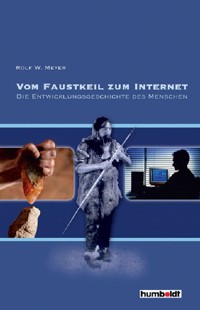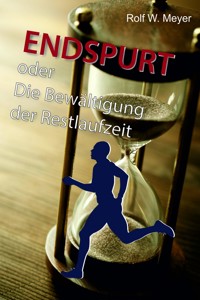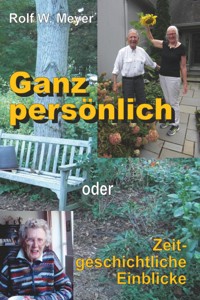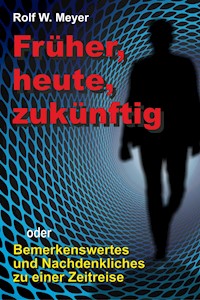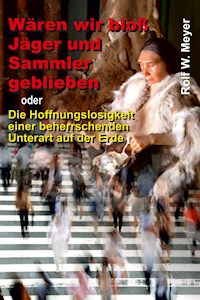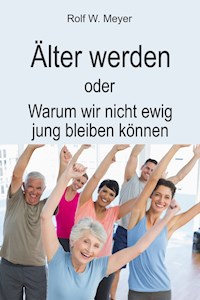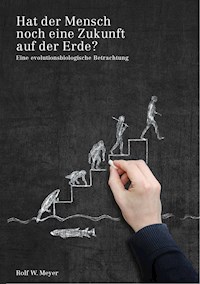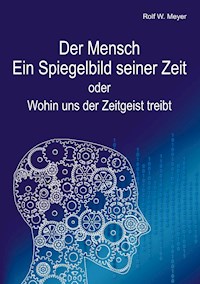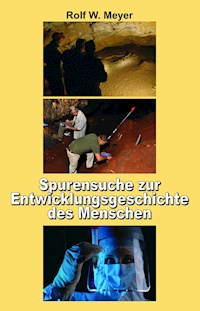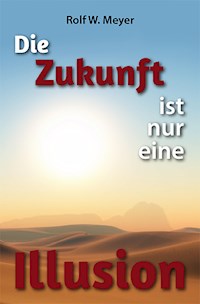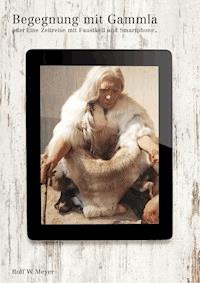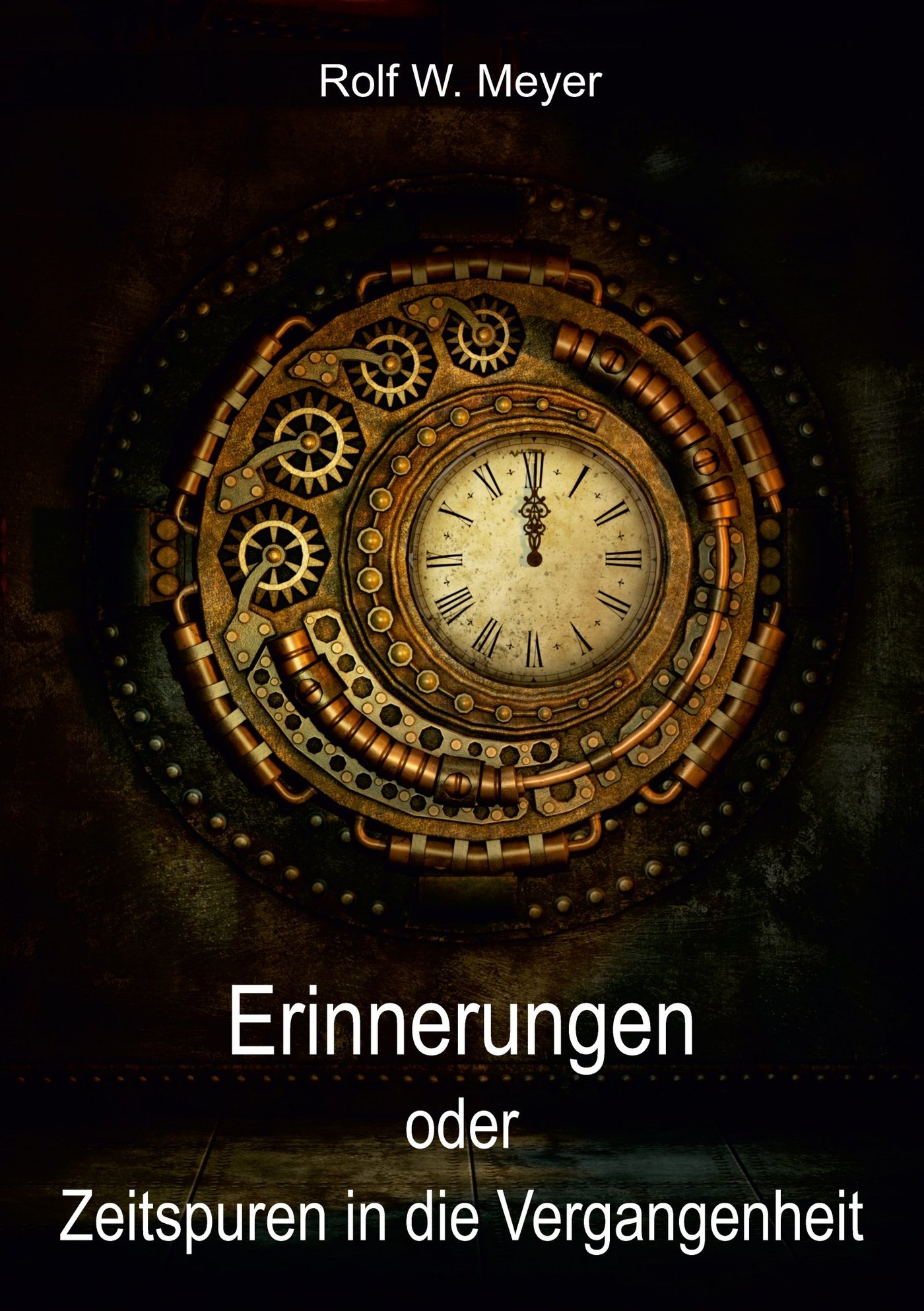
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Wenn man älter wird, nimmt die Erinnerung an die Vergangenheit in den eigenen Gedanken einen immer größeren Raum ein. Der alternde Mensch, dessen Erwartungen von der Zukunft geringer werden, kehrt gleichsam den Blick öfter als zuvor rückwärts. In der größeren Besinnlichkeit, mit der er das Leben betrachtet, werden Bilder vergangener Jahrzehnte, Bilder seiner Mitmenschen, die ihn begleitet haben, und Bilder seiner Erlebnisse aus weit zurückliegenden Zeiträumen deutlicher. So träumt der alternde Mensch von seiner Kindheit und sieht sich in Räumen und an Orten, die aus seiner Gegenwart seit langem entschwunden sind. Diese Erkenntnis aus eigener Erfahrung hat den Autor dazu angeregt, ein Buch über den Bezug zwischen Älterwerden und Erinnerungen an die Vergangenheit zu schreiben. Zusätzliche Bezugsquellen zu diesem Thema waren für ihn Dokumente aus verschiedenen verwandtschaftlichen Nachlässen in Form von alten Briefen und anderen Hinterlassenschaften aus mehreren Generationen. Die "Zeitspuren in die Vergangenheit" sind nicht nur für den Autor und dessen Lebensphilosophie bedeutsam. Es werden auch die Leserinnen und Leser dieses Buches mit einbezogen, indem jedes Kapitel mit einer Auflistung historischer Ereignisse eingeleitet wird, die für jeden von Interesse sein kann. Die Texte vermitteln eine Fülle an Informationen und geschichtlichen Hintergründen, die das Leben aus den Generationen der Eltern, Großeltern und Urgroßeltern beschreiben. Durch diese "Zeitzeugen" wird etwas bewahrt, das unter Umständen irgendwann vergessen sein wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 321
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rolf W. Meyer
Erinnerungen
oder
Zeitspuren in die Vergangenheit
Rolf W. Meyer
Erinnerungen
Copyright: © 2020 Rolf W. Meyer
Umschlagfoto: Rolf W. Meyer
Umschlag & Satz: Erik Kinting | www.buchlektorat.net
Konvertierung: sabine abels | e-book-erstellung.de
Die Aufnahmen von Familien und Einzelpersonen sowie weitere im Buch verwendete Abbildungen stammen ausschließlich aus den Nachlässen von C. F. Otto und Edith Meyer, Düsseldorf, sowie von Johanna Meyer, Plauen im Vogtland.
Druck: epubli, ein Service der neopubli GmbH, Berlin
Für meine Familie und für die Menschen weltweit, die in nahezu acht Jahrzehnten für meinen Lebensweg so wichtig gewesen sind.
„Das Alter hält immer Rückschau – im Traum, in den schlaflosen Stunden. Das Alter lebt sozusagen rückwärts. Man hätte Anlass, alle denkwürdigen Geburtstage und die Umstände, unter denen sie erlebt wurden, aufzuzeichnen. Es ist eine bunte Reihe merkwürdiger Erlebnisse, schöne und weniger schöne Erinnerungen.“
C. F. Otto Meyer (1901–1977)
Vorwort
Wenn man älter wird, nimmt die Erinnerung an die Vergangenheit in den eigenen Gedanken einen immer größeren Raum ein. Der alternde Mensch, dessen Erwartungen von der Zukunft geringer werden, kehrt gleichsam den Blick öfter als zuvor rückwärts. In der größeren Besinnlichkeit, mit der er das Leben betrachtet, werden Bilder vergangener Jahrzehnte, Bilder seiner Mitmenschen, die ihn begleitet haben, und Bilder seiner Erlebnisse aus weit zurückliegenden Zeiträumen deutlicher. So träumt der alternde Mensch von seiner Kindheit und sieht sich in Räumen und an Orten, die aus seiner Gegenwart seit langem entschwunden sind. Diese Erkenntnis aus eigener Erfahrung hat mich dazu angeregt, ein Buch über den Bezug zwischen Älterwerden und Erinnerungen an die Vergangenheit zu schreiben. Zusätzliche Bezugsquellen zu diesem Thema fanden sich in der alten Familientruhe, die ich vererbt bekommen hatte. Im Laufe vieler Jahrzehnte waren in ihr Dokumente aus verschiedenen verwandtschaftlichen Nachlässen eingelagert worden. Bei deren Durchsicht fanden sich eine Vielzahl alter Briefe und andere Hinterlassenschaften aus mehreren Generationen. Für die Hinterbliebenen ist die Entscheidung über die Vernichtung solcher Nachlässe oder deren Aufbewahrung als Familiendokumente nicht immer einfach. So kann etwa die Scheu vor der Erinnerung an einen Menschen, der einem nahe stand, zu dem Entschluss führen, Briefe zu vernichten.
Die Erfahrung zeigt, dass es für jemanden, der nach Jahrzehnten Mitteilungen von Vorfahren liest, schwer ist, alte Briefe richtig zu verstehen. Dazu müssen nämlich historische Umstände und verwandtschaftliche Verhältnisse berücksichtigt werden. Sofern es sich in Briefen um rein persönliche Belange handelt, sollten diese Dokumente mit besonderem Verständnis und Einfühlungsvermögen gelesen werden. Anderenfalls können leicht oberflächliche Urteile entstehen. Auch sollten längst vergangene personenbezogene Geschehnisse mit Abstand betrachtet werden und einer anderen Generation keinen Anlass zu falschen Beurteilungen geben. Urteile über ein ganzes Leben eines Vorfahren können verständlicherweise nur von einem Menschen in fortgeschrittenem Alter gegeben werden, wenn er die Vergangenheit selbst erst als Geschichte begreift und die betreffende Person mit den damaligen Zeitumständen in Verbindung bringt.
Die „Zeitspuren in die Vergangenheit“ sind nicht nur für den Autor und dessen Lebensphilosophie bedeutsam. Es werden auch die Leserinnen und Leser dieses Buches mit einbezogen, indem jedes Kapitel mit einer Auflistung historischer Ereignisse eingeleitet wird, die für jeden von Interesse sein kann. Die Texte vermitteln eine Fülle an Informationen und geschichtlichen Hintergründen, die das Leben aus den Generationen der Eltern, Großeltern und Urgroßeltern beschreiben. Durch diese „Zeitzeugen“ wird etwas bewahrt, das unter Umständen irgendwann vergessen sein wird. Die Anmerkungen am Ende des Buches erklären Namen und Sachverhalte, soweit sie von historischer Bedeutung sind.
Rolf W. Meyer, Ratingen
„Wir alle wollen wissen, wer wir sind und woher wir kommen. Ganz gleich, was wir im Leben erreichen, ohne diese Klarheit bleibt eine Leere in uns, ein Gefühl der Wurzellosigkeit.“
Alex Haley (1921–1992)
1 Die Suche nach dem familiären Ursprung
Geschichtliche Ereignisse:
1730
Im August erscheint die erste schriftliche Erwähnung der Schildhornsage durch Jacob Paul von Gundling.
1731
Am 2. Februar wird die Oper Poro von Georg Friedrich Händel auf ein Libretto von Pietro Metastasio in London uraufgeführt.
1739
In Frankreich kommt es aufgrund von Hungersnöten immer wieder zu Unruhen. Diese Unruhen fördern die Entwicklung der Aufklärung und unterstützen den Gedanken an eine demokratische Lebensweise, die durch die französische Revolution erst Jahre später durch den Sturm auf die Bastille 1789 durchgesetzt werden konnte und zum Fall der Monarchie und des Absolutismus führte.
Der Stamm Meyer lässt sich nur bis zum Anfang des 18. Jahrhunderts zurückverfolgen. Am 2. August 1730 kaufte der Meister Andreas Meyer, der Einwohner in Ritteburg war, vor dem königlich – polnischen und kurfürstlich – sächsischen Sequestrationsamt Artern von der Witwe Sophie Dorothea Meyer für 300 Thaler Hof, Garten, Haus, Scheune, Stall und Land. Am 6. Februar 1731 erwarb er für 206 Reichsthaler und 21 Groschen Ländereien an Äckern und Wiesen.
Ritteburg liegt bei Artern an der Unstrut, einem linken Nebenfluss der Saale. Es gehörte um 1700 zum „Manfeldschen Kreis“ des Kurfürstentums Sachsen und befindet sich im östlichen Teil der fruchtbaren „Goldenen Aue“, dem Helmetal nördlich des Mittelgebirges Kyffhäuser.
Dies war der historische Boden der Schlacht bei Riade, bei der ein militärisches Aufgebot unter dem Befehl von König Heinrich I. (876–936) gegen ein größeres Heer von Magyaren (Ungarn) gekämpft hatte. Historiker vermuten Riade im Kalbsriether Ortsteil Ritteburg an der Mündung der Helme, einem linken und westlichen Zufluss der Unstrut.
Die zersplitterte Grafschaft Mansfeld war bereits im 15. Jahrhundert in die lehensrechtliche Abhängigkeit der Wettiner gekommen. Zunehmende Verschuldung der durch den Bergbau einst reichen Grafen führte 1570 im Vertrag von Leipzig zu einer Sequestration (Zwangsverwaltung) durch den Kurfürsten August von Sachsen (1526–1586) und durch die geistlichen Landesherrschaften Magdeburg und Halberstadt. Damit gingen wesentliche Bestandteile der Landesherrschaft auf die Sequestrationsmächte über. Schließlich erwarb der Kurfüst August von Sachsen im Jahre 1573 auch die Halberstädter Hoheits- und Lehensrechte. Damit wurde dieser östliche Teil der Goldenen Aue kursächsisches Gebiet.
Über die Herkunft von Andreas Meyer war nichts Genaueres zu ermitteln. Er wird vermutlich im letzten Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts geboren sein, ist aber wahrscheinlich nach Ritteburg zugewandert, da er dort im Kirchenbuch nicht verzeichnet ist. Aus dem Traueintrag von 1762 für seinen ältesten Sohn Johann Gottfried Meyer (geboren am 15. April 1717) kann entnommen werden, dass dieser in Wolferstedt, gelegen zwischen Ritteburg und Eisleben, geheiratet hat. Im Taufeintrag des sechsten Kindes von Andreas Meyer, seinem Sohn Johann Michael Meyer (geboren am 28. Mai 1730), wird der Vater als „Meister Andreas, der Schäfer“ bezeichnet. An anderer Stelle wird er als „Kesslerischer Schäfer“, als „Schafmeistert“ (1732) oder „Pachtinhaber des Kesslerischen Gutes“ beschrieben. Auf Grund seines Landerwerbes heißt er später „Einwohner“. Andreas Meyer starb am 9. November 1739 und wurde dort am 11. November 1739 begraben. Die Frau von Andreas Meyer war Maria Christiane geborene Schmied, die am 6. April 1772 in Ritteburg verstarb. Aus der Ehe waren sieben Kinder hervorgegangen.
Historisch interessant ist, dass die Schäferei schon vor dem Dreißigjährigen Krieg (1618–1648) und bis in das 18. Jahrhundert hinein in hoher Blüte stand. Die Schafwirtschaft war bedeutungsvoller als die Pferde- und Schweinezucht. Daher genoss der Schäfer höheres Ansehen als andere Hirten. Schäfer brachten es oft zu beträchtlichem Wohlstand und bewirtschafteten Güter nur mit großen Schafherden. Schafwolle war ein wertvoller Rohstoff gewesen. In der Mitte des 19. Jahrhunderts führte die Ablösung und Aufhebung der Weiderechte, vor allem in Wäldern, und der Verfall der Wollpreise mit dem Aufkommen der Baumwolle allerdings zum Niedergang der Großschäferei.
Die Bezeichnung „Meister“ ist nicht im Sinne des modernen Gewerberechts zu verstehen. Sie ist eine allgemeine Bezeichnung, die Berufen zugesetzt wurde. „Keßlerischer Schäfer“ wird bedeutet haben, dass Andreas Meyer ein einstmals herrschaftliches Gut einer Familie dieses Namens in Pacht oder Lehn bewirtschaftete oder auch der Schafmeister des Gutes in dessen Dienst war.
Das sechste Kind von Andreas Meyer, sein Sohn Johann Michael Meyer (1730–1796), lebte in Ritteburg als Landwirt und war zweimal verheiratet gewesen. Seine Ehefrau in zweiter Ehe war Christiane Augustine (1755–1814), die Tochter des Pachtschäfers Johann Andreas Werfel aus Unterröblingen. Sie hatten, mit dem Kind aus der ersten Ehe, sieben Kinder, unter deren Paten wiederholt Schäfer genannt werden.
Das sechste Kind aus der zweiten Ehe, Johann Gottlob Meyer (1789–1861) wurde Müller. Er verließ, offenbar dem Wandertrieb dieses Handwerks folgend, die Heimat und heiratete am 14. Januar 1820, in Markleeberg bei Leipzig die 28jährige Tochter Johanna Magdalene des „Pferdners und Nachbarn“ Johann Daniel Otto aus Beucha bei Borna, der ein gelernter Brauer war. Johann Gottlob Meyer muss es zu Wohlstand gebracht haben, denn schon bei der Geburt seines zweiten Sohnes, Friedrich Otto (1830–1901), ist er Pachtmüller in Markleeberg. Seit etwa 1850 hat er das Rittergut Probstdeuben als Pächter bewirtschaftet. 1863 wird er als Rittergutspächter in Probstdeuben bezeichnet. Johann Gottlob Meyer verstarb im Alter von 72 Jahren in Probstdeuben, seine Frau Johanna Magdalene im Alter von 76 Jahren in Herlasgrün. Der zweite Sohn von Johann Gottlob und Johanna Magdalene Meyer, Friedrich Otto Meyer, war mein Urgroßvater.
Nebenbei bemerkt
Der Familienname Meyer tritt allein in den Kaufverträgen mehrmals auf (Sophia Dorothea Meyer, Hausvogt Jakob Meyer). 1713 werden als Paten der Gemeindebäcker Hans Jakob Meyer und die Witwe Maria des Christian Meyer genannt. 1936 war in Ritteburg noch ein Landwirt mit dem Namen Friedrich Meyer (geboren 1879) ansässig, der zwei Brüder hatte (geboren 1887 und 1892). Von ihnen kam der Hinweis, dass „nach mündlicher Überlieferung die Vorfahren aus Schlesien gekommen seien“.
„Vielleicht wirken die Taten und Leiden der Vorfahren noch in ganz anderer Weise auf unsere Gedanken und Werke ein, als wir Lebenden begreifen. Aber es ist eine weise Fügung der Weltordnung, daß wir nicht wissen, wieweit wir selbst das Leben vergangener Menschen fortsetzen, und daß wir nur zuweilen erstaunt merken, daß wir in unseren Kindern weiterleben.“
Gustav Freytag (1816–1895)
2 Wie die Vorfahren gelebt haben
Geschichtliche Ereignisse:
1839
Das preußische Regulativ vom 9. März über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in den Fabriken verbietet Kinderarbeit vor Vollendung des neunten Lebensjahres. Es gilt als das erste deutsche Gesetz zum Arbeitsschutz.
1864
Am 13. November wird die Liberty Party als erste Partei der Anti-Sklaverei-Bewegung in der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika gegründet. Theodor Schwann und Matthias Jakob Schleiden begründen die Zelltheorie.
1883
Der erste Teil von Friedrich Nietzsches dichterisch – philosophischem Werk „Also sprach Zarathustra“ erscheint.
1899
Am 11. August eröffnet Kaiser Wilhelm II. den Dortmund-Ems-Kanal. Das östliche Ruhrgebiet hat damit einen Schiffsweg zur Nordsee.
1910
Am 20. Dezember kann Ernest Rutherford den experimentellen Nachweis von Atomkernen erbringen.
1920
Am 10. Januar tritt der Friedensvertrag von Versailles in Kraft.
2.1 Vorfahren väterlicherseits
Johann Friedrich Fischer war mein Ururgroßvater. Er kam 1806 in Löbnitz zur Welt. Diese Ortschaft liegt an der Mulde, einem linken Nebenfluss der Elbe, zwischen der Leipziger Tieflandsbucht und der Dübener Heide. Als Siebenjähriger hatte er in Stöhna den Durchmarsch preußischer Truppen erlebt, die im Herbstfeldzug 1813 im Rahmen der Freiheitskriege gegen die Vorherrschaft Frankreichs unter Napoleon Bonaparte in der Völkerschlacht bei Leipzig eingesetzt wurden. Diese militärische Schlacht, die vom 16. Bis 19. Oktober 1813 geführt wurde, war die Entscheidungsschlacht der Freiheitskriege, auch Befreiungskriege genannt. Napoleon Bonaparte musste damals seine Truppen über den Rhein zurückziehen.
Mein Ururgroßvater Johann Fischer hatte den Beruf eines Huf- und Waffenschmiedes gelernt und viele Jahre in Stöhna ausgeübt. Auf Wanderschaften war er weit herumgekommen. Von dem ersparten Kapital lebte er später bei seiner Tochter Friederike Liberta in den vogtländischen Ortschaften Herlasgrün und Haselbrunn. Erwähnenswert ist, dass der Bau der Bahnstrecke Leipzig – Plauen – Hof von 1846 bis 1851 die Ortschaft Herlasgrün und das Leben seiner Einwohner gravierend verändert hatte. 1846 begann nämlich die Sächsisch-Bayerische Eisenbahn-Compagnie mit dem Bau von zwei Brücken, die die geplante Bahnstrecke Leipzig – Hof ermöglichen sollten: die Göltzschtalbrücke (sie ist die bisher größte Ziegelsteinbrücke der Welt) und die Elstertalbrücke. 1847 übernahm die Sächsisch-Bayerische Staatseisenbahn den Weiterbau und stellte am 15. Juli 1851 beide Brücken gleichzeitig fertig. An diesem historischen Bau der Göltzschtalbrücke hatten mein Ururgroßvater und seine Tochter Friederike Liberta mit gut verdient. Denn in der Nähe der Baustelle hatten Vater und Tochter die Bauarbeiter verköstigt und so den Grundstein für ein Vermögen gelegt.
Von Herlasgrün aus lief Johann Fischer nach Art eines Schmieds in Lederpantoffeln bis nach Reimersgrün. Von Haselbrunn aus fuhr er noch in den 1880er Jahren mit der Eisenbahn in der 4. Klasse (wobei er einen Feldstuhl benutzte, da es dort keine Sitzplätze gab) nach Lucka im Altenburger Land. Von dort aus wanderte er nach Leipzig zur Messe, um seinen Tabakbedarf (einen ganzen Sack voll) einzukaufen. Am 2. März 1888 verstarb mein Ururgroßvater in Haselbrunn.
Urgroßeltern Friedrich Otto Meyer und Friederike Liberta Meyer geb. Fischer
Friedrich Otto Meyer, der 1830 in Markkleeberg bei Leipzig zur Welt kam, war mein Urgroßvater. Er erlernte den Beruf eines Landwirtes („Ökonom“). Die Lehrzeit erfolgte von 1845 bis 1849 in Probstdeuben, die er 1849 bis 1854 auf einem Gut bei Bautzen fortsetzte. 1855 kehrte er nach Probstdeuben zurück, wo sein Vater Johann Gottlob Meyer ein Rittergut zur Pacht übernommen hatte. 1863 heiratete er die 24jährige Tochter Friederike Liberta des Huf- und Waffenschmiedes Johann Friedrich Fischer in Stöhna bei Leipzig. 1864 kaufte mein Urgroßvater einen Landgasthof, den „Sächsisch-Bayerischen Hof“, im vogtländischen Herlasgrün. Dieser Landgasthof befand sich unmittelbar am Bahnhof Herlasgrün an der Bahnstrecke Leipzig-Hof, etwa 10 km südlich von Reichenbach. Da der Bahnhof Umsteigeort für die Bahn-Nebenstrecke Herlasgrün – Treuen – Auerbach war, hatte er größeren Fremdenverkehr.
1883 erwarb mein Urgroßvater das Vorwerk Haselbrunn bei Plauen im Zusammenhang mit einer Zwangsversteigerung für 62.500 Mark und zog mit der Familie dorthin. Zu dem Vorwerk, einem landwirtschaftlichen Gutshof, gehörten nicht nur ein umfangreicher Besitz an Weiden und Feldern, sondern auch eine Ziegelei im Heidenreich, nördlich der Bahnlinie Plauen – Leipzig. Vor dem Verkauf der „Hut“ hielt man auf dem Gut 30 Stück Vieh. In einer ungewöhnlich schnellen Entwicklung ihrer Industrie dehnte sich die Stadt Plauen immer mehr nach Norden aus. Dies führte zu einer unerwarteten Wertsteigerung der Grundstücke in Haselbrunn als Baugrund. So verkaufte mein Urgroßvater um 1890 70.000 qm Weideland an der „Rußhütte“ für 145.000 Mark und baute davon die Ziegelei aus. Ihre Erzeugnisse konnten nicht nur in Plauen, sondern auch in der ländlichen Umgebung abgesetzt werden. Am 1. Januar 1899 wurde Haselbrunn nach Plauen eingemeindet. Friedrich Otto Meyer, der in seinen letzten Lebensjahren einen Backenbart nach Kaiser Wilhelm I. trug, war im Gemeinderat des Dorfes Haselbrunn gewesen und hatte den Eingemeindungsvertrag mitunterzeichnet. Er starb 1901 an einem Herzschlag.
Friederike Liberta Meyer geborene Fischer, die einzige Tochter des Huf- und Waffenschmieds Johann Friedrich Fischer, war meine Urgroßmutter. Sie kam im März 1839 in Stöhna zur Welt. Sie war die treibende Kraft eines mehrmaligen Ortswechsels mit ihrer Familie, der mit einem sichtbaren Vermögenszuwachs verbunden war. Auch im Haselbrunner Unternehmen „Meyers Gut“ war sie der Mittelpunkt der Familie. Nach dem Tod ihres Mannes führte sie das Unternehmen mit Tatkraft weiter. Die umfangreichen Grundstücke um das „Meyers Gut“ herum (schon 1910 wird es in der Garnisonumgebungskarte so genannt) werden beschleust, die Haselbrunner Straße (in Gemeinschaft mit dem Nachbarn Roßbach) und die Hans-Sachs-Straße ausgebaut. In der Haselbrunner- und in der Morgenbergstraße werden in den ersten Jahren des neuen Jahrhunderts im Verlauf der „Blütezeit“ von Plauen einige Wohnhäuser als Spekulationsbauten finanziert. 1905 schloss meine Urgroßmutter des gesamten Grundstücks- und Ziegeleibesitz, der damals mit 1.300.000 Mark bewertet wurde, in den „Meyer’s Ziegelwerken GmbH“ zusammen. Zu den Gesellschaftern machte sie ihre vier Kinder. Ihre Söhne Friedrich Otto (mein Großvater) und Friedrich Albert wurden Geschäftsführer. Den Erwerbspreis der Grundstücke durch die GmbH stundete sie zinslos gegen die Eintragung von unkündbaren Hypotheken in der Höhe des Erwerbspreises. Auf diese Weise band sie ihre Kinder zusammen und diese an die Gesellschaft. Meine Urgroßmutter hatte die Ansicht vertreten: „Wer nicht mitmacht, wird enterbt!“ Ihre Geschäftsgewandtheit wurde nicht dadurch behindert, dass sie nur schlecht und nicht orthographisch richtig schreiben konnte. Auf der anderen Seite war sie tatkräftig, rührig, geschäftstüchtig, auf der anderen Seite konnte sie herrschsüchtig und oft auch rechthaberisch auftreten. Menschen, die mit ihr zu tun hatten, sahen überwiegend ihre positiven Charaktereigenschaften. So äußerte sich beispielsweise ein Notar, der mit ihr beruflich zu tun gehabt hatte: „Eine tüchtige Frau, die wusste, was sie wollte. In ihren Geschäften war sie weitblickend und großzügig.“ Von einem alten Schweizer, der auf ihrem Gut gearbeitet hatte, kamen die anerkennenden Worte: „Früh die Erste und abends die Letzte, … aber anständig zum Gesinde.“ Meine Urgroßmutter hielt sich Kutsche und Pferd und fuhr in ihren letzten Lebensjahren mit der Gummikutsche in die Stadt Plauen. 1906 verstarb sie in Haselbrunn.
Großeltern Friedrich Otto Meyer und Emma Elise Meyer geb. Baumann
Friedrich Otto Meyer, der 1872 in Herlasgrün im Vogtland im „Sächsisch-Bayerischen Bahn-Gasthof“ seiner Eltern zur Welt kam, war mein Großvater. Er besuchte die Schule in Limbach und kam 1883 nach Haselbrunn, als seine Eltern das Gut in Haselbrunn erwarben. Nach dem Besuch der Realschule in Plauen lernte er das Maurerhandwerk bei dem Maurerobermeister Friedrich Gustav Richter in Plauen und legte 1890 vor der Innung der Baugewerksmeister in Plauen die Gesellenprüfung ab. Als Maurergeselle arbeitete er in Elberfeld, Braunschweig und in Auerbach. In Großenhain und in Elsterberg (bei der Firma Piehler) arbeitete er als Bautechniker. 1899 legte er in Plauen die Maurermeisterprüfung und danach die staatliche Baumeisterprüfung ab. Von 1900 an war er als selbständiger Baumeister tätig. So erbaute er 1901 das Garnisonlazarett der Infanterie-Kaserne 134 und in der Folgezeit mehrere Wohnhäuser und Fabrikgebäude in Haselbrunn, das inzwischen nach Plauen eingemeindet worden war: Haselbrunner Straße 108, 110, 112; das Stickereigebäude Körner; die Maschinenfabrik Endesfelder & Weiß; die Eisengießerei Iwan & Winkel. 1903/1904 war er an dem Bau der Radrennbahn in Plauen-Kauschwitz beteiligt. Mein Großvater war Mitgründer der Kirchengemeinde St. Markus in Haselbrunn und Mitglied des Kirchenvorstandes von Anfang an. Während des Kirchenbaues 1912/13 war er Vorsitzender des Bauausschusses. Meine Großeltern stifteten für die Markuskirche den Altar, den Taufstein und ein Kirchenfenster.
Mein Großvater hing am Hergebrachten und war in der Lebensauffassung sowie in der Politik konservativ, zuweilen bis zur Einseitigkeit und in vorgefasster Meinung schwer belehrbar („Das bäuerliche Erbe wirkte nach.“). Sein Wesen war voll Gemüt. Er war sehr musikalisch und seine Lieblingslieder waren: „Traute Heimat meiner Lieben …“, „Nach der Heimat möchte ich wieder …“, „Ein getreues Herze wissen …“. Er war von tiefer und überzeugter Gottgläubigkeit, die ihn in vielem eine Stütze war. 1933 starb er laut betend nach einem Leben voller Sorgen, Mühen und Entsagungen, in dem seine Fürsorge für die Familie stets im Vordergrund stand.
Emma Elise Meyer geborene Baumann wurde 1879 in Elsterberg als 5. Kind meiner Urgroßeltern Christian Friedrich und Mathilde Therese (eine geborene Lenk) Baumann in Elsterberg geboren. Im Familienkreis wurde sie „de Kleene“ genannt. Im kleinbürgerlichen Elsterberg im Vogtland wuchs sie auf, besuchte dort die Schule und erlernte auch das Klavierspiel. Nach der Schulzeit war sie für einige Monate bei einem Geschäftsfreund ihres Vaters in Düsseldorf und in einem „Marthaheim“ in Leipzig, um Hauswirtschaft zu lernen. In Elsterberg lernte sie das Kochen in der Gaststätte „Goldenes Lamm“ am Marktplatz. Mein Großvater verkehrte in dieser Zeit dort. 1901 heirateten meine Großeltern.
Die Zahl der Kinder (zwei Söhne, vier Töchter) kennzeichnete ihren Lebensweg. Sie führte das Leben der Frauen des Bürgertums am Anfang des 20. Jahrhunderts, die, für Familie und Haushalt erzogen, in diesem Pflichtenkreis aufgingen. Meine Großmutter war fleißig, sparsam, wirtschaftlich und offenherzig. Sie hat keine Arbeit in den schweren Hungerjahren des Ersten Weltkrieges gescheut. Sie lebte nur für die Familie. Aus dem kleinstädtischen Haushalt ihrer Eltern in Elsterberg kannte sie Arbeiten des „Ackerbürgers“ aus eigener Erfahrung und führte danach ihren Haushalt. Sie war unermüdlich. Bis zum Ersten Weltkrieg hatte sie das zeit- und standesgemäße „Dienstmädchen“, dann schaffte sie es mit den heranwachsenden Kindern allein. Als ihre Familie in der Not des Ersten Weltkrieges Viehzeug halten musste, wie etwa Hühner, Gänse, Ziegen, Schweine und viele Karnickel, hatte sie auch das bewältigt. Sie konnte schlachten, Wild und Geflügel ausnehmen, backen und verrichtete jede Gartenarbeit. Sie strickte und häkelte, nur das Nähen lag ihr nicht. Sie konnte melken und wusch, als es nicht mehr anders ging, auch die Wäsche für die ganze Familie.
Meine Großmutter bewahrte das Brauchtum und die Lebensgewohnheiten ihrer Eltern. Das war die sparsame und bescheidene Lebensart der erzgebirgischen Ahnen. Ihre ständige Mahnung war: „zusammennehmen“ und „bescheiden sein“. Nichts, was noch verwendbar war, durfte „umkommen“. Sie schnitt kein Brot an, ohne mit dem Messer drei Kreuze darüber zu machen. Den Anschnitt legte sie nie nach der Tür, damit „das Brot im Hause bleibe“. So bewahrte sie manchen kleinen Aberglauben ihrer kleinstädtischen Jugend. Die hohen Feste und besondere Ereignisse, wie zum Beispiel das Stollenbacken, wurden nach überkommenen Regeln und alten Rezepten begangen. So gab es Heringssalat am Heiligen Abend und Hirsesuppe am Silvestertag. Die Karpfenschuppe kam in die Geldbörse, damit das Geld nie ausging und selbst am Sonntag wurden Strümpfe mit dem Kartoffelwasser der grünen Klöße gewaschen, „damit nichts umkommt“. Die „große Welt“ kannte meine Großmutter nicht. Abgesehen von ihrem „Kaffeekränzchen“, einem lebenslangen Freundschaftskreis, lebte sie zurückgezogen in Haselbrunn. Doch sie war gastfrei und recht freigebig. Die Tageszeitung „Vogtländer“ und darin vor allem die „Geschichte“ der Fortsetzungsromane, auch einmal ein Buch, das war ihr bescheidenes Feld. Als ihre Kinder älter wurden, nannten sie ihre Mutter nur „unsere Emm“. Denn sie waren über den häuslichen Rahmen hinausgewachsen.
Auf das Urteil anderer Leute gab meine Großmutter viel. Ihr regelmäßiger Kirchgang in die benachbarte Markuskirche geschah zum wesentlichen Teil „der Leute wegen“ oder „weil jemand aus dem Haus [Haselbrunner Straße 112] in der Kirche sein muss“. Eines ihrer Hauptargumente war: „Was soll denn der Herr Pastor Weidenkaff denken.“ Bei aller Liebe für ihren Mann und ihre Kinder war Zärtlichkeit nicht die Baumannsche Art. Selbst bei herzlichen Anlässen wurden Küsse nicht ausgetauscht. Anders verhielt sie sich ihren Enkelkindern gegenüber. Meine Großmutter starb in der Nacht vom 28. Februar zum 1. März 1947. Noch in den letzten Stunden ihres Lebens bewegte sie der Gedanke, dass ihre Familie und besonders die beiden kleinen Enkelkinder genug zu essen haben werden („Hoffentlich müsst Ihr nie mehr hungern.“).
Über den Tod meiner Großmutter steht in einem Brief ihrer Tochter Magdalene Emma Meyer vom 20. April 1947 geschrieben: „Aufregungen, Entbehrungen und Bombenangriffe [auf Plauen im Jahr 1945] hatten ihr Herzleiden verschlimmert. Der furchtbarste aller Winter [im Jahr 1947] hat ihr das letzte bissel Kraft genommen. Trotzdem hat sie immer wieder gearbeitet, gekocht und geschafft, bis dann Mitte Februar ein schlimmer Herzanfall Mutter zum Liegen zwang.“ Und über das Begräbnis berichtet dieser Brief: „Ich selber musste am Sonntag von Elsterberg nach Plauen laufen, weil keine Züge fuhren. Dieser Weg bleibt mir unvergessen. Über die Dörfer war ungewöhnlich viel Schnee heruntergekommen und die Landstraße war völlig vereist gewesen. Ich bin immer hin und her gerutscht. In Jößnitz kam mir mein Bruder Eitel entgegen. … Das Begräbnis war ein Opfer für alle Teilnehmer in dieser Kälte und bei den schaurigen Zugverbindungen. … Zum Glück war Strom da und die Glocken konnten läuten. … Alle Elsterberger Verwandte und Onkel Fritz Baumann aus Oschatz waren emotional ergriffen, wie wunderbar Pfarrer Kurt Weidenkaff gesprochen hat. Seiner Ansprache lag der Bibelvers zugrunde: „Haltet mich nicht auf, denn der Herr hat Gnade zu meiner Reise gegeben. Lasst mich, dass ich zu meinem Herrn ziehe.“ [1. Mose (Genesis), Kapitel 24, Vers 56] … Särge waren nicht zu bekommen. Der Herr Pfarrer hatte in der Woche vorher 8 Leichen ohne Särge beerdigt. Bei Tischler Haase bekam ich mit Eitel zwar noch einen Sarg, wir mussten ihm aber Kleiderstoffe, die uns die Verwandten aus der Anlauftschen Weberei gegeben haben, als Gegenleistung liefern. Die Leichenhalle ist zum größten Teil zerstört. Feuerbestattungen gibt es nicht. Wir durften Mutter ausnahmsweise bis zum 6. März in der Wohnung aufgebahrt behalten. Jeden Tag die vielen Toten. Sie kamen mit dem Gräberschaufeln nicht nach. Die meisten Toten konnten nur in einem Papiersack der Erde übergeben werden.“
2.2 Kirschen
1910
Die Erzählung aus dem Jahre 1910 stammt von C. F. Otto Meyer, der 1901 in Plauen im Vogtland geboren wurde und 1977 in Düsseldorf verstarb. Verfasst wurde sie von ihm am 1. August 1972.
Wenn die Kirschen auf dem Markt erschienen, ging das Jahr seinem Höhepunkt entgegen. Der Sommer wendete es in den Herbst. Kirschenalleen gab es überall, soweit an Landstraßen Kirschbäume standen. Die Elsterberger Landstraße hinter der „Schöpsdreh“ in Syrau trug Kirschen. War Erntezeit, stand die „Kirschbude“ des Pächters am Straßenrand unter den großen Bäumen. Der Pächter schlief dort in der Reifezeit, um seine Pachtbäume zu bewachen. Immer, wenn die Ernte da war, hatte er dort seinen Verkaufsstand. Die Menschen, die zu seinem Stand kamen, kauften die Kirschen pfundweise. Aus einem Zeitungsbogen, um die Hand geschlungen, war flugs eine Tüte gedreht und schon hatte man 2 bis drei Pfund herrlicher Früchte im Arm. Das war der köstliche Lohn eines Spazierganges: eine Tüte Kirschen. Und sie kosteten wenig. Das war vor dem ersten Weltkrieg, als der Verkehr auf den staubigen Landstraßen gering war und die Ansprüche des Volkes viel bescheidener waren als heute. Man aß das, was das Land hervorbrachte. Vom Assistenten Schmidt kamen die Kirschen in Körben. Der „Herr Assistent“ war ein kleiner, rundlicher Mann. Er war Beamter auf dem Güterbahnhof in Plauen und wohnte neben uns in Haselbrunn in meines Vaters Haus Nr. 108. Seine Frau war größer und dicker als er. Seine Tochter Hella war ein Mädchen mit schwarzem Haar und auch sehr dick. Der „Herr Assistent“ war ein Freund der Kinder auf unserer Haselbrunner Straße. Wo er erschien, mittags vom Dienst kommend und danach gemächlich wieder zum Dienst schreitend, liefen die Jungen und Mädchen auf ihn zu, grüßten und knicksten mit einem „guten Tag, Herr Assistent“ und gaben ihm die Hand. Wer das tat, bekam mit dem Händedruck eine Süßigkeit, einen Zuckerstein oder eine Pfeffernuss in die Hand. Wenn der „Herr Assistent“ eine Hand aus der Tasche zog, war sie gefüllt. Er muss unerschöpfliche Taschen gehabt haben. „Herr Assistent“ Schmidt stand in hohem Ansehen auch bei den Frauen und Müttern unserer Straße. Er vermittelte Esswaren, besonders Obst, das aus beanstandeten Frachtsendungen nicht abgenommen und der Verderblichkeit wegen von der Eisenbahn auf dem Güterbahnhof zu einem sehr günstigen Preis versteigert wurde. Stand da etwas Preiswertes in Aussicht, nahm er in unserer Straße Bestellungen entgegen. So kam es, dass in Weidenkörben Kirschen, abgedeckt mit welkem Laub, angefahren wurden, aber auch Pflaumen, Heidelbeeren, Äpfel und Birnen. Die ganze Straße aß dann Kirschen oder anders Obst, denn keine Hausfrau konnte sich den günstigen Erwerb entgehen lassen. Auch die Kinder konnten essen, bis sie nicht mehr konnten. Und Kirschkuchen gab es auch!
2.3 Erinnerungen an Elsterberg im Vogtland
1921
Die 1914 in Bautzen geborene Eva Mathilde Traulsen geb. Baumann schrieb 1998 auf Wunsch ihrer Kinder die Erinnerungen an die 1920er Jahre auf, in denen sie als junges Mädchen ihre Ferien bei Verwandten im Vogtland verbrachte. Sie starb 2008 in Rendsburg.
Jedes Jahr, wenn die Sommerferien näherkamen, wartete ich aufgeregt auf die Einladung von Tante Anna Heyer aus Elsterberg. Wie oft ich die Sommerzeit dort verbracht hatte, weiß ich nicht mehr. Es war jedenfalls eine unvergessliche Zeit. Anfangs fuhr ich mit meinen Brüdern Fritz und Konrad, später auch allein. Das Kofferpacken war ein Ereignis. Jedes Stück wurde auf einer Liste vermerkt. Der Koffer war aus Stroh, zwei Schalen ineinandergesteckt mit Lederriemen und einem Griff versehen. In Leipzig wurde umgestiegen. Oft trafen wir dort jemanden von den Reichardts, die uns eine Süßigkeit zusteckten. Dann ging es weiter nach Süden. In Reichenbach musste ich wieder umsteigen. Aber hier wartete Onkel Robert Heyer, mit dem ich dann in ein Abteil der 1. Klasse mit roten Samtpolstern umsteigen durfte. Onkel Robert hatte einen Spitzbart. Meistens zauberte er irgendetwas Süßes aus seiner Jackentasche. Vom Bahnhof in Elsterberg ging es dann an der Fabrik des Verwandten Paul Anlauft vorbei über die Elsterbrücke, von wo man die Elsterberger Ruine sehen konnte, auf die Lange Straße hinunter am Café Schenderlein vorbei, zu dem Eisenwarengeschäft C.L. Oschatz am Markt von Elsterberg. Ich klopfte an das Fenster, wo hinter grüner Gaze an einem Stehpult Onkel Otto Baumann stand. Er war der Bruder meines Vaters Christian Friedrich Baumann. Onkel Otto kam heraus und begrüßte mich. Im Laden der Eisenhandlung mit all den Schubkästen, die auf grünem Filz die Muster des Inhalts befestigt hatten, bin ich oft gewesen. Quer über den Markt lief man auf das Wohnhaus der Familie Baumann zu. Es war das Geburtshaus meines Vaters. Jetzt stand Tante Anna Baumann dort zur Begrüßung. Sie hatte eine kleine schwarzhaarige Tochter geboren, die aber bald nach der Geburt gestorben ist. Es wurde in der Verwandtschaft kaum darüber gesprochen. Und nun endlich ging es zu Heyers, die auf der Gartenstraße in Elsterberg wohnten. Tante Anna hatte ein Kissen auf der Fensterbank und guckte uns entgegen. Manchmal hat dort auch die Heyersche Mama an der Fensterbank gestanden. Bis zu ihrem Tod hat sie mit im Haus gewohnt. Sie saß meistens in einem Sessel in der Küchenecke und drehte ihren Stock zwischen den Händen. Einmal hatte ich die Beine voller Hitzebuckeln, die fürchterlich juckten. Da nahm die Heyersche Mama meine Beine auf ihren Schoß und streichelte sie mit ihren kalten Händen. Das vergaß ich nie. Mit Tante Anna und Onkel Robert tauschten wir nie irgendwelche Zärtlichkeiten aus. Aber wir haben uns trotzdem sehr geliebt. Und wenn ich wieder abfuhr, gab es bei Tante Anna Tränen. Sie hatten selbst keine Kinder, genauso wie Onkel Otto Baumann und Tante Anna. Mit Onkel Robert spielte ich „Dame“ und „Mühle“, im Schrank am Ende des Flurs lag Schokolade. Das roch sogar im Schrank danach. Tante Anna kochte mir immer mein Lieblingsessen, nämlich Nudeln mit Rindfleisch. Die Nudeln wurden selbst gemacht. Dazu wurde der Teig dünn ausgerollt, eine kurze Zeit zum Trocknen aufgehängt, in Streifen geschnitten, aufgerollt, fein geschnitten und gelockert getrocknet. Sonntags gab es grüne Klöße und Sauerbraten. Zum Frühstück aßen wir „Dreierbrodeln“. Nie haben mir Brötchen besser geschmeckt. Im Hinterhaus war die Waschküche. Die gewaschene und gekochte Wäsche wurde auf einen einrädrigen Schubkarren geladen und über die Elsterbrücke zu der Elsterwiese gefahren, ausgebreitet und wenn sie trocken war mit dem damals so sauberen Elsterwasser gesprenkelt. In der Zwischenzeit plantschten wir barfuß im Fluss herum. Im Tremnitzgrund lag die Badeanstalt. Es war bestimmt ein Weg von einer halben Stunde durch Wiesen mit blühenden Blumen und summenden Insekten. Ich war oft dort und hatte auch immer ein Butterbrötchen mit. Am Sonntagabend ging Tante Anna mit mir zum Friedhof. Aus dem kleinen Garten nahmen wir Sträuße mit. Ich erinnere mich an Levkojen, Reseda und Astern. Das Grab von Onkel Robert, der 1925 gestorben war, lag links, das Baumannsche Familiengrab gerade aus an der Mauer. Vor dem Friedhof lief aus einer Quelle Wasser in ein Becken.
Das Klo in der Gartenstraße war auf der halben Treppe, ich meine sogar ohne Wasserspülung. Dann waren am Haus zwei Austritte (Balkone) mit Geranien rund herum. Als die Schwalben im Haus nisteten, musste die Tür dorthin offenbleiben. In regelmäßigen Abständen bekam Tante Anna ein sechs Kilogramm schweres Butterpaket aus Marne. Ich trug die Butter zu den Kränzelschwestern in einer schwarzen Ledertasche.
Der Marsch auf den Kriebelstein und der Besuch der Burgruine gehörte jedes Jahr mit zu meinem Besuchsprogramm. Zum Kriebelstein stieg man ziemlich steil auf Zick-Zack-Wegen empor, dann ging es gerade aus durch den Wald bis zum Aussichtsplatz. Von dort aus konnte ich Elsterberg überblicken. Tante Anna stand auf ihrem Austritt und winkte mit einem großen Tuch. Die Burgruine mit mittelalterlichen Türmen und Fensterbögen weckte immer wieder sagenhafte Erinnerungen an längst vergangene Ritterzeiten.
Bei Baumanns am Markt wurde ich zu Beginn meines Aufenthaltes in Elsterberg auf der großen Dezimalwaage gewogen, die dort in der Durchfahrt stand und für die Wägung langer Eisenträger gebraucht wurde. Zum Essen wurden wir von der Verwandtschaft reihum eingeladen. Von meinen Brüdern Fritz und Konrad wird erzählt, dass sie dreimal die berühmten vogtländischen Klöße an einem Sonntag verspeisten. Tante Anna Baumann hat mir einige Handarbeiten beigebracht. Konrad wohnte bei Otto und Anna Baumann, Fritz bei Paul und Clara Anlauft. Die Anlaufts wohnten damals noch in der Piehlerstraße, von wo man auf einer steilen Treppe in das Fabrikgelände hinunterlaufen konnte. Onkel Paul nahm mich mit in einen Raum, wo die gewebten Stoffe auf Fehler untersucht und ausgemustert wurden. Ich durfte wir dann oft einen Stoff aussuchen, der von Frau Lindner zu einem Kleid meines Geschmacks genäht wurde. Frau Lindner, eine Kusine meines Vaters, war Witwe und hatte fünf Töchter. Mit Anni war ich befreundet. Als ich nach 65 Jahren das ehemalige Wohnhaus auf dem Schlossberg wiederfand, traf ich dort sogar noch die jüngste Tochter Trudel.
Onkel Paul hatte sich vom Schlosser zum Webereibesitzer und Millionär emporgearbeitet. Als er 1939 starb, soll das eine riesengroße Beerdigung gewesen sein. Er war sehr beliebt und verschenkte gern etwas, wenn er Armut sah. Im Zeppelin ist er einmal über Elsterberg hinweggeflogen. Tante Clara hat ihm damals aus dem Werksgelände zugewunken. Onkel Paul ließ sich von seinem Schofför Gölisch, der eine Uniform trug, in seinem Mercedes fahren. Eine Glaswand im Auto trennte den Fahrer ab, dafür hatte Onkel Paul ein Sprechgerät. Im hinteren Teil des Wagens konnten zu zwei Polstersitzen noch zwei bequeme Sitze aus der Vorderwand herausgeklappt werden. Einmal gingen wir in Plauen in eine Gaststätte zum Essen. Ich hatte keine Ahnung und keine Erfahrung, was ich bestellen sollte. Johanna („Hannel“), die Tochter von Paul und Clara Anlauft, sagte zu mir: „Nimm doch ein Omlett!“ So etwas Vornehmes hatte ich noch nie gegessen, aber es schmeckte mir überhaupt nicht.
Meistens besuchte ich in Plauen – Haselbrunn auch die Verwandten der Familie Meyer. Es ging dort immer sehr fröhlich und laut zu. Onkel Friedrich Otto und Tante Emma waren sehr nett. Ihre sechs Kinder waren sehr musikalisch, spielten Klavier und sangen.
Erwähnen will ich noch den Elsterberger Pastor Däberitz, den ich jedes Mal gern in seinem Studierzimmer am Marktplatz besuchte. Als meine Mutter Alice Rosa im November 1920 in Oschatz starb, nahmen mich Onkel Robert und Tante Anna zu sich. Ich bin in Elsterberg Ostern 1921 eingeschult worden und erst im Herbst 1921 wieder nach Oschatz zurückgekommen.
2.4 Vorfahren mütterlicherseits
Mein Urgroßvater August Schmitz kam 1853 in Mettmann zur Welt. Bis zu seinem 14. Lebensjahr besuchte er die Elementarschule in Mettmann. Da er ein guter Schüler war, hätte sein Lehrer es gern gesehen, dass mein Großvater Lehrer geworden wäre. So aber kam er beim Nachbarn, dem Kupferschmied Hohmann, in die Lehre. Nach einer dreijährigen Militärzeit beim Infanterie-Regiment 93 in Düsseldorf ging er auf Wanderschaft. Dabei hat er längere Zeit in Celle gearbeitet. Nachdem er die Meisterprüfung vor der Handwerkskammer in Elberfeld abgelegt hatte, machte er sich in den 1870er Jahren in Mettmann selbständig. Dort heiratete er 1880 Laura Nordmann. Aus der Ehe gingen fünf Kinder hervor. Mit seinen Ersparnissen und einem Darlehen seines Schwiegervaters Ferdinand Nordmann kaufte er 1880 das Haus Freiheitsstraße 876 in Mettmann. Durch Fleiß und Klugheit brachte er sein Unternehmen empor. Nach einigen Jahren wurde er in den Stadtrat von Mettmann gewählt. In dieser Stadt war er Mitbegründer der Fortbildungsschule und des Gewerbevereins für das Handwerk. Aufgrund seiner beruflichen Erfolge zog er mit seiner Familie nach Düsseldorf, Oberbilker Allee 295. Hier brachte er sein Handwerk zu höchster Blüte, vorwiegend mit kunstgewerblichen Arbeiten wie Lampen, Türen, Beschläge, Kamine und dergleichen in Kupfer. Als Kupferschmiedemeister stellte er 1902 auf der großen Gewerbeausstellung in Düsseldorf, die den Rang einer Weltausstellung hatte, seine Erzeugnisse aus und erhielt eine Silbermedaille sowie die bronzene Staatsmedaille. 1904 erhielt er als Teilnehmer an einer Sammelausstellung der Stadt Düsseldorf in St. Louis, Missouri (USA) eine Bronzemedaille. August Schmitz führte zahlreiche Arbeiten an öffentlichen Gebäuden durch. Außerdem hatte er eine reiche Privatkundschaft.
Urgroßvater August Schmits
Ein kenntnisreicher und zuverlässiger Handwerksmeister
Das vielseitige, handwerkliche Können meines Urgroßvaters schätzte man auch während der Zeit des Kalkabbaus im Neanderthal, wo bekanntlich im August 1856 zwei Arbeiter beim Ausräumen der Feldhofer Grotte 16 Knochen fanden, die der Lehrer Johann Carl Fuhlrott aus Elberfeld einem eiszeitlichen Menschentyp, nämlich dem Neanderthaler, zuordnete. Interessant ist ein Referenzschreiben, das Wilhelm Pasch aus Düsseldorf am 24. August 1901 meinem Urgroßvater ausgestellt hatte: „Während meiner Tätigkeit als Geschäftsführer und Betriebsleiter der früheren Actien-Gesellschaft für Marmor-Industrie zu Neanderthal, von Anfang der 70er Jahre bis Ende der 80er Jahre, habe ich den Kupferschläger, Installateur und Pumpenmacher Herrn August Schmits zu Mettmann bei Anlage von Brunnen vielfach zu Rate gezogen, und, auf Grund dessen hervorragender Kenntnisse über die Wasserführung des Gebirges, eine Anzahl von Brunnen für Trinkwasser mit stets sicherem Erfolg an verschiedenen Stellen des im allgemeinen als brüchig und wasserarm bekannten Neandertales und Hochdahler Terrains anlegen lassen, welche sich auch dauernd als gut, gesund und gleichmässig wasserhaltend bewährt haben. Die fachmännische Kontrolle dieser Brunnen und ihrer Querschläge auf genügenden Wasserzufluss vor Ort, während des Abteufens und auch später, wurde gleichfalls stets durch Herrn Schmits ausgeführt. Die für die Brunnen erforderlichen Pumpen und Leitungen, eine Pumpe ausgenommen, hat Herr Schmits geliefert und eingebaut, desgleichen umfangreiche Rohrnetze zur Verteilung des der Hauptleitung des Neandertaler Pumpwerkes entnommenen Betriebswassers auf die verschiedenen Ziegeleiarbeitsplätze und sonstigen Verbrauchsstellen der genannten Actien-Gesellschaft ferner führte derselbe um die Mitte der 1880er Jahre große bauklempnerische und Zinkbedachungsarbeiten beim Umbau des Neandertaler Spinn- und Weberei-Etablissements aus, desgleichen stets auch einen Teil der Erneuerung und Unterhaltung des diversen Betriebsgeschirrs. Nach Inkrafttreten des Dynamitgesetzes lieferte Herr Schmits für die Neandertaler Steinbrüche ein zum Teil aus seiner eigenen Initiative von ihm construiertes System von Sicherheitsapparaten zum gefahrlosen Auftauen von erstarrtem Dynamit und erwarb sich damit die ungeteilte Anerkennung auch der behördlichen und berufsgenossenschaftlichen Aufsichts-Organe. Bei all diesen Leistungen, Lieferungen und Arbeiten, deren Betrag sich auf viele tausende von Mark belaufen hat, und für welche sich nicht immer feste Preisvereinbarungen im Voraus treffen ließen, ist es niemals zu Differenzen und Beanstandungen irgendwelcher Art gekommen. Ich habe Herrn Schmits allezeit als einen kenntnisreichen, zuverlässigen, ruhigen und umgänglichen Mann, als rechtlich denkenden und handelnden tüchtigen Handwerksmeister und Geschäftsmann kennen und schätzen gelernt und rechne es mir zur Ehre, ihm solches hiermit bescheinigen zu dürfen.“
Düsseldorf, Carl-Antonstr. 24, den 24. August 1901
gez. Wilhelm Pasch
In Düsseldorf beteiligte er sich auch in Düsseldorf politisch am öffentlichen Leben. Zweimal wurde er als Kandidat für die Nationalliberale Partei für den Reichstag aufgestellt. In Düsseldorf-Oberbilk gründete er den Arbeiterverein. Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914 war ein Schlag für sein Unternehmen, da der einzige Sohn Otto Fritz sich kriegsfreiwillig meldete, alle Arbeiter einberufen wurden und damit die Arbeiten eingestellt werden mussten. Als sein Sohn 1920 unerwartet an den Folgen eines Kriegsleidens starb, beschleunigte das auch das Ende meines Urgroßvaters. Er starb 1924.
Urgroßmutter Laura Schmitsgeb. Nordmann
Meine Urgroßmutter Laura Schmitz geborene Nordmann wurde 1852 in Mettmann geboren, wo sie auch aufwuchs und geheiratet hat. Sie hatte blaue Augen und dunkelblondes Haar von besonderer Länge. Ihre Zöpfe reichten bis zu den Kniekehlen. Da sie ihr Kopfhaar nicht waschen konnte, reinigte sie es durch beständiges Kämmen. Sie war eine musterhafte Hausfrau, die fleißig arbeitete, sehr sparsam, selbstlos und genügsam war. Als kirchengläubige und fromme Person las sie sonntags regelmäßig in der Bibel. Bis ins hohe Alter war sie eitel und legte Wert auf korrekte Kleidung. Ihr Schwiegersohn Ludwig Schröder sagte einmal: „Ich habe meine Schwiegermutter nie mit Hausschuhen gesehen.“ Ernsthafte Krankheiten hatte meine Urgroßmutter, die 1940 starb, nie gehabt.
Großeltern Wilhelm Geisendörfer undLydia Geisendörfer geb. Schmits
Georg Wilhelm Geisendörfer,