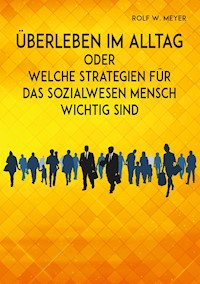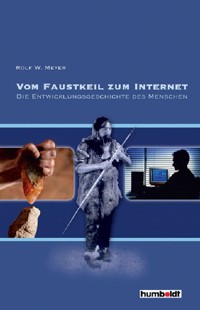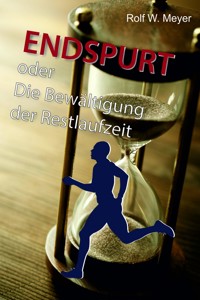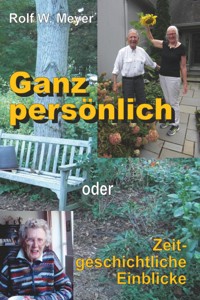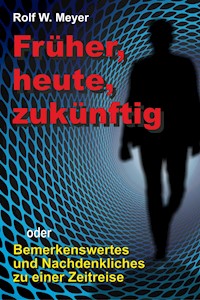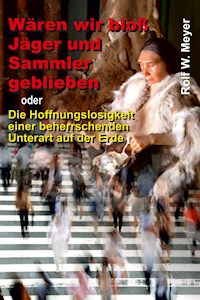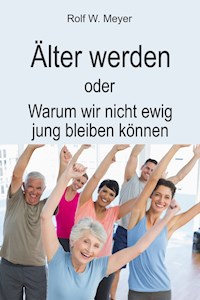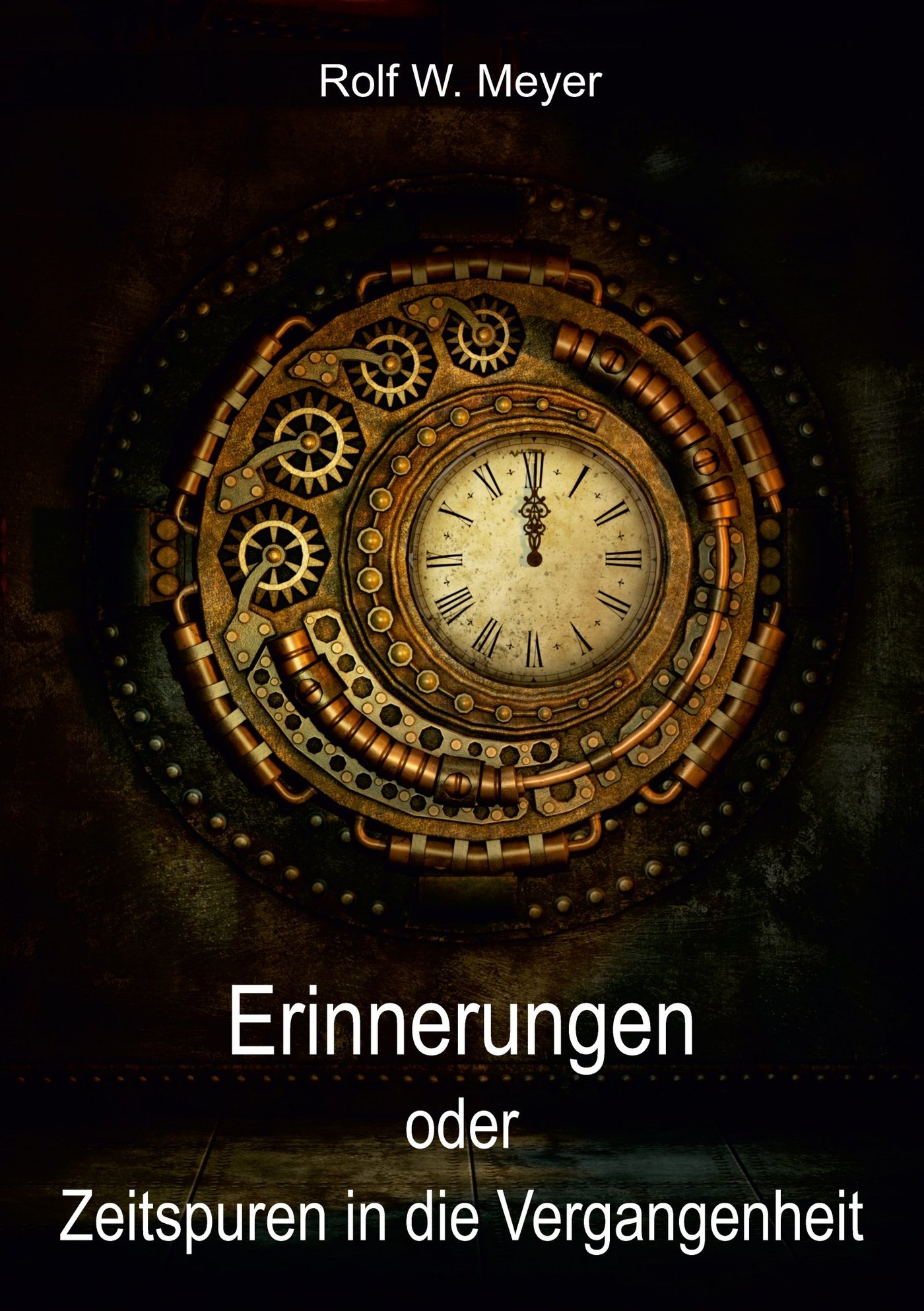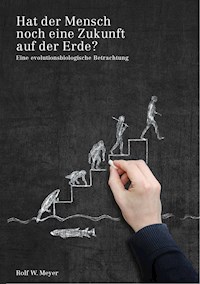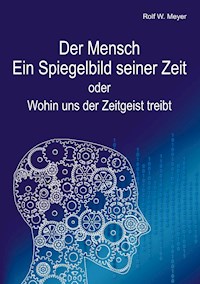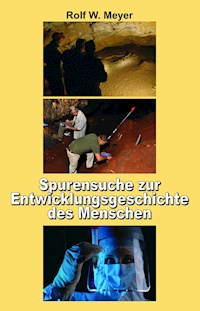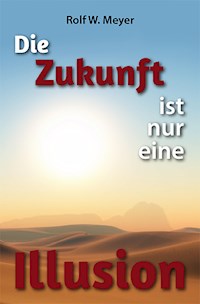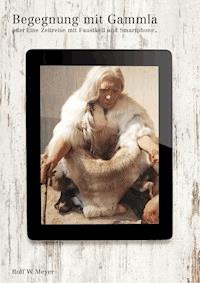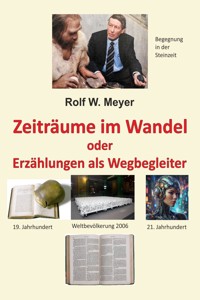
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse und von Erzählungen werden charakteristische Merkmale folgender vier historischen Zeiträume beschrieben: •Die Steinzeit, die die früheste Epoche der Menschheitsgeschichte darstellt und vor 2,6 Millionen Jahren begann. •Das 19. Jahrhundert, das durch einen bis dahin noch nicht erfolgten umfangreichen und tief gehenden globalen Wandel gekennzeichnet war, und die damit in Verbindung stehenden Veränderungen den "Beginn der Moderne" kennzeichneten. •Das 20. Jahrhundert war, auf Grund von zwei Weltkriegen und zahlreichen Stellvertreterkriegen, eine Epoche der Gewalt, der Ideologien und von anthropogenen Katastrophen. •Im 21. Jahrhundert leben die Menschen in der Regel in einem sozialen Umfeld, das geprägt ist von Internet und mobiler Kommunikation, von künstlicher Intelligenz und Robotik. • Es sei angemerkt, dass sich mittlerweile zwar die Umwelt des Menschen in einem relativ kurzen Zeitraum in dramatischer Form verändert hat, nicht aber das menschliche Erbgut. Das bedeutet, dass im Informationszeitalter die Menschen weltweit noch immer mit einer "Steinzeitpsyche" denken, fühlen und handeln. Während verschiedene Institutionen auf dem Planeten Erde bereits an futuristischen Projekten für die Menschen arbeiten ("Ein Leben im Weltall"), wird die Weltbevölkerung in all ihren Lebensbereichen beständig mit kriegerischen Konflikten konfrontiert. Lösungen für diese Gefahrensituationen sind kaum in Sicht. In Verbindung mit Künstlicher Intelligenz (KI) wird ein neues technologisches Ziel angestrebt, nämlich eine Superintelligenz der Art "Menschen plus". Wenn allerdings KI auf menschliche Dummheit trifft, können die Konsequenzen für alle Menschen verheerend sein.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 336
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rolf W. Meyer
Zeiträume im Wandel
oder
Erzählungen als Wegbegleiter
Alle Personen und Geschichten sind real, sie werden aber teilweise verfremdet dargestellt. Eventuelle Ähnlichkeiten und Übereinstimmungen mit den Namen von lebenden Personen sind nicht beabsichtigt und daher rein zufällig.
Rolf W. Meyer
Zeiträume im Wandel
Copyright: © 2024 Rolf W. Meyer
Umschlag & Satz: Erik Kinting – www.buchlektorat.net
Coverbilder: Motiv 1 oben: Stefan Fries, Motive 2 u. 3 links unten: Neanderthal Museum, Mettman
Druck: epubli, ein Service der neopubli GmbH, Berlin
Für meine Familienmitglieder Ingrid, Imke und Jan, die mit viel Empathie und Kooperation zur Entwicklung dieses Buchprojektes beigetragen haben.
Weiterhin widme ich dieses Buch der Weltbürgerin Rosemarie Coßmann, die sich immer wieder aufgeschlossen zeigt im Meinungsaustausch zur gegenwärtigen fragilen Weltlage, sowie dem gesamten Team von Trinkgut Krallmann e.K., Rehhecke 77 in 40885 Ratingen-Lintorf.
Das Buch ist ebenfalls dem jungen Afrikaner Christ Daniels aus Ghana gewidmet, der sich, weit weg von seiner Heimat, konsequent an dem Leitgedanken orientiert: „Ich kann, ich will, ich werde.“
„Die Zeit ist nur ein leerer Raum, dem Begebenheiten, Gedanken und Empfindungen erst Inhalt geben.“
Wilhelm von Humboldt (1767–1835, preußischer Gelehrter, Schriftsteller und Staatsmann)
„In Büchern liegt die Seele aller gewesenen Zeit.“
Thomas Carlyle (1795–1881, schottischer Essayist und Historiker)
„Wir leben in einem gefährlichen Zeitalter. Der Mensch beherrscht die Natur, bevor er gelernt hat, sich selbst zu beherrschen.“
Albert Schweitzer (1875–1965, deutsch-französischer Arzt, Philosoph, evangelischer Theologe und Pazifist)
„Zeit ist das, was man an der Uhr abliest.“
Albert Einstein (1879–1955, Begründer der Relativitätstheorie)
„Das Merkwürdige an der Zukunft ist wohl die Vorstellung, dass man unsere Zeit einmal die gute alte Zeit nennen wird.“
Ernest Hemingway (1899–1961, US-amerikanischer Schriftsteller)
Erinnerungswert*
The world shines in gold today
they made a promise, soon it will break
lightning flashes through the curtains
a warm summer night
thunder rolls in a far distance
a foundry has been torn down
empty streets and laughters from the edge of town.
Erste Strophe aus dem Song „Lightning“ von Jan Meyer
(I paint the scenery)
PROLOG
Der entscheidende Impuls für mich zur Veröffentlichung eines neuen Buchprojektes ging letztendlich von der folgenden Aussage der US-amerikanischen Schriftstellerin Toni Morrison (1931–2019) aus: „Wenn es ein Buch gibt, das du gern lesen willst, das aber noch nicht geschrieben wurde, dann musst du es selbst schreiben.“ Und motivierend hinterließ Neil Postman (1931–2003), ein US-amerikanischer Medienwissenschaftler, der Nachwelt seine Erkenntnis: „Bleistift, Papier und Bücher sind das Schießpulver des Geistes.“
Als Verfasser von Büchern beherzige ich immer wieder gern den Ratschlag des US-amerikanischen Schriftstellers und Literaturnobelpreis-Trägers von 1954, Ernest Hemingway (1899–1961): „Autoren sollten stehend an einem Pult schreiben. Dann würden ihnen ganz von selbst kurze Sätze einfallen.“ Hinzu kommt aber auch, dass dem anatomisch modernen Menschen (Homo sapiens sapiens), zu dem ja auch der Verfasser dieses Buches zählt, evolutionsbiologisch betrachtet, die Voraussetzungen für ein langes Sitzen (z.B. am Schreibtisch) fehlen.1 Der Grund dafür ist, dass die biologische Evolution des Menschen schon seit langem nicht mehr Schritt halten kann mit der von dem Menschen selbst (gehirnmäßig) eingeleiteten kulturellen Evolution. Das hat zur Folge, dass die jeweils erforderlichen Adaptionen (in Form von Genmutationen) nicht ausgebildet werden können.
Neue Studien belegen übrigens, „dass beim Schreiben mit der Hand im Gegensatz zum Tippen auf einer Tastatur die Verknüpfungen in bestimmten Hirnregionen aktiver sind.“2
Oft erkundigen sich Mitmenschen bei mir nach meiner Arbeitsweise für ein Buchprojekt. Gern bin ich bereit, an dieser Stelle darauf einzugehen: Auf der Grundlage meiner Beobachtungen, situativer Ereignisse oder angeregt durch biologisch-soziokulturelle Ereignisse überlege ich mir, welches Buchprojekt sich anbieten würde. Dann entscheide ich mich für einen Arbeitstitel. Die zu klärenden Fragen sind nun: Wie umfangreich soll das Buch werden? Sollen ausschließlich Texte verwendet werden oder auch Abbildungen miteingefügt werden? Welche Gliederung legt man dem Manuskript zugrunde? Welche Kapitelüberschriften oder welche Zwischentitel würden sich anbieten?
Bevor mit der Manuskriptarbeit begonnen wird, ist ergänzendes Informationsmaterial zu sammeln und zu archivieren. Dann wird ein Grundkonzept zum geplanten Buchprojekt entworfen. Auf der Grundlage des Konzeptentwurfes wird in einem oder in mehreren Ordnern das einzusetzende Arbeitsmaterial in Klarsichthüllen jeder geplanten Buchseite zugeordnet.
Die Ausarbeitung des Manuskripts erfolgt sodann nach einem festgelegten Zeitplan. Anschließend wird der Manuskripttext auf dem Computer in einem dafür bestimmten Ordner eingetippt. Korrekturen und Ergänzungen lassen sich dadurch digital problemlos durchführen.
Zur Veröffentlichung des Buchprojektes arbeite ich mit einem Buchlektorat und einem Book-on-Demand-Verlag zusammen.
Womit beschäftigt sich dieses Buch?
Anhand wissenschaftlicher Erkenntnisse und auf der Grundlage von Erzählungen (zum großen Teil von Zeitzeugen) wird für die Leserschaft meines aktuellen Buches der Blick auf vier historische Zeiträume gelenkt und deren jeweiligen charakteristischen Merkmale exemplarisch herausgestellt: Die Steinzeit, das 19. Jahrhundert, das 20. Jahrhundert und das gegenwärtige 21. Jahrhundert. Ein kurzer Überblick soll uns mit diesen Zeiträumen vertraut machen.
Die Steinzeit stellt die früheste Epoche der Menschheitsgeschichte dar. Gekennzeichnet ist sie durch erhalten gebliebene Steingeräte. Nach gegenwärtigem Forschungsstand (2024) begann die Steinzeit mit den ältesten als gesichert geltenden Werkzeugen der Oldowan-Kultur vor 2,6 Millionen Jahren.
Zu den Herstellern von Steingeräten zählen die frühzeitlichen, nur fossil überlieferten Menschenarten Homo rudolfensis und Homo habilis sowie alle späteren frühzeitlichen Menschenarten wie beispielsweise Homo ergaster/Homo erectus, die Neanderthaler und der Homo sapiens. Aus ihm ist, nebenbei bemerkt, nach gegenwärtiger Erkenntnis vor 300.000 Jahren der anatomisch moderne Mensch (Homo sapiens sapiens) hervorgegangen.
Das 19. Jahrhundert war gekennzeichnet durch einen globalen Wandel, den es „in diesem Umfang, dieser Tiefe und dieser Dynamik in keiner historischen Periode zuvor gegeben hatte.“3 Dieser stete Wandel und die damit in Verbindung stehenden Veränderungen bezeichnet man auch als „Beginn der Moderne“.
Als vielfältiges Merkmal für das 20. Jahrhundert ist herausgestellt worden: „Die Epoche der Gewalt, der Ideologien und Katastrophen.“4 Der Historiker Edgar Wolfrum (Jahrgang 1960) spricht von einer „Welt im Zwiespalt.“
Im 21. Jahrhundert leben die Menschen in einem sozialen Umfeld, das geprägt ist von Internet und mobiler Kommunikation, von Künstlicher Intelligenz (KI) und Robotik. In diesem Zusammenhang sei angemerkt, dass sich mittlerweile zwar die Umwelt des Menschen in einem relativ kurzen Zeitraum völlig (und in dramatischer Form) verändert hat, nicht aber das menschliche Erbgut. Das bedeutet, dass im Zeitalter der Computertechnik („Informationszeitalter“) die Menschen weltweit noch immer mit einer „Steinzeitpsyche“ denken, fühlen und handeln (sic!).
In Verbindung mit Künstlicher Intelligenz (KI) hat der Facebook-Gründer Mark Zuckerberg (Jahrgang 1984) öffentlich gemacht, dass er ein neues technologisches Ziel anstrebe. Er möchte eine Superintelligenz entwickeln, sozusagen eine Art „Menschen plus“. Im 21. Jahrhundert sind Technologien der künstlichen Intelligenz seit langem schon Teil unseres Alltags. Aber mit der Entwicklung von „Artificial General Intelligence (AGI)“5, in Verbindung mit der Planung von „Menschen plus“, würde eine gefährliche Grenze überschritten werden. Denn es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich AGI eines Tages verselbstständigen könnte. Und zu bedenken ist: „Wenn künstliche Intelligenz auf menschliche Dummheit trifft, könnte das unvorstellbare Konsequenzen für uns alle haben.“6
Während verschiedene Institutionen auf dem Planeten Erde immer wieder futuristische Pläne für die Menschheit schmieden („Ein Leben im Weltall“), wird die Weltbevölkerung auf diesem Planeten in all ihren Lebensbereichen unaufhörlich mit kriegerischen Konflikten konfrontiert. Lösungen für diese Gefahrensituationen sind nicht in Sicht.
Anlässlich des Internationalen Frauentages am 8. März 2024 verbreiteten die Medien die zuversichtliche Mitteilung: „Den Frauen gehört die Zukunft.“ Folgende Botschaft sandte ich daraufhin per E-Mail an die langjährige, treue Freundin meiner Familie, Frau Theresa Ku, die mit ihrer Familie in USA lebt: „Congratulations on today’s International Women’s Day. The future belongs to women!“.7 Daraufhin erhielt ich von Theresa folgende Antwort: „The future belongs not only to women. Hopefully the future will have women alongside men in wisdom and understanding!“.8 Dadurch wird eindeutig zum Ausdruck gebracht, dass eine intensive Kooperation zwischen Männern und Frauen ein sehr wirkungsvolles Modell für die Zukunft der Weltbevölkerung sein kann.
1. Als anatomisch moderne Menschen haben wir genetische Wurzeln in ganz Afrika
Spurensuche zur Entwicklungsgeschichte des Menschen
Seit Mitte des 19. Jahrhunderts haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine bedeutende Anzahl fossiler Funde von Homininen (Vormenschen- und Menschenformen) entdecken können. Derartige fossile Funde, auf die man durch aufwendige Grabungen auf allen Kontinenten der Erde aber oft auch zufällig stößt, erregen seit der Entdeckung des Neanderthaler-Skeletts im Jahre 1856 immer wieder Aufsehen. Ständig entwickelt man aufgrund neuer Erkenntnisse und mit Hilfe erweiterten Fachwissens neue Theorien. Bestehende Theorien werden korrigiert, ergänzt oder verworfen, neue Überlegungen kritisch hinterfragt. Schon lange beschränken sich Paläoanthropologen nicht mehr nur darauf, fossile Funde zu datieren, zu vermessen und in Stammbäume (phylogenetische Bäume; alternativ verwendet man in der biologischen Systematik die Bezeichnung „Stammbusch“) einzuordnen. Vielmehr setzt man Arbeits- und Untersuchungsmethoden aus verschiedenen Fachbereichen ein und bemüht sich um eine möglichst umfassende Rekonstruktion des Erscheinungsbildes und der Lebensweise der menschlichen Vorfahren. Dabei untersucht man Zusammenhänge zwischen ökologischen Bedingungen, Sozialsystemen sowie anatomischen und physiologischen Merkmalen mit Blick auf die Eignung bzw. dem Fortpflanzungserfolg (Fitness) der Individuen. Manche Faktoren der Hominisation („Menschwerdung“), wie z.B. Körpergröße, Geschlechtsdimorphismus, Gehirnvolumen, Gebiss, Werkzeugherstellung, können aus fossilen Funden und Artefakten direkt erschlossen werden. Andere Faktoren, wie etwa Lebensgeschichte und Kommunikation, lassen sich oft nur indirekt erschließen. Da die Hominisation nach wissenschaftlichen Erkenntnissen den Prinzipien der Selektion unterlag, sind die Entwicklungen der Homininen im Laufe der Evolution als stammesgeschichtlich erworbene, genetisch verankerte adaptive Veränderungen zu verstehen.
Mit den Fragen „Woher kommen wir?“, „Wer sind wir?“, „Wohin gehen wir?“ haben sich Menschen schon immer auseinandergesetzt. Neue fossile Funde und deren Auswertung auf der Grundlage von fächerübergreifender und interdisziplinärer Zusammenarbeit tragen immer wieder mit dazu bei, konkretere Antworten auf die Frage „Woher kommen wir?“ geben zu können. Sie führen aber auch zwangsläufig zu Paradigmenwechsel. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind sich weitgehend darüber einig, dass Afrika die Wiege der Menschheit ist („Wir sind vom genetischen Ursprung her alle Afrikaner.“). Hier spielten sich die vier entscheidenden Phasen der Evolution der Homininen ab: die Entstehung der Vormenschen (zu denen beispielsweise die Australopithecinen zählen), der Urmenschen (Homo rudolfensis, Homo habilis), der Frühzeitmenschen (Homo ergaster, Homo erectus) und der anatomisch modernen Menschen (Homo sapiens sapiens). In den tropischen Regenwäldern, die noch vor 20 Millionen Jahren den afrikanischen Kontinent weiträumig bedeckten, lebten die ursprünglichen Populationen der afrikanischen Menschenaffen und später die ersten Homininen.
Nicht nur Anthropologen bemühen sich, auf die Frage „Wer sind wir?“ Antworten zu geben. Auch in anderen Wissenschaftsbereichen, wie z.B. Ethnologie (Völkerkunde), Ethologie (Verhaltensforschung), Philosophie, Religionswissenschaft, Sozialwissenschaften versucht man im Hinblick auf diese Fragestellung Erkenntnisse zu gewinnen. Auch die moderne Primatenforschung liefert uns wertvolle Erkenntnisse, die mit dazu beitragen, das Wesen des Menschen zu charakterisieren: Es ist die „Affennatur“, die eine der Besonderheiten des Menschen ausmacht. Paläogenetisch lässt sich durch die Analyse alter DNA („ancient DNA“) aus gut erhaltenen Homininen-Fossilien und aus dem Vergleich mit der DNA heutiger Menschen belegen, dass der anatomisch moderne Mensch von seiner Entwicklungsgeschichte her ein genetisches und anatomisches Mosaik aufweist. Unsere „moderne Identität“ spiegelt das Ergebnis von zwei Millionen Jahren Migration wider.
Hervorzuheben ist, dass der Mensch sowohl Natur- als auch Kulturwesen ist. Die Evolution des Kulturwesens Mensch ist nicht zuletzt eine Geschichte der technischen Innovationen. Für den heutigen Menschen, der von seiner Entwicklungsgeschichte her Jäger und Sammler ist, ergeben sich in den modernen Gesellschaftsformen immer mehr Probleme. Daher ist die Frage „Wohin gehen wir?“ von besonderer Aktualität.
Neue fossile Funde, die Anwendung moderner und oftmals ungewöhnlicher Arbeitsmethoden sowie eine fächerübergreifende Zusammenarbeit in der Paläoanthropologie öffnen den Blick für eine völlig andere Modellvorstellung zur Evolution der Vormenschen und Menschenformen.
Die Meinungen der Gelehrten gehen auseinander
Als im Jahre 1856 bei Steinbrucharbeiten im Neanderthal bei Düsseldorf 16 Knochen in der Feldhofer Grotte entdeckt wurden, hielt man sie zunächst für die Knochen eines Höhlenbären. Der Elberfelder Lehrer Johann Carl Fuhlrott (1803–1877) jedoch erkannte, dass es sich um Überreste eines eiszeitlichen Menschen handelte. In Anlehnung an den Fundort wurde der Name Neanderthaler gewählt.1 Der Anatom und Prähistoriker Rudolf Virchow (1821–1902), der die Zellularpathologie begründet hatte, hielt hingegen die Funde für Reste eines anatomisch modernen Menschen, dessen Knochen krankhaft verändert waren. Durch seine Autorität verhinderte Virchow über Jahrzehnte eine allgemeine Akzeptanz des Fundes in Deutschland. Fuhlrott starb 1877 verbittert und ohne Anerkennung gefunden zu haben. Virchow beharrte auf seiner Meinung und starb 1902 ohne von der Existenz des Neanderthalers überzeugt zu sein. Neben wissenschaftlichen waren auch politische Gründe für die Missdeutung der Fossilien aus dem Neandertal verantwortlich. Dieser Knochenfund war der Auslöser für international gegensätzlich geführte Diskussionen und zugleich der Beginn der Erforschung der Menschwerdung (Hominisation). Der Fund aus dem Neanderthal, der ein zentrales Beweisstück für die Abstammung des Menschen darstellt, brachte im 19. Jahrhundert ein jahrtausendealtes kirchliches Weltbild ins Wanken und schließlich zum Einsturz. Seine Berühmtheit verdankte der Knochenfund dem zeitlichen Zusammentreffen mit der Veröffentlichung von Charles Darwins Hauptwerk „Die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl“, das im Jahre 1859 erschien. Erst 1871 veröffentlichte Darwin sein Werk über die Abstammung des Menschen.²
Im Jahre 1908 wurde in einer kleinen Höhle bei La Chapelle-aux-Saints in Mittelfrankreich ein Neanderthaler-Skelett gefunden, von dem mehr erhalten war als von jedem anderen bis zu diesem Zeitpunkt. Die von dem französischen Anthropologen Marcellin Boule (1861–1942) ausgearbeitete Studie über diesen Fund („Der Alte von La Chapelle-aux-Saints“) sollte das Bild des Neanderthalers nachhaltiger beeinflussen als alle bisherigen Veröffentlichungen. Dieses Bild wies die Neanderthaler als äußerst primitive und „äffische“ Wesen aus. Moderne Untersuchungsmethoden und in Verbindung damit neue wissenschaftliche Erkenntnisse belegen jedoch, dass der Neanderthaler ein intelligenter Mensch auf einer relativ hohen Kulturstufe gewesen war.
Die Aussage der Evolutionslehre von Charles Darwin (1809–1882), dass der Mensch sich aus tierlichen Vorfahren nach allgemeinen Regeln der Evolution entwickelt hat, schockierte viele religiöse Menschen, da für sie die Aussagen der biblischen Schöpfungsgeschichte ausschlaggebend waren.³ Im Jahr 1925 fand ein Prozess vor einem Gericht in Dayton, Tennessee statt, bei dem es um ein im selben Jahr verabschiedetes Gesetz ging, welches untersagte, „Theorien zu lehren, die der Bibel in Bezug auf die Entstehungsgeschichte der Menschheit widersprechen.“4 Da der Lehrer John Thomas Scopes die Evolutionstheorie von Charles Darwin an öffentlichen Schulen gelehrt hatte, wurde er in diesem Prozess zu 100 Dollar Bußgeld verurteilt. Der Scopes-Prozess ging unter dem Namen „Scopes Monkey Trial“ („Scopes Affenprozess“) in die Geschichte ein.5 Auch heute noch beziehen sich viele Menschen als Anhänger des Kreationismus ausschließlich auf die biblische Schöpfungsgeschichte, und die Anhänger der Theorie des Intelligent Design berufen sich auf einen „intelligenten Schöpfer“, der ihrer Meinung nach das Wunder der Schöpfung steuerte.6
Im Dezember 1912 wurde während eines Treffens der Geologischen Gesellschaft in London den Wissenschaftlern ein außergewöhnlicher „fossiler“ Schädel vorgestellt. Er ähnelte im Wesentlichen demjenigen eines modernen Menschen, jedoch hatte er einen Unterkiefer, der äffische Merkmale aufwies. Gefunden hatte ihn der Amateur-Archäologe Charles Dawson (1864–1916) in einer Kiesgrube bei dem Dorf Piltdown in der englischen Grafschaft Sussex. Die damaligen britischen Gelehrten waren davon überzeugt, dass es sich bei diesen Fragmenten um die Überreste einer bisher unbekannten Form der Vorfahren des Menschen handelte. Sie gaben dem Fund zu Ehren seines Entdeckers Charles Dawson den wissenschaftlichen Namen „Eoanthropus dawsoni“ („Dawsons Mensch der Morgenröte“). Erst 1953 entlarvten drei Wissenschaftler der Universität Oxford den „Piltdown-Menschen“ als Fälschung. Sie konnten nachweisen, dass das „Fossil“ aus einem künstlich gealterten modernen Menschenschädel und einem neuzeitlichen Orang-Utan-Unterkiefer bestand. Aus dem Fall „Piltdown-Mensch“ haben die Anthropologen gelernt, dass zu hoch gesteckte Erwartungen in die Irre führen können.7
1917 prägte der Nervenarzt Sigmund Freud (1856–1939) den Begriff „Kränkungen der Menschheit“ für „umstürzende wissenschaftliche Entdeckungen, die, so Freuds These, das Selbstverständnis der Menschen in Form einer narzisstischen Kränkung in Frage gestellt haben“.8 Freud nennt dazu drei große Einschnitte, „die der naive Narzissmus des menschlichen Bewusstseins durch den historischen Fortschritt wissenschaftlicher Erkenntnis erlitten habe.“9 Es handelt sich dabei um:
Die kosmologische Kränkung: Die Aussage des Astronomen Nikolaus Kopernikus (1473–1543), dass die Erde nicht der Mittelpunkt des Weltalls ist (Kopernikanische Wende).
10
Die biologische Kränkung: Die Erkenntnis von Charles Darwin, dass der Mensch aus der Tierreihe hervorgegangen ist und damit ein Produkt der Primatenevolution ist.
11
Die psychologische Kränkung: Die von Sigmund Freud entwickelte „Libidotheorie des Unbewussten“, die besagt, dass sich ein beträchtlicher Teil des Seelenlebens der Kenntnis und der Herrschaft des bewussten Willens entzieht.
12
In den letzten 158 Jahren haben Wissenschaftler13 eine bedeutende Anzahl von Funden menschlicher Fossilien gemacht. Seit der Entdeckung des Neanderthalers erregen fossile Funde, auf die man durch aufwendige Grabungen in Afrika, Amerika, Asien und Europa stößt, immer wieder Aufsehen. Ständig entwickelt man aufgrund neuer Erkenntnisse und erweiterten Fachwissens neue Hypothesen und Theorien. Bestehende Theorien werden korrigiert, ergänzt oder verworfen, neue Überlegungen kritisch hinterfragt.
Widerlegung von historischen Irrtümern
Weltbilder im Wandel – Copernicus und der Neanderthaler
Was verbindet den Neanderthaler mit Nicolaus Copernicus? Diese Frage scheint auf den ersten Blick weit hergeholt zu sein. Und doch zeigen das Lebenswerk des großen Astronomen Nicolaus Copernicus (1473–1543) und die Erkenntnisse, die man aus dem Fund im historischen Neanderthal bei Ratingen im Jahre 1856 gewonnen hat, in einem tieferen Sinn etwas Gemeinsames: In beiden Fällen wurden Weltbilder verändert.
Schon immer haben die Menschen nach Erklärungen für dir Bewegung der Gestirne gesucht und Erklärungsmodelle entworfen. Von der Antike bis in die frühe Neuzeit hinein haben die Gelehrten vorrangig das dem menschlichen Wahrnehmungsvermögen so einleuchtende Erklärungsmodell des Ptolemäus vermittelt, demzufolge die Erde eine Scheibe darstellt und Mittelpunkt des Weltalls sei. Diese Vorstellung war autorisiert durch die Kirche und galt nahezu unangefochten.
Die Erkenntnisse des Astronomen Nicolaus Copernicus, der im übrigen als Domherr zeitlebens ein frommer Mann blieb, widerlegten die Ptolemäische Lehre grundlegend und hatten in der Epoche Galileis die bekannte Auseinandersetzung mit der römischen Kurie zur Folge.
Eine ebenso tiefgreifende Veränderung des menschlichen Bewusstseins bewirkte der Neanderthaler. Als er 1856 in der Feldhofer Grotte im historischen Neanderthal entdeckt wurde, war er keine Sensation, es war ein Skandal. Dieser Fund brachte ein Jahrtausende altes Weltbild ins Wanken und schließlich zum Einsturz, nachdem der Elberfelder Lehrer, Dr. Johann Carl Fuhlrott, über die von Steinbrucharbeitern gefundenen Skelettreste das Ungeheuerliche behauptet hatte: dass sie nämlich „aus der vorhistorischen Zeit, wahrscheinlich aus der Diluvialperiode stammen und daher einem urtypischen Individuum unseres Geschlechts einstens angehört haben.“
Für die Menschen im 19. Jahrhundert hieß das nicht mehr und nicht weniger als: Es gibt keinen Schöpfergott, die biblische Schöpfungsgeschichte ist ein Märchen.
Seine Berühmtheit verdankt der Fund aus dem historischen Neanderthal dem zeitlichen Zusammentreffen mit der Veröffentlichung von Charles Darwins Hauptwerk „Die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl“ im Jahre 1859. Charles Darwin hatte gehofft, der Begriff der natürlichen Auslese würde einiges Licht auf die Ursprünge des modernen Menschen werfen. Stattdessen schlug er wie ein Blitz ein.
Fast alle Kritiker der Evolutionstheorie missverstanden Charles Darwin und nahmen an, er habe gemeint, der moderne Mensch stamme unmittelbar vom Affen ab. Dieses Missverständnis hatte zur Folge, dass sich Charles Darwin dem Spott vieler seiner Mitmenschen ausgesetzt sah.
Im Zuge der heftigen Diskussion über die Richtigkeit der Evolutionstheorie ist der Fund von 1856 aus dem historischen Neanderthal ein zentrales Beweisstück für die Abstammung des Menschen.
Die Entwicklung des Evolutionsgedankens
Frühe Theorien
Der Mensch: Ein Sonderfall? Die Schöpfungsgeschichte, die das Alte Testament erzählt, wurde im christlichen Abendland lange Zeit wortwörtlich genommen. Der irische Bischof James Ussher berechnete Mitte des siebzehnten Jahrhunderts sogar, wann sich die Erschaffung der Welt wohl ereignet haben musste: 4004 vor Christus. Andere Gelehrte kamen zu anderen Ergebnissen. Doch galt es vielen als unbezweifelbar, dass die Welt höchstens einige tausend Jahre alt sei. Mit den wachsenden Erkenntnissen in der Geologie stellte sich jedoch heraus, dass z.B. tief gelegene Erdschichten weit älter sein mussten. In ihnen fanden sich auch Knochen, die vom uralten Leben zeugten. Wie war das mit der Bibel in Einklang zu bringen? Die Katastrophentheorie gab hierzu eine Antwort: Es habe nicht nur die eine, sondern davor schon weitere Schöpfungen gegeben. Das jeweils entstandene Leben sei aber immer wieder durch Katastrophen, wie etwa die Sintflut, vernichtet worden.
Der Mensch: Ein Fall für die Evolution? Angesichts von Fossilfunden begannen Wissenschaftler, über den Ursprung des Lebens nachzudenken. Die wissenschaftliche Revolution des 19. Jahrhunderts gipfelte in der Evolutionstheorie von Charles Darwin. Berühmte Wissenschaftler hatten zuvor den Boden für eine Widerlegung der Schöpfungsgeschichte, wie sie in der Bibel beschrieben wird, geebnet.
Der französische Zoologe und Paläontologe Georges Cuvier (1769–1832) bewies die Existenz ausgestorbener Arten und begründete damit die Paläontologie.
Der schwedische Biologe und Begründer der biologischen Systematik Carl von Linné (1707–1778) entwickelte das erste einheitliche Ordnungssystem zur Klassifikation der Arten und stellte den Menschen in eine Gruppe mit den Primaten.
Der französische Biologe Jean-Baptiste Lamarck (1744–1829) war der erste Wissenschaftler, der für eine kontinuierliche Evolution eintrat. Er registrierte anatomische Unterschiede zwischen ausgestorbenen und noch lebenden Tierarten. Darauf baute er eine Abstammungstheorie auf, nach der sich die Gestalt der Lebewesen veränderte, wenn sich die Umweltbedingungen änderten.
Der englische Naturwissenschaftler Charles Darwin (1809–1882) ist der Begründer der Evolutionstheorie. Nach seiner Theorie begünstigt die natürliche Variation das Überleben bestimmter, der Umwelt am besten angepassten Arten. Er bezog ausdrücklich den Menschen in seine Überlegungen mit ein.
Der englische Anatom und Naturwissenschaftler Thomas Henry Huxley (1825–1875) bezog den Fund von 1856 aus dem Neanderthal erstmals ausführlich in sein Werk „Zeugnisse für die Stellung des Menschen in der Natur“ mit ein.
Der deutsche Zoologe Ernst Haeckel (1834–1919) wies nach, dass keine der lebenden Affen der Vorfahre des Menschen sein kann, sondern dass nach fossilen Formen gesucht werden muss.
Das Rätselwesen Mensch
Im Laufe ihrer Kulturgeschichte haben Menschen schon immer darüber nachgedacht, was das Wesen des Menschen charakterisiert und seine Sonderstellung unter den tierlichen Lebewesen begründen könnte. Zahlreiche anthropologische Theorien aus mehreren Jahrhunderten sind überliefert. Sie stellen jeweils Versuche dar, das Rätselwesen Mensch zu deuten.
Der altgriechische Philosoph Aristoteles (384–322 v. Chr.) sah in dem Menschen ein „geselliges“ Tier (zoon politicon), das Schöpfer komplizierter Gesellschaftssysteme und Staatsgebilde ist. Für den deutschen Philosophen Immanuel Kant (1724–1804) war der Mensch das zur Vernunft und Logik fähige Tier (animal rationabile). Jedoch machte Kant eine wesentliche Einschränkung: Der Mensch handelt nicht immer den Gesetzen der Logik entsprechend, sondern er ist sehr oft gefühlsbetont und irrational. Der schwedische Naturforscher Carl von Linné (1707–1778) sprach von dem vernunftbegabten Menschen (homo sapiens). Er betonte damit die geistigen Fähigkeiten, die ihn von seinen nächsten lebenden Verwandten, den Menschenaffen, unterscheiden.
Bis ins 19. Jahrhundert hinein hat es zahlreiche, allerdings auch unzulängliche Theorien über das Wesen und die Herkunft des Menschen gegeben. Mit den Erkenntnissen des englischen Wissenschaftlers Charles Darwin (1809–1882) stürzte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts das bis dahin vorherrschende Menschenbild, das sog. Anthropozentrische Weltbild, ein. Darwin lehrte, dass der Mensch ein Produkt natürlicher Evolution ist und aus dem Tierreich abstammt. Dies bedeutet, dass das Lebewesen Mensch durch das Wechselspiel von zufälligen Erbgutänderungen (Mutationen) und natürlicher Auslese (Selektion) aus einer Formenvielfalt hervorgegangen ist. Umfangreiches, wissenschaftliches Beweismaterial hat seitdem belegen können, dass auch der Mensch, wie alles Organische in der Natur, den Gesetzen genetischer Evolution unterliegt.
Der Wissenschaftler Alister Hardy (1896–1985) betrachtete den Menschen als das betende Tier, ein Sinn schaffendes Wesen, ein Wesen der Religion (homo religiosus), des Aberglaubens, der Mystik und der Visionen.
Die Selektionstheorie von Charles Darwin
Der englische Naturforscher Charles Darwin sammelte auf einer mehrjährigen Weltreise mit dem Forschungsschiff „Beagle“ (1831–1836) umfangreiches Material und wichtige Erkenntnisse zu biologischen und geologischen Erscheinungen. Diese Erkenntnisse waren die Grundlagen seiner später entwickelten Theorie der gemeinsamen Abstammung der Arten und seiner Theorie der natürlichen Auslese. 1859 erschien sein Werk „Über die Entstehung der Arten durch natürliche Auslese oder die Erhaltung der begünstigten Rassen im Kampf ums Dasein“. Mit diesem Buch schuf er die Grundlagen der modernen Evolutionstheorie und damit auch die theoretische Grundlage der Paläoanthropologie. Ohne über fossile Belege zu verfügen, veröffentlichte er 1871 ein weiteres Werk: „The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex“ („Die Abstammung des Menschen und die geschlechtliche Zuchtwahl“). Dieses Buch erregte sehr viel Aufmerksamkeit, löste aber auch einen Sturm der Entrüstung aus. In dieser Veröffentlichung stellte er unter anderem die Thesen auf, dass Mensch und Menschenaffen biologisch eng verwandt sind und dass Mensch und Menschenaffen gemeinsame Vorfahren gehabt haben, die nach seiner Ansicht vor 20 Millionen Jahren in Afrika gelebt haben. Er postulierte die Existenz eines Zwischengliedes („missing link“) zwischen ausgestorbenen Affenformen und Mensch.
Nachgefragt
Welche grundlegenden Aussagen gibt die Evolutionstheorie („Selektionstheorie“) von Charles Darwin wieder?
Jeder Organismus produziert weit mehr Nachkommen, als für die Erhaltung der Art erforderlich ist und aufgrund des Nahrungsangebotes schließlich auch überleben (Überproduktion).
Die Angehörigen einer Art sind niemals völlig gleich, sondern sie unterscheiden sich voneinander in zahlreichen Merkmalen (Variabilität).
Die variierenden Merkmale sind erblich und treten auch bei den Nachkommen auf (Vererbung).
Innerhalb einer Population kommt es zwischen den verschiedenen Individuen zum Kampf ums Dasein („struggle for life“). Träger vorteilhafter Merkmale überleben mit höherer Wahrscheinlichkeit („survival of the fittest“) und können damit ihre Anlagen an die nächste Generation weitergeben (natürliche Auslese oder Selektion).
Wandel durch Anpassung: Prinzipien der Evolution
Arten sind nicht konstant, sondern sie sind in ständiger Bewegung. Innerhalb einer Gruppe oder Population gleicht kein Individuum dem anderen. Bei der Vererbung wird nämlich das genetische Material der Eltern immer wieder neu gemischt, so dass ständig neue Varianten von Artgenossen entstehen. Zusätzlich zu dieser Rekombination können auch durch Mutationen Veränderungen des Erbmaterials erfolgen.
Dieser Variationsreichtum ist erforderlich, da sich auch die natürliche Umwelt (Klima, Vegetation und Tierwelt) ständig verändern. Die Umwelt übt somit Druck auf die Individuen aus. Sie macht eine Anpassung erforderlich. Besser angepasste Individuen können die Angebote der Umwelt auch besser nutzen. Sie können eine Nahrungsquelle besser erschließen, ernähren sich besser, können sich gegenüber Feinden besser behaupten und sind bei der Fortpflanzung gegenüber Artgenossen erfolgreicher. Reproduktive Fitnessmaximierung ist das Lebensprinzip aller Organismen. Fitness (Eignung) ist im Wesentlichen gleichbedeutend mit Fortpflanzungserfolg. Dieses Konkurrenzverhalten
schließt allerdings reziproken Altruismus nicht aus, wenn die beteiligten Individuen daraus für sich gegenseitig Nutzen ziehen können. Gerade dieser Aspekt der Evolution hatte wahrscheinlich in der Hominisation („Menschwerdung“) eine entscheidende Rolle gespielt.
Einen bedeutenden wissenschaftlichen Beitrag zum Verständnis der Evolutionsmechanismen, die tierliches und damit auch menschliches Sozialverhalten bestimmen, leistet die Soziobiologie. Sie betrachtet nicht Organismen, sondern Gene als Selektionseinheiten.
Die Synthetische Evolutionstheorie
Man fasst die gegenwärtigen Vorstellungen über den Ablauf und die Ursachen der Evolution als „Synthetische Evolutionstheorie“ zusammen. Sie verbindet alle Wissenschaftsgebiete miteinander, die sich mit Lebewesen befassen.
Der Mediziner und Zoologe August Weismann (1834–1914) hatte erste Gedanken zu dieser Synthetischen Theorie eingebracht, die von den Evolutionsbiologen des 20. Jahrhunderts weiterentwickelt wurden. Neue Erkenntnisse auf dem Gebiet der Genetik (Vererbungslehre) in den 1940er Jahren brachten neue Einsichten in die Mechanismen zur Erzeugung genetischer Variabilität. Danach bestimmen Gene den Phänotyp (das Erscheinungsbild), welcher die Bau- und Leistungsmerkmale eines Organismus widerspiegelt. Mutationen sind die erblichen, zufällig eintretenden Veränderungen, welche die Gene und damit den Phänotyp verändern und der natürlichen Auslese aussetzen. Die Populationsgenetik liefert mathematische Modelle zur Veränderung der Allelenfrequenz in einer Population (Allel: Alternative Form eines Gens). Die Struktur und Verteilung von Populationen bestimmt die Entwicklung neuer Arten (Eine Population umfasst gleichartige Lebewesen eines bestimmten Lebensraumes, die miteinander in regelmäßigem Genaustausch stehen.). Reproduktive Isolation ist hierfür die Grundvoraussetzung. Zu einer biologischen Art (Species) gehören alle Individuen, die miteinander in Genaustausch stehen und fruchtbare Nachkommen haben.
Wissenswert
Begründer der Synthetischen Evolutionstheorie und ihre Fachbereiche:
Theodosius Dobzhansky (1900–1975): Populationsgenetik der Taufliege Drosophila; Präadaption.
Julian Huxley (1887–1975): Zusammenhänge zwischen Evolutionstheorie und Genetik; Beiträge zur Philosophie der Naturwissenschaften.
Ernst Mayr (1904–2005): Biogeographie und Systematik; Definition der biologischen Art als Fortpflanzungsgemeinschaft; Artbildung durch geographische und reproduktive Isolation.
Bernhard Rensch (1900–1990): Zoologie und Verhaltensbiologie.
George Gaylord Simpson (1902–1984): Paläontologie; Entwicklung statistischer Methoden zur Untersuchung der Interkontinental-Wanderung der frühen Säugetiere.
G. Ledyard Stebbins (1902–1984): Botanik, Genetik.
Offenbar überdauert kein wissenschaftliches Paradigma ohne Abwandlung länger als ein Jahrhundert. Denn viele Evolutionsbiologen stellen heute einige Aussagen der Synthetischen Evolutionstheorie in Frage.
Erwähnenswert
Beispiele von wissenschaftlichen Ansichten, die noch immer kontrovers diskutiert werden:
Determinismus:
Mutationen erfolgen nicht nur rein zufällig, sondern sie sind auch einem molekularen Determinismus unterworfen.
Neutralismus:
Nicht nur das Auftreten der Varianten ist zufällig, sondern auch ihre „Etablierung“ innerhalb einer Population. Die Begründung des japanischen Genetikers Motoo Kimura, der 1968 die „Neutrale Theorie der molekularen Evolution“ aufstellte: „Wenn die meisten genetischen Unterschiede einem Selektionsdruck unterliegen würden, müsste die genetische Variabilität in einer Population niedrig sein. Da aber die Variabilität hoch ist, sind die meisten genetischen Unterschiede für das Überleben weder hinderlich noch förderlich, das heißt adaptiv neutral.“ Es muss also unterschieden werden, wie viele Varianten durch Zufall erhalten bleiben und wie viele Varianten aufgrund eines Anpassungsvorteils nicht beseitigt werden.
Gradualismus:
Evolution erfolgt in kleinen Schritten und in allmählichen Übergängen.
Egoistische Gene:
In seinem Buch „Das egoistische Gen“ vertritt der britische Evolutionsbiologe Richard Dawkins die These, dass nicht die Individuen, sondern die Gene die Einheit der Selektion darstellen.
Erlebter eiszeitlicher Alltag
Eine Bisonjagd setzt Kooperation voraus
Für den Großstadtbewohner und Schulleiter eines Gymnasiums, Johann Feldhof, erfüllt sich eines Tages ein Traum. Er hat eine unerwartete Begegnung mit der alten Neanderthalerin Gammla. Auf einer Zeitreise mit ihr in die Altsteinzeit erlebt Johann Feldhof das Alltagsleben des Clans von Gammla während der letzten Eiszeit.
Inzwischen ist es dämmerig geworden. Johann erhebt sich von dem Fell, auf dem er saß und das ihm Schutz auf dem kalten Bodenbereich gegeben hat. Er streckt sich und reibt mit beiden Händen das Gesicht und vor allem die Nase. Dann geht er langsam zur Feuerstelle. Sie ist ein wichtiger Versammlungsplatz für die Clanmitglieder. Im Feuer wird nicht nur Nahrung aufbereitet und Holzmaterial der Speere und Lanzen gehärtet, sondern in der Nähe des Feuers werden auch Rituale gefeiert. Selbst wenn die Dunkelheit kommt, gibt ihnen das Feuer ein Gefühl der Sicherheit. Wenn sie alle zusammensitzen, tauschen sie Informationen aus und die älteren Mitglieder geben ihr Wissen und ihre Erfahrungen weiter. Die Männer sprechen bei dieser Gelegenheit über eine bevorstehende Jagd. Viele Absprachen müssen getroffen werden. Es kommt auf den Ranghöchsten an, vorausschauend zu planen und jedem, der an der Jagt teilnimmt, eine Aufgabe zu übertragen. Von dem Ranghöchsten geht eine besondere Ausstrahlung aus.14
Johann versucht, seine bisherigen Eindrücke, die er bei den Neanderthalern gewonnen hat, zu ordnen. Interessant ist, welche Arbeiten bei ihnen im Laufe des Tages geleistet werden müssen. Jedes Mitglied des Clans muss bereit sein, sich für die Gruppe einzusetzen. Nur so hat die Gruppe eine Chance, in der Umgebung, in der sie lebt, sich zu behaupten und damit zu überleben.15 Meist halten sich die Frauen in der Nähe des Lagerplatzes auf, während die Männer überwiegend auf die Jagd gehen. Oft werden aber auch die kräftigeren Frauen, soweit sie nicht schwanger oder unmittelbar mit der Betreuung der Kinder beschäftigt sind, mit auf die Jagd genommen. Die Frauen und auch die älteren Kinder suchen in der näheren Umgebung nach Essbarem und nach Brennmaterial. Oft müssen sie sich aber auch weit von dem Lagerplatz entfernen, um mehr sammeln zu können. Manchmal bringen die Frauen auch spezielle Kräuter mit, die sie zur Heilung von kranken und verletzten Mitgliedern des Sozialverbandes verwenden können. Es fallen zahlreiche weitere Arbeiten für die Männer und Frauen an: Zubereiten der Jagdbeute, Herstellen von Steinwerkzeugen und Geräten aus Knochen. Wenn die Männer erschöpft und verletzt von der Jagd zurückkommen, dann kümmern sich die Frauen um sie. Haben die Männer erfolgreich gejagt, dann geben ihnen die Frauen körperliche Zuwendungen. Die Männer lieben das, zumal die Frauen sehr einfallsreich sind. Das ist sicherlich ein Ansporn für die Jäger, möglichst viel Beute in das Lager zu bringen.
Schon seit Tagen haben die Kundschafter des Clans beobachtet, dass eine Bisonherde sich in der Nähe des Lagerplatzes aufhält. Den Neanderthalern bietet sich die Möglichkeit für eine ertragreiche Beutejagd. Unruhe und Nervosität breiten sich im Clan aus. Für die bevorstehende Jagd ist es wichtig, Jagdwaffen zusammenzustellen und diese zu überprüfen. Zwischen den Beteiligten der Jagdgemeinschaft sind Absprachen zu treffen, an die sie sich auch zu halten haben. Man muss sich gegenseitig vertrauen können. An den Ranghöchsten werden besondere Anforderungen gestellt. Solange er das leistet, wird er auch als Ranghöchster anerkannt. Auf ihn kommt es an, seine Jagdpartner gut auf die Jagd einzustimmen und seine Erfahrung einzubringen. Die Jäger sind sich der gefährlichen Situation bewusst, der sie ausgesetzt sind, wenn sie Großwild jagen. Da die Neanderthaler keine ausdauernden Dauerläufer sind, müssen sie versuchen, möglichst schnell und dicht an das Beutetier heranzukommen. Das ist allerdings immer sehr risikoreich. Denn die Jägerinnen und Jäger können sich schwere Verletzungen im Kopf- und Nackenbereich und an den Armen und Beinen zuziehen.
Von seinem Studium her weiß Johann, dass der langhornige Steppenbison etwa so groß wie ein amerikanischer Büffel aus den Great Plains ist. Ein ausgewachsener Bulle wird bis zu 3,50 m lang, erreicht eine Schulterhöhe von 2 m und wiegt etwa 1.000 kg. Seine langen Hörner können bis zu 1,20 m Spannweite erreichen. Im Frühjahr und Herbst sammeln sich die Bisons, um in großen Herden in ihre Sommer- bzw. Winterweidegebiete zu ziehen. „Welche Strategie werden die Neanderthaler anwenden, um diese Tiere zu jagen?“, fragt sich Johann. Schon bald kann sich der Großstadtmensch selbst ein Bild davon machen, wie die Jagdgruppe strategisch vorgeht. Es wird zunächst in der Steppe eine Stelle gewählt, wo ein Flusstal durch eine Hügelkette verengt wird. An einer derartigen Engstelle drängen sich die Tiere auf ihrer Wanderung viel dichter als sonst. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, mehrere Tiere gleichzeitig zu erbeuten. Durch zusätzliche Hindernisse verengen die Jäger den Durchgang. Es ist nicht ungefährlich, sich in die Nähe von so vielen Großtieren zu begeben. Denn auf der Flucht kann die Herde alles niedertrampeln, was sich ihr in den Weg stellt. Daher muss die Jagd gut geplant sein. Ein Teil der Gruppe versucht, einige Bisons zu dem vorbereiteten Platz zu dirigieren. Dort warten schon die Jägerinnen und Jäger, um ihre Speere mit aller Kraft auf die heraneilenden Tiere zu schleudern. Nur zwei Tiere sind sofort tot. Die verwundeten Tiere laufen wild umher. Bei dem Versuch, sie zu töten, kann es leicht zu Unfällen kommen. Daher übernehmen die besonders erfahrenen Jäger die Aufgabe, einem ausgewählten Tier mit einer Stoßlanze den Todesstoß zu versetzen.
Die erlegten Tiere werden von der Jagdgruppe an Ort und Stelle geschlachtet. Zunächst wird mit einem scharfkantigen Faustkeil die Haut abgezogen und zusammengerollt. Mit einfachen Steinabschlägen und Werkzeugen mit Sägekante werden die Tiere zerlegt.16Die Jägerinnen und Jäger arbeiten Hand in Hand und trennen zügig Fleisch, Sehnen, Därme und andere innere Organe aus dem Tierkörper heraus. Die Langknochen zerschlagen sie mit einem Steingerät, um an das nahrhafte Knochenmark zu gelangen. Alles Beutematerial, was sie tragen können, bringen sie zum Lagerplatz. Zum Glück gab es keine Verletzten, um die man sich hätte kümmern müssen. Blutverschmiert, erschöpft aber glücklich kommen sie an. Es gibt genug Gründe, diese erfolgreiche Jagd zu feiern. Johann sieht diesem Ritual mit gemischten Gefühlen entgegen.
Von der Jägerin Ene erfährt Johann, dass auch Rentiere eine bevorzugte Jagdbeute für die Neanderthaler sind. Mit den Armen und mit den abgespreizten Fingern ihrer Hände ahmt Ene ein Geweih nach und verdeutlicht durch Bewegungen, dass diese „Waffe“ der Tiere nicht zu unterschätzen ist. Für Johann ist es überraschend zu erfahren, wie vielseitig der Körper eines Rentieres verwertet wird. Das Fleisch und den pflanzlichen Mageninhalt der Tiere verwenden die Neanderthaler als Nahrung. Magen und Darm werden aufgeblasen und getrocknet. Sie eignen sich als Behälter. Das Fell der Rentiere benutzt man zur Herstellung von Kleidung und Lederriemen oder zum Abdecken von Behausungen im Freien. Getrocknete Sehnen, Nerven und Därme verwenden die Neanderthaler als Schnüre. Aus Teilen des Geweihs stellen sie Speerspitzen her. Die langen Knochen eignen sich dazu, mit ihnen das Fell abzuschaben.
„Die Jagderfolge“, äußert Ene und blickt dabei Johann mit einem ernsten Gesicht an, „sind im Laufe des Jahres sehr unterschiedlich. Spät im Winter, wenn der Boden von einer harten Schneekruste bedeckt ist, können die Tiere kaum Futter finden. Dann ist es für die Jägerinnen und Jäger leichter viele Tiere, die vom Hunger geschwächt sind, zu erlegen. Es kommt aber auch vor, dass die Jagdgruppe tagelang ohne Erfolg unterwegs ist. Das ist dann für den Clan sehr bedrohlich.“
2. Verwandtschaftliches Leben im 19. Jahrhundert
Aus dem Leben der Urgroßeltern Schmits
(1853–1924)
Die 1888 in Mettmann geborene Paula Auguste Schröder geb. Schmits beschrieb auf Bitte eines ihrer Großneffen im Jahre 1952 Wesensmerkmale und Tätigkeiten seiner Urgroßeltern August Schmits und Laura Schmits geb. Nordmann. 1974 starb Paula Auguste Schröder in Düsseldorf.
Dein Urgroßvater, der ja mein Vater war, kam 1853 in Mettmann zur Welt. Bis zu seinem 14. Lebensjahr besuchte er die Elementarschule in Mettmann. Da er ein guter Schüler war, hätte sein Lehrer es gern gesehen, wenn Dein Urgroßvater auch Lehrer geworden wäre. Beim Nachbarn der Familie seiner Eltern, dem Kupferschmied Hohmann, kam er in die Lehre. Seine dreijährige Militärzeit verbrachte er beim Infanterieregiment 93 in Düsseldorf. Danach ging er, wie es damals bei Handwerkern üblich war, auf Wanderschaft. In Verbindung damit hat er längere Zeit in der niedersächsischen Stadt Celle gearbeitet. Übrigens hat er von dort aus einmal seiner Mutter Agnes Schmits, die eine geborene Weier war, ein Schock Eier, das Stück zu einem Pfennig, geschickt. Ein Schock entspricht 60 Stück. Die Prüfung zum Kupferschmiedemeister legte Dein Urgroßvater vor der Handwerkskammer in Elberfeld ab.
In den 1870er Jahren machte er sich in Mettmann selbstständig, wo er 1880 Laura Nordmann heiratete. Noch im gleichen Jahr kaufte er mit seinen Ersparnissen und einem Darlehen seines Schwiegervaters Johann Peter Weier in Höhe von 3000,- Mark das Haus Freiheitsstraße 876 in Mettmann. Durch Fleiß und Klugheit brachte er das Geschäft hoch und wurde nach einigen Jahren in den Stadtrat von Mettmann gewählt. In seiner Heimatstadt war er auch Mitbegründer des Gewerbevereins für das Handwerk und der Fortbildungsschule, die allerdings nur unter schwierigen Bedingungen zustande gebracht wurde.
Das vielseitige, handwerkliche Können Deines Urgroßvaters schätzte man auch während der Zeit des Kalkabbaus im Neanderthal, wo bekanntlich im August 1856 zwei Arbeiter beim Ausräumen der Feldhofer Grotte 16 Knochen fanden, die der Lehrer Johann Carl Fuhlrott aus Elberfeld einem eiszeitlichen Menschentyp, nämlich dem Neanderthaler, zuordnete. Interessant ist ein Referenzschreiben, das Wilhelm Pasch aus Düsseldorf am 24. August 1901 Deinem Urgroßvater ausgestellt hatte: „Während meiner Tätigkeit als Geschäftsführer und Betriebsleiter der früheren Actien-Gesellschaft für Marmor-Industrie zu Neanderthal, von Anfang der 70er Jahre bis Ende der 80er Jahre, habe ich den Kupferschläger, Installateur und Pumpenmacher Herrn August Schmits zu Mettmann bei Anlage von Brunnen vielfach zu Rate gezogen, und, auf Grund dessen hervorragender Kenntnisse über die Wasserführung des Gebirges, eine Anzahl von Brunnen für Trinkwasser mit stets sicherem Erfolg an verschiedenen Stellen des im allgemeinen als brüchig und wasserarm bekannten Neandertales und Hochdahler Terrains anlegen lassen, welche sich auch dauernd als gut, gesund und gleichmässig wasserhaltend bewährt haben. Die fachmännische Kontrolle dieser Brunnen und ihrer Querschläge auf genügenden Wasserzufluss vor Ort, während des Abteufens und auch später, wurde gleichfalls stets durch Herrn Schmits ausgeführt. Die für die Brunnen erforderlichen Pumpen und Leitungen, eine Pumpe ausgenommen, hat Herr Schmits geliefert und eingebaut, desgleichen umfangreiche Rohrnetze zur Verteilung des der Hauptleitung des Neandertaler Pumpwerkes entnommenen Betriebswassers auf die verschiedenen Ziegeleiarbeitsplätze und sonstigen Verbrauchsstellen der genannten Actien-Gesellschaft, ferner führte derselbe um die Mitte der 1880er Jahre große bauklempnerische und Zinkbedachungsarbeiten beim Umbau des Neandertaler Spinn- und Weberei-Etablissements aus, desgleichen stets auch einen Teil der Erneuerung und Unterhaltung des diversen Betriebsgeschirrs.
Nach Inkrafttreten des Dynamitgesetzes lieferte Herr Schmits für die Neandertaler Steinbrüche ein zum Teil aus seiner eigenen Initiative von ihm construiertes System von Sicherheitsapparaten zum gefahrlosen Auftauen von erstarrtem Dynamit und erwarb sich damit die ungeteilte Anerkennung auch der behördlichen und berufsgenossenschaftlichen Aufsichts-Organe. Bei all diesen Leistungen, Lieferungen und Arbeiten, deren Betrag sich auf viele tausende von Mark belaufen hat, und für welche sich nicht immer feste Preisvereinbarungen im Voraus treffen liessen, ist es niemals zu Differenzen und Beanstandungen irgendwelcher Art gekommen. Ich habe Herrn Schmits allezeit als einen kenntnisreichen, zuverlässigen, ruhigen und umgänglichen Mann, als rechtlich denkenden und handelnden tüchtigen Handwerksmeister und Geschäftsmann kennen und schätzen gelernt und rechne es mir zur Ehre, ihm solches hiermit bescheinigen zu dürfen.“
Düsseldorf, Carl-Antonstr. 24, den 24. August 1901
gez. Wilhelm Pasch