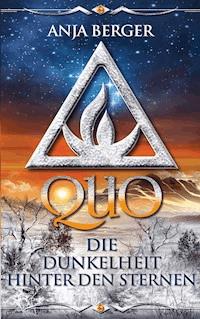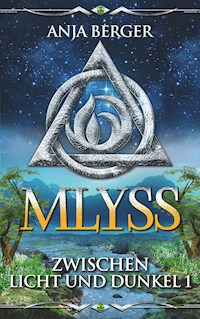4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Vor sechs Jahren verbreitete Der Menschen-Präparator in Basel Angst und Schrecken. Nun ist er wieder da. Ein neuer spannender Thriller von Anja Berger. Eine schreckliche Entdeckung trübt die Basler Fasnacht: grausig zugerichtete Leichen stellen die Polizei vor ein Rätsel. Als wenig später Auszüge aus Memoiren über eben diese Funde unter die Fanpost der TV-Köchin Tessa geraten, ist das Grauen perfekt. Der Täter beschreibt ausführlich, wie er die Opfer bei lebendigem Leib präpariert, dann ihre Leichen kostümiert und während der Fasnacht in Szene setzt. Einzig der Polizeibeamte Colin Jäger, mit dem Tessa seit kurzem ausgeht, erkennt, was vor sich geht: Der Mann, der schon vor sechs Jahren präparierte Leichen ausgestellt, beinahe seine Karriere ruiniert und seine damalige Freundin brutal ermordet hat, ist zurück. Und die Auszüge aus dem Memoiren sind erst der Anfang. Aber wovon diesmal? Und warum jetzt? Während Colin noch Antworten sucht, hat sich der Täter bereits sein nächstes Opfer geholt, um es lebend zu präparieren: Tessa. »Der Menschen-Präparator« von Anja Berger ist ein eBook von Topkrimi – exciting eBooks. Das Zuhause für spannende, aufregende, nervenzerreißende Krimis und Thriller. Mehr eBooks findest du auf Facebook. Werde Teil unserer Community und entdecke jede Woche neue Fälle, Crime und Nervenkitzel zum Top-Preis.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 608
Ähnliche
Anja Berger
Der Menschen-Präparator
Kriminalroman
Knaur e-books
Über dieses Buch
Vor sechs Jahren verbreitete der Menschen-Präparator in Basel Angst und Schrecken. Nun ist er wieder da. Ein neuer spannender Krimi von Anja Berger.
Eine schreckliche Entdeckung trübt die Basler Fasnacht: grausig zugerichtete Leichen stellen die Polizei vor ein Rätsel. Als wenig später Berichte über eben diese Funde unter die Fanpost der TV-Köchin Tessa geraten, ist das Grauen perfekt. Der Täter beschreibt ausführlich, wie er die Opfer bei lebendigem Leib präpariert, dann ihre Leichen kostümiert und während der Fasnacht in Szene setzt. Einzig der Polizeibeamte Colin Jäger, mit dem Tessa seit Kurzem ausgeht, erkennt, was vor sich geht: Der Mann, der schon vor sechs Jahren präparierte Leichen ausgestellt, beinahe seine Karriere ruiniert und seine damalige Freundin brutal ermordet hat, ist zurück. Und die Berichte sind erst der Anfang. Aber wovon diesmal? Und warum jetzt? Während Colin noch Antworten sucht, hat sich der Täter bereits sein nächstes Opfer geholt, um es lebend zu präparieren: Tessa.
Inhaltsübersicht
Memoiren eines Künstlers
Sonntag, 13. Februar 2005
»Bist du kitzlig, mein Püppchen?« Ich halte in der Bewegung inne und sehe zu ihr auf. Ihr Kopf sackt zur Seite, ihre weit geöffneten milchig wirkenden Augen schauen mich an.
Sie ist wunderschön. Sie ist mir so gut gelungen. Dieses Porzellangesicht mit den Pausbäckchen und dem immerwährenden Kussmündchen, diese Augen mit den leuchtend blauen Linsen – ein einziges Meisterwerk, von mir gefertigt.
Doch etwas fehlt.
Ich stehe auf, packe den knallroten Lack weg, mit dem ich eben noch ihre Fußnägel verschönert habe. Kritisch betrachte ich mein Püppchen, meine Schöpfung.
Da fällt es mir endlich auf. Ihre Wangen sind viel zu blass. Sie braucht Rouge.
Ich hole eine silberne Dose aus meinem Utensiliengürtel. Auf dem Deckel ist eine Rose eingraviert.
»Na, erkennst du sie? Natürlich tust du das. Sie gehört dir.«
Sie hat eine schöne Farbe gewählt. Ein sattes Rot, passend zu dem Lippenstift. Die Farbe der Sünde. Ob sie das bewusst so ausgesucht hat? Wie dem auch sei, sie ist nicht hier, weil sie eine Sünderin ist. Sie ist einfach nur wunderschön. Das ist alles. Ein Fehler der Natur, weiter nichts. So läuft das eben: Ein Gesicht wie das ihre muss herausgeputzt werden!
Es gibt aber auch andere Gesichter. Bei denen kann keine Schminke mehr etwas ausrichten. Bei denen hilft nur eins: Das Gesicht abziehen und durch eine neues ersetzen.
Ich prüfe das Ergebnis meiner Arbeit. Die Kontur ihres linken Wangenknochens ist noch nicht perfekt betont. Ich setze den Pinsel erneut an, lasse meine Gedanken weiter schweifen.
Will man ein Gesicht entfernen, schneidet man am Rand des Haaransatzes mit einem scharfen Messer die Haut auf. Besonders viel Spaß macht das bei lebendigen Objekten. Die veranstalten aber einen immensen Lärm. Da muss man sich schon gut mit den Nachbarn verstehen, will man keine unangenehmen Überraschungen erleben.
Mein Püppchen hat geschrien wie am Spieß. Ihretwegen habe ich beinahe meinen gesamten Betäubungsmittelvorrat aufgebraucht, sonst hätte ich ihre Beine und Arme nicht präparieren können. Aber ich bin ihr nicht böse deswegen. Sie war toll. Eines der besten Spielzeuge bisher, wirklich. Die Fotos, die ich von ihr geschossen habe, sind auch richtig gut geworden. Ich werde sie später in meine Sammlung aufnehmen.
Grinsend trete ich erneut einen Schritt zurück, betrachte kritisch mein Kunstwerk. Ihre Wangen leuchten mit den Lippen um die Wette.
Ich bin zufrieden. Mein Püppchen ist ein farbenfroher Kontrast zu der sonst grauen Umgebung.
Als ich sie hergebracht habe und sie zu sich kam, konnte ich in ihren Augen sehen, dass sie sich den Ort, an dem sie sterben würde, anders vorgestellt hatte. Wärmer. Liebevoller. Nicht so einsam und kalt. Ihre letzten Stunden hätten in ihrer Vorstellung nicht in einer übelriechenden Folterkammer stattfinden sollen. Aber so war es nunmal.
In dem Zimmer, in dem sie wohnt, bis ich mit ihr fertig bin, riecht es nicht nach frischer Wäsche. Es riecht nach Schweiß. Blut. Urin. Erbrochenem. Tod.
Sieht man aber über die fleckige Wand und die menschlichen Ausscheidungen hinweg, entdeckt man Kunst. Denn das ist es, was meine menschlichen Präparate sind: Kunst. Und diese gilt es nun, der Öffentlichkeit zu präsentieren.
Ich gehe zum Schrank und betrachte die Larven, die dort lagern. Ich hole den Waggis heraus – ein aus Pappmaschee gefertigter Kopf mit einer überdimensionalen Nase und langem, rotgelbem Basthaar, das wild wippt, wenn man sich bewegt. Diese Basler Fasnachtsfigur Waggis ist dem Elsässer Gemüsebauern nachempfunden. Ich mag diese Kostümierung. Die Figuren dürfen sich während der Fasnacht beinahe alles erlauben. Sie sind wild und ungehobelt.
»So darfst du auch bald sein, Püppchen. Aber nicht heute. Heute ist der Auftakt der Fasnacht, und für diese besondere Nacht habe ich ein ganz besonderes Menschenpräparat angefertigt.«
Sonntag, 13. Februar 2005
In Basel/Fünf Stunden vor dem Morgenstreich
Es war kurz vor dem Auftakt der Basler Fasnacht. Waldi und Colin waren für den Dienst eingeteilt. Die beiden waren zusammen auf der Polizeischule gewesen, wo sie sich kennengelernt hatten. Auch Carolina, Waldis Schwester, ließ sich gleichzeitig zur Polizistin ausbilden. Sie war zwar ein Jahr jünger als ihr Bruder, doch im Gegensatz zu ihm war sie in ihrer schulischen Laufbahn kein einziges Mal sitzen geblieben. Die drei freundeten sich rasch an, wobei aus Colin und Carolina bald ein Paar wurde. Um nicht getrennt zu werden, bewarben sie sich alle drei nach der Ausbildung erfolgreich bei der Basler Polizei, wo sie, mit Ende zwanzig, ihre Karrieren begannen. Dass Colin und Waldi Partner wurden, war hingegen reiner Zufall.
Auch wenn Colin und Waldi in dieser besonderen Nacht lieber nicht gearbeitet hätten, so hatten die Kollegen mit Familie, vor allem die mit Kindern, bei der Ferieneinteilung Vorrang.
Zumindest entging ihnen beiden der große Moment nicht, wenn um Punkt vier Uhr morgens sämtliche Lichter in der Innenstadt erloschen. Auf Befehl des Tambourmajors setzten sich dann die Cliquen in Bewegung. Dabei spielten alle ein und denselben Marsch: den Morgestraich.
Dass Colin Dienst hatte, war also eigentlich die Garantie dafür, den Morgenstreich live mitzuerleben, genauso wie seine Kollegen, die mit ihren Freunden und Familien in der Stadt unterwegs waren. Obwohl oder eher, weil er arbeitete, würde er auch die kommenden Fasnachtstage nicht verpassen. Auf Streife konnte er mit ansehen, wie die Waggiswagen ihre Gaben an die Zuschauer verteilten oder sie mit den bunten Papierschnipseln, die die Basler beinahe liebevoll als Räppli bezeichneten, bewarfen. Er konnte die strammen Schläge der Tambouren und die grellen Klänge der Piccolos hören. Er konnte die in liebevoller Handarbeit angefertigten Larven und Kostüme bestaunen, genauso wie die aufwendig gestalteten Laternen.
Colin war also einigermaßen enthusiastisch, als er an diesem Abend seinen Dienst aufnahm.
Waldi und er patrouillierten zu Fuß. Die Lichter der Straßenlaternen schimmerten in verzerrten Flecken auf dem regennassen Asphalt. Inzwischen hatte der Regen aufgehört, und wenn der Wetterbericht Wort hielt, würde er bis Donnerstagmorgen auch nicht mehr einsetzen.
Es waren bereits viele Leute unterwegs, vor allem die Nachtschwärmer. Die Fasnächtler dösten größtenteils noch in ihren Betten oder bereiteten sich in diesem Moment auf ihren großen Einsatz vor. Der eine oder andere Passant zeigte in eindeutigen Gesten oder Ausrufen, was er von der Polizei hielt. Doch Colin hatte keine Lust, sich darüber zu ärgern.
Sie passierten gerade die Mittlere Brücke, die mit ihren massiven Steinbögen den Rhein überspannt, als der Funk knisterte: ein Notruf aus der Zentrale im Spiegelhof. Es wurde polizeiliche Unterstützung im Hotel Les Trois Rois verlangt. Eine traditionsreiche Unterkunft am Rheinufer, die ihren Namen den drei Statuen verdankte, die auf einem Sockel an der Fassade thronten. Während der Fasnacht war es allerdings schlicht das Drei Waggis – eine beliebte Location mit überteuerten Getränkepreisen.
Die beiden Männer wechselten einen bedeutungsschweren Blick. Das war eindeutig ein Einsatz für sie, denn das Grand Hotel stand direkt vor ihnen. Waldi ließ die Zentrale sofort wissen, dass er und Colin sich um den Notruf kümmern würden.
Waldi, erpicht darauf, sich dem Problem zu stellen, übernahm die Führung. Aus tiefer Überzeugung, die anstehende Aufgabe in jedem Fall zu meistern, grinste er bereits jetzt triumphierend.
Ehe Colin sich richtig wappnen konnte, blieb Waldi vor dem Zielort stehen, eine Hand zur Faust geballt in die Hüfte gestemmt, mit der anderen kratzte er sich seinen kahlen Schädel. »Sie sagten, der Mann, der den Notruf abgesetzt habe, würde uns in Empfang nehmen, aber da ist niemand.«
Colin ließ seine dunklen Augen über den ausladenden Eingang die elegante Front hinauf zum Sockel und den drei Figuren wandern. Wie zur Fasnacht üblich, waren über ihre Roben einfache weiße Hosen sowie blaue Hemden und über ihre Kronen Waggislarven gezogen worden. Colins Blick blieb an der linken Figur hängen. Sie wirkte irgendwie unordentlich eingekleidet. Das Hemd war nicht richtig in die Hose gesteckt worden, die Larve saß schief. Die Schultern waren breiter, dafür wirkte die Figur insgesamt kleiner als die anderen.
»Sieh mal, ich denke, das dort drüben ist unser Empfangskomitee«, riss Waldi Colin aus seinen Betrachtungen. Colin löste den Blick von der Figur und folgte Waldi.
Vor einem Nebeneingang stand ein Mann. Er blickte unruhig hin und her, wartete offensichtlich auf die gerade angekommenen Polizisten. »Kommen Sie, bitte«, drängte der Mann die Polizisten ins Innere des Gebäudes, vorbei an fleißigem Personal, das letzte Hand vor dem großen Showdown anlegte. »Mein Name ist Joseph, ich trage hier die Verantwortung während der kommenden Tage.«
»Haben Sie den Notruf abgegeben?«, fragte Colin routiniert.
Joseph, der gut zwei Köpfe kleiner war, als der 1,95 Meter große Colin, sah zu seinem Gegenüber auf. »Ja, bitte folgen Sie mir. Es ist einfach entsetzlich!«
»Sie haben zu Protokoll gegeben, dass Sie einen Toten entdeckt haben. Zeigen Sie uns doch bitte, weshalb wir hier sind.«
»Es ist unaussprechlich. Und das gerade heute! Sie müssen das so unauffällig und schnell wie möglich beseitigen, bitte. Die Hotelgäste dürfen von alledem nichts mitkriegen. Es ist schon beunruhigend genug, dass die Polizei im Haus ist.«
»Zeigen Sie uns einfach erst einmal, was Sie gefunden haben.« Colin hatte nicht vor, sich durch die Nervosität des Mannes anstecken zu lassen. Er hatte seinen Job zu erledigen, ob es Joseph gefiel oder nicht.
»Okay«, Joseph nickte einmal so heftig, dass sich eine Strähne seiner pechschwarzen Haare aus seinem säuberlich zurechtgemachten Seitenscheitel löste. Er ging den beiden Uniformierten voraus und führte sie über die gepflegten Treppen weiter nach oben.
Als er einen Raum betrat, der dem Rhein abgewandt zur Straße hin lag, konnte Colin Josephs Widerwillen deutlich spüren.
Waldi sah sich in dem Raum um. »Wo ist sie?«, fragte er, als er das Erwartete nicht entdecken konnte. Colin stutzte ebenfalls. Eine Leiche hatte man ihnen angekündigt, doch davon war hier drinnen nichts zu sehen.
Joseph rang seine zittrigen Hände. »Kommen Sie näher, bitte.« Er trat ans Fenster am gegenüberliegenden Ende des Raumes, umschloss den Griff, als kostete es ihn enorme Überwindung. Er zögerte, dann öffnete er endlich den Flügel des Fensters.
Colin hatte, ohne es zu merken, den Atem angehalten, den er jetzt langsam entweichen ließ. Er gab Waldi den Vortritt. Dieser richtete arglos den Blick nach draußen, suchte dann den Rahmen ab. Colin erkannte, wie Waldis Augenbraue sich fragend hochzog. Eine Geste die auch dem nervösen Joseph nicht entging, der sogleich helfend einsprang. »Links von Ihnen.« Josephs Stimme zitterte inzwischen beinahe so sehr wie seine Hände.
»Ich kann nichts sehen, außer die Statue …« Waldi brach ab. Sein Körper erstarrte, seine Nackenmuskeln über dem Kragen seiner Uniform spannten sich an.
»Heilige Scheiße …«, stieß er hervor und trat vom Fenster zurück. Colin drängte sich an seinem Partner vorbei, der sich am Funk zu schaffen machte.
Er streckte den Kopf aus dem Fenster und wandte ihn nach links. Colin fand sich direkt neben einer der drei namensgebenden Figuren, die die Fassade des Hotels zierten. Das blaue Hemd, das die Figur traditionsgemäß während der kommenden Tage trug, bauschte sich im Wind auf. Die steife Brise trug Colin einen süßlich-fauligen Geruch entgegen. Spontan setzte sein Würgereflex ein. Colin erschauderte. Das Hemd flatterte kurz und gab Colin einen Blick auf das frei, was darunterlag. Rötlich weiß marmoriert schimmerte die Oberfläche der Figur unter der Kleidung im diffusen Licht der Fassadenbeleuchtung.
Mit einem Mal wurde Colin klar, woran er sich zuvor gestört hatte, als er sich die drei Figuren an der Fassade angesehen hatte: Das, was er hier vor sich hatte, war keine Statue. Der dritte König war ein Mann. Ein toter Mann. Gehäutet. Verkleidet. Ausgestellt.
Memoiren eines Künstlers
Dienstag, 15. Februar 2005
Der Umzug ist bunt und fröhlich. Eine Menge Räppli wirbeln durch die Luft, und ich bin zusammen mit meinem Püppchen mittendrin.
Ich springe wild durch die Gassen, dass mein Basthaar nur so wippt. Die Schubkarre, in die ich mein Püppchen gesetzt habe, schiebe ich vor mir her.
Hier und da erschrecke ich den einen oder anderen Passanten, indem ich einfach auf ihn zurenne. Aufgescheucht wie Rehe packen die Leute in solchen Momenten ihre Kragen, ziehen sie um ihren Hals fest zu, aus Angst, eine Ladung Räppli abzubekommen. Dabei habe ich kaum welche dabei. Kichernd sehen sie mir nach, wenn ich unverrichteter Dinge weiterziehe.
»Na, Püppchen, gefällt dir die Fasnacht? Habe ich dir zu viel versprochen?«
Ein kleines Kind mit weißer Zipfelmütze kommt mit ausgestreckter Hand auf mich zu. Aber ich habe nichts, was ich ihm geben kann, und biege scharf nach rechts in die nächste Gasse ab. Die Altstadt von Basel ist wunderschön, zur Fasnachtszeit sowieso. Ich genieße das trockene Wetter, lasse mich von der ausgelassenen Stimmung weiter antreiben. Vor einem Cliquenkeller am Nadelberg mache ich halt. Ich habe gute Lust auf ein kühles Bier, aber ich kann mein Püppchen nicht zurücklassen.
Ich steuere die Karre weiter, am Fasnachtskeller vorbei, ratternd die nächsten Stufen hinunter, durch ein dichtes Gewühl gut gelaunter, staunender und faszinierter Menschen. Am Marktplatz angekommen, fahren große Wagen an mir vorüber, die kostümierten Menschen darauf brüllen mich an, intrigieren. Einer pöbelt, ob meine Begleitung zu betrunken sei, um etwas sagen zu können, was ich mit tiefer Stimme bestätige. Dafür bekommt sie ein Redbull und ich ein Bier, weil ich so schwer schieben muss. Sehr nett, diese Herren in ihren schwarzen Kostümen.
Nach einer Weile finde ich mich unterhalb der Martinskirche wieder. Ich schaue sie mir an. Nach kurzem Überlegen beschließe ich, dass das der richtige Ort ist. Ich schiebe die Karre zwischen den Sevogelbrunnen und die Umfassungsmauer mit dem niedrigen Gitter, die das Staatsarchiv einrahmt. Den Blick auf die Kirche gerichtet, setze ich mich vor die Schubkarre und öffne mein Bier. Ich krame einen Strohhalm hervor, ohne die Handschuhe auszuziehen, und stecke ihn in die schmale Öffnung der Flasche. Ich proste dem Krieger auf dem Brunnstock zu. Er hütet seine Säule in etwa so starr wie mein Püppchen ihre Karre. Ich sauge an dem Strohhalm. Das Bier ist etwas zu warm. In einer anderen Situation hätte mich das geärgert. Hier und heute nehme ich es hin. Denn es gibt im Augenblick etwas Wichtigeres als warmes Bier. Durch die kleinen Augenöffnungen in der Larve beobachte ich die Menschen, die meinen Weg kreuzen. Die wenigen, die sich hierher verirren, beachten mich kaum. Sie sind alle mit sich selbst beschäftigt.
Im Staatsarchiv ist voraussichtlich niemand zugegen, immerhin ist Fasnacht.
Ich werde etwas wehmütig, als ich meinen schwerer werdenden Kopf meinem Püppchen zudrehe. Es ist Zeit. Zeit, sich zu verabschieden.
Dienstag, 15. Februar 2005
Auf der Polizeiwache
Eine seltsame Nervosität lag in der Luft. Die Polizei arbeitete bereits auf Hochtouren daran, zu rekonstruieren, was geschehen war und wer für den Toten an der Hotelfassade verantwortlich ist. Was Colin am meisten beschäftigte, war die Frage nach dem Warum. Was musste dem Täter widerfahren sein, um sich solche Grausamkeiten auszudenken und sie dann auch noch umzusetzen?
Am Nachmittag war wieder ein Anruf in der Notrufzentrale eingegangen. Ein älteres Ehepaar hatte eine leblose Frau in einer Schubkarre hinter dem Sevogelbrunnen gefunden. Wie sich herausstellte, war die Frau bis zu den Knien zu einer Art Strohpuppe umgewandelt worden.
»Denkst du, es wird eine Dritte geben?« Carolina saß Colin in dem kleinen Café gleich um die Ecke der Wache gegenüber, rührte gedankenverloren in ihrem Kaffee. Sie verbrachten ihre Pausen oft gemeinsam hier, denn egal, wie wild es draußen zuging, hier drinnen war es ruhig und gemütlich. Der Geruch nach frischem Kaffee sorgte für eine wohlige Atmosphäre. Das Café lebte von der Theke mit frischem Gebäck und dem Angebot verschiedenster Kaffeekreationen zum Mitnehmen im vorderen Teil des Lokals. Neben Colin und Carolina waren nur zwei weitere Gäste anwesend. Sie waren ebenfalls Polizisten, die für einen kurzen Moment Abstand von der Aufregung suchten.
Colin sah zu Carolina auf. Wie jedes Mal, wenn er sich innerlich nicht wappnete, verschlug ihm ihr Anblick kurz die Sprache, ließ ihn alles rundherum vergessen. Diese faszinierenden dunklen Augen luden ein, darin zu versinken und nie wieder aufzutauchen. Wie sehr wünschte er, er könnte das jetzt tun. Einfach mit ihr verschwinden und dieses entsetzliche Chaos hinter sich lassen. Aber das war unmöglich. Er hatte Polizist werden wollen. Das brachte Verantwortung mit sich. Er konnte nicht einfach abhauen, nur weil es schwierig wurde. Jetzt war die Zeit, herauszufinden, ob er wirklich für diesen Job geschaffen war.
»Ich hoffe nicht. Aber die Anzeichen sprechen dafür. Am Morgenstreich die erste, am Fasnachtsdienstag die zweite. Da müssen wir darauf gefasst sein, am Mittwoch eine dritte Leiche aufzufinden. Es bleibt nur zu hoffen, dass wir die Kollegen nicht umsonst aus den Ferien zurückgeholt haben und den Täter tatsächlich auf frischer Tat ertappen. Es kann doch wirklich nicht sein, dass er ungesehen einfach tote Menschen in der Stadt verteilen kann! Er ist nicht unsichtbar!«
Colin schlug frustriert mit der Faust auf den Tisch. Rufus, Carolinas Diensthund, der darunter sein Nickerchen hielt, kläffte einmal kurz, ließ sich aber nicht wirklich aus der Ruhe bringen. Ein Ton, ähnlich dem Quietschen eines ungeölten Scharniers zeigte an, dass er gähnte. Dann war es wieder ruhig unter dem Tisch.
Carolina griff nach Colins Hand, fixierte seinen Blick. Sie strahlte eine Ruhe aus, die geradezu hypnotisch wirkte. »Nein, er ist nicht unsichtbar. Wenn er jedoch wirklich kostümiert unterwegs ist, wie wir denken, dann kann er sich sehr wohl unauffällig zwischen den Menschen bewegen. Wir werden ihn kriegen. Aber du darfst dich nicht so in die Sache hineinziehen lassen. Das gilt auch für meinen Bruder. Waldi nimmt das Ganze zu persönlich, agiert zu aggressiv. Das schadet mehr, als es nützt. Ihr müsst euch konzentrieren, sonst passieren Fehler, die nicht passieren dürfen. Wir arbeiten an der Sache. Wir haben die Kollegen kurzfristig aus den Ferien zurückgepfiffen. Wir alle wollen Antworten, und vor allem wollen wir dieses miese Schwein haben, das so etwas tut. Hab Vertrauen!«
Colin fuhr mit dem Daumen über ihre Knöchel, hielt an dem schmalen goldenen Ring an ihrem Zeigefinger inne, den er ihr geschenkt hatte. Ein Symbol ihrer Liebe.
Er wollte ihr glauben. Ihre Zuversicht teilen. Doch eine unheilvolle Vorahnung hielt ihn davon ab. Irgendetwas sagte ihm, dass es nicht besser, sondern nur noch schlimmer werden würde.
Memoiren eines Künstlers
Mittwoch, 16. Februar 2005
Heute pfeift der Wind scharf um die Hausecken. Die Temperaturen sind seit gestern merklich gesunken. Mir macht das nichts aus. Ich weiß Kälte zu schätzen. Ihr verdanke ich es, dass meine Toten schön frisch bleiben.
Tag drei ist angebrochen. Die Fasnacht ist fast vorbei. Zum letzten Mal mische ich mich unter das feiernde Volk. Selten hört man die Basler ihren Dialekt in diesem ausgeprägten Maß benutzen wie während der Fasnacht. Ob es daran liegt, dass nur zu dieser Zeit so viele gesellig miteinander plaudern, oder daran, dass sie ihre Sprache in den drei Tagen richtiggehend zelebrieren, weiß ich nicht – aber es nervt. Nein, es widert mich geradezu an. Diese falsche Kontaktfreudigkeit, diese gespielte gute Laune, diese übertriebene Ausgelassenheit. Alles nur Schein. Morgen ist der Spuk vorbei, und alle kriechen sie wieder in ihre Höhlen, sehen sich gegenseitig nicht mehr in die Augen, agieren als Einzelmasken, kehren als die Arschlöcher in ihre Büros zurück, die sie die restlichen 362 Tage sind. Diese Scheinheiligkeit hat es nicht besser verdient, als mit einem Schock aufgemischt zu werden. Die grausame Realität verschwindet nicht einfach unter dem Berg dieser farbigen Räppli!
Seit drei Tagen verseuchen sie die Stadt nun schon mit dieser Heile-Welt-Atmosphäre, dieser aufgesetzten Freude. Drei Tage zu viel. Ich tue so, als sei ich wie sie. Ich imitiere sie, mische mich unter die Heuchler. Gebe mich fröhlich, ausgelassen. Vor allem aber: unecht. Sie merken es nicht einmal. Sie merken auch jetzt nicht, wie dämlich sie sind, wie verachtungswürdig. Armselige Affenärsche.
Das alles kotzt mich nur noch an. Ich habe keinen Bock mehr.
Es ist an der Zeit, dieses affektierte Getue einer ganzen Stadt noch ein letztes Mal in diesem Jahr mit etwas Realität zu würzen.
Für mein Vorhaben brauche ich einen passenden Fasnachtswagen. Er muss während der Nacht abseits geparkt sein, es dürfen ihn nicht allzu viele Leute passieren, dennoch muss er gut zugänglich sein. Manche Wagen dienen nach dem Umzug, pardon, Cortège, gut und gerne noch als Bar für die Wagenclique und deren Familien, Freunde und Eroberungen. So einer darf es nicht sein.
Während ich mit meinem Lastenfahrrad, eines der Sorte, bei der der Transportkasten vorne und nicht hinten montiert ist, durch die Gassen radelte, habe ich Ausschau gehalten und bin fündig geworden. Nun mache ich mich auf den Weg dorthin.
Ich falle nicht auf. Wie schon die vergangenen beiden Tage trage ich mein Kostüm. Während der Fasnacht wundert sich niemand über einen Typen mit Fahrrad und Verkleidung. Sie würden staunen, wenn sie wüssten, was ich in meiner Transportbox in der Gegend herumfahre. Jeder vermutet unter dem hölzernen Deckel, den ich mit Scharnieren auf der Kiste befestigt habe, sowieso nur Räppli, Bonbons, Plüschtiere, Gemüse, Alkohol oder sonst was, das mit der aktuellen Veranstaltung zu tun hat. Aber bestimmt keine Leiche.
Es ist nicht immer einfach, Frauen zu finden, die für meine Ideen geeignet sind. Für meine Kochkünste darf es eine fülligere Person sein. Für meine anderen Künste hingegen brauche ich leichte, filigrane Figuren. So wie die in meiner Kiste. Eigentlich hätte ich an der Kiste noch einen Drehgriff anschrauben sollen, damit sie aussieht wie ein überdimensionierter Jack in the Box. Dieser Gedanke bringt mich unter meiner Larve zum Lächeln. Eigentlich eine gute Idee. Eins meiner Opfer zu Jack in the Box umzufunktionieren. Das ist bestimmt machbar. Mal sehen. Aber ehe der Spieltrieb ganz mit mir durchgeht, muss ich mich auf die aktuelle Aufgabe zurückbesinnen.
Ich kurve weiter durch die Gassen, überquere letztendlich die Mittlere Brücke. Dort, auf offener Fläche, den Fluss direkt unter mir, erwischt mich ein eisiger Windstoß derart unvorbereitet, dass ich fröstelnd meinen Kopf einziehe. Das Wetter dürfte morgen ziemlich garstig werden. Wenn ich mich hier weiter herumtreiben will, und das will ich, dann muss ich mehr anziehen. Ich weiche einer großen Guggenmusik aus, die in beinahe militärischem Gleichschritt über die Brücke in Richtung Kleinbasel marschiert.
In Grossbasel angekommen, schlängle ich mich durch die Menge. Je weiter ich vom Zentrum wegkomme, desto ruhiger wird es, desto mehr lichten sich die Menschenmassen. Hier in diesen Gassen und Straßen steht, was ich suche. Es gibt eine Wagenclique, die ihren Wagen immer hier abstellt, ehe die vergnügungssüchtige Truppe weiterzieht. Auftauchen würden sie erst nach Sonnenaufgang wieder.
Der Standort entspricht meinen Anforderungen. Mein Fahrrad passt gerade so neben den Wagen, wo ich es abstelle. Voller Vorfreude entriegele ich den Deckel der Box und klappe ihn auf.
Sie liegt aufgerollt wie ein Schneckenhaus oder ein Rouladengebäck in der Kiste. Sie lebt nicht mehr. Ich habe wohl etwas zu wild mit ihr gespielt. Schade. Aber Zeit für Bedauern habe ich nicht. Ich klappe den Deckel wieder zu und schleiche zum Kopf des Fasnachtswagens. Die Wagenclique enttäuscht mich nicht. Der Waggis, der stets ihre Galionsfigur ist, hängt an Ort und Stelle. Unter dem Kostüm versteckt sich eine Schaufensterpuppe.
Ich klettere auf den Wagen und sehe mir die Aufhängung an. Die Puppe ist an zwei Punkten an einem mittig am Bug des Wagens angebrachten Balken befestigt. Sie haben sie am Hals und um die Taille festgezurrt. Aufgehängt ist sie an einer simplen Schlaufe, die man über einen stabilen Haken gelegt hat. Ich löse die Seile, hole die Puppe herunter, trage sie zu meinem Fahrrad und setze sie daneben ab. Ich bin auf der Hut, lausche stets auf ungewöhnliche Geräusche. Doch es gibt keine Überraschungen, auch nicht, während ich sicherheitshalber noch um die Ecken spähe, ehe ich meine Jackie aus der Box hole und neben die Puppe setze. Ich ziehe meiner Jackie die weite Bluse der Puppe und die einfache Hose mit Gummizug über. Dann positioniere ich sie an der Stelle auf dem Wagen, an der zuvor die Puppe gehangen hat. Ich ziehe ihr die Larve über und hauche ihr zum Abschied einen Handkuss zu.
Als der Morgen graut, sich die kalte Luft mit dem Tageslicht verändert, kauere ich in der Kiste meines Fahrrades, das ich mit Blick auf den Fasnachtswagen an einem Laternenmast abgestellt und angekettet habe. Angekettet, weil man nie weiß, was diesen Fasnächtlern alles in den Sinn kommt. Die Abdeckung der Box habe ich geschlossen. Neben meinen angewinkelten Füßen liegt meine Larve. Meine Gliedmaßen fühlen sich allmählich steif an. Trotz der Decke, die ich über mir ausgebreitet habe, sind meine Finger und Zehen kalt. In der Box riecht es noch nach meinem Mädchen. Ein Duft, der Sehnsüchte weckt. Sie ist nicht weit von mir entfernt und doch unerreichbar. Nun, sie hat eine Aufgabe, und die wird sie perfekt erfüllen. Meine Bedürfnisse, sie zurückzuholen und bei mir zu behalten, muss ich zurückstellen. Bald werde ich eine neue Spielgefährtin haben. Dieser Gedanke tröstet mich ein wenig.
Draußen werden auf einmal Geräusche laut. Ich vernehme die für Holzschuhe typische Abfolge von Schlurfen und Klackern. Heisere Männerstimmen lassen mich aufhorchen. Ich spähe durch den Spalt und warte. Es dauert eine gefühlte Ewigkeit, bis sie in meinem Blickfeld auftauchen. Ich schaue mir ihre Kostüme an und spüre, wie sich mein Magen nervös zusammenzieht. Das sind sie. Das ist die Truppe zum Wagen, den ich etwas umgestaltet habe. Ich lausche den Sticheleien, die sie austauschen. Anscheinend haben sie eine erfüllte Partynacht hinter sich gebracht und nur kurz geschlafen, wenn überhaupt.
Einfältiges Pack!
Mit trockenem Mund beobachte ich, wie der Erste auf den Wagen steigt. Anfangs noch arglos, bleibt er auf einmal stehen. Mit gefurchter Stirn dreht er sich zu seinen Kumpanen um. »Sagt mal, ist hier was anders?«, fragt er verwirrt.
Einer der anderen lacht laut auf, während ein Dritter nachhakt. »Was soll anders sein?«
Der vierte im Bunde besteigt den Wagen. Er scheint der mit Abstand ausgeschlafenste zu sein. Er klopft seinem Kumpel auf die Schultern. »Alter, nichts ist anders. Du bist einfach noch betrunken, und selbst das ist normal.«
Den Misstrauischen scheint die erhaltene Antwort noch nicht ganz zufriedenzustellen. Er schaut sich um, wirkt, als würde er darüber nachdenken, ob er sein ungutes Gefühl ignorieren oder ihm auf den Grund gehen soll. »Ach verdammt«, murmelt er dann kopfschüttelnd, »du hast wahrscheinlich recht. Ich habe gestern wirklich über die Stränge geschlagen.«
»Zum Glück hast du eine Larve, dann sieht wenigstens niemand die kleinen, roten Knöpfe, die du Augen nennst«, sagt der Dritte, während er sich zu den anderen auf den Wagen gesellt.
Amüsiert verfolge ich die Szene. Der Vierte folgt seinen Vorgängern. »Wann kommen die anderen?«, fragt er, während er einen leeren Plastikbeutel aufnimmt und aus dem Wagen wirft.
Anscheinend ist das die Vorhut, die mit der Vorbereitung des Wagens für den Umzug betraut ist.
»Keine Ahnung«, kommt die Antwort aus dem Innern des Wagenaufbaus. Damit ist die Frage, ob etwas nicht stimmt, endgültig vom Tisch.
Ich warte noch einen Moment, spähe aus meiner Box. Lauere. Als alle vier von meinem Fahrrad abgewandt mit sich selbst und ihrer Aufgabe beschäftigt sind, krieche ich aus meiner Kiste und radle unbemerkt davon.
Mittwoch, 16. Februar 2005
Basler Fasnacht
Je länger Tom mit den Händen fuchtelnd die Leute am Straßenrand zu Reaktionen provozierte, desto wärmer wurde ihm. Es war temperaturmäßig nicht die ideale Fasnacht, aber der angekündigte Regen war bisher ausgeblieben, teilweise zeigte sich sogar die Sonne. Zum Glück. Denn nass und kalt war ihm definitiv das verhassteste Wetter von allen, auch wenn er, wie alle Fasnächtler, gut eingekleidet und auf alle Eventualitäten vorbereitet war. Tom hatte seine Trommelschlägel längst an den Nagel gehängt. Dennoch erinnerte er sich gut an die Momente, in denen es ihm und seinen Kollegen aus der Clique zu eisig wurde. Die fleißig klappendrückenden Finger der pfeifenden Damen und Herren versteiften sich allmählich, und die Lippen wurden taub. Dann nutzten die Aktiven ihre Pausen, um sich bei heißem Wasser vermengt mit Zucker und Schnaps aufzuwärmen – nur eine der diversen Möglichkeiten, das gefrorene Blut wieder in Wallung zu bringen und die Energie für die nächste Runde zu sammeln. Den Schnaps lehnte Tom heute noch nicht ab. Auch wenn an Tagen wie diesem die Keller überquollen, weil sich Aktive und Passive gleichermaßen ein warmes Plätzchen suchten. Das bedeutete vor allem für das Servicepersonal und die zahlreichen Helfer Stress, aber auch locker sitzende Portemonnaies.
Tom schwang das Bein über den Rand des Fasnachtswagens und klopfte mit seinen Holzzoggeli gegen die Wand. Seine Larve wog langsam schwer, aber das war ihm eigentlich egal. Heute war der letzte Fasnachtstag, und seine Gefühle waren wie immer gemischt. Noch einmal so richtig auf den Putz hauen, alles aus den Leuten rausholen, gleichzeitig aber mit Wehmut die letzte Ware an williges Publikum loswerden. Das Kostüm, das in der heißen Phase vor der Fasnacht noch letzte Anpassungen erfahren hatte, war inzwischen ein Teil von ihm, die Larve, die er in stundenlanger, minutiöser Handarbeit selbst gefertigt hatte, fühlte sich an, als wäre sie angewachsen, auch wenn sie den Nacken allmählich zusammenzudrücken schien. So federleicht, wie sie sich am Montag noch angefühlt hatte, war sie heute nicht mehr. Es waren drei intensive Tage gewesen, er war müde, wollte aus den Sachen raus und sie doch nicht loslassen. Fast wie bei seiner Exfrau. Er hatte aus der Beziehung rausgewollt und konnte sie dennoch nicht loslassen. »Himmel, es reicht mit dieser Trübsalblaserei«, wies er sich selbst zurecht. »Das ist der Schlafmangel, nichts weiter.«
Tom durchkämmte mit Kennerblick die wartende Menge. Er griff gedankenverloren in den Sack neben sich, warf die Bonbons vorsichtig den Leuten entgegen, während er diejenigen, die direkt vor dem Wagen standen und etwas zu ergattern versuchten, mit einer Ladung Räppli bedachte.
Weiter vorne entdeckte Tom ein hübsches kleines Mädchen am Straßenrand, das sich scheu ans Bein einer ebenso hübschen Frau klammerte. Ob das die Mutter war? Als hätte die Kleine etwas gespürt, nahm sie Tom mit ihren großen braunen Augen ins Visier, ansonsten rührte sie sich nicht. Erst als Sigi den Wagen weiter in ihre Richtung lenkte, zog die Kleine die Frau am Rock. Was stellte die Blonde dar? Schürze, Rock, Bluse. Eine Marktfrau? Er wusste es nicht, aber sie hatte etwas, vor allem, als sie die Kleine hochhob und dann Tom ansah.
»Sieht auch etwas abgekämpft aus, die Gute. Vielleicht hilft ein Schnäpschen«, überlegte er sich und entdeckte gleichzeitig den Becher um ihren Hals. Sigi bremste ab, der Wagen fuhr langsamer. Vorne auf der Route war einiges los.
»Ideal«, dachte Tom laut und zog einen Plüschhasen und eine Flasche Williams aus seinem Fundus. Er streckte der Kleinen den Hasen noch nicht entgegen, sondern wartete ab. Sie sah ihn an. Normalerweise ließen sich die Leute von den gemalten Augen seines Waggiskopfes ablenken und fanden den direkten Blickkontakt nicht. Die Kleine war da anders. Sie entdeckte die Löcher in der Larve, knapp oberhalb der Pappmascheelippen, hinter denen seine Augen lagen. Obwohl sie ihn direkt ansah, erkannte er in ihrem Blick eine scheue Zurückhaltung. Sie würde ihn nie direkt nach einer Gabe fragen, dazu reichte ihr Mut noch nicht aus, ihre Augen hingegen sprachen Bände.
Tom musste lächeln. Er wackelte hinter der Wagenwand mit dem Hasen, sodass die Kleine einen Blick darauf erhaschen konnte. Als sie das Plüschtier entdeckte, wurden ihre Augen größer und leuchteten auf einmal, als hätte jemand ein Licht angezündet. Vorsichtig streckte sie den Arm. Tom legte den Plüschhasen in ihre kleinen Hände. Kleinlaut bedankte sich das Mädchen.
Die Kleine war zuckersüß, und das Beste: Er hatte bisher kein einziges Wort sagen müssen. Seine Stimme, die längst einem heiseren Krächzen gewichen war, würde es ihm danken. Nun war die Frau an der Reihe. Er sah ihr in die Augen. Die Blondine lächelte, verlagerte das Gewicht der Kleinen auf ihrer Hüfte und reichte ihm ihren leeren Zinnbecher. Er füllte ihn gut und prostete ihr mit der Flasche zu. Er war so angetan von der Blondine und diesem süßen Mädchen mit seinem Hoppelhasen, dass er kaum wahrnahm, wie hinter ihm Bewegung in den Wagen kam.
»Verfluchte Scheiße!«, rief Eugene aus und riss sich die Larve vom Kopf. Erst jetzt reagierte Tom. Er stellte die Flasche weg und drehte sich um.
»Was ist …?« Der Rest des Satzes blieb ihm im Hals stecken.
Cédric hatte sich wie so oft am Kopf des Wagens postiert, wo er auf den Rand kletterte und sich am mittleren Pfosten festhielt. Dort posierte er gerne zusammen mit der Galionsfigur.
Normalerweise legte er den Arm um sie, gab ihr Küsschen, stellte sich hinter den Pfosten, an dem sie festgemacht war, sodass man ihn von vorne nicht sofort entdeckte. Dann steckte er seine Arme durch das Kostüm der Puppe und bewegte sie. Das sah urkomisch aus und erregte die Aufmerksamkeit der Passanten. Aber heute nicht. Heute weckte etwas ganz anderes das Interesse der Zuschauer.
Der Galionsfigur war der Kopf nach vorne gekippt, ihre Larve darüber hinweggerutscht und auf die Straße gefallen.
Tom schluckte schwer. Das konnte nicht gehen, denn sie war nur eine Schaufensterpuppe. Ihre Gliedmaßen waren gelenkig, damit Cédric seine Spielchen treiben konnte. Nur der Kopf, der saß steif auf dem Nacken.
Ein unangenehmes Kribbeln machte sich in Toms Fingerspitzen breit. Er schwang sein Bein über den Rand zurück in den Wagen und stand auf. Die Menschen rundherum blendete er ganz automatisch aus. Wie in Zeitlupe ging er auf den Kopf des Wagens zu, zog sich zu der Galionsfigur hoch. Tom hielt sich am Pfosten fest und lehnte sich weit nach vorn, um der Figur, der stillen Anführerin der Truppe, ins Gesicht sehen zu können. Aber was ausdruckslos zurückstarrte, war nicht das in Blautönen aufgemalte Augenpaar.
Es waren die braunen Augen einer Frau. Einer realen Frau. Der Blick war ähnlich ausdruckslos. Keine Regung ging von ihrem Gesicht aus, kein Blinzeln, kein Zucken der Mundwinkel.
Tom hielt ihr seine vor Aufregung zitternden Finger unter die Nase. Doch es war kein noch so geringes Lüftchen zu spüren. Das Kribbeln wurde beinahe unerträglich. Ohne den Blick abzuwenden, erteilte er Anweisungen, denen Cédric ohne zu zögern Folge leistete. »Die Polizei. Sofort.«
Als hätten diese Worte den Effekt einer Nadel, zerplatzte die Blase, in der Tom sich in den letzten Minuten befunden hatte. Plötzlich hörte er die aufgeregte Menge, die entsetzten Schreie, das verwirrte Gerede. Vor allem aber nahm er die Blitzlichter wahr. Diverse Kameras waren auf ihn und die falsche Puppe gerichtet.
»Verfluchte Scheiße«, murmelte er. Über den Lärm des Traktormotors und der Menschen hinweg bellte er Sigi zu, den Wagen sofort an den Rand zu fahren. Sigi, der längst nicht mehr auf die Straße vor sich, sondern auf Toms Akrobatikeinlage sah, wirkte wie gelähmt. »Sigi!«, ermahnte Tom ihn streng.
Endlich blinzelte Sigi, erwachte aus seiner Starre. »Ja, ja, natürlich!«, rief er zurück, wandte sich wieder seinem Lenkrad zu und steuerte das Ungetüm vorsichtig durch die Leute, bis er in einer vernünftigen Parkposition ankam. Den Wagen verstecken zu wollen, hatte keinen Sinn. Es gab kurz vor dem Barfüsserplatz keine Möglichkeit, sich einfach in Luft aufzulösen. Aber dieses Gesicht …
»Dieses Gesicht muss weg«, überlegte Tom, während er seine eigene Larve abnahm und sie der Unbekannten über den Kopf stülpte. Er hoffte inständig, dass ihm das nicht während der polizeilichen Ermittlungen, die es zweifelsohne geben würde, zum Verhängnis werden würde, genauso, wie er hoffte, keine Beweise oder was auch immer der Polizei nützlich sein könnte, zu zerstören.
Tom schluckte schwer, als er das Gesicht vorsichtig unter der gemalten Fratze seines riesigen Kopfes verschwinden ließ. »Oh, Gott, wenn es dich gibt, dann flehe ich dich an, lass das einen entsetzlichen Albtraum sein. Bitte!«
Jetzt setzte auch noch sintflutartiger Regen ein. Die Menschen stoben erschrocken kreischend auseinander. Tom hob den Kopf in Richtung Himmel und akzeptierte das Unvermeidliche: Ob es ihn gab oder nicht, Gott konnte hier nichts für ihn tun. Denn dieses Grauen war kein Albtraum.
Polizeieinsatz während des Cortège
Mit stoischer Ruhe hatte Colin den Schilderungen des Mannes vor sich gelauscht. Sein Name war Thomas Aufwind, kurz Tom. Ein gestandener Mann. Dreiunddreißig, minimal größer als Colin, mit breiten Schultern, etwas Übergewicht, dunklem, an den Schläfen ergrauendem Haar. In Haltung und Ausstrahlung erkannte man ein gesundes Selbstbewusstsein und eine gewisse Autorität. In seinen Bewegungen lag eine kühle Ruhe. Ein angenehmer Mensch, der sympathisch wirkte, auch wenn er angesichts der Umstände aschfahl war und seine Hände zitterten. Das war zumindest Colins erster Eindruck.
Colin hatte sich bemüht, sich nicht von dem Treiben hinter Tom ablenken zu lassen. Nicht auf die tote Frau zu starren, die gerade von dem Fasnachtswagen runtergenommen wurde. Nicht dem Brechreiz nachzugeben, den diese elende Situation bei ihm auslöste.
»Cédric stieg heute Morgen auf den Wagen mit der Bemerkung, dass etwas nicht stimmte. Wir haben ihm nicht geglaubt. Wir haben nicht auf ihn gehört. Wir haben sein seltsames Gefühl auf den Restalkohol in seinem Blut geschoben. Hätten wir ihm doch bloß mehr Aufmerksamkeit geschenkt!« Der große, stattliche Tom ging vor Colin in die Knie. Die Stirn auf die Handballen gestützt, die Finger im dunklen Haar festgekrallt.
Colins Puls raste, seine Uniform wog in diesem Augenblick tonnenschwer. Dennoch gab er sich ruhig. »Stehen Sie bitte auf und kommen Sie mit, damit wir Ihre Aussage aufnehmen können. Okay?«, fragte Colin noch, obwohl Tom eigentlich nicht wirklich eine Wahl hatte.
Es dauerte einen Moment, bis Tom sich regte, aber dann hob er den Kopf. In seinen Augen glänzten Tränen, doch sein Nicken wirkte entschlossen. Er erhob sich, straffte die Schultern und wischte sich Nase und Augen mit den weiß behandschuhten Händen ab. Colins Blick blieb an den Handschuhen hängen. Er wusste, dass diese Teil des Kostüms waren, dennoch notierte er sich in Gedanken, dass Tom danach gefragt werden muss, ob er die Handschuhe einmal abgelegt hatte. Sei es, um den Puls der Toten zu überprüfen, um ihr die Larve über den Kopf zu stülpen oder wusste der Teufel, warum.
Colin sah sich am Tatort um. Blickte in die Augen der Neugierigen, die sich um den abgesperrten Bereich versammelt hatten. Viele wichen einem direkten Augenkontakt aus, andere erwiderten ihn unverhohlen.
Colin schaute seinen Kollegen zu. Es wurden Spuren gesichert, Polizisten kamen und gingen. Es fanden sich Reporter ein, der Lokalsender bezog mit seiner Fernsehkamera Stellung, die Moderatorin hielt das Mikrofon bereit. Sie wirkte nervös. Sie war für die Fasnachtsberichterstattung abgestellt worden und fand sich in einem Krimi wieder. Das war ihre Chance, groß rauszukommen, wenn sie den Auftritt vor laufender Kamera nicht vermasselte.
Es war ein Desaster. Viel zu viele Passanten und Schaulustige hatten Fotos gemacht und Videos von den Vorgängen gedreht. Derzeit war noch keine offizielle Erklärung seitens der Behörden abgegeben worden, was bedeutete, dass die Gerüchteküche brodelte. Das Internet war bestimmt schon voll von Spekulationen, verwackelten Filmchen und unscharfen Fotos. Nun, das war nicht mehr Colins Problem. Er musste sicher bald zu seinem nächsten Einsatz. Zu seiner nächsten Leiche? Hoffentlich nicht. Das hier war die dritte. In drei Tagen. Die drei schönsten Tage, wie es die Basler nannten. Er hatte sich darauf gefreut, Teil des Trubels zu werden. Er hatte sich höchstens auf Prügeleien, Zankereien und Diebstähle eingestellt, die seiner Fasnachtsstimmung aber nicht wirklich einen Abbruch tun konnten. Bekommen hatte er drei grauenhaft zugerichtete Leichen.
Montag, 21. März 2005
Bei der Staatsanwaltschaft
Die Fasnacht war seit knapp einem Monat vorbei. Zum Glück. Denn bisher hatten sich keine neuen Leichen gefunden. Doch die eigentliche Arbeit hatte erst begonnen.
Colin und Waldi hatten bald nach den Leichenfunden darum ersucht, bei den Ermittlungen mitarbeiten zu dürfen. Da man die Toten fand, während sie Dienst hatten und auch sie jedes Mal die Ersten vor Ort gewesen waren, nahmen sie die Taten persönlich. Rick Vossmann, ihr Vorgesetzter, stimmte ihrer Bitte zu. Er war dankbar um jede helfende Hand, in der Hoffnung, die Fälle möglichst bald klären zu können.
Die Ermittler waren unter Hochdruck dabei, Spuren auszuwerten. Berichte wurden geschrieben, Untersuchungen getätigt. Alle Angehörigen der Clique, auf deren Wagen die Galionsfigur entdeckt worden war, wurden befragt. Die Gäste des Hotels Les Trois Rois wurden unter die Lupe genommen, genauso wie die Handwerker, die Restauratoren und deren Umfeld. Im Restaurationsbetrieb selber stellte man Nachforschungen an. Aber das Einzige, was bisher festgestellt werden konnte, war, dass die aufwendig zurechtgemachten Statuen der drei Könige, die eigentlich über den Eingang des gleichnamigen Hotels gehörten, nicht pünktlich hatten geliefert werden können, deshalb hatte man kurzfristig für Ersatz gesorgt. Allem Anschein nach war es immer wieder zu mysteriösen Zwischenfällen gekommen, die die Auslieferung verzögert hatten. Werkzeuge, die verschwanden, Farbe, die abblätterte, und so weiter. Die Angestellten sprachen allesamt von Sabotage an den zu restaurierenden Figuren. Das mochte schon sein, schloss aber noch lange nicht aus, dass einer von ihnen die Hand im Spiel hatte.
Eine Spur, die zum Täter führte, fand man nicht. Auch das Durchleuchten der Vergangenheit der Opfer ergab nichts Brauchbares.
Das Mädchen in der Schubkarre, Moira Celeki, war eine Touristin. Sie reiste alleine. Ihre Eltern konnten zwar von ihren Plänen berichten, Hinweise auf einen Tatverdächtigen ergaben sich daraus aber keine.
Der ersetzte König, Vladimir Belekin, war Mitte vierzig und alleinstehend gewesen. Er lebte zurückgezogen, war aber in seinem Beruf, Bildhauer, eine Koryphäe. Nahe Verwandte? Fehlanzeige. Die Adoptiveltern waren zwar über die Art und Weise des Todes ihres Sohnes erschrocken, aber nicht überrascht. Sie rechneten schon länger damit, dass sie das nächste Mal von ihm hören würden, wenn sie seine Beerdigung organisieren mussten – die Worte seiner Mutter. Er hatte vor geraumer Zeit den Kontakt zu seinen Eltern abgebrochen. Auf die Gründe gingen sie erst auf wiederholtes Drängen näher ein. Angeblich hatte ihr Sohn eine Affäre mit seiner Schwester gehabt, die zwar nicht blutsverwandt war, auf dem Papier jedoch zur Familie gehörte. Das kam in seinem Umfeld nicht besonders gut an.
Die Galionsfigur war unter den drei Opfern am besten in Basel verwurzelt gewesen. Ihr Vater war bei einer großen Versicherung angestellt, ihre Mutter arbeitete Teilzeit bei einer Gemeindeverwaltung. Die Familie war finanziell abgesichert, besaß ein Einfamilienhaus in Bettingen, das Familienleben verlief harmonisch. Unauffällige Jugend, einige Nebenjobs als Kellnerin, gesundes Umfeld. Da sie an einer Arbeit für die Uni schrieb, setzte sie sich immer mal wieder alleine in eine angemietete Hütte ab, um für sich zu sein. Es war nicht ungewöhnlich, dass man in solchen Phasen länger nichts von ihr hörte. In eben eine solche Hütte war sie eine Woche vor Beginn der Basler Fasnacht geflohen. Mutterseelenallein, abgeschieden in einem Fünfseelendorf. Sie wollte zur Fasnacht zurück sein. Das war geglückt, nur nicht ganz so, wie erwartet.
Es war erstaunlich gewesen, wie die Polizei es fertiggebracht hatte, die Berichterstattung auf ein Minimum zu reduzieren. Es war bis heute kaum privates Bildmaterial im Internet aufgetaucht. Zwar wurde spekuliert, aber der Rummel um den Vorfall hielt sich im Grunde in Grenzen. Beinahe so, als hätten alle Anwesenden verleugnet, dass die Unbeschwertheit der Fasnacht durch entsetzliche Geschehnisse getrübt worden war. Wahrscheinlich war das dem Polizisten zu verdanken, der die Angelegenheit gegenüber der anwesenden Reporterin geistesgegenwärtig heruntergespielt hatte. Er hatte den Kommentar nicht verweigert, wie man es eigentlich erwartet hätte. Stattdessen hatte er ein kurzes Interview gegeben, bei dem er genau die richtigen Worte gefunden hatte.
Aber was nicht war, konnte ja noch werden. Es galt abzuwarten, ob im Lauf der Zeit nicht doch noch mehr Berichte und Bilder über den Zwischenfall auf dem Fasnachtswagen kursieren würden.
In seine Gedanken versunken, spielte Colin mit einem silbernen Schlüssel. Er saß an einem Schreibtisch in der Staatsanwaltschaft, wo er und Waldi, seit sie zu den Ermittlungen zugelassen wurden, öfter anzutreffen waren. Die Akten stapelten sich neben ihm, eine lag offen vor ihm. Colin rieb sich die müden Augen. Egal, wie oft er die Akten wälzte, die Aussagen studierte, sich mit Waldi und den anderen besprach, der nötige Durchbruch blieb aus. Colin überlegte sich, was er noch tun könnte. Er legte den Schlüssel weg. Nahm ihn wieder auf. Auf einmal wurde ihm bewusst, womit er seine Hände beschäftigte. Es war der Wohnungsschlüssel der Galionsfigur Esther Müller. Das war der einzige Ort, den er noch nicht gesehen hatte. Colin griff zum Telefon und wählte Waldis Nummer. »Waldi? Ich will mir Esther Müllers Wohnung ansehen, bist du dabei?«
Colin war klar gewesen, dass sein Partner sofort einwilligen würde. Deshalb fanden sie sich eine halbe Stunde später vor Esthers Wohnung ein.
Obwohl ihre Kollegen von der Spurensicherung bereits alles gründlich untersucht hatten, hatte Colin das Bedürfnis, sich Esthers Zuhause selbst anzusehen. Er wollte auf diese Weise ein besseres Gefühl für das Opfer erhalten. Ihm war zwar nicht ganz klar, wie ihn das der Lösung des Falles näherbringen sollte, aber wenn er besser verstehen konnte, wer sie war, eröffnete ihm das vielleicht neue Perspektiven, die ihn dann möglicherweise bei den Ermittlungen weiterbringen konnten.
»Wonach suchen wir?«, fragte Waldi, während er sich in der Mitte des Wohnzimmers hinstellte und den Blick über die Unordnung schweifen ließ, die Esther als ihr Zuhause bezeichnet hatte.
»Ich habe keine Ahnung.« Colin drückte sich an Waldi vorbei, wobei er gegen einen Stapel Zeitschriften stieß. Die Hefte rutschten weg.
»Mist.« Colin ging in die Hocke, um die Magazine wieder zusammenzuschieben. Da streifte sein Blick etwas, das aus einem der Kataloge herauslugte. Er streckte seine Hand danach aus, hob es auf. Es war eine Visitenkarte.
»A–Z Tourenplanung, die etwas andere Art, Ihre Umgebung zu entdecken. Ein Erlebnis, nicht nur für Touristen. Unsere Geistertouren durch den städtischen Untergrund sind besonders beliebt!«, warb die Kartenvorderseite, und auf der Rückseite war eine Telefonnummer abgedruckt.
In Colins Erinnerung regte sich etwas. Er wusste aus den Polizeiakten, dass Moira Celeki, die Schubkarrenleiche, laut ihrer Familie etwas von einer geplanten Stadtführung erzählt hatte. Auf Details war sie angeblich aber nicht eingegangen. Auch bei Vladimir Belekin, der als Statue des dritten Königs inszeniert worden war, fand sich ein ganzer Stapel mit Katalogen und Reiseführern über Basel und Umgebung. Genau diese Visitenkarte war zwar in den Unterlagen der Polizei nicht dabei gewesen, aber Belekin war anscheinend wild entschlossen gewesen, seine neue Heimat zu erkunden. Das passte, war er doch erst kürzlich aus Russland nach Basel gekommen. Er war in seiner Heimat Spezialist für besondere Restaurationsarbeiten gewesen, weshalb er auch kürzlich von dem Betrieb angeworben worden war, der die drei Königsstatuen des Hotels restaurierte. Doch die Prüfung seiner Aufenthaltsgenehmigung war noch nicht einmal abgeschlossen gewesen, da war er bereits tot.
Von einer plötzlichen Aufregung erfasst, streckte Colin die Karte wortlos Waldi hin, während er selbst nach seinem Handy griff und die A–Z Tourenplanung googelte. Viel gab das Internet nicht her. Es gab eine Homepage und einen Haufen positiver Bewertungen auf gängigen Reiseportalen. Das Unternehmen war zwar nicht im Handelsregister eingetragen, doch das musste nichts heißen. Einzelfirmen zum Beispiel mussten nur unter bestimmten Voraussetzungen eingetragen werden.
Da ihn das nicht weiterbrachte, wählte Colin, ohne weiter darüber nachzudenken, die Nummer, die auf der Karte aufgedruckt war. Sein Anruf wurde auf einen Anrufbeantworter umgeleitet. Die Ansage verlangte von ihm, seine Telefonnummer zu hinterlassen. Colin tat, wie geheißen, und sprach seine private Handynummer auf das Band.
Waldi beobachtete seinen Partner aufmerksam. »Willst du mir erklären, was es mit dieser Tourenplanung auf sich hat und wieso du denen deine Nummer gegeben hast?«
»Unsere beiden anderen Leichen hatten geplant, die Stadt zu erkunden, und ausgerechnet bei einer Einheimischen finde ich diese Visitenkarte von einem Unternehmen, das Stadttouren anbietet. Es ist weniger als ein Strohhalm, ich weiß, aber es ist mal was Neues und besser als nichts.«
»Also möchtest du eine Tour buchen?«
»Genau. Kommst du mit?«, fragte Colin und verließ das Haus, ohne eine Antwort abzuwarten.
Eine Straße weiter hatte Colin seinen alten Jeep geparkt.
Er hatte kaum die Autotür geöffnet, da klingelte sein Handy. Colin zog es aus der Tasche. Die Nummer des Reisebüros leuchtete auf dem Display auf.
»Das ist das Reisebüro«, klärte Colin Waldi auf und nahm den Anruf unter Nennung eines falschen Namens entgegen.
»Guten Tag«, meldete sich eine vertrauenswürdig klingende männliche Person. »Hier spricht Cornelius. Ich bin der Geschäftsführer der A–Z Tourenplanung. Wie kann ich Ihnen helfen?«
»Ich bin neu in der Stadt und würde gerne eine Tour bei Ihnen buchen, da ich schon viel Gutes von Ihnen gelesen habe«, gab Colin so locker, wie es ihm möglich war, zurück.
»Verstehe. Haben Sie denn schon eine Vorstellung, was Sie gerne sehen würden? Ich könnte Ihnen zum Beispiel ein sehr interessantes Angebot für die Tour ›Industrielles Basel‹ machen.«
»Industrielles Basel«, Colin gab sich nachdenklich, »doch, das klingt interessant. Wann fände die denn statt?«
»Wie flexibel sind Sie?«
»Ziemlich flexibel.«
»Wunderbar! Wie wäre es gleich am Donnerstag?«
»Donnerstag passt. Wann und wo?«, fragte Colin.
»17 Uhr. Den Treffpunkt werde ich Ihnen noch nennen.«
Colin legte auf. »Waldi? Wir sind da möglicherweise auf etwas gestoßen …«
Donnerstag, 24. März 2005
Bei der A–Z Tourenplanung
Colin fuhr den dunklen Škoda schweigend. Seinen Ellbogen stützte er auf dem Fensterrahmen der Fahrertür ab, mit dem Zeigefinger fuhr er sich grübelnd über die Stirn. Carolina saß auf dem Rücksitz, ihr dänischer Schäferhund Rufus lag in der Hundebox im Kofferraum.
Colin warf einen Blick in den Rückspiegel, den Carolina prompt auffing. Der Anblick der dunklen Augen und das Gefühl, ertappt worden zu sein, jagte ein heißes Kribbeln durch seinen Magen. Sie trug ihr Haar zu einem strengen Pferdeschwanz zurückgebunden – wie immer, wenn sie arbeitete. Nur wenn sie sich zwischendurch zu einem Drink oder einem Abendessen alleine trafen, trug sie ihre Haare offen. Sie fielen ihr dann locker auf die Schultern. Meistens strich sie sie hinter die Ohren. Dort blieben sie, bis sich diese eine widerspenstige Strähne löste und ihr ins Gesicht fiel. Sie hatte schönes Haar. Haar, in das man seine Finger versenken wollte.
Ihre Gegenwart fühlte sich richtig an, machte regelrecht süchtig. So kam es ihm jedenfalls vor, denn immer, wenn sie nicht in seiner Nähe war, wünschte er, sie wäre es. Wenn er sie nicht berühren konnte, wie jetzt, konnte er an kaum etwas anderes denken. Ohne sie kam er sich vor wie ein Alkoholiker auf dem Trockenen.
»Wenn du deine Augen nicht sofort weg von meiner Schwester und zurück auf die Straße richtest, kannst du was erleben!«
Colin errötete prompt und riss sich von dem spontanen Lächeln, das Carolina ihm im Spiegel schenkte, los. »Schon gut, Waldi. Ich habe alles im Griff. Keine Sorge.«
»Es wäre mir lieber, du hättest Carolina etwas weniger im Griff und das Lenkrad etwas mehr. Wir sind gleich da, also konzentrier dich.«
Waldi hatte recht. Colin musste sich auf das konzentrieren, was vor ihm lag. Er wusste, er hätte die neuen Informationen seinem Vorgesetzten übergeben müssen. Das wollte er im Grunde auch, aber zuerst wollte er sicher sein, dass die Verbindung zwischen den Opfern tatsächlich existierte und nicht nur ein Hirngespinst von ihm war. Waldi kam nach kurzem Überlegen zum selben Schluss. Er sagte Colin seine Unterstützung ohne zu zögern zu. Zusätzlich holten sie Carolina mit ins Boot, da ihnen Rufus‘ Spezialgebiet, fliehende Personen zu stellen, nützlich werden konnte.
Und da saßen sie nun. In Carolinas Dienstwagen. Sie hatte darauf bestanden, der Hundebox wegen ihren Wagen zu nehmen.
Colin wurde beinahe übel, wenn er daran dachte, dass sie nur hier war, weil er sie eiskalt angelogen hatte. Er hatte Carolina gegenüber behauptet, die Sache wäre von ganz oben abgesegnet worden.
Wie tief war er gesunken. Zu jung, zu ehrgeizig, zu dumm.
Er müsste ihr die Wahrheit sagen, sie selbst entscheiden lassen. Umdrehen, anonym bei der Polizei anrufen und den Tipp durchgeben. Dann würden die sich darum kümmern.
»Worüber grübelst du nach?«, fragte Waldi von der Seite, als ahnte er die Zweifel, die Colin plagten.
Erneut ertappt, räusperte der sich. »Nichts. Wir sind da«, lenkte er ab und bog in eine dunkle Straße am Rande eines stillgelegten Industriegebiets ein.
Erstaunlicherweise war der Ort nicht so abgelegen, wie Colin erwartet hätte. Nur zwei Straßen weiter begann ein neu angelegtes Wohngebiet mit ausladenden Grünflächen zwischen den Bauten.
»Ich gehe alleine. Er erwartet nur mich«, sagte Colin an die anderen gewandt, als er rechts ranfuhr.
Carolina wirkte verwirrt. »Alleine? Wohin?« Suchend spähte sie aus dem Seitenfenster.
»Ich steige hier aus und gehe den Rest zu Fuß. Irgendwo an dieser Häuserreihe müsste dieses ominöse Reisebüro doch angeschrieben sein. Oder er wird auf sich aufmerksam machen. Er hat mich schließlich hierherbestellt.«
Colin verließ den Wagen und ging zu der Adresse, die ihm der Eventmanager durchgegeben hatte. Es war die Adresse, die er bereits auf der Homepage als Sitz des Unternehmens gefunden hatte, was Colin stutzig machte.
Er sah sich auf dem alten Fabrikgelände um. Zum Thema der gebuchten Tour passend, ging es ihm durch den Kopf. Bisher also alles stimmig. Sein Bauchgefühl sagte ihm aber etwas anderes. Irgendwo unter dieser Verbissenheit, den grausamen Killer endlich dingfest zu machen, meldete sich eine leise Stimme, die ihn zur Vorsicht mahnte. Es war eben diese Stimme, die Colin zuversichtlich stimmte. Zuversichtlich, dass er auf dem richtigen Weg war, der richtigen Fährte folgte.
Am Treffpunkt besah sich Colin von außen das leer stehende Gebäude. Es war eine große Halle, gemauert aus dunkelroten Backsteinen. Die Fenster lagen hoch über dem Eingang. Er konnte sich vorstellen, wie es innen aussah. Stahlträger, stabile Installationen, Reste von Seilzügen und Maschinen aus längst vergangenen Zeiten, als hier noch gearbeitet wurde. Alte Zuggleise waren in den grauen Betonboden eingelassen und verschwanden unter der Torschwelle. Allem Anschein nach wurde hier damals etwas auf Züge verladen und weitertransportiert. Das Tor war für einen Güterzug jedenfalls groß genug. Entschlossen drückte Colin die mannshohe Tür auf, die in dem riesigen Tor eingelassen war.
Quietschend und schwerfällig öffnete sich die Tür. Sie wirkte, als wäre sie schon eine ganze Weile nicht mehr bedient worden, was überhaupt nicht zu dem Bild eines gut laufenden Geschäfts mit Stadtführungen passen wollte.
Colin trat vorsichtig ein. Die Tür hinter ihm schlug von alleine zu. Nun stand er in einer riesigen Fabrikhalle. Das Grau des schwindenden Tages, das sich durch die schmutzigen Scheiben über ihm stahl, war seine einzige Lichtquelle. Alles wirkte verlassen. Aber er ahnte, dass er nicht alleine war.
Colin wartete. Bis sich etwas rührte, bis jemand in sein Blickfeld trat, bis man das Wort an ihn richtete. Doch nichts dergleichen geschah. Also ging er in die Offensive. »Okay, wenn das so eine Führung mit Schreckeffekt sein soll, dann muss ich gratulieren. Mir ist nicht mehr wohl in meiner Haut!«, rief Colin in den Raum. Er setzte ein verunsichertes Lächeln auf, spielte den Unschuldigen und hoffte, dass er in seiner Rolle überzeugte.
Im nächsten Moment fuhr Colin erschrocken zusammen. Irgendetwas fiel so unerwartet laut scheppernd zu Boden, dass er im Affekt beinahe an die Stelle seiner Hüfte gegriffen hätte, an der seine Dienstwaffe saß. Ein Griff, der ihn verraten hätte. Er konnte sich gerade noch beherrschen. Stattdessen legte er beide Hände auf seinen Bauch. »Uff, jetzt wäre mir beinahe mein Herz in die Hose gerutscht! Ich muss schon sagen, im Inszenieren sind Sie verdammt gut! Das werde ich in meiner Bewertung berücksichtigen!« Suchend sah er sich in der immer dunkler werdenden Umgebung um. Es gab viele Schatten, in denen sich jemand verbergen konnte, und es wurden immer mehr …
»Ich bekomme was für mein Geld geliefert, das muss ich schon sagen. Aber nun ist es gut, meinen Sie nicht?« Colin horchte. Nichts. »Na, kommen Sie schon, zeigen Sie sich!« Immer noch nichts. »Gut, wenn das alles war …«, sagte er schließlich und tat, als würde er den Rückzug antreten. Er streckte den Arm nach der Tür aus, ohne sich nach ihr umzudrehen. Colin wagte es nicht, der Halle den Rücken zu kehren.
Da. Rechts über ihm nahm er eine Bewegung wahr. Hinter einem breiten Stahlträger auf einem Zwischenboden einer Metalltreppe, rührte sich etwas. »Colin, Colin, Colin«, tadelte eine irgendwie leiernd klingende Stimme.
Colin kniff die Augen zusammen, konnte aber außer einem halben Umriss nichts erkennen.
»Das mit der Schauspielerei hättest du besser üben sollen.«
»Ich verstehe nicht …«, sagte Colin, doch er wusste, dass er seinen Atem verschwendete. Er saß in der Falle und war eine wunderbare Zielscheibe in dem offenen Raum.
»Lass den Mist. Weißt du, ich überprüfe sehr genau, wen ich zu meinen Touren einlade und wen nicht. Einmal ausgesucht, hefte ich mich an ihre Fersen, beobachte sie. Befinde ich sie als geeignet, schlage ich zu. Weißt du, ich habe dich schon eine ganze Weile im Visier, Colin, und du hast nichts davon bemerkt. Genauso wenig wie all die anderen. Das ist auch wichtig, wenn ich nicht erwischt werden will, denn meine Kunden überstehen die Ausflüge in der Regel nicht lebendig.«
Colin legte seine ohnehin aufgeflogene Tarnung ab. »Dann hast du gewusst, wer ich bin, und trotzdem hast du einem Treffen zugestimmt? Weshalb?«
»Neugierde. Spaß am Spiel.«
»Das ist alles?«, fragte Colin, ohne zu verhehlen, dass er ihm kein Wort glaubte.
»Imponieren. Konkurrenz aus dem Weg schaffen. Unfähig hättest du wirken sollen, nicht clever genug. Unwürdig.« Ehe Colin nachfragen konnte, was die kryptischen Aussagen zu bedeuten hatten, ruckte der Kopf des Schattens hoch. Er stieß ein zischendes Geräusch aus. »Du hast sie mitgebracht?«, fauchte er aufgebracht.
Colin verstand den plötzlichen Stimmungswechsel nicht. Er sah sich um, konnte aber nicht erkennen, was den Schatten auf einmal so aus der Fassung brachte.
»Du Hurensohn! Ihn hätte ich erwartet, aber nicht sie! Nicht sie!«, schrie er beinahe hysterisch.
Im nächsten Moment ging draußen ein Licht an, das durch die schmutzigen Scheiben ins Innere drang. Es wurde kaum hell genug, um den Unbekannten zu erkennen, aber es reichte aus, um zu sehen, was er in der ausgestreckten Hand hielt: Das Licht brach sich im blank polierten Lauf einer silbernen Pistole.