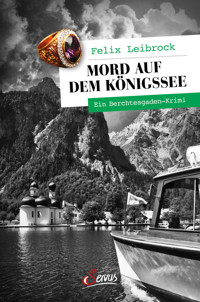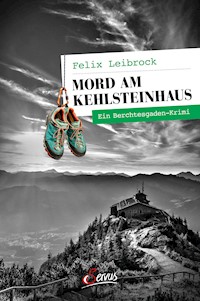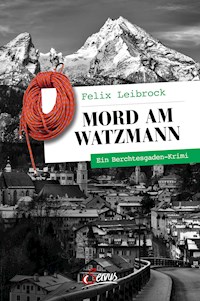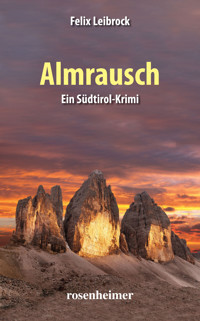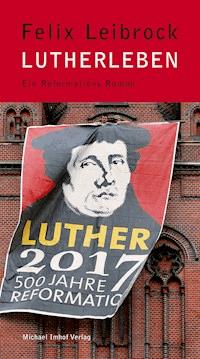Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Philipp ist Mädchen gegenüber schüchtern, einsam, in der Schule ein Außenseiter. Die Schuld daran gibt er vor allem seiner Familie. Den Vater erlebt er als cholerisch, die Mutter als abwesend, die ältere Schwester als gemein. Nach dem Abitur entscheidet er sich zu einem radikalen Schritt: Er verlässt seine Familie und lässt sich von einem kinderlosen Ehepaar adoptieren. Selbstvertrauen holt er sich unter anderem beim Klettern in den Bergen. Doch dann passiert gerade beim Bergsteigen ein schlimmer Unfall. Plötzlich ist Philipp auf seine alte Familie angewiesen. Wird sie ihm seine Flucht, seine Abkehr verzeihen? Ein Roman zwischen Leben und Tod, Liebe und Hass, Verzweiflung und Hoffnung. Der Wert einer Familie steht dem Gefühl entgegen, in der Familie gefangen zu sein. Und über allem die Frage, was wir vom anderen Menschen, und sei er uns noch so nah, wirklich wissen. "Manchmal passieren Dinge, da ist danach nichts mehr so, wie es vorher war. Bei mir ist das gerade der Fall. Ich habe das Gefühl, alles zerfällt, löst sich auf."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 253
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Seht ihr den Mond dort stehen?
Er ist nur halb zu sehen,
Und ist doch rund und schön.
So sind wohl manche Sachen,
Die wir getrost belachen,
Weil unsre Augen sie nicht sehn.
Matthias Claudius:
Der Mond ist aufgegangen
(1779)
Inhaltsverzeichnis
PROLOG
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
EPILOG von LOU
PROLOG
Tief unten im See entdeckt ein Taucher eine geheimnisvolle Höhle. Gerade will er in sie eintauchen, sie erkunden, da geht ihm der Sauerstoff aus. Schafft er es noch rechtzeitig zurück an die Oberfläche?
Wie dieser Taucher fühle ich mich. Die schönen Seiten des Lebens – Sinn, Liebe, Zukunft – habe ich gerade entdeckt. Jetzt geht mir die Luft aus. Panik macht sich in mir breit. Und ich bin voller Selbstvorwürfe. Hätte ich nicht diese Tour unternommen, wäre ich heute nicht in dieser schlimmen Lage. Aber Hätte und Wäre sind Bremsklötze des Lebens. Mein Leben ist zurzeit sehr reduziert. Man kann auch sagen, es hat keine klare Perspektive. Ich will mir das Leben, seine Fülle, seine positiven Optionen zurückholen. Surfen am portugiesischen Atlantik, Lassowerfen in Texas, Darts spielen in einem irischen Pub … Meine Träume reichen für tausend Leben. Aber mir genügt das eine Leben, wenn ich es behalte. Wenn …
Ich will nicht weiter absacken, depressiv werden, resignieren. Was kann ich tun? Zwei Hoffnungen habe ich.
Die erste Hoffnung ist eine Organspende. Es ist ganz einfach: Ohne eine neue Niere sterbe ich bald, mit einer Spenderniere kann mein Leben zwar anders, aber neu beginnen.
Die zweite Hoffnung: All die Wunden, die mir das Leben in mein Innerstes, in meine Seele oder wie immer ich es nenne, geschlagen hat, heilen. Narben bleiben, aber es schmerzt nicht mehr. Hier glaube ich an die heilende Kraft des Lesens. Verrückt? Ja, Romane und Gedichte, die das Leben mit seinen Brüchen beschreiben, ver-rücken mich. Literatur bietet mir Fantasiewelten an, in die ich abtauche.Welten, in denen ich meine Not zeitweise vergesse oder sie bei Romanfiguren wiederentdecke. Fiktiven Geschwistern, die für sich Wege zurück ins Leben gefunden haben. Auch Schreiben hat diese therapeutische Kraft. Indem ich diesen Text, die Vorgänge um mich herum und in mir drin, hier niederschreibe, nehme ich die Bleigewichte ein wenig von meinen Schultern.
Aber werde ich nur mit Hoffen und Lesen und Schreiben überleben?
So lange nun schon hoffen, hoffen, hoffen. Hoffen kann auch in den Wahnsinn treiben. Die Hoffnung stirbt zuletzt, was für ein Schwachsinn. Die Hoffnung stirbt immer und immer wieder. Aber genauso steht sie wieder auf, flutet das Herz und mandelt sich verführerisch zum Wunderengel auf.
Ach, und lesen und schreiben, wenn es einem so richtig dreckig geht - manchmal möchte ich die Bücher an die Wand schmeißen.
„Ein Mensch kann sehr lange, aber dennoch sehr wenig leben“, sagt Michel de Montaigne vor mehr als vierhundert Jahren. Ich lebe vielleicht nicht mehr lange. Aber wenn es irgendwie geht, möchte ich noch sehr viel leben.
1
Das Bild vom Zauberberg ist mir gekommen, als ich den gleichnamigen Roman von Thomas Mann gelesen habe. Ich heiße übrigens Philipp und bin dreiundzwanzig Jahre alt. Damals, nach dem Abitur, habe ich bei einer Versicherung eine Ausbildung gemacht. Mein Chef, ein blasierter Vogel mit durchsichtig lackierten Fingernägeln, gab mir vom ersten Tag an zu verstehen, ich sei nur dann ein guter Mitarbeiter, wenn ich die Kunden übers Ohr haue. So direkt hat er es zwar nicht gesagt, aber die Tendenz war klar. Er erklärte mir seine Tricks, seine rhetorischen Finten bei Kundengesprächen und schickte mich zu entsprechenden Weiterbildungen in billige Konferenzhotels in den Spessart. Ein Leben lang bei solch einer Versicherung zu arbeiten, stellte ich mir unerträglich vor. Im Büro langweilte ich mich. Bei Kundengesprächen fürchtete ich mich vor empörten Fragen, weil der Schwindel aufflog. Auf Tagungen quälte ich mich durch kalte Themen, vorgetragen von arroganten Rednern, für die Kunden lediglich zu manipulierende Objekte waren. Ich sehnte mich nach einer Gegenwelt, nach einer Flucht in ein buntes warmes herzvolles ehrliches Leben. Literatur war für mich diese Gegenwelt. In jeder freien Minute habe ich damals gelesen, fast manisch.
Schon als Kind war Lesen für mich eine Art Burg und Hort und Halt. Ich lebte mit meiner Fantasie in Hogwarts, in Mittelerde oder in Kingsbridge. Das half mir, den Stress mit meiner Familie wenigstens zeitweise zu vergessen. Mit fünfzehn, sechzehn ging meine Lesesucht auf die deutschen Klassiker über. Auch liebte ich es, nach Neuerscheinungen in Buchhandlungen zu stöbern. Wie waren die neuen Romane von Christoph Hein oder Sibylle Berg aufgebaut? Warum waren junge Autoren wie Benjamin Lebert oder Helene Hegemann erfolgreich? Welche Themen wählten Julia Engelmann oder Jan Wagner für ihre Gedichte? In der Stadtbücherei lieh ich mir die Bücher aus. Manchmal las ich sie schon, während ich die Treppen der Bibliothek hinunterstieg, so fiebrig erregt war ich von den Themen, so neugierig, wie sie behandelt wurden. Eine Zeitlang begeisterte ich mich für französische Gegenwartsliteratur. Faszinierend fand ich den Kultautor Michel Houellebecq, aber auch Jonathan Littell, Anna Gavalda oder Frédéric Beigbeder schenkten mir mit ihren Büchern das, was ich mit Glück gleichsetze: Das Vergessen der Zeit beim Lesen. Dass ich damit unter den Gleichaltrigen mit ihren Spielkonsolen und ihrem Abhängen an der Isar mit Soundbar zum Exoten avancierte, war mir egal.
Von der Ödnis im Versicherungsjob lenkte mich neben Lesen auch das Klettern ab. Die Idee, das Klettern in den Bergen zu erlernen, verdanke ich einem meiner Schullehrer. Wenn ich mich auf einem Klettersteig mit meinen Seilen und Karabinern sicherte, mich mit letzter Kraft auf einen Felsvorsprung stemmte und unter mir einen Hunderte Meter tiefen Abgrund sah, hatte ich das Gefühl, noch zu leben. Ein Gefühl, das mir im Versicherungsgebäude aus grauem Waschbeton am Mittleren Ring in München abging. Dort verwaltete ich Policen, Bearbeitungsnummern, Sachtitel - tote Materie. In den Wänden der Ostalpen dagegen hörte ich das Blut in meinen Ohren rauschen, mein Herz kam mir vor wie ein Bergwerk. Ein Steinbock sprang in der Morgenröte vor mir davon, Dohlen umkreisten mein Haupt, und der Enzian blühte trotz kargen Untergrunds.
An einem schwülen Augusttag war ich von München aufgebrochen, um den Watzmann zu überschreiten. Am Abend vor der anstrengenden Tour mit langem Aufstieg stand ich in Ramsau vor meiner einfachen Unterkunft mit den abgewetzten Matratzen. Nein, das war kein nobles Sanatorium nahe Davos wie bei Thomas Mann. Auch spielt sich in Der Zauberberg das Wesentliche am und auf dem Berg ab. Und doch, als ich den Watzmann in den letzten Sonnenstrahlen rotgolden leuchten sah, das war so – zauberhaft. Und von da aus war es nicht weit bis zum Bild vom Zauberberg. Literatur als Zauberberg. Mit meinem Lesen lege ich Schächte an, dringe mit meinem Pickel in den Berg vor und erschließe mir neue Welten. Mit Rowling, Tolkien und Follett hatte ich ganz unten im Berg eine erste wunderbare Höhle mit einem dunklen See entdeckt. Mit Goethe, Schiller, Kleist, Lenz, Büchner war ich höher gestiegen, hatte einen riesigen Tropfsteinpalast aus Stalagmiten und Stalaktiten im Zauberberg ausgemacht. Weiter oben, zum Gipfel hin, traf ich auf einen Flöz mit wertvollen Rohstoffen, der französischen und deutschen Gegenwartsliteratur. Was aber ist mit den großen Russen? Was mit Flaubert, Maupassant, Baudelaire, Balzac, Zola? Was mit Shakespeare und Hemingway, mit Huxley, Salinger und John Williams? Ganz zu schweigen von den großen literarischen Werken aus Spanien, Italien, Skandinavien, von afrikanischer Literatur, den großen Werken aus Lateinamerika, Fernost … Sie alle waren noch im Zauberberg verborgen und warteten darauf, von mir entdeckt zu werden.
Also machte ich mich auf die Spur, betrat den Zauberberg. Das bedeutete: Nach Abschluss der Lehre bei der Versicherung kündigte ich sofort und schrieb mich im Fach Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität München ein. Berufsaussichten? Ich weiß schon, jetzt kommt der abgenutzte Gag mit dem Taxifahren. Geschenkt! Ich binüberzeugt, man findet einen erfüllenden Beruf, wenn man das studiert, was einem das Herz rät. Ja, das Herz. Und nicht der Verstand, die Berechnung, die Hoffnung auf ein fettes Konto.
Ich glaube nach wie vor, dass gute belletristische Bücher und Gedichte uns verändern, den Blick weiten, uns vielleicht sogar retten. Auch mich selbst. Aber das Leben hat mir ins Gesicht gespuckt. Ich muss mich erst mal abwischen.
2
Manchmal passieren Dinge, da ist danach nichts mehr so, wie es vorher war. Bei mir ist das gerade der Fall. Ich habe das Gefühl, alles zerfällt, löst sich auf. Eben habe ich die Posaunen von Jericho gehört und war beeindruckt von ihrem mächtigen Klang. Jetzt liegen vor mir tausend Trümmersteine, die nicht mehr aufeinanderpassen. Ich muss das Durcheinander in meinem Kopf sortieren. Das geht am besten, indem ich meine verknoteten Gedanken aufschreibe und sie, so hoffe ich, dadurch etwas auflöse.
Désirée, um mit ihr einmal anzufangen, lerne ich in der Cafeteria der Uni an einem gar nicht mal so grauen Novembertag kennen. Mit Mädchen Kontakt zu suchen, war mir immer schwergefallen. Die Angst, zurückgewiesen zu werden, als aufdringlich zu gelten, nur das Eine zu wollen, lähmte mich. In meiner Verzweiflung habe ich einen Mitschüler, Hubert, gefragt, wie so was geht. Mädchen anquatschen. Hubert war einer, der bei Mädchen gut ankam. Eine nach der anderen führte er, seinen Arm um ihre Hüfte gelegt, stolz wie ein Pfau über den Schulhof. Und er war, wie ich, erst vierzehn Jahre alt.
„Na, du musst sie halt ein bisschen anrempeln und fragen, ob sie mit dir gehen will“, sagte er.
„Mehr nicht?“, fragte ich.
„Mehr nicht!“, antwortete er.
Ich war so blöd und habe das wirklich einmal getan. Die arme Nadja. Ich betete sie heimlich an. Den ganzen Tag dachte ich an sie. Und vor allem abends, vor dem Einschlafen. Dieses Kribbeln im Bauch, und noch mehr weiter unten. Und das Herz? Eine gepresste Zitrone. So bitter, so verzweifelt, so voller Sehnsucht war ich.
Sie steigt aus dem Bus, ich stolpere von hinten an sie heran, stottere die dämliche Hubert-Frage. Mein Puls schlägt wie Prasselregen. Sie zuckt zusammen, geht leicht in die Knie vor Schreck. Wendet sich zu mir um. Die saphirblauen Augen weit aufgerissen, die Pupillen starr. Wie ein Kalb vor der Schlachtung. Und dann rennt sie davon. Keuchend, panisch. Ihr Pferdeschwanz tanzt bedenklich. Ich stehe da wie ein Aussätziger, der eine Gesunde umarmen wollte. Wie bescheuert bist du denn, schreie ich mich an und trete gegen das Bushäuschen. Der Fuß schmerzt noch Tage danach.
Nach diesem Erlebnis habe ich es in der Schulzeit nie wieder gewagt, ein Mädchen anzusprechen. Ich zählte zu den dreien, vieren aus meiner Klasse, die bis zum Abitur keine Freundin hatten. Ich war ein Sehnsuchtsbündel, ein Kolumbus, dem allerdings die Pinta, die Niña und die Santa Maria vor dem Ziel abgesoffen waren. Mädchen, ein unerreichbarer Kontinent.
Und dann endlich, im Studium, Désirée. Sie sitzt an einem Ecktisch. Die schulterlangen Haare, braun, mit blonden Strähnchen, etwas spröde, hängen ihr in die Stirn, während sie sich über ein Buch beugt. Die rechte Hand an der Cappuccinotasse.
„Ach, du liest auch den Nadolny“, sage ich und setze mich an ihren Tisch. Für meine Verhältnisse ist dieses Ansprechen sehr mutig. Immerhin störe ich sie beim Lesen. Sie wird aufstehen und gehen, erwarte ich. Das Nadja-Trauma. Mein Herz schlägt irgendwo im Hals ganz oben. Wahrscheinlich wandert es gerade ins Gehirn.
„Ja, den Anfang finde ich nicht schlecht“, erwidert sie und schaut mich mit ihren Bernsteinaugen an. Eine Karthäuserkatze. Ich fühle, wie Schweiß als dünnes Rinnsal meinen Rücken hinunterläuft. Um meinezitternden Hände unter Kontrolle zu bringen, lege ich sie um die warme Teetasse.
„Warst du auch in der Vorlesung?“
Wir unterhalten uns über Sten Nadolnys Die Entdeckung der Langsamkeit, ein Buch aus dem Jahr 1983. Im Mittelpunkt steht John Franklin, ein Admiral und Forschungsreisender. Er denkt und handelt langsam. Viele Expeditionen in der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts hat er geleitet.
„Er hat sein Handicap genutzt, die Langsamkeit.“ Ich räuspere mich. Mein Hals ist sehr trocken. Als hätte ich Backpulver verschluckt. „Er hat nicht übereilt gehandelt. Bei solchen Exkursionen manchmal ein Vorteil.“
Stille. Das Gespräch darf nicht auslaufen, sage ich mir. Mir ist heiß. Haben die die Heizung bis zum Anschlag aufgedreht? Oh Mann, wenn sie wieder in das Buch schaut, war alles Ansprechen vergeblich. Dieser ganze Aufwand, dieser emotionale Höllenritt.
„Hat er eigentlich eine Frau gehabt, der Admiral?“ Ich atme auf. Sie hat von sich aus etwas gefragt. „Ich meine, bei so vielen Exkursionen, da war er doch kaum zuhause. Und auf Deck gabs ja wohl kaum Frauen …“
Zum Glück habe ich das Buch schon gelesen. Ich setze an, von Franklins erstem sexuellen Erlebnis mit einer Prostituierten in Südafrika zu berichten. Wahnsinn, jetzt rede ich schon über Sex mit einer Studentin, die ich vor fünf Minuten noch nicht gekannt habe. Da unterbricht sie mich.
„Sorry, ich habe dich zwar selbst nach den Frauen von Franklin gefragt. Aber eigentlich will ich das doch noch nicht wissen. Das spoilert die Geschichte, nimmt mir die Spannung.“
Wir sprechen noch eine Weile über das Thema Langsamkeit. Über die beschleunigte Zeit seit dem Erscheinen des Buches, den digitalen Wandel der Welt. Sie wird gleich aufstehen und gehen und du siehst sie dann niemals wieder, sagte eine Stimme in mir. Los! Frag sie nach ihrem Namen! Nach ihrer Telefonnummer!!! Sie wird dir einen Korb geben, spricht eine andere Stimme. Sie wird dich für aufdringlich halten! Lass es lieber bleiben! Ich weiche ihrem Blick aus. Starre mein graues Tablett an, als ob es ein Fernseher ist, auf dem gerade ein Actionfilm läuft. Dabei steht nur die trostlose Teetasse mit dem leichten Sprung drauf.
„Ich muss dann mal weiter!“ Sie erhebt sich jetzt tatsächlich, hat die Tasse in der einen Hand. Mit der anderen wirft sie ihren gelben Fjällräven-Rucksack über die Schulter.
Los, rede!!!, brüllt es jetzt in mir.
„Ich heiße übrigens Philipp.“ Paralysiert bleibe ich auf meiner Bankseite sitzen. Schaue sie von unten herauf an wie ein Chihuahua sein Frauchen.
„Désirée.“ Sie lächelt mich an.
„Äh, gibt’s du mir deine Handynummer?“ Das sage ich trocken, ersterbend. Habe ich ein Reibeisen verschluckt? Jetzt huste ich auch noch wie eine alte Zündkerze. Sie kramt ihr Handy aus dem Rucksack. Ich sage ihr meine Nummer. Als sie mir ihre mit Bluetooth schickt, weiß ich nicht, was stärker vibriert, mein Handy oder mein Herz.
3
Noch am selben Abend schreibe ich ihr. Ich drücke auf Senden. Ab diesem Augenblick klebt mein Blick auf dem Handy. Obwohl es beim Eingang einer Nachricht vibrieren und ich es hören würde. Vor dem Schlafengehen lege ich es auf meinen Nachttisch. Stelle den Signalton auf laut. Alle zwei Minuten, ach was, alle zehn Sekunden schaue ich drauf. An Einschlafen ist nicht zu denken. Mein Gehirn nimmt die Form eines Handys an. Aber Désirée antwortet nicht. Hat sie einen Freund? Bin ich ihr zu langweilig? Stören sie meine Aknenarben? Fragen wie Säbelhiebe. Erst am Wochenende darauf kommt die Erlösung.
Bin mit dem Nadolny durch. Wollen wir mal quatschen?
Ich nehme mir vor, ihr einige Stunden später zu antworten. Schreibe ihr nach fünf Minuten. Du verlierst sie sonst, weil sich vielleicht zwischendurch ein interessanterer Typ bei ihr meldet. Das rede ich mir ein. Unterstelle damit, ich hätte sie gewonnen. Mann, ich bin verliebt! Nach so einer langen Durststrecke, wie ich sie hinter mir habe, geht das mit dem Verlieben schnell. Endlich einmal eine Freundin haben. Hand in Hand losspazieren und die Sonne vom Himmel pflücken. Sie hat eine kleine Lücke zwischen den linken Schneidezähnen. Über der Oberlippe einen winzigen Leberfleck. Ist einen Kopf kleiner als ich. Sie schaut frech und optimistisch aus. Einfach nur schön ist sie. Finde ich jedenfalls. Dass sie um die Hüften ziemlich kräftig gebaut ist, stört mich nicht. Wenn man verliebt ist, wird ein Schotterplatz zum Erdbeerfeld. Sie liest außerdem Gegenwartsliteratur und Gedichte. Dazu dieser eher seltene und feengleiche Name- es gibt für mich, so bin ich mir sicher, keine bessere Frau auf der ganzen weiten Welt.
Wir verabreden uns zu einer Fahrradtour an der Isar. Picknicken. Sprechen über unser Studium, unsere Berufsziele, über das Leben in München. Über meine bescheuerte Lehre als Versicherungskaufmann. Nur als sie mich nach meiner Familie fragt, halte ich mich bedeckt. So ein schwieriges Thema. Désirée hakt nicht nach, als ich ausweichend antworte. Sie spürt wohl mein Unbehagen. Nach einigen Wochen fällt auch diese Schranke. Sie ist die Tochter einer Schauspielerin aus Luxemburg und eines Kölner Unternehmers und Karnevalspräsidenten. Mit ihrer direkten, unverkrampften Art strahlt sie etwas Leichtes, Positives, Lebensbejahendes aus. Eigenschaften, die mir selbst fremd sind. Was mir aber gefällt, guttut. Ausführlich erzähle ich ihr jetzt von meinem strengen und cholerischen Vater. Vom trüben Dasein meiner Mutter im abgedunkelten Schlafzimmer. Von meinem Entschluss, vor meiner Familie zu fliehen. Wie ich das mit achtzehn Jahren umgesetzt habe. Um diese Flucht vor mir selbst zu rechtfertigten, habe ich meinen Eltern neue Namen gegeben. Nur für mich. Wenn ich an sie denke, mich innerlich gegen sie rechtfertige. Nicht mehr Papa und Mama nenne ich sie. Das waren sie für mich schon lange nicht mehr. Mein Vater ist für mich jetzt der Gereizte, meine Mutter die Abwesende. Auch von meiner Schwester Lou berichte ich ihr. Von den vielen Streiten, der gelegentlichen Nähe, dann der völligen Entfremdung. All das Bedrückende meines Lebens auszusprechen, es durch Rückfragen Désirées gespiegelt zu sehen, das macht mich frei. Jemanden zu haben, bei dem man seine Probleme aussprechen kann und der oder die einem zuhört statt mit Ratschlägen zuzustopfen, ist ein Geschenk. Ich fühle mich Désirée immer stärker verbunden. Sie studiert Geografie,Berufsziel noch offen. Ich würde gerne in einem Verlag arbeiten, vielleicht als Lektor. Damit ich meine Liebe zur Literatur ausleben kann. Träume, weich und süß wie die Zuckerwatte auf der Auer Dult. Uns verbindet viel, es hat gefunkt, wir sind auf der gleichen Wellenlänge. Ein glückliches Leben zu zweit leuchtet auf. Für mich jedenfalls. Damals. Vor dem Absturz.
Klettern in den Bergen ist leider nicht Désirées Sache. Meine Überredungsversuche laufen ins Leere. Ich glaube, sie fühlt sich zu dick und schwer dafür, ohne dass sie es ausspricht. Aber sie wandert gerne. Während ich in den Wänden klettere, geht sie auf den markierten Pfaden zum Gipfel. Oben auf der Hütte dann Kaiserschmarrn und Radler für uns beide. Allerdings muss sie am Wochenende des Unglücks eine Hausarbeit schreiben. So fahre ich alleine mit dem Zug nach Füssen, in die Ammergauer Alpen. Den Tegelberg über den gleichnamigen Steig zu erklimmen, ist mein Ziel. Ich lege meinen Kletter-Harnisch an, befestige die beiden Karabiner daran und mache ein Selfie, das ich Désirée schicke.
Ich freue mich auf dich heute Abend!
Ich habe Bilder von Désirées kuscheliger Ein-Zimmer-Wohnung vor Augen. Das mit einer roten Plüschdecke überzogene Bett. Die duftenden Kerzen auf dem mintgrünen Beistelltisch. Die auf dem Herd köchelnden Spaghetti. Dort werde ich sie noch am selben Tag, abgekämpft vom Klettern, sehen, sprechen, lieben. Denke ich. Unsere nächste Begegnung ist aber erst mehr als eine Woche später. In der Unfallklinik in Murnau.
4
Der Morgen ist diesig, der Himmel eine wabernde milchige Suppe. Ein Junitag, an dem die Sonne noch nicht weiß, ob sie ein alter Mann mit Arthrose ist, der lieber zuhause bleibt oder der doch den ganzen weiten Weg über den Horizont antritt. Es ist nicht kühl, nicht heiß – ideales Kletterwetter. Die Ammergauer Alpen bieten einige anspruchsvolle Steige für Kletterer. Vor vier Jahren habe ich mir Klettern als Freizeitsport ausgesucht. Ich wollte etwas gegen meine Ängste tun. Sie fluten oft meine Gedanken, hemmen mich, ein normales Leben zu führen. Wenn ich mich ihnen beim Klettern gezielt stelle, überwinde ich sie ein Stück weit, so hoffte ich. Am Anfang standen zwei Kletterkurse in den Ötztaler Alpen, die ich über den Deutschen Alpenverein buchte. Einführung in die Grundtechniken, Risikoabschätzung, Wetter- und Materialkunde. Auch das Klettern im Eis haben wir probiert. Mir genügte das, um für mittelschwere Klettersteige in den Alpen gerüstet zu sein. Etwa dreißig Klettersteige habe ich bis zum Unglückstag absolviert. Darunter deutlich schwierigere als den Tegelbergsteig. Beim Klettern bin ich zu diesem Zeitpunkt längst angstfrei. Auf keinen Fall möchte ich den letzten Zug nach München verpassen und dann den Abend auf einer Bank des Füssener Bahnhofs verbringen. Désirées warme Arme sind die klar bessere Perspektive. Ich bin im Klettern geübt, sicher, routiniert. Immer ein Karabiner muss im Seil befestigt sein, lautet eine der Grundregeln. Das Ein- und Ausklinken der Karabiner ist allerdings zeitaufwändig. Kann man sich an sicheren Stellen sparen. Eine gefährliche Kombination braut sich da bei mir zusammen:Routine und Eile. Ergibt Leichtsinn. Das weiß ich heute, im Rückblick.
Wenn ich versuche, den Ablauf des Unglücks zu rekonstruieren, bin ich auch auf Zeugenaussagen angewiesen. Außerdem auf das Protokoll der Bergwacht. Und Schilderungen des medizinischen Personals in der Murnauer Unfallklinik. Meine eigenen Erinnerungen enden bei dem Gefühl, irgendein fliegender Teufel sei auf meinem Rücken gelandet.
Immer ein Karabiner im Seil. Daran halte ich mich die ganze Zeit, als ich den ersten Abschnitt des Tegelbergsteigs in Angriff nehme. Das schreibe ich nicht nur wegen der Versicherung, die meine Behandlungskosten sonst infrage stellt. Es war wirklich so. Der Anstieg ist anspruchsvoller, als ich es vermutet habe. Schwierige Passagen, die Kraft und Balance erfordern. Ich sehe eine Gruppe von drei Kletterern, eine Frau und zwei Männer. Sie sind an einer dieser Stellen sichtlich angespannt. Die Arme und Hände zittrig, mit fast panischen Blicken. Der Steig ist eine Einbahnstraße. Da müssen sie jetzt durch. Mit nervösem Lachen machen sie mir Platz. Ich fühle mich in diesem Augenblick überlegen, stark, unbesiegbar. Nach der steilen Kletterpassage komme ich an eine ebene und erdige Stelle, die für eine kurze Rast geeignet ist. Trinken, Arme entspannen, Kraft tanken. Das Drahtseil endet an der flachen Stelle, um einige Meter weiter im nächsten Steilstück neu zu beginnen.
Erst jetzt klinke ich mich mit beiden Karabinern aus, öffne den Rucksack. Schnell trinke ich ein paar Schlucke von meinem Energy Drink und wische mir den Schweiß mit dem Ärmel von der Stirn. Dann die Flasche wieder in den Rucksack, die Schnüre zusammenziehen, den Rucksack schultern. Ein letzter Kontrollgriff, ob der Rucksack auchgut und eng anliegt. Ich gebe zu, dass ich das eilig, unkonzentriert, aus heutiger Sicht auch leichtsinnig tue. An so einer unbedenklichen Stelle kann nichts passieren, sagt mir mein Unterbewusstsein. Natürlich wäre es besser, während der Rast mit einem Karabiner am Ende des Seils noch eingeklinkt zu bleiben. Danach ist man immer klüger. Ich greife also nach hinten. Genau da spüre ich dieses Ziehen am Rücken, den Flugteufel. Kurz sehe ich ihn über die Schulter an. Er ist entgegen tradierten Bildern weiß wie Marmor aus Carrara. Oder ist er aus Meißner Porzellan? Mit seinen zwei kleinen Hörnern erinnert er mich an Michelangelos Moses in San Pietro in Vincoli in Rom – das monumentale Denkmal behandelten wir im Kunstunterricht. Nur dass der Teufel auf meinem Rücken viel kleiner ist. Einem Schimpansen vergleichbar. Mit angezogenen Knien klammert er sich mit seinen langen schlanken Fingern an meinem Rucksack fest. Die algengrünen Augen funkeln wie die bei Käthe-Kruse-Puppen. Mit seiner langen blutroten Zunge hechelt er mir direkt ins Ohr. Mit aller Macht zieht er mich mit seinem Gewicht vom Felsen weg in die Tiefe. Heute erkläre ich mir das mit einer Windböe. Sie erfasst mich direkt am Rucksack. Durch die Körperdrehung und den heftigen Windstoß verliere ich das Gleichgewicht. Mit dem Gesicht schlage ich heftig gegen den Felsen und sehe für einen Sekundenbruchteil, wie mir Blut auf die Hand spritzt. Die Grasbüschel, auf denen ich stehe, sind vom Tau der Nacht noch etwas feucht und damit glitschig. Von ihnen rutsche ich jetzt ab in die Tiefe wie mit einer Seifenkiste. Im Weggleiten versuche ich, mich mit den Händen noch in die Grasbüschel zu krallen. Das gelingt nur Millimomente. Die physikalischen Kräfte des Stürzens sind zu stark. Im freien Fall höre ich den gellenden Schrei der Frau aus der Dreiergruppe unter mir. Dann ist alles wüst und leer, und es wird finster auf der Tiefe.
Die Bergwacht ist schnell zur Stelle. Ich liege bewusstlos neben einem schweren Felsbrocken. Mit dem Rettungshubschrauber fliegt man mich nach Murnau in die Unfallklinik. Vier Tage dämmere ich bewusstlos auf der Intensivstation vor mich hin. Dann erwache ich. Ein Licht irgendwo über mir blendet mich.
„Ein Wunder, dass Sie das überlebt haben!“ Ich erkenne einen hageren Mann mit fliehendem Kinn und hoher Stirn, der sich über mich gebeugt hat. „Gut, dass Sie einen Helm aufgehabt haben!“
Jetzt sehe ich schemenhaft auch andere Menschen in weißen Kitteln. Sie alle sind länglich, wie in einem Zerrspiegel. Irgendetwas stimmt mit meiner Optik nicht.
„Sie sind ganz schön tief gestürzt. Zum Glück hat ein Gebüsch den ersten Aufprall abgefedert. Sie haben sich danach noch mehrfach überschlagen. Abgebremst hat sie zum Schluss ein stattlicher Felsbrocken. Der war wie eine Wand, an der sie nicht mehr vorbeikamen. Hallo? Verstehen Sie, was ich zu Ihnen sage?“
Der Mann mit seinem spitzen Mund hat sich wieder über mich gebeugt, leuchtet mir ins Auge. Ich rieche sein Rasierwasser. Seine Spechtaugen sehen mich eindringlich durch eine Brille an.
„Ist er zerbrochen?“, frage ich.
„Wer?“
„Der Teufel.“
5
„Was denn für ein Teufel?“
„Der Porzellanteufel.“
Der Specht wendet sich der Gruppe zu. Sie murmeln etwas, was ich nicht verstehe. Ich dämmere wieder weg.
Am nächsten Tag bei der Visite bin ich schon wach, als der Tross an mein Bett tritt.
„Ah, das sieht doch schon mal ganz anders aus als gestern“, hebt der Arzt an. Noch einmal erzählt er mir vom Wunder, vom Helm. Er beugt sich wieder über mich, flüstert.
„Beim ersten Aufprall haben Sie instinktiv die Embryostellung eingenommen. Einige Rippen sind gebrochen, auch das rechte Bein. Dazu die Gehirnerschütterung. Kompliziert ist der Bruch am Übergang von Brustwirbel- und Lendenwirbelsäule. Wir haben die gebrochenen Wirbelkörper wieder zusammengeflickt. Das tut jetzt noch einige Zeit weh, ich weiß. Aber das heilt alles wieder. Und ist glimpflich angesichts der Sturzhöhe. Nur …“
Die Pause, die jetzt eintritt, hat etwas Bedrohliches. In der Ferne höre ich, wie sich die automatische Tür zur Intensivstation öffnet und wieder schließt. Das nur des Arztes spricht Bände. Deutet an, dass die schlimmste Nachricht noch bevorsteht. Oder bilde ich mir das nur ein? Mir ist es nicht möglich, nachzufragen, was das nur bedeutet. Ich bin einfach zu schwach. Professor Baumer, als der ich ihn später kennenlerne, dreht sich zur Visitationsgruppe um. Sie machen wieder auf Murmeltiere. Als die Gruppe zum nächsten Intensivbett geht, kommt Schwester Heidi zu mir und gibt mir etwas zutrinken. Hallo, wie geht es uns denn, schön, dass Sie aufgewacht sind.
Wieder einen Tag später bin ich bei der Visite noch ein Stück wacher im Kopf als am Vortag. Ich frage Professor Baumer sofort, was er mir verschwiegen hat.
„Verschwiegen habe ich Ihnen nichts“, entgegnet er. „Wir haben noch verschiedene Untersuchungen abgewartet. Aber jetzt sehen wir schon klarer, was mit Ihnen ist.“
Er sieht mich mit einem schiefen Lächeln an. Sein Kinn ist wirklich ausgeprägt.
„Was?“, presse ich hervor.
„Sie haben leider eine schwere Schädigung beider Nieren.“ „Nieren?“
„Ja, das ist durch den massiven Aufprall auf den Rücken passiert. Eine Ihrer Nieren ist völlig zerstört. Wir müssen sie operativ entfernen. Die andere hat nur noch eine geringe Leistungsfähigkeit. Vielleicht zwanzig Prozent.“
Die Worte sacken nicht richtig in mein Bewusstsein. Noch halten Sandsäcke die Flut ab, schützen mich vor dem Ertrinken, dem Verzweifeln. Vielleicht ist alles nur ein Irrtum. Reichen nicht zwanzig Prozent einer Niere zum Leben? Ich habe keine Ahnung. Aber man hat ja heutzutage so viele medizinische Möglichkeiten. Gibt es nicht auch künstliche Nieren? Die werden mich doch nicht hier mit einer solchen Nachricht alleine lassen, nach Hause schicken … Trotz dieser panischen Gedanken schlafe ich während der Visite ein. Die vielen Medikamente erschöpfen mich.
Als ich wieder aufwache, stehen Frank und Sabine an meinem Bett auf der Intensivstation. Meine Adoptiveltern. In grünen Besucherkitteln und Mund-Nase-Masken. Erst als sie sprechen, erkenne ich sie.
„Wir bekommen das alles hin“, sagt Frank. Seine Augen sind wässrig, halten meinem Blick nicht lange stand. Ichführe das auf mein ramponiertes Aussehen zurück. In meinem Gesicht spüre ich überall Pflaster, den Kopf umhüllt ein riesiger Mullverband, das gebrochene Bein hängt an einem Galgen über meinem Bett. „Wir werden dir die besten Bedingungen schaffen, wenn du in Großhadern oder Harlaching zur Dialyse musst. Wir fahren dich. Oder zahlen dir ein Taxi, kein Problem. Du bekommst als Privatpatient optimale …“
„Stopp, Frank“, gehe ich dazwischen. Seine Worte reißen die Sandsäcke weg, überschwemmen mich. „Heißt das, ich bin ein Leben lang jetzt von Geräten abhängig? Dialyse, was bedeutet das?“
Sabine schiebt Frank zur Seite. Sie greift nach meiner Hand, streichelt sie umständlich um die Kanüle herum.
„Philipp, bei der Dialyse übernimmt ein Gerät anstelle der Niere die Blutreinigung. Aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten, dir zu helfen. Ich meine, wegen deiner Nieren.“
Ich reiße die Augen auf, sehe, wie Sabines Lippen ganz leicht zucken. Ihre weichen Gesichtslinien stehen im Kontrast zu den streng zurückgekämmten und in einem Pferdeschwanz domestizierten Haaren.
„Welche Möglichkeiten?“ Ich ahne in diesem Augenblick, die Antwort Sabines wird über Leben und Tod entscheiden.
„Man kann dir auch eine Niere transplantieren.“ Jetzt fällt ihr eine Haarsträhne ins Gesicht und baumelt wie ein Pendel vor meinen Augen hin und her. Mir fällt ein Podcast der Süddeutschen Zeitung ein. Da ging es um Transplantationen. Um Wartelisten für Spenderorgane und wie wichtig es sei, einen Organspendeausweis auszufüllen und bei sich zu tragen.
„Ich muss also darauf warten, irgendwann mal von einem Toten eine Niere zu bekommen, richtig? Und wenn dienicht rechtzeitig kommt, sterbe ich, sollte die verbleibende und beschädigte Niere komplett ausfallen, ja?“
Eigentlich hätte ich diese Fragen besser Professor Baumer gestellt. Aber Frank und Sabine haben sicher mit ihm gesprochen, wissen Bescheid. Sie sind nun mal gerade hier, müssen mir antworten, weil ich nicht länger im Ungewissen bleiben will. Ich erinnere mich an das Stichwort Lebendspende, das in dem Podcast fiel. Dass dafür aber nur nahe Verwandte infrage kommen. Oder andere Personen, wenn sie einem persönlich sehr nahestehen und geeignete medizinische Werte haben. Frank ist jetzt wieder an mein Bett getreten, redet.