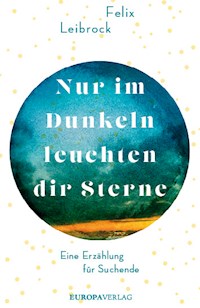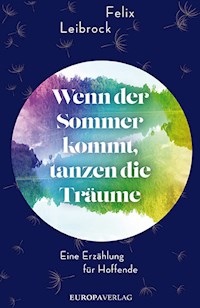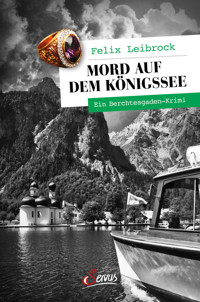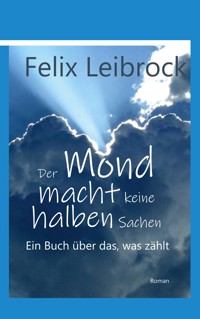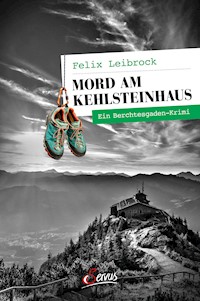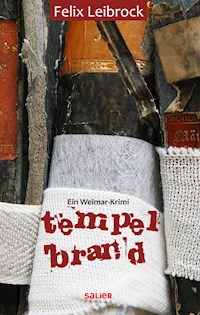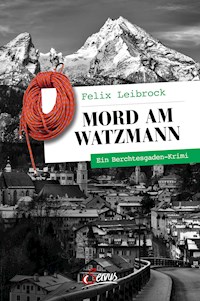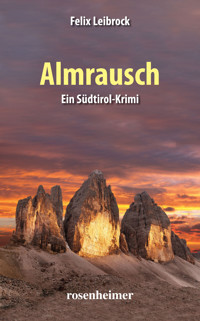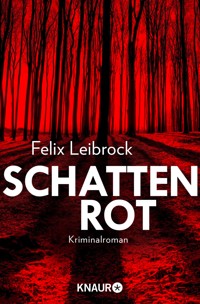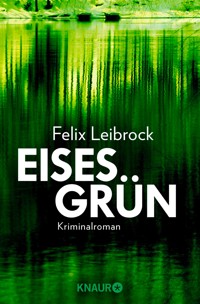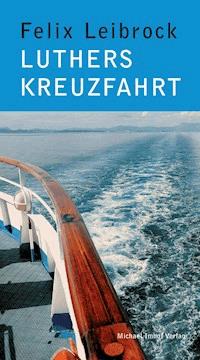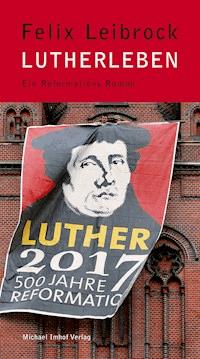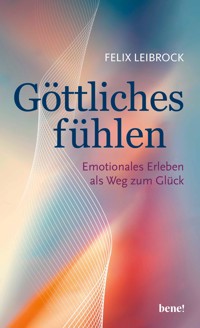
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: bene! eBook
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Der Sinnsuche-Ratgeber für alle, die sich einen neuen Zugang zu christlicher Spiritualität wünschen. Ein inspirierender Ansatz, die emotionale Seite des Glaubens zu entdecken. Manchmal sind wir im Innersten von etwas bewegt, was sich uns oftmals nicht sofort erschließt. Wer gerührt ist, verliert die Macht über seine Emotionen. Oft sind solche Momente mit Scham verbunden: Trauernde entschuldigen sich für ihre Tränen am Grab, Hochzeitspaare kämpfen vor dem Altar gegen den Ausbruch der Gefühle an. Dabei vergibt man sich so viel, wenn man sich dem Bewegtsein, der Rührung verweigert und sie unterdrückt statt sie zu akzeptieren, ja sogar zu suchen. Theologe Felix Leibrock ist sicher: Auch in unserer Spiritualität braucht es eine größere Offenheit für emotionale Nähe. Jesus war ein Berührer. Er umarmte viele Menschen, denen er begegnete, gab Aussätzigen die Hand, segnete die, die am Rande der Gesellschaft lebten. Seine Worte bewegen Menschen tief im Herzen. Und weil er um die heilende Bedeutung der Berührungen weiß, lässt er sich auch selbst berühren. »Manchmal ist es so, als würde ein Spalt zum Tor des Paradieses kurz offenstehen. Wir lauschen, schnuppern, tasten uns hinein ... Hat uns da für einen Augenblick das Göttliche selbst berührt?« Felix Leibrock
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 255
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Felix Leibrock
Göttliches fühlen
Emotionales Erleben als Weg zum Glück
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
»Unser Leben lang tragen wir eine große Sehnsucht nach Geborgenheit in uns. Eine Sehnsucht nach Liebe. Nach einem intensiven Miteinander.Manchmal sind wir dabei von etwas bewegt, was sich uns nicht sofort erschließt. Wir fühlen uns ergriffen, glauben, ein Spalt zum Tor des Paradieses stehe kurz offen. Hat uns da für einen Augenblick, für einige Sekunden das Göttliche selbst berührt? Es ist nicht in Worte zu fassen, doch es umgibt uns von allen Seiten.
Paulus sagt vor 2000 Jahren: ›Die Liebe hört niemals auf.‹ Indem wir der Liebe folgen, werden wir heil, wo wir psychisch verletzt sind. Unsere Seele gesundet. Übersetzt heißt das griechische Wort ›Psyche‹ übrigens Seele, aber auch Schmetterling. Gott ist der Schmetterling in uns.«
Felix Leibrock
Das Buch für alle, die sich nach einem neuen, emotionalen Zugang zu christlicher Spiritualität sehnen.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.bene-verlag.de
Inhaltsübersicht
[Zwischenblatt]
Prolog
Geburt – vom Atmen des Lebens
Erste Lebensjahre – der emotionale Speicher
Kindheit – wenn Spucke heilt
Laternenkinder – vom göttlichen Licht
Erste Liebe – in Liebe ertrinken
Enttäuschungen – einen Deich bauen
Heiratsantrag – der Sieg über die Arthrose
Hochzeit – auf dem Liebesstern leben
Orgasmus – die andere Welt fühlen
Das Kind im Inneren – sich anrühren lassen
Kino – fliegen in der Gefühlskapsel
Friedensgruß – wie eine Geste uns verwandelt
Engel – über Steine tanzen?
Erde – den Urgrund spüren
Bäume – immer tiefer wurzeln
Wasser – rein werden und fließen
Wind – vom behutsamen Streicheln
Berge – wenn die Seele frei wird
Schnee – das Unendliche sehen
Urlaub – das Fremde schmecken
Lesen – was uns unbedingt angeht
Strand – Sand in deiner Hand
Sehnsucht – wenn es im Herzen zieht
Beruf – brennen, ohne auszubrennen
Jobwechsel – Herz oder Kopf?
Kunst – wie Gemälde das Herz ergreifen
Musik – der Soundtrack deines Lebens
Die Fünfzig – rasten, feiern, genießen
Freundschaft – High Five für die Seele
Krankheit – wenn uns Gefühle aufsaugen
Weihnachten – Dornen tragen Rosen
Ruhestand – die Hände öffnen
Noch einmal Krankheit – wie Salben hilft
Erinnern – wenn die Stimme versagt
Enkel – von gemeinsamen Geheimnissen
Lebensrückblick – der Weg zum Sein
Versöhnung – das Leben umarmen
Segen – das Göttliche berührt dich
Loslassen – von der Kunst des Abschiednehmens
Sterben – das Ewige erahnen
Friedhof – wo Trauer heilt
Kirche – wo Emotionen leben (sollten)
Epilog
Literatur und Quellen
Dank
Der leichteren Lesbarkeit halber verwende ich in diesem Buch mal die Form des einen, mal des anderen Geschlechts, meine aber immer alle Geschlechter, wenn es nicht ausdrücklich anders gesagt wird.
Prolog
An Gott glaube ich nicht«, sagen viele. Sie ergänzen oft: »Aber dass da irgendetwas ist, etwas, was sich nicht so richtig erklären lässt, davon bin ich dennoch überzeugt.« Um dieses Irgendetwas geht es in diesem Buch.
Ein Kind wird geboren, während in der gleichen Stunde seine Großmutter an einem anderen Ort stirbt. Ist das Zufall? Gott? Ein Zeichen aus dem Universum? Berührt sind wir dann jedenfalls von etwas Großem, auch ein bisschen Unheimlichem, vielleicht Heiligem, jedenfalls größer als das, was sich unserem Verstand erschließt. Dieses Große nennen die einen Gott, andere Allah, andere Vishnu, andere Buddha. Mal heißt es Schicksal, Fügung, Glück beziehungsweise Unglück. Oder es hat gar keinen Namen.
Wir nennen es hier das Göttliche. Es in Worte zu fassen, ist schwierig. In Lehrsätze lässt es sich schon gar nicht pressen. Mit Geschichten, Gleichnissen und Gefühlen kommt man dem Göttlichen eher nahe. Geschichten, die Grenzen überwinden. Die uns aufwachen lassen aus unseren Vorstellungen, in die wir uns eingenistet haben und von denen wir uns manchmal eingeengt fühlen. Seit meiner Kindheit finde ich überall Beispiele und Analogien für das Göttliche. Vor Kurzem etwa bei einem Konzert mit Taylor Swift. Da ist zwar die Sängerin, alleine und im Grunde verloren im weiten Rund eines Fußballstadions. Aber sie singt elektronisch verstärkt, läuft auf dem langen Steg an den Fans vorbei, trägt einen silber-rosafarbenen Glitzerbody. Dazu Tänzer, die mit ihren wehenden Tüchern wie Märchenfiguren wirken. Die Sängerin nimmt das Publikum mit ins Boot, indem Zehntausende LED-Bänder an deren Armen leuchten. Mit ihren Songs erzählt sie Geschichten, in denen sich die zuhörende Gemeinde wiederfindet. Wenn sie sich dann zu einem kleinen Mädchen beugt und dieses, emotional überwältigt, ihr ein Freundschaftsarmband überstreift, bleibt kein Auge trocken. Was hier von einer einzelnen Sängerin ausgeht, ist Aura, Fluidum, Magie, Charisma. Ein ganzes Stadion bebt, weint, vibriert. Die Zeit steht still. Augenblick, verweile doch! Du bist so schön!
So ähnlich ist das mit dem Göttlichen. Nur dass das nicht von einem einzelnen Menschen ausgeht. Taylor Swift ist keine Göttin, obwohl ihre Konzerte viele Züge einer Religion haben. Das Göttliche geht von etwas oder jemand Höherem aus. Dem Irgendetwas. Das Göttliche, das ist der Bereich, wo eine höhere Macht wirkt und viele ergreift, erfasst, berührt. Der Ort, wo magische Momente in die Welt kommen und zu uns überspringen. Der topografische Rahmen ist nicht ein Fußballstadion wie bei Taylor Swift, sondern das gesamte Universum.
Was heute vielen schwerfällt, ist, sich eine höhere Macht als jemanden vorzustellen, der sich uns zum Beispiel durch Blitz und Donner offenbart. Da kann uns Sven Plöger besser erklären, was am Himmel passiert und wie die Unwetterlage zustande kommt. Auch ein Gott, der seinem Chefunterhändler Moses hilft, ein ganzes Meer zu teilen und damit einen sicheren Weg zu eröffnen, um vor den Feinden zu fliehen, ist in einer rational durchwirkten Welt schwer zu vermitteln. Dass Gott so handelt, das haben sich die Menschen vor Tausenden von Jahren so vorgestellt. Auch war es in ihren Augen ein allmächtiger, oft zürnender, bisweilen knallharter Gott. Ist dieses Bild vielleicht überholt?
Es »beten dich an die Mächte und fürchten dich alle Gewalten«, heißt es auch noch heute mit Bezug auf Gott, wenn sich Menschen in Kirchen versammeln. Ist das noch so? Beten die Mächte noch Gott an bei so vielen gottverachtenden Mächten in dieser Welt? Fürchten noch »alle Gewalten« Gott angesichts all der selbst erklärten Götter dieser Welt? Es gibt auch das ganz andere Gottesbild. Gott als sanfte, tröstende, heilende und auch leidende Kraft. Noch immer tun wir uns schwer, die höchste Macht uns in dieser Weise vorzustellen. Wir sind geprägt von einem Gott, »der alles so herrlich regieret«, wie es in einem alten Kirchenlied heißt. Aber wir, die wir Erdbeben, Hochwasser und den Tod Millionen Unschuldiger in den Hungerregionen Afrikas kennen, wir, die wir zugleich auf den Mond geflogen sind und selbstfahrende Autos konstruieren, scheitern an diesen Bildern eines allmächtigen, durch Donner und Blitze sprechenden Gottes. Sie wollen uns einfach nicht mehr in den Kopf!
Viel empfänglicher sind viele Menschen der sogenannten westlichen Welt heute für Bilder des Göttlichen, wie sie Religionen in Asien bereithalten. Im Hinduismus glaubt man, jeder Mensch habe eine Art göttlichen Wesenskern (Atman). Dieser Kern strebt ein Leben lang danach, eins zu werden mit dem Göttlichen, das das Universum (Brahman) durchströmt und ausmacht. Schaut man in die mystischen Traditionen zurück, wie sie das christliche Europa ausgebildet hat, stoßen wir auf Gottesdenker wie den mittelalterlichen Meister Eckhart (um 1260–1328). Er hat die Bibel studiert und dann das Göttliche ähnlich beschrieben, wie wir es von asiatischen Religionen kennen. Eindrücklich verdeutlicht Eckhart, wo wir Gott und mit ihm das Göttliche finden: nicht im Jenseits, nicht im Weltall, nicht im Gotteshaus. Nein, Gott wohnt in uns selbst, tief in unserer Seele, als Seelenfünklein. Mit seinem Bild vom Seelengrund, wo sich Mensch und Gottheit vereinen, sind wir nicht weit vom universell Göttlichen des Hinduismus, nach dem der göttliche Kern jedes Einzelnen strebt, entfernt.
Kann man dieses Göttliche fühlen? In vielen Religionen wird das so behauptet. Ein irischer Segen treibt es auf die Spitze. Demnach soll Gott vor mir, neben mir, über mir, in mir und um mich sein. In seiner Hand soll er mich auch noch halten, und zwar fest. Tritt der Segen ein, kann ich Gott gar nicht entrinnen. Er ist ja überall. Seine Aura durchströmt die Welt, meine Welt, und weitet sich zum Göttlichen, Jenseitigen, Himmlischen. Trotzdem wirkt das, als projiziere ich die Nähe des Göttlichen in ein Reich der Wünsche. Möge das Göttliche mit mir sein, wie schön. Was aber bedeutet das denn genau? Schützt mich so ein Segen, die Nähe des Göttlichen, wirklich vor Unheil?
Ein Gott, der aus der Sphäre des Göttlichen auftaucht und mir ganz praktisch die Hand reicht, wenn ich in den Bergen wandere und am Steilfelsen gerade in die Tiefe rutsche – das wäre doch mal ein starker Beweis, dass er und seine göttliche Sphäre existieren! Aber so was passiert nicht. Wenn ich Glück habe, wächst da irgendein knorriger Busch aus den Felsritzen, an dem ich mich festkralle. Wenn ich Glück habe! Oder ist dieses Glück eine Chiffre für Gott? Es wäre nicht das erste Mal, dass Gott sich in einem Busch versteckt, schon die Bibel erzählt davon. Aber für viele ist es einfach ein Busch, nicht Gott. Wir sagen: »Glück gehabt.« Und nicht: »Gott gehabt.«
Die Welt ist entstanden, weil eine göttliche Macht das so gewollt hat. Auch das behaupten viele Religionen. Die Bibel beginnt mit diesem Thema. Wer Gott als den Schöpfer der Welt und allen Lebens glaubt, fühlt den Höchsten oder das Höchste, wenn eine Seerose aufgeht oder die Sonne sich romantisch am Horizont verabschiedet. Aber wirkt das Göttliche auch, wenn ein Unwetter ganze Täler überschwemmt? Wenn wegen sengender Hitze die Brüllaffen in Mexiko tot von den Bäumen fallen? Hat das Göttliche eine gute und eine böse Seite, die wir da spüren?
»In ihm leben, weben und sind wir« (Apostelgeschichte 17,28), sagt Paulus, Reiseprediger, von Gott. Wenn wir in einem Dorf in Südfrankreich eine alte Kirche betreten und zufällig gregorianische Choräle zu hören sind, empfinden wir nach, was Paulus meint. Wir fühlen dann eine jenseitige Sphäre, ohne dass wir genau sagen können, was uns da so anrührt. Wie Fische sind wir dann, die ihre natürliche Lebensgrundlage, das Wasser, nicht spüren. Sie kennen es nicht anders. Es sei denn, ein Angler zieht sie an Land. Ohne Wasser zappeln sie hilflos umher und überleben nicht. Für uns Menschen wäre dann das Göttliche mit Luft gleichzusetzen. Nicht im Sinne von: »Für mich bist du Luft, Gott«, also überflüssig, nicht existent. Im Gegenteil. Luft im Sinne von Sauerstoff. Ohne dich, Sauerstoff-Gott, kann ich nicht leben. Die hebräische Bibel kennt das vielsagende Wort Ruach, bei dem neben dem Wort Luft auch Wind, Atem, Geist und, der modernen Chemie sei es gedankt, Sauerstoff mitschwingt. Ruach schwebte über den Wassern, als die Erde aus damaliger Sicht entstand. Ohne Ruach im Sinne von Sauerstoff zappeln auch wir nur noch kurz rum und überleben nicht. Gott als unser aller Sauerstoff. Hm. Materie, die uns umgibt und die wir nicht bewusst spüren, weil wir immer von ihr umgeben sind. So wie wir selten merken, dass wir atmen, obwohl wir das ein ganzes Leben lang tun. Geht das nur, wenn ich mir Gott dabei vorstelle? Oder kann ich nicht einfach sagen: Sauerstoff umgibt mich, darum lebe ich. Ich werde dem noch genauer nachgehen. Denn wir sind damit dem Göttlichen zumindest auf der Spur!
Gott in allen Dingen finden, lautet ein vielsagender Buchtitel des katholischen Theologen Gisbert Greshake. Er beschreibt, wie erfüllend es ist, Gott in dieser Welt zu suchen (und zu finden). Doch wo fangen wir mit der Suche an? Wenn die Polizei jemanden sucht, der verschwunden ist, setzt sie Spürhunde ein. Brauchen wir demnach Spürhunde für Gott? Im Ernst: Ein bisschen leichter wäre die Sache mit Gott schon, wenn er klarer zu identifizieren wäre. Wie will ich jemanden von Gott überzeugen, wenn ich diesen nicht höre, sehe, fühle?
Ein alter Beter spricht zu Gott: »Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.« (Psalm 139,5) Wenn das stimmt, dann kann es gar nicht ausbleiben, dass ich Gott fühle. Aber was, wenn man bei mir einen kaum heilbaren Tumor festgestellt hat. Gott dann im Tumor sich vorzustellen, als Macht, die mich zerstört, kann man den Betroffenen nicht verdenken. Dem steht allerdings entgegen, dass Gott sich in der Bibel als der darstellt, der Leben schenkt, Leben schätzt, Leben schützt.
Das Göttliche umgibt mich von allen Seiten. Muss ich mir Gott vielleicht wie meinen Schatten vorstellen? Der ist, bei Sonnenschein, immer da, ohne dass ich ihn fühle. Beim romantischen Dichter Adelbert von Chamisso verkauft der Protagonist Peter Schlemihl seinen Schatten an den Teufel. Wäre es uns demnach möglich, Gott zu verkaufen? Aber Gott gehört uns gar nicht. Das wird also kein Deal. Oder kann ich meinen Schatten irgendwo abgeben und nur gelegentlich mit ihm sprechen? So ergeht es all den Schatten in Haruki Murakamis Roman Die Stadt und ihre ungewisse Mauer. Das würde dann bedeuten, wenn Gott mir zu sehr auf die Pelle rückt, trenne ich mich von ihm. Ab und zu schimpfe ich noch mit ihm.
Aber Schatten, das ist tote Materie. Ich möchte nicht, dass Gott nur mein gefühlloser Schatten ist. Ich möchte spüren, dass Gott lebt. Wie er mich begleitet, beschützt, berührt. Wie ich Teil einer göttlichen Sphäre bin und dieses Göttliche mir ein Freundschaftsarmband überstreift. Viele positive Attribute werden Gott seit Jahrtausenden zugeschrieben: Er spendet Trost, er richtet auf, er ist an der Seite des Elenden, wo alle anderen weglaufen. Das möchte ich jetzt, bitte schön, ganz konkret fühlen! Nicht wie Wortgeklingel, das vertröstet, sondern reale Präsenz an meiner Seite, wenn’s mal dicke kommt.
»Ich brauchte jemanden, der meine Hand hielt«, schreibt Salman Rushdie. Der berühmte Schriftsteller war seit Jahrzehnten wegen seines Romans Die satanischen Verse von einem Todesurteil (Fatwa) aus dem Iran bedroht. 2022 geschah dann ein Attentat auf ihn, als er selbst nicht mehr damit gerechnet hatte. Schwer verletzt überlebt er diesen Anschlag. Jetzt hat er einen entscheidenden Termin bei seiner Augenärztin, wo sich entscheiden wird, wie es mit seinem zerstörten Auge weitergeht. Er hat großen Bammel vor dem Gespräch. Er findet die gewünschte Hand, nämlich die seiner Frau Eliza, die ihn begleitet. Für Rushdie hat die Hand, die er braucht, nichts mit Gott zu tun. Er ist durch und durch Atheist. Er gesteht jedem Menschen zu, an Gott zu glauben oder nicht. Dass er das Attentat überlebt hat, obwohl ihm selbst die Ärzte kaum noch Chancen gaben, ist für ihn Glück. Was aber ist Glück? Ist es gleichbedeutend mit Zufall? Mal hat einer Glück, mal hat einer Pech. Man kann selbst nicht beeinflussen, wie es kommt. Kann man so sehen, okay. Aber was, wenn wir hier einen höheren Willen ins Spiel bringen? Nennen wir den höheren Willen mal Liebe. Die Liebe ist das Höchste, hat Paulus gesagt. Rushdie spricht immer wieder von der Liebe, wenn er an seine Ehefrau, an seine Familie, seine Freunde denkt. Liebe. Liebe. Liebe. Sie hat ihm geholfen, die schlimme Zeit auszuhalten. Woher kommt die Liebe? Ist sie eine Erfindung der Menschen? Liebe lässt sich nicht herbeireden, nicht erzwingen. Man bekommt sie nicht im Discounter, bei Tinder oder beim Roulette im Spielcasino in Bad Wiessee. Sie kommt und ist einfach da. Umgibt mich und behütet mich wie ein Mantel in rauer Zeit und wie ein Schirm im Sommer. Ich fühle die Liebe. Sie zeigt sich auch durch Menschen, die uns in schwerer Zeit die Hand halten. Ich würde die Hand von Rushdies Frau nicht als die »Hand Gottes« bezeichnen. Das hieße nämlich, gleich zweifach zu vereinnahmen: zum einen Gott, so wie es der argentinische Fußballer Diego Maradona bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1986 getan hat: Sein unfaires Handspiel führte er auf die »Hand Gottes« zurück. Und zum anderen: Rushdies Frau hat ja ohne Gottesbezug gehandelt. Trotzdem leuchtet in ihrem liebevollen Handeln in dieser so schwierigen Zeit etwas auf, was nicht zu erklären, nicht zu beschreiben und dennoch immer irgendwo vorhanden ist, auch wenn es oft verdeckt ist. Paulus sagt vor zweitausend Jahren: »Die Liebe hört niemals auf.« Die Liebe als etwas Hohes, Großes, das immer da ist und unseren Verstand weit übersteigt. Da ist es nur noch ein kleiner Schritt, Liebe und Gott gleichzusetzen. »Gott ist Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm« (1. Johannes 4,16b), sagt einer, der nach Gott sucht. Der erfahren hat, wie Gott als ganz anderer wie erwartet sich verhält. Gott straft nicht, zürnt nicht, sondern vergibt, liebt. Würden Sie da ein Stück weit mitgehen, Herr Rushdie, wenn wir Gott so umschreiben? Nein, nicht dass Sie sich die Vorstellung zu eigen machen. Aber dass Sie sie nachvollziehen. Am Ende dieses Buches greifen wir die Frage an den Autor und Atheisten Rushdie noch einmal auf. Er beantwortet sie auf eine bemerkenswerte Weise.
Rushdie deutet ungewollt an, wo wir Gott am direktesten fühlen. Nämlich dann, wenn wir von etwas oder von jemandem berührt werden. In seinem Fall durch die Hand seiner Frau, bevor er das Sprechzimmer der Augenärztin betritt. Indem wir berührt werden, überkommt uns etwas, das sich unserem Verstand entzieht. Manchmal sind wir dann sogar ge-rührt (Steigerung von be-rührt), verlieren die Kontrolle über unsere Emotionen. Wer oder was rührt uns da?
Berührt sind wir oft, wenn wir uns erinnern. Wir stöbern zum Beispiel auf dem Dachboden und entdecken einen Zauberstab. Dessen Griff ist ein Glitzerstern. Als Kind haben wir mit ihm die Welt um uns verzaubert. Oder wir stehen am Grab der Großmutter. In jeder, wirklich jeder Not hat sie uns getröstet. Die Erinnerungen, die hochkommen, sind warm und wohlig. Wir stoßen auf ein Foto, das unsere erste Liebe zeigt. Eine einseitige Liebe war das. Sie ging nur von uns aus, die angebetete Person war unerreichbar. Wegen ihr konnten wir nicht schlafen. In uns tobte ein Orkan. Die Erinnerungen schmerzen heute nicht mehr, aber wir sind von uns selbst, von unserem jugendlichen Ich gerührt.
Berührt sind wir von bestimmten Songs. Von Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium, von Amy Winehouse oder von Metallica – jede und jeder ist da auf seiner musikalischen Welle empfänglich und kennt den Soundtrack seines Lebens. Oder ein sanfter Wind streichelt uns im drückend heißen Sommer das Gesicht und kühlt uns ein wenig ab. Auch angenehme Düfte und satte Farben, zum Beispiel die eines Lavendelfeldes, rühren uns an und entführen uns in eine Sphäre, die über das hinausgeht, was wir sonst so kennen. Wir fühlen uns erhoben, getragen, ergriffen. Wir glauben, ein Spalt zum Tor des Paradieses stehe kurz offen. Wir lauschen, schnuppern, tasten uns hinein, um dann wieder in unser normales, oft belastetes Leben zurückzukehren. Hat uns da für einen Augenblick, für einige Sekunden das Göttliche selbst berührt?
Werden wir so berührt, durchdringt das eine Membran bei uns. Was wir erleben, geht unter die Haut, verursacht mitunter Gänsehaut. Als ob wir träumten, ist unser Blick auf ein Bild von Caspar David Friedrich fixiert. Der von ihm gemalte Mönch am Meer, das sind plötzlich wir selbst. Die dräuenden Wolken, die gespenstische See – wir setzen uns jetzt mit den eigenen Gespenstern in unserem Kopf auseinander. Was geschieht in diesen Augenblicken mit uns? Irgendetwas springt uns da an. Wir haben das Gefühl, auf der Spur von etwas Tiefem, Ursprünglichem, dem Eigentlichen zu sein. In solchen Situationen nehmen wir eine Auszeit vom Alltag. Wir gehen aus uns heraus, leben emotional (von lateinisch e-movere, wörtlich: heraus-bewegen). Dieses Aus-uns-Herausgehen tut uns gut. Sogar therapeutisch wirkt das. Wir werden heil, wo wir psychisch verletzt sind. Unsere Seele gesundet. Übersetzt heißt das griechische Wort Psyche Seele, aber auch Schmetterling. Gott ist der Schmetterling in uns. Wo merken wir das mehr, als wenn wir etwas hören, sehen, riechen, schmecken, fühlen, das unsere Seele, unsere Psyche ergreift? Wir lassen Gott, den Schmetterling in uns, zu wenig fliegen. Nur wenn wir verliebt sind, gestehen wir uns Schmetterlinge im Bauch zu.
Nicht nur Dinge wie Poesiealben oder Beatles-Songs berühren uns. Natürlich geschieht das auch direkt durch Menschen. Manchmal sind es Worte, die unter die Haut gehen. »Du fehlst mir«, hören oder lesen wir von einem Menschen, dessen Liebe wir uns nicht sicher sind. Da wirken diese drei Worte wie Balsam. Wenn er oder sie mich vermisst, bin ich ihm oder ihr nicht gleichgültig. »Es tut mir leid«, auch diese Worte, ehrlich gemeint, berühren. Da nimmt jemand sein Verhalten zurück, erkennt, wie verletzend es war. Ein erster Schritt, um sich aufrichtig zu versöhnen, sodass nichts mehr an Vorwürfen zurückbleibt. »Der Krieg ist vorbei«, was für Worte, wenn sie ein Soldat an der Front an die übermittelt, die ihn lieben. Das gilt aber auch für die vielen anderen Kriege, zum Beispiel die, die sich Paare liefern, wenn sie sich trennen. Oder für verfeindete Nachbarn, die sich vor Gericht ihre Psyche wund streiten.
Manchmal sind wir berührt von einer Geste. Ein Freund, den wir durch das Fenster der U-Bahn für eine Sekunde sehen und der um unsere Lebenskrise weiß, hebt den Daumen nach oben. Er signalisiert damit: Du schaffst das, auf mich kannst du außerdem zählen. Oder nehmen wir die Tochter, die zum Studium ans andere Ende der Welt fliegt. Am Flughafen, kurz bevor sie hinter der Gepäckkontrolle verschwindet, haucht sie einen letzten Kuss von der Hand in Richtung der Eltern. »Ich werde euch trotz der räumlichen Entfernung im Herzen behalten, ihr seid mir sehr wichtig, ich liebe euch« – so vieles sagt diese Geste aus. Das schmerzt, rührt an, ist auch Proviant, um die Zeit auszuhalten, in der man getrennt ist. Proviant, der uns unterschwellig von höherer Seite gegeben wird? Oder fällt er einfach so vom Himmel? Das wäre dann das Gleiche. Manna für die Seele.
Über diese Gesten hinaus geht es, wenn Menschen sich direkt berühren. Nicht beiläufig und ungewollt ist hier gemeint, sondern gezielt. Die Eltern, mit denen wir den Kontakt abgebrochen haben und die wir umarmen, nachdem wir uns endlich ausgesprochen haben. Die greise Mutter, die dem erwachsenen Kind über das Haar streicht – weil sie die Liebe, die sie gegenüber dem Säugling empfunden hat, auch im Alter noch genauso empfindet. Oder das fünfjährige Kind greift auf dem Nachhauseweg im Dunkeln nach der Hand der Mutter, um sich zu beruhigen und des Schutzes zu vergewissern. Was für den familiären Bereich gilt, trifft auch zu, wenn wir mit jemandem befreundet oder gut bekannt sind.
Sich körperlich berühren zu lassen und selbst jemanden zu berühren, ist Medizin. Wie Studien zeigen, stärken wir damit unser Immunsystem. Die heilende Kraft, die uns zuströmt, wenn wir uns berühren, geht jedoch weit darüber hinaus. Berühren wir uns, spüren wir, wie wir zu einer größeren Gemeinschaft gehören. Besonders gut zu beobachten ist das beim Sport. Wenn jemand ein Tor erzielt, stürmen die anderen auf ihn zu, umarmen, herzen den Torschützen lange und ausgiebig. Dann spüren wir es: das große WIR!
Punktuell bricht hier durch, was in südlicheren Ländern Europas und überhaupt auf der Südhalbkugel der Erde zum Alltag gehört: sich körperlich nahe zu sein. In nördlichen Gefilden ist man in diesem Punkt zurückhaltender. Die überfällige und mehr als berechtigte MeToo-Debatte und die Pandemie haben ihr Übriges dazu getan, sich zurückzuhalten, wenn wir andere berühren. Klare Grenzen für körperliche Nähe zu ziehen, ist wichtig. Wer sie ignoriert, wird übergriffig. Sexuelle Gewalt hat hier ihre Keimzellen. Das geht natürlich gar nicht, auch nicht in Ansätzen. Das gilt aber nicht für von beiden Seiten erwünschte Berührungen, die uns viel positive Energie schenken. Die uns Göttliches fühlen lassen.
»Sie haben mich früher immer mal umarmt«, sagt mir die alte Frau am Ausgang der Kirche. Ich stutze. Sie hat recht. Ich bin da als Pfarrer vorsichtig geworden. Gerade in der Kirche ist so viel körperlicher und damit auch seelischer Missbrauch geschehen. Darf ich da noch eine alte Frau einfach so ungefragt umarmen? Auch wenn ihre Blicke scheinbar genau das sagen: Berühren Sie mich! Ich habe niemanden, der mich mal in den Arm nimmt! Ich brauche das so! Ich frage mich, ob ich mir das nur einbilde. Aber sie hat sich ja beklagt. Also wünscht sie sich doch, umarmt zu werden. Oder sehe ich das falsch?
Wenn wir uns wenig berühren, enthalten wir uns etwas Wesentliches vor. Viele empfinden das soziale Miteinander als distanziert und kalt. Emotionen öffentlich zu zeigen, gilt als peinlich. Ich erlebe es immer wieder, wie sich Leute bei einer Trauerfeier dafür entschuldigen, dass sie weinen. Dabei ist es so befreiend, wenn wir unseren Emotionen mal freien Lauf lassen. Im Sommer in einem Park ekstatisch tanzen, vor Glück über eine Stellenzusage laut jubeln, sich für ein Paar Ohrringe begeistern, von einem treu blickenden Hund gerührt sein, empathisch mit einem Jungen leiden, dem sein Fahrrad gestohlen wurde – vieles bietet sich an, um unsere Emotionen auszuleben. Es geschieht oft in Fußballstadien, bei Rockkonzerten, auch beim Kölner Karneval. Bei diesen Ereignissen gehen viele, oft vom Alkohol enthemmt, aus sich heraus, umarmen fremde Menschen oder klatschen einander ab. Es ist, als ob ein Gitter hochgeht, das uns sonst einsperrt. Wie ausgehungert nach physischer Nähe viele unter uns sind, zeigt auch ein viral gehendes Video mit einem Mann, der in Fußgängerzonen anbietet, jeden, der möchte, zu umarmen. Der Mann kassiert kaum Körbe! Auch gibt es sogenannte Kuschelpartys, bei denen sich Fremde auf Sofas in den Armen liegen und sich drücken. Für mich sind diese Kuschelpartys ein Zeugnis, wie emotional verarmt wir sind, wenn wir es nicht schaffen, Räume für Nähe zu schaffen, ohne dass wir Vorgaben bekommen und Geld dafür bezahlen.
Gott fühlen, das geht auch auf direktem Wege. Dazu sind die Religionen da. Sie kennen Rituale, die den göttlichen Geist (lateinisch wird er spiritus genannt) herbeirufen und eine Brücke in eine jenseitige Welt (meta-physisch) schlagen sollen. Solche jenseitigen Berührungen erleben Empfängliche, wenn sie meditieren, beten, Rituale feiern. Sie fühlen dann Gott in einer besonders intensiven Weise.
Viele Rituale, die uns die Nähe Gottes bringen, gehen auf die Religionsstifter und ihre Zeit zurück. Rituale sind kein Selbstzweck, sondern haben die Aufgabe, den Weg ins Jenseits, in eine andere Welt punktuell zu ermöglichen. Wir werden dann zu Kindern, denen es erlaubt ist, einen Blick durchs Schlüsselloch auf all das Schöne zu werfen, was uns unter dem Weihnachtsbaum erwartet. Auch wenn es noch eingepackt ist. Aber wir spüren: Das wird tolltolltoll!
Religion geschieht oft in Gemeinschaft. Eine individuelle, nicht auf Gemeinschaft angelegte Religion widerspricht in vielen Fällen ihrem Wesen. Wo Religion ist, da ist Emotion. Wo Emotion ist, da ist es nicht weit zu körperlicher Nähe, zur Berührung. Jesus will uns beibringen, Gott zu fühlen. Deshalb berührt er in manchen Situationen Menschen empfindsam. Er herzt Kinder, fasst Aussätzige an, segnet gerne die, die am Rande der Gesellschaft leben. Er steckt einem Taubstummen die Finger in die Ohren, berührt dessen Zunge und heilt ihn mit dieser zeichenhaften Handlung. Der Vater läuft dem verlorenen Sohn entgegen, fällt ihm um den Hals und küsst ihn; die offenen Arme des Vaters stehen symbolisch dafür, wie Gott sich zeigen will, nämlich als gnädiger und vergebender Vater.
Jesus berührt aber nicht nur Menschen, sondern symbolträchtig auch die Erde, als die sogenannte Sünderin vor dem Männertribunal steht; mit dieser Geste durchbricht er die Spirale von Sünde und Strafe. Weil er weiß, wie sehr Berührungen heilen, lässt er sich auch selbst berühren. Eine Frau, die als Sünderin gilt, lässt er gewähren, als sie ihm die Füße mit ihrem Haar trocknet, küsst und salbt. Dem Lieblingsjünger erlaubt er, den Kopf auf seine Brust zu legen. Wenn seelisch aufgewühlte Menschen auch nur das Gewand von Jesus berühren, beginnen sie zu heilen. Jesu Worte schließlich, sie berühren seit mehr als zwei Jahrtausenden Unzählige, die verzweifeln, trauern, leiden. Diese Worte kommen, so sagt Jesus, direkt aus der göttlichen Sphäre. Das Höchste selbst ist es, das uns damit berührt.
Das Bedürfnis, berührt zu werden und zu berühren, geht weit über religiöse Rituale und Räume hinaus. Es betrifft uns täglich, stündlich, in allen Bereichen. Wir tippen in unser Smartphone, auf den Touchscreen des Geldautomaten, den Türöffner der U-Bahn. Diese Berührungen sind einseitig. Der Geldautomat spuckt Geldscheine aus, aber er ist uns nicht emotional nahe, vergibt uns nicht und hört uns auch nicht empathisch zu. Wir sind viel »in Touch«, aber auf einer Einbahnstraße. Genau das lässt uns noch stärker spüren, was uns fehlt, um glücklich zu sein. Was wir brauchen, ist emotionales Erleben. Darin liegt der Weg zum Glück, zumindest zu glücklichen Momenten (gibt es überhaupt mehr als glückliche Momente? Dauerhaftes Glück, das wäre keins, weil es sich gar nicht mehr gegenüber dem Unglück als Glück profiliert). Wo ich emotional lebe, aus mir herausgehe, mache ich Platz für etwas Größeres, das in mir einzieht.
»Wo du Wohnung hast genommen, da ist lauter Himmel hier. Zieh in meinem Herzen ein, lass es deinen Tempel sein«, heißt es in einem alten Kirchenlied. Angesprochen ist Gott. Gebe ich ihm Raum, wird er in mir wohnen. Wirklich? Wir werden es beobachten. An Geschichten, Songs, Bildern, literarischen Texten, zwischenmenschlichen Begegnungen und jenseitigen Erlebnissen. Über allem die Frage: Ist da Göttliches zu fühlen?