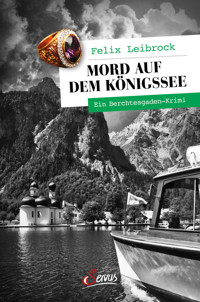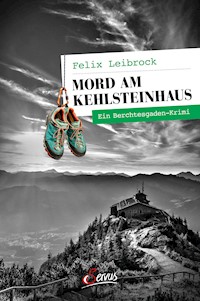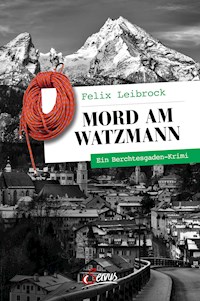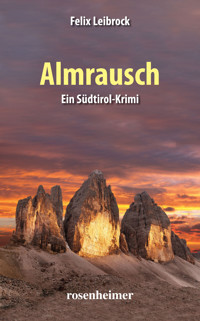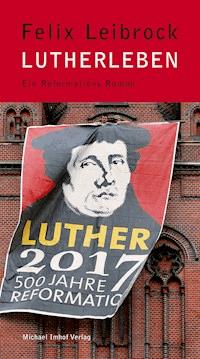Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Europa Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die 18-jährige Selma ist eine lebenslustige junge Frau. Vor ihr liegt ein Sommer voller Träume, gerade hat sie Abitur gemacht und schmiedet Pläne für die Zukunft. Doch dann schlägt das Schicksal erbarmungslos zu: Bei einem tragischen Verkehrsunfall verliert Selma ihr Augenlicht. Für die junge Frau bricht eine Welt zusammen. Nur schwer findet sie sich in ihrem neuen Leben als Blinde zurecht. Und immer wieder hadert Selma mit denselben Fragen: Warum ist das Leben so ungerecht? Woher nehme ich den Mut zum Leben? Und gibt es das Unsichtbare hinter den sichtbaren Dingen? Als sie mit den Bewohnern eines nahegelegenen Seniorenheims ins Gespräch kommt, erhält Selma unverhofft Antworten. Die Alten erzählen aus ihrem Leben, berichten von Krisen und Schicksalsschlägen, aber auch von der Kraft des Neuanfangs. Tief berührt von der Weisheit ihrer Worte, fasst Selma langsam den Mut, ihr Leben wieder in die Hand zu nehmen. Und dann, genau ein Jahr nach ihrem Unfall, kehren mit dem Sommer auch Selmas Träume zurück ... Die einfühlsame Geschichte einer jungen Frau, die sich tapfer zurück ins Leben kämpft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 240
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
1. eBook-Ausgabe 2020
© 2020 Europa Verlag in Europa Verlage GmbH
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur
Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Umschlaggestaltung und Motiv:
Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich
Redaktion: Claudia Alt
Layout & Satz: Robert Gigler, München
Konvertierung: Bookwire
ePub-ISBN: 978-3-95890-310-4
Das eBook einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlichgeschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen desUrheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässigund strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen,Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung undVerarbeitung in elektronischen Systemen. Der Nutzer verpflichtetsich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Alle Rechte vorbehalten.
www.europa-verlag.com
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Ansprechpartner für ProduktsicherheitEuropa Verlage GmbHMonika RoleffJohannisplatz 1581667 Mü[email protected]+49 89 18 94 [email protected]
Inhalt
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
KAPITEL 20
KAPITEL 21
KAPITEL 22
KAPITEL 23
KAPITEL 24
KAPITEL 25
ÜBER DEN AUTOR
KAPITEL 1
Es ist einer jener Sommer voller Schwalben, flirrendem Asphalt und dem unverwechselbaren Geruch von Sonnenöl, Pommes und Jugend über dem matten Grün der Schwimmbadwiese.
Ein Grashüpfer ist auf meinen Studienführer gesprungen und schnuppert am T von DIE ZEIT. Mit meinem Abi von 1,8 ist es schwer bis unmöglich, einen Studienplatz für Psychologie zu bekommen. Ich schreibe Wartezeit in die Contra-Spalte.
»Ey, Selma, komm, mach mit!« Robert und Julia stehen am Volleyballnetz zwanzig, dreißig Meter entfernt und albern mit dem Ball im grauweißen Sand herum. Für ein Volleyballspiel brauchen sie noch Leute. Ich winke ab.
Vielleicht gehe ich ein Jahr ins Ausland. Australien oder Neuseeland, Work and Travel, Erdbeerenpflücken und dann ein bisschen durchs Land reisen. Das würde mir Spaß machen. Ob man mir das als Wartezeit für das Psychologiestudium anrechnet? Ich blättere im Studienführer. Auf der hellblauen Fleecedecke vor mir liegen mehrere Blätter. Oben auf jedes Blatt habe ich einen Studiengang geschrieben, der mich interessiert. Darunter zwei Spalten. Meine berühmten Pro- und Contra-Listen, der Running Gag in unserer Clique. Schauen wir in Roberts Studentenbude die neue Game of Thrones-Staffel? Oder chillen wir bei Giovanni in der Eisdiele? Selma, mach doch mal eine Pro- und Contra-Liste! Sollen sie sich ruhig darüber lustig machen. Mir ist das egal. Ich brauche diese Listen, um meinen Kopf aufzuräumen.
»Seeelma!« Robert hält die Hände als Trichter vor seinen Mund. Wieder winke ich ab. Der Grashüpfer ist auf meinen Oberschenkel gesprungen. Ein leichtes Prickeln durchströmt meine Haut. Das Orange meines Bikinis scheint wie eine Signalfarbe auf ihn zu wirken. Ich bleibe im Schneidersitz und erfreue mich an meinem kleinen Besucher.
»Geografie« steht auf einem der Blätter. Mich interessieren ferne Länder, exotische wie Patagonien oder die Archipele in Indonesien. Ein anderes trägt die Überschrift »Biologie«. Vor einigen Tagen habe ich mir das Institut an der Uni angeschaut. Eine Hochalpenexkursion bieten sie dort an, auf 2500 Meter zur Kürsingerhütte. Und ein meeresbiologisches Freilandpraktikum am Wattenmeer. Wow, das wäre supercool. Aber das ist sicher alles teuer. Auch für Philosophie interessiere ich mich. Bekommt man damit aber einen Job? Wer braucht eine Philosophin?
Oder Germanistik. Ich lese gerne Gegenwartsliteratur, Romane, auch Gedichte. Im Deutsch-Abi habe ich vierzehn Punkte. Das alles schreibe ich in die Pro-Spalte. Oder nimmt man in Germanistik nur die Klassiker durch? Berufliche Perspektiven hätte ich da wohl nur als Lehrerin. Eigentlich will ich das nicht. Auf ein anderes Blatt habe ich »Medienwissenschaften« geschrieben. Immer mehr Pros und Contras zu den jeweiligen Studiengängen fallen mir ein.
Julia und Robert haben zwei Jungs gefunden, die jetzt mit ihnen Volleyball spielen. Sie haben viel Spaß miteinander. Robert ist mit seinen dreiundzwanzig Jahren ganz schön lebenserfahren. Die Ausbildung bei der Polizei hat er abgeschlossen. Polizeioberwachtmeister ist er – gewesen. Kurz nach der Ausbildung hat er den Dienst quittiert. Eine Kollegin von ihm sitzt im Rollstuhl, weil ein psychisch Gestörter sie angeschossen hat. Robert hatte die Schicht unmittelbar danach. Er redet nicht gerne über den Vorfall, aber für ihn war es ein Schlüsselerlebnis. Jetzt studiert er Betriebswirtschaft. Seinen Humor hat er behalten. Ich kenne ihn schon seit Kindertagen, seine jüngere Schwester Clara hat mit mir Abi gemacht. Jetzt ist er mit Julia zusammen, meiner besten Freundin. Das hat mich ziemlich verletzt, denn er hat mir schon immer gefallen. Die letzten beiden Jahre habe ich wegen ihm oft gelitten, konnte nichts essen oder nicht schlafen, aber er wusste nichts davon. Ich habe immer auf eine Gelegenheit gewartet, dass er und ich irgendwo, irgendwie … ach, vergiss es. Die Liebe kann man nicht erzwingen. Jetzt schäkern sie da drüben beim Volleyballspielen miteinander, umarmen sich ständig, geben sich flüchtige Küsse nach jedem Ball, obwohl Julia doch wissen müsste, wie sehr ich in Robert verliebt war und vielleicht immer noch ein bisschen bin. Sie tut mir weh, aber ich bin sicher, sie macht das nicht mit Absicht. Robert himmelt sie an und sie ihn, die beiden passen einfach zueinander. Ich bin draußen. So ist das nun mal.
Pechschwarze Wolken ziehen hinter dem Sprungturm und dem Wäldchen auf. Plötzlich grollt es am Himmel, ein Donnern, dass die Gläser in der Strandbar klirren. Ein Gewitter droht sich schon sehr bald zu entladen. Robert und Julia rennen atemlos herbei. Ihnen folgen die zwei Jungs vom Volleyballfeld. Robert stellt sie mir kurz vor, er kennt sie vom BWL-Studium.
»Los, wir packen es, fahren wir dem Gewitter davon. Im Isartal müsste schon wieder die Sonne scheinen. Dort gehen wir noch in einen Biergarten.«
Eilig klauben wir unsere Klamotten, Zeitschriften, Sonnencremes auf und falten die Decken zusammen. Mit unseren Flipflops, die Taschen über der Schulter, starten wir ein Wettrennen. Robert ist der Erste, der zum Ausgang stürmt und am Mercedes Cabrio seines Vaters eintrifft. Sein Dad hat ihm den Wagen ausgeliehen, im Fuhrpark des Schönheitschirurgen steht ein halbes Dutzend edler Gefährte zur Auswahl. Julia springt auf den Beifahrersitz. Ich quetsche mich mit Luis und Daniel, so heißen die beiden Kumpels von Robert, auf die Rückbank.
»He, Robert, willst du nicht das Cabrio schließen?«, fragt Luis.
»Nein, wir fahren dem Regen davon.«
Robert fährt schneidig los. Man merkt ihm seine Fahrerfahrung an. Neben den Führerscheinstunden hat er bei der Polizei ein spezielles Fahrtraining absolviert. Für Blaulichtfahrten. Bei ihm fühle ich mich sicher, auch wenn er riskant fährt. Allerdings merke ich, dass ich auf dem Sicherheitsgurt sitze. Auch die beiden neben mir auf der Rückbank sind nicht angeschnallt. Wenn ich den Gurt jetzt unter meinem Hintern hervorholen will, müsste ich mich ganz schön hin und her ruckeln. Und das neben den zwei Kumpels von Robert. Am Schluss denken die noch, ich will ihnen auf den Schoß steigen. Ist schon sehr eng da hinten im Fond. Nun, für die paar Kilometer geht es auch mal ohne Gurt.
»Hör auf, Luis! Na warte!«, schreit Robert jetzt gespielt empört nach hinten. Eine nasse Badehose ist von der Rückbank nach vorne geflogen. Die beiden Jungs neben mir feixen, Julia, die ein paar Wasserspritzer abbekommen hat, kreischt vor Vergnügen auf. Laut tönt Musik von Peter Fox aus dem Radio. Mit dem linken Arm hält Robert das Lenkrad fest. Nur kurz dreht er sich um und zielt mit der Badehose auf Luis. Es ist genau der Moment, in dem eine schwarze Wand um die Ecke kommt. Als Robert wieder nach vorn schaut, ist es zu spät. Ein Schleudern wie auf der Achterbahn, dann ein Krachen, als ob mein Schädel platzt. Das Herz steht still. Doch schlimmer als der Knall, das Krachen, ist das völlige Fehlen von Geräuschen danach. Wie in einem Sarg zehn Meter unter der Erde. Totenstille.
Ich heiße Selma Thierer, bin achtzehn Jahre alt und habe gerade mein Abitur gemacht.
KAPITEL 2
Die Wand hat 441 Pferdestärken und gehört einer Spedition, deren besonderes Merkmal die glänzend schwarze Lackierung des gesamten Fuhrparks ist. Instinktiv hat Robert das Lenkrad herumgerissen und damit die Frontalkollision mit dem Lkw vermieden. Das hat uns fünf vermutlich das Leben gerettet. Das Cabrio ist aus der Kurve geflogen und hat sich nicht überschlagen. Auch das ist Glück im Unglück. Aber Robert war es nicht möglich, den seitlichen Aufprall des schleudernden Autos gegen eine Ulme zu verhindern, die wenige Meter neben der Fahrbahn am Feldrand steht. Der Baum hat das Auto genau an der Stelle eingedrückt, an der ich sitze. Durch den Aufprall hat es mich nach vorne geschleudert. Mein Körper ist verdreht und in die Seitentür eingepresst wie ein menschlicher Stempel. Ich falle in eine Art Schlaf, höre zwischendurch immer mal ein paar Wortfetzen. Polizei, Feuerwehr, Notfallseelsorgerin, so sortiere ich die Stimmen. Irgendwann merke ich, wie jemand an meinem Kopf zugange ist, vielleicht einen Verband anlegt. Später höre ich ein lautes Knirschen und Quietschen und stöhne vor Schmerz, weil sich die Seitentür des Autos noch etwas weiter in meinen Rücken und in die Schulter bohrt. Heftiger Regen setzt ein und prasselt auf die Motorhaube wie der Trommelwirbel einer apokalyptischen Band. Dazu wieder Donnergrollen. Dann verliere ich das Bewusstsein.
Diese Abfolge der Ereignisse setzt sich für mich erst später so zusammen, aus dem Polizeibericht, Zeugenaussagen, meinen bruchstückhaften Erinnerungen. Als ich erwache, spüre ich als Erstes meine Arme, eine Decke, ertaste das Gestänge eines Bettes. Gedämpfte Stimmen, das Gespräch zweier Personen.
»Papa, bist du das?«
Für einen Augenblick ist es im Raum völlig still. Nur in der Ferne ist leise ein Martinshorn zu hören.
»Selma! Das ist so schön, dass du wieder wach bist!«
Es ist mein Vater. Aber irgendetwas ist anders an seiner Stimme. Ich kann ihn nicht sehen und will an meine Augen greifen, die mir verklebt vorkommen wie bei einer Bindehautentzündung, die ich als Kind einmal hatte. Ich ertaste einen dicken Mullverband an meinem Kopf, mehrere Pflaster. Ich öffne die Augen, sehe aber nichts.
»Wo bin ich, Papa?«
»Im Krankenhaus, Selma. Bleib ganz ruhig. Du bist hier in guten Händen.«
»Papa, ich kann nichts sehen!«
Mein Vater bleibt stumm. Eine helle Stimme räuspert sich.
»Ich rufe den Oberarzt«, sagt sie und geht nach draußen, wie ich an den Schritten höre.
»Papa, bist du da?«
»Ja, Selma. Mama und Lennart kommen nachher auch.«
Ich bin in einem Krankenhaus. Geräusche schwirren in meinem Kopf herum. Ein Krachen, Bersten, Klirren. Dann totale Stille. Schließlich Stimmen. Sie gehören den Rettungskräften, die das Auto mit einer Metallschere auseinanderschneiden. Oder sägen sie mich auseinander?
»Selma, ist doch gut! Nicht so laut schreien.«
Mein Vater hat seine Hand beschwichtigend auf meinen Arm gelegt. Ich fühle, wie mir der Schweiß ausbricht.
»Papa, wieso kann ich nichts sehen?«
Erst jetzt merke ich, wie meine Schulter und der Brustkorb schmerzen. Nur ganz vorsichtig kann ich den rechten Arm hin und her bewegen. Ich höre, wie sich die Tür öffnet. Schritte, wohl von mehreren Personen. Ich spüre die Präsenz eines Menschen an meinem Bett, jemand beugt sich über mich. Der leichte Geruch von Rasierwasser.
»Frau Thierer, ich bin Doktor Hollweck. Man hat mich aus der Augenklinik zu Ihnen gerufen. Ich werde jetzt einmal Ihre Augen untersuchen, sind Sie einverstanden?«
»Ja, Herr Doktor, bitte.«
Ich zittere am ganzen Körper. Jemand hält meine Hand. Ich vermute, es ist mein Vater. Ein anderer drückt an meinen Augenlidern, am Jochbein. Ein leichtes Klappern und Knacksen, das ich nicht zuordnen kann. Die Zeit dehnt sich.
»Wir werden noch einige Untersuchungen durchführen, Frau Thierer. Jetzt erholen Sie sich erst einmal.«
Dann dieselbe Stimme, leiser: »Sie sind der Vater? Kommen Sie bitte mal mit.«
Schritte, die sich entfernen. Eine Tür fällt ins Schloss.
»Hallo, ist noch jemand hier?«, rufe ich in den Raum. Keine Antwort. Minuten später geht die Tür wieder auf.
»Du hast auch Glück gehabt, Selma«, höre ich meinen Vater mit belegter Stimme sprechen. »Außer den Verletzungen im Gesicht hast du nur das rechte Schlüsselbein und eine Rippe gebrochen. Das hätte noch viel schlimmer ausgehen können.«
Daher die Schmerzen in der Schulter, denke ich mir. Im selben Moment, wo ich mir das bewusst mache, zieht ein Stechen durch meinen rechten Arm, und ich bäume mich leicht auf.
»Papa?«
»Ja?«
»Was ist mit den anderen?«
Wieder höre ich, wie sich die Tür öffnet. Irgendwelche Geräusche neben meinem Bett. Vermutlich der Nachttisch. Jemand schenkt eine Flüssigkeit ein.
»Hier, Frau Thierer, trinken Sie mal einen Schluck. Ich bin übrigens Schwester Vera. Hier ist ein Knopf.« Sie führt meine linke Hand. »Der liegt neben ihrem Bett, auf der linken Seite. Hier. Wenn Sie irgendetwas brauchen, klingeln Sie bitte.«
»Danke«, flüstere ich und höre Schritte, die sich entfernen, eine Tür, die sich schließt.
»Wir sind jetzt alleine im Raum, Selma«, sagt mein Vater wieder mit dieser merkwürdig tonlosen Stimme.
»Die anderen, was ist mit Julia? Mit Robert und seinen beiden Kumpels?«
Ich bin verzweifelt, vor allem, weil mein Vater mit der Antwort zögert. Ich rechne mit dem Schlimmsten. Das Hemd, das ich anhabe, klebt jetzt vor Schweiß an mir wie ein nasser Schwamm.
»Die anderen im Auto sind auch verletzt. Aber nicht ganz so schwer. Julia hat Schnittwunden im Gesicht und ein Bein gebrochen, Robert einen Arm. Ansonsten viele Prellungen, Abschürfungen. Aber die Airbags haben Schlimmeres verhindert. Am wenigsten abbekommen haben die beiden Studenten, die neben dir saßen. Obwohl sie wie du auch nicht angeschnallt waren. Kannst du dich erinnern, wie es zu dem Unfall kam, Selma?«
Das metallicgoldene Mercedes Cabrio von Roberts Vater. Die klitschige Badehose. Ich fühle Luis neben mir, wie er ausholt und wirft. Die Spritzer an der Innenseite der Windschutzscheibe und auf Julias Top. Roberts Blick nach hinten. Die schwarze Wand.
»Nein, nicht so richtig.« Ich atme schnell, mein Herz krampft sich zusammen. »Papa«, schreie ich, »bin ich blind?«
Zwei Hände auf meinem Unterarm, die mich streicheln, drücken.
»Selma, es gibt offensichtlich da ein Problem. Weil du nicht angeschnallt … Also, das ist jetzt auch egal. Durch den Aufprall des Autos auf diesen Baum hat es dich nach vorne geschleudert. Dein Kopf … ich meine, ich bin da kein Experte. Aber der Doktor Hollweck hat mir das mit Fliehkräften erklärt, die dazu geführt haben, dass bei dir der Sehnerv offenbar durchtrennt wurde, also, der ist nicht mehr durchblutet, so wie er das eben gesehen hat, allerdings, ich meine, du weißt ja, die wollen ja noch Untersuchungen machen, also … Aber auch wenn das so sein sollte, werden wir das schaffen.«
»Wenn was so sein sollte, Papa?«
Keine Antwort. Nur das Drücken des Unterarms. Das kann nicht sein. Ich und blind? Sicher ist das nur vorübergehend. Wer erblindet heute noch bei einem Unfall? Vielleicht ist die Linse eingetrübt oder was weiß ich. Eine, zwei, drei OPs, dann kommt das Sehen wieder.
»Da kann doch die Medizin was machen, Papa, oder?«
»Ja, wir werden sehen.«
Mehr kommt nicht. Weint mein Vater etwa? Das habe ich noch nie erlebt. Selbst als Opa starb, sein Vater, hat er die Fassung gewahrt. Beim Essen nach der Trauerfeier hat er sogar eine Rede gehalten, bei der alle immer mal wieder auch gelacht haben. Warum redet mein Vater jetzt so wenig? Gedanken, giftig und schwer wie Blei, fluten mein Gehirn und geben mir das Gefühl zu ertrinken. Mein Puls rast.
»BIN ICH BLIND?«
Ich schlage um mich, drehe mich wild hin und her und schreie hemmungslos wie damals, als ich mit sechs Jahren barfuß von einer Mauer in einen rostigen, aus einem alten Plattenweg ragenden Nagel gesprungen bin. Aber dieses Mal will der Drang zu schreien nicht nachlassen, weil auch das Leiden nicht nachlässt. Sollte ich wirklich blind sein, ist das vielleicht für immer. Erst als ich in meinem linken Arm ein pulsierendes Stechen spüre, lasse ich mich erschöpft nach hinten ins Kissen fallen. Schritte, die herbeieilen.
»Die Kanüle mit der Infusion ist aus Ihrem Arm gerissen, Frau Thierer«, höre ich Schwester Vera leicht angespannt sprechen. »Ich lege sie jetzt neu. Bitte beruhigen Sie sich.«
Bittere Realitäten, die durchsickern. Da soll man sich beruhigen! Meine erste Lehre fürs Leben nach diesem zerstörerischen Unfall: Schock und Schreien gehören zusammen. Man muss einen Ort schaffen, der Schreien ermöglicht. Eine zutiefst verletzte Seele braucht einen Brüllraum.
KAPITEL 3
Seit einer Woche liege ich jetzt in der Augenklinik. Es steht fest: Der Unfall, das Umherschleudern meines Kopfes durch den schweren Aufprall, hat meinen Sehnerv durchtrennt.
ICH BIN BLIND!
Es klopft an der Tür, und ich murmele ein mechanisches »Herein«. Eigentlich ist es mir egal, ob jemand zu mir kommt. Alles ist mir gleichgültig geworden. Besuche, Essen, Fernsehprogramm. Haha, das Fernsehprogramm. Ich bin blind, mein Leben ist zerstört. Der Gedanke, es zu beenden, kommt mir immer häufiger in den Sinn. Aber selbst dazu bin ich als Blinde ja nicht ohne Weiteres imstande. Wenn ich zur Wand renne, wo die Fenster sein müssten, eins öffne und springe, lande ich vielleicht mit ein paar gebrochenen Knochen auf einem Vordach nur zwei Meter tiefer. Was kann ich überhaupt noch?
»Hallo, Selma«, höre ich eine leise, brüchige Stimme. Ich erkenne sie trotzdem.
»Julia. Wie geht es dir denn?«
Julia ergreift meine Hand.
»Hallo. Ich bin auch da.«
Auch diese Stimme ist verrutscht, schwach, fast wie ein Zwölfjähriger, den die Eltern beim Rauchen erwischt haben und jetzt zur Rede stellen.
»Robert?«
»Ja.«
Mehr kommt nicht. Nur ein Schluchzen höre ich.
»Julia? Weinst du?«
Ich vermute, dass sie es ist, die sich schnäuzt.
»Es ist so furchtbar, Selma«, bricht es jetzt unter Tränen aus ihr heraus. »Das war doch alles so nicht abzusehen. Hätten wir doch nur diese blöde Badehose nicht herumgeworfen. Dann wäre das alles nicht passiert.«
Ich warte ab, ob sie noch was sagt. Aber sie schweigt.
»Hätte, hätte, hätte«, übernehme ich und merke eine Aggression in mir, die ich bisher nicht an mir kannte. »Hätte ich mit euch Volleyball gespielt, wäre das alles nicht passiert. Hätten wir die Öffentlichen genommen und nicht diesen supertollen, superschnellen, superschönen, superteuren Mercedes … Jetzt ist der Schrott, und ich bin es auch. Na bravo!«
Ich habe mich aufgerichtet und schreie so laut, dass sich die Tür öffnet und ein Krankenpfleger fragt, ob alles in Ordnung sei.
»Ja«, sage ich scharf, »alles ist in Ordnung. ALLES!«
Keine Ahnung, was für Blicke der Pfleger und meine Besucher miteinander wechseln. Jedenfalls schließt sich die Tür wieder, und der Pfleger scheint nicht mehr im Raum zu sein.
»Es tut mir unendlich leid, Selma. Ich hätte vorsichtiger sein müssen. Am Steuer muss man nach vorne schauen.«
»Toll! Kluge Erkenntnis, Robert!«, fahre ich ihn an. »Noch so ein Hätte-Mensch. Ich liebe Hätte-Menschen. Hätte. Hätte. Hätte. Hättest du darauf verzichtet, uns deine Bonzen-Karre vorzuführen! Hast du aber nicht! Hättest du als Fahrer darauf bestanden, dass wir uns hinten anschnallen! Hast du aber nicht! Und jetzt bin ich blind!«
Es ist ruhig, und ich wimmere leise vor mich hin. Noch mehr Seufzen und Schluchzen ist zu hören. Ich vermute, Julia und auch Robert haben ihre Gefühle jetzt überhaupt nicht mehr im Griff. Minuten vergehen. Kurz kommt mir der Gedanke, dass ich das mit dem Anschnallen gerade auch Robert in die Schuhe geschoben habe. Ich bin ja kein kleines Kind, ich hätte mich unaufgefordert anschnallen müssen. Aber das ist mir in diesem Augenblick egal. Roberts Schuldpaket soll ruhig noch schwerer werden. Er hat es verdient, und zwar so was von!
»Wenn ich es wiedergutmachen könnte, würde ich es tun«, sagt er schließlich.
Mir schießt ein Gedanke durch den Kopf. Robert, meine große Liebe. Er könnte doch als Ausgleich für sein Versagen am Steuer, jetzt statt Julia mich als neue Freundin … Ich verbiete mir den Gedanken gleich wieder. Absurd. Was für ein Bullshit!
»Und mein Vater hat auch alle Hilfe angeboten«, fährt Robert fort. »Du weißt, er ist Chirurg. Plastische Chirurgie. Aber das wirst du nicht brauchen. So wie ich das sehe, sind das nur Schürfwunden, blaue Flecken, Prellungen. Die gehen von alleine weg.«
Sicher meint es Robert, getrieben von schlechtem Gewissen, gut. Aber es ist ein einziges Wort, das genügt, um mich wieder auf die Palme zu bringen.
»NUR Schürfwunden habe ich, mein guter Robert!« Wieder werde ich laut. »Ach Gottchen, alles halb so schlimm, ja, klar. Weißt du eigentlich, dass ich nie wieder etwas sehen werde? Dass ich blind bin, weil du in den Graben gefahren bist?«
Dieses Schreien ist mir wesensfremd. Aber ich kann nicht anders. Mir fällt eine Szene mit Mama ein, als ich noch klein war. Sie hat einen neuen Schnellkochtopf ausprobiert und etwas in der Gebrauchsanweisung falsch verstanden. Der Druck im Topf war gewaltig, als sie ihn geöffnet hat. Die Gemüsesuppe ist bis an die Decke geschossen. Ich bin gerade so ein Schnellkochtopf. Und Robert kennt die Gebrauchsanweisung nicht. Vielleicht gibt es auch keine Gebrauchsanweisung. Er hat jedenfalls den Deckel geöffnet.
»Ich weiß doch, Selma. Aber auch da hat mein Vater seine Hilfe angeboten, ich meine finanziell, er will …«
»HÖR AUF MIT DEINEM VATER!« Ich atme schwer und beiße mir heftig auf die Lippen. »Du musst selbst Verantwortung übernehmen für das, was du angerichtet hast. Ich brauche keine Schönheits-OPs und kein Geld. Ich will wieder sehen, begreifst du das nicht? Ich will in Neuseeland Erdbeeren pflücken, eine Exkursion mit der Uni ans Wattenmeer machen oder mit dem Fahrrad zum Philosophiestudium fahren. Aber das geht alles nicht mehr. Da kann mir dein Vater nicht helfen. Und du nicht. Niemand kann mir da helfen. Aus. Vorbei. Finito.«
Ich lasse mich weinend in die Kissen zurückfallen. Keine Kraft mehr zum Aufbäumen. Dann tauche ich in meine unsichtbare Kapsel ein, fast schalldicht, nur einen undefinierten leisen Geräuschteppich nehme ich noch wahr, unbeholfene Sätze von Robert, vertröstende Worte von Julia. Ich öffne die Luke zur Kapsel nur noch einmal, als Julia mir etwas in die Hand drückt, eine Schachtel.
»Hier! Ich habe meinen Bruder gebeten, mir das zu besorgen.«
Ich öffne die Packung und ertaste ein Gefäß.
»Du musst hier drücken.« Julia führt mir die Hand, den Zeigefinger. »Mach es dir hier auf den Handrücken der rechten Hand. Und dann halte sie dir unter die Nase.«
»Das geht nicht, Julia, das Schlüsselbein rechts ist doch gebrochen.«
»Okay. Dann mach es mir auf die Hand, und ich reib es auf deinen anderen Handrücken.«
Ich drücke den Knopf. Das Geräusch eines Sprühstoßes. Sie reibt ihre Hand an meine.
»So, jetzt riech mal.«
Ich atme durch die Nase einen tiefen Zug ein.
»Donna Karan New York«, sage ich tonlos.
Julias Lieblingsparfüm. Sie hat es letztes Weihnachten von ihren Eltern geschenkt bekommen. Und sie hat nicht vergessen, wie ich mich für den Duft begeistert habe.
»Ich würde vorschlagen, Selma, das wird ab jetzt unser gemeinsamer Duft.«
»Wie? Ist das für mich?«
»Ja. Dann sind wir uns noch ein bisschen näher.«
Julia will mich aufmuntern. Aber sie erreicht mich nicht, weil sie nicht versteht, was uns unterscheidet. Sie hat ein gebrochenes Bein, Robert einen gebrochenen Arm. Ich aber, ich habe ein gebrochenes Herz. Gebrochene Beine und Arme wachsen wieder zusammen. Gebrochene Herzen nicht.
Stühlerücken, Julia umarmt mich, küsst mich auf die Wange, flüstert mir tatsächlich »Ich liebe dich« ins Ohr. Ihr Atem riecht nach Wrigley’s Spearmint. Robert traut sich offenbar nicht, mich zu berühren. Abschiedsworte. Sie gehen in die Welt der Sehenden. Ich bleibe im Reich der Blinden zurück. Als sie gegangen sind, halte ich mir den Handrücken unter die Nase und sauge den Duft tief ein.
In den wenigen klaren Momenten in diesen ersten Tagen nach dem Besuch von Julia und Robert sage ich mir: Ich darf es mir nicht mit denen verscherzen, die nach so einem Ereignis an meiner Seite sind. Nicht dieses Schimpfen, das ganz schnell, bei einer falschen Bemerkung, in ein Beschimpfen übergeht. Auch bei meinen Eltern, bei meinem jüngeren Bruder Lennart habe ich mich schon mehrfach so wie bei Julia und Robert gehen lassen. So war ich doch vor dem Unfall nicht. Bin ich nur vorübergehend wehleidig, oder verwandle ich mich in eine Misanthropin? In einer Zeitschrift habe ich gelesen, dass Trauernde die ersten Wochen nach dem Tod des geliebten Menschen viel Zuwendung erfahren. Aber spätestens nach einem halben Jahr wandelt sich das in Ungeduld: Jetzt trauert die immer noch!
Wer bin ich anderes als eine Trauernde? Ich trauere um Selma, die Sehende. Maximal ein halbes Jahr habe ich also. Dann wird es einsam um mich.
KAPITEL 4
Meine Eltern sind beide gekommen. Zwei Wochen nach dem Unfall ist mein Klinikaufenthalt zu Ende. Ich darf nach Hause. Wir fahren mit dem Auto. Ich zittere vor Angst. Die Erinnerung an meine letzte Autofahrt (von der Fahrt mit dem Krankenwagen, an die ich mich nicht erinnere, abgesehen), die Unfallfahrt. Aber es geht nicht anders. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln wäre es noch schwieriger.
Die ersten Tage und Wochen zu Hause sind schlimm. Meine Mutter bemüht sich, es mir schön zu machen. Sie kocht fast jeden Tag ein anderes meiner Lieblingsessen, kauft tausend Teesorten oder Igelbälle für die Handmassage. Aber ich nehme das gar nicht richtig wahr, meine Seele ist eine düstere Zelle ohne ein Fenster zur Außenwelt.
»Wir haben eine Blindenlehrerin gefunden, eine Trainerin. Die würde dir erst mal privat einigen Unterricht geben. Mobilitätstraining und so.«
Ich hebe den Kopf in die Richtung, aus der ich die Stimme meines Vaters gehört habe. Wir sind im Wohnzimmer, ich sitze im Sessel der Ledergarnitur, die in einem ganz tiefen Blau gehalten ist. Oder ist sie doch schwarz? Ich erinnere mich nicht mehr. Sofort spüre ich einen Stich im Herzen. Nie wieder werde ich selbst überprüfen können, welche Farbe das Sofa hat. Auch weiß ich nicht, wie der Garten hinter unserem Haus mittlerweile aussieht. Sind schon Blätter gefallen? Jagen die Eichhörnchen noch durch die Bäume? Und in meinem Zimmer, liegen da noch die ganzen Abi-Unterlagen rum? Wie soll ich, wenn ich ein Buch oder einen Zettel in der Hand halte, herausfinden, was da draufsteht? Mir tut sich ein Ozean voller Fragen auf, und die Antworten liegen tausend Kilometer tief auf dem Meeresgrund.
»Ich brauch keine Lehrerin«, sage ich trotzig. »Ich habe monatelang fürs Abi gebüffelt. Das muss reichen.«
Mir ist klar: Diese Aussage ist nicht logisch. Kein Ausbund an Intelligenz. Aber ich will einfach nicht logisch sein. Logisch ist auch nicht, dass mich eine schwarze Wand und eine alte Ulme zerstören.
»Selma, die Lehrerin wird dir die Blindenschrift beibringen. Auch wie du am Computer arbeiten kannst. Außerdem lernst du, mit einem Blindenstock zu gehen. Das macht dich unabhängiger«, sagt mein Vater mit einem fast flehenden Unterton.
Ich atme schwer. Will da jemand sagen, ist doch alles halb so wild?
»Ich werde nie wieder unabhängig sein. Immer abhängig von der Hilfe anderer. Da kannst du dich nicht hineinversetzen. Niemand!«
Nicht zum ersten Mal unternimmt mein Vater den Versuch, mein Denken nach vorne auszurichten. Er nervt mich damit. Ich kann nicht gedanklich nach vorne schauen, wenn in meinem Kopf nur Bilder von Ulmen und zerquetschten Autotüren auftauchen. Ich kann keine Ratschläge hören, wenn in meinem Kopf das Geräusch einer Metallschere dröhnt, die eine Karosserie aufschneidet. Ich kann nicht an eine Zukunft denken, wenn meine Träume von vor wenigen Wochen in ein Land namens Absurdistan ausgewandert sind.
»Du kannst der Lehrerin absagen. Ich will das nicht.«
Mein Vater sitzt irgendwo auf dem Sofa. Ich höre, wie er sich erhebt, im Wohnzimmer umherläuft.
»Aber wie stellst du dir denn deine Zukunft vor?«, fragt er schließlich, und ich glaube, eine leichte Ungeduld in seiner Stimme zu hören. »Willst du dich für immer hier im Haus und in deinem Zimmer verkriechen?«
»Ach, geh ich euch auf den Keks? Wollt ihr mich hier weghaben? Weil ja der Plan war, dass ich irgendwo studiere und ihr das Haus dann sanieren könnt?«
Meine Stimme hat wieder dieses Schrille. Als ob der Unfall auch ein paar Stimmbänder zerkratzt hätte. Ich mag mich so nicht hören, muss mich aber auch wehren. In mir kocht es, brodelt es seit dem Unfall, manchmal explodiere ich. Neben dem Bild vom Schnellkochtopf ist mir ein anderes für meine Wutausbrüche eingefallen: das vom Old Faithful, dem regelmäßig aktiven Geysir im Yellowstone Nationalpark. Den habe ich mir vor wenigen Wochen noch angeschaut. Die USA-Reise, direkt nach der Abi-Feier. Das Geschenk meiner Eltern zum Schulabschluss. Fast bin ich erleichtert, dass der Unfall erst danach stattfand. Sonst hätte ich auch das nicht erlebt.
»Selma, wie kommst du denn auf so was? Wir wollen dich doch nicht weghaben.« Meine Mutter ist auch irgendwo im Raum und wirkt konsterniert.
»Weil ich nur noch eine Last für euch bin. Ihr müsst euch um mich kümmern, sucht mir eine Blindenlehrerin aus und lauter solche Sachen. Ich will aber nicht mehr von euch abhängig sein. Ich will meine Freiheit! Das ist doch mit achtzehn Jahren ein ganz normaler Wunsch! Könnt ihr oder wollt ihr das nicht begreifen?«
Mein Old Faithful spuckt wieder heiße Gischt aus. Ich erhebe mich und taste mich zur Wendeltreppe, die in den ersten Stock und zu meinem Zimmer führt. An der Treppe stoße ich mir das Schienbein und schreie vor Schmerz auf. Ich setze mich auf die Treppe und habe meine Gefühle nicht mehr im Griff.