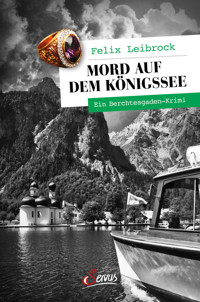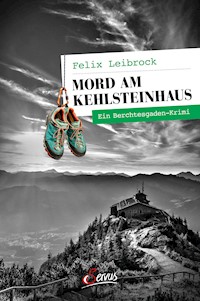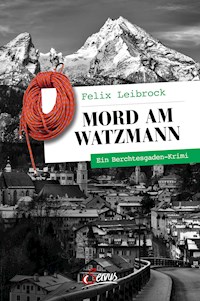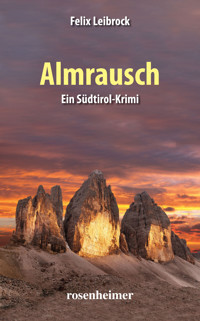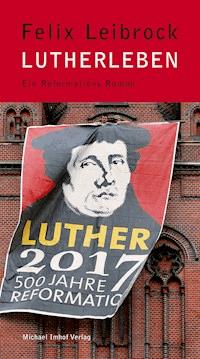Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Europa Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Stalter, du bist raus." Mit dieser WhatsApp-Nachricht beginnt für Stalter der unaufhaltsame Abstieg. Bis vor Kurzem war er noch der erfolgreiche Geschäftsmann mit Frau und Kindern und der Option auf ein schickes Haus in München-Solln. Jetzt ist die Ehe am Ende, seine Geschäftspartner haben ihn ausgebootet, die letzten Geldreserven sind aufgebraucht. Mit Hartz IV ist die Miete in München unbezahlbar, Stalter landet auf der Straße, wo ihn die harte Realität der Obdachlosigkeit mit voller Wucht trifft und er sich unter den Ausgestoßenen der Gesellschaft wiederfindet. Beim "Sternenexpress", einer mobilen Obdachlosenhilfe, trifft Stalter auf die Märchenerzähler Vasile, Samir und einige andere Obdachlose. In ihren stimmungsvollen Geschichten aus ihrer Heimat geht es um Trauer und Verlust, um Liebe und Hoffnung, um die Suche nach dem Glück. Sie berühren Stalter tief und eröffnen ihm einen neuen Blick auf sein altes, von der Jagd nach Geld und Erfolg getriebenes Leben. Er erkennt die heilende Kraft der Märchen, erkennt, wie viel Lebensweisheit in ihnen steckt. Er beginnt, sie aufzuschreiben und an Passanten zu verteilen. So wird Amelie, eine Mitarbeiterin beim "Sternenexpress", auf ihn aufmerksam. Auch sie glaubt an den tiefen Sinn der Märchen und macht Stalter ein Geschäftsangebot – Stalters Chance, sich ein neues, erfülltes Leben aufzubauen. Die einfühlsame Entwicklungsgeschichte eines Mannes, der ganz tief fällt und sich wieder nach oben kämpft, verwoben mit alten Märchen aus verschiedenen Kulturkreisen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 231
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das eBook einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
1. eBook-Ausgabe 2019
© 2019 Europa Verlag GmbH & Co. KG, München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur
Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Umschlaggestaltung und Motiv:
Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich
Redaktion: Claudia Alt
Layout & Satz: Robert Gigler, München
Konvertierung: Bookwire
ePub-ISBN: 978-3-95890-283-1
Alle Rechte vorbehalten.
www.europa-verlag.com
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Ansprechpartner für ProduktsicherheitEuropa Verlage GmbHMonika RoleffJohannisplatz 1581667 Mü[email protected]+49 89 18 94 [email protected]
INHALT
PROLOG
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
KAPITEL 20
KAPITEL 21
KAPITEL 22
KAPITEL 23
KAPITEL 24
MÄRCHEN IN DIESEM BUCH
ÜBER DEN AUTOR
PROLOG
Es beginnt mit einer WhatsApp-Nachricht:
Stalter, du bist raus!
In diesem Augenblick weiß ich, was mir bevorsteht.
Der Abstieg in nie gekannte Tiefen.
Sie haben mich betrogen, ausgetrickst.
Ich habe den Falschen vertraut.
Kann man überhaupt jemandem vertrauen?
KAPITEL 1
An manchen Tagen sind wir froh, wenn sie vorbei sind. Wir haben eine Prüfung vergeigt. Uns mit einem Nachbarn zerstritten. Oder einen Auffahrunfall verursacht. Endlich liegen wir im Bett, schließen die Augen. Aber wie schwarze Wolken über dem Atlantik ziehen uns Bilder entgegen, die uns am Einschlafen hindern. Hätte ich bei der Prüfung nur das andere Thema gewählt! Wäre ich nur dem Nachbarn aus dem Weg gegangen! Hätte ich nicht für diesen einen Sekundenbruchteil aufs Handy geschaut, als ich am Steuer meines Golfs saß! Wir sind in die Grübelfalle geraten. Gedanken, die unablässig wie Silberfischchen durch unseren Kopf wuseln.
An meinem ersten Tag auf der Straße ist es genauso. Es ist der erste April, zugleich der Ostersonntag. Doch es ist kein Aprilscherz, sondern bitterer Ernst. Am Tag zuvor habe ich meine Siebensachen in den Reisekoffer gepackt, den vergammelten Teppich und das klapprige Badregal in den riesigen Rollcontainer der Wohnanlage geworfen und den Boden gewischt. Jetzt sehe ich ein letztes Mal in die nun leere Wohnung. Die Wände malern muss ich Gott sei Dank nicht, dazu wohne ich zu kurz hier. Ich gehe die vier Stockwerke die Treppen hinunter. Im Innenhof befördere ich auch den Schrubber und das feuchte Putztuch in den Container. Die Wohnungsschlüssel bringe ich zum Hausmeister.
»Und nun, wohin des Weges?«, sagt er und kratzt sich am Hals. In seinen Augen sehe ich kleine Dolche blitzen. Im Hintergrund springen seine Enkelkinder mit Schokoladen-Osterhasen durch die Wohnung und schreien laut. Ich halte seinem Blick nicht stand. Stumm ziehe ich davon.
Der Himmel ist seltsam farblos, unentschieden. Mich interessieren die Temperaturen, die in der Nacht zu erwarten sind. Ich schaue in die Wetter-App meines Handys. Noch bis Ende April läuft der Vertrag. Dann habe ich zwar noch ein Handy, aber keinen Anbieter mehr. Vielleicht wird mein Geld reichen, um mir bei einem Discounter eine billige Flatrate zu kaufen.
Ich gehe zur Sparkasse, schiebe die EC-Karte in den Automaten. Auf meinem Konto sind sechshundertvierundzwanzig Euro und siebenunddreißig Cent. Das Hartz-IV-Geld ist am Tag zuvor eingegangen. Das muss für einen Monat reichen. Bald werde ich mich um eine Adresse bei einer sozialen Einrichtung bemühen, um für das Arbeitsamt erreichbar zu sein. Sonst ist auch diese finanzielle Unterstützung bedroht, ebenso wie der Erhalt meines Bankkontos, das an eine Adresse gebunden ist. Ohne Wohnsitz bist du in Deutschland am Arsch.
Am Hauptbahnhof falle ich mit meinem schweren Touristenkoffer (der Gepäckstreifen vom Mallorca-Urlaub vor zwei Jahren klebt noch an der Trageschlaufe) und dem blauen Rucksack nicht weiter auf. Hoch unter der Bahnhofskuppel turteln zwei Tauben. Niemand interessiert sich für dieses Liebesspiel. Die Lautsprecherdurchsagen und das Rauschen und gelegentliche Quietschen der ein und aus fahrenden Züge vermischen sich zu einem Klangteppich. Ich starre auf eine Dachstrebe. Die leere Wohnung taucht vor meinem inneren Auge auf, dann Bilder aus früheren Urlauben, die Kinder beim Ponyreiten. Ich spüre, wie Gefühle von Schuld und Existenzangst in mir hochsteigen.
Erst als die Tauben aus der Halle fliegen, nehme ich meine Umwelt wieder wahr. An einem Kiosk kaufe ich mir ein Roggensandwich mit Salami und Käse, dazu einen Liter Milch. Auf einer Bank an den Gleisen lasse ich mich zum Essen nieder. Ein Zug in Richtung Dortmund steht bereit. Nach und nach füllt er sich mit Reisenden. Niemand nimmt von mir Notiz, nicht einmal die Bundespolizisten, die an mir vorbeipatrouillieren.
Warteraum, steht auf einem Wegweiser. Vielleicht kann ich dort meine erste Nacht verbringen, denke ich. Ich gehe in die Richtung, die das Schild weist. Oben, am Ende einer Rolltreppe, sehe ich durch eine Scheibe in den Warteraum. Darin sind hölzerne Bänke, kleine weiße Tische, die fest im Boden verankert sind.
Aufenthalt nur mit einem gültigen Fahrausweis gestattet, lese ich auf einem Schild an der Eingangstür. Das klingt nach Konflikt. Tausende Obdachlose gibt es in der Stadt, und ich bin ein absoluter Anfänger, ein Novize des Lebens auf der Straße. Als ob man einfach so in einem Wartesaal im Bahnhof übernachten kann, das war wahrscheinlich ein lächerlicher Gedanke. Der Kapitalismus muss sich gegen seinen eigenen Auswurf schützen. In einer Zeitung habe ich gelesen, manche Filialisten großer Handelsketten in der Fußgängerzone hätten versteckte Wasserdüsen angebracht, die nachts alle halbe Stunde den Eingangsbereich wässern und so die Obdachlosen vertreiben.
In meiner ersten Nacht will ich auf jeden Fall Konflikte vermeiden. Eigentlich bin ich sowieso ein eher konfliktscheuer Typ. Im Wartesaal des Bahnhofs will ich es nicht drauf ankommen lassen. Ich ziehe weiter.
Draußen ist es dunkel geworden. Die Reihe der Taxis am Ausgang ist endlos. Kaum fährt eines davon, rückt am Ende der Schlange ein neues nach. Ich ziehe mit meinem Koffer durch die Straßen. Mein Ziel ist ein kleiner Park gleich hinter der Matthäuskirche beim Sendlinger Tor.
Den habe ich mir ein paar Tage vorher schon mal angeschaut. Es gibt Bänke, keinen Zaun. Ein Obdachloser liegt eingemummelt in Decken auf einer dieser Bänke. Sein unregelmäßiges Schnarchen ist weithin zu hören. So merkwürdig es klingt, ich bin froh, ihn dort auf dieser Bank zu wissen. In Extremsituationen möchten wir nicht allein sein, auch wenn wir den anderen nicht kennen. Für mich ist es eine Extremsituation. Die ersten Stunden als Obdachloser liegen hinter mir. Jetzt kommt die Nacht. Ich sehe mich um. Die schwache Parkbeleuchtung gibt nur den Deckenberg zu erkennen, unter dem der Schnarcher liegt. Sonst ist niemand in diesem Park unterwegs.
Ich öffne meinen Koffer und breite den zusammengerollten Schlafsack auf der Bank aus. Zwei Pullover knautsche ich als Kopfkissen zurecht. Den Koffer lege ich unter die Bank, den Rucksack neben meinen Kopf. Vorsichtshalber habe ich eine Schnur dabei, die ich am Koffer und an meinem linken Arm verknote. Falls jemand versucht, mir im Schlaf den Koffer zu stehlen, reißt mich die Schnur wach. Wer auf der Straße lebt, so befürchte ich, ist im Dauermodus des Bewachens. Das wenige, was man hat, ist immer bedroht. Diebe, Betrunkene, die Lust am Vandalismus haben – die Angst ist diffus, bei mir aber gerade jetzt, in dieser ersten Nacht, extrem stark. Der Gedanke, auch noch meine paar Klamotten, die Fotos von den Kindern, meine Behördenpapiere zu verlieren, macht mich fast wahnsinnig. Ich ruckele mich in den Schlafsack und schaue zum Sternenhimmel.
Sterne haben schon vielen Menschen den Weg gewiesen. Mir sagen sie nichts. Nach einer Weile schließe ich die Augen. Ich spüre mein Herz schlagen. An Schlaf ist nicht zu denken. Die Silberfischchen im Kopf. Ich sehe Leon und Lisa vor mir. Sie sind aus dem Alter raus, in dem sie noch Ostereier suchen. Aber trotzdem bekommen sie von Sabine heute kleine Geschenke. Und Karl und Gerlinde sind sicher zu Besuch gekommen. Die Schwiegereltern, die mich von vornherein abgelehnt haben und mich jetzt vernichten wollen. Aus der Firma geflogen, pleite, nicht mal mehr in der Lage, eine Familie zu ernähren.
Wahrscheinlich gibt es das große Osterlästern über mich, selbst vor den Kindern. Karl kennt da keine Rücksichten. Die Kinder sollen ruhig wissen, was für ein Hallodri ihr Vater ist. Ich hoffe auf Sabine, sie ist anders. Sanfter, nachgiebiger. Auch wenn sie enttäuscht von mir ist, würde sie vor den Kindern nicht schlecht über mich reden. Sie hätte auch die geschäftliche Pleite mit mir durchgestanden. Aber was sie mir nicht verzieh, war die Affäre mit dieser komischen Nadja. Das war auch so eine, die nur ihren Vorteil sah, mich ausnutzte. Aber ich war schwach. Nachdem Sabine Nadjas Briefe (sie schrieb mir welche mit der Hand) entdeckt hatte, gab es einen Bruch.
Nadja war nur der Auslöser, schon seit einigen Jahren war mir und sicher auch Sabine klar, dass es nicht mehr stimmte zwischen uns beiden. Jetzt kann sie mir nicht mehr vertrauen, sagt Sabine. Ich glaube, sie schiebt das vor, zum Teil jedenfalls. Sie hat, nach reichlich Rotwein, Karl und Gerlinde von meiner Affäre erzählt. Die sahen die Chance gekommen, ihren blutleeren Ruhestand mit einem Mega-Thema zu füllen: die Rettung ihrer Tochter vor dem Nichtsnutz und Fremdgänger Stalter. Ein moralisches Hochamt, was sie da feierten. Der Krieg gegen mich war eröffnet, auch wenn ich alles unternahm, um ihm auszuweichen.
Erst weit nach Mitternacht dämmere ich weg. Dann schrecke ich plötzlich hoch. Die Schnauze des Schäferhundes ist nur wenige Zentimeter von meinem Gesicht entfernt. Er bellt fürchterlich. Nur eine straff gezogene Leine hält ihn ab, sich auf mich zu stürzen.
KAPITEL 2
Der Hundebesitzer, der eine filterlose Zigarette in der Hand hält und einen lila Kapuzenpullover trägt, murmelt ein »Dertutnix« und zieht weiter. An Einschlafen ist jetzt nicht mehr zu denken. Ich brauche eine andere Schlafstätte, die nicht so zentral gelegen und wo nicht jederzeit mit Publikumsverkehr zu rechnen ist.
Ich erhebe mich, während es zu dämmern beginnt. Wie eine Figur aus der Augsburger Puppenkiste bewege ich mich langsam und ungelenk, um meinem Körper ein paar koordinierte Bewegungen abzuringen. Irgendetwas registriere ich positiv, ohne in diesem Augenblick klar zu wissen, was. Auf meinem Handy drücke ich die Selfie-funktion, um mich anzuschauen. Graue Bartstoppeln sprießen aus meinen leicht eingefallenen Wangen und am Kinn hervor. Unter den Augen zeichnen sich ein Netz von Fältchen und dunkle Furchen ab. Bin ich schon durch diese eine Nacht gealtert? Manchmal schauen wir in den Spiegel und haben das Gefühl, schlagartig um Jahre gealtert zu sein. Heute ist für mich so ein Tag. Ich überlege, ob ich zum Hauptbahnhof gehe, um zu duschen. Am Vortag habe ich gesehen, dass das dort sieben Euro kostet. Viel zu teuer angesichts meiner Finanzlage. Ich brauche eine preiswertere Variante. Auch muss ich mich an den Gedanken gewöhnen, nicht mehr wie die letzten Jahrzehnte fast täglich zu duschen. Als ich mein Handy öffne, um eine Duschgelegenheit zu googeln, sehe ich zu meinem Schrecken den Ladezustand, der auf zehn Prozent abgerutscht ist.
Im Familienchat ist eine Nachricht angezeigt. Sie ist am Abend zuvor eingegangen.
Frohe Ostern, Papa. Wo bist du? Was machst du?
LG Leon und Lisa
Als Erstes muss ich einen Weg finden, das Handy aufzuladen. Ich gehe zum Burger King in der Sonnenstraße, der aber noch geschlossen ist. Ob es dort ungeschützte Steckdosen zum Aufladen gibt, ist ohnehin ungewiss. Bei Google finde ich den Hinweis auf Sankt Bonifaz. In dem Benediktinerkloster nahe dem Königsplatz ist es Obdachlosen möglich, sich zu duschen. Auch etwas zum Essen steht dort bereit. Ich mache mich auf den Weg. Duschen, das Handy aufladen, was essen, dann werde ich den Kindern etwas länger schreiben.
Wenn wir ziellos vor uns hin leben, drohen wir uns zu verlieren, ins Beliebige zu verfallen. Wie eine im Meer treibende Plastikflasche werden wir hin und her geworfen. Darum ist es wichtig, dem Tag eine Struktur zu geben. Erst tue ich dies, dann das, dann jenes.
Als ich an Sankt Bonifaz ankomme, ist die Tür verschlossen: Ostermontag, erst am nächsten Morgen ist Duschen möglich. Aus der Kirche strömen einige Gottesdienstbesucher. Ein älterer Mann mit hellbrauner Hornbrille sieht mich zusammengekauert seitlich auf den Kirchenstufen sitzen und schiebt mir mit reglosem Gesicht einen Zehneuroschein zu. Ich nicke, murmele ein »Danke« und schäme mich abgrundtief. Ich frage mich, ob ich nach einer Nacht im Freien auf Menschen mit einem geregelten Leben schon wie ein Bettler wirke.
Der Akku meines Handys ist inzwischen leer. Ich werde den Kindern erst morgen schreiben können, falls dann in Sankt Bonifaz das Aufladen möglich ist.
Mit Koffer und Rucksack stapfe ich wieder zum Hauptbahnhof und beobachte die Reisenden. Viele, die über Ostern Verwandte besucht haben, fahren jetzt wieder in ihre Orte zurück. Diese Familienleute leben in ihrer Welt, und ich lebe in einer neuen Welt, die gar keine Welt ist. Oder besser: eine Unwelt. Eine Unwelt des Überlebens, eine Existenz mit den Elementarzielen Essen, Trinken, Waschen, Aufwärmen, Handyaufladen. Eine Unwelt, weil sie keinen höheren Zweck, keine über das blanke Überleben hinausgehenden Ziele kennt. Eine Unwelt ohne Lachen, Hoffen und freudigem Erwarten. Einfach nur die Stunden fristen, die Tage herunterleben, bis es dann hoffentlich irgendwann vorbei ist. So blicke ich in die Zukunft und merke, wie eine unsichtbare Kraft mich in meinem Inneren nach unten zieht. Stiche im Herzen, mein Kopf wiegt zehn Tonnen.
Am Mittag verzehre ich einen Döner. Den Rest des Tages lege ich mich auf eine Bank hinter der Glyptothek und sehe in den grauen Himmel. Eine Wolkendecke wie ein verwaschenes farbloses Bettlaken. Nach einer Stunde Sinnieren fällt mir ein, was mich in der Morgendämmerung positiv berührt hat: das Vogelgezwitscher. Der vielstimmige Frühlingschor, wie er aus den Hecken und Sträuchern an der Matthäuskirche hervorgestiegen ist. In den noblen Büroräumen in der Nymphenburger Straße, die ich mir mit Galkowski und Kleinert geteilt habe, habe ich mich oft bis in die Morgenstunden aufgehalten. Gut möglich, dass beim Verlassen des Büros irgendwo auch Vögel zu hören waren. Aber meine Gedanken spazierten auch beim Verlassen des Büros durch offene Kundenrechnungen, Kreditraten und Mahnbescheide. Die Natur existierte für mich nicht.
In trostlosen Lagen brauchen wir kleine Freuden, Dinge, die wir im Alltagsgetriebe übersehen, überhören oder als selbstverständlich erachten. Ich nehme mir vor, mich beim nächsten Einschlafen auf den Gesang der Vögel im Morgengrauen zu freuen.
Trotz gerade erfolgter Umstellung auf die Sommerzeit fällt die Dunkelheit schnell wie ein Theatervorhang über den Königsplatz. Es beginnt zu nieseln. Ich flüchte mich zur Technischen Universität, unter das Vordach der Mensa. Die Straße ist fast menschenleer. Nur ein paar Studierende mit asiatischen Gesichtszügen parken ihre Fahrräder vor der gegenüberliegenden Musikhochschule und tragen ihre Instrumentenkoffer wie eine Monstranz vor sich her. Ich setze mich auf den Boden und starre in die Regenpfützen auf der Straße. Die Nacht werde ich auf einer der Bänke hinter der Glyptothek verbringen. Nicht nur weil Ostern ist, habe ich mir eine Flasche bulgarischen Rotweinfusel am Bahnhof gekauft, an der ich jetzt nippe und warte, bis ich richtig müde bin und der Regen aufhört.
Kurz vor zweiundzwanzig Uhr fährt ein dunkelblauer Bus mit der Aufschrift Sternenexpress an der Mensa vor. Ein junger Mann mit Flaumbart und eine Frau um die vierzig mit offenem lockigem Haar, ebenen, nur von einer beiläufigen Falte über der Nasenwurzel durchbrochenen Gesichtszügen wuchten einen großen Stahlbehälter aus dem Laderaum und stellen ihn auf einen ebenfalls mitgebrachten Hocker. Als ich mich abwende, um mich still zu verdrücken, ruft die Frau nach mir.
»Hallo, möchten Sie nicht auch eine Suppe essen?«
Die Stimme klingt etwas rau, aber nicht unsympathisch. Ich drehe mich um und sehe in ein Paar sanftblaue Augen.
»Gestatten, Amelie«, sagt sie und strahlt mich warm an. Ihre Jeans ist an mehreren Stellen eingerissen, und ich bin mir nicht sicher, ob das Mode oder ein Zeichen der Solidarität mit den Obdachlosen und ihren teils zerrissenen Kleidern ist. Denn sie selbst ist, wie ihr zwar freundliches, aber auch dominantes Auftreten verrät, aus einer anderen Welt als die der Obdachlosen. Über einem schwarzen kragenlosen Pullover trägt sie ein rotes Regencape. Sie drückt mir eine Plastikschale mit stark duftender Gemüsesuppe in die Hand. Ihr Helfer, ein Student namens Benno, wie ich aus den kurzen Gesprächen schließe, die er mit den anderen Obdachlosen führt, gibt mir eine trockene Semmel dazu.
Die anderen Obdachlosen. Jetzt erst nehme ich sie richtig wahr, während sie gierig die Suppe in sich hineinlöffeln. Im Schutz der Dunkelheit sind sie scheu wie Stadtfüchse aus den umliegenden Hecken herbeigehuscht. Niemand soll sie länger als nötig im Licht der Öffentlichkeit sehen. Wirke ich etwa jetzt auch schon so wie ein Großstadtfuchs?
»Sorry, wir haben nicht mehr so viel Suppe. Leider ist kein zweiter Teller mehr drin. Am Anger und am Isartor, da gibt’s immer mehr. Dort fängt unsere Tour ja an.«
Amelie drückt mir noch einen Apfel in die Hand, dann setzt sie sich ans Steuer und fährt mit Benno davon. Ich sehe dem Bus hinterher, bis er hinter den Propyläen verschwindet. In diesem Augenblick fällt mir ein, an wen mich Amelie erinnert. Ihre sanfte Art, das wallende Haar, der achtsame Blick führen mich gedanklich in meine Kindheit zurück. Entfernte Verwandte aus der DDR hatten mir ein Buch geschenkt, als ich vielleicht acht Jahre alt war. Der Zauberer der Smaragdenstadt hieß es, geschrieben von Alexander Wolkow. Die kleine Elli und ihr Hund gelangen auf wundersame Weise in eine Zauberwelt, vermissen dort aber ihr Zuhause. Die Fee Stella, Herrscherin über das Rosa Land, ordnet die Dinge schließlich so, dass es Elli und ihrem Hund gelingt, in ihre alte Heimat und zur Familie zurückzukehren.
Auch ich möchte in meine alte Familie oder in eine ähnliche Konstellation zurück. Das kleine Glück des bürgerlichen Lebens. Ein wieder irgendwie geregeltes Leben mit einem Dach über dem Kopf. Ich muss die Dinge so ordnen, wie es Stella damals für Elli und ihren Hund getan hat. So weit ist mir das klar. Aber das ist leichter gesagt als getan. Mir fehlt jeglicher Schwung, die Dinge anzupacken.
Ich werfe mich auf die Bank hinter der Glyptothek. Nicht mal ein letzter Schluck bulgarischer Rotwein ist in der Flasche.
KAPITEL 3
Am nächsten Morgen herrscht großes Gedränge in Sankt Bonifaz. Eine freundliche Mitarbeiterin mit Kopftuch und Schürze bietet Brezen, abgepackte Wurst am Verfallsdatum und eine Kiste mit gerade noch genießbaren Bananen an. Viele Obdachlose stehen um neue Kleider an, nachdem die alten durch die verregneten Ostertage durchweicht und schimmelig sind. Ein herber Geruch durchwabert den scheinbar erst vor Kurzem geweißelten Raum. Das Bedürfnis nach Körperhygiene ist groß. Ich fühle mich in diesem Umfeld unwohl und hoffe, mit der Zeit werde sich das legen. Der Mensch gewöhnt sich an alles, daran glaube ich. Auch gibt es mit dem Müllerschen Volksbad eine Alternative, wenngleich dort das Baden oder Duschen ohne Besuch des Schwimmbads nur an zwei Tagen in der Woche möglich ist und zwei Euro zwanzig kostet.
Während ich darauf warte, dass eine der beiden Duschen frei wird, sehe ich mich verstohlen um, wo ich das Handy aufladen kann. Mir fehlt der Mut, den freundlich und dennoch streng wirkenden Priester, der die Abläufe in Kleiderkammer und Duschraum überwacht, danach zu fragen. Unter der Bank entdecke ich endlich eine Steckdose und schließe mein Handy mit dem Ladekabel an. Um es zu tarnen, lege ich meinen alten Pullover drüber, den ich nach dem Duschen durch einen neuen aus meinem Koffer ersetzen werde. Wenig später verlässt ein spilleriger Mann um die siebzig mit schütterem, frisch gekämmtem Haar den Duschraum, und ich betrete ihn mit Koffer und Rucksack.
In den Ecken des Duschbeckens sehe ich Haarknäuel und einigen undefinierbaren Schmodder. Angewidert nehme ich die Handbrause und spritze all das Eklige in Richtung Abfluss. Mir ist in diesem Augenblick klar, was für ein Privileg ich bis vor drei Tagen hatte, morgens einfach so zu duschen. Ohne zu warten und ohne sich vor Fremddreck zu ekeln. Privilegien erkennen wir oft erst als solche, wenn wir sie nicht mehr genießen. Die Dusche heute tut mir trotzdem gut. Auch steht Shampoo bereit, das ich ausgiebig nutze. Beim Rasieren sehe ich mich im leicht dampfbeschlagenen Spiegel und halte meinem eigenen Blick nicht stand. Man kann sich auch vor sich selbst schämen. Ich bin jetzt ein Stadtfuchs, eine gescheiterte Existenz, ein Vater ohne Kinder.
Die Kinder. Ihnen werde ich jetzt nach dem Duschen gleich schreiben. Von draußen klopft es laut und ungeduldig an die Tür. Ich raffe meine Sachen zusammen und verlasse das Bad, um sie im Vorraum in aller Ruhe in den Koffer und in den Rucksack einzusortieren.
Unter der Bank will ich mein jetzt halbwegs geladenes Handy hochholen. Es ist weg. Hektisch blicke ich mich um, prüfe, ob ich die Bank vielleicht verwechselt habe. Aber ein Irrtum ist ausgeschlossen. Ich spüre, wie in mir etwas hochkocht, das ich nicht zu kontrollieren vermag. Ich packe den ersten Obdachlosen am Kragen und schreie ihn an.
»Wo hast du mein Handy?« Wehrlos lässt sich der frisch gekämmte Siebzigjährige mit der Hühnerbrust durchschütteln. Aber mir ist gleich darauf klar, dass für das Verschwinden des Handys viele andere infrage kommen. Im Vorraum und in der Kleiderkammer tummeln sich vielleicht dreißig Personen. Die Eingangstür öffnet und schließt sich im Sekundentakt. Wie konnte ich nur so blöd sein, mein Handy zwar versteckt, aber dennoch unbeaufsichtigt unter diese Bank zu legen!
»Wo ist mein Handy, verdammt!«, brülle ich jetzt in den Vorraum und spüre die Adern an meinem Hals schwellen. Pater Valentin, der, so vermute ich, in diesem sozialen Umfeld geübt im Umgang mit schwierigen Besuchern ist, eilt in seiner schwarzen Kutte herbei und packt mich fest am Arm.
»Geschrien wird hier nicht, verstanden?«, herrscht er mich an und bittet mich, jetzt in ruhigerem Ton, zu erzählen, was vorgefallen ist.
Der Verlust oder besser der Diebstahl des Handys ist schlimm, da er für mich einen weiteren Ausstieg aus dem bisherigen Leben bedeutet. Die Chancen, wieder in eine geregelte Existenz mit Wohnung und Arbeitsplatz zurückzukehren, verringern sich dadurch weiter. Um mit dem Arbeitsamt oder sozialen Einrichtungen wegen einer Wiedereingliederung zu sprechen, muss ich ab sofort eine Telefonzelle aufsuchen, sofern es die überhaupt noch gibt. Ein neues Handy ist erst drin, wenn ich mir eine kleine Rücklage erspart habe. Noch mehr aber schmerzt mich etwas anderes.
»Ich muss dringend meinen Kindern schreiben! Und jetzt hat irgend so ein Arschloch mein Handy geklaut«, höre ich mich fluchen und bin nicht weit weg davon, hysterisch zu heulen.
»Hier!« Pater Valentin hält mir ein Handy hin. »Schreiben’s halt mit dem.«
Ich nehme das Handy und öffne den Ziffernblock. Doch dann fallen mir die Nummern der Kinder, um sie über den Familienchat oder mit einer SMS anzuschreiben, nicht mehr ein. Sie sind ja in meinem Handy eingespeichert, und ich habe immer nur ihren Namen eingegeben. Ich merke, wie meine Knie weich werden und ich zusammensacke.
Als ich aufwache, liege ich auf einer Pritsche und weiß überhaupt nicht, wo ich mich befinde. Ich richte mich auf, sehe meine Schuhe unter dem Bett stehen, an der Wand gegenüber entdecke ich meinen Koffer. Der Rucksack hängt an einem Haken an der Innentür des kleinen Raums. Auf einer Kommode liegt eine Bibel. Ich richte mich auf. Während ich die Schuhe anziehe, betritt Pater Valentin den Raum. Durch die Tür sehe ich den Duschraum und die Kleiderausgabe.
»Geht es Ihnen besser?«
Die Frage verwirrt mich, bis mir einfällt, was sich in den Räumen nebenan zugetragen hat. Der Diebstahl meines Handys. Mir wird leicht schwindlig, ich taste nach der Liege, um mich abzustützen.
»Geht schon«, brumme ich.
»Soll ich mich um ein Bett für Sie heute Nacht kümmern?« Der Priester sieht mich mit großen dunklen Augen an, die mich an einen Mops erinnern.
»Nein, danke, ich komm schon klar.«
Wenig später streife ich wieder durch die Stadt. Ziellos. Ein Stadtfuchs bin ich jetzt also. Oder eher ein Stadtstreicher? Ich erinnere mich, wie meine Eltern früher, als ich ein Kind war, verächtlich von Landstreichern gesprochen haben. Ein Stadtstreicher ist wohl kaum etwas Besseres. Was nur denken Lisa und Leon von mir? Keine Antwort auf ihre Osternachricht! Aber ich kann unmöglich zu Sabine fahren und an ihrer Wohnung klingeln. Wenn Karl das erfährt, wird er mich wegen Hausfriedensbruchs anzeigen. Und Nötigung. Und Bedrohung. Und was weiß ich noch alles.
Am Nachmittag finde ich ein Quartier für die Nacht. Eine Bank an einem Trafohäuschen, an einer Straße hoch über der Isar gelegen, direkt gegenüber dem Maximilianeum. Noch einmal mache ich mich auf in die Innenstadt. Gegen einundzwanzig Uhr sehe ich am Isartor den Sternenexpress vorfahren. Amelie ist nicht dabei. Heute gibt es Brote und Tee, ausgeteilt von zwei grauhaarigen Männern. Viele Obdachlose drängeln sich um den Bus und fragen nach Socken, Unterhosen und Schlafmatten. Ich schnappe schnell nach zwei belegten Broten und eile zum Trafohäuschen zurück. Von den drei Bänken sind zwei jetzt von anderen Obdachlosen besetzt. Einer ohne Zähne knurrt mich böse an, ich solle abhauen. Dann aber rollt er sich in seine Decken und schnarcht nach zwei Minuten tief. Offenbar ist das Trafohäuschen ein begehrter Platz. Ich bin dabei, mich zum Experten zu entwickeln. Ein Experte für Stadtstreichen.
Beim Einschlafen denke ich an meine verstorbenen Eltern. Gut, dass sie nicht mehr miterleben, in was für einen tiefen Abgrund ich gesunken bin.
KAPITEL 4
Amelie fährt die Tour mit dem Sternenexpress offenbar einmal die Woche. Das Trafohäuschen gehört zu dem Obdachlosenrevier am Isartor. Das habe ich nach einer Woche im Freien schon gelernt: Obdachlose haben Reviere, wie streunende Katzen. Jeden Abend harre ich in einem Hofeingang mit Blick zum Isartor aus und begebe mich erst in letzter Minute unter die Bedürftigen. Zur Tarnung habe ich mir außerdem in einer Kleiderkammer der Caritas ein rotes, mit einer goldenen Taube besticktes Basecap zugelegt, dessen Schild ich tief nach unten ziehen kann. Viel zu groß ist meine Angst, Bekannte aus meinem alten Leben oder gar meine Kinder könnten zufällig vorbeikommen, während ich bei der Essensausgabe anstehe.
Als ich Amelie an diesem Sonntag zum zweiten Mal in meinem Leben mit dem Bus ankommen sehe, schlägt mein Herz schneller. Mich überkommt das Gefühl, einer Bekannten zu begegnen, die ich schon länger kenne als nur eine Woche. Ob sie mich wiedererkennt, da bin ich unsicher. Sie ist freundlich und bestimmend wie beim ersten Mal. Und: Sie ist eine Menschenöffnerin. Weil sie Fragen stellt, sich für andere interessiert. Selbst die, die ganz verschlossen wirken, nuscheln ein paar Worte, wenn sie sie anspricht. Über manch verlebtes Gesicht huscht der Anflug eines Lächelns.
Unter denen, die sich am Isartor versammeln, ist auch eine Reihe von Männern und Frauen aus Südosteuropa und vom Balkan, darunter Sinti und Roma, die nur leise miteinander reden. Wenn sie überhaupt mal miteinander reden.
Einer von ihnen, Vasile, ein Rumäne, spricht exzellent Deutsch. Ihn scheint Amelie gut zu kennen; der Ton zwischen beiden ist vertraut, sie schäkern fast, obwohl sie aus unterschiedlichen, sogar konträren Welten kommen. Amelie, so erfahre ich von einem deutschen Bedürftigen mit Trinkernase und vom Rauchen gelben Fingern, arbeitet in ihrem anderen Leben als Managerin in einem exklusiven Hotel am Alten Botanischen Garten in der Nähe des Münchner Hauptbahnhofs. Die Fahrten für die Obdachlosen macht sie ehrenamtlich, wie alle anderen Fahrer auch. Den Verein, der das organisiert, gibt es seit dreißig Jahren. Jeden Abend findet die Tour statt, dreihundertfünfundsechzig Mal im Jahr.
Vasile, der so Mitte vierzig sein dürfte, ist in seinem früheren Leben Dozent für deutsche Philosophie in Sibiu gewesen. Doch aus Sibiu und dem umliegenden Siebenbürgen zogen Zehntausende weg. Eines Tages fand Vasile die Pforte seiner Hochschule geschlossen vor. Die staatlichen Gelder waren ausgeblieben, und ein Fach Philosophie brauchte niemand, solange die Wohnungen in Sibiu kalt und die Teller fast leer blieben. Über Umwege, schlechte Ratgeber und aus der Verzweiflung heraus ist er nach München gekommen, wo ihn jetzt frühmorgens am Hauptbahnhof windige Schlepper an Baufirmen vermitteln, zu Tagessätzen, gegenüber denen der Mindestlohn ein ferner und unerreichbarer Kontinent ist.