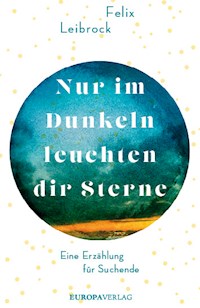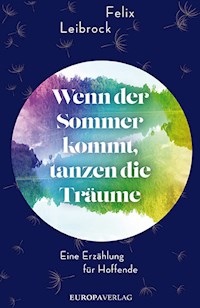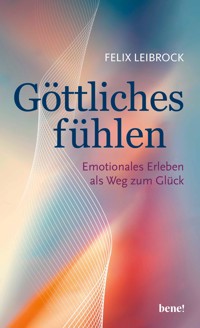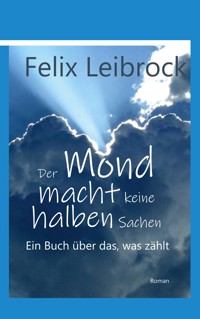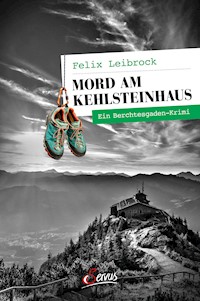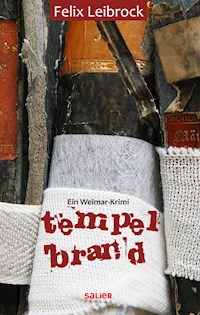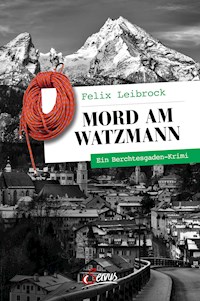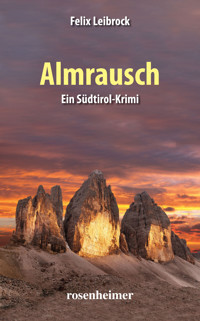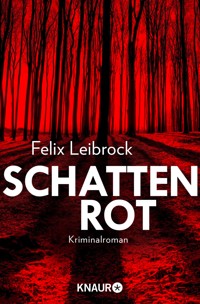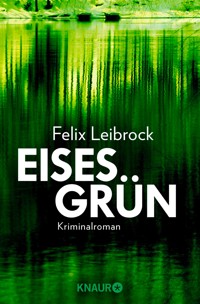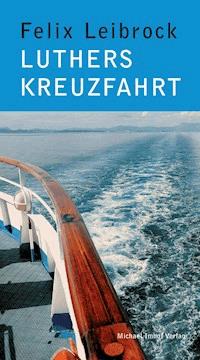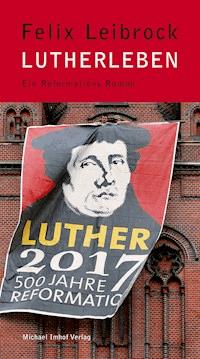Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Krimi
- Serie: Servus Krimi
- Sprache: Deutsch
Simon Perlingers dritter Fall: Blutiger Ritualmord am Königssee So hatten sich die Gäste aus dem Berchtesgadener Land ihren Ausflug aufs Wasser wohl nicht vorgestellt: Statt das herrliche Bergpanorama vom Königssee aus zu genießen, setzen sechs tote Priester in Ruderbooten liegend der Überfahrt ein jähes Ende. Im Instrumentenkoffer des Schiffsbegleiters findet sich zudem eine abgetrennte Hand mit einem wertvollen Ring – der jedoch kurz darauf verschwindet. Mysteriöse Fälle wie dieser sind für Simon Perlinger, Polizeibergführer und Leiter der Kripo Berchtesgaden, nichts Neues mehr. Wird es ihm auch diesmal gelingen, die richtige Fährte zu finden? - Band 3 der erfolgreichen Krimireihe rund um den jungen Bergfex mit einem Gespür für Verbrechensaufklärung - Hexenprozesse, alte Schuld und Fährunglücke: Geschichtsträchtiger Schauplatz Königssee - Bayerischer Regionalkrimi: Perfekte Urlaubslektüre für Bergfreunde - Sechs tote Priester: Was hatten die Brüder des Bartholomäus-Ordens damit zu tun? - Ein weiterer spannender Bayern-Krimi von Erfolgsautor Felix Leibrock Mord-Ermittlungen im Kloster: Wer hat die gekreuzigten Priester auf dem Gewissen? Sechs Tote, ein verschwundener Ring und ein vermisster Ordensbruder – Simon Perlinger hat alle Hände voll zu tun, um Licht in das Wirrwarr der Spuren zu bringen. Zum Glück hat er nicht nur kompetente Kollegen, sondern schickt zur Not auch seinen Großvater Undercover in die Klosterbibliothek. Wie kam es, dass die Priester von der Hochgebirgswallfahrt gekreuzigt in Ruderbooten auf dem See endeten? Was haben der gestohlene Ring, die Hexenprozesse des 17. Jahrhunderts und die Skandale der modernen Kirche damit zu tun? Simon Perlinger arbeitet sich Stück für Stück zur Lösung des Falls vor – und stößt dabei auf Abgründe, die man in der vermeintlich heilen Bergwelt Berchtesgadens nie vermutet hätte.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MORD AUF DEM KÖNIGSSEE
Felix Leibrock
MORD AUF DEM KÖNIGSSEE
Ein Berchtesgaden-Krimi
Diese Geschichte ist frei erfunden. Tatsächlich existierende Personen und Firmen wurden verändert und/oder vom Autor ausgedacht, Geschehnisse anderen und/oder fiktiven Personen zugeordnet. Verbleibende Übereinstimmungen mit etwaigen realen Personen wären somit rein zufällig und sind nicht gewollt.
Sämtliche Angaben in diesem Werk erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung der Autoren bzw. Herausgeber und des Verlages ist ausgeschlossen.
1. Auflage 2024
Copyright dieser Ausgabe © 2024 Servus Verlag bei Benevento Publishing Salzburg – Wien, einer Marke der Red Bull Media House GmbH, Wals bei Salzburg
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags, der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen sowie der Übersetzung, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Medieninhaber, Verleger und Herausgeber:
Red Bull Media House GmbH
Oberst-Lepperdinger-Straße 11–15
5071 Wals bei Salzburg, Österreich
Satz: MEDIA DESIGN: RIZNER.AT
Gesetzt aus der Palatino, Bauer Bodoni, Courier
Umschlaggestaltung: www.b3k-design.de, Andrea Schneider, diceindustries
Umschlagmotive: © Heinz Wohner / Lookphotos / picturedesk.com; © papa studio/ shutterstock.com
Autorenillustration: © Claudia Meitert/ carolineseidler.com
Lektorat: Martina Paischer
Printed by CPI books GmbH, Germany
ISBN: 978-3-7104-0358-3
eISBN: 978-3-7104-5080-8
Die Zauberinnen sollst du nicht leben lassen.
2. Mose 22,17
Wer im Königssee untergeht, taucht nicht mehr auf.
Ein Wasserwachtler
PERSONEN
Simon Perlinger, junger Polizeibergführer und Leiter der Kripo Berchtesgaden
Ludwig Perlinger, Großvater von Simon, Schnitzer, Hobbyhistoriker und Entenzüchter
Maria Perlinger, Gattin von Ludwig, Hühnerzüchterin und Rosenkranzbeterin
Kunigunde Pöppel, beste Freundin von Maria Perlinger, Hühnerexpertin
Andrea Heusmann, Schriftstellerin, evangelisch, zehn Jahre ältere Freundin von Simon
Clara, Schulfreundin von Simon
Luisa Sedlbauer, Polizeibergführerin, Kripo Berchtesgaden
Michael (Michi) Pregler, Polizeibergführer, Kripo Berchtesgaden, zurzeit in Therapie
Belinda Koreck, Polizeihauptkommissarin bei der Kripo Traunstein
Ferdinand (Ferdi), Streifenpolizist, zeitweise bei der Kripo Berchtesgaden eingesetzt
Rigobert Stoll, katholischer Pfarrer von Berchtesgaden
Christoph Stehr, evangelischer Pfarrer von Berchtesgaden
Dominik Pasold, Kapitän der Schifffahrtsgesellschaft Königssee
Lydia, Freundin von Dominik Pasold
Max Schmidbauer, Schiffsbegleiter, Flügelhornspieler
Toni Kranz, Leiter der Bayerischen Schifffahrtsgesellschaft Königssee
Veronika Mergenthaler, von allen Vroni genannt
Matthias Mergenthaler, Ingenieur, Sohn von Vroni Mergenthaler
Herbert und Roswitha Heuninger, Hofbesitzer
Arthur Greiner-Schuh, Heimathistoriker und ehrenamtlicher Vorsitzender des Berchtesgadener Heimatkundevereins
Hubert Steiner, Wirt des ehemaligen königlichen Jagdschlosses und jetzigen Gasthauses Sankt Bartholomä auf der Halbinsel Hirschau
Weitere Wirte: Klosterwirt Höglwörth, Hüttenwirtin Riemannhaus, Hüttenwirt Kärlingerhaus
Marie Peschinger und Marija Ribar, Hüttenbedienungen
Tomislav Ribar, Drogenhändler
Jerko Ribar, Sohn von Tomislav und Marija
Markus Zimmerscheid, Inhaber des Sportgeschäfts Finkenzeller in Berchtesgaden und Kletterer
Benjamin Poisel und Robert Kurz, Klempner
Jakub Kowalczyk, einhändiger polnischer Priester, und Ambrosius, sein Münchner Mitbruder
Klaus-Peter Kalinski, Dortmunder Antiquitätenhändler
Kloster Höglwörth (1678–2021)
Maximilian Gandolf Graf von Kuenburg, Fürsterzbischof von Salzburg von 1668 bis 1687
Johann und weitere, Bedienstete des Fürsterzbischofs
Dr. Sebastian Zillner, Mitglied des Hofrats und Hexenkommissar
Barbara Koller, auch Schinderbärbel, Mutter von Jakob Koller, Abdeckerin, 1675 als angebliche Hexe verbrannt
Jakob Koller, auch Jackl, Zauberer Jackl, Schinderjackl, geb. um 1655, Bettler, Kleindieb, angeblicher Hexer und Anführer einer Kinderbande
Agnes Fresner, Bettlerin, verhaftet 1678 in Salzburg unter dem Vorwurf der Hexerei und am 12. März 1678 hingerichtet
Adam Weber, Klosterpropst von Höglwörth von 1676 bis 1686
Patritius Pichler, Klosterpropst von Höglwörth von 1686 bis 1691
Wolfgang, Caspar, Eberhard und weitere, Mönche der Bartholomäusbruderschaft 1678–1690
Ortwin, Klosterpropst von Höglwörth seit 1976
Guido Staller, Archivar und Bartholomäusbruder im Kloster Höglwörth seit 1958
Gregor Heuninger, Wolfram und weitere, Bartholomäusbrüder in Höglwörth
Inhalt
PERSONEN
Kapitel 1 • Hexenjagd
Kapitel 2 • Eine Hand
Kapitel 3 • Ein Fürsterzbischof hat’s nicht leicht
Kapitel 4 • Der Leichensee
Kapitel 5 • Hoher Besuch
Kapitel 6 • Mordkommission Priester
Kapitel 7 • Der Ring
Kapitel 8 • Die erste Schneise
Kapitel 9 • Kirche und Kloake
Kapitel 10 • Kripo im Kloster
Kapitel 11 • Die Gruft
Kapitel 12 • Der Insider
Kapitel 13 • Das Unglück
Kapitel 14 • Auf Wallfahrers Spuren
Kapitel 15 • Das Vermächtnis
Kapitel 16 • Immer noch auf Wallfahrers Spuren
Kapitel 17 • Der erste Fund
Kapitel 18 • Falsches Leben
Kapitel 19 • Die Besucherin
Kapitel 20 • Ludwig erzählt
Kapitel 21 • Der zweite Fund
Kapitel 22 • Die Nacht im Ostwand-Lager
Kapitel 23 • Schlimmes Erlebnis
Kapitel 24 • Die Klempner
Kapitel 25 • Der polnische Priester
Kapitel 26 • Zwischenbilanz
Kapitel 27 • Das Tagebuch
Kapitel 28 • Hausgeburt
Kapitel 29 • Matthias Mergenthaler
Kapitel 30 • Belauschte Gespräche
Kapitel 31 • Der Faden
Kapitel 32 • Hausdurchsuchung
Kapitel 33 • Besoffene Mönche
Kapitel 34 • Der Ringtäter
Kapitel 35 • Falscher Vater
Kapitel 36 • Die Gegenüberstellung
Kapitel 37 • Unklare Vaterschaft
Kapitel 38 • Der Ornithologe
Kapitel 39 • Geständnis?
Kapitel 40 • Der Durchbruch
Kapitel 41 • Noch mehr Morde?
Kapitel 42 • Die Nacht der Rache
Kapitel 43 • Versuchungen
Kapitel 44 • Entscheidungen
Epilog
LITERATUR UND DANK
Kapitel 1 • Hexenjagd
Salzburg, Rathaus, 1678
»Hat Sie mit dem Schinderjackl den Beischlaf gehalten?«
Sebastian Zillner, Doktor der Rechte und Hexenkommissar, starrte an der Angeklagten vorbei auf die raue, feuchtfleckige Wand der Zelle. So viele Verhöre hatte er die letzten Monate geführt! Früher oder später hatte er die Malefikanten alle gekriegt! Irgendwann haben sie alle gestanden! Kriminelles zum Beispiel: Ja, ich habe die Schafherden verzaubert, deswegen sind die Tiere alle gestorben! Lüsternes: Natürlich habe ich es mit dem Teufel getrieben und auch ansonsten mit vielen Männern kopuliert! Sensationelles: Ich gebe zu, den Bauch der Schwangeren beschworen und besprochen zu haben, sodass das Kind mit zwei Köpfen zur Welt gekommen ist!
Agnes Fresner mied den Augenkontakt mit Zillner. Ihr dünnes, fast schon weißes Haar erinnerte an ausgeblichenes Stroh. Die Kopfhaut mit ihren Narben und Krusten schimmerte überall durch und gab dem Haar zusätzlich einen Stich ins Aschfahle. Die Pupillen ihrer blutunterlaufenen Augen sprangen hin und her wie ein Hase, der vor den Jägern im Zickzack flieht. Sie verströmte einen penetranten Geruch, der vom Urin herrührte. Mit ihm hatte sie den ganzen Körper eingerieben, um den juckenden Grind zu bekämpfen. Der eigene Urin war das einzige Mittel gegen die eitrigen Blasen und das Jucken. Das einzige Mittel jedenfalls, das einer Bettlerin wie ihr zur Verfügung stand. Zwanzig Jahre alt war sie, schaute aber aus wie eine Greisin. Sie trug den groben Leinenkittel der Gefangenen. An den Kehlkopf hatte man ihr ein geweihtes Amulett mit dem Bild der Allerheiligsten Jungfrau Maria mit einer Schnur eng festgezurrt. Sie würgte deswegen ständig, keuchte, röchelte. Das kalte Gemäuer, in dem sie sich befanden, gab diesen Lauten einen apokalyptischen Hall.
»N-e-e-i-n. Ha-a-a-b ich ni-i-i-cht«, hechelte sie. Zillner wandte ganz langsam seinen Blick den Gerichtsdienern zu.
»Dreißig Mal die Rute, wohlempfindlich. Außerdem rasieren und in Weihwasser baden. Ist ja nicht auszuhalten, dieser Höllengestank«, beschied Zillner den Dienern. Zwei von ihnen packten Agnes grob am Arm und zerrten sie über den grauen Gang in den Vorraum der Folterkammer. Einer der Diener flüsterte dem Freimann zu, was Zillner befohlen hatte. Der riss der Fresnerin mit einem kräftigen Ruck den Kittel vom Leib. Barbusig, nur mit einem leinenen Tuch um die Hüften stand sie vor ihm. Auch der Körper war mit ausgeprägten Narben und offenen Wunden übersät. Ungeniert glotzte der stiernackige Henker die schweren Brüste der Angeklagten an. Lange. Endlos lange. Immer wieder schnalzte er mit der Zunge, stieß mit einem Holzstab mal die eine, mal die andere Brust an und kicherte vor Geilheit. Dann tauchte er ein Rutenbündel in das vor einer Stunde von einem Priester geweihte Wasser. Die Rute weichte ein, wurde geschmeidiger, die Schläge mit ihr schmerzvoller. Auch befolgte er damit eine Anordnung des Fürsterzbischofs Max Gandolf. Für ihn geschah das Foltern und Züchtigen in einem höheren Auftrag. Folglich wollte er solches Handeln mit einer religiösen Weihe vollzogen wissen. Eine mit Weihwasser besprengte Missetäterin hatte deshalb größere Aussichten, von ihren Dämonen mittels erprobter Foltermethoden geheilt zu werden. Starb sie dabei, stand auch das im Einklang mit dem biblischen Gebot: »Die Zauberinnen sollst du nicht am Leben lassen!« Letztlich lag alles, was sie an missratenen Frauen wie Agnes Fresner taten, in Gottes Hand. Davon war der geistliche Herrscher von Salzburg fest überzeugt.
Überhaupt gab sich der Herrscher gnädig, christlich, erbarmungsvoll. Wenn Zauberer Reue zeigten. Wenn Hexen sich einsichtig gaben. Wenn Kinder vor Angst schrien. Nein, das ließ ihn nicht unberührt. Allen diesen Sündern wollte er die Qualen ersparen. Sie sollten nicht langsam auf dem Scheiterhaufen bei lebendigem Leibe verbrennen. Also ließ er sie auf dem Scheiterhaufen erdrosseln, bevor der Freimann und seine Knechte ihre Leiber den Flammen übergaben. Der Freimann stellte dazu eine Säule auf, band das Opfer daran und legte ihm einen Strick um den Hals. Mit einem Knebel drehte er den Strick Stück für Stück so lange zu, bis das anfängliche Röcheln versiegte. Allerdings zweifelte Max Gandolf gelegentlich an dieser Praxis, als ihn Zillner einmal darauf ansprach. Der Doktor der Rechte meinte, es sei wohl weniger schmerzhaft, auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen, als vorher erdrosselt zu werden. Denn auf dem Scheiterhaufen ließ der aufsteigende Rauch die Zauberer und Hexen in Ohnmacht fallen, bevor die Flammen ihre Körper angriffen und hinwegfraßen. Der Fürsterzbischof hielt dem die Schreie entgegen, die die Verurteilten auf dem Scheiterhaufen ausstießen. Das ginge ja kaum, wenn man ohne Bewusstsein sei.
Aber sei’s drum, für Max Gandolf war das Erdrosseln ein weithin sichtbares Zeichen für die christliche Gnade. Auch starb keiner dieser Missetäter, ohne dass ihn ein Geistlicher vorher mit Weihwasser besprengte und auf dem Scheiterhaufen segnete.
Die Arme von Agnes Fresner band der Freimann ihr jetzt auf dem Rücken zusammen. Das Amulett mit dem Bild der Heiligen Jungfrau schob er ihr in den Mund, um ihre Schreie etwas abzudämpfen. Erst gab es die Peitschenhiebe, hart, wuchtig, schnell nacheinander. Mit den aufgebrochenen Wunden schubste er die Fresnerin in eine Wanne mit eiskaltem Wasser. Sie wand sich wie eine Forelle auf dem Trockenen hin und her vor Schmerzen. Nachdem der Folterer sie an den Haaren aus der Wanne gezogen hatte, stellte er sie an die Wand. Er rasierte ihr eine Glatze. Noch mehr Wunden und Narben platzten dabei auf. Das Blut floss in Strömen über ihr Gesicht, die Brüste, die Beine. Zum Rasieren der Scham und der Achselhaare rief er seine Frau herbei. Man wollte ja anständig bleiben. Die Fresnerin blieb auf einer Pritsche liegen, bis das Blut nicht mehr aus den offenen Wunden lief. Dann brachte sie der Gerichtsdiener in die Verhörzelle zu Zillner zurück.
»Hat Sie mit dem Schinderjackl den Beischlaf gehalten? Mit diesem vermaledeiten Zauberer?«, hob dieser mit schneidender Stimme an.
Sie schüttelte wie benommen und mit unkoordinierten Bewegungen den Kopf. Die Schläge auf den Rücken hatten ihr das Blut aus dem Kopf gesaugt.
»Zugestimmt«, murmelte der Protokollführer. Zillner fuhr mit dem Verhör fort.
»Ob sie der Teufel markiert hat, brauche ich bei ihr ja nicht zu fragen«, lachte er zum zweiten Kommissar hin. Der nickte unterwürfig, obwohl er vom Rechtsstatus her Zillner ebenbürtig war. Zillner erhob sich, betrachtete die vom frischen Blut schimmernden Narben auf der Kopfhaut der Fresnerin.
»Na, da hat er sich aber sehr wohlgefühlt, der Satan«, sagte er spitz und stach mit einem Stift in eine der Narben. Blut lief Agnes über die Stirn in die Augen. Sie stöhnte auf.
»Hat der Teufel Ihren Namen mit Blut auf einen Zettel geschrieben?«
Wieder nickte die Fresnerin apathisch. Zillner diktierte das, was er diktieren wollte, dem Protokollanten.
»Und welche der Wunden hat Ihr der Koller Jackl zugefügt? Weil Sie Mitglied in seiner Diebes- und Teufelsbande wurde, hä?«
»Keine«, jaulte Agnes auf. Die Bilder rutschten vor ihrem inneren Auge ineinander. Der Jackl, den sie ein einziges Mal nur kurz, noch dazu aus der Ferne gesehen hatte. Der leibliche Vater, der sie über Jahre hinweg missbraucht hatte. Ihr mit einer Holzkeule den Kopf und den ganzen Körper geschlagen, an ihr sogar seine fleischliche Lust ausgelebt hatte. Von ihm alleine stammten alle Wunden, die nicht der jahrelange Grind verursacht hatte. Er war ihr der leibhaftige Teufel. Aber solche Antworten zählten hier nicht. Vorhin, im Vorraum, hatte sie gesehen, wie eine andere Gefangene die eigentliche Folterkammer verließ. Ein gebrochener Mensch, in der doppelten Bedeutung des Wortes. Der Blick leer und blödsinnig, der Rücken gebeugt, schwere Wundmale an Armen und Beinen, die Daumen zerquetscht, der Kittel blutverklebt.
»Keine?«, brüllte Zillner jetzt.
»Doch, doch, wohl, wohl«, pflichtete Agnes schnell bei und zeigte ihm irgendwelche Narben, die demnach vom Jackl stammen sollten. Der Zauberer Jackl galt den Behörden im Fürsterzbistum Salzburg als die Inkarnation des Teufels. Der Anführer einer jugendlichen Bettlerbande verhexte das ganze Land und verführte die Jugend zum Betteln und Stehlen, davon waren sie überzeugt. Alle, die ihn auch nur kannten, waren dadurch selbst vom Teufel befallen worden. Sie waren ihrer gerechten Strafe zuzuführen, um die Menschheit vor ihnen und ihren Dämonen zu schützen.
»Hat Sie heilige Hostien geschändet?«, wollte Zillner wissen. Agnes wusste von Gerüchten, was man hier von ihr erwartete. Nicht nur das Geständnis, dass sie das getan hatte, sondern auch wie. Allein schon Zillners lüsterner Blick machte ihr das deutlich. Auch ließ er ihr die Schnur mit dem Amulett am Kehlkopf lockern. Sie sollte reden, ausführlich! Drastisch musste es sein, wenn sie nicht direkt in die Folterkammer wollte. Also fabulierte sie. Ja, sie habe die Hostie bei der Kommunion entgegengenommen, sie dann aber wieder ausgespuckt und sich heimlich in den Hintern gesteckt. Auf dem Friedhof habe sie mit einem Messer in die Hostie hineingestochen. Daraufhin sei Blut aus der Hostie geflossen, der Heiland habe sich ihr gezeigt. Aber sie habe wie wild darauf eingetreten, bis die Hostie nur noch ein krümeliger Haufen war. Den habe sie dann unter dem Kreuz am Eingangstor der Trauerkapelle begraben, nicht ohne noch Hundekot beizugeben und darauf zu urinieren.
Zillners Blick war jetzt geweitet. Der Stift des Schreibers flog über das Papier. Was für eine wunderbare Bestätigung gab die Delinquentin da für den Verdacht, sie sei mit dem Teufel höchstselbst im Bunde!
Im Laufe des Verhörs gestand Agnes, ohne dass es strafender Maßnahmen bedurfte, sie habe an der Hexenfahrt zum Untersberg teilgenommen; sie habe mit teuflischem Pulver die Bestände eines Weinkellers vergiftet; sie habe gesehen, wie der Jackl es mit einer Kuh und einem Schwein getrieben habe; nein, sie habe selbst keinen Geschlechtsverkehr mit irgendwelchem Vieh gehabt … An diesem Punkt hakte Zillner nach. Er wollte ihr das nicht glauben, ließ es aber schließlich dabei bewenden. Dass der Teufel ihr in der Gefängniszelle begegnet sei, von ihr verlangt habe, nichts zu beichten, bestätigte sie dem Hexenkommissar auch noch. Erst als er sie zu ihrer Verwandtschaft fragte, wer dies sei, wo die sich befinde, was sie so treibe, schnürte sich ihr die Kehle auch ohne Amulett zu.
»Ob Ihre Mutter, Ihr Vater auch teuflische Bündnisse eingegangen sind, soll Sie sagen«, herrschte sie Zillner an. Sie brachte kein Wort heraus. Ihr Vater, ihr Misshandler und Missbraucher, über ihn zu sprechen, das ging nicht. So landete sie also doch in der Folterkammer. Alles erfinderische Lügen vorher war für die Katz gewesen. Der Freimann und sein Folterknecht fesselten sie dort stehend an ein rostiges Eisengerüst. Dann hielten sie ihr brennende Fackeln unter die Achselhöhlen, trieben ihr Holzspäne unter die Fingernägel und zündeten diese Späne an. Sie schnürten mit mechanischen Rädern Seile tief in ihr Fleisch. Legten ihre Daumen in den Stock, den sie so weit wie möglich zuschraubten. Banden sie an eine Winde, um sie eine Stunde mit verrenkten Gliedern in der Luft baumeln zu lassen. Als das alles nichts half, die Fresnerin schon nur noch halb in dieser Welt lebte, fixierten sie sie auf einer Leiter. Die Walze drehten sie so weit, bis es ihren Körper fast auseinanderriss. Erst als die Schreie in ein Wimmern übergingen und ein paar unverständliche Laute zu hören waren, brachen sie ab. Die Delinquentin war jetzt doch bereit, über ihre Eltern auszusagen. Ihre Mutter sei tot, behauptete sie, obwohl sie sich da nicht sicher war. Sie hatte sie schon seit Kindestagen nicht mehr gesehen. Nur gerüchteweise hatte sie erfahren, ihre Mutter sei als Hure und Marketenderin unterwegs gewesen, bevor sie einer ihrer Freier abstach. Als sie vom Vater erzählte, fantasierte sie freiweg. Sollte man ihre Aussage überprüfen und als falsch entlarven – was sollte noch Schlimmeres als die Folter eben kommen. Sie erzählte nichts vom Wohnsitz des Vaters in Murau in der Steiermark. Nein, ihr Vater sei ein Söldner und mit irgendeiner Armee unterwegs. Mehr wisse sie nicht. Über ihren Vater und seine Misshandlungen offen zu reden, das konnte sie nicht. Niemals. Und schon gar nicht hier.
Noch eine letzte Frage hatte Agnes zu beantworten. Ob sie Opferstöcke geplündert habe. Wie es die Schinder Barbara und ihr Sohn, der Jackl, getan hätten. Mit Gänsekielen und Baumharz hätten die beiden, so die Aussage eines Fünfzehnjährigen, in den Pfarrkirchen von Kuchl, Sankt Koloman und Sankt Ulrich im goldeggschen Gebiet Münzen herausgefischt, ohne das Schloss aufzubrechen. Das lag schon ein paar Jahre zurück. Aber zwischenzeitig gab es ein paar neue Verdachtsfälle. In Salzburg selbst und dort sogar im Dom, sozusagen in Max Gandolfs bester Stube, soll es deutlich weniger Geld in den Opferstöcken gegeben haben. Das könnten nur Diebe gewesen sein. Die Fresnerin hatte mit dem Jackl den Beischlaf gehalten. War es da nicht naheliegend, dass sie mit ihm auch auf Diebeszug gegangen war?
Nur ein resigniertes Ja kam über ihre Lippen. Die Folter hatte Agnes endgültig gebrochen. Sie sah auf ihre zerquetschten Daumen, das verkrustete Blut, die Eiterblasen an den Händen. Sie wollte nur noch eins: sterben.
Zillner diktierte auch diese Aussage ins Protokoll. Alle Fragen waren damit abgehakt. Er war akkurat, wenn es um das Verurteilen von Hexen und Zauberern ging. Ein Jurist von Gottes Gnaden. Er wusste, der Fürsterzbischof würde das Protokoll abnicken. Justitia ging ihren Weg. Oder kam dem Erzbischof sein christliches Gewissen über den Weg? Schon oft hatte er die Urteile abgeschwächt. Zillner gefiel das nicht. Er redete Max Gandolf auch nicht in seine geistlichen Belange hinein. Andererseits war der Erzbischof im Salzburgischen auch der weltliche Herrscher. Sein Vorgesetzter. Und letztlich störten den Fürsterzbischof nicht die Prozesse als solches, beruhigte sich Zillner. Aber irgendwie bekam er ein ungutes Gefühl nicht los. Der Teufel war ein harter Knochen. Da brauchte es auch harte Methoden, um ihm den Garaus zu bereiten.
Kapitel 2 • Eine Hand
Königssee, Sonntag, 28. August
Riesengetümmel an der Seelände. Auf den Wetter-Apps lacht für jede Stunde an diesem Tag die Sonne. Viele tragen die Trophäen touristischer Eroberungen auf dem Leib: Cappys mit Watzmann-Silhouette, T-Shirts mit röhrenden Hirschen im Nationalpark Berchtesgaden, Sommerjacken mit aufgedruckten Wolpertingern. Keine Frage, die Souvenirstände in der lang gezogenen, leicht abfallenden Seestraße haben schon am frühen Morgen gute Umsätze gemacht. Das Patroziniumsfest von Sankt Bartholomä ist außerdem. Das verspricht Brauchtum, Folklore, religiöse Rituale auf der Halbinsel Hirschau. Dort steht die berühmte Wallfahrtskapelle Sankt Bartholomä mit ihren charakteristischen Zwiebeltürmen, dem roten Dach aus Lärchenschindeln und den Stuckaturen des Salzburger Barockkünstlers Josef Schmidt im Inneren. Der Grundriss der Kirche ähnelt dem des Salzburger Doms. Auch die Almer Wallfahrt, die gestern stattgefunden hat, verbindet das Salzburger mit dem Berchtesgadener Land: Sie beginnt in Maria Alm oberhalb des österreichischen Saalfelden am Hochkönig und endet auf der Halbinsel Hirschau an der Kirche Sankt Bartholomä. Sie ist eine der ältesten Hochgebirgswallfahrten der Welt. Mindestens genauso wichtig wie die kleine Kirche auf der Hirschau ist für die Touristen das ehemalige Jagdschloss. Heute findet sich darin eine anheimelnde Gaststätte mit Räucherforelle, Gamsragout und Münchner Hofbräu im Angebot. Mächtige alte Kastanienbäume spenden im Biergarten nebenan reichlich Schatten an schwülen Sommertagen. Die Touristen erwartet heute ein unvergesslicher Tag auf dem Königssee. Auch viele Einheimische in feierlichen Trachten stehen an der Seelände für die Schiffe an. Die festliche Messe zu Ehren des Heiligen Bartholomäus in und um die Kirche beginnt um zehn Uhr. Gewusel an den Schiffsstegen. Niemand stört sich daran. Alle genießen den Ausblick, der sich auf Millionen Postkarten wiederfindet: ein azurblauer Himmel, der smaragdgrüne, an manchen Stellen fast schwarze See, die steilen Waldhänge und Felsen, die das Tal in einen norwegischen Fjord verwandeln.
Die Schiffe liegen wie lauernde Krokodile in ihrer Startposition. Symmetrisch angeordnet warten sie darauf, ihre Menschenladung aufzunehmen und sie mit elektrischer Energie sicher, leise und umweltschonend über den ebenso tiefen wie kalten See zu befördern. Die Kapitäne überprüfen die Rettungsringe, den Motor, die Landebrücken. Anderes Personal der Bayerischen Seenschifffahrt, ebenfalls in schmucker Uniform, kontrolliert ein letztes Mal, ob in den Schiffen alles sauber ist. Dann ist es so weit: Ordnungskräfte entfernen die Seile, die die Gäste von den Schiffen bislang ferngehalten haben. Jetzt strömt es und quirlt es in die Schiffe, ein fröhliches und juchzendes Ausflugsvolk setzt sich in Bewegung und sticht bald darauf in See.
Das erste Schiff steuert Dominik Pasold, einer der jüngeren Kapitäne. Das Studium der Physik in München hat er wegen Heimweh abgebrochen. Pasold ist Mitglied bei den Weihnachtsschützen und im Sportverein, Aushelfer auf verschiedenen Almen, außerdem seit Schulzeiten in einer Beziehung mit Lydia. Das alles wegen des Studiums hinter sich zu lassen war für ihn schlimm. Zu schlimm. Als der Ausbildungsplatz bei der Bayerischen Seenschifffahrt ausgeschrieben war, bewarb er sich. Einfach so. Mal sehen, was rauskommt. Dann kam die Einladung zum Bewerbungsgespräch. Wenige Tage später traf die Zusage ein. Sein Faible für Motoren, für physikalische Zusammenhänge wirkte sich hier positiv aus. Im Winter, wenn nur wenige Schiffe fahren, würde er auf der Werft am See arbeiten. Schiffe warten und bauen. Das war der entscheidende Punkt, der Game Changer. Schon als Kind hatte er gerne Modellschiffe gebaut. Und jetzt richtige …
Als Pasold am Morgen sein Schiff aus der Holzhalle geholt hat, war das Schloss am Tor offen, aber nicht aufgebrochen. Hatte er am Abend vorher nicht abgeschlossen? Passierte ihm eigentlich nie. Komisch. Aber ist nicht weiter schlimm. Das Schiff liegt gesättigt mit Strom da, friedlich und ausgeschlafen.
Heute mit ihm auf dem Schiff ist Max Schmidbauer. Er zählt zu den altgedienten Mitarbeitern der Schifffahrtsgesellschaft. Schon mehr als dreißig Jahre fährt er fast jeden Tag auf dem See. Über die Bordanlage bietet er den Gästen Informationen zum Königssee, zur Schifffahrt, gewürzt mit vielen Anekdoten. Seinen großen Auftritt hat er stets rund eine Viertelstunde nach Ausfahrt aus dem Hafen. Dann nämlich, wenn das Schiff an die sogenannte Echowand kommt. Von dort sieht man eine hoch am Felsen befestigte Tafel. Sie erinnert an die vielen Wallfahrer, die 1688 bei einem Unglück auf dem Königssee ihr Leben verloren haben. An dieser Stelle packen Schmidbauer oder seine Kollegen ihr Flügelhorn aus und spielen einige fanfarenartige Sequenzen zur Wand hin, die mit einem Echo zurückkommen. Für alle Schiffsgäste ein Höhepunkt, ein absolutes Muss, das Echo auf dem Königssee!
Vor einiger Zeit gab es eine Versammlung für die Mitarbeitenden der Schifffahrtsgesellschaft. Gastredner war der Vorsitzende des Berchtesgadener Heimatkundevereins, Arthur Greiner-Schuh. Er hatte wirklich spannende Neuigkeiten. Das Boot mit den Wallfahrern ist 1688 nicht unterhalb der Falkensteiner Wand, auch Kreuzelwand genannt, gekentert. Das hatte man bis dahin geglaubt. Die Schiffsbegleiter haben es ihren Gästen auf dem See tagtäglich so erzählt. Der Gruselfaktor für die Schiffstouristen wurde dadurch erhöht. In Wahrheit aber liegt die Unglücksstelle unweit des Reitls, dort, wo der Königssee am schmalsten ist. Gegenüber von der Halbinsel Hirschau mit der Kirche Sankt Bartholomä. Hier und nur hier ist, so der Vortragende, der See im Uferbereich flach. Nur so war es 1688 möglich, alle einundsiebzig Ertrunkenen zu bergen und in Berchtesgaden auf dem damals neuen Friedhof neben der Franziskanerkirche zu bestatten. An der Falkensteiner Wand sei das Kreuz wie andere Marterl angebracht worden, um allgemein an dieser exponierten Stelle mit Blick über das ganze Gewässer an Tote auf dem Königssee zu erinnern. Nicht aber, um genau die Stelle zu markieren, wo sich das Unglück jeweils ereignet habe.
»Und du denkst, ich ändere jetzt meine Geschichte, die ich seit fast dreißig Jahren den Leuten erzähle?«, grantelte Schmidbauer mit dem in Berchtesgaden üblichen Du zum Vortragenden hin. »Ich leb vom Trinkgeld auf dem See. Und das bekomme ich fürs Echo mit dem Flügelhorn und für meine Geschichterln. Und wenn die nicht spannend sind, zahlt keiner was. Weißt, wenn ich sag, hier an dieser Stelle unterhalb der Falkensteiner Wand sind einundsiebzig Leute ertrunken, dann gruselt’s die Leute so richtig. Mein Kapitän lässt dann auch das Schiff langsam anruckeln. Dann werden manche ganz bleich.«
»Aber der Wahrheit entspricht das nicht«, hielt Greiner-Schuh dagegen und sah dabei zum Leiter der Bayerischen Seenschifffahrt, Toni Kranz. Der aber zuckte nur mit den Schultern. Die Schiffsbegleiter waren nicht verpflichtet, den Gästen etwas zu erzählen. Aber ohne ihre Anekdoten und das Echospiel würde die Schifffahrt auf dem Königssee viel an Reiz verlieren. Außerdem behauptete ein früherer katholischer Pfarrer von Berchtesgaden sehr wohl, das Boot sei an der Kreuzelwand verunglückt. Die Pilger hätten in Sankt Bartholomä nur Zwischenstation gemacht. Sie wären auf dem Weg zum Marienwallfahrtsort Dürrnberg gewesen. Auch wenn er dafür keinerlei Belege hatte, war sein Ansehen qua Amt bei den Schiffsbegleitern hoch. So behalten die meisten von ihnen die bisherige Erzählung bei. Nur einige wenige sprechen seit damals bei ihren Schiffstouren mehr allgemein vom Unglück auf dem Königssee. Aber den wahren Ort des Debakels, die Seestelle nahe dem Reitl-Ufer, erwähnt kaum einer. Aus Gründen.
Das Schiff tuckert leise wie eine Nähmaschine über den wellenfreien See. Dominik Pasold schaut kurz nach rechts zur Wand am westlichen Ufer. Dann schaltet er den Motor aus. Das Schiff hinter ihm ist noch weit genug entfernt. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo Schmidbauer das Flügelhorn spielt. Der Kapitän gönnt sich einen Schluck heißen Kaffee aus seinem neonblauen Thermobecher.
Max Schmidbauer hat einige seiner Anekdoten abgefeuert. Weil er die im Schlaf aufsagen kann, hat er gleichzeitig die Fahrgäste gemustert. Wie immer sind viele Holländer unter ihnen, meist Familien, die Kinder mit Haaren gelb-weiß wie Goudakäse. Dickbäuchige Männer aus NRW um die sechzig mit gleichaltrigen Frauen, die wilde Tattoos (Schlangen, Flammen, Kolibris) an Oberarmen und Unterschenkeln tragen. Ein albernder und gackernder Kegelclub aus Peine, der schon vor der Fahrt ordentlich getankt hat oder noch die Restpromille von der Nacht entfaltet. Alleinreisende mit verhärmtem Blick; niemand weiß, was für Dramen sich hinter ihrer Stirn abspielen. Einheimische in Trachten, die zur Kirchweih übersetzen. Mehrere alte Männer mit knielangen karierten Baumwollhosen, die die Krampfadern an den weißen Unterschenkeln freilegen. Ein starker Kontrast zu den sehr jungen thailändischen Frauen an ihrer Seite mit reiner Haut und sanft braunem Teint. Eine dieser Thailänderinnen ist es auch, die Schmidbauer eine Frage stellt. Er ist gerade dabei, den Flügelhornkoffer aus dem Schränkchen seitlich der Treppe zur Kapitänskabine hochzuholen. Schmidbauer hat soeben die Geschichte vom Unglück von 1688 erzählt.
»Entschuldigen Sie, äh, iche habe eine Filme gesehen, da hate mane gesagt, das Boot seie nix hiere untergegange, sondern weiter oben an Stelle genannt Reitl. Stimmte dase?«
Schmidbauer tut so, als habe er die Frage nicht gehört. Dieses Thema will er definitiv nicht verhandeln. Jetzt bringen die schon im Fernsehen Berichte darüber! Aber als er von der Plane nach oben schaut, sieht er in eine ganze Reihe gespannt wartender Gesichter.
»Jo mei«, knurrt er, »ich glaub halt dem früheren katholischen Pfarrer von Berchtesgaden. Der sagt, es ist genau hier passiert.«
»Aber ine Filme, Mann hate gesagt, iste ohne Beweise. Er aber hate viele Dokumente, dasse nichte hiere passiert ist großes Unglück. Waren wohle zu viele Leute aufe Boote damals.«
Schmidbauer schaut die Thailänderin an wie eine Bulldogge das Küken. Er holt tief Luft. »Vielleicht ham die damals zu viel diskutiert hier auf dem Boot. Waren vielleicht zu viele Gscheidhaferl auf dem Boot. Irgendwann ist einem der Hiesigen der Kragen geplatzt. Es kam zu einer Rauferei. Und dann ist das Boot gekentert.«
War das jetzt eine Drohung? Auf Kapitän Pasolds Stirn zeigt sich eine Falte über der Nasenwurzel. Er kennt Schmidbauer gut, weiß, dass der auch schon mal pampig wird, wenn ihn einer der Gäste nervt. Während Schmidbauer den Koffer auf die Sitzbank neben sich stellt, legt die Thailänderin mit einer weiteren Frage nach.
»Äh, dase Boote, dase die Wallfahrer damals hatten, iste dase gewesen eine Segelboot?«
Schmidbauer überfordert die Frage. Hätte er dem Vortrag von Arthur Greiner-Schuh bis zum Ende gut zugehört, wüsste er, wie das Boot von 1688 beschaffen war: zwei Einbäume, die mit Querbrettern verbunden waren, auf denen die Pilger standen. In den Einbäumen ruderten Einheimische das Boot, das einem Floß glich, zur Hirschau. Aber Schmidbauer hatte sich damals über Greiner-Schuhs Ansinnen, die Geschichte vom Unglück neu zu erzählen, sehr echauffiert. Die ganze Zeit tuschelte und frotzelte er beim restlichen Vortrag mit seinen Kollegen. Nichts bekam er daher von dem Boot von 1688 mit, wie es Greiner-Schuh beschrieb.
»Was weiß denn ich, was das für ein Boot war. Wird so ein Floß gewesen sein«, antwortet er schroff. Die Thailänderin erschrickt und lehnt sich zurück in den Arm ihres Begleiters, der ihr Großvater sein könnte. Oder sind die Thailänderinnen Pflegerinnen der älteren Herren auf dem Schiff? Die Paare scheinen sich untereinander nicht zu kennen. Aber gegen ein Pflegerinnendasein der Thailänderinnen spricht, wie die Herren die jungen Frauen betatschen.
»So, meine Herrschaften, ich hole jetzt das Flügelhorn raus und werde Ihnen dann einige Melodien spielen. Wenn Sie sich bitte der Felswand zuwenden. Von dort werden Sie eine bemerkenswerte Antwort hören. Das funktioniert allerdings nur, wenn Sie mir keine weiteren Fragen stellen und stad sind.«
»Stad?«, fragt eine mollige Frau aus Peine. Der Rest des Kegelclubs findet diese Frage zum Brüllen. Und brüllt.
»Stad sein, genau das meine ich, nicht so rumbrüllen, wie ihr es jetzt grade hier tut!« Schmidbauers Laune ist jetzt im Keller. Er hat die Peinerin richtig angebellt. Das Kichern in den Gesichtern der Gruppe friert ein. Trinkgeld werden sie wohl nicht viel geben. So ein unfreundlicher Bayer. Aber Schmidbauer kennt seine Grenzen. Für Trinkgeld macht er nicht alles. Einen gewissen Respekt fordert er schon ein.
Jetzt öffnet er die Schnallen seines Flügelhornkoffers. Er hat ihn neben sich auf die Bank gelegt, nahe am Ausgang, wo er später in Sankt Bartholomä die Landebrücke anlegt. Damit er Platz für den Koffer hat, sind die Menschen auf der Bank noch enger als ohnehin schon zusammengerückt. Auch auf den Längsbänken in der Mitte des Decks sitzen die Gäste eng nebeneinander wie Erstklässler beim Schulausflug. Das Schiff ist mit rund neunzig Gästen komplett ausgelastet. Die meisten beobachten Schmidbauer. Wie er den Kopf schüttelt wegen der Thailänderin. Wie er noch mal kräftig in ein Taschentuch schnäuzt. Wie er langsam den Deckel des Instrumentenkoffers anhebt. Schmidbauer staunt, warum das Tuch, das das Flügelhorn abdeckt, fleckig ist. Er nimmt es weg. Im selben Moment stößt die Thailänderin spitze Schreie aus. Als kröche eine Vogelspinne auf sie zu. Ihre Schreie hallen über den ganzen See. Sogar ein Echo ist leise zu hören. Zitternd, mit weit aufgerissenen Augen quetscht sie sich an ihren Opa-Ersatz. Auch andere Gäste brüllen los oder wenden sich entgeistert ab. Wieder andere sind gebannt von dem, was sie da sehen. Von allen Seiten drängen sie herbei und geben dem Schiff so eine bedenkliche Schlagseite. Die Falkensteiner Wand und das Echo sind jetzt bedeutungslos.
»Jesses, Maria und Josef«, stammelt Schmidbauer. Geistesabwesend schaut er zum Kapitän. Pasold drängelt sich zu ihm durch, schiebt einige Fahrgäste auf die andere Schiffsseite und sieht dann ebenfalls konsterniert auf den Inhalt des Koffers.
»Ich rufe den Toni an. Und die Wasserwacht. Und die Polizei«, sagt er zu Schmidbauer hin, der nur nickt.
Im Koffer ist schon noch das Flügelhorn. Doch auf ihm liegt eine abgetrennte menschliche Hand. Am Ringfinger blinkt, funkelt und schillert ein überdimensionaler Ring mit einem kästchenförmigen Aufsatz. Er ist mit Diamanten und einem Amethyst besetzt. Aus der Hand ist Blut auf das goldene Flügelhorn getropft und dort verkrustet. Altersfleckig, faltig – die Hand ist nicht die eines jungen Menschen. Die Finger sind ungewöhnlich dick, vielleicht geschwollen. Sie hätten jedem Metzger zur Ehre gereicht.
Dominik Pasold telefoniert mit Toni Kranz. Den Motor hat er noch nicht wieder angelassen. Beim Telefonieren sieht er, wie ein scheinbar herrenloses Ruderboot auf sein Schiff zutreibt.
»Ja, eine Hand«, bestätigt er dem Leiter der Schifffahrtsgesellschaft.
»Dann drehst du jetzt sofort um. Ich verständige die Polizei. Den Koffer am besten wieder zuklappen und niemanden …«
»Nein!«
»Wieso nein? … Dominik! …«
»Da ist ein Ruderboot auf dem See, Toni.«
»Ja? Was ist damit?«
»Es sah eben so aus, als ob niemand drin ist.«
Stille. Die Zeit ist stehen geblieben. Pasolds Blick. Ein Hitchcock-Moment.
»Dominik? … Hallo? … Und? … Ist doch jemand drin? Hallo?«
»Ja«, haucht Pasold nur.
»… Dominik? Hallo? … Dominik? Jetzt meld dich halt! … Was ist mit dem Ruderboot? Herrschaftszeiten!«
Kapitel 3 • Ein Fürsterzbischof hat’s nicht leicht
Salzburg, Fürsterzbischöflicher Palast, 1678
Fürsterzbischof Max Gandolf trug eine elegante französische Weste, edle Schuhe aus Lissabon und duftete nach Parfüm aus Persien. Das Feuer prasselte im Kachelofen. Ein Diener brachte ihm indischen Tee, dazu ein Fläschchen mit Mirabellenschnaps aus der Wachau. Eigentlich hatte er für diese ganzen Hexen- und Zauberer-Prozesse gar keine Zeit. Der Salzburger Dom brauchte neue Seitenaltäre, die Haube der Franziskanerkirche zerfiel zusehends, die Höglwörther Klosterkirche bedurfte dringend einer Generalsanierung. Außerdem beabsichtigte er, eine eigene fürsterzbischöfliche Bibliothek zu errichten, die seinen Namen tragen und ihn unsterblich machen würde. Überall musste er entscheiden, Geld beschaffen, Baupläne goutieren. Er kam sich vor wie der Herrscher eines Zitronenreichs. Die Zitronen waren seine Untertanen. Und er presste sie mit Steuern und Abgaben aus bis auf den letzten Tropfen. Sonst scheiterten all seine Bauvorhaben. Außerdem beaufsichtigte er die geistlichen Belange im Salzburgischen. Ihm oblag es, über die reine katholische Lehre zu wachen. Damit sich nicht dieser Hokuspokus vom Jackl und anderer Aberglaube ausbreitete. Tausend Dinge gab es, für die er verantwortlich zeichnete. Delegieren, das war nicht seins. Wer Macht abgab, hatte schon verloren. Also überflog er beispielsweise sämtliche Protokolle der Verhöre mit den vorwiegend jugendlichen Anhängern dieses verflixten Jackl, trotz aller Zeitnot. Auch Kinder waren unter den Angeklagten. Man musste das Übel bei der Wurzel packen. Darum gerade auch die ganz jungen Hexen und Zauberer ergreifen und abstrafen. Was wurde sonst aus diesen, wenn sie in ihrem Zauberwahn erst mal erwachsen waren? Er schlug ein weiteres Protokoll auf. Las alle Fragen und die Antworten durch. Guter Mann, der Zillner. Der machte mal noch Karriere an seinem Hof!
Agnes Fresner. Sie war geständig. Die Hostie hatte sie sich … Wie dem Hexenkommissar kam es auch dem Fürsterzbischof vor, als würde man ihm Honig zwischen die Kiemen tropfen. In den Mundwinkeln wandelte sich der stets vorhandene Sabber zu Schaumkrönchen. Seine Zunge ragte ein Stück weit zwischen den Lippen hervor. Agnes Fresner war ihm zwar nie zu Gesicht gekommen. Aber auch ein Geistlicher hatte Fantasie. Warum sollte er die nicht schweifen lassen. Trotzdem … er rief sich selbst zur Ordnung und las weiter. Ah … ui … was für ein ungeheuerlicher Vorfall. Die Hostie mit Hundekot beschmiert!
So sehr sich Max Gandolf über die Delinquentin empörte, verspürte er ganz weit hinten in seinem Kopf ein Unbehagen. Was, wenn das ganze System von Denunziation, Festnahme, Anklage, Folter und Geständnis irgendwo einen Strickfehler hatte? Ihn beschäftigte die Frage, ob es reichte, den Zauberer Jackl gekannt zu haben, um deswegen selbst der Zauberei und Hexerei geziehen und sodann verurteilt zu werden. Überhaupt waren es manchmal nichtige Anlässe, die zu Verhaftungen führten. Und wer einmal verhaftet war, der kam nur schwer noch aus den Fängen der Justiz heraus. Auch kosteten die Prozesse viel Geld. Das Geld brauchte er aber für viele andere Dinge. Ihm lagen die Pfarreien vor Ort, die Orden in den Ohren, weil sie dringend Mittel brauchten, um Stuckateure zu bezahlen, Chorgestühl zu beschaffen oder die Opferstöcke zu erneuern. Warum also steckte er so viel Geld in diese Hexenprozesse?
Man hatte es nicht einfach als Regent. Vor allem wenn man auch als Geistlicher christliche Milde zeigen sollte, sagte er sich. Er kehrte wieder zu dem Protokoll zurück, das das Verhör mit Agnes Fresner beinhaltete.
Christliche Milde. Sie war geständig. Dann will ich Gnade walten lassen. Gelobt sei die Jungfrau Maria. Tod durch Erdrosseln, danach erst den Scheiterhaufen anzünden und ihren Leib den Flammen überlassen. Schon wollte er die Mappe schließen, da sah er den Vermerk: Bestreitet Verkehr mit Tieren.
Dann wollen wir ihr das Sterben doch noch etwas erschweren, brummelte er. Drei Mal Zwicken mit dem glühenden Eisen in jede Brust vor dem Erdrosseln, notierte er auf den Gerichtsordner. In nomine Patri et Filii et Spiritus sancti. Amen.
Max Gandolf atmete auf. Jetzt war endlich Zeit, sich zu erholen. Zeit für etwas Erhebendes, das ihn aus den Niederungen dieses Zauberunwesens trug. Er schlurfte zum intarsienreichen Sekretär in der Zimmerecke, öffnete eine Schublade und nahm eine kleine Perlmuttschatulle heraus. Den Deckel klappte er vorsichtig nach oben. Da lag es, das Prachtstück, der Amethyst-Ring. Das intensive Violett glitzerte und schimmerte ihm entgegen, je nachdem, wie stark die ins Palais scheinende Vormittagssonne auf den Ring traf. Umrankt war der Amethyst von goldgelben Diamanten. Ein Schauspiel für die Augen! Aber das eigentlich Wertvolle war unter die Edelsteine in ein metallenes Kästchen eingearbeitet: ein winziges Stück Stoff, grau in der Grundfarbe, das in der Mitte dunkel verfärbt war. Max Gandolf wusste, welche Bewandtnis es damit hatte. Die dunkle Verfärbung rührte von einem wahrhaftigen Tropfen des Blutes Christi her, das er am Kreuz vergossen hatte. Joseph von Arimathia selbst hatte dieses Stoffstück mit dem Tropfen aus dem Tuch geschnitten, das um Jesus hing, als Joseph dessen Leichnam vom Kreuz holte. Der Fürsterzbischof nippte an seinem Mirabellenschnaps. Davon konnte er so viel trinken, wie er mochte. Denn der Ring, so hatte es ihm der Verkäufer erklärt, ein Händler aus der Lombardei mit besten Kontakten zu den Höfen im gesamten Mittelmeerraum, schützte den Besitzer und alle in seinem Umfeld vor den schädlichen Wirkungen des Alkohols. Der Ring schenkte sogar einen schönen Rausch: Man konnte die doppelte Menge saufen – und am nächsten Morgen brummte einem nicht der Schädel. Ein Rausch ohne Folgen, nur eben der aufgeputschte Zustand, welcher Rausch konnte schöner sein. Prosit! Die nächste Mirabelle! Mit dem Blutstropfen Christi war der Ring außerdem eine Reliquie. Als solche schützte er seinen Besitzer und das Umfeld, in dem er sich befand, vor allen Formen von Unglück.
Max Gandolf schaute aus dem Fenster. Dort führten Gerichtsdiener zwei Kinder zur Exekution. Gerade brach der Bannrichter den Stab über ihnen. Sie bestiegen das Arme-Sünder-Wagerl. Als die Glocken des Doms läuteten, setzte sich ein langer Zug in Bewegung. Gebete ertönten für das Seelenheil der Zauberbuben. Aus den Häusern und Gassen strömten immer mehr einfache Menschen herbei und schlossen sich dem Zug an. Ziel war die Richtstätte in Gneis.
»Sie sind noch keine vierzehn«, sinnierte Max Gandolf, »sie dürfen den Tod mit dem Fallbeil erwarten. Ein schöner und schneller Tod. Wir sind ja keine Barbaren.«
»Einer geht noch«, flüsterte er und schenkte sich den Rest des Mirabellenfläschchens in sein Glas. »Auf die gute Ordnung in meinem Fürstentum!«, prostete er sich erneut zu. Er legte sich auf die schwere waldgrüne Chaiselongue mit den goldbestickten Brokatkissen. Während er hinwegdämmerte, hörte er die einsamen Schreie der beiden Jungen nicht mehr. Durch alle Gassen Salzburgs schallten sie, als der Freimann sie auf der Bank festband. Das Beil trennte ihren Kopf mit einem einzigen Schlag ab. Blut spritzte aus den Adern, die aus dem Hals hervorzüngelten wie geköpfte Blumenstängel. Die Menge schwieg andächtig.
Nach einer guten Stunde erwachte der Fürsterzbischof und klingelte nach seinen Dienern. Ihn schmerzten die Glieder, seine Zehen wiesen mehrere Deformationen auf. Mit Bücklingen verließen die Diener den Prunkraum, um ätherische Öle zu holen. Bevor er sich von ihnen damit einreiben ließ, schaute Max Gandolf noch einmal auf seinen Schreibtisch. Dort lag ein Schreiben vom Abt der Bartholomäusbrüder in Höglwörth.
»Eine Einladung zur Bierverkostung, oho«, freute er sich. »Da kommst du zu deinem ersten großen Einsatz, mein Lieber!« Er streichelte den Amethyst-Ring, betrachtete ihn verzückt wie der Bräutigam die Braut vor der Hochzeitsnacht. »Die werden sich wundern, wie viel ihr Herr Fürsterzbischof verträgt!«
Kapitel 4 • Der Leichensee
Königssee, Sonntag, 28. August
Das Elektroschiff gerät erneut in Schieflage. Fast alle Fahrgäste haben sich weg vom Flügelhorn auf die andere Seite begeben. Sie starren in das Ruderboot, das herangetrieben ist. Pasold und Schmidbauer haben es mit einem Seil an ihrem Schiff befestigt, damit es nicht davontreibt.
Im Ruderboot liegt ein Priester in vollem Ornat und mit schwerem Kreuz an einer Kette um den Hals. Zu erkennen ist der Überwurf über der Tunika, das Skapulier, beides in Schwarz. Außerdem ein genähtes rotes Abzeichen auf der Brust, darauf abgebildet ein Dolch oder Messer sowie ein weiterer, vom Bootsrand aus nicht zu definierender Gegenstand. Der Priester liegt auf dem Rücken und füllt mit seiner Korpulenz fast den gesamten Bootsraum aus. Die Arme hat er seitlich von sich gestreckt wie Jesus am Kreuz. Und wie diesem sind auch dem Priester lange Nägel durch Hände und Füße getrieben, hier ins Holz des Bootsrumpfes geschlagen. Im Hüftbereich ist das Skapulier nach oben verrutscht und ein breiter Ledergürtel zu sehen, an dem ein zerfledderter Rosenkranz befestigt ist. Gebettet ist der Körper des Priesters auf seinem ebenfalls schwarzen Chormantel, der vorne geöffnet ist und faltenreich an den Seiten des Körpers anliegt. Auch eine schwarze Kapuze schaut neben seinem Kopf hervor. Sie ist an einem separaten Schulterüberwurf befestigt. Alles schwarz. Das Gesicht ist aufgedunsen, die Lippen zugespitzt, die Augen offen, mit einem letzten Entsetzen, den Blick jetzt in Richtung Schiff gerichtet. Ein riesiger gekreuzigter Kolkrabe!
Neben seinem Kopf steht ein silberner Kelch mit einem Rest dunkler Flüssigkeit. Auch einige Kekse oder so was liegen da im Schiffsrumpf, manche in kleinen Wasserpfützen. Sind das Rotwein und Hostien, die Utensilien der Eucharistie?
Auf dem Ausflugsschiff macht sich Panik breit. Viele haben ihre Handys gezückt, um das Boot mit dem Priester zu fotografieren. Dabei stützen sie sich aufeinander. Die ganz unten bekommen Platzangst, fürchten, erdrückt zu werden. Pasold und Schmidbauer haben alle Hände voll zu tun, um die Gäste zu beruhigen. Zwischendurch ruft Pasold wieder Toni Kranz an. Der hat bereits ein Boot der Wasserwacht zu ihnen entsandt. Bei Kranz ist das Telefon pausenlos besetzt. Gleichzeitig sind mehrere Martinshörner zu hören. Die Polizei kämpft sich mit zwei Einsatzfahrzeugen, darunter ein ziviles, durch die Menschenmassen zum Seeufer. Ebenso eine Notärztin und ein Rettungswagen, das Technische Hilfswerk und die Feuerwehr.
Pasold beobachtet die anderen Schiffe, die kurz nach ihnen ausgelaufen sind und alle in gebührender Entfernung hinter ihnen ausharren. Bei einem sieht er, wie sie auch ein Ruderboot an die Längsseite gezogen und festgezurrt haben. Als der Kapitän endlich bei Toni Kranz durchkommt, wird ihm klar, warum dort immer besetzt war. Auch im zweiten Ruderboot befindet sich ein toter Priester. Gleicher Habit, gleiche Positionierung, gleiche Mitgaben. Das Boot der Wasserwacht fährt von Schiff zu Schiff, schafft es aber nicht bis zu Pasold. Denn in der Zwischenzeit treiben immer mehr scheinbar unbemannte Ruderboote von Sankt Bartholomä oder dem Reitl her in Richtung Nordufer des Sees. Die Elektroschiffe mit den Touristen ziehen die Boote heran. Ein zweites Boot der Wasserwacht kommt dem ersten zur Hilfe. Sie fahren zu den Schiffen, sammeln die Ruderboote ein und binden sie aneinander. Dann fahren sie die Ruderboote in die Werft am Königssee, wo sie vor neugierigen Blicken geschützt sind.
Die fragefreudige Thailänderin, deren Begleiter sie jetzt immer nur Mäuschen nennt, schreit, sie wolle nur noch nach Hause. Wobei nicht klar wird, ob sie damit das Zuhause mit dem Seniorpartner oder Thailand meint. Dem Kegelclub entweicht mit dem Restalkohol jegliche Heiterkeit wie dem zerstochenen Reifen die Luft. Einige Katholiken bekreuzigen sich unentwegt beim Anblick des toten Priesters, auch wenn er ihnen unbekannt ist. Die Paare aus NRW kratzen sich an den Tattoos. Die holländischen Kinder sind bleich wie Ziegenkäse. Still ist es geworden, nur das Schwappen der Wellen an den Rumpf des Schiffes gibt dem Ganzen etwas fast Meditatives.
Ein Motorboot mit zwei sportlichen jungen Leuten legt am Ausflugsschiff an. Die beiden betreten das Schiff über die Bordleiter. Sie stellen sich als Kriminalbeamte vor. Simon Perlinger, der Leiter der Berchtesgadener Kriminalpolizeistation, und Luisa Sedlbauer, seine Kollegin. Die Polizisten schauen sich den Koffer mit der abgetrennten Hand an. Über den Koffer halten sie die Plane, um nicht neugierige Blicke zu provozieren und für Unruhe auf dem Schiff zu sorgen. Als Schmidbauer den Koffer zum Spiel mit dem Flügelhorn wenige Minuten vorher geöffnet hatte, dachte niemand gleich ans Fotografieren. So verblüfft waren alle. Das würde sich jetzt sicher ändern, wenn sich die Gelegenheit auftäte. Im Land der »Tatort«-Gucker wäre jeder gerne ein kleiner Ermittler und würde Beweise sammeln. Die Fotos und Videos würden viral gehen. Dass es sich hier um Kriminalfälle handelt, ist offensichtlich. Darum stellt sich Schmidbauer mit vor der Brust verschränkten Armen vor die Ermittler. Er bittet die Fahrgäste, Abstand zu wahren, soweit das auf dem voll besetzten Schiff möglich ist. Luisa Sedlbauer macht einige Fotos von der Hand und vom Instrumentenkoffer und schiebt ihn dann unter die Plane zurück. Die Spurenermittler aus Rosenheim sind bereits angefordert. Aber die beiden Berchtesgadener Ermittler werden angesichts der Lage weitere Verstärkung anfordern. Denn, so hört es Simon Perlinger über Funk, in den anderen Ruderbooten sind auch tote Priester gefunden worden.
»Sobald wir an der Werft sind, verschaffen wir uns einen Überblick«, sagt er leise zu Luisa. Informationen prasseln über Funk auf sie herein. Einem der toten Priester soll die rechte Hand abgetrennt worden sein. Ist es die Hand im Flügelhornkoffer? Es ist, so haben sie gesehen, auf jeden Fall eine rechte Hand. Genau wie die fehlende beim toten Priester.
Die Schiffsausflügler sind jetzt zu Zeugen geworden. Wegen der Enge des Raumes und der voll besetzten Bänke haben die Ermittler keine andere Möglichkeit, als Fragen an alle auf dem Schiff zu stellen. Schmidbauer hält sich bedeckt, Kapitän Pasold telefoniert ständig mit