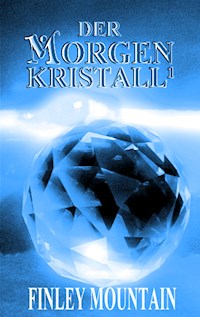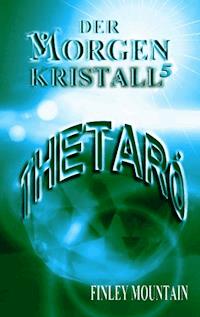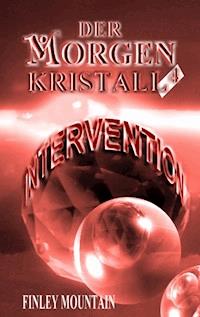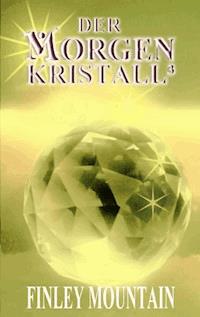Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Der Morgenkristall
- Sprache: Deutsch
Vor zweiundsechzig Jahren sind die Weichen gestellt worden, die Waylon gerade noch, im wahrsten Sinne des Wortes, neu stellen konnte. Doch er soll nicht zur Ruhe kommen. Ihm kommt ein seltsam versiegelter Brief zu, der das Testament seines leiblichen Vaters beinhaltet. Darin wird er aufgefordert, die Geschicke in die Hand zu nehmen, die dieser nicht mehr vollenden konnte. Zur gleichen Zeit nimmt, viele hunderte Lichtjahre entfernt und von der Menschheit unbemerkt, ein Phänomen seinen Anfang, das auch auf die Erde Auswirkungen haben wird. Ein rivalisierendes, völlig gegensätzlich beschaffenes Universum streift das Unsrige. Im Zentrum der Berührungsfläche entsteht mitten auf Arimea eine Spiegelwelt, die gefahrlos betreten werden kann. Dessen ungeachtet vereint die Überlappung unterschiedlichen Raum und Zeit mit der arimeanischen Gegenwart. Was Waylon auf Uridräo erfährt und weshalb seine Tochter Olivia ebenfalls plötzlich dort auftaucht, wird im sechsten Buch des Morgenkristalls erzählt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 283
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Buch
Vor zweiundsechzig Jahren sind die Weichen gestellt worden, die Waylon gerade noch, im wahrsten Sinne des Wortes, neu stellen konnte. Doch er soll nicht zur Ruhe kommen. Ihm kommt ein seltsam versiegelter Brief zu, der das Testament seines leiblichen Vaters beinhaltet. Darin wird er aufgefordert, die Geschicke in die Hand zu nehmen, die dieser nicht mehr vollenden konnte. Zur gleichen Zeit nimmt, viele hunderte Lichtjahre entfernt und von der Menschheit unbemerkt, ein Phänomen seinen Anfang, das auch auf die Erde Auswirkungen haben wird. Ein rivalisierendes, völlig gegensätzlich beschaffenes Universum streift das Unsrige. Im Zentrum der Berührungsfläche entsteht mitten auf Arimea eine Spiegelwelt, die gefahrlos betreten werden kann. Dessen ungeachtet vereint die Überlappung unterschiedlichen Raum und Zeit mit der arimeanischen Gegenwart. Was Waylon auf Uridräo erfährt und weshalb seine Tochter Olivia ebenfalls plötzlich dort auftaucht, wird im sechsten Buch des Morgenkristalls erzählt.
Der Autor
FINLEY MOUNTAIN wird 1965 geboren. Büchern kann er anfangs nur sehr wenig abgewinnen. Schullektüre, zu der damals zum Beispiel auch Robinson Crusoe gehörte, legt er achtlos beiseite. Erst ein Jugendbuch erregt seine Aufmerksamkeit, und entfesselt eine bis dahin verborgene Leidenschaft. Von nun an verschlingt er alles, was er zwischen den Fingern bekommt. Darunter alte Klassiker wie Charles Dickens, Daniel Defoe, Kurt Laßwitz, Jules Verne. Durch einen Comic kommt er zum Schreiben. Zeichnet er anfangs versuchsweise noch seine Charaktere, stellt er bald fest, dass ihm das Wort besser liegt. So entstehen erste, zaghafte Versuche. Unter Pseudonym veröffentlicht er Anfang 2000 im Internet zahlreiche Texte. Mit dem Morgenkristall legt er 2014 sein Debüt in der Fantasy-Literatur vor. Zur Zeit arbeitet er an der Fortsetzung.
HANDLUNGEN UND PERSONEN SIND FREI ERFUNDEN. JEDE ÄHNLICHKEIT IST REIN ZUFÄLLIG UND UNBEABSICHTIGT.
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Teil 1: Geheimnisvolle Botschaften
Kapitel Eins
Kapitel Zwei
Kapitel Drei
Kapitel Vier
Kapitel Fünf
Kapitel Sechs
Kapitel Sieben
Kapitel Acht
Kapitel Neun
Kapitel Zehn
Kapitel Elf
Kapitel Zwölf
Kapitel Dreizehn
Kapitel Vierzehn
Kapitel Fünfzehn
Kapitel Sechzehn
Kapitel Siebzehn
Kapitel Achtzehn
Kapitel Neunzehn
Teil 2: Riss im Schatten
Kapitel Zwanzig
Kapitel Einundzwanzig
Kapitel Zweiundzwanzig
Kapitel Dreiundzwanzig
Kapitel Vierundzwanzig
Kapitel Fünfundzwanzig
Kapitel Sechsundzwanzig
Kapitel Siebenundzwanzig
Kapitel Achtundzwanzig
Kapitel Neunundzwanzig
Kapitel Dreißig
Kapitel Einunddreißig
Kapitel Zweiunddreißig
Kapitel Dreiunddreißig
Kapitel Vierunddreißig
Kapitel Fünfunddreißig
Kapitel Sechsunddreißig
Epilog
Prolog
Er schaut nicht zurück. Der Abschied ist für immer. Er weiß es, sie wissen es. In ihren Augen hat er lesen können. Und das tut weh. Verdammt weh…
Er stapft davon. Immer geradeaus. Bald hat er den Hügel erreicht. Dahinter hofft er aus Sichtweite zu sein. Die Augen der Beiden durchbohren seinen Körper. Dort, wo er sie vermutet, brennen besagte Stellen regelrecht auf seiner Haut.
Wie hat es nur soweit kommen können! Vor diesen Tag graute es ihm. Er wußte es von Anfang an. Hätte nie etwas dagegen getan. Was hätte es auch genützt? Es war unvermeidbar! Dieser Tag sollte kommen, daran führt kein Weg vorbei. Er hat es gewusst – wie konnte es nur soweit kommen …
Hinter dem Hügel führt ein Trampelpfad gemächlich hinab. Er atmet auf. Und tatsächlich lässt das Brennen im Rücken etwas nach. Ob sie immer noch ihm nachschauen? Kurz zögert er, verlangsamt den Schritt um eine Nuance. Nein! Nur nicht stehen bleiben. Die Verlockung ist zu groß und er will unbedingt vermeiden, sich umzublicken.
Augen sind verräterisch. Sie offenbaren auf geheimnisvoller Weise so ziemlich alles. Und das will er vermeiden. Schon schwer genug, nicht alles sagen zu können. Erklärungsbedarf gab es seit längerem. Doch sie vermieden das Thema. Es lag in der Luft, wurde aber konsequent aufgeschoben. Bis heute.
Dem inneren Drang gewaltsam unterdrückend, sich unter keinen Umständen umzudrehen, geht er weiter. Alles andere wäre in seinen Augen kontraproduktiv, und würde begünstigen, was er vermeiden will.
Der Weg wird breiter. In der Nähe ist Motorenlärm zu hören. Die Landstraße ist wenig befahren, deshalb macht er sich darüber keine weiteren Gedanken. Ungewöhnlich erscheint nur, dass es sich um mehrere Fahrzeuge handeln muss. Unbeirrt geht er weiter. Im Geiste sieht er die Beiden, die sein Leben bedeuten…
Er konzentriert sich nunmehr auf die vor ihm liegenden Aufgaben. Sie werden alles von ihm abverlangen, was er an Energie und Kraft aufbringen kann. Darum müssen sämtliche Brücken abgebrochen werden, die ablenken könnten. Und das würden sie zweifelsohne. Er kann es sich nicht leisten, angreifbar zu sein. Dies gilt es zu verhindern. Ob es gelungen ist, wird sich noch zeigen.
Die Motorengeräusche schwellen erneut an. Veranstalten die da etwa eines dieser illegalen Rennen? Man hört ja öfters davon und besonders in weniger bewohnten Gegenden. Er bleibt stehen, lauscht. Plötzlich ist da wieder dieses Gefühl, welches stets in brenzlichen Situationen einsetzt. Ins Bewusstsein rückt sein angeborener Instinkt, verdrängt alle Logik. Innerhalb weniger Millisekunden erfasst er die unmittelbare Umgebung. Bis zum Versteck sind es an die zweihundert Meter. Unmöglich ist diese Strecke ungesehen zu bewältigen, wenn er beobachtet würde. Und davon geht er aus. Äußerlich gelassen setzt er seinen Weg fort. Niemandem soll auffallen, dass er um ihre Anwesenheit weiß.
Vor seinem Geist sieht er mindestens vier Autos. Eins steht mit laufendem Motor tuckernd in Warteposition etwas weiter weg. Die gesamte Straße wird also überwacht.
Er bückt sich und hebt einen Ast auf, deren kleinere Äste er abbricht, um so einen Spazierstock zu erhalten. Der Weg verjüngt sich wieder zum schmalen Trampelpfad, den nicht nur Menschen nutzen. Wie ein Wanderer schaut er sich, die Natur bewundernd, um, zeigt auffälliges Interesse an Pflanzen, die er gezielt abreißt und daran riecht. Gemütlich verlässt er den Pfad und schlendert über die Wildwiese. Im hohen Gras hinterlässt er eine nicht zu übersehende Spur. So unbefangen wie möglich wandert er weiter.
Sein Verhalten mag die Verfolger irritieren. Mindesten zwei der Wagen geben Gas und verschwinden. Er überlegt, auf schnellstem Wege zum Versteck zu gelangen. Einmal dort, haben sie keine Chance, ihm weiter zu folgen. Gut vorbereitet trat er diese Reise an – dachte er jedenfalls. Etwas hat er wohl übersehen. Eine Schwachstelle der Reise ist der Zielort an sich. Alles andere ist bis ins Detail planbar. Doch hiesige Gegebenheiten des Ortes können schnell unüberschaubar werden. Zumal sich die Gegner hier sehr gut auskennen. Fremde fallen auf, besonders er, der einer anderen ethnischen Gruppe entstammt, die so gar nicht in diese Gefilde passen will. Damit kann er umgehen. Auch in der Heimat gilt er als Exot, zieht Blicke auf sich, die nicht immer wohl gesonnen zu werten sind. Hat er die Problematik vielleicht doch unterschätzt? An Aufmerksamkeit liegt ihm nichts, auch wenn er damit relativ gut fährt. Im alten Europa wird seinesgleichen angestarrt und hinter vorgehaltener Hand getuschelt, wie auf einem mittelalterlichen Jahrmarkt Missgebildete. Im Zentrum des Interesses steht nicht er als Mensch oder als Vertreter seines Volkes. Viel eher irritiert seine Erscheinung. Neben Hautfarbe und Gebaren erregt auch die Kleidung ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit, obwohl er auf die übliche Tracht wohlweislich verzichtet. Und die auffällige Hautfarbe tut ihr übriges.
Auf einer Bodenerhebung steht eine morsche Bank, die ihre beste Zeit bereits seit Jahren überschritten hat. Als Sitzgelegenheit hat sie ausgedient. Ameisen und anderes Kleingetier nutzen das verfaulte Holz für ihre Zwecke. Im Gewimmel der schwarzglänzenden Chitinpanzer findet er Entspannung. Auf dem ersten Blick erscheint das Insekten-Wirrwarr unkoordiniert und planlos. Doch bei genauerer Beobachtung kristallisiert sich eine arbeitsteilende Ordnung im anscheinenden Chaos heraus, die ihresgleichen sucht. Diese fleißigen Wesen sind die wirklichen Herrscher der Erde und es gibt kaum einen Landstrich, den sie nicht erobert haben. Jedes Individuum hat seinen bestimmten Platz und die ihm auferlegte Aufgabe, für die es lebt und ausfüllt.
Von nichts lassen sich diese Insekten ablenken. Sie rotieren wie ein sprichwörtliches Uhrwerk. Er nimmt ein kleines Stöckchen und legt es quer über den Ameisenpfad, dass nun wie eine Schranke wirkt. Es kommt zu einem Stau, den die Tierchen zu überwinden suchen. Eines rennt wie wild am Hölzchen entlang, bis es dessen Ende findet. Ebenso lang dauert es, bis der ursprüngliche Weg gefunden ist. Kaum hat die Ameise ihn betreten, folgen die Anderen den Duftstoffen, die sie dabei abgesondert hat. Nur kurze Zeit später ist alles wieder im vorherigen Fluß.
»Du solltest besser auf deinen Weg achten«, erklingt hinter ihm eine sonore Stimme. Er braucht sich nicht umzudrehen, er kennt auch so den Mann.
»Mein Pfad ist sicher«, antwortet er. »Wie sonst kommt es, dass du dich so wohl auf ihm fühlst?!«
»Überschätz dich nicht. Auch du wirst eines Tages einsehen, wie oft du irrtest.«
»Wir tun alle das, was uns aufgetragen wird.«
»Immer loyal und treu. Ist selten geworden.«
»Sprichst du von dir?«
»Loyalität wird nicht immer gut entlohnt.«
Bisher hat er unumwunden die Ameisen beobachtet. Eigentlich will er sich auch nicht dem zuwenden, der ihn seit Anbeginn auf den Fersen ist. Jetzt kann er nicht anders.
»Loyalität kommt von hier«, sagt er scharf und mit aufgelegter Hand aufs Herz. »Doch das sagt dir ja nichts.«
Der Mann lacht verhalten auf.
»Du solltest mit deinen Äußerungen wirklich vorsichtiger sein, Freund. Wie leicht könnte es zu Missverständnissen kommen.«
»Ich kenne dich nicht anders. Bloß das deine Drohungen bei mir unwirksam bleiben.«
Demonstrativ ruhig wendet er sich wieder seinen Beobachtungen zu.
»Vielleicht ist es so, Cheveyo, vielleicht aber auch nicht. Aber bedenke stets, dass die Zeit gegen dich spielt. Ich bin nicht der Feind!«
»Was suchst du dann hier? Spionierst du mir denn nicht nach?«
Der Mann lacht.
»Mach dich doch nicht lächerlich! Du jagst einem Phantom nach. Mann nennt dich nicht ohne Grund den ›Geisterkrieger‹.«
»Nur weil keiner von euch sieht, was uns alle bedroht, heißt es noch lange nicht, dass es Geister sind, gegen die gekämpft werden muss. Ich sage dir nochmal: Das sind Gegner aus Fleisch und Blut.«
»Und wo stecken sie dann? Keiner hat sie je zu Gesicht bekommen!«
»Dennoch sind sie allgegenwärtig«, entgegnet Cheveyo ruhig. »Sei froh, dass du sie bisher noch nicht gesehen hast. Denn dann ist es zu spät.«
Der Mann wird blass. Cheveyos Gelassenheit wirkt bedrohlicher, als jede anders geartete verbale Äußerung. Der vermeintliche ›Geisterkrieger‹ ist seiner Sache ungemein sicher. Sollte doch etwas Wahres dran sein? Urteilt er vorschnell?
»Ich werde dich im Auge behalten, Cheveyo. Dann werden wir ja sehen.«
Eine Weile wartet der ›Geisterkrieger‹ in vornüber gebückter Beobachtungshaltung. Als er wahrnimmt, dass die Motoren verstummen, richtet er sich auf.
»Ja, Tonweya, wir werden sehen …«
TEIL 1
GEHEIMNISVOLLE BOTSCHAFTEN
»Die meiste Zeit verliert man damit,
dass man Zeit gewinnen will.«
John Steinbeck
Eins
Undurchdringlicher Dschungel ist auf Nosy Be die vorherrschende Kulisse. Das feuchte Klima ist selbst für den in Nordamerika beheimateten Nayati gewöhnungsbedürftig. Hohe Luftfeuchtigkeit legt sich um seine Brust, wie ein zu eng geschnürtes Korsett. Viel zu oft ringt er nach Luft, die von Wassertröpfchen übermässig geschwängert ist. Vom Indischen Ozean her weht eine kaum merkliche Brise an diesem Tag. Von Abkühlung kann keine Rede sein.
Gleich hinter dem weißen Sandstrand beginnt der Regenwald, aus dem die typische Geräuschkulisse zu ihm dringt. Der vulkanische Boden lässt die Vegetation dieses Landstrichs – der in Malagasy »Große Insel« bedeutet –, in aller Herrlichkeit gedeihen. Einmal werden hier sechzigtausend Menschen leben. Die Riesenbäume, mit ihren knapp vierzig Metern, wird es auch dann noch im geschaffenen Naturreservat geben. Von den späteren elf Kraterseen gibt es jetzt bereits neun. Diese werden dann von den Sakalava als heilig und Heimat der Ahnen angesehen und verehrt. Nur barfüßig und in einem Wickeltuch gehüllt, darf man sich ihnen nähern.
Vom Lakobe aus, der höchsten Erhebung der Insel, sind die Nebeninseln und das zehn Kilometer entfernte Madagaskar gut zu sehen.
Nosy Be ist zu seiner Wahlheimat geworden. Etwa zweitausend Jahre in der Vergangenheit, ist die Insel noch unbesiedelt und er kann sich relativ frei bewegen. Erst im fünfzehnten Jahrhundert werden Swahili und Händler aus Indien hier heimisch werden.
Seit Nayati dem ›Kristallenen Kreis‹ angehört, nutzt er Nosy Be als Rückzugsort. Hier bereitet er sich auf zukünftige Missionen vor, schöpft Kraft und sinnt über das weitere Vorgehen nach. Gewahrer sein bedeutet stets den Blick zu erweitern und mehr zu sehen, als andere. In den letzten drei Jahren bestand sein Leben hauptsächlich in der Aneignung der Geschichte des ›Kreises‹ und des Kodexes. Tagtägliches Studium ist ermüdend und energiezehrend. Als Ausgleich nimmt er gern die natürliche Stille Nosy Bes in Anspruch.
Ihm verbleiben noch zwei Jahre aufopferungsvollen Lernens. Dann darf der Gewahrer das erste Mal ins Heiligtum des Hüte-Kreises vorstoßen; Zartaks Mond Uridräo. Dort soll ein uralter Stützpunkt der Arimeaner existieren, die einst die ›Sternenbruderschaft‹ ins Leben riefen, um das wirklich Wahre zu huldigen: dem Leben. Zahllose Legenden rangen sich um diese sagenumwobene Bruderschaft. Sie sind Teil dessen, was Nayati studiert.
Auch die alten Griechen wussten offenbar davon. Ptolemäus beschrieb in der antiken Astronomie bereits ein darauf zurückzuführendes Sternbild am Rande der Milchstraße. Mythologisch betrachtet soll das Sternbild der Schlange deren Träger darstellen; Asklepios, der Heilkundige, um dessen Stab sich eine Schlange windet. Seit altersher das Symbol der heilenden Kunst weltweit.
Etwa dreiundsiebzig Lichtjahre von der Erde entfernt ist Serpentis das hellste Gebilde des Sternbildes Schlange. Dabei soll es sich um einen Riesenstern handeln, dessen Leuchtkraft des solaren Systems um mehr als das dreißigfache übersteigt.
Dorthin wird es ihn als nächstes verschlagen. Ein wichtiges Etappenziel, um tiefer in die Gründe des Hüte-Kreises hinabzusteigen. Wofür die ›Sternenbruderschaft‹ Abertausende von Jahren benötigte, wird er innerhalb kürzester Zeit in sich aufnehmen und verinnerlichen. Hätte das sein Vorgänger Nayati vorher gesagt, er wäre vermutlich niemals in dessen Fußstapfen getreten. Der Reiz des Unbekannten war stärker, als detailliertes Nachfragen. Nun gibt es kein Zurück mehr.
Gleichfalls gilt es das Artefakt vor Zugriff zu beschützen. Noch trägt er es direkt am Körper, was natürlich nicht die günstigste Option darstellt. Somit ist einem unautorisierten Zugriff Tür und Tor geöffnet. Dies ist ebenfalls ein Grund, weshalb Nayati Nosy Be auserwählt hat; ein menschenleeres Stück Land, deren derzeitig einzige Bedrohung im wilden Dschungel liegt.
Ein selbst zusammengestellter Mix aus Kräutern, bestimmten Baumrinden und Wurzeln verschiedener Pflanzen, in konsequenter Dosierung, versetzen ihn in einen spirituellem Trancezustand. Ein «Geisttor» öffnet sich, durch das er in eine Welt gelangt, in der er eigene hautnahe physische Erfahrungen macht. Die Rezeptur stammt aus den Anfangszeiten des Bundes. Damalige Initiatoren suchten nach einer schnellen Möglichkeit, Erfahrungen und geschichtliche Ereignisse fühlbar weiterzugeben. Das Ergebnis ist beeindruckend effektiv.
Seine indianische Herkunft begünstigt den Dämmerungszustand. Mit halb geschlossenen Augen sitzt er regungslos und in sich gesunken da. Während sein Körper in der Gegenwart verharrt, begibt sich der Geist in eine weit zurückliegende Vergangenheit zurück. Vor ihm entsteht eine längst vergangene Kultur. Fremdartige Gebäude zeugen von intelligentem Leben. Menschenähnliche Gestalten ziehen wortlos vorüber, die Gesichter tief im Stoff der Umhänge verborgen. In Reih und Glied marschieren sie in Richtung eines Berges. Nayati kann sich frei bewegen, da nur sein Geist anwesend ist. Dennoch reiht er sich in die Prozession ein und folgt den Verhüllten.
Über eine künstliche Plattform gelangen sie über das Wasser. Drüben auf der anderen Seite strömen die Ersten ins Allerheiligste. Der Strom von Personen will nicht versiegen. Nayati wendet sich um. Hinter ihm folgen mindestens noch Mal so viele. Es fällt kein Wort. Die Köpfe nach unten gebeugt, folgen sie ergeben den Vorgängern.
Es dauert, bis Nayati seine Körperlosigkeit bewußt wird, und dementsprechend ist er für andere nicht existent. Er löst sich aus dem Glied heraus, erreicht allmählich an Höhe. Kurz darauf wird ihm bewusst, dass er über die Szenerie schwebt.
Als es ihm das erste Mal passiert ist, kam es zu unmittelbaren Abbruch und somit zum urplötzlichen Erwachen aus der Trance, was zur Folge hatte, dass er mehrere Tage orientierungslos blieb. Seiner ausgesprochenen physischen und vor allen psychischen Widerstandsfähigkeit ist es zu verdanken, dass er ohne bleibende Schäden aus dem Traumzustand herauskam.
Im Laufe seiner Ausflüge, lernt er sich dementsprechend zu bewegen, sodass eine Rückkehr jederzeit sicher stattfindet.
Jedesmal beginnt die Vergangenheits-Reise am selben Ort. Es ist fast wie ein alter dicker Wälzer, dessen Buchrücken durch das Aufschlagen immer der selben Stelle gebrochen ist. Man wird sich vergeblich mühen, nicht diese Seite aufzuschlagen.
Sei es, wie es sei – da muss er durch! Mit der Zeit hat er es soweit in Griff, dass er sich frei bewegen kann. Speziell gelingt es bestimmte Orte aufzusuchen, ohne den erwähnten Startpunkt. Je öfter Nayati seine Ausflüge unternimmt, umso sicherer wird er.
In den arimeanischen Annalen findet der Gewahrer wichtige Hinweise auf die politisch-gesellschaftlichen Gegebenheiten. Ein äußerst friedfertiges Volk, keine Kriege untereinander. Evolutionär gab es bereits anfangs einen elementaren Sprung zur Intelligenz. Kaum Tierarten, dafür jedoch Abertausende Arten von Pflanzen.
Eine seltsame Welt! Nicht vergleichbar mit der hiesigen, in der das Leben ebenfalls sprießt und gedeiht, aber in der Vielfältigkeit in nichts nachsteht. Dennoch würde er niemals tauschen wollen…
Eine Sache beschäftigt ihn am meisten. Nach der Prozession wechselt das Geschehen stets ins dunkle, kalte Weltall, dessen Leere von einem umherirrenden Asteroiden seltsamen Materials ausgefüllt wird. Bruchstücke umkreisen ihn, die aber aus ganz normalen Gestein und Eisklumpen besteht, also nicht seine ursprüngliche Materie entspringt. Es verschafft ihm Kopfzerbrechen. Weder ist erkennbar, woher der Asteroid stammt, noch wohin die Reise geht. Und doch taucht er immer wieder auf.
Als Ausgleich unternimmt er ausgiebige Spaziergänge. Die Insel ist dafür prädestiniert und eignet sich hervorragend, auf andere Gedanken und den Kopf frei zu kommen.
Geraschel von allen Seiten. Auch nach den vielen bisherigen Besuchen, stellen sich bei all dem Geräuschwirrwarr immer noch sämtliche Nackenhärchen auf. Wer kann schon sagen, was sich da gerade in unmittelbare Nähe hinter all dem Pflanzengrün verbirgt und vielleicht nur auf eine günstige Gelegenheit wartet? Solche Gedanken sind nur schwer verdrängbar!
Er atmet auf, als alles ruhig bleibt.
Aber ist wirklich alles so ruhig?
Nayati verharrt mitten in der Bewegung. Im Pflanzenschatten bewegt sich etwas. Er hält die Luft an. Sein langer Blick lässt bald die Augen brennen, so angestrengt starrt er auf besagter Stelle. Für den Moment kann er nichts ungewöhnliches ausmachen.
Beruhigt geht er an den von leichten Wellen umspülten Strand zurück. Das Wasser ist warm, kühlt kaum seine nackten Füße ab. Im Schatten eines potameia crassifolia lässt er sich mit einem argwöhnischen Blick Richtung mysteriösen Schatten nieder. Etwas ist dort! Seine indianischen Wurzeln lassen sich diesbezüglich nicht ohne weiteres täuschen.
Leichter Wellenschlag macht ihn müde. Es dauert nicht lang und seine Lider werden schwer. Auf der Stelle driftet er in einen unruhigen Schlaf.
Ein lauter Knall, einhergehend mit spürbarer Bodenvibration, bringt ihn wieder zu sich. Von der idyllischen Ruhe ist nichts mehr übrig. Er springt auf.
Leichte Erdstöße bringen die Bäume zum Wanken. Aus den kleinen Wellen sind halbmannshohe Brecher geworden. Von überallher rumort und grummelt es gefährlich. Vergessen ist die geschätzte und beschauliche Ruhe, die diesen Landstrich so auszeichnet. Damit scheint es vorbei.
Schnell nimmt er die Lage in Augenschein. Durch den dichten Dschungel ist es unmöglich, weiter ins Landesinnere zu sehen. Das anhaltende Rumoren deutet auf einen Vulkanausbruch hin.
Ohne weiter darüber nachzudenken, rennt er los. Die einzige Möglichkeit, Nosy Be zu verlassen, ist das alte arimeanische Glasgefährt. Dieses Artefakt ermöglicht dem Gewahrer, ziemlich frei in Raum und Zeit zu bewegen und ist das Vermächtnis seines Vorgängers. Nun gilt es, das Fortbewegungsmittel rechtzeitig zu erreichen, sonst käme er niemals mehr von hier fort.
Für einen Moment verliert Nayati die Orientierung. Alles herum schwankt eigenartig und ihm wird schwindlig. Der gesamte Dschungel ist in Aufruhr. Hektisches Geflatter und Gekreische weht heran. Äste brechen. Obwohl er nichts sehen kann, ist die drohende Gefahr deutlich spürbar. Vogelschwärme verdecken daraufhin den Himmel. Es wirkt wie ein warnender Fingerzeig, die Insel endlich zu verlassen.
Bis zum arimeanischen Gefährt sind es weniger als hundert Schritt. Unter einem Riesenbaum, eines canarium madagascariense, hat er es sicher abgestellt; dachte er jedenfalls, denn durch die ruckartigen Erdbewegungen stellt es sich nun als nicht ungefährlich dar. Einzelne Verwerfungen machen aus dem vorherigen Trampelpfad einen abenteuerlichen Parcours.
Er rennt los. Hinter ihm tobt das Meer, es kocht regelrecht. Die Brandung nimmt dramatisch zu. Und das unterirdische Rumoren wird ebenfalls stärker.
Der Gewahrer kommt ins Stolpern. Er versucht auszubalancieren, was ihn jedoch angesichts eines weiteren Erdstoßes nur halb gelingt. Hart wird er aus der Bahn geworfen und prallt mit einem dicken Ast zusammen, der ihn den Atem raubt. Er hält er sich die schmerzende Brust, japst wie ein des Wassers beraubter Fisch.
Abermals baut sich innerhalb Nosy Bes Spannung auf. Dann setzt urplötzlich Stille ein. Kein Laut dringt zu ihm. Schlagartig soll alles vorbei sein?
Benommen geht er langsam weiter. Überwindet einen umgestürzten Baum, der das Glasgefährt nur um Haaresbreite verfehlt hat. Etwas stimmt nicht! Er kann es fühlen. Aber er kommt nicht darauf. Im Inneren des Gefährtes ist alles so, wie er es verlassen hat. Trotz des beschränkten Platzes finden sich mehrere Kisten an Bord, die die gesamte Rückwand verdecken. Wichtige Dinge, auf die er nicht verzichten mag.
Nayati nimmt dazwischen Platz. Draußen hält die absonderliche Ruhe an. Sogar der Wind ist verstummt. Eigentlich könnte er auch hierbleiben. Ist ja nichts passiert und wie es aussieht, wird auch nichts passieren. Aber mit der Ruhe ist es vorbei. Und er glaubt zu ahnen, dass sie so schnell nicht wiederkehren wird.
In dunklen Gedanken versunken, leitet er den Startvorgang des Zeittransmitters ein. Er wird das Gebiet überfliegen, um seine Neugierde zu besänftigen, bevor er in die eigene Zeit zurückkehrt. Er hasst es, wenn Unklarheit herrscht.
Lautlos umhüllt das Gefährt der Energie-Schutzschirm. Die Zeichenfolge eingebend, lässt er die letzten Augenblicke noch einmal Revue passieren. Dann löst er sich ins Nichts auf.
Zwei
Vereinigtes Königreich, Gegenwart.
In klaren Nächten leuchten die Sterne am Firmament besonders eindrucksvoll. Natürlich sollte man sich außerhalb des Lichtsmogs befinden, der in der Welt in sämtlichen Großstädten den Genuss derartiger Beobachtungen stark schmälert, wenn nicht gar gänzlich unmöglich macht. Was die Wenigsten wissen, sind in Stadtnähe gerade einmal zweitausend Gestirne zu sehen; gerade Mal ein Drittel aller außerhalb der Ballungsgebiete Sichtbaren. Sternenfreunde suchen deshalb höher liegende Gegenden auf. Von den Einen als Eigenbrötler und Träumer belächelt, gelten sie bei den Anderen als Kenner himmlischer Darstellungen.
Auf Olivia trifft wohl letzteres zu. Sie liebt alles was mit Sternen zu tun hat. Seit Kindheitstagen an. Interessiert lauschte sie, wenn Dad ihr Geschichten erzählte. Davon konnte Klein-Olivia nie genug bekommen! Manchmal schaffte sie es, dass Dad noch eine zweite Geschichte anhing. So wurden aus der Gute-Nacht-Geschichte des Öfteren und zum Leidwesen Moms mehrere Stunden, in denen Dad seiner Fantasie freien Lauf ließ. Sogar ihren Freundinnen schwärmte sie vor, und Olivia ließ nicht locker, bis Dad endlich einwilligte, an einem Sonntagnachmittag die Kinder mit seinen Geschichten berieselte.
Benjamin teilt nur halbherzig ihre Vorliebe. Er hört Olivia zu, was in einer Ehe schon mal vorteilig ist. Das war’s dann aber auch schon. Deswegen geht sie abends gerne allein spazieren. Dann ist sie frei – so wie damals, als kleines Mädchen und kann ungezügelt ihren Träumen nachgeben.
»Ein Lichtpunkt ist eine ganze Galaxy«, flüstert Olivia kaum vernehmlich.
Vom Horizont nähern sich Wolken.
›Kein guter Abend‹, findet sie. ›Wird ein sehr kurzer Spaziergang heute.‹
Die Sterne flackern im Dunst der Atmosphäre. Manche sind klitzeklein und fast nur zu erahnen. Andere hingegen wirken groß und greifbar. Die Großen sind Planeten, weiß Olivia. Venus zum Beispiel – die römische Liebesgöttin, der Schönheit und des erotischen Verlangens. Doch Venus ist auch als Morgen- beziehungsweise Abendstern bekannt. Früher war den Menschen nicht bewußt, dass es sich bei beiden um das ein und dasselbe Gestirn handelte.
Für heutige Verhältnisse, in denen die Mythologie eine eher untergeordnete Rolle spielt, klingen solche alten Geschichten ziemlich weit hergeholt und wie aus einer anderen, Lichtjahre entfernten Welt. Dabei wird allerdings immer vergessen, dass es sich dabei um die gleiche Welt handelt, nämlich der Erde.
Unzählige Geschichten ranken sich darum, deren Inhalte geprägt sind von kulturellen und glaubensabhängigen Hintergründen. Jede Zeit hat ihren Glauben. Olivia lächelt. Sie selbst ist weder gläubig, im herkömmlichen Sinne, noch verteufelt sie Konfessionen von Grund auf. Wenn sie ganz ehrlich ist, dann stimmt das jedoch nicht wirklich. Eigentlich glaubt Olivia schon an etwas: Moderne Wissenschaft! Dadurch wurde der symbolische Horizont des Tellerrandes arg erweitert und die Sicht auf die Dinge haben sich grundlegend geändert.
Mein Gott! Früher wäre Olivia als Ketzerin verurteilt und auf den Scheiterhaufen verbrannt worden! Die kurze Eingebung versetzt sie in Angst. Ohne es zu wollen, schaut sie sich irritiert um. Keiner da! Allerdings will ihr nicht der sprichwörtliche Stein vom Herzen fallen. Von Erleichterung momentan also keine Spur!
Inzwischen treibt ein stärker werdender Westwind die dunklen Wolken weiter heran. Zusehends zieht sich der Himmel zu. Gedankenbeladen tritt Olivia den Heimweg an.
Im Hause Latham brennt im Dachgeschoss ein Licht. Karoline bleibt über Nacht bei einer alten Freundin. Somit ist Waylon allein zuhause. Die Abende verbringen sie in gemütlicher Zweisamkeit; ein Privileg, welches es gelang, über all die Jahre zu erhalten. Doch an Abenden wie diesen verbringt der rüstige Senior meistens die Zeit damit, in alten Tagebüchern zu blättern.
Das Geschriebene versetzt Waylon in eine Zeit zurück, an die er sich kaum erinnern kann. Eigentlich fehlt jegliche Erinnerung! Jedesmal, wenn er die abgegriffenen Kladden in Händen hält, hat er den Eindruck, dass was da steht noch nicht gelesen zu haben. Dabei hat Waylon mehrmals von dieser eigenwilligen Lektüre Gebrauch gemacht.
Voll vertieft und die Stirn in tiefe Falten gelegt, liest er Wort für Wort. Manches muss er erst entziffern; dann flucht er innerlich über seine damalige ›Klaue‹. Alles in allem kommt es Waylon wie ein Bericht aus einer anderen Welt, mindestens jedoch eines anderen Lebens vor.
«In meinen kühnsten Träumen vermochte ich mir nie solch einen grandiosen Anblick vorstellen. Die Gänsehaut breitet sich wohlig aus und ich bin den Tränen nah.
»Dieser winzige Punkt ist Zartak«, erklärt Dako. »Das Zentralgestirn in diesem System.«
Es klingt stolz aus seinem Mund. Wahrscheinlich weiß er es selbst noch nicht so lang. Egal. Nicht die Namen sind wichtig, sondern der atemberaubende Anblick.
Old Way – so habe ich beschlossen, mein älteres Ich zu nennen und auch anzusprechen (ihm scheint es zu gefallen) –, wirft nur einen kurzen Blick zum Bildschirm, so, als interessiere es ihm nicht. Viel später erst werde ich begreifen, dass er durch meine Augen sieht, hat Old Way mir begreiflich gemacht. Heute verstehe ich es nicht. Auch unwichtig, irgendwie. Denn er hat bewiesen, dass die Erzählungen wahr sind.»
Er schaut auf. Älteres Ich? Zartak? Unwahrscheinlich, dass stimmt, was da steht! Klingt wie ein fadenscheiniger Entwurf zu einem Science-Fiction-Roman. Waylon legt die Kladde weg. Dies würde ja heißen, er war irgendwann da gewesen. Indiskutabel! Und noch nicht einmal ein Datum ist zu finden.
Verstört ergreift Waylon die Kladde erneut. Jede Seite einzeln durchblätternd sucht er nach eventuellen Hinweisen. So richtig allerdings ist er nicht bei der Sache. Ein Gedanke spukt durch seinen Kopf.
Von sich selbst Besuch bekommen! Das hat was! Und so fremd ist der Gedanke nun auch wieder nicht. Früher hat er sich das öfters vorgestellt und als witzig empfunden. Das ist lange her – verdammt lange …
«Sobald ich die Augen schließe, erwachen die Alpträume. Dann sehe ich immer die schemenhafte Umrisse des dunklen Turms. Sicht und Atmung fallen schwer; es scheint unmöglich zu sein, in dieser brodelnden Hölle zu überleben.»
Nachdenklich klappt Waylon das Buch zu. Der letzte Eintrag erschaudert ihn regelrecht – und das jedes Mal. Die Gänsehaut erfasst den gesamten Körper. Er presst die Augenlider zusammen, hält den Atem an. Dann versucht er gleichmäßig ein- und auszuatmen. Bald beruhigt er sich wieder.
Das Telefon läutet. Abwesend sucht Waylon das Mobilteil, kann es jedoch nirgends sehen. Ein Blick auf die Uhr verrät ihn, dass es nach neun Uhr Abends ist.
»Wer ist das denn jetzt«, brummt er mürrisch vor sich hin.
Der Anrufer ist einer von den Hartnäckigen, die nicht so leicht aufgeben. Das nervt!
Langsam setzt er sich in Bewegung und folgt dem Klingeln. Durch die Deckenluke hört er es unten im Flur. Mit Wut im Bauch steigt Waylon die Klappleiter hinab.
»Hat man denn niemals seine Ruhe«, brummelt er.
Ein Fuß verfehlt eine Holzsprosse und tritt ins Leere. Gerade noch kann sich Waylon festhalten. Dabei macht sein Knie die Bekanntschaft mit einem Querholz.
»Verdammt«, zischt er vor Schmerz.
Währenddessen läutet das Telefon unvermindert weiter.
»Ja, ja.«
Solchen Leuten gehört es verboten, ein Telefon zu haben! Die haben keinen Anstand und scheuen sich nicht, braven Mitmenschen deren wohlverdiente Ruhe zu gönnen!
Im unteren Flur angekommen sieht Waylon schon von Weitem das Telefon, deren Display blau leuchtet. Prüfend schaut er darauf.
»Keine Nummer?!«
Er ist gewillt, den Anruf zu ignorieren. Doch irgendetwas sagt ihm, es könne wichtig sein.
»Latham hier!«
»Schon wieder Juli«, sagt Benjamin, und es klingt ein wenig wehmütig.
»Ja, die Zeit rennt«, entgegnet Olivia. »Irgendwie ist alles so kurzlebig.«
Beide sitzen auf der Terrasse.
»Gerade noch saßen wir hier alle zusammen und haben das Neue Jahr begrüßt.«
Olivia nickt.
»Dad gab seine Geschichten zum Besten …«
Sie lachen.
»Wo nimmt er nur alles her?«
»Er hat eben seine kindlich überschwängliche Fantasie sich bewahrt. Das war schon immer so.«
»Den Kindern gefällt’s, dass ist die Hauptsache.«
»Mir auch, Ben.«
»Ich sag ja nicht …«
»Was?!« Olivia wirkt angespannt.
»Ich find es ja toll …«
»Aber?!«
»Manchmal wirkt es … aufgesetzt …«
Sie setzt sich aufrecht hin und verschränkt die Arme.
»Aufgesetzt …«
»Ich weiß auch nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Mir fällt kein besserer Ausdruck ein.«
Olivias Gesicht ist wie versteinert. Ihr Blick wird bohrend.
»Du magst meinen Dad nicht, gib’s doch zu!«
»Quatsch. Dreh mir doch nicht das Wort im Mund rum.«
»Ach, jetzt bin ich wieder Schuld!«
»Nein, Liv. Das hab ich doch nicht gesagt …«
»Aber gedacht!«
Benjamin atmet hörbar durch. Es ist komisch, wie aus einer so daher gesagten Plattitüde ein handfester Streit entbrennen kann. Ein banaler Auslöser – mit fatalen Folgen. Der gemütliche Teil des Abends jedenfalls ist vorbei.
Zur Bestätigung klingelt auch noch Olivias Handy.
Waylon glaubt den Boden unter den Füßen zu verlieren. Das, was er soeben erfahren hat, verschlägt ihn die Sprache. Er wankt bedenklich. Sein Blutdruck steigt, ihm wird übel. Das Blickfeld wird von winzigen, flirrenden Lichtpunkten in der Netzhaut stark eingeschränkt.
Er steht unter Schock!
Es will ihn nicht so recht in den Kopf, was der Anrufer gerade behauptet hat. Waylon kennt dessen Stimme, oder glaubt sie zu kennen. Plötzlich ist alles anders. Seine Gefühlswelt wurde von einem auf den anderen Moment auf den Kopf gestellt. Die massive innere Unruhe macht ihn nervös und anfällig. Ein Satz prangt drohend in feurigen Lettern am geistigen Horizont Waylons. Wider jeglicher Vernunft und Logik ertönt gleichzeitig hallend die Anruferstimme, mit immer denselben Worten.
»Der ahbleza ist tot!«
Auf den ersten Blick betrifft es Waylon nicht. Er weiß noch nicht einmal, was ein ahbleza sein soll. Dennoch versetzt diese Aussage sein Inneres erdbebenartig in einen unbeschreibbaren Zustand.
Der schrille Schrei kommt aus dem Wohnzimmer. Benjamin springt auf und stürzt ins Haus. Zu seinem Entsetzen findet er Olivia zusammengesunken auf der Couch liegend vor. Er eilt zu ihr.
»Livia, was ist mit dir …«
Sie stöhnt erschreckend laut. Äußere Anzeichen einer Verletzung gibt es nicht, die ihren Zustand erklären. Hat das etwa mit dem späten Anruf zu tun?
»Livia. Sag was!«
Ihre Stirn ist fiebrig heiß. Kalter klebriger Schweiß überzieht die Haut. Zudem ist sie unnatürlich bleich.
»Olivia!«
Er schüttelt sie. Panische Angst ergreift ihn. In diesen Augenblick reißt Olivia die Augen übermäßig weit auf.
Drei
Es ist so weit: Zum ersten Mal betritt Nayati den Boden Uridräos. Durch die perfekten Beschreibungen seines Vorgängers findet er sich gut zurecht. Der alte arimeanische Stützpunkt ist rasch gefunden und der Zugang geöffnet. Der greise, scheidende Mann hat jedes kleine Detail so plastisch beschrieben, dass es Nayati nun leichtfällt, sich zu orientieren. Zielsicher schlägt er eine bestimmte Richtung ein.
Sein Interesse gilt der überwältigenden technischen Überlegenheit der Außerirdischen. Eigentlich ist er selbst auf diesem Mond ein Außerirdischer, was jedoch absolut nichts an der Sachlage ändert. So rasch ihn seine Füße tragen, folgt er dem unterirdischen Weg, der ihn direkt ans Ziel führen wird.
Von der magisch wirkenden Wandbeleuchtung beeindruckt, überkommt ihn jetzt doch ein erhebendes Gefühl. Wenn man sich vorstellt, dass alles von jemanden erbaut worden ist, den es seit Jahrtausenden nicht mehr gibt, wird man automatisch demütig gegenüber der Vergänglichkeit.
Seine Schritte werden abrupt langsamer. Die Lichtdarstellungen sind verdammt plastisch und wollen den Betrachter mit sich ziehen. Für menschliche Begriffe einfach nur wunderschön! So etwas gibt es auf der Erde nicht. Die fremde Zivilisation ist denen der Menschen weit voraus; und das zu einer Zeit, in der wahrscheinlich der erste Primat auf der Erde noch auf den Bäumen lebte.
Nayati bleibt stehen. Das dreidimensionale Bildnis erinnert an etwas. Zugegeben: Von solchen Dingen hat er keine Ahnung. Dennoch glaubt er, zu kennen, was er da sieht …
Zaghaft geht Nayati weiter, ohne den Blick abzuwenden. Im Tunnel herrscht eine mysteriöse Atmosphäre, die durch türkisfarbenes Licht noch verstärkt wird. Während Nayatis Schritte von den Wänden zurück hallen, dringt ein Grundgeräusch an sein Ohr. Erneut bleibt er stehen. Es ist ein dumpfer, tiefer Ton, der von überallher kommt. Die Luft vibriert; Nayati kann die Luftmoleküle deutlich spüren. Er schließt die Augen, saugt den Augenblick auf und gibt sich ihm mit jeder Faser seines Körpers hin. Eine Weile verharrt Nayati, dann steigt er bedächtig die schmalen Stufen hinauf.
Trotz des fahlen, indirekten Lichtes, das von den Wänden ausgeht und unaufdringlich den Gang erhellt, reicht es aus, um die Unebenheiten des Bodens auszumachen. Inzwischen ist der tiefe Ton verstummt. Überhaupt ist es sehr still geworden, sogar die eigenen Schritte haben den hallenden-klappernden Klang verloren.
Der Öffnungsmechanismus der steinernen Geheimtür setzt sich schleifend in Gang, nachdem Nayati den Öffnungscode eingegeben hat. Mit Spannung beobachtet er, wie der Fels rappelnd zur Seite gleitet und die Sicht freigibt. Und da steht er nun inmitten arimeanischer Technik.