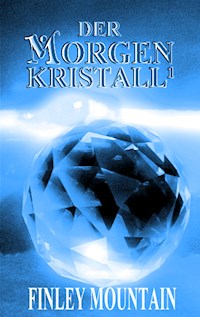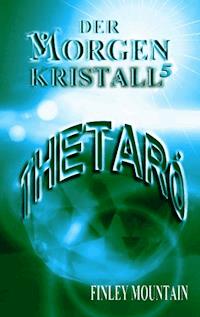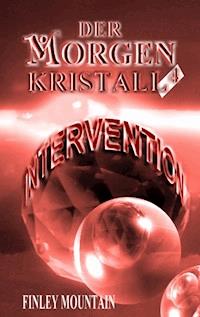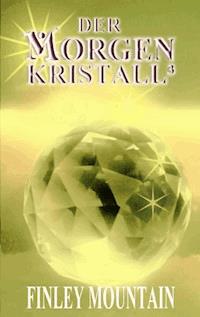
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Morgenkristall
- Sprache: Deutsch
Waylon ist dem Untergang des Stützpunktes auf Uridräo in letzter Sekunde entkommen. Zurück auf der Erde wird ihm schon bald klar, dass sein Plan nicht ausführbar ist. Zudem taucht Mr Dako auf, der ein Geheimnis mit sich trägt, das so einiges auf den Kopf stellen wird. Nachdem Waylon in sein altes Schema zurück fällt, fühlt sich Karoline von Unbekannten bedroht. Hilfesuchend wendet sie sich an Waylon. Vor einem geplanten Abendessen, zu dem auch Elionor und Sophie eingeladen sind, macht Waylon eine unglaubliche Entdeckung. Was seine neuerlichen Visionen, ein altes Foto und uralte Legenden damit zu tun haben, wird im dritten Band des Morgenkristalls erzählt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 263
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Buch
Waylon ist dem Untergang des Stützpunktes auf Uridräo in letzter Sekunde entkommen. Zurück auf der Erde wird ihm schon bald klar, dass sein Plan nicht ausführbar ist. Zudem taucht Mr Dako auf, der ein Geheimnis mit sich trägt, das so einiges auf den Kopf stellen wird. Nachdem Waylon in sein altes Schema zurück fällt, fühlt sich Karoline von Unbekannten bedroht. Hilfesuchend wendet sie sich an Waylon. Vor einem geplanten Abendessen, zu dem auch Elionor und Sophie eingeladen sind, macht Waylon eine unglaubliche Entdeckung. Was seine neuerlichen Visionen, ein altes Foto und uralte Legenden damit zu tun haben, wird im dritten Band des Morgenkristalls erzählt.
Der Autor
FINLEY MOUNTAIN wird 1965 geboren. Seine Liebe zu Büchern findet er in alten Klassikern, darunter auch Kurt Laßwitz und Jules Verne. Durch einen Comic kommt er zum Schreiben. Zeichnet er anfangs noch seine Charaktere, stellt er jedoch bald fest, dass ihm das Wort besser liegt. So entstehen erste, zaghafte Versuche. Unter Pseudonym veröffentlicht er im Internet Anfang 2000 zahlreiche Texte. Mit dem Morgenkristall legte er 2014 sein Debüt in der Fantasy-Literatur vor, die mit dem vorliegenden dritten Teil nun seine Fortsetzung findet.
HANDLUNGEN UND PERSONEN SIND FREI ERFUNDEN.
JEDE ÄHNLICHKEIT IST REIN ZUFÄLLIG UND UNBEABSICHTIGT.
Inhaltsverzeichnis
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Die Geburt
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
Neunzehn
Zwanzig
Einundzwanzig
Zweiundzwanzig
Dreiundzwanzig
Vierundzwanzig
Fünfundzwanzig
Sechsundzwanzig
Siebenundzwanzig
Achtundzwanzig
Neunundzwanzig
Der Erste seiner Art
Epilog
Eins
In der Nähe des Piers schleicht seit einiger Zeit ein älterer, seltsam gekleideter Mann herum. Anscheinend erwartet er jemanden. Er macht nichts außer still herumzustehen. Seinen Kopf ziert ein ebenso alter Hut mit weicher Krempe. Von Wind und Wetter verfilzt, bietet er gerade Mal ausreichenden Schutz vor der Sonne. Er trägt einen langen, durchlöcherten Mantel und abgetretene Schuhe. Nur das Oberhemd und die Hose sind von besserer Qualität, die sich nur die obere Schicht leisten kann. Sorgsam scheint er darauf bedacht zu sein, die Kleidung durch den Mantel bedeckt zu halten. Der Fremde raucht, zündet sich zu jeder vollen Stunde eine Zigarette an. Sein linkes Armgelenk ziert ein unbekannter Band aus unbekannten Materialien. Bevor eine Zigarette entzündet wird, schaut der mysteriöse Fremde darauf, als würde er die Uhrzeit ablesen. Dafür gibt es allerdings Taschenuhren. Nur einem aufmerksamen Beobachter würde es auffallen, dass er anders ist. Da sich aber in diesen Teil des Hafens so manches übles Gesindel herumtreibt, fällt er nur durch seine Erscheinung auf.
Ein Einspänner rast rappelnd heran. Der Kutscher reißt die Zügel an und es bremst abrupt ab, sodass die Hufe Staub aufwirbeln. Das Pferd schnaubt heftig, wirft dabei den Kopf auf und ab. Mit einem Sprung landet der Kutscher neben dem Wagen, führt das Pferd zur Tränke.
Der Fremde behält den Ankömmling im Auge, bis dieser in einer Tür verschwindet. Gelassenen Schrittes geht er zu dem Pferd, das ausgiebig säuft. Es muss eine anstrengende Wegstrecke im Galopp zurückgelegt haben, so sehr transpiriert es. Der Fremde streicht dem Tier sanft über den Hals. Es ist ein wohlgenährter Hengst, höchstens zwei Jahre alt. Mit diesem Prachtexemplar von einem Pferd, könnte man einiges anstellen.
»Hey Fremder, lass deine dreckigen Pfoten von dem Gaul, klar?!«
Der Angesprochene ignoriert ungerührt die drohende Ansprache.
»Ich sagte, Pfoten weg!«
Langsam wendet der Fremde nun doch seinen Kopf.
»Sprichst du mit mir, Boy?«
Jetzt wird der Kutscher noch böser.
»Ja – du dreckiger, stinkender Kojote!«
»Man darf doch sicher ein so wunderschönes Tier bewundern, oder etwa nicht, Boy?«
»Aber klar doch! Nur nicht anfassen, das kostet …«
»Wieviel?«
Sichtlich irritiert blinzelt der Kutscher den Fremden an. Dessen unverfrorene Frechheiten nerven und imponieren zugleich.
»Suchst du Arbeit …«
»Ich warte.«
»Auf was? Den morgigen Tag? Oder das ein reicher Kaufmann vorbeikommt?«
»Nichts von alledem, Boy.«
»Du gefällst mir, Fremder. Zeigst Mut, lässt dich nicht einschüchtern. Wo kommst du her?«
»Von weither, Boy.«
»Gesprächig bist du nicht gerade, Mister. Gefällt mir.«
Der eiserne Blick des Fremden haftet auf ihn.
»Also gut, darfst den Hengst berühren. Kostet dich keinen Penny, Mister. Dafür passt du aber gut auf ihn auf, während ich meinen Geschäften nachgehe …«
»Was zahlst du?«
»Mann, du verlierst wohl nie die Fassung! Six Pence?«
»Okay.«
»Abgemacht!«
Ein prüfender Blick und der Kutscher betritt erneut das Lager. Als er eine Dreiviertel Stunde später wieder herauskommt, findet er nur noch den Wagen vor. Sein Pferd und der Fremde waren verschwunden …
Mitten im Wald, nur wenige Minuten von der Straße entfernt, hat der Fremde Posten bezogen. Wer sich immer dem Pier nähert, muss unweigerlich an dieser Stelle vorbei. Es dürfte ihm niemand entgehen!
Die betreffende Person, auf der er seit mehr als zwei Wochen wartet, sollte bald auftauchen. Oder hat er sich so sehr in der Zeitangabe geirrt? Seit Mitte August beobachtet er diesen Landstrich nun. Nicht leicht, wenn Land und Menschen unbekannt sind und auch die Mentalität von der Seinen stark abweicht.
Doch er hat keine andere Wahl! Er muss es tun! Vieles hängt davon ab. Nein, überlegt er. Alles hängt davon ab! Der Auftraggeber scheint vielwissend und sehr weise zu sein. Als dieser auftauchte erschrak er nicht wenig. Bereits die Kleidung jagte ihm Angst ein. Nicht der Mode entsprechend, wirkte sie – wenn auch leger und locker – nicht bisherigen Gepflogenheiten zugehörig. Stoff und Schnitt schienen nicht von dieser Welt!
Ebenso die Sprache, in denen einige Ausdrücke ihm vollkommen unbekannt waren!
Der Fremde stellte sich ihm als Aylon vor. Er saß am Strand, auf dem Findling, und genoss neben der Ruhe auch den fantastischen Sonnenuntergang. Seit Monaten ging das so. Auf diese Weise entfloh er dem trägen Trott und entzog sich dem längst eingeschliffenen nichtsnutzigen Alltagsleben.
Vier Monate vor dem Aufeinandertreffen beider, trennte sich seine Jugendliebe von ihm. Verheiratet waren beide nicht, lebten mehr oder weniger in ›Wilder Ehe‹. Sie beharrte darauf, wie er anfangs auch, auf eine offene Beziehung. Bald merkte er, wie sehr er darunter litt. Und irgendwann, nach vielen Jahren stummen Ertragens, zog nicht er, sondern sie die Reißleine. Ende der Siebziger Jahre des einundzwanzigsten Jahrhunderts, genoss man das Leben in vielfältigerer Form, als noch zehn Jahre früher.
Nach der Flower-Power-Zeit herrschte in weiten Teilen der Gesellschaft Aufbruchsstimmung. Jobs fühlten sich sicherer an, neue Technologien verhießen eine rosige Zukunft, die Wirtschaft boomte. Für Politik hatte er keinen Nerv. Die Atomgegner empfand er als lästig, Wahlkämpfe gingen ihm sonstige vorbei und die Russen sollten doch machen was sie wollten! Vielmehr interessanter war die Lebensweise, die durch harte Arbeit bezahlbar geworden ist. Keine Luxusgüter oder ähnliches Gedöns – nein, sein Lebensgefühl fand Anerkennung in den unzähligen, aus den Boden sprießenden Unterhaltungsräumlichkeiten, mit modernem Pop, Beat oder den ersten Zuckungen des Technos.
Dort fühlte er sich richtig wohl. Lernte die tollsten Weiber und die schrägsten Typen kennen. Den ersten Schuss erhielt er hier genauso, wie seinen ersten Quickie. Beides Ausnahmeerscheinungen, die keiner Wiederholung bedurften. Es folgte zwar später ein Blind-Date, doch die Phase des Erwachens versetzte ihn einen Knacks fürs Leben! Wochenlang danach noch hatte er Alpträume.
Gefangen im Strudel selbstgewählter Gefälligkeiten, geriet er immer weiter in dessen Sumpf anstatt aus eigener Kraft herauszukommen. Fehlte ihm etwa der Mut? Eher der Antrieb hierzu! Und der Typ Mann ist er auch nicht – noch nie gewesen! –, der eigene Analysen anstellt und sie von allen Seiten her beleuchtet. Dafür ist ihm seine Lebenszeit zu kostbar.
Darum war der Fremde eine willkommene Abwechslung. Darum ließ er sich ein auf dieses mysteriös geheimnisvolle Angebot. Was hätte das Leben auch sonst bieten können? Weitere Sinnlosigkeiten, die nur Geld und Zeit kosten, aber ansonsten nichts wirklich Wichtiges?
Von nun an trafen sie sich jeden Tag, an dem der Fremde über Dinge sprach, die aus einem Georg-Lucas-Film hätten stammen können. Gebannt hörte er zu, sog alles auf. Wissbegierig wie ein zehnjähriger Junge lauschte er den Geschichten.
Und was das für Geschichten sind! Utopisch im Klang, erzählte Aylon mit einer Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit, dass alles in Wahrheit genauso sein kann. Nur der Verstand wehrte sich. Als moderner Mensch aufgeklärt und durch Wissenschaft und Technik im Handeln geführt, konnte er dem Fremden ideell und geistig folgen. Dennoch – ein Hauch von Science Fiction blieb.
Jeweils am Ende ihrer Treffen ging Aylon ohne einen Gruß. Nicht einmal eine Verabredung für den nächsten Tag wurde getroffen. Und doch trafen sie aufeinander, gleiche Zeit, gleiche Stelle. Zufall konnte dies keiner mehr sein; spätestens nach dem dritten Tage. Denkt er jetzt zurück, dann kommt es ihm eher vor, als habe der Fremde ihn auserkoren. Nur für was?
Aylon kam ihn als ›normal‹ rüber. Er schätzte den Fremden auf Ende fünfzig. So genau kann er es nicht sagen. Austrainiert und fit machte der einen passablen Eindruck. Ob er sich selbst ebenso in diesem Alter fühlen wird?
Am siebten Tag wartete er vergebens auf den Fremden. Auch nachdem die Sterne den Himmel erobert hatten, tauchte er nicht mehr auf. Die Geschichtenstunden waren zur Gewohnheit geworden, und er ein neugieriger, aufmerksamer Zuhörer. Ihm fehlte etwas. Er schlief schlecht, wälzte sich von einer auf die andere Seite. Verkatert und unausgeschlafen begann der neue Tag dann auch noch verregnet.
Es war genau so ein Tag, an dem man lieber die Zudecke über den Kopf zieht und liegen bleibt. Morgens schnitt er sich beim rasieren und das Blut floss seiner Meinung nach in Strömen. Beim Zähneputzen verschluckte er noch eine Borste, die sich weder heraus würgen noch schlucken ließ. Der Toast verbrannte, verräucherte Küche und Flur mit versengtem Teiggestank. Ein Knopf vom Hemd sprang widerstrebend irgendwo hin, der Schnürsenkel riss. – Das Essen fiel aus, ein Poloshirt tat's auch und in Sandalen verließ er das Haus. Ein fast normaler Tag also.
Eigentlich hätte er nicht gehen brauchen, doch ein Tag Fehlzeit wollte er sich nicht leisten. Schließlich brauchte er das Geld. Hatte einiges vor in diesem Jahr. Was genau kann er jedoch noch immer nicht in Worte fassen.
Nach den ersten Metern hatte er bereits klitschnasse Füße, getränkt vom Regen und rücksichtslos fahrenden Autos. Die schienen geradewegs durch Wasserläufe und Pfützen zu steuern, wie ein fanatischer Jäger Enten abknallt. Ein hinkender Vergleich, doch ihm war danach.
Optimistisch nach vorn schauen gelang ihm gar nicht. Das Einzige, was heute auf Anhieb klappte, war nass zu werden. Und um die Mittagszeit fühlte er sich so schlapp und müde, dass er doch wieder nachhause ging.
Kopf und Glieder schmerzten. Sich der nassen Klamotten entledigend, sprang er unter die Dusche, rutschte fast noch aus. Genervt schalt er sich einen Tölpel.
Im Bademantel schlief er auf der Couch sitzend, den Kopf schräg Bach hinten abgeknickt, ein. Vom eigenen Schnarchen aufgeweckt, verhinderte eine unendliche Schläfrigkeit den dementsprechenden Stellungswechsel. Im Schlaf fantasierte sein Hirn, gaukelte ihm imaginäre Feinde vor, zwang ihn in den freien Fall. Haltlos ging's bergab. Die Welt geriet ins Wanken, fiel um, riss ihn mit. Schweißüberströmt röchelte er im umnachteten Zustand vor sich hin; noch immer den Kopf abgeknickt.
Abrupt endete der freie Fall, jedoch nicht schlagartig und schmerzhaft, wie man vermuten könnte. Auch landete er nicht. Stattdessen eröffnete sich ihm ein ganz anderes Bild, auf dem er ging. Diesmal wusste er sofort, wo er sich befand und wo es hin ging – in die Schule!
Lachend betrat er das alte Gebäude, ging zielstrebig in den Klassenraum, nahm Platz. ›Die Sonne blendet heute besonders stark‹, dachte er bei sich. Blinzelnd holte er aus dem abgenutzten Ranzen Buch, Heft und Stift-Mappe heraus. Der Schein der Sonne störte. Schützend mit der Hand die Augen abschirmend, blätterte im Schulheft und war sichtlich stolz, die Hausaufgaben gelöst zu haben. Kam nicht oft vor!
›Diese doofe Sonne!‹
Extreme Helligkeit überforderte seine Augen. Der hohe Kontrast machte es schwer, Einzelheiten oder Gesichter zu erkennen. Er bekam Kopfweh, rieb sich ständig über die Augen. Und plötzlich konnte er nichts anderes mehr sehen, außer allem verschlingenden, gleißenden Lichts …
Er riss die Augen weit auf. Oh, wie der Nacken schmerzte! Jede Bewegung ließ es knirschen. Wie spät mochte es sein? Vor Müdigkeit bekam er kaum die Augen auf. Obwohl die Augen geschlossen sind, wird er noch immer geblendet. Komisch, erst Dauerregen und dann Sonne!
Er hustete den sich angesammelten Schleim im Rachen in die geschlossene Mundhöhle und schluckte den Klumpen kurzerhand hinunter. Was blieb war der berühmte »Frosch im Hals«. Er musste unbedingt trinken! Ausgedörrt wie ein altes, abgehangenes Stück Fleisch, gierte der Körper nach Flüssigkeit. Außerdem wollte er unbedingt diesen schrecklichen Geschmack im Mund loswerden.
Noch einmal unternahm er den Versuch, die Lider mit Gewalt zu öffnen, was allerdings erneut misslang, da die Sonne ihm direkt in die Augen scheinen musste. Mit einem Ruck kam er in eine normale Sitzposition, was einen stechenden Schmerz im Rücken zur Folge hatte, der den Geschundenen nach Luft ringen ließ.
Gefühlt dauerte diese Prozedur Stunden! Nur war dies noch nicht alles. Ärgerlich die Zähne zusammen beißend, vergräbt er das Gesicht in die stützenden Hände. Nicht lang, denn durch das Gewicht des Kopfes bohrten sich die Ellenbogen unangenehm punktuell in die Oberschenkel.
Egal was er auch anstellte, er wurde permanent geblendet. Einbildung? Schlief er etwa noch? Spielte ihm seine Wahrnehmung einen derben Streich?
Unwahrscheinlich war dies nicht!
›Vielleicht habe ich auch nur hohes Fieber!‹
Ja, die Stirn war heiß. Sehr heiß sogar. Angestrengt blinzelt er durch einen winzigen Spalt zwischen den Fingern. Die Helligkeit war weg und die Einrichtung des Wohnzimmers klar erkennbar. Darüber erleichtert, machte er Anstalten aufzustehen. Doch etwas hinderte ihn …
Ein unheimliches Gefühl, nicht allein zu sein, bemächtigte sich seiner. Vorsichtig sah er sich um, wendete zögernd den Kopf. Und dann glaubte er nicht, was er sah. Im Sessel saß der Fremde!
»Hallo Riley. Zeit zum reden?«
* * *
So war das damals. Riley Mortimer Scott schmunzelt. Damals ist noch keine zwei Monate her. Diese sechzig Tage haben sein Leben umgestülpt. Alles was Riley zu wissen glaubte, wurde über den Haufen geschmissen. Voller Abenteuerlust willigte er ein. Aylon hat etwas an sich, das Vertrauen erweckt. Seine Worte sind schlüssig und nachvollziehbar. Er strahlt Ruhe aus und vor allem Verständnis. Riley kommt es vor, der Fremde weiß wovon er spricht. Kaum verwunderlich, dass er jetzt hier ist.
Pferdegetrappel kommt näher. Aus den Gedanken gerissen geht er hinter einem leicht ansteigenden Hügel in Deckung. Zwischen Grashalmen und einer wild wachsenden Hecke hindurch hat er gute Sicht auf den Weg. Noch war von Pferd und Reiter nichts zu sehen. Um bloß nicht entdeckt zu werden, drückt er sich noch tiefer auf die Erde.
Eine Gefährdung von Aylons Unterfangen, hätte auch für Riley schwerwiegende Folgen. Was er damit zu tun haben soll, will nicht in seinen Kopf gehen. Weder Aylon noch die erwartete Person sind ihm bekannt. Von letzterer weiß er nur den Vornamen.
»Scheint nicht gerade gemütlich zu sein!«, erschallt eine Frauenstimme hinter ihn. Als er den Kopf drehen will, schnalzt sie nur mit der Zunge.
»Probier's Kleiner, dann bist für schneller Futter für die Maden, als dir lieb ist!«
»Darf ich aufstehen …«
»Gib mir erst deine Waffe, Kleiner!«
»Ich habe keine, Lady …«
Über ihn lachte es.
»Du nennst mich Lady?«
»Ihrer Stimme nach zu urteilen, sind sie eine, Miss.«
Die Frau pfiff leise.
»Gib mir deine Waffe!«
»Ich … ich habe keine …«
»Was denkst du, wer dir das glaubt?«
Schuldbewusst zuckt er mit der Schulter.
»Sie, Mrs Lady?«
Anhand der zurückweichenden Schritte nimmt er an, er könne nun aufstehen, was er auch langsam macht.
Die Lady hindert ihn nicht im Geringsten, sie lässt ihn im sicheren Abstand gewähren.
Ihre Blicke treffen sich. Riley ist wie vom Donner gerührt! Das sind die Augen, die er stets in seinen Träumen erblickt. In denen er versinkt. Aber wie kann das sein?
»Was schaust du mich so seltsam an? Noch nie eine Dame in Hosen gesehen?«
Über alle Zweifel erhaben, ist Riley gerade unfähig, etwas zu sagen. Die Frau hält seinem Blick stand. Fast scheint es, sie empfindet ebenso wie er.
»Hallo!«
Riley ist der Wirklichkeit um einiges entrückt und vergisst alles. Im Strudel ihres Blickes eingesogen, kann er nichts dagegen tun, wenn er denn wollte. Und er will nicht. Es ist wie ein Sechser im Lotto! Dies geschieht einem nur einmal im Leben! Das Schicksal führte Riley hierher und er trifft die Frau seiner Träume! Wahnsinn!
Er kann sich zwar nicht an das dazugehörende Gesicht erinnern, dies ist nur ein verwaschener Fleck, aus dem ebendiese wunderschönen, alles erzählende Augen ihn anschauen.
»Hey, Kleiner! Aufwachen!«
Keine Chance!
»Träumst du?«
Die Dame mit Hut und Hose wird es allmählich zu bunt. Der Blick des Mannes ist ein anderer, als von vielen Männern vorher, die sie meistens gierig verschlangen. Der hier könnte ihr sogar gefallen, wenn sie nichts Wichtigeres zu tun hätte. Und ein Abenteuer kommt sowieso nicht infrage!
Mit dem Gewehr auf ihn zielend steht sie da und überlegt. Wenn sie jetzt einfach wieder verschwinden würde, fiele es diesen Kerl vermutlich nicht auf. Der schaut sie immer noch an. Frauen spüren, wenn Männer etwas von ihnen wollen. Nur Männer vergessen eines (oder merken es einfach nicht), dass sich die Frauen selbst den potentiellen Partner aussuchen.
Hingerissen von der Tiefe, in der ihre Augen Riley ziehen, vergisst er alles andere. Ihre Aura hält ihn gefangen im Bann zärtlich aufkommender Gefühle, die ähnlich eines Keimes in der Wüste zaghaft sich vortasten. Seine innere Stimme schreit nach ihr, der Verstand murmelt wie unerreichbar sie doch ist.
So stehen beide stumm und den anderen musternd gegenüber. Keiner wagt in dieser Situation etwas zu sagen, etwa was ihm im Moment durch den Kopf geht. Hat er sich unsterblich in diese wundervollen Augen Hals über Kopf verliebt, will sie ihn dagegen schnellstmöglich loswerden. Zwei Welten prallen gegeneinander, die unterschiedlicher nicht sein können!
Die verzwickte Situation wird recht ungalant Weise gelöst. Von beiden unbemerkt, oder wenigstens zu spät, um noch rechtzeitig reagieren zu können, tauchen plötzlich mehrere vermummte Gestalten auf. Klickende Gewehre werden auf sie gerichtet.
»Leg die Knarre weg, Puppe!«, ertönt eine raubeinige Stimme, die wohl dem Anführer gehört.
Ihr bleibt nichts anderes übrig, als brav zu gehorchen, will sie nicht mehr riskieren, als ihr lieb ist. Vorsichtig folgt die Lady der rabiaten Aufforderung.
»Schaut euch das Bübchen an«, grölt ein anderer. »Der is ja völlig weggetreten!«
»Manche Weibsbilder sind wie Schlangen«, erwidert der Nächste. »Schaust du ihr in die Augen, findest du dich schnell in deren Magen wieder.«
Tatsächlich begreift Riley die Lage ziemlich spät.
»Ist das überhaupt ein Frauenzimmer?«
»Wegen den Hosen, Ben? Vielleicht versteckt die darunter ja ihre Strapse!«
Das Hohngelächter über diesen vermeintlich gut gelungenen Witz erfüllt die Luft. Ein wirklich kleiner der Vermummten, drückt sich breitbeinig mit erhobenen Händen an die Lady in Hose. Die anderen Lachen noch lautstarker.
»Na los, Jack! Schau nach!«
Mit einem Mal vollführt die Lady eine Wendung um einhundertachtzig Grad und stößt das blitzschnell angewinkelte Knie dem aufdringlichen Kerl geradewegs ins Allerheiligste. Brüllend geht der zu Boden. Schlagartig verhallt das Lachen.
Einen besseren Augenblick als diesen wird es sobald nicht mehr geben. Die Lady nutzt die Gunst der Stunde. Mit einer unbändigen Bewegung wirbelt sie um die eigene Achse, dabei drei der Banditen mit sich reisend, die mit schmerzverzerrtem Gesicht wie gefällte Bäume umfallen. In der darauffolgenden Schrecksekunde, die die Männer über der Schlagkraft des vermeintlich schwachen Geschlechts staunen, bekommen zwei weitere einen kräftig ausgeführten Faustschlag ins Gesicht. Taumelnd wenden diese sich ab. Bleiben noch ein hagerer Bandit sowie der Anführer.
»Hast du … hast du das … gesehen?«
Der Hagere hat eine Fistelstimme, die dazu noch vor Unglauben eine Oktave höher springt.
Riley schaut dem Szenario als unbeteiligter Beobachter zu. Ob er überhaupt irgendetwas vom Geschehenen mitbekommen hat, ist äußerst fraglich. Jedenfalls schaut er mit weit aufgerissenen Augen zwischen den beiden Männern und der Lady hin und her. Sichtlich geht eine heftige Zuckung durch seinen Körper, als die Lady ausholt.
Sie hat ihr Gewehr in der Hand, den Lauf fest umschlungen. Ohne erbarmen und mit vollem Schwung trifft der Kolben den Hageren an der Schläfe.
Das Gewehr wirbelt kurz in ihren Händen herum.
»Das wagst du nicht, du dreckige Hu …«
Die Antwort ist das Spannen des Hahns. Blankes Entsetzen zuckt in den Augen des Banditen auf. Blässe übertüncht seinen ansonsten dunklen Teint.
»Lass es darauf ankommen …«, zischt sie.
Betont langsam wirft der Ganove sein Gewehr auf die Seite, hebt ebenso langsam beide Arme.
»Fessle ihn, Kleiner!«
Riley, mit der Situation überfordert, sucht nach passendem Material.
»Nimm das hier«, sagt die Lady, dabei auf ihr Pferd deutend. An der Satteltasche sieht Riley das Seil hängen.
»Ihr kommt nicht weit«, meint der Anführer in einem abschätzenden Ton. »Wir werden euch überall finden, merk dir das.«
In den Augen des Banditen erkennt die Lady blanken Hass. Diesen Typen hat vermutlich noch niemand in die Schranken gesetzt. Und ausgerechnet eine Frau tat dies eben!
»Du solltest dich immer umschauen, ob nicht ich oder einer meiner Männer …« Er verstummt und beendet seine Drohung nicht.
Die Lady bleibt ruhig und schweigt. Solche Menschen sind ihr zuwider. In der Regel ignoriert sie derartige Anfeindungen, was jedoch nicht immer funktioniert.
Riley beginnt den Banditen umständlich zu fesseln. In diesen Dingen ungeübt, muss er mehrmals ansetzen. Dadurch entsteht eine gewisse Unruhe und Unübersichtlichkeit.
»Und du solltest …«, setzt sie entgegen, wird aber durch ein Knack-Geräusch seitlich von ihr unterbrochen und abgelenkt. Von ihr unbemerkt hat sich einer der Banditen erheben können und ist klar genug im Kopf, ein Ablenkungsmanöver zu starten. Dieses reicht aus, ihr für eine Sekunde die Oberhand zu rauben. Wie ein wildes Tier und archaisch schreiend rennt er auf die Lady zu. Ihr bleibt nichts anderes übrig: Krachend löst sich der Schuss. Dumpf schlägt der Getroffene auf der Erde auf.
Der Banditenanführer macht eine barsche Bewegung und bekommt Riley von hinten zu fassen. Ein Messer plötzlich in der Hand, das er den verdatterten Riley an die Kehle hält, bekommt der Ganove die Situation wieder unter Kontrolle.
»Waffe weg! Sonst stirbt der hier …«
»Der gehört nicht zu mir, ich kenn den nicht mal!«
»Gut. Dann kann ich ihn ja abstechen …«
»Mach das und du bist tot!«
»Oh, will die Süße ihren Kleinen rächen?«
Trotz Mundtuch glaubt sie sein süffisantes Lächeln zu erkennen. Der Kleine macht einen völlig verweichlichten, nichts verstehenden Eindruck. Eigentlich ist er ihr ja egal. Aber in seinem Blick lag vorhin so viel Zärtlichkeit, dass sie sich jetzt fragt, ob es vielleicht doch einen tieferen Sinn gibt, dass die ihn traf! Um dies herauszubekommen sollte ich schnellstens etwas einfallen. Einige der Niedergeschlagenen räkeln sich bereits wieder …
»Was ist nun!«
Er ist in der Offensive, und er weiß es auch. An Rileys Hals zeichnet sich ein dünner roter Streifen ab. Blut! Sie muss handeln!
»Lass ihn gehen. Dies ist eine Sache zwischen uns. Wir werden kämpfen.«
»Ich soll mit einem Frauenzimmer mich schlagen?«
Er ist darüber belustigt, lacht aber nicht laut.
»Du wirst doch nicht etwa Angst vor mir haben?«
Mit einer knappen Kopfbewegung zu seinen Kumpanen hinüber, sagt er: »Das da war Glück. Mit mir hast du nicht so ein leichtes Spiel.«
»Dann kann dir ja auch nichts passieren …«
Sekunden vergehen, in denen nichts weiter geschieht, als ein intensiver Blickwechsel.
»Es sei. Also weg mit dem Gewehr!«
Noch zögert sie. Läge sie die Waffe jetzt weg, verzichtet sie auf einen Vorteil, der durch so schnell nicht wieder aufholbar wäre. Den Kleinen könnte es allerdings mehr kosten, als notwendig. Dieses Greenhorn kann einem nur Leid tun! Jedoch ist das eigene Leben nicht mehr wert?
Diese Gedanken schossen der Lady innerhalb weniger Sekundenbruchteile durch den Kopf.
»Nimm das Messer weg!«
Für einen Augenblick sieht es so aus, der Bandit wolle nachgeben …
Zwei
Waylon schaltet enttäuscht den Zukunftsschau-Modus ab. Was er sieht gefällt ihm überhaupt nicht! Was hat er übersehen? Langsam wird er nervös. Bereits mehrere Tage verbringt er damit, mit unterschiedlichsten Daten einen möglichst vielversprechenden Ausgang berechnen zu lassen. Der Modus des Zeittransmitters, in der Anleitung gefunden, sah anfangs recht vielversprechend aus. Man muss nur die Ausgangsposition eingeben und schon kann visuell verfolgt werden, was sein kann.
Seine Fantasie erlebt ungeahnte Höhenflüge. Leider waren die Ideen nicht umsetzbar, weil stets einer von beiden – Rebecca und Riley – auf der Strecke blieb. Gerade war es Riley, der in dieser Situation den Kürzeren zog und, wäre es real gewesen, es ihn nicht mehr geben würde. Einmal endete die Ausgangsposition sogar mit seinem Ableben.
Waylon schaltet den Transmitter aus. Wenigsten hat er einen passenden Standort gefunden, der ihn unbehelligt bleiben läßt. Ein kleiner Lichtblick, der ihn im Moment aber auch nicht weiterhilft.
›Ich brauche Input!‹, denkt Waylon. Festgefahren im Denken, wird er auf diese Weise wohl nie ans Ziel gelangen.
Ohne jemanden zu gefährden scheint die Aufgabe unlösbar. Schade nur, dass keiner da ist, mit dem Waylon sich austauschen kann.
Der Mohrenmaki flippert.
»Wenn du mich nur verstehen würdest«, sagt er zärtlich.
Das Weibchen hat sich schnell erholt. Nur eine dunkle Linie im Fell zeugt noch von der Verletzung. Sie ist zwar noch etwas langsam und bedächtig in ihren Bewegungen, ansonsten erfreut sie auch Waylon mit ihren aufgeweckten Gehabe.
Der Maki sitzt, wie gewohnt fest angeschmiegt, auf seiner Schulter.
»Weißt du, ich brauche neue Ideen – Eingebungen wären noch besser.«
Das Äffchen löst sich von seinem Hals und sieht ihn an. Ein Außenstehender könnte meinen, es denke nach. In Wirklichkeit fühlt es Waylons Gemütsverfassung über seine Ausstrahlung. Um ihn zu beruhigen, fängt es an, mit den kleinen Händchen durch Waylons Haar zu streichen.
Diese Berührungen haben tatsächlich eine entspannende Wirkung. In Halsnähe gibt es eine Stelle, die Waylon durch und durch geht. Genüsslich schließt er die Augen. Die winzigen Finger des Makis fühlen sich an, wie ein weicher Kamm, der ohne Kraftaufwand eingesetzt wird. Diese streichelnde Minimassage versetzt ihn in einen ruhenden Zustand. Von seinem Problem gedanklich regelrecht verfolgt und gemartert, entschleunigt er für einige Minuten.
Eigentlich hat er ja auch alle Zeit der Welt! Durch den Paläo-Transmitter, der ehrlich gesagt moderner nicht sein kann, braucht nichts überstürzt zu werden. Die Station muss in dieser Zeitebene keinen Angriff befürchten. Der gegenwärtige Gewahrer erfüllt mit Bravour und besonnen seine Berufung.
Dennoch nagt in Waylon das schlechte Gewissen. Während er sich den Annehmlichkeiten des Lebens getrost hingeben kann, gibt es die Freunde vielleicht nicht mehr! Allein dieses Wissen macht ihn unruhig und zappelig. Dabei wollte er doch endlich den neuen Lebensabschnitt einfach nur genießen …
›Weshalb beklage ich mich überhaupt? Der Kristall hat doch mein Leben bereichert!‹
War seine Existenz davor von depressiven Anfällen bis zur Selbstkasteiung bestimmt, hat er jetzt einen gewissen Halt und Sinn gefunden. Damals abgeschoben und aufs Abstellgleis verbannt, wird er heute mehr denn je gebraucht! Was für eine Wendung! Es hat eben jede Herausforderung positive wie auch negative Seiten. Von jetzt auf gleich wieder Vollgas geben, kann auch in die Hose gehen. Überfordert vom Erfolgsdruck fahren die Gefühle Achterbahn. Kaum oben angelangt geht es brachial wieder nach unten.
Doch warum beklagt er sich? Nur weil es kein Do-it-your-Self-Buch für derartige Situationen gibt, nach denen man sich richten und gegebenenfalls die Schuld darauf schieben kann, wenn es misslingt? Für alles gibt es Anleitungen, Ratgeber oder wie sie alle heißen mögen! Schrecklich, wie Waylon findet. Wo bleibt da der eigene Gedanke? Oder der eigene Wille Dinge anzugehen? Alles hat sein Für und Wider.
Derweilen streicht und zupft und zupft und streicht der Maki, in unermüdlicher Ausdauer, durch Waylons Haar. Manchmal ziept es, wenn überschüssige Hautpartikel entfernt werden. Trotz allem geht das Äffchen rücksichtsvoll, ja beinahe zärtlich vor. So kann der Gedanken geplagte Waylon sich weiter diesen uneingeschränkt widmen.
›Ach unci, wärst du doch da …‹
Das Bild der Großmutter entsteht vor seinem geistigen Auge. Sanftmütig lächelt sie. Unci verstand ihn immer. Ebenso wie sein Daddy. Beide standen sich diesbezüglich in nichts nach. Mit sensiblem Einfühlungsvermögen fanden beide stets die richtige Lösung.
Wehmut kommt auf, bemächtigt sich Waylon ohne Unterlass. Es kommt ihm wie ein Tuch vor, das sich über ihn legt und mit jedem weiteren Atemzug schwerer wird. Betrübt öffnet er die Augen.
Plötzlich hört er Elionors Stimme in seinem Kopf, klar und deutlich. »Einer von ihnen hat hier vor mehr als hundert Jahren ein Artefakt begraben. Du solltest es finden, denn er kannte dich.« Das sind genau die Worte, die sie Waylon auf der Bank unter dem Baum sagte. Besonders der letzte Satz bereitet ihm Kopfzerbrechen. »Du solltest es finden, denn er kannte dich.«
Woher sollte er Waylon kennen? Darauf fallen ihn nur die Morgenreisen ein. Vermutlich wußte der Dakota, dass seine Wahl, Rebecca zum Gewahrer zu berufen, eine Fehlentscheidung war! Doch warum änderte er nicht einfach seine Meinung? Hatte er etwa keine Zeit mehr? Oder steckt mehr dahinter?
»Man müsste mit diesem alten Herrn reden können«, redet er vor sich hin. Der Maki ist an Waylons Selbstgespräche gewöhnt, deshalb streicht und zupft er geduldig weiter.
»Was bin ich doch für ein Esel!«
Seine linke Hand klatscht ihm gegen die Stirn. Das ist es! Der Maki zuckt zusammen, sind doch solcherart von Einfällen nichts für seine zarte Natur; wenigstens was die äußeren Eindrücke betrifft. Verunsichert springt er von Waylon hinab, nimmt genau vor ihm auf dem Boden Platz.
»Kleine, ich glaube ich weiß wie wir vorgehen«, beginnt er eifrig. Mangels vorhandener Gesprächspartner beginnt er immer öfters seine Monologe an den Maki zu richten. Dies gibt Waylon den Eindruck eines verstehenden Zuhörers. »Was hältst du von einen Ausflug nach Kanada?«
Das Maki-Weibchen flippert in gewohnter Weise, allerdings klingt es nicht zustimmend.
»Was wir dort wollen? Einen alten Dakota suchen und mit ihm reden, dass wollen wir dort!«
Die Augen des Makis sind skeptisch auf Waylon gerichtet.
»Ist ungefährlich und notwendig.«
Ein kurzes Fauchen wird laut.
»Du hast was dagegen?«
Flippern.
Nun ist es Waylon, der skeptisch dreinschaut. Hat der Affe vielleicht doch Recht? Zweifel befallen ihn. Voreiliges Handeln ist sehr töricht und schädlich! Er scheltet und beschimpft sich in Gedanken, verzieht nach außen hin keine Miene.
»Keine Angst, Kleine. Mir wird schon noch was einfallen.«
In den Tiefen des über Hunderte von Meilen sich hinziehenden Regenwaldes, herrscht reges Treiben. Es ist die Zeit der Dämmerung. Tagschwärmer gehen zur Ruhe, Nachtschwärmer erwachen. Ganz in der Nähe sitzt ein Sprenkelkauz und beobachtet blinzelnd die Umgebung. Das nachtaktive Tier macht sich bereit für die Jagd.
Vögel flattern auf der Suche nach einem geeigneten Schlafplatz umher. In den dichten Baumkronen werden sie fündig. Unter einigen von ihnen bricht Streit aus. Außer einigen Federn und lautstarkes Geschrei geht dieses Gerangel harmlos aus.
Auch auf dem Boden im Unterholz geht es hoch her. Unsichtbar fleucht es dort, wird gejagt und gefressen, verdaut und kompostiert. Im ewigen Kreislauf vergeht und entsteht.
Am Rande dieses Regenwaldes, hat Waylon sein Lager aufgeschlagen. Unweit von hier, gibt es eine alte Blockhütte, in der ein Baum wächst. Bald wird es die Hütte nicht mehr geben, denn die Natur hat sie längst in Beschlag genommen. Ein uraltes, verrostetes Bettgestell bietet ein notdürftiges Nachtlager. Wenigstens kann er sich ausstrecken und liegen.
Direkt vor der Tür, steht der Transmitter; gut getarnt durch wildwuchernde Pflanzen.
Das, was einmal ein Kamin war, nutzt Waylon zum Feuer machen. Darüber liegen mehrere Eisenstangen, die als Rost fungieren. Während der Maki mühelos kleine Insekten fängt – ein wirkliches Schlaraffenland für das Äffchen – muss Waylon abwägen, was er zu Essen bekommt.
Über eine Woche ist er bereits hier. Am dritten Tage war der Hunger so übermächtig, dass er eine mittelgroße Schlange fing, ihr den Kopf einschlug und ihr Fleisch vorsichtig briet. Der erste Happen schmeckte vorzüglich, der Zweite eher ekelhaft und nach dem Dritten erbrach er alles. Der Geschmack erinnerte ihn ein wenig an Hühnchen und Aal, wobei Letzteres wohl am nächsten kam.