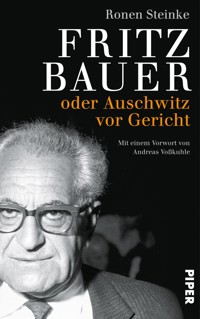20,98 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Berlin Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die israelische Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem hat bis heute mehr als 25 000 mutige Männer und Frauen geehrt, die während des Zweiten Weltkriegs Juden retteten. Diese Geschichte ist trotzdem einzigartig. Unter den »Gerechten unter den Völkern« ist bislang nur ein Araber: Mohammed Helmy. Er lebte in Berlin. Den ganzen Krieg über blieb er in der Stadt. Der Ägypter balancierte ständig auf einem schmalen Grat zwischen Anpassung und Subversion, und er vollbrachte ein wahres Husarenstück, um die Nazis auszutricksen. So rettete er die Jüdin Anna Boros. Dieses Buch wirft ein Licht auf eine fast vergessene Welt, das alte arabische Berlin der Weimarer Zeit, das gebildet, fortschrittlich und in weiten Teilen alles andere als judenfeindlich war. Einige Araber in Deutschland stellten sich in den Dienst des NS-Regimes. Aber eine nicht unbedeutende Gruppe – und von ihr handelt diese Geschichte – bildete einen Teil des deutschen Widerstands gegen den NS-Terror.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.berlinverlag.de
Für Hannah
ISBN 978-3-8270-7953-4
© Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH, München 2017
Covergestaltung: zero-media.net, München
Covermotiv: Nachlass Dr. Mohammed Helmy / Familienarchiv el-elish, Kairo (links) und Nachlass Anna Gutman / Familienarchiv Gutman, New York (rechts)
Datenkonvertierung: abavo GmbH, Buchloe
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Cover & Impressum
Nahost-Berlin
Hausbesuch
Der Duft von Tee
»Artverwandtes Blut«
Narrenfreiheit
»Sofort internieren«
Schluss mit Hoffen – abtauchen
Ein verwegener Plan
Unsichtbar vor aller Augen
In der Höhle des Löwen
Über Nacht Muslimin
Mariage blanc
Die Gestapo kommt näher
Die letzte Lüge
Besuch in Kairo
Personen
Zeittafel
Anmerkungen
Quellen
Bildnachweis
Dank
Nahost-Berlin
»Manche Damen halten sich eine Zwergbulldogge. Manche Damen tragen ein Monokel. Manche Damen besuchen Verbrecherkeller. Und manche Damen legen sich eine exotische Religion zu«, schrieb »Rumpelstilzchen«, mit bürgerlichem Namen Adolf Stein, der berühmte deutschnationale Kolumnist des Berliner Lokalanzeigers. Über Krishnamurti sei man inzwischen hinaus in der Reichshauptstadt und auch über die Buddhisten, die ihren Tempel im Villenvorort Frohnau besuchten. Aber, schloss Rumpelstilzchen 1928: »Am modernsten und schicksten ist zur Zeit in Berlin-West der Islam.«[1]
Als die Gestapo-Männer im Herbst 1943 in die Praxis des ägyptischen Arztes in Charlottenburg hineinpolterten, sahen sie am Eingang eine muslimische junge Frau. Sie saß an der Rezeption und sortierte Blut- und Urinproben. Volles Gesicht, kluge Augen (»friedevolle Messiasaugen«, hätte bei Rumpelstilzchen gestanden)[2], helle Haut.
Ihre dunklen Locken wurden von einem Kopftuch aus dünnem Stoff zusammengehalten. Wenn sie lächelte, bildeten sich Grübchen. Das geschah recht oft, selbst als nun die Gestapo-Männer auf sie zukamen. »Sie strahlte Energie und Gesundheit aus«, so haben manche sie später beschrieben.[3]
Groß sei sie gewesen, hübsch. Andere taten sich schwer mit einer Beschreibung. Orientalisch. Südländisch. Kopftuch. Was soll man sagen? Gut angepasst sei die junge Frau eben gewesen, das auf jeden Fall. Dieses Kompliment, das jemand für die muslimische Assistentin des Arztes Dr. Mohammed Helmy fand,[4] war sogar treffender, als die meisten ahnten.
Als die Gestapo-Männer ihre Kommandos bellten – den Chef sprechen, sofort! –, bat die junge Frau, doch Platz zu nehmen, einen Moment zu warten. Der Herr Doktor werde gleich für die Herren da sein, selbstverständlich. Man helfe gern, man wisse, was sich gehöre.
Sie sprach, wie er, akzentfrei Deutsch. Sie trug den arabischen, aber auch für Deutsche leicht auszusprechenden Namen Nadja. Und wenn jemand fragte, woher sie komme, dann erklärte sie: Der Herr Doktor und sie seien verwandt. Sie sei die Nichte.
Die Gestapo-Männer zogen an Schubladen und Schranktüren. Sie rumpelten misstrauisch ins Patienten-Wartezimmer, zogen Vorhänge zur Seite. Vielleicht schnauzten sie jemanden an, er solle seine Papiere herzeigen – und Nadja, für alle sichtbar, half, stets mit einigen Metern Abstand, stets im Hintergrund, wie es von ihr erwartet wurde, unaufdringlich und leise.
Schon seit zwei Jahren rollten die Züge in die Vernichtungslager. Mit einem Marsch der Schande hatte es in Berlin begonnen, an einem beißend kalten Herbsttag, dem 18. Oktober 1941. Damals waren Hunderte jüdischer Männer durch die Straßen von Moabit, Charlottenburg und Halensee getrieben worden, bei strömendem Regen über Straßen, Marktplätze, auch über den Kurfürstendamm, bis hin zum Bahnhof Grunewald.
Nun suchte die Gestapo nach Untergetauchten, die zurückgeblieben waren. Tausende Juden lebten noch versteckt in Berlin, viele irrten ohne festes Obdach umher, schliefen im Freien, unter Brückenbögen oder in den Wäldern, manche fuhren bis Betriebsschluss in der S-Bahn herum und suchten dann die Wartesäle oder Toilettenräume der Bahnhöfe auf, um zu schlafen.
Es war nicht das erste Mal, dass die Gestapo-Schnüffler in dieser Arztpraxis in Charlottenburg aufkreuzten und verlangten, den muslimischen Arzt zu sprechen, und es war auch nicht das erste Mal, dass sie sich mit Nachdruck nach einem ganz bestimmten jüdischen Mädchen erkundigten, das verschwunden sei. Anna.
Herr Doktor wird sich freuen, Ihnen helfen zu können, konnte seine verschleierte muslimische Assistentin gerade noch sagen, bevor die knarzenden Dielen ankündigten, dass der Arzt sie endlich befreien würde aus diesem Gespräch. Ein dunkler, hoch aufgeschossener Ägypter war es, der aus seinem Behandlungszimmer herauskam und den Männern die Hand entgegenstreckte.
Heil Hitler, meine Herren.
»Hier ist der leibhaftige Orient. Beduinen, Derwische, Kairenser, Türken, Griechen und die dazugehörigen Weiberchen und Mägdlein sind in unbestreitbarem Originalzustand vorhanden«, davon war der große Theaterkritiker Alfred Kerr überzeugt, als er sich im sommerlichen Berlin einer kleinen Lehmhütte näherte.[5] Der Duft von nahöstlichem Kardamom-Kaffee mischte sich mit den Rauchschwaden von Berliner Zwei-Pfennig-Zigaretten. Vor der Hütte schmauchten, so schrieb ein weiterer Reporter, »Muselmänner in goldgestickter Seide«. Wobei: »So ganz urwüchsig ist die große Gesellschaft, die wir jetzt den Sommer über im Zoologischen Garten sehen, natürlich nicht mehr«, wandte Rumpelstilzchen ein. Sie »ist vielmehr schon erheblich von der Zivilisation beleckt.«[6] Die Berliner Bevölkerung gab sich ihrer Orient-Faszination in vollen Zügen hin. Aber am liebsten betrachtete sie die Menschen durch die Stäbe eines Zoos.
Araber wurden in Berlin ausgestellt wie exotische Tiere, schon 1896 in einem »Tunesischen Harem«, 1927 in der »Tripolis-Schau«. Auch Kairo und Palästina waren beliebte Völkerschau-Motive. »Ick bitt Ihnen, schuppsen Se doch nich so!«, zitierte ein Reisender in seinem Bericht aus dem Gedrängel.[7] Nur ein Autor der Allgemeinen Zeitung des Judenthums wurde auch etwas wehmütig beim Anblick der kleinen Kairo-Kulisse, dieses »orientalischen Bildes, das an so viele biblische Szenen erinnert«, auch an die »glorreiche Vergangenheit und die traurige Gegenwart meines Volkes«.[8]
Juden und Muslime – gerade in den turbulenten Zeiten im Berlin der 1920er und 1930er Jahre waren sie einander derart nahe, entdeckten das Verbindende, kamen gut miteinander aus. Dass es diese Zuneigung gab, war grundsätzlich schon bekannt. Wie weit diese Zuneigung gehen konnte, blieb aber lange unerzählt.
Erst durch neue Funde im Landesarchiv und im Politischen Archiv des Auswärtigen Amtes ist es jetzt offensichtlich geworden: Mitten in der Hauptstadt des Hitler-Reichs versteckten Araber Juden, um ihnen das Leben zu retten. Es ist eine Geschichte, die Mut macht in diesen Zeiten des Hasses.
Wenn heute manche Muslime in Deutschland den Eindruck haben, die Erinnerung an den Holocaust tangiere sie nicht, es gebe da keinen Berührungspunkt mit ihrer eigenen Geschichte, muslimische Migranten kämen darin nicht vor – dann beweist die Geschichte, die in diesem Buch erzählt werden soll, das Gegenteil. Sie basiert auf historischen Dokumenten, auf Entschädigungsakten, Gestapo-Post und Diplomaten-Papieren, auf den persönlichen Nachlässen von Helmy und Anna sowie auf vielen Stunden Gesprächen mit den noch lebenden Kindern und Neffen dieser beiden Hauptfiguren. Sie wirft ein Licht auf eine fast vergessene Welt, auf das alte arabische Berlin der Weimarer Zeit, das gebildet, fortschrittlich und in weiten Teilen alles andere als judenfeindlich war.
Wenn heute manche Juden in Deutschland den Eindruck haben, dass Gegenden mit besonders vielen muslimischen Bewohnern für sie zu No-go-Areas geworden sind, in denen man sich nicht mehr gefahrlos bewegen kann – dann sind die wahren Begebenheiten, die hier erzählt werden sollen, kein Trost. Aber sie beinhalten immerhin die Hoffnung, dass die Dinge wieder anders werden können. Die Geschichte der Muslime in Europa ist älter und facettenreicher, als es oft erscheint.
Es soll nichts beschönigt werden. Unter den Berliner Muslimen der 1930er Jahre dienten sich manche den Nazis an, manche stellten sich in den Dienst des Regimes, halfen mit bei dessen judenfeindlicher Politik und Propaganda oder übersetzten Mein Kampf ins Arabische. Aber eine nicht unbedeutende Gruppe unter ihnen bildete auch einen ganz besonderen Teil des deutschen Widerstands gegen die Judenverfolgung. Von ihr, von ihnen und von ihrem Mut handelt dieses Buch.
Hausbesuch
Es muss ein Nachmittag im Jahr 1936 gewesen sein, als sie sich zum ersten Mal begegneten, Dr. Mohammed Helmy und das Mädchen Anna.[1] Peinlich berührt folgte sie dem Schauspiel, das an diesem Tag geboten wurde, es sollte ihr noch lange in Erinnerung bleiben wegen der Art, wie sich die Erwachsenen verhielten. Es war geschäftig gewesen draußen auf den Straßen von Moabit, Dr. Helmys Wagen hatte immer wieder halten müssen auf seinem Weg ins Zentrum, zu den Schaufenstern und Reklametafeln des Alexanderplatzes.
In der Neuen Friedrichstraße hielt er vor ihrem großbürgerlichen Haus, stieg aus und klingelte. Hausnummer 77, das Erdgeschoss wurde fast vollständig von einem Obstgeschäft eingenommen. Über den Bürgersteig wehte der Duft frischer Pfirsiche aus Italien, das Kilo zu vier Mark, auch frische Tomaten, das Kilo zu zwanzig Pfennig.[2] Eine ihm unbekannte Dame hatte ihn gerufen.
Die beiden Frauen, die ihn an der Wohnungstür begrüßten, hatten eigens Schmuck angelegt, Brillantringe und Colliers. Der Arzt hatte kaum Guten Tag sagen können, da umschmeichelten sie ihn schon und machten ihm Komplimente. Sie riefen ihre Haushälterin herbei, schnell einen Tee zu servieren für den Herrn Doktor, und ihre ungarische Köchin,[3] eine Kleinigkeit zu essen zu bereiten, eine Erfrischung für Herrn Doktor, und bitte keine Sorge, Herr Doktor, wir verwenden kein Schweinefleisch in diesem Haus, Sie verstehen?
Anna war erst elf Jahre alt, sie lebte mit den beiden Frauen zusammen, mit ihrer Mutter und Großmutter – und sie traute ihren Ohren kaum, wie ihre Mutter den unbekannten Ägypter hofierte.[4] Die Frauen begannen, ihn auch mit Einladungen zu umgarnen, »um Herrn Doktor im Privaten zu gewinnen«, wie es Anna erschien.[5]
Anna war »nicht der Mensch, der über seinen Kummer spricht«, sagte sie später. Mit den beiden Frauen konnte sie über nichts reden, was sie bedrückte.[6] Als streng empfand sie die beiden, nicht freigiebig. Sie waren hart, vielleicht weil sie es sein mussten. Die Männer in ihrer Familie waren unbeständig geblieben, früh verstorben oder geschieden. So führten die Frauen das Geschäft. Sie geizten mit Komplimenten und Aufmerksamkeiten. Umso merkwürdiger erschien dem Kind nun dieses Theater in der Gegenwart von Dr. Helmy. Die Frauen »machten sich ran«, so nahm Anna es wahr.[7]
Immer wieder riefen sie Anna herbei, obwohl sie mit diesem Arztbesuch nichts zu tun hatte. Anni hier, Panny da. Pannyka!,[8] sagte die Grußmutter, die ungarische nagymama, die Nettigkeiten wie Gehässigkeiten stets süß flötend intonierte, ne álljitt a doktorúrútjába, teddmagadhasznossá! – Steh dem Herrn Doktor nicht im Weg herum, mach dich nützlich!
Dr. Helmy, der gerade im Begriff war, seinen Mantel abzulegen, hatte sich gar nicht beklagen wollen, dass ihm jemand im Weg stehen würde. Aber Anna verstand genug, um der Großmutter keine Szene zu machen. »Ich wusste mit unseren Verhältnissen genauestens Bescheid«, erinnerte sie sich später. Für Juden hatte es begonnen sehr schlecht zu werden, »die Enteignung der Geschäfte, die Einziehung des Geldes und so weiter«, so Anna.[9] Also blieb sie lieber still.
Die Haushälterin brachte das Teeservice. Sie schlängelte sich vorbei am Klavier und den mit Brokat bezogenen Sofas. Durch das Wohnzimmer mit der Chaiselongue, den zwei Betten, zwei Schränken, drei Läufern. Vorbei an Gemälden, Geschirren, Skulpturen, hin zu dem Raum, den Annas nagymama ausgesucht hatte, um sich dort von dem arabischen Arzt untersuchen zu lassen: dem Salon mit der Vitrine, den sechs Sesseln und dem Wandspiegel, den die Großmutter einen »Trumeau« nannte.[10]Bild_der_Familie_am_Tisch.jpeg
Es waren zahlungskräftige Leute, wie Dr. Helmy im Widerschein des Trumeaus bemerken sollte. Möglicherweise auch deshalb hatte man ihn zur Visite hierherbestellt, statt zu ihm in die Klinik zu kommen. In dem Obstgroßhandel unten im Erdgeschoss, der M. Rudnik GmbH, benannt nach Moise »Max« Rudnik,[11] dem zweiten Ehemann von Annas Großmutter Cecilie, herrschten die beiden Frauen über Tonnen von Grapefruits und Wagenladungen von Ananas. Über Personal. Über Hunderttausende Mark an Jahresumsatz. Dem Arzt wird trotzdem gedämmert haben, wie nervös sie waren.
Eine Tonne Weintrauben aus Holland schlug der Betrieb monatlich um.[12] Mit den Judengesetzen war das sehr viel schwieriger geworden, die Zahlungsmoral nichtjüdischer Kunden stellte diesen und andere Betriebe jüdischer Kaufleute vor Probleme. Auberginen aus Italien, Feigen aus Griechenland, Rosinen aus Frankreich, Paprika, Gurken, Maiskolben und Birnen aus Ungarn:[13] Neuerdings galten für all die Importwege, die das Unternehmen einst groß gemacht hatten, Beschränkungen. Es bedankte sich die brandenburgische Rübe.
In der Zentralmarkthalle, nur ein paar Schritte die Neue Friedrichstraße hinunter, hatte man Schilder angebracht: »Juden ist der Zutritt erst ab zwölf Uhr gestattet.« Also erst dann, wenn gedellte Tomaten und angefaulte Salatköpfe obenauf lagen. Als Annas Mutter, Julie, einmal trotzdem schon morgens um zwanzig vor neun ihre Runde drehte, zeigte ein Händler sie an. Die Polizei brummte ihr 25 Mark Strafe auf.[14] Immerhin, der Import aus der alten Heimat der Familie funktionierte noch. So kamen noch Walnüsse vom Schwarzen Meer in ihre Berliner Auslagen.[15]
Ob man dem Herrn Doktor noch etwas Gutes tun könne und ob er denn wisse, dass man auch aus arabischen Ländern importiere? Annas Mutter Julie redete viel, das tat sie immer, wenn sie verunsichert war. Um Anerkennung hatte sie stets kämpfen müssen. Einst hatten ihre Eltern große Erwartungen in sie gesetzt – Klavierunterricht am Konservatorium. Aber es war Julie nicht entgangen, was ihre Eltern davon hielten, als sie dann auf dem heimischen Klavier hauptsächlich Stücke wie »Morphium« von Mischa Spoliansky spielte oder Shimmys, in denen sich »Willy in der Nacht« reimt auf »Schwips nach Haus gebracht« oder »ein Kind, das schwarz gelockt ist« auf »ius primae noctis«.[16]
Die elfjährige Anna mit ihrer Mutter und ihrem Stiefvater, 1936
Schon im Jahr zuvor, 1935, hatten die meisten jüdischen Ärzte in Berlin ihre Zulassung verloren,[17] für jüdische Patienten war es nun noch schwieriger geworden. Der muslimische Dr. Helmy war da in einer besonderen Lage: Er war der einzige »Nicht-Arier« in Berlin, der noch eine Position als Klinikarzt innehatte, sogar an einem der größten Krankenhäuser der Stadt, dem Robert-Koch-Krankenhaus in Moabit. Eine kostbare Position, denn so war er auch der Einzige, der noch an vernünftige Medikamente herankam, an Strophantin gegen Herzschwäche, an Salvarsan als echtes Antibiotikum, und nicht nur an jene trüben Gebräue, auf welche jüdische Ärzte zurückgeworfen waren.
Es war also keine wahre Herzlichkeit, sondern Verzweiflung, die Annas Großmutter zu ihrem besonderen Gast so freundlich sein ließ. Und sie verstand auch schon, dass Helmy noch eine andere, dunklere Seite haben musste.
Später würde sie kein gutes Wort über ihn verlieren, kein Wort der Dankbarkeit. Selbst noch nach dem Krieg würde sie in einem Brief über ihn schreiben: »Der Schweinehund bleibt Schweinehund.«[18]
Zu übertriebener Nettigkeit neigte die Großmutter eigentlich nicht, wie Anna wusste; umso irritierender erschien ihr deren überschwängliche Freundlichkeit an diesem Nachmittag. Annas Mutter Julie war nicht unbedingt freiwillig nach Berlin gekommen. In der alten Heimat hatte sie mit dem jüdischen Fabrikbesitzer Ladislaus Boros zusammengelebt. Sie hatten geheiratet, die neugeborene Anna war ihr Geschenk des Himmels. Aber Annas Großmutter Cecilie war damals schon vorgegangen nach Berlin, und sie hatte gewollt, dass sie nachkommt. Also hatte die Großmutter Cecilie von Berlin aus einen Privatdetektiv beauftragt, der Ladislaus Boros der Schürzenjägerei überführen sollte. Der Detektiv tat seine Arbeit, die Ehe zerbrach, und Julie wurde geschieden. Alleinerziehend mit der zweijährigen Anna war sie niedergeschlagen nach Berlin gekommen. So wie Cecilie es geplant hatte.[19]
Beim Besuch des muslimischen Arztes nun, am heimischen Trumeau: nur süßeste Flötentöne. Anna zuckte innerlich zusammen. Die ungarische Köchin stellte das Tablett mit Erfrischungen ab. Nur zu!, ermunterten die beiden Frauen Dr. Helmy, und es hätte Anna nicht gewundert, wenn ihre Mutter sich noch ans Klavier gesetzt hätte, um dem fremden Gast zu imponieren, wie sie es so oft tat. Das ungarische Klavierstück »Schmeichelkätzchen«, so resümierte Anna später bitterböse, hätte sich angeboten.[20]
Der Duft von Tee
Annas Großmutter erinnerte sich noch genau an den Tag, als vor ihrem Obstgroßhandel am Alexanderplatz zum ersten Mal SA-Männer herumgestanden und »Boykott!« gerufen hatten. »Kauft nicht bei Juden«, solche Dinge. Es hatte genieselt. Es waren ein paar erbärmliche, bald auch nasse Figuren gewesen, die glücklicherweise wieder abzogen.[1] Die wirklichen Gewalttäter hatte die SA an diesem 1. April 1933 an einem anderen Ort von der Leine gelassen: im Krankenhaus Moabit, wo mehrere Lastwagen des SA-Sturms »33« zwischen den roten Backsteinflügeln aufgefahren waren. Es war jenes Krankenhaus, an dem auch der Ägypter Dr. Helmy arbeitete.
»Sturm 33«, das waren die kampferprobtesten Schläger der Braunhemden gewesen, genannt »der Mordsturm«. Zwei Dutzend von ihnen waren von den Lastwagen heruntergesprungen und ausgeschwärmt. Sie waren auf jede einzelne Station des Krankenhauses gestiefelt, vorgefertigte Listen in der Hand. Sie hatten jüdische Ärzte aus Arbeitszimmern und Operationssälen geholt.
»Erlauben Sie, dass ich meine Patienten noch meinem Oberarzt übergebe?«, hatte der Direktor der neurologischen Abteilung gefragt, Professor Kurt Goldstein, als die SA-Leute in seiner Tür standen. Worauf die Männer brüllten: »Jeder Mensch ist zu ersetzen, Sie auch!«[2]
Die jüdischen Ärzte trugen alle noch ihre weißen Kittel, als die SA-Leute sie auf die im Innenhof bereitstehenden Bretterwagen scheuchten. Man brachte sie in die ehemalige Kaserne in der General-Pape-Straße, wo die Braunhemden sich einquartiert hatten. Alles wurde registriert und säuberlich protokolliert. Die SA kostete das Hochgefühl aus, dass sie sich neuerdings »Hilfspolizei« nennen durfte. Jeder Gefangene bekam einen Laufzettel, auf dem ordentlich Name und Beruf eingetragen waren, als folgte dies alles Regeln. Die »militärisch-bürokratische Ordnung, nach der die Misshandlungen« in der Pape-Straße vor sich gingen, sei fast das Schauerlichste gewesen, erinnerte sich der Schriftsteller Lion Feuchtwanger später.[3] In der Nacht begann im Keller eine Prügelorgie. Auf einige der Ärzte schlugen sie mit Knüppeln so lange ein, bis sie starben.[4]
Am Tag darauf lag das Krankenhaus still da, wie leer gefegt. Die große Mehrheit der Ärzte hier war jüdisch gewesen, gut zwei Drittel, nun waren sie verschwunden. Das war das Besondere an diesem Krankenhaus, das zwischen den Schlaglöchern und Schwarzbrennereien von Moabit gelegen war – inmitten jener Verbindung von Backstein, Plakatsäulen, Feuertreppen und Wäscheleinen, die auf der ganzen Welt das Gesicht der Armenviertel bildeten –, dessen Schicksale das Krankenhaus schon seit der großen Wirtschaftskrise 1929 »überflutet« hatten, wie sich ein Arzt erinnerte.[5]
Für Annas Großmutter hatten die Zweifel an Dr. Helmys Charakter deshalb offen zutage gelegen, als sie zum ersten Mal von ihm gehört hatte, jenem Ägypter, der 1936 noch immer hier arbeitete – drei Jahre nach dieser braunen Razzia. Sie musste nur eins und eins zusammenzählen.
»Jeder Mensch ist zu ersetzen, Sie auch!« Als die SA-Männer dies 1933 gebrüllt hatten, da hatte Helmy offenbar nicht zu jenen gezählt, die ersetzt wurden. Sondern zu jenen, die bereitstanden, um andere zu ersetzen.
Ausgerechnet ein Araber, so wird die Großmutter gedacht haben. Wie eng war die Verbindung zwischen der kleinen Gruppe der Araber in Berlin und der viel größeren Gruppe der Juden gewesen, wie viel hatten Araber in dieser Stadt gerade den Juden zu verdanken. Tausende junger Männer aus arabischen Ländern waren nach Berlin gekommen, die Universitäten der Stadt hatten Söhne aus vornehmstem Kairoer oder Damaszener Hause angezogen.
Als Helmy im Oktober 1922 hier angekommen war, um Medizin zu studieren,[6] hatte die Stadt einen denkbar bizarren Eindruck vermittelt: Die Deutschen hatten gerade ihren Außenminister erschossen, den ersten jüdischen, Walther Rathenau. Es lag eine nervöse Stimmung über der Stadt, die allzeit in Aggression umschlagen konnte. Frauen mit Kopftuch und Schürze schoben Schubkarren mit Geldscheinen vor sich her, die Stadt lag am Boden, die Börse war in ein tiefes Loch gestürzt. »Nach Art der Blätterteigtörtchen«, so erschien es einem ausländischen Besucher, »vervielfältigte sich eine Mark unter dem Einfluss eines unergründlichen Geistes und wurde ein Bündel von tausend Blättern. Die Vervielfältigungsmaschine stand nicht mehr still, in der Berliner Notenpresse arbeiteten Zauberlehrlinge.«[7] Aber all das bedeutete auch: »Man kann gut und gerne für zehn Pfund im Monat seinen Lebensunterhalt bestreiten.« So schwärmte ein ägyptischer Medizinstudent, der schon eine Weile in Berlin war, in einer Kairoer Zeitung.[8] Die Wechselkurse waren für Ägypter traumhaft. Vor allem, wenn sie aus wohlhabendem Haus kamen, wie Helmy, der Sohn eines ägyptischen Armee-Majors.
Wenn seine Neffen aus Ägypten ihn besuchten, zeigte er ihnen nicht nur die Kulturtempel der Stadt, wie etwa die Nofretete-Büste, die seit 1924 auf der Museumsinsel Huldigungen entgegennahm. Er widmete sich auch profaneren Genüssen, den Gourmet-Tempeln etwa. Schweinebraten, Schinken, Wein, nichts war tabu. »Probier ruhig, habibi!« Damit zog er sie auf. »Ich bin Arzt. Das ist gesund.«[9]
Die arabischen Gaststudenten waren begehrt in dieser Stadt, ihnen öffneten sich Türen. Wenn sie am Anhalter Bahnhof ankamen, in messingverzierten Schlafwagen, die sich, von der Südspitze Italiens kommend, leise ratternd nach Norden geschlängelt hatten, dann zogen sich einige deutsche Frauen Sonntagskleider an und fingen sie schon am Bahnsteig ab. Vor allem rund um den Ku’damm, die mondäne Einkaufs- und Flaniermeile, kamen die Gäste aus dem Orient in bürgerlichen Familien unter, ihre Untermiete rettete manche Familie. Hier genossen sie den Blick auf Cabarets, Kaffeehäuser und die stumpfen Hauben der preußischen Schutzpolizei. Manche der arabischen Studenten wurden geradezu adoptiert, so empfanden sie es; auch Helmy hatte an den Wochenenden Verabredungen zum Tennis, Wandern oder Segeln.[10]