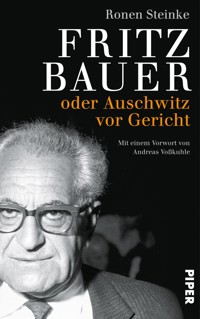13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: eBook Berlin Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Zeit, dass Polizei und Justiz aufwachen! In Deutschland hat man sich an Zustände gewöhnt, an die man sich niemals gewöhnen darf: Jüdische Schulen müssen von Bewaffneten bewacht werden, jüdischer Gottesdienst findet unter Polizeischutz statt, Bedrohungen sind alltäglich. Der Staat hat zugelassen, dass es so weit kommt - durch eine Polizei, die diese Gefahr nicht effektiv abwehrt, sondern verwaltet; durch eine Justiz, die immer wieder beschönigt. Der jüdische Autor Ronen Steinke, selbst Jurist, ist durch Deutschland gereist und erzählt von jüdischem Leben im Belagerungszustand. Er trifft Rabbinerinnen und Polizisten, konfrontiert Staatsschützer, Geheimdienstler und Minister mit dem Staatsversagen. Viel muss sich ändern in Deutschland. Was zu tun wäre, erklärt dieses Buch.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:www.berlinverlag.de
Von Ronen Steinke liegt im Berlin Verlag vor:Der Muslim und die Jüdin. Die Geschichte einer Rettung in Berlin (2017)
© Ronen Steinke/Berlin Verlagin der Piper Verlag GmbH, München 2020Covergestaltung und -motiv: zero-media.net, München Karten: cartomedia, Karlsruhe
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich Fahrenheitbooks nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Cover & Impressum
Blaming the victims
Ein Doppelmord in Erlangen
»Kompromittierendes Material«
»Schillernde Vergangenheit«
Wehrsportgruppe Hoffmann
Die tägliche Angst
Die Schleuse öffnet sich
»Diese No-go-Area-Scheiße«
Jüdische Lieder im Supermarkt
Gated Community
Am Blumenmeer
Selbstverteidigung
Die Tür
Leere Hüllen, wo einst Synagogen waren
»Es müssen erst furchtbare Dinge geschehen«
Bedrohte Juden als Bittsteller beim Staat
»Unregelmäßige Bestreifung«
Entwicklungshilfe aus Israel
»Daran sind ja nicht die Juden schuld«
Einzelfälle, überall Einzelfälle!
Die Vermeidung des T-Worts
Im Netzwerk der Rassisten
Der Antisemitismus der Neuen Rechten
Juden in der AfD
»Israel ist unser Unglück«
»Judenknacks«
Die Bombe im jüdischen Gemeindehaus
Verniedlichung bis heute
Wie der Verfassungsschutz Beihilfe leistete
Ein Brandanschlag in München
Kulturrabatt
Ramadan-Ende in Wuppertal
Ich habe nichts gegen Juden, aber …
»Jude, Jude, feiges Schwein«
Ein selbst gemaltes Hitlerbild
Der blinde Fleck in der Statistik
Israel versus Juden
Eyes wide shut
»Mein Grundvertrauen ist erschüttert«: Der Restaurantbetreiber
»Es macht die Sache noch schlimmer«: Die Journalistin
»Ich bin so aufgewachsen, dass man nicht zur Polizei geht«: Der Professor
»Das war normal für mich«: Der jüdische Polizist
»Vertrauen aufbauen«: Die Antisemitismusbeauftragte
Auswandern?
Schluss damit
Chronik antisemitischer Gewalttaten in Deutschland seit 1945
Chronik
Quellen und Literatur
Blaming the victims. Wie beim NSU
Die tägliche Angst. Schulkinder, die Polizeischutz brauchen
Selbstverteidigung. Wenn Synagogen auf sich allein gestellt sind
Einzelfälle, überall Einzelfälle! Terror von rechts
»Judenknacks«. Terror von links
Kulturrabatt. Terror von muslimischen Antisemiten
Eyes wide shut. Wie ein Dunkelfeld entsteht
Auswandern? Könnte euch so passen
Chronik antisemitischer Gewalttaten in Deutschland seit 1945
Dank
Karten
Blaming the victims
Wie beim NSU
»Mich. Meinen Sohn. Alle.«
Josef Jakubowicz, Holocaust-Überlebender, auf die Frage, wen das Bayerische Landeskriminalamt verdächtigte, etwas mit dem Mord an dem jüdischen Verleger Shlomo Lewin 1980 zu tun zu haben. Er war nicht der einzige Jude, der grundlos verdächtigt wurde.
Ein Doppelmord in Erlangen
Wir Juden reden nicht gern darüber, so werden wir erzogen, und so geben wir es weiter an unsere Kinder. Über die ständige Bedrohung wird in den jüdischen Gemeinden nicht zu offen mit Außenstehenden gesprochen. Man möchte keine Nachahmer auf den Plan rufen, heißt es, wenn wieder wohlmeinende Journalisten abgewimmelt werden, oder einfach und ehrlich: Man wolle in der Öffentlichkeit nicht immer als Opfer dastehen.
Wir klagen aber auch nicht viel über das, was dieses Problem so sehr vergrößert. Immer wieder habe ich das bei meinen Recherchen gehört: Bitte, wir wollen keine Probleme mit der Polizei und den Gerichten. Wir brauchen doch deren Hilfe.
Ich glaube, das ist ein Fehler.
Der 19. Dezember 1980 ist ein Freitag, es ist halb sieben am Abend, soeben hat der Schabbat begonnen, eine Zeit für Kerzenschein und ein Glas Wein. In einem Bungalow in der Ebrardstraße 20 nahe der Erlanger Universität sind die Jalousien heruntergelassen, so werden später die Beamten der Spurensicherung notieren. Shlomo Lewin, bis vor Kurzem Vorsitzender der jüdischen Gemeinde, ist zu Hause mit seiner Lebensgefährtin Frida Poeschke. Es klingelt, Lewin öffnet.
Sofort fallen Schüsse. Der Rechtsradikale Uwe Behrendt, 29 Jahre alt, feuert dreimal aus einer Maschinenpistole der Marke Beretta, Kaliber 9 Millimeter, mit Schalldämpfer, und als Lewin schon am Boden liegt, setzt er noch einen Kopfschuss aus nächster Nähe auf, es ist eine regelrechte Hinrichtung. Dann bemerkt der Täter offenbar Frida Poeschke, die er sofort danach im Eingang zum Wohnzimmer ebenfalls mit vier Schüssen tötet. In kürzester Zeit ist er wieder verschwunden.
So läuft es ab, das erste tödliche Attentat auf einen Vertreter der deutschen Juden nach 1945. Aber anstatt in der örtlichen Nazi-Szene zu ermitteln – die Wehrsportgruppe Hoffmann, die gerade erst vom Bundesinnenminister verboten worden ist, hat ihre Zentrale ganz in der Nähe –, verdächtigt die Polizei zunächst das Umfeld des Opfers.
Die bayerischen Behörden spekulieren, der Mossad habe eine Rolle gespielt, Israels Auslandsgeheimdienst. Ein Journalist einer Nachrichtenagentur zitiert noch am Abend »informierte Kreise« mit der Vermutung, der Tote sei ein Agent gewesen.
Die erste Frage, die der zuständige Staatssekretär im Bonner Bundesinnenministerium nach der Tat stellt, zielt dann auf einen »möglichen nachrichtendienstlichen Hintergrund des Ermordeten«, wie interne Protokolle verzeichnen. Die Spezialisten des Bundesnachrichtendienstes sollten dies einmal abklären, bittet er.
Die Ermittler mutmaßen auch, Shlomo Lewin hätte im Jom-Kippur-Krieg im Jahr 1973 unter Israels damaligem Verteidigungsminister Mosche Dajan gedient. Das ist der General mit der Augenklappe, einer der verhasstesten Männer in der arabischen Welt. Die erste Schlagzeile, mit der die Leser der Erlanger Nachrichten dann von dem Mord erfahren, lautet nicht: Ex-Vorsitzender der jüdischen Gemeinde unserer Stadt ermordet. Sondern: »Ex-Adjutant Mosche Dajans hingerichtet«. Als wäre es eine Kriegshandlung. Nahöstliche Rache. Fremde unter sich.
Es ist Unsinn, in Wahrheit hat Lewin schon seit 1960 in Süddeutschland gelebt und gearbeitet, als Lehrer und Verleger von Büchern zu deutsch-jüdischer Kultur. Er ist 1911 in Jerusalem geboren worden, in die Großfamilie Rivlin, die sich dort vierzehn Generationen zurückverfolgen lässt. Aber schon seit dem ersten Lebensjahr hat er im Deutschen Reich gelebt. Sein Vater, ein Rabbiner, war damals einem Ruf an eine Synagoge ins preußische Posen gefolgt.
In ihrer Ermittlung mit dem Aktenzeichen 340 Js 40387/81 beschreiben die Polizisten die beiden Mordopfer jetzt so: »Frida Poeschke, Glaubensbekenntnis: evangelisch, Staatsangehörigkeit: deutsch«. Und: »Shlomo Lewin, Glaubensbekenntnis: mosaisch«; seine Staatsangehörigkeit interessiert offenbar nicht. Dabei ist Lewin Deutscher. Sein Vater hat sich 1914 – als das Deutsche und das Russische Reich sich an die Kehle gingen – freiwillig als Feldrabbiner gemeldet, zum Dank haben er und seine Familie die Staatsangehörigkeit erhalten.
Später hat Shlomo Lewin in Köln studiert, erst auf der Flucht vor den Nazis ist er von 1938 an für einige Jahre, um sein Leben zu retten, in die damalige britische Kolonie Palästina gekommen, auf deren Gebiet im Jahr 1948 der Staat Israel gegründet wurde. Seit 1960 ist er wieder in Deutschland.
»Ex-Adjutant Mosche Dajans hingerichtet«: Als die Zeitung mit dieser Schlagzeile aufmacht, hat dies Folgen. Tags darauf geht beim Oberbürgermeister ein Brief ein, Betreff: »gekillerter Israeli, samt Hure«, der anonyme Verfasser schreibt: »Die gehen und kommen, wie sie belieben! 1 Dutzend Reisepässe in der Tasche! Wenn der Oberstinker im Kriegsstab bei Dajan war, hat der doch bei uns gar nichts mehr zu suchen und muß seine Exekution dort bei den Arabern abwarten!«
»Kompromittierendes Material«
Am Tag nach dem Mord wird Arno Hamburger, Lewins Nachfolger im Amt des Gemeindevorsitzenden, gleich drei Mal von anonymen Anrufern bedroht: »Arno Hamburger, du verfluchte Judensau, Shlomo Lewin war der Erste, du bist der Nächste. Du kannst dich darauf vorbereiten«, kündigt einer an. Ein anderer bekräftigt: »Du entgehst uns nicht.«
Hamburger hat den Holocaust dank eines Kindertransports nach Palästina überlebt. Nach dem Krieg hat er seine Eltern in Nürnberg wiedergefunden, der Rest der Familie war ermordet worden. Die Eltern waren zu schwach, um fortzugehen und noch einmal ein neues Leben anzufangen. Als einziges Kind, so hat Hamburger einmal erzählt, habe er dann »das moralische Empfinden gehabt, dass ich meine Eltern nicht allein lassen könnte«.
Viele Mitglieder der Gemeinde sind in Angst, manche meinen, in der Mordnacht auch vor ihrer eigenen Wohnung seltsame Gestalten gesehen zu haben. Man hatte »Befürchtungen«, erinnert sich Rose Wanninger, die spätere Gemeindevorsitzende in Erlangen in den 1990er-Jahren, ihr Mann habe deshalb eine Weile »mit dem Colt unter der Matratze« geschlafen.
Es sind schreckliche Tage, deutschlandweit herrscht »blankes Entsetzen« in den jüdischen Gemeinden, so hat Paul Spiegel später in einem Interview erzählt, der Präsident des Zentralrats der Juden in den frühen 2000er-Jahren. »Aber auch Entsetzen darüber, dass das von der breiten Gesellschaft nicht so wahrgenommen wurde.« Paul Spiegel denkt anfangs, jetzt würde ein Aufschrei durch das Land gehen. Er irrt sich. Stattdessen geschieht etwas anderes.
Arno Hamburger, Lewins Nachfolger, bekommt Besuch von Ermittlern des Bayerischen Landeskriminalamts. Aber nicht, um ihm Schutz zu bieten. Sondern um ihn als Verdächtigen zu befragen.
Hamburger ist ein Mann mit breiten Schultern und Lederjacke, ein gebürtiger Nürnberger, der Fränkisch spricht, sich in Fußballvereinen engagiert und für die SPD im Stadtrat sitzt. Er ist bodenständiger als der kunstsinnige Lewin, der zu Demonstrationen gegen die NPD auf dem Nürnberger Hauptmarkt schon mal eine Dixieland-Band mitbrachte. Die beiden sind keine Freunde gewesen.
Aber ein Mord? Die Ermittler steigen hinab in den Keller von Shlomo Lewin. Sie vermuten, er habe dort »kompromittierendes Material gesammelt oder aufbewahrt«, um andere Juden zu erpressen. Dies könne »wertvolle Hinweise auf den möglichen Täterkreis« ergeben, so sagt es der Leitende Oberstaatsanwalt Dr. Rudolf Brunner auch vor Journalisten.
Lewin hat sein Archiv nicht für Erpressungen, sondern »lediglich« für den Betrieb seines kleinen Verlags genutzt, notiert der Staatsanwalt nach der Durchsuchung enttäuscht. Der Verlag »Ner Tamid«, ewiges Licht, gibt illustrierte Bände zu jüdischer Zeremonialkunst heraus, historische Essays, auch Dokumentationen über »den Nazismus in Westdeutschland«, sehr erfolgreich ist er nicht, Lewin hatte ihn schon so gut wie aufgegeben.
An ihrer Hypothese vom jüdischen Mordkomplott halten die Ermittler dennoch fest. Als Israels Regierung nachfragt, weshalb denn nichts vorangehe bei dieser Ermittlung, antworten die Deutschen: Gemach. Die Staatsanwaltschaft, so heißt es in einem Vermerk an die deutsche Botschaft in Tel Aviv vom 9. Januar, halte »sowohl persönliche als auch politische Motive für möglich (Tendenz: persönliche Motive)«.
Von Neonazis ist da noch immer keine Rede.
Wer sich jetzt an den NSU erinnert fühlt, an den entsetzlichen Umgang der Ermittler mit den Opfern der Neonazi-Bande in den 2000er-Jahren, dem geht es wie mir. Auch dort verdächtigten die Ermittler vor allem die meist türkischstämmigen Opfer und ihr Umfeld. Auch dort stellten sie die Ermordeten als Menschen hin, die von ihren angeblichen dunklen Geheimnissen eingeholt worden seien.
Im Fall von Shlomo Lewin verbreitet die Lokalzeitung, orthodoxe Juden könnten ihn umgebracht haben, weil er mit einer Christin zusammenlebte. »Seine Familie in Israel« habe »bisher ebenfalls wenig zur Aufhellung beigetragen«. Und lange bevor in Nürnberg die Tochter des ersten NSU-Mordopfers Enver Şimşek, Semiya Şimşek, die Fragen ertragen muss, ob ihr ermordeter Vater eine Affäre gehabt habe, bei Drogengeschäften mitgemacht oder womöglich für die Kurdenpartei PKK spioniert habe, verschicken die Ermittler im Mordfall Shlomo Lewin eine ausführliche Liste an alle Landeskriminalämter bundesweit. Thema: Lewins Liebesleben.
»Schillernde Vergangenheit«
Die Nachrichtenagentur ddp vermeldet am 8. Januar 1981: Der Leitende Oberstaatsanwalt Dr. Brunner sei nach genauer Erforschung des Lebens des Ermordeten zu dem Ergebnis gekommen, dass Shlomo Lewin einen »bunten Lebenslauf« gehabt habe. Zwei Scheidungen. Ein unehelicher Sohn. Es gebe »Ungereimtheiten« in Lewins »schillernder« Vergangenheit, schreiben die Erlanger Nachrichten.
Angehörige sprechen damals von einer zweiten Hinrichtung, einer totalen Rufzerstörung. Eine »mörderische Hand« habe ihn getötet, sagt bei der Trauerfeier am 25. Dezember 1980 ein Cousin, Arie Frankenthal. »Eines steht aber fest: dass diese Hand nicht ruht, sondern sogar nach dem schrecklichen körperlichen Tod auch seine geistige Ermordung, durch die negative Darstellung seiner Person in der Presse, herbeiführen will und dadurch auch das Blut seiner Kinder vergossen wird.«
Heute wird oft behauptet, dass die Ermittler aus ihrem Versagen beim NSU gelernt haben. Seither würden sie stärker auf rechtsextreme Hintergründe achten. Das hätten die Ermittler, zumal in Nürnberg, natürlich schon aus dem Fall Lewin lernen können.
Es herrschen Temperaturen unter null, als sich die Trauergäste in der Aussegnungshalle in Fürth versammeln, es ist ein jüdischer Friedhof, wie es Hunderte gibt in der Bundesrepublik. Die letzte Schändung liegt in Fürth damals zwei Jahre zurück, im März 1978 sind hier Grabsteine umgestoßen und mit NS-Parolen beschmiert worden, im Jahr 1964 haben Rechtsextreme hier 39 Grabsteine umgeworfen, im Jahr 1960 sind 30 Grabsteine zerschlagen worden.
Einer der Trauergäste, Josef Jakubowicz, bittet die Polizei, den Sarg anschließend ins Polizeipräsidium mitzunehmen. »Ich hab gebeten«, erinnert er sich, »dass man soll die Leiche nicht schänden, also bewachen über Nacht.« Das Begräbnis soll nicht hier, sondern erst einige Tage später in Israel stattfinden. In Israel begraben zu werden, das hat sich Shlomo Lewin zwar nicht selbst gewünscht. Ein Testament hat er nicht hinterlassen. Aber seine Freunde finden, das sei das Beste.
Auch Beamte des Landeskriminalamts sind zu der Trauerfeier gekommen. Sie sehen sich um nach Verdächtigen. Sie bitten den Kantor, den Vorbeter der Gemeinde, zu sich. Sein Name ist Baruch Grabowski. Als ich ihn in Nürnberg besuche und danach frage, lächelt er. Er fand es nicht schlimm, dass die Polizei ihn damals verdächtigte, »sie hat jeden verdächtigt«.
Grabowski ist Argentinier. Er ist 1969 gemeinsam mit seiner Frau, einer Opernsängerin, nach Europa gekommen. Während sie Engagements an großen Häusern in Madrid, Brüssel und Paris hatte, suchte er nach Arbeit in einer Synagoge. Jedes Land dieses Kontinents wäre ihm lieber gewesen als Deutschland, erinnert er sich. Als er nach langer Suche nur ein einziges Angebot bekam, aus Nürnberg, war seine Familie entsetzt. Schlimm genug, dass es Deutschland war. Aber dann auch noch die Stadt der Rassengesetze.
Es war ein Onkel, der schließlich den Ausschlag gab. Er riet: »Weißt du, wir sind Juden, und wir haben die Pflicht zu zeigen, trotz der Geschichte, trotz aller Verfolgungen: Wir sind da.« »Lamrot hakol«, sagt Grabowski auf Hebräisch. Das heißt: Trotz alledem. Es ist eine Art Credo geworden. »Das hat mir Kraft gegeben.«
Die Ermittler bohren nach. Wo war Grabowski in der Tatnacht? Wie gut kannte er Lewin? Sie befragen auch Josef Jakubowicz. Ihn kennen sie schon. Sie haben ihn bereits am Abend des Mordes an den Tatort gerufen. Seine Telefonnummer hatten sie auf einer Hochzeitseinladung in Lewins Wohnung gefunden. Er sollte die Leichen identifizieren. »Ich bin auch mitgefahren in die Pathologie«, erinnert er sich später, »ich habe gebeten, dass man die Sektion schonend machen soll.«
Seine Eltern und Großeltern sind ermordet worden, er selbst hat elf Konzentrationslager überlebt, am schlimmsten sei die Zwangsarbeit bei der Reichsbahn gewesen, »das waren die größten Mörder, was es gibt«. In Nürnberg hat er eine Videothek betrieben. Auch er gilt jetzt als verdächtig. »Sie haben alle befragt«, erinnert er sich. »Mich. Meinen Sohn. Alle.«
Die Polizisten holen den damals 30 Jahre alten Henry Majngarten, den Vorsitzenden des jüdischen Fußballklubs Bar Kochba e. V., sogar mittags an seinem Arbeitsplatz ab, einem Nähbetrieb in Fürth. Es dauert bis Mitternacht, »dann hatte ich alle meine Freunde erreicht, die bezeugen konnten, wo ich an dem Abend war«, erzählt er mir am Telefon. Heute lebt er in Israel.
Wehrsportgruppe Hoffmann
Wären die Ermittler gleich der Spur in die Neonazi-Szene gefolgt, sie hätten den Täter noch fassen können. Er hat es den Ermittlern nicht schwer gemacht, am Tatort hat er eine Sonnenbrille fallen gelassen, die eine Sonderanfertigung war. Ein örtlicher Optiker hatte sie der Freundin des Neonazi-Führers Karl-Heinz Hoffmann geschenkt.
Der Anführer der Wehrsportgruppe Hoffmann beschäftigt Polizei und Justiz schon lange. Als eine italienische Illustrierte, Oggi, einmal ein üppig bebildertes Porträt über ihn veröffentlicht, eine filmreife Gestalt mit Kaiser-Wilhelm-Bart und einem Puma als Haustier, der mit einer Schar seiner Getreuen auf Schloss Ermreuth 14 Kilometer von Nürnberg lebt – da stellt sie Shlomo Lewin als seinen örtlichen Gegenspieler dar.
Aber erst nach fünf Wochen tauchen die bayerischen Ermittler auf dem Schloss auf, wo auch der Todesschütze gelebt hat. Acht Monate vergehen, bis am 20. August 1981 das Amtsgericht Erlangen einen Haftbefehl gegen Uwe Behrendt erlässt, Hoffmanns »Unterführer« und rechte Hand, »z. Zt. unbekannten Aufenthalts«. Da ist er schon ins Ausland abgetaucht, in ein palästinensisches Ausbildungslager im Libanon.
Erst 1984 beginnt ein Prozess gegen Hoffmann als mutmaßlichen Auftraggeber des Mords. Da sind die Richter auf das wenige angewiesen, was er ihnen zu erzählen bereit ist, ein Schwadroneur, der kokettiert, sein Ruf als »Judenfresser« sei weit übertrieben. Es ist eine hübsch glatte, eine für Hoffmann weitgehend entlastende Geschichte. Er, Hoffmann, habe von nichts gewusst.
Die Tat sei »bis heute nicht geklärt«, schreiben die Erlanger Nachrichten noch zum zehnten Todestag Lewins im Jahr 1990. Es ist ein bemerkenswertes Stück Journalismus, in dem Artikel findet sich kein Wort über Rechtsradikale, kein Wort über Antisemitismus. Den beiden Opfern geschieht kurz gesagt, was leicht auch den Opfern des NSU hätte widerfahren können, hätte sich der NSU nicht spektakulär selbst enttarnt und zu seinen Taten bekannt. Sie geraten in Vergessenheit.
Deutschland, so erinnert sich der Kantor Grabowski, der heute 85 Jahre alt ist, sei für ihn als Einwanderer aus Argentinien »ein anderer Planet« gewesen. »Diese Kälte.« Shlomo Lewin dagegen habe große Wärme ausgestrahlt, hingebungsvoll, manchmal auch überschäumend. »Er hatte so eine starke Stimme!« Manchmal sang Lewin die jiddischen Chansons von Mordechaj Gebirtig.
Lewin war in religiösen Dingen relaxt, erinnert sich meine Mutter. Unkonventionell, sagt mein Vater. Meine Eltern lebten in Erlangen, als Mitglieder der jüdischen Gemeinde waren sie ein paarmal bei Lewin und Poeschke zu Gast, immer donnerstags war »open house« bei ihnen im Wohnzimmer. Meine Eltern hatten gerade geheiratet. Die Kuchenplatte, die Lewin ihnen schenkte, benutzen sie heute noch.
Als ich geboren wurde, lag der Mord schon mehr als zwei Jahre zurück. Aber ich bin mit diesen Menschen aufgewachsen. Der Kantor hat mich auf meine Bar Mitzwa vorbereitet. Ich bin zur Schule gegangen mit der Enkelin von Josef Jakubowicz, hatte Religionsunterricht mit den Kindern von Henry Majngarten.
Es ist ein winziger jüdischer Mikrokosmos gewesen, in meiner Kindheit gab es gerade einmal 30 000 Juden in Ost- und Westdeutschland. Von 1990 an sind einige aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion hinzugekommen, wo sie wegen ihrer Religion schikaniert, beim Studium und der Berufswahl behindert wurden. Heute zählen die Gemeinden insgesamt etwa 150 000 Mitglieder, immer noch viel weniger als in Frankreich oder England.
1996 habe ich in der Nürnberger Synagoge Bar Mitzwa gemacht, draußen wachte die Polizei. Einer der Freunde meiner Eltern hatte einen Waffenschein, weil er regelmäßig Drohanrufe erhielt wie Arno Hamburger. Ich habe mir damals, als Kind, nicht einmal viel dabei gedacht. Das ist der Zustand, Juden in Deutschland kennen ihn seit Jahrzehnten nicht anders. Aber man darf sich niemals einreden, das sei normal. Nichts davon ist normal.
Heute werden die allermeisten antisemitischen Gewalttaten in diesem Land nicht einmal angezeigt, so gering ist das Vertrauen in Polizei und Justiz. Das liegt auch an Ermittlungen wie denen im Fall Lewin/Poeschke. Oder jener in München nach dem Brandanschlag auf das jüdische Altenheim mit sieben Getöteten im Februar 1970, als die Ermittler ebenfalls lange einen Verdacht gegen die jüdische Gemeinde selbst streuten.
Der Terror ist nie weg gewesen. Kurz vor dem Münchner Brandanschlag gab es die Bombe im jüdischen Gemeindehaus in Berlin während der Gedenkfeier am 9. November 1969, dann 1982, ebenfalls in Berlin, die Bombe im jüdischen Restaurant »Mifgash«, die ein 14 Monate altes Mädchen tötete, 1988 die Autobombe, die vor dem neu eröffneten jüdischen Gemeindehaus in Frankfurt am Main explodierte, 1992 den Kopfschuss auf offener Straße, der eine 68-jährige jüdische Garderobiere tötete, die für den rechtsextremen Täter an ihrer KZ-Tätowierung erkennbar war, 1994 die lichterloh brennende Synagoge von Lübeck, 1998 Sprengstoffanschläge auf das Grab des Präsidenten des Zentralrats der Juden, 2000 den Rohrbombenanschlag auf jüdische Sprachschüler in Düsseldorf, im selben Jahr auch Brandanschläge auf die Düsseldorfer, Erfurter und Essener Synagogen, 2003 ein Bombenkomplott gegen die Grundsteinlegung der neuen Münchner Synagoge, immer wieder Steinwürfe, Briefbomben, und wieder Molotowcocktails auf die Synagogen in Mainz und Worms im Jahr 2010 und in Wuppertal 2014.
Am 9. Oktober 2019 folgte dann der Anschlag eines schwer bewaffneten Rechtsextremen auf die voll besetzte Synagoge in Halle an der Saale. Antisemiten haben in den vergangenen Jahren immer weiter Hemmungen abgelegt, die Schlagzahl hat sich erhöht. Es braucht hohe Zäune, so traurig das ist. Judentum in Deutschland, das ist heute Religionsausübung im Belagerungszustand. Aber der Staat hat auch zugelassen, dass es so weit kommt. Durch eine Polizei, die diese Gefahr vielerorts nicht abwehrt, sondern seit Jahrzehnten verwaltet. Durch eine Justiz, die immer wieder beschönigt. Heute werden die allermeisten antisemitischen Gewalttaten in diesem Land nicht einmal angezeigt, so gering ist das Vertrauen in Polizei und Justiz. Das liegt auch an Ermittlungen wie denen im Fall Lewin/Poeschke.
Vieles davon trifft auch andere rassistisch Marginalisierte. Judenfeindlichkeit, Muslimfeindlichkeit: Same shit, different asshole. Die Recherche zur Arbeit von Sicherheitsbehörden und Justiz, die ich in diesem Buch unternehme, muss deshalb Teil einer weiter gefassten Kritik sein. Wenn der Rechtsstaat den Schutz mancher Bevölkerungsteile weniger ernst nimmt als den anderer, ist das nicht nur ein Sicherheitsproblem. Es ist ein Gerechtigkeitsproblem.
Die tägliche Angst
Schulkinder, die Polizeischutz brauchen
»Wir wünschen euch, dass ihr friedlich spielen könnt.«
Selbst gemaltes Plakat von Berliner Grundschülern für den Kindergarten der orthodox-jüdischen Chabad-Gemeinde in Berlin-Wilmersdorf, nachdem unbekannte Täter in der Nacht zum 25. Februar 2007 die Fassade mit Hakenkreuzen und Hetzparolen wie »Scheiß Juden« und »Weg hier« beschmiert, eine Rauchbombe in das Gebäude geworfen und Spielzeug mit SS-Runen beschmiert und zerstört hatten
Die Schleuse öffnet sich
Die Kinder hüpfen auf und ab, zupfen an ihren Sitzgurten, es ist der erste Morgen nach den Herbstferien. In einem weißen Minibus sitzen Eliyah, Klasse 3a, Hannah, Eva und Amelie, Klasse 2a, und die viereinhalbjährige Marit, die noch in die Vorschule geht und in ihrem Rucksack nur die Brotbox hat. Der Bus musste bereits einmal außerplanmäßig halten, Toilettenpause, auf dieser Fahrt, die manchmal von Eltern begleitet werden darf. Aber jetzt ist es so weit, Endhaltestelle: Heinz-Galinski-Schule.
An der jüdischen Grundschule in Berlin-Charlottenburg waren die Ferien besonders lang diesmal. Erst fiel das jüdische Neujahrsfest Rosch ha-Schana in die Woche mit dem Tag der Deutschen Einheit, da blieb die Schule zu. Dann kamen zwei Wochen staatliche Herbstferien. Dann noch mal zwei jüdische Feiertage, Schemini Azeret und Simchat Tora, da werfen Eltern in der Synagoge Bonbons, die Kinder sammeln sie auf. Jetzt endlich soll der Alltag wieder beginnen. Das normale Leben. Wenn jemand das so nennen möchte.
Der Minibus, in dem die Kinder hinter getönten Scheiben sitzen, hält vor einem Gebäude, das von einem Zaun umstellt ist. Metallstangen, Metallspitzen, Videokameras. Ein erstes Tor öffnet sich, der Bus fährt hinein, das Tor schließt sich, dann kommen Sicherheitsleute mit Walkie-Talkies.
Es ist November 2019, vier Wochen zuvor hat ein Rechtsradikaler versucht, in eine Synagoge in Halle einzudringen, er wollte die Betenden mit selbst gebauten Waffen töten. Er kam wie aus dem Nichts, sagen die Sicherheitsbehörden, und weil dies keine sehr beruhigende Erklärung ist, sehen die Kinder durch die Scheiben ihres Busses an diesem diesigen Morgen auch einen Polizisten, der ihre Schule bewacht.
Der Bus fährt weiter, die Schleuse öffnet sich nach innen auf den Hof der Schule. Die Wachleute, junge Männer in Jeans und Kapuzenjacken, geben Handzeichen. Auch die Lehrer kommen gerade zur Arbeit, aber durch einen anderen Eingang, an dem hinter einer dicken Glasscheibe ein junger Israeli sitzt und jedem von ihnen zuwinkt. Ein Metalldetektor fiept.
Normales Leben: So sieht das aus an einer Grundschule, die sich von anderen nur dadurch unterscheidet, dass die Kinder im Herbst Chanukkaleuchter aus Knetmasse basteln statt Adventskerzen. Dass sie an jüdischen Feiertagen freihaben und dafür mehr Nachmittagsunterricht absitzen müssen. Normaler Alltag, das heißt, dass sie das Verhalten bei einem Terrorangriff auf die Schule üben, und zwar schon bevor sie das Abc beherrschen. Es gibt dafür Probealarme, mehrmals im Jahr. Die größte Herausforderung dabei ist: Die Kinder dürfen keinen Mucks von sich geben.
In Frankreich ist in der Stadt Toulouse im Jahr 2012 ein Attentäter in eine jüdische Schule eingedrungen. Er erschoss vier Menschen, sie waren dreißig, acht, sechs und drei Jahre alt. In Belgien befahl die Polizei allen jüdischen Schulen zu schließen, nachdem ein Attentäter im jüdischen Museum um sich geschossen hatte. Auch in Paris, wo ein Islamist 2015 in einem koscheren Supermarkt vier Menschen erschoss, waren eigentlich jüdische Schulkinder das Ziel gewesen, wie sich später herausgestellt hat. Allein die Sicherheitsvorkehrungen hatten den Mann in letzter Minute abgeschreckt.
Hinter dem hohen Zaun in Berlin-Charlottenburg wuchert ein riesiger verwilderter Garten, und es gibt eine Rutsche, die so hoch ist, dass die Kinder erst ab der dritten Klasse drauf dürfen. In der Mitte des Schulgeländes steht eine verwinkelte kleine Bastelwerkstatt, Tonfiguren trocknen auf der Fensterbank. Wie eine Mutter aus Frankfurt am Main sagt, die früher selbst auf die jüdische Grundschule dort gegangen ist: Es gibt eine Geborgenheit.
Als Annabelle G. ihre Tochter zum ersten Mal in die jüdische Schule in Frankfurt brachte und das Surren der Sicherheitsschleuse hörte, habe das ein vertrautes Gefühl in ihr ausgelöst. Dieses Geräusch. Dieser Raum mit den Videobildschirmen. »Den kannte ich noch.« Die netten jungen Israelis, die aufpassen: »Die Kinder lieben die.«
Die Frage ist, was für ein Land eigentlich da draußen liegt, auf der anderen Seite des Schulzauns. Ein Land, in dem es Wachleute braucht, damit Kinder im Musikunterricht ein paar Schabbat-Evergreens singen können. Die zweifache Mutter Annabelle G. zündet sich vor einem Café eine Zigarette an. Es ist einer der letzten milden Tage in Berlin. Sie ist gerade zu Besuch aus Frankfurt. Sie bittet, ihren Nachnamen nicht zu erwähnen.
Wir kennen uns seit dem Studium. Sich zu verstecken ist eigentlich überhaupt nicht ihre Art. »Sind mir zu abgefuckte Zeiten einfach«, sagt sie. Im Radio lief gerade eine Sendung darüber, dass in rechtsradikalen Kreisen Listen mit den Namen von Juden kursieren, gekennzeichnet mit einem Stern.
»Diese No-go-Area-Scheiße«
Annabelle G. schickt ihre Tochter gern auf die jüdische Schule. Die Lehrerin sei toll, ihre Kinder knüpften Freundschaften zu Kindern, mit deren Eltern Annabelle G. selbst seit ihrer Kindheit befreundet ist. Und die Kinder lernten ihre jüdische Identität als etwas Positives kennen, ohne sich als Außenseiter zu fühlen. Das sei wertvoll. »Aber nach Jom Kippur«, nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle, »hab ich mir gesagt, ich kann sie nicht mehr hinbringen.«
Sie hat mit ihrem Mann darüber gesprochen. Am Ende waren sie sich einig: Man kann der Gefahr nicht entgehen. Man muss mit ihr umgehen. Und man muss auch einsehen, dass es den Kindern nicht verborgen bleiben wird. Natürlich kann man versuchen, ihnen etwas vorzumachen. So wie morgens, wenn der Bus auf dem Schulgelände in Berlin ankommt und die Sicherheitsleute eine lange Stange unter den Bus schieben, an dessen Ende ein Spiegel befestigt ist. Wie in einer militärischen Sperrzone. Das sei doch nur, »damit man sieht, dass das Auto nicht kaputt ist«, hat eine Siebenjährige neulich zu Hause erzählt. So habe ihr das jedenfalls der Busfahrer erklärt.
Die Kinder bekommen natürlich trotzdem eine Menge mit, auch bei all den Worten der Solidarität nach der Attacke in Halle. Sie hören »Anschlag« und »bewaffnet«, sie spüren die Angst. Und dann geschieht es wie in Frankfurt am Main, wo an der jüdischen Grundschule die Lehrerin der ersten Klasse am ersten Schultag nach der Attacke in Halle im Sitzkreis fragt, was in den Ferien so passiert sei. Zwei Kinder erzählen vom Anschlag. »Sehr detailliert«, wie die Lehrerin sagt. Durch die moderne Fassade der Grundschule geht ein dramatischer, riesiger Riss, eine Idee des Architekten.
Die Lehrerin unterbrach die Kinder. Sie versuchte, das Gespräch umzulenken auf das Thema jüdische Religion und andere Religionen und erklärte den Kindern, »dass wir alle das Recht haben, so zu sein, wie wir sind, mit blonden oder braunen Haaren«. Aufwühlende Minuten seien das gewesen, schreibt die Lehrerin in einer E-Mail. Dann sei es weitergegangen mit dem Gespräch über die »schönen Erlebnisse der Kinder in den Herbstferien«. Die meisten Kinder seien ein bisschen verwirrt zurückgeblieben. Sie hätten später aber nicht mehr danach gefragt.
Jüdisches Leben in Deutschland, das ist auch die Frage: Wie erkläre ich’s den Kindern? Wie beschütze ich sie vor schlimmen Wahrheiten? Darf man das überhaupt: die Kinder abschirmen? Und: Schafft man das, sie abzuschirmen?
»Ein böser Mann hat versucht, etwas Böses zu machen, aber zum Glück ist er nicht in die Synagoge reingekommen«, hat die Lehrerin in Frankfurt den Erstklässlern gesagt. Von der zweiten Klasse an aufwärts hatten die Lehrer sogar die Anweisung, den Anschlag von sich aus zu thematisieren. Um den Kindern zu zeigen, dass sie bei Angst jederzeit Hilfe erhalten könnten. Die Lehrer haben die Kinder auch aufgefordert, vorsichtig zu sein.
Annabelle G. ärgert sich darüber. »Wozu sagt man Kindern, sie sollen aufpassen?« Ihre Tochter ist erst sechs, »sie soll aufpassen, dass sie rechtzeitig auf die Toilette geht oder dass sie an ihre Hausaufgaben denkt. Mehr nicht. Man kann nicht vor Terroranschlägen aufpassen. Was soll man da aufpassen? ›Meiden Sie große Plätze‹? Das ist diese No-go-Area-Scheiße«, sagt sie, das solle man nicht schon kleinen Kindern vermitteln. »Es ist nicht die Aufgabe von Fünf- und Sechsjährigen, wachsam zu sein. Das ist unsere Aufgabe als Eltern.«
Sie holt ihr Handy heraus. In der WhatsApp-Gruppe der Eltern in Frankfurt wurde diskutiert. Es gab Protest. Annabelle G. liest vor. Die Elternvertreter schrieben der Lehrerin: Man sei »teilweise geschockt, dass mit den Kindern überhaupt über das Thema gesprochen wurde«. Die Eltern hätten »teilweise versucht, die Ereignisse von den Kindern fernzuhalten«, um sie zu beschützen.
Es sei schon schwierig genug. Die Kinder würden früh genug Angst bekommen in ihrem Leben. Wenn man ihnen jetzt Dinge erzähle, die ihnen Angst machten: Ist es nicht genau das, was die Täter wollen?
Jüdische Lieder im Supermarkt
Auch in der Oranienburger Straße in Berlin stehen in den Wochen nach dem Anschlag in Halle vier Mann vor der Neuen Synagoge Wache. Keine netten älteren Herren mehr wie vorher. Sondern junge Männer mit Maschinenpistolen. Es ist fast erleichternd, wenn man mit den Kindern an ihnen vorbei ist. Die Schleuse öffnet sich, die Schleuse schließt sich mit hydraulischem Zischen. Die Welt bleibt draußen.
Die Neue Synagoge hat eine historische Fassade und eine goldverzierte Kuppel. Ein Postkartenmotiv. Der historische Bau dahinter aber ist ausgebombt und entkernt, drinnen sieht es teils eher aus wie in einer alten Gesamtschule. Enger Fahrstuhl, Glastüren, Linoleumboden.
Zwei Tage nach dem Anschlag in Halle hat die Rabbinerin der Neuen Synagoge, Gesa Ederberg, eine E-Mail an ihre Gemeindemitglieder verschickt. Sie erinnerte daran, wie es nach dem Anschlag auf die Synagoge in Pittsburgh mit elf Toten im Oktober 2018 war. Damals kamen in den USA viele Nichtjuden in den Gottesdienst, unter dem Motto »Show up for Shabbat«.
Ein solcher »Ansturm« der »nichtjüdischen Unterstützer*innen« sei nicht das Richtige, so die Rabbinerin. »Es ist uns wichtiger, dass sie auf den Straßen der Stadt und mehr noch in persönlichen Begegnungen mit antisemitischen (und homophoben und frauenfeindlichen und muslimfeindlichen und …) Bemerkungen ihre Stimme erheben.«
Der Gottesdienst soll ein Ort der Besinnung bleiben, nicht alles vom Terror überlagert werden. Im Gebetsraum hängen von Kindern gebastelte Bilder. Vor dem Gebetsraum liegen Broschüren aus, eine zeigt einen Davidstern in Regebogenfarben, Titel: »Jüdisch und queer. Niemand soll sich zwischen jüdischer und queerer Identität entscheiden müssen«.
»Wir sagen unseren Kindern: Ihr seid jüdisch«, sagt Miron Kropp, die blonden Haare stecken unter einer Baseballmütze. Seine Tochter geht auch auf die jüdische Grundschule in Charlottenburg, früher war er selbst dort Schüler. »Andererseits: Man muss es nicht jedem zeigen.« Das sei der Zwiespalt, den er im Grunde furchtbar finde. Die Kinder sollten sich nicht eingeschlossen fühlen. Sie sollen nicht mit dem Gefühl aufwachsen, sich verstellen zu müssen. Und trotzdem.
Als seine Tochter kleiner war, ging sie in den jüdischen Kindergarten, »da hat sie in jedem Supermarkt angefangen, jüdische Lieder zu singen, und auch, jedem zu erzählen: Wir feiern kein Weihnachten, wir sind jüdisch.« Die meisten reagierten darauf mit einem Lächeln. Als Vater fürchte man aber, dass sie auch mal auf den Falschen treffe. Miron Kropp selbst ist einmal in der U-Bahn getreten worden, weil er eine Kette mit einem Davidstern trug. Und er findet: Man müsse den Kindern helfen, sich in der Welt zu orientieren, in der sie nun mal leben.
Der Anschlag in Halle hat ihn noch einmal nachdenklicher gemacht, sagt er, aber keinen Moment lang habe er darüber nachgedacht, seine Tochter von der jüdischen Schule zu nehmen. »Ja, das hat jetzt uns getroffen. Aber es hätte auch Muslime treffen können«, sagt er. »Oder Schwarze. Die können es – im Gegensatz zu uns – nicht verbergen. Ich kann den Davidstern wegtun, wenn es mir zu riskant ist.« Manchmal tue er das.
Das Thema Holocaust steht natürlich nicht auf dem Lehrplan einer Grundschule, auch nicht einer jüdischen. Aber an irgendeinem Gedenktag neulich kam es auf, und dann hat der Musiklehrer – warum ausgerechnet der Musiklehrer? – den Kindern mehr erzählt, als manchen Eltern lieb war. Jetzt erzählen Siebenjährige zu Hause von Nazis. Mit »giftigen Gasen« töteten sie die Juden, so hat neulich Hannah beim Abendessen erzählt, ihre vierjährige Schwester saß daneben. »Die haben gesagt: Wollt ihr duschen nach eurer langen Zugfahrt?« Aber aus den Duschen kam kein Wasser. Diese Geschichte mache sie so traurig, dass sie fast weinen müsse.
»Man schafft es eh nicht, die Kinder in Watte zu packen«, meint Miron Kropp. Wenn es nicht der Musiklehrer ist, dann hörten sie vielleicht zufällig im Autoradio die Nachrichten. »Bei einer Gedenkstunde des Bundestags für die ermordeten Juden Europas …« Kinder aus nichtjüdischen Familien würden bei solchen Sätzen vielleicht weghören. Unbekannte Wörter. Jüdische Kinder aber erkennen sie. Für Eltern heißt das, sie müssen sich entscheiden, wie ehrlich sie sein wollen. Und Miron Kropp findet: Besser, man ist gleich ehrlich. »Kinder sind viel schlauer, als man denkt.«
Anfangs habe die Heinz-Galinski-Schule noch fast normal ausgesehen, erinnert sich Miron Kropp. Die Mauern und Zäune seien erst später immer höher gewachsen, »wir hätten eigentlich gewünscht, dass sie mit den Jahren immer weniger nötig sind«.
Gerade hat die Direktorin der Heinz-Galinski-Schule einen neuen Rundbrief verschickt:
»Liebe Eltern, nach dem erschütternden Terroranschlag an Jom Kippur in Halle werden die polizeilichen Sicherheitsmaßnahmen vor allen jüdischen Einrichtungen vonseiten des Berliner Senats diskutiert und überprüft. Wir als Schulleitung haben uns ebenfalls Gedanken gemacht, wie wir die Sicherheit unserer Schule optimieren können …« Es folgen neue, verschärfte Regeln.
Gated Community
Niemand müsse sich doch separieren von der breiten Gesellschaft, heißt es manchmal vorwurfsvoll, niemand müsse sich doch absondern von der Masse und sich auf eine solche konfessionelle Schule zurückziehen. Alle Kinder könnten doch gemeinsam lernen. Manche meinen, dies sei gerade Teil des Problems, dieses Sich-separieren-Wollen. Anders-sein-Wollen.
Aber Anderssein, das ist nicht etwas, das man abwählen könnte. »Ich bin als jüdisches Mädchen oft genug daran erinnert worden, auch wenn ich auf einer staatlichen Schule mit lauter katholischen und evangelischen Mitschülern war«, sagt Klara D., deren zwei Söhne auf die jüdische Grundschule in München gehen.
Immer wieder guckt sie auf ihr Handy, vormittags arbeitet sie in einer Filmproduktionsfirma, jetzt holt sie ihre Kinder ab. Die Grundschule ist im Bauch eines großen Klotzes versteckt, des jüdischen Gemeindezentrums am Sankt-Jakobs-Platz. Auf dem Platz vor der Schule scheint die Sonne, es ist ein Kommen und Gehen.
In München gibt es eine Besonderheit. Gleich nebenan steht eine katholische Mädchenschule. Ein interessantes Nebeneinander, dort werden die Mädchen von Nonnen unterrichtet, ohne männliche Mitschüler, das ist auch eine Art von Sich-Separieren, meint Klara D., und andere Eltern würden sich für eine Waldorf- oder eine internationale Schule entscheiden.
Wer seine Kinder auf die jüdische Schule gibt, der hat sich das Anderssein im Vergleich wahrscheinlich noch am wenigsten ausgesucht. »Natürlich ist es auch angenehm, dass man sich mit Antisemitismus in der Schule nicht so auseinandersetzen muss«, sagt Klara D. Die jüdischen Schulen haben derzeit viel Zulauf. Es wechseln auch immer wieder Kinder mitten im Schuljahr dorthin, dahinter verbergen sich oft keine schönen Geschichten.
Schlimm an dem Zustand des Bewachtseins bleibt jedoch, dass er zwar kurzfristig ein Problem behebt, aber langfristig ein größeres Problem vertieft. Juden werden als privilegiert imaginiert. Als Leute, denen es zu gut gehe. Die teuren Security-Maßnahmen wirken fast noch wie ein Beleg. Als sei das ein Luxus, nicht eine finanzielle und sonstige Belastung. Der grundsätzliche Missmut gegenüber Juden, er wächst.
Bei der Polizei laufen manchmal sogar Beschwerden von eifersüchtigen Bürgern ein, so erzählen etwa die Beamten, die vor dem Jüdischen Museum Westfalen wachen, einem modernen Glas- und Betonbau in der Stadt Dorsten. »Da heißt es: Da steht die Polizei, und zu uns kommt der Streifenwagen bei einer Notsituation möglicherweise später, weil dieses Fahrzeug eben nicht frei ist und vor dem ›Judenmuseum‹ steht.«
Am Blumenmeer
Auch in Halle bemühen sie sich, zu so etwas wie Normalität zurückzufinden. Es ist eine besondere Akustik in diesem alten Gebäude in der Humboldtstraße, der weiche Gesang des Kantors hallt wider wie in einer Kirche, weil der Boden aus Stein ist und die Decke sehr hoch. Aber es dringen auch Kinderstimmen aus dem Nebenraum herein. Dort spielen sie Verstecken, die elfjährige Naomi hält sich gerade die Augen zu und zählt bis zwanzig.
Ende der Leseprobe