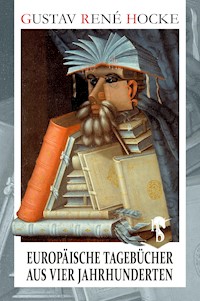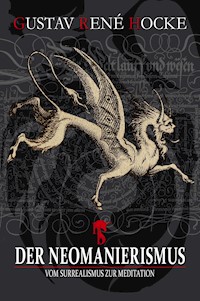
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Märchen, Traum- und Zauberwelten, Horror, Wahnsinn und das Abstruse … Phantastische Kunst und Literatur ist keine Erfindung unserer Zeit: Es gibt sie, seitdem Menschen künstlerisch tätig sind. In seinem originellen und atemberaubenden Streifzug durch die Kunst- und Literaturgeschichte Europas legt Gustav René Hocke anhand seines beeindruckenden Wissens den kulturgeschichtlichen Strang der Phantastik oder des Manierismus frei, der sich von der Antike bis in unsere heutige Zeit wie ein Roter Faden durch alle Epochen europäischer Kunstgeschichte zieht, bis er in unserer Zeit zu einer dominierenden Kunstform aufblüht. In »Der Neomanierismus« stellt Gustav René Hocke die Phantastik in der zeitgenössischen Kunst vor.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 620
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Gustav René Hocke
Der Neomanierismus
Vom Surrealismus zur Meditation
Den Freunden aus der Jugendzeit in der Folge der Jahre 1925–1939: Gert H. Theunissen, Adolf Frisé, Ernst Wolf Mujtaba Ali Syed,Hans Mayer, Karl Troost, Joseph Witsch, René König, Max Bense,Gerhard F. Hering, Ernst Johann, Alfred Neven Du Mont Hans Eberhard Friedrich, Dolf Sternberger, Karl Korn
Einführung
Man hat für die Zeit von etwa 1750 bis rund 1850 von einem »Neoklassischen Zeitalter« gesprochen[1]. Sehr wahrscheinlich wird später einmal ein »Zeitalter des Neomanierismus« festgestellt werden können, und zwar von etwa 1900 bis 2000(?).
Künstler, Dichter und Komponisten unserer Gegenwart, die mehr der Vorstellungskraft vertrauen als Maßstäben der bloßen »Naturnachahmung«, werden in allen Weltkulturen erörtert und immer mehr anerkannt. Auch das gehört zu den entscheidenden Wendungen unserer Zeit. Immer mehr Zustimmung finden – auch in Kreisen, die Kunst nur als klassizistische »idealisierte« oder gar nur gut »kopierte« Natur anzuerkennen bereit sind – Bilder, Gedichte, Kompositionen, die mehr vom seelischen Eigenleben (nicht nur der Künstler) künden.
Damit wird, in einem neuen positiven Sinne, nicht nur die »subjektive«, das heißt von der Innenerfahrung ausgehende schöpferische Leistung des Altmanierismus (16. Jahrhundert), bisher vielfach verworfen, als ein echter »Ausdruckszwang« (Benn) anerkannt. Es hatte auch dieser Meinungswechsel eine außerhalb von »Fachkreisen« oft noch nicht genau erkannte und erst recht noch nicht richtig gewertete Folge: das Entstehen eines heute international verbreiteten Neomanierismus.
Dieser soll hier dargestellt werden, und zwar in seiner zeitgenössischen Entwicklung vom Surrealismus bis zu einer Kunst und Dichtung, deren Ursprung in einem neuen Verhältnis zur Konzentration psychischer Kräfte in der Meditation liegt. Dazu vorerst noch eine Bemerkung.
Dem besonders geplagten Menschen von heute, umgeben von den harten Rhythmen der technisierten Gesellschaft, geht es nicht allein um die Rettung eines noch so kleinen Ich-Seins. Er sehnt sich auch nach Durchblick auf eine nicht nur materielle Welt, die seinem Kampf um individuelle Selbstbewahrung einen Sinn gibt. Man könnte sagen, dass man auf vielen persönlichen Wegen nach einer – nicht nur – irdischen Identität ausgeht, weil die Erlösungslehren der Kirchen heute für manche »abgegriffen« erscheinen.
Solange es Menschen gibt, die über ihren seltsamen Gastaufenthalt auf dieser Erde, zwischen Geburt und Tod, nachdenken, haben Künstler besonderer Art diese elementare »übersinnliche« Unruhe von seelisch empfindsamen oder geistig wachen Menschen in Bilder zu bannen versucht: der Kunst, der Dichtung, der Musik.
Manche, auch allerhöchste Meister, begnügten sich mit der bloßen Nachahmung der Natur. Andere, nicht minder vorzügliche, glaubten an eine Kunst »an und für sich«, das heißt an ihre rein ästhetischen Qualitäten. Nicht wenige dienten nur Dekorationsbedürfnissen, dem Streben nach gesellschaftlicher Geltung von Macht und Besitz, dem nur »prunkvollen« Selbstbehaupten also.
Mit Recht war Goethe entsetzt, als er, Student in Straßburg, Wandschmuck für den dortigen Empfang von Marie-Antoinette sah. Es handelte sich um schlecht gemalte Gräuelszenen, aus französischen Werkstätten niederen Ranges, die sozusagen zu einer Ehe-Verherrlichung der österreichischen Prinzessin dienen sollten. Sie stellten das Gegenteil eines möglichen Glücks dar. Goethe fand es unerträglich, dass kaum jemand auf diesen stofflich »sinnlosen« Wandschmuck achtete. Nur dekorative Werte galten, nicht mehr auch geistig und seelisch anregende, wirklich bedeutsame Stoffe von künstlerisch wirklich hervorragender Qualität.
Neomanierismus also! Doch kann man die Bedeutung dieses Begriffs besser erkennbar machen, wenn man zunächst einmal von einzelnen Künstlern ausgeht. Hier sollen also zunächst ihr Werk und zum Teil auch einige Grundaspekte ihres Lebens dargestellt werden. Rein abstrakte Erörterungen würden auch den Gutwilligen, der dieses faszinierende Panorama überblicken will, mehr irritieren als informieren, vielleicht sogar sein Interesse erlahmen lassen.
Deshalb beginne ich mit illustrierten Einzeldarstellungen, mit Monografien, die jeweils Werk und Person beispielhafter Künstler umfassen.
Ich stelle also hier Maler, Zeichner, Grafiker, Architekten und Bildhauer vor, die der Kunst wieder sinnstiftende Bezüge gegeben haben. Außerdem wird eine neue Entwicklung sichtbar. Die entsprechend »überreale« Tendenz führt von einer noch surrealistisch »konkreten« Kunst zu einer meditativen Kunst, die nun das »Bild jenseits des Bildes« sucht, das heißt auf das im Surrealismus noch Figurative verzichtet; in dieser Darstellung führt der Weg von Fabrizio Clerici bis Gerhard Hoehme. Beziehungen zur Dichtung und Musik werden immer wieder hergestellt.
Ich beginne meine beiden Bildsammlungen mit einer Deutung des Werkes von Fabrizio Clerici nicht nur seines Geburtsjahres (1913) wegen. Es gibt ältere Vertreter des Neomanierismus als ihn, die heute noch leben, doch gibt es gegenwärtig keinen Künstler seines Ranges, der so bewusst und wissend vom noch gegenständlichen Altmanierismus ausgeht und ihn so konsequent ins »Moderne« transponierte. Die Reihenfolge dieser Kurz-Monografien wird nicht allein von künstlerischen Qualitäten oder Generationsstufen bestimmt. Sie ergibt sich vor allem aus den zentralen Themata in meinen früheren Studien zur subjektivistischen Kunst des Manierismus[2]. Das »Nacheinander« schließt also keinerlei ästhetisches Werturteil ein. Man muss die Folge als einen individuell und qualitativ verschiedenen Zusammenhang sehen, der von der obengenannten Entwicklung vom Surrealismus zur Meditation künden soll. Ich gebe also nur vereinzelte Beispiele für eine weitverbreitete Erscheinung, weil ich sonst ein umfangreiches »Lexikon« hätte schreiben müssen, und das kann nicht meine Aufgabe sein.
Ein Einzelner kann sie auch gar nicht leisten. Man wird also manchen bedeutenden Namen vermissen. Immerhin habe ich in weiteren Studien auf andere wichtige Künstler der »Ideakunst« hingewiesen und auch manches über sie gesagt. Außerdem werden im zweiten, historisch-analytischen Teil viele weitere Namen genannt.
Ich hoffe, meine Kritiker überlesen diese Bemerkung nicht. Wie es in unserem menschlichen Erfahrungsbereich ebenso geschieht, wurden alle hier angeführten Künstler auch deshalb ausgewählt, weil es zu persönlichen Begegnungen mit ihnen kam, zu Gesprächen, die mir halfen, zu einem Meinungsaustausch, der mich ermunterte. Ich habe mich immer vor dem Schicksal des Kunstkritikers gefürchtet, der in Werke von Künstlern, Dichtern und Komponisten eigene Theorien hineingeheimnist, über die dann die Künstler lachen – auch sie sind nicht alle gutartig – oder weinen.
Im Frühjahr 1974 trafen sich in Ratzötz bei Brixen der Verfasser und die Verleger Marguerite Schlüter und Dr. Herbert Fleissner, um Konzeption und Anlage des Buches zu besprechen. Zunächst eher zufälliger, dann aber sofort begeistert engagierter Teilnehmer der Gesprächsrunde war Ephraim Kishon.
Die Formulierung des Untertitels, sowie die Verbindung der Künstlermonografien durch einen Haupttitel stellten das wichtigste Problem dar. Man wurde sich darüber einig, dass nicht nur handwerkliches Können und Beherrschung auch modernster formaler Verfahren Voraussetzung für angemessene künstlerische Kriterien bleiben sollten, sondern dass auch ein universalerer Begriff maßgebend werden müsse. Die »Intuitionen« des neuen Surrealismus und die »Anschauungen« einer neuen »Meditation« – alle subjektiv-manieristischen Charakters – bilden somit das Grundthema. Daraus ergaben sich, bei strenger Berücksichtigung jeweils individueller Inhalte und Formen im Werke der einzelnen Künstler, Ober- und Untertitel. Die wichtigsten historischen Kriterien dieser säkularen Entwicklung werden ebenso dargestellt (im analytischen Teil) wie Probleme zu differenzierteren epochalen Begriffen.
Zu danken habe ich hier allen Künstlern, die stets zu Auskünften aller Art bereit waren. Es bleibt aber dabei: Diese einundzwanzig Künstler stehen beispielhaft für viele Hunderte in Europa, Amerika und Asien.
In einer »ordnenden« Weise werden beide Monografien-Folgen von einem Motiv bestimmt: von dem fortschreitenden Abstraktionsgrad auch in der neomanieristischen »Ideakunst«. Der Bogen, der sich von Clerici bis zu Hoehme spannt, von »surrealistischer« bis zu »meditativer« Kunst, mag weit erscheinen. Er hat immer seine Fundamente in einer »Menschlichkeit«, die das Eigene in der Freiheit des Person-Seins erhalten will, aber stets in Bezug auf eine Gesellschaft, die noch immer unvollkommen ist und daher der Veränderung bedarf. Ohne von dieser Unerfülltheit aller Menschen, im Westen wie im Osten, zu wissen, und ohne sie illusionslos anzuerkennen, wird man das, was sich im Werk dieser Künstler spiegelt, ebenso wenig verstehen wie die Hoffnung, die sie zugunsten einer »Humanisierung« auch und gerade der Gesellschaft beflügelt: doch stets im Hinblick auf eben jenes »Surreale« oder in der »meditativen« Konzentration, die sie, jeden auf seine Weise, kennzeichnet und auszeichnet.
Gustav René Hocke,
Ostern 1975
Buch I
Monografien
Erster Teil
1. Fabrizio Cerlici – Mysterien des Absurden
Fabrizio Clerici wurde 1915 in Mailand geboren. Die Familie siedelte 1920 nach Rom um. Dort studierte Fabrizio Architektur, doch vor allem das »altmanieristische«, das »surreale« Rom. Eine frühe Freundschaft verband ihn mit Alberto Savinio, dem Bruder De Chiricos, des Dichters und Malers des »Absurden« in der alten wie neuen gräco-lateinischen Kultur. Clericis erste Zeichnungen entstanden: Abbilder von Träumen zwischen Verzweiflung und Zuversicht. Doch lenkt ihn sein energischer Spürsinn auf die »seltsamsten« Meister des Altmanierismus, auf den genialen Enzyklopädisten Athanasius Kircher, auf den »raumzerstörenden« Erhard Schön, auf die Optik-Phantasien von P. Niceron. Er reist viel, malt, macht Bühnenbilder. Wie Lionardo scheint ihn ein Fieber zu befallen: Bewusstseinserweiterung, Wissen, Erfassen, Festhalten … Aber nur das, was – für uns – »hinter den Dingen« steckt: Symbole, neue Symbole, wenn auch noch in ihren alten Gewändern. Zwischen 1950 und 1960 beherrscht Clerici das italienische Bühnenbild. Dazu zeichnet und malt er mit einer Energie, die selbst Picasso hätte imponieren müssen: Bilder aller Art, Zeichnungen, mit vielen Varianten. Er illustriert auch Klassiker, in einer geradezu überschwänglich phantastischen, aber stets »logistischen« Weise. Der letzte große Zeichner unserer Epoche? In Berlin erschien eine von ihm illustrierte Ausgabe des Milione von Marco Polo[3]. Intensität, Kälte und »metaphysische« Unruhe, bei völligem Verzicht auf Erbauungs-Gerede, kennzeichnen Clericis Werk. Welche Botschaft enthält es?
Jetzt, wo die Arabesken des Gegenstandlosen vielfach zu einer bloß dekorativen Neo-Ornamentik zu entarten drohen, jetzt erst beginnt der Maler, Grafiker, Zeichner und Bühnenbildner Fabrizio Clerici in Europa und Amerika Schule zu machen. In einer Welt sich verflüchtigender Formen der Kunst hat Clerici stets den Mut zu drei Zielsetzungen gehabt, die durch Dauer belohnt werden: Unverdrossenheit der geistigen Geschmackskultur, Beständigkeit eines ästhetischen Historismus, symbolische Chiffrierung der Gehalte. Gerade dieses letzte, so kontinuierliche und energische Vorhaben bewirkte, dass Clerici durch derart vielfältige Impulse eine gelegentlich allzu simple Imitatio Clerici auslöste.
Was das Werk dieses jetzt meist in Rom lebenden Mailänders auszeichnet, ist – neben Formqualitäten, Phantasie, Eleganz und Takt – die Wiederbelebung einer traumschweren, doch wieder verständlichen Metaphorik. Gewiss, auch Clerici bietet in seinem so preziösen, im Sinne Lionardos sogar ingeniös-intellektuellen Werk vor allem eine absurde Metaphorik des Geheimnisses. Doch können wir erneut begreifen, wenn auch nicht mit rationalen Erkenntnismitteln, dass diese Geheimnisse Mysterien unseres europäischen Schicksals sind, unseres spezifisch europäischen Schicksals, ob es sich um das delphische Arkanum von Hellas, um die christlichen Mysterien speziell manieristischer Spekulationen oder um unsere zeitgenössische Weltangst-Metaphysik handelt. Weiter noch dringt Clerici vor: in die symbolische Sprache des Vorderen Orients und Indiens. Doch führen alle diese so weit in das Vergangene und Gegenwärtige ausgreifenden Gebärden stets zurück auf einen europäischen Kernraum, auf diese »Méthode de Léonard de Vinci«, die ein Paul Valéry als den sichersten Weg pries zu geistig-mystischer, also nicht sentimental-magischer Teilhabe am Geheimnis des Seins im Umkreis des überschaubar Humanen.
Darin liegt die Einzigartigkeit dieses Künstlers, der mächtige Phantasie mit geradezu pedantischer Akribie vereint. Auch Salvador Dali verfügt über diese Spannungskräfte. Doch wird man im Werke Clericis vergebens nach gewaltsamer Destruktion oder nach pseudoreligiösen Effekten suchen. Man hat Clerici den »Surrealisten« zugeordnet. Das ist nur sehr bedingt richtig. Clerici ist – auf seine Weise – vor allem Lyriker. Manche seiner Beschwörungen einer tragischen Antike erinnern an Gedichte Hölderlins, manche seiner Zeichnungen und Malereien an jene »Seele des Tanzes«, die ebenfalls Paul Valéry so verherrlichte: als Kraft, Metaphorik des Geheimnisses durch pure Bewegung zu erschließen. Insofern schrieb ein Kritiker einmal mit Recht, jede Zeichnung Clericis könne in ein Ballett verwandelt werden. Zwangsläufig führte dies Clerici schon früh zur Bühnenbildnerei – für ein Ballett. Seinen ersten großen internationalen Erfolg errang er 1948 in Venedig mit seinen Bühnenbildern und Kostümen zum Orpheus von Strawinsky, in der Choreographie von Aurel v. Milloss. Seine szenischen Ausstattungen sind Ausdruck einer spezifischen malerischen und zeichnerischen Kunst, also keineswegs umgekehrt, wie nur diejenigen behaupten konnten, die seine künstlerische Entwicklung nicht genau kannten. Daraus ergaben sich Missverständnisse. Die Kunst Clericis hat theatralische Elemente, ja geradezu liturgisch-theatralische Bezüge. Doch erwachsen sie in erster Linie aus originären Maler-Erfahrungen und aus seinem »tänzerischen« Gefühl für (sagen wir es ruhig) Wahrheits-Rhythmen in dieser seiner Metaphorik des Geheimnisses, für meta-humane Transzendenzen, die – für ihn – immer nur in menschlicher »Immanenz« darstellbar sind. Seine zahlreichen Nachahmer haben ihn deshalb so gründlich missverstanden, weil sie die künstlerisch-mystischen Elemente seines Werkes in allzu vordergründiger Weise in bühnen-magische Derivate umgewandelt haben. Aus einer Wesens-Kunst wurde bald eine Effekt-Artistik gemacht. Das ist zu bedauern, doch haben ein ähnliches Schicksal gerade die Besten der Moderne auch in der Literatur erlebt, von Apollinaire bis Joyce, von Ungaretti bis Eliot.
Versuchen wir also zum Verständnis für das Werk Clericis festere Ausgangspunkte zu gewinnen. Ich habe schon auf Paul Valéry hingewiesen. In seinem Traktat über die Methode Leonardo da Vincis schreibt er: »Das Erstaunen entsteht nicht durch die Dinge, die da sind; es ergibt sich daraus, dass sie so und nicht anders sind. Die Gestalt dieser Welt bildet den Teil einer Familie von Gestalten, von denen wir – ohne es zu wissen – alle Elemente unendlicher Gruppen besitzen. Das gehört zum Geheimnis der Erfinder[4].« So muss man, glaube ich, den so vielseitigen Fabrizio Clerici zunächst zu verstehen suchen: als einen Erfinder, der von Grundfigurationen der Welt ausgeht, die er immer wieder neu kombinieren kann. Sein erfinderischer Scharfsinn besteht darin, dass er vor allem bestimmte mythische Vorstellungen der Welt in ein ganz persönliches Spiegelsystem bringt, dass er sie von ihrer bloß vordergründigen Legendarität befreit oder von zu rationalistischen Interpretationen erlöst. Auf diese Weise dringt er, unseren Skeptizismus überwindend, wieder in den mystischen Kernraum des Mythischen ein, und zwar mit den Mitteln des »Absurden«. Eine »exquisite Logik«, schreibt Valéry zu Lionardo, eine »gut kultivierte Mystik« führen zur Erkenntnis, dass die uns gewohnte Realität uns nur eine Lösung unter vielen anderen universalen Aspekten bietet. Dieses neue Bewusstsein ermöglicht mehr »innere Kombinationen«, als zum Leben notwendig sind[5].
Doch verfällt Clerici nicht dem Fehler so vieler Surrealisten, die alles mit allem »kombinieren« zu können glauben. Die Thematik seiner »Absurdität« hat Grenzen, anthropomorphe Grenzen. Seine Absurdität hat Architektur, und zwar paradoxaler Weise umso mehr, als seine Malerei das bloß Architektonische zugunsten der viel »freieren« Malerei zu überwinden beginnt. Ein daidalischer Erfindertypus wie Clerici empfindet offenbar eine elementare Freude nicht nur an der seriellen »Konstruktion« von Einfällen. Im Laufe der Zeit entdeckt er, dass er auf für ihn unergründliche Weise sich selbst konstruiert. Er steht oft unter dem »incubo« dessen, was auch wieder Valéry in seinen Fragments d’Eupalinos über die Architektur »d’édifices imaginaires« nannte. Clerici stand in seinen ersten Zeichnungen noch, im Sinne André Bretons, unter dem Zwange, nicht miteinander Vereinbares zu verkoppeln, auf »delirierende« Art und Weise. Allmählich gewannen seine Traumvisionen klarere Konturen. Er erlebt, wie Eupalinos, Behausungen (»demeures«) von Göttern oder Menschen, so phantastisch sie auch sein mögen, als »Teile seines Körpers« (Valéry), als Funktionen des menschlichen Mikrokosmos, als Mittelpunkt im universalen Makrokosmos. Insofern bleibt sein architektonischer Humanismus im Sinne des Anthropozentrismus von Protagoras-Valéry stets formgebend, maßgebend. Treu bleibt er den typisch humanen »combinaisons du régulier et de l’irrégulier«.
Demzufolge wird man Fabrizio Clerici, in Bezug auf seine heute in Europa nicht mehr bestrittene Sonderstellung, zunächst als einen der differenziertesten Vertreter ebenso maßvoller wie problemreicher mittelmeerischer Existenz-Art bezeichnen müssen. Seine »accopiamenti di circostanze più lontane« (Tesauro) entsprechen mehr denen Rimbauds als denjenigen von Hopkins, mehr denen von Proust als von Joyce, mehr denen Marinos als Góngoras, mehr denen Tassos als des Angelus Silesius. Seine verwöhnte, nervöse, ebenso wache wie melancholische Vitalität ist von altem Kulturerbe bestimmt. Seine Abenteuer haben nicht nur individuellen Charakter. In ihnen wirken archetypische Vorstellungen einer intuitiven Mentalität nach. Sein exakter Formsinn legt jedoch den weniger gezügelten Ausschweifungen nordischer Zerbrecher von Inhalten und Formen klare Grenzen auf. Clerici mag Breughel lieben. Er steht Lionardos, Parmigianinos, Tiepolos Phantasmen, dem römischen Manierismus näher. Er wirkt auch poetischer, ergreifender als Monsù Desiderio mit seinen glühend-eisigen Palästen. Mit dem ironischen Wahl-Mailänder Stendhal steht er allerdings in engerer Wahlverwandtschaft als mit Carducci oder Manzoni.
Clerici hat in Italien Freunde und Feinde, welcher Künstler hätte sie nicht! Wenige seiner Feinde scheinen begriffen zu haben, dass Clerici mit seinem Werk, auch im geistesgeschichtlichen Sinne, jetzt schon die vielfach allzu provinzielle »Modernität« mancher italienischen Avantgarden – älterer oder neuerer – beschämt hat. Aus vielen Gründen! Clerici las viel, reiste oft, sammelte, forschte, blieb neugierig, hatte keine ideologischen oder gar regionalen und nationalen Vorurteile. Er stöberte auf dem Flohmarkt von Porta Portese in Rom herum und nahm an archäologischen Ausgrabungen in Syrien teil. Viel besser als Max Ernst oder Eugéne Berman kennt er die »Bas-Fonds« der Vorläufer der »Modernen« im 16. und 17. Jahrhundert. Doch will es mir scheinen, als ob Clerici, bei all seinem Wissen um den heute fast unerträglich vollen Basar des Irrationalen, der Weltangst-Upims, der plumpen metaphysischen Aufsässigkeiten jeder, auch der dümmsten Art, eine der besten humanen Eigenschaften für sich retten konnte: die Fähigkeit des richtigen Auswählen.
Durch die abstrusen Akkumulationen von Motiven, die keine Summe, keine Synthese ermöglichen, soll heute auf artifizielle Art vielfach so etwas wie ein Panorama des vorkreatürlichen Chaos gegeben werden, oder des Infernos. Das Chaos ist, so könnte man sagen, eine unabsehbare Fülle ungegliederter Motive; das Inferno ein strukturloses Universum des illegitimen Alles-Wollens. Wieder bekundet Clerici seine humanere Latinität, indem er unter der Fülle der möglichen Vereinigungen von Disparatem auswählt, auszuwählen versteht. Auch das ist mittelmeerisch, christlich, aquinatisch: Freiheit entsteht durch Wählenkönnen. Das Werk Clericis wird daher von wenigen Grundmotiven beherrscht: sterbende Städte zum Beispiel, die in ihrer magischen Trauer unser Gewissen anregen, die in ihrer schrecklichen Stille uns wieder mit einem absoluten Sein konfrontieren. Sie wirken wie eine Fata Morgana der Hoffnung. Ihr Nicht-Sein, ihr Nicht-Mehr-Sein spiegelt ein höheres Sein, ein wahrhaft mythisches Sein, ein elementares Echt-Sein vergangener, noch kosmisch gebundener Kulturen vor. Wir empfinden es beim ersten Aufklingen dieses Motivs: Venezia senz’acqua von 1949. Wir erleben es wieder beim Trojanischen Pferd (1949–1957), das – in einem fiktiven Sinne – in der Wüste wiederaufgefunden wird. Wir erfahren es erneut vor dem Abbild der Barca Solare, des Pharaonenschiffs, das 1955 tatsächlich in einer Wüste Ägyptens entdeckt wurde. Auch die labyrinthischen Ei-Tempel Clericis, ebenfalls von 1955–1965 immer wieder variiert, gehen auf ein elementares, mythisches Urbild zurück: auf das Ei als Ursprung allen Lebens, auf die elliptische Form als beliebteste Figuration der manieristischen Antiklassik Europas: gegen den »Kreis« der Kunstvorschriften geschlossener Gesellschaften, die aus politisch-ideologischen Gründen mit »Anmut und Würde« das Problematische verdrängen. Schließlich wird Clerici noch konziser. In den letzten Jahren wählt er »Sicherheitsnadeln« (spille) als Symbole für spannungsreiche Klammern, die Chaotisches verbinden, aber auch Muscheln, Labyrinthe, Spiralen; die spiralförmige Bewegung, die Goethe so liebte, weil er sie für eine ursprüngliche Bewegungsart des Lebendigen hielt, das aus dem Chaos in den Kosmos drängt. Aber auch Mannequins, zerbrochene Möbel, verfremdete Tiere.
Doch könnte auch dies noch als romantische Archäologie eines um die konkrete menschliche Existenz unbekümmerten surrealistischen, ornamentalen Zynismus des Spiels mit bloß Bizarrem erscheinen. Man darf nicht übersehen, dass im Werk Clericis nicht nur die Form »anthropomorph« bleibt. Auch thematisch bleibt der Mensch als Maß aller Dinge im Mittelpunkt. Schuld und Sühne; Anklage, Gericht und Urteil gehören ebenfalls zu Grundmotiven Clericis. Minotaurus klagt in einem »phantastischen« Labyrinth seine Mutter an; im Tribunal della Martinique scheint das Gewaltprinzip schlechthin vor Gericht zu stehen. In der Grande Confessione Palermitana ersteht vor unseren Augen ein ganzes (barockes) Panorama von Geständnis, Richten und Sühne. Und wer wüsste nicht, nach den barbarisch-unmenschlichen Katastrophen dieses Jahrhunderts, dass die Wiederholung unmenschlicher Gewaltanwendung nur durch Schuldbewusstsein und Reue unmöglich gemacht werden kann! Absurdität soll also die Welt nicht als sinnlos-absurd erscheinen lassen, wie im Theater von Beckett etwa. Durch das Absurde soll an den ursprünglichen Sinn des Menschenlebens in der Welt erinnert werden, an das Reifen des Menschen und an seine Bewusstseinserweiterung, an eine metaphysisch gebundene Moral, die anmutige Ordnungen schafft in Menschen und in Menschengruppen, die lichtvollen Ordnungen, von denen der Griechenfreund Hölderlin schwärmte. Alles das ist beileibe keine Doktrin, kein lehrhaftes Engagement, kein Stoff für Predigten und Erbauungslehren. Es bleibt Poésie pure, aber eine Poésie pure des Absurden mit einem konstruktiv-logischen, mit sinnstiftendem Charakter.
Wieder werden wir auf Proust, den so mediterranen, gelenkt. Auch Clerici beschwört die »Verlorene Zeit« allerdings nur von Menschensiedlungen in seinen Visionen so hintergründig lebendig-toter Städte. Aber er verklammert sie, auch mit Hilfe der Muschel-Labyrinthe, Spiralen und »elliptischen« Nadeln mit der »Wiedergefundenen Zeit«, mit der besseren Zukunfts-Zeit, die der Mensch, sofern er noch dazu fähig ist, erfahren kann, wenn er wieder zu einem Schuldbewusstsein und auch zur Sühne fähig wird. Dann, wahrscheinlich, würden sich alle diese mystischen Totenstädte mit neuem Leben füllen. Eigentlich stehen alle Tore offen. Die Fundamente sind erhalten. Der Boden ist voller Risse, aber er hält noch. Alles Vergangene und Zukünftige scheint nur auf eine fruchtbare Saat zu warten, auf den Schock, der die Leere mit Leben füllt, mit Leben, wie es sich allerdings ein neuer Mailänder Prinz der Spätrenaissance wünscht: mit erstauntem, elegantem, charmantem, rücksichtsvollem Leben, mit einem Leben erasmischer Weisheit und Güte, mit einem Leben ohne Hast, ohne Lärm, ohne Härte und Grausamkeit, mit einem Leben als sublimes Spiel.
Die ebenso freie wie melancholische Selbstbewusstheit unterscheidet Fabrizio Clerici von Vorläufern, an die man denken könnte, von Künstlern, die, wie er, von den »espaces inquiets« (Marcel Brion) fasziniert waren, also von Caron, Monsù Desiderio, Piranesi, Papini, Ricci, Klee, De Chirico, Carrà, Berman, Blume, Maréchal und so weiter. Brion stellt Clerici in diese »lignée«, doch hebt er ganz andere Züge hervor: die Präzision Pisanellos und die »acuité expressive« von Dürer[6]. Für die Kunstmittel, deren Clerici sich bedient, sind dies richtige, aber nicht ausreichende Vergleiche. Wieder möchte ich die spezifische Latinität Fabrizio Clericis betonen. Seine Phantasmen erinnern, auch in formaler Hinsicht, eher an Titus Lucretius Carus, an seine Atomreigen und »Templa serena«, sowie an die noch mythisch gebundene Naturbeobachtung des Plinius. Dafür ist sein Werk Pietra Leonina lehrreich. In ihm kommt ein in liebenswerter Weise »naives« Grübeln über die Interferenz aller Lebensbereiche zum Ausdruck: Steine spiegeln Meere, Wälder, Konstellationen von Sternen und umgekehrt. Dazu kommt Wissen, ein Augen-Wissen – aus dem Orient: Karma-Erfahrung. So wird auf kleinen indischen Elfenbeinreliefs der Karma-Prozess der »Ewigen Wiederholung« dargestellt. Man weiß, dass Arcimboldi derartige Darstellungen zu seinen »absurden« Physiognomien benutzt hat. Doch strebt Clerici nicht in dieser »arciboldesken« Weise nach Effekten. Er grübelt über Steine, Pflanzen, Knochen, Muscheln, Eier, geologische Schichten und dergleichen ernsthaft nach. Er sieht sie als »Chiffren« für Botschaften aus dem Jenseits an, ähnlich wie Teilhard de Chardin. Clerici kombiniert Archäologie und Paläontologie, er verklammert – wie seine »Spille« – Menschengeschichte und Naturgeschichte. Und auch dies ist, von Lukrez über Plinius, Thomas von Aquin, Giordano Bruno bis Lionardo spezifisch lateinisch: das Suchen nach Strukturen im Chaos, nach Recht gegen Dämonie. Mystik kann Leitziel werden, aber nur dann, wenn sie mit der Naturbeobachtung verbunden bleibt. Der Mensch darf nicht zu einem metaphysischen Versuchskaninchen werden. Er muss Individualität, Gesicht bewahren, eine streng profilierte Rechtsstellung zwischen dem Anorganischen, Organischen und Spirituellen, eine Basis der juristischen Ordnung, eine Basis desjenigen Rechts, das jedem leidvollen menschlichen Einzelwesen zwischen all diesen mysteriösen Einzelreichen der Natur Sicherheit und Würde verleiht. Das »römische Recht« schafft in einer Welt des Abstrusen Harmonie. Proust, religiös gleichgültig, versagte in Bezug auf eine höhere Ordnungsvision. Clerici predigt darüber gewiss nicht. Aber er lässt aus allen seinen Steinen, Schnecken, Muscheln und Phantasmen doch die echt lateinische Dialektik von Ordnung und Unordnung sichtbar werden, mit einer deutlichen Tendenz: dass jeder, wer auch immer es sei, sich vor »Gericht« verantworten muss, wenn er Ordnungsprinzipien der Welt verletzt, selbst abstruse, irreguläre, disharmonische. Wieder steht also der Mensch im Mittelpunkt der Welt: gerade dann, wenn er völlig zu vereinsamen droht. Clericis mythische Totenstädte sind auch Symbole aller Menschen, die mit ihrem Gerechtigkeits- und Rechtsempfinden, mit ihrem »Perfektionismus« isoliert sind, aber die Hoffnung selbst als »mirage« nicht aufgegeben haben.
Clerici ist dazu imstande, weil er über eine andere spezifisch lateinische Eigenschaft verfügt, über die »Cortesia«. Einsamkeits-Psychosen, an denen in den Beton-Dschungeln heutiger Städte jeder wohlgeartete Mensch leidet, werden ebenso scharfsinnig wie lyrisch, ebenso humorvoll wie melancholisch enthüllt, bloßgelegt, theatralisch abstrus-»schön« ausgebreitet. Wir werden auf diese Einsamkeits-Elegie noch zurückkommen. Man spürt zunächst, dass bei Clerici Herzensgüte vorwaltet: wie bei Francis Jammes, wie (es sei wiederholt) bei Proust, der Jammes sehr hoch schätzte. Fabrizio Clerici bleibt, bei allem Leiden an der Welt und bei aller Tendenz, das Grauen in ihr bloßzulegen, ein an römischer Würde und römischer Satire geschulter gutmütiger Augur. Er mag das plump Dramatische ebenso wenig wie das vulgär Aufsässige. Einen spezifischen »Mittelton« der Modernen beherrscht er nahezu vollkommen. Diese Tonlage bestimmt auch seine künstlerischen Qualitäten: keine grellen Farben, keine beleidigenden Deformationen, keine herausfordernden Kontraste. Zeichnerische Strenge vor allem, auch ohne jede Härte. Alles liebevoll Erfasste wird überhaucht mit Pastelltönen, die an die Abendhimmel von Mittelmeerstädten erinnern, bevor sie durch die Beton-Industrie vergiftet wurden. Nuancen aus seltenen Gläsern, aus dem blassen Wangenrot von Pontormo-Jünglingen. Grau und Blau herrschen vor wie im Gefieder von Tauben. Doch schimmert darüber ein sanftes Violett, ein melancholisches Gold. Die Komposition vereint Strenge (rigeur) im Sinne Valérys und Verve der Phantasie im Sinne Marinos, den Clerici illustrierte. Die verhaltene Dynamik erinnert vor allem an die preziöse Courtoisie, die dem Spätmanierismus an europäischen Höfen seit den Lebensvorschriften Castigliones so teuer war. Aus dieser Zeit nimmt Clerici vielfach die Gewänder für seine Figuren, wie er sich für seine eleganten Grotesken von Remelli, Kircher und Bracelli anregen lässt. Damit belegt er geradezu den aristokratischen Manierismus, der ihm eigen ist, der bei ihm wieder schöpferische Formen annimmt wie im literarischen Werk von Luis Borges, dem Clerici ebenfalls viel verdankt, auch für seine phantastische Botanik, Zoologie und Geologie.
Die geradezu tänzerischen Elemente seiner Kunst, ich sagte es schon, machten ihn zum idealen Bühnenbildner für so bedeutende Tanzschöpfungen wie Strawinskys Orpheus und Monteverdis Combattimento di Tancredi e Clorinda, in der Choreografie von Aurel v. Milloss. Er illustrierte aus diesem Grunde auch mit genialer Virtuosität besonders abstruse (im modernsten Sinne) Meisterwerke wie Leonardo da Vincis Bestiario und seine Favole e Facezie. Leoncillo Leonardos Bestiario; Alberto Savinios Phantasmen; Julien Greens Leviathan; Cabell Branchs L’Incubo; Giambattista Marinos Parigi; Marco Polos Dell’Isola di Madagascar und, sein demnächst erscheinendes Kabinettstück, den Orlando Furioso mit 160 Tafeln im Format von 35 x 45 cm.
Bezeichnende Namen, bezeichnende Themata! Auch hier bekunden sich die geistigen Wahlverwandtschaften, die Lignées spirituelles, denen Clerici sich verbunden fühlt. Man würde ihn jedoch missverstehen, übersähe man die nicht intellektuellen Hintergründe seines neomanieristischen Universums. Die nächtliche Elegie der Einsamkeit beherrscht sein Werk. Sie nähert ihn einem der geistigsten Romantiker an: Novalis, der wie er Steine liebte und kannte, geologische Schichten der Erde und der Seele. Clerici rückt aber nicht nur die Einsamkeit des Einzelmenschen in der technisierten Gesellschaft in eine groteske Optik. Er bringt den »ennui fatale« unseres Planeten in entmythisierter Zeit, in einer Philosophie ohne Gott zum Ausdruck. Der Mensch also ist einsam in der heutigen Gesellschaft, wie unser Planet im Kosmos einsam zu sein scheint: mit all seinem »hektischen Leben«, das andere Gestirne, soviel man weiß, nicht mit ihm teilen. Diese Einsamkeit des Lebens auf dem Planet Erde muss das Todesbewusstsein erweitern. In einer Art scharfsinniger Neugier auf den Tod liegt die irrationale Wurzel des Werkes dieses subtilen Maler-Philosophen. Alle seine Figuren, Gesichter, erfundenen Städte, gehören der »Geheimgesellschaft des Todes« an, von der André Breton in einem glücklichen Augenblick einmal schrieb.
Das Maschinenzeitalter braucht ein »seelisches« Gegengewicht. Aus Hast und bloßem technischem Verrichten kann es nur durch Kontemplation gerettet werden. Ohne »vita contemplativa« ist die »vita attiva« nicht denkbar. Kontemplation und Gewissen bleiben ohne Todesbewusstsein schwach. »Echte« Menschen gibt es nur, wenn sie Goethes Weisung folgen, dass das Leben zur Heiterkeit verpflichte, aber auch zum mythischen Wissen aller Urkulturen, dass das Leben ohne Todesbewusstsein schal und oberflächlich bleibt, bloß »mechanisiert« (im Sinne der Kulturkritik Walter Rathenaus) nicht einmal vegetativ, nicht einmal animalisch. Clericis Grande Confessione Palermitana, wie seine Visionen toter Städte, die nur noch die Aufgabe zu haben scheinen, in ihren labyrinthischen Ruinen das »Ur-Ei« des Lebens zu hüten, künden von einem gelassenen Umgang mit dem Tod, der für Leben und Werk aller großen Künstler charakteristisch ist. Eine Landschaft des Nihilismus im Werke Clericis? Ich glaube es nicht, ebenso wenig wie man annehmen darf, Eliot sei in seinen hieroglyphischen Versen einem metaphysischen Vulgärmanierismus verfallen. Für Clericis Bild entscheidend ist die erneuerte Symbolik des Todes, zumindest metaphorisch des Todes, der wieder auf das Leben horcht.
Das stellt eine religiöse Wendung dar, und es ist nützlich, an einige Daten aus dem Leben Clericis zu erinnern. Wir werden dann erkennen, dass hier nicht etwas »konstruiert« ist, sondern dass im zeitgenössischen Manierismus, der bewusst diesen »Ausdruckszwang« des 16. und 17. Jahrhunderts wiederaufgreift, im Sinne eines auch im Manierismus legitimen Traditionalismus, ebenfalls die einstige Relation von Ästhetik und Theologie übernommen wird. Clerici besuchte sieben Jahre in Rom das jesuitische Collegio Massimo. Das Rom von 1550–1650 wird ihm zu einer »Traumwelt«, nicht zur »klassischen Erinnerung«. Um zu leben, zeichnet er Anatomietafeln. Zu Studienzwecken wohnt er oft Operationen bei, ist häufiger Besucher der römischen Leichenhalle. Und wieder zum Tod! Breton hatte erklärt: »Der Surrealismus wird Dich in den Tod einführen, und dieser bildet eine Geheimgesellschaft.« In der Beichte von Palermo bilden Glaube und Unglaube keine »Probleme«. In den Tod braucht man nicht »einzuführen«. Er ist eine Realität, die den Menschen nicht nur neugierig, sondern – schöpferisch macht. In einer Stadt der Toten wie Rom kann der Mensch nur schöpferisch bleiben, wenn er den Tod in einer sinnbildlich wirkenden Traditionskette überwindet. Die Fackel des Lukrez flammt wieder auf. Eine Generation gibt der anderen die Flamme des Lebens, des Wissens … und auch der »manieristischen« Impulse. Der Tod als »Angst« und als Antrieb zur morbid-intellektuellen »Neugier« wird hier in einem sehr persönlich »modernen« Traditionalismus überwunden. Das ist römisch. Auch das Extreme wird in Ahnenschaft einbezogen! Im Norden ist es anders und wird es wohl anders bleiben.
Clerici hat in Nordeuropa manche Nachahmer gefunden, in Deutschland und in Österreich, speziell in der sogenannten »Wiener Schule«. Warum?
»literarisch« empfinden mögen, einmal der technisierten Massengesellschaft von heute einen heilsamen Zerrspiegel vorgehalten, zum anderen, weil er zu einer neuen Perfektion des künstlerischen Handwerks angeregt hat. Doch haben Italiener von Rang seine Bedeutung viel früher erkannt. Schon Alberto Savinio sah in ihm einen Bruder des Wahl-Mailänders Stendhal, und er nannte ihn: Fabrizio del Dongo. Ungaretti erkannte in seinem Werk Nachwirkungen der ersten Illusionstäuschungen des »Seicento«. Jacques Audiberti schrieb über ihn, er arbeite mit einem Pinsel, der den Tauben von San Marco die Farben raube und eingetaucht sei in das schillernde Gelb der Lazerten des Kolosseums. Von Julien Green sind die Worte: »Vor den Bildern von Clerici habe ich mich mehr als einmal gefragt, wie es ihm gelungen ist, mit so delikaten Mitteln, die Angst darzustellen, die jeder vor uns angesichts der heutigen Welt hat. Es handelt sich um die schönsten Träume der modernen Weltangst[7].« Alberto Moravia meinte: »Clerici ist der Zeuge der Unmöglichkeit und gleichzeitig der poetischen Würde in der Größe. Auch seine Farben, das Rosa verwelkter Blütenblätter, das sterbende Grün, das verdunstende Gelb, das verblasste Blau haben einen träumerischen wie beschwörenden Sinn. Schließlich scheint Clerici in seinen Fata Morganas ein Endurteil über Kulturen zu fällen, die im Flugsand der Zeit entstehen und die nach einem kurzen zauberhaften Schwingen für immer verschwinden. Täuschungen: Paläste, sie alle, Burgen, Türme und Städte, die zu Schilfrohr und Büschen werden und die ihrerseits verblassen, Reflexe werden und die schließlich in einem Nichts verschwinden[8].«
Im Nichts? Inzwischen beginnt ein Abstraktionsprozess in den letzten Werken Clericis. Seine »architetture inventate« werden immer mehr zu »informellen« Stenogrammen, die der Betrachter selbst zu deuten hat, wenn es ihm heute auch leichter fällt, da man sich allmählich an »gegenstandslose« Kryptogramme gewöhnt hat, an Botschaften ohne Inhalt, die vielfach nur noch faszinieren, weil sie schön geschrieben sind. Wie Marino Marini in seiner Spätphase zeigt sich Clerici bereit, das Unerkennbare zum Symbol des noch nicht sinnvoll Gewordenen in unserer Epoche zu erheben. Doch geschieht auch dies bei Clerici mit Takt und Geschmack. Das vorkreatürliche Chaos begegnet – wieder in einem ironischen manieristischen Spiegel – der seelisch noch nicht bewältigten, also auch noch »chaotischen« Mechanisierung unserer heutigen Lebensverhältnisse. Vielleicht bekundet sich hier auch eine humane Solidarität Clericis mit seinen Zeitgenossen, die aus Entsetzen vor der »realen« Wirklichkeit von heute in ein Reich nicht mehr deutbarer Hieroglyphen fliehen? Clerici hat einen Höhepunkt erreicht, der auch eine gefährliche Peripetie auslösen könnte. Wird auch er vor der zwar abstrusen, aber noch immer konkreten Wirklichkeit ermüden? Welche Wege gibt es noch für ihn, der für viele das rettete, was gescheitert, tot und begraben zu sein schien: das »Welträtsel« in noch menschlichen Figurationen? Was wäre Clerici, wenn er, wie einer seiner Lieblinge, Marco Polo, nicht mehr Abenteuer des Auges, sondern nur noch Abenteuer des Intellektes, des Herzens und der Sinne aufzeichnen würde, Gebilde, die keinen Bezug mehr haben auf konkretes Leben, konkretes Lieben, konkrete Gerechtigkeit und konkreten Tod? Vielleicht entstammt die scharfsinnige Tristezza, die dem Werk Clericis entströmt, auch dieser tragischen Situation des Künstlers von heute, der sich oft fragen muss: Wie kann ich in einer Welt der ABC-Waffen, des Waren-Fetischismus, des gesellschaftlich mehr denn je entfremdeten Menschen, der Kybernetik, der Wohlstandsgesellschaft mit ihrem Tanz ums goldene Kalb, aber auch umgeben von gleißnerischen Realismen der Idola fori, von Sex, Grauen, Verbrechen, bedrängt von neuen und alten totalitären Ideologien, ein fassbares, verständliches Bild schaffen, das nicht sofort missdeutet, verkannt, letztlich verraten und schließlich zertreten wird?
Die neueste Bibliografie zum Werke Clericis findet man in dem Ausstellungskatalog über Zeichnungen von Fabrizio Clerici zum Orlando Furioso. Venedig, 20.6.–31.7.1968. Vgl. auch den Ausstellungskatalog: Kunstamt Berlin-Tempelhof, Berlin 1968, sowie den Ausstellungskatalog Fabrizio Clerici, Zeichnung und Tempera von 1962 –1971. Galleria Aldina, Rom, 6–28.4.1971
2. Ernst Fuchs – Sehnsucht nach dem Paradies
Eine der größten Überraschungen im heutigen geistigen Europa bilden Entstehen und Entwicklung der »Wiener Schule«, einer »phantastischen Malerei« von sehr eigener Art. Manche spätbürgerlichen Kreise nicht nur in Wien und an der Donau möchten Europa restaurieren mit Symbolen einer allzu vergangenen Sentimentalität. Man denkt dort an ein Europa aus Zucker und Stahl. In der Wiener Schule, wie in ähnlichen »Schulen« in Rom, Paris, Zürich, München und London, rebelliert man gegen solche Rekonstrukteure eines angeblich immer lieblichen Walzertraums, die so tun, als habe ein Mann wie Sigmund Freud nie Träume auf eher realistische Weise analysiert, und als gebe es heute keine Ideologen mehr, die das Bild des Menschen auf eine ganz andere Weise reduzieren: auf das Bild von kollektiv marschierenden Marionetten; unter den Fanfarenklängen des historischen und biologischen Materialismus, aber auch eines stets wackeren »idealistischen« Etatismus.
Zwischen den idealistischen und materialistischen Extremen der Ideologien von West wie Ost sucht die Wiener Schule, wie andere »figurativ« wieder engagierte Künstlergruppen Europas, nach einer neuen Mitte der Wahrheit. Allerdings nicht als hausbackenes Zentrum »braver« kultureller Gemütlichkeit. Sie erstrebt den Vorrang einer menschlichen Wahrheit, die zumindest keine falschen Illusionen mehr zulässt. Sie wollen zurückführen, so meine ich, auf das humanistische Extrem des Menschen, auf seine erbsündlich konstitutive Widersprüchlichkeit, nachdem die antihumanistischen Extremisten aller Himmelsrichtungen das Bild des Menschen zur politischen Fahne ihrer Vereinsinteressen gemacht hatten. So erscheint zunächst der Mensch auf diesen Bildern wie ein Sammelbecken aller Schrecken dieser Welt. Mancher wird vor diesen Werken zwischen dem Interesse (im Sinne Kants) und dem üblichen Abscheu derjenigen schwanken, die (im Sinne aller Diktatoren dieser Erde) meinen, die Kunst müsse stets prall, gesund und rund sein.
Die »Autoritären« träumten auf diese Weise zu allen Zeiten tatsächlich von einem nur »politischen«, das heißt von einem geistig reduzierten Menschen, der sich mit den Hebeln des Staates leichter beherrschen lässt als der »ganze« Mensch des echten realistischen Humanismus und des kritischen Utopismus bester europäischer Traditionen.
Man sollte also genauer hinsehen, stärker fühlen, genauer denken, bevor man sich – in diesem Schwanken für die allzu leichte Negation entscheidet. Gerade die Wiener Schule lässt mit den Mitteln einer Art künstlerischer »Magie« immer wieder durchblicken, dass es im Schattentanz der apokalyptischen Angstträume von heute einen Urkern großartiger Daseinsgewissheit gibt. Ihre Vertreter wenden eine konstruktive Logik des Vorrangs der Wahrheit an, wie auch immer diese Wahrheit aussieht. Sie wollen einen unveränderlichen schöpferischen Sinn im Sein wenigstens fühlen und ahnen lassen. Zu allen Zeiten haben Traumdeuter nach dem Zukunftswert von Träumen gesucht. Diese Traumdeuter waren, wie man weiß, meist nur subjektive »Mystiker«. Die besten Vertreter der Wiener Schule wollen die Schreckensträume des sensiblen europäischen Menschen weniger deuten als zunächst einmal erkennbar machen, wenn auch nur in einer approximativ richtigen Weise. Und damit stehen sie einer ganz anderen »Wiener Schule«, der Wiener Schule der Logik und Logistik näher, als bisher erkannt oder zugegeben wurde.
Sichtbar möchten sie dabei allerdings auch werden lassen – mit künstlerischen Mitteln – die zeugende Kraft des Wahren in einem durchaus christlichen wie »laizistisch«-sozialen Sinne, und zwar aus den Figurationen des Grauens, des Abstrusen, des Zusammenhanglosen, des Zerbrochenen. Denn Gott ist Liebe und Wahrheit. In allem scheinbar Sinnlosen waltet stets ein Absolutes, wie immer man es nennen mag. Auch im grauenhaft Relativen blüht das Licht des ganz und gar Unbestreitbaren auf. Die Pilatus-Frage nach der Wahrheit wird so beantwortet: Wahrheit ist das, was tatsächlich Wahrheit ist. Es gibt eine Relativität der Wahrheit als Meinung. Es gibt aber eine handfeste Wahrheit der Tatsachen, jedoch nicht nur in dem Sinne, dass eine Rose kein Rennpferd ist. Es gibt auch eine faktische Wahrheit im Leben der menschlichen Seele, und der europäische Mensch wird das Opfer des eigenen Selbstbetrugs wie des Betrogenwerdens durch Kollektivmächte bleiben, wenn er sich der tatsächlichen Anatomie seiner Seele nicht bald so bewusst wird wie der Anatomie seines Körpers.
Italien ist durch die Erkenntnisse seiner besten Forscher auf eine Begegnung mit dem herausfordernd bitteren Schmelz eines derart unsentimentalischen Wiener Geistes in anderen Zusammenhängen vorbereitet worden: durch die gelehrten Studien von Enrico Castelli über das Dämonische in der Kunst, durch die geistvollen Querschnitte von Mario Praz durch die manieristische Kunst und Literatur Europas, durch die scharfsinnigen Untersuchungen von Giulio Carlo Argan über die spezifische Seinsnähe der »modernen« Kunst in einem differenzierteren ontologisch-ästhetischen Sinne.
Ein konventioneller Beurteiler der geistigen Sinngebungen einer so unerschöpflichen Kulturlandschaft, in diesem so bilderreichen Donauraum, wird sich fragen, wieso gerade in einer Stadt wie Wien, die man so oft mit dem Begriff einer supremen Anmut zu erklären versucht, so jäh, so tumultuarisch, so erbarmungslos Bilder aus den unterschwelligen Schichten unseres Bewusstseins gezeigt werden. Ich kann darauf nur stichwortartig Antwort geben. Auch in Österreich wurde durch barocke Übertreibungen oder klassizistische Untertreibungen eine der Grundaufgaben der Kunst, abgesehen von ihren ästhetischen Qualitäten, verdrängt, nämlich ihre Aufgabe, an der Entfaltung der Wahrheit im Schöpfungsplan mitzuwirken. Sigmund Freud hat dazu beigetragen, dass man gerade in Wien, schon vor dem ersten Akt unserer neuen Kriegs-Apokalypse, dem Medusenantlitz des menschlichen Daseins tapfer ins Auge sah. Doch konnte gerade in einem derart christlichen wie liberalen und sozialen Kulturgebiet der Künstler, der nie lediglich Analytiker ist, als auch er der Wahrheit des Erkennens sich verpflichtete, nicht auf die schöpferisch-konstruktive Verwandlungskraft jeder Kunst verzichten, auf ihre gleichsam angeborene Tendenz, die bloße Analyse in den Dienst einer eher meta-physischen wie meta-klinischen Sinngebung zu stellen.
Dieser dialektische Prozess einer These von einseitig »idealem« Sinn und einer Antithese von ebenso einseitig analytischem Sinn, der zu einer Synthese von universalem Wahrheitsbild führt oder führen könnte, hat natürlich historisch auch weiter zurückliegende Ursprünge. Er wird sichtbar in Seitenzügen der österreichischen Romanik und Gotik und in den manieristischen »Phantasmen« am Hofe Rudolfs II. in Prag. Schon damals brachen sich Bilder und Begriffe einen Weg zu einer Freiheit, die in der sogenannten offiziellen Kultur verdrängt worden war. Die heutige Wiener Schule, 1959 konstituiert, nach vorangegangenem Wirken mancher »Isolierter« wie Klimt, Kokoschka, Kubin, also die Fuchs, Brauer, Hausner, Krejcar, Lehmden, Regschek, Urbach und andere, hat eine viel ältere Tradition, eine Tradition, die bisher vielfach – weil zu »irregulär«, zu »phantastisch«, zu »unbequem«, – gewissermaßen »inoffiziell« blieb. Sie distanziert sich vom programmatischen Surrealismus wie von der dekorativen Ornamentik der ebenso kommerziellen nicht-figürlichen Epigonen der »Abstrakten«.
Mancher, der an »Europa« denkt, stellt sich darunter eine höchstens in Börsen umstrittene Harmonie rein materieller Konstellationen vor. Solche Vorstellung geht von der Hoffnung aus, man könne Europa in einem westlichen oder östlichen Sinne auf einen nun auch erheblich »schwankenden«, geldlichen Mittelwert reduzieren. Europa kann eine derartige Verringerung seiner noch immer enormen Spannungsverhältnisse offenbar nicht vertragen. Es würde »idealistisch« oder »materialistisch« versteppen, wenn es aufhören sollte, von dem Gedanken fasziniert zu sein, man könne doch einmal die Wahrheit finden, wenn auch nur in einer irregulären Harmonie, in einer humanen dialektischen Beziehung des Gegensätzlichen.
Wir müssen uns damit auseinandersetzen: diesseits und jenseits der Alpen. Die bildnerische Botschaft aus Wien hat einen Sinn, den wir gemeinsam entziffern müssen: es gibt eine echte Ordnung des Traumes und eine falsche Ordnung der Wirklichkeit. Vielleicht liegt, wenn man an die Wahrheit der Tatsachen glaubt, eine noch höhere humane Wahrheit darin, die »extremen« Wahrheitsvorstellungen von »echten« Individualträumen mit den irrtümlichen Ordnungsprinzipien, die von angeblicher Wirklichkeit höchst verschiedener Art abgeleitet werden, zunächst einmal vor dem Tribunal einer derartig menschlichen Logik zu konfrontieren! Die älteste, nicht nur engere politische Staatsidee der österreichisch-habsburgischen Monarchie lag, wie Musil so elegant-klug dargestellt hat, vor ihrer Dekadenz darin, außerordentliche politische Kontraste in einem allmählich nur noch menschlichen Spannungsfeld aufzugreifen, damit Gegensätze zu überwinden, bloße Ideologien als veraltet zu entlarven, kurzum einen humanen Modus vivendi zu finden, der immer dann möglich wird, wenn die Extremisten wie ihre Gegner erkennen, dass die Zeit sie überrundet hat und dass es viel weniger sinnvoll ist, deshalb (heute) auf Atomknöpfe zu drücken, als einen eben humanen, aber unerbittlich-neuen sozialen Consensus omnium zu finden.
Wer sehen kann, sollte auch hören! Wir meinen, dass in diesen vielfach auch künstlerisch-handwerklich beachtlichen Leistungen die sehr schmerzlichen Dissonanzen in den noch immer nicht ganz verstandenen Kompositionen Mozarts zu »sehen« sind: dass in diesen »Bildern« das unerbittliche Wahrheitsstreben der jüngsten österreichischen Dichtung zu »hören« ist, wie etwa der Ingeborg Bachmann oder aber auch der älteren wie der Heimito v. Doderers. Wer sich fragt, ob diese Kunst authentisch ist, der sollte, wie immer er auf den Anblick solcher disharmonischen Harmonien oder, noch schrecklicher, nur disharmonischen Dissonanzen reagiert, einmal überlegen, wo so gemalt wird.
Wo? Auf einem Vorposten zwischen einer »freien« Welt des Westens, die im christlichen Sinne, das sagen heute bekanntlich manche Konzilsväter des Johannes-Konzils, nicht in jeder Weise viel christlicher ist als die »unfreie« Welt des Ostens. Insofern bringen die so »anstoßenden«, also auch trans-ästhetischen Werke der Wiener Schule außerdem eine dramatische Grenz-Konflikt-Situation zum Ausdruck. Was scheint jedes Bild zu sagen? Etwa dieses? »Seht euch selbst an, eure Gesichter, bevor ihr, eurer Rechthabereien und rein räumlicher Konflikte wegen, diesen offensichtlich sinnlich ganz angenehmen Planeten in die Luft sprengt!« Sehen wir nicht alle, westlich, östlich, südlich, nördlich, im Bösen wie im Guten, gleich aus? Sind wir nicht alle Kinder der Finsternis wie des Lichts? Haben wir nicht alle zwei Gesichter, ein Gesicht des Teufels und ein Gesicht des Engels, und zwar gerade deswegen, weil wir alle hoffnungslos nur Menschen sind und Menschen bleiben, sofern wir nicht einmal kollektiv-atomar verkalkt und verkaltet werden?
Was also sollten wir, weit über den Sade-Mythos der letzten Pariser Surrealismen hinaus, anlässlich dieser gewiss nicht »angenehmen« Bilder, zu verstehen versuchen? Eine ebenso neue wie alte Sprache der Konzilianz aus tiefster Erschütterung; eine in keiner Weise mehr nur »ästhetische« Kunstsprache; eine Ausdrucksweise also, die sich in jeder Beziehung auf des Messers Schneide bewegt. Doch erobert sie, ohne Barockkerzen am Vortragspult, vielleicht deswegen in einem Vorhutgefecht, das sich von dem unserer Väter durch neue kollektive Vernichtungsmittel unterscheidet, zumindest neue »abstruse« Vorstädte der Menschlichkeit in unseren ebenso kollektiven wie anti-apokalyptischen Wunschträumen von einem heute fast schon unausweichlichen Frieden in Anführungszeichen, weil ein Krieg ohne Anführungszeichen uns allen wohl nur noch wenige Stunden lang die Möglichkeit geben würde, über Krieg und Frieden in der Art von »Rechts«-Politikern wie von »Links«-Literaten nachzudenken. Das Denken aller dieser Köpfe würden uns die Atomköpfe ersparen, und gerade diese Kopf-Antagonismen sollte man in den »anatomischen« Darstellungen der Wiener Schule von heute beachten. Das Drama zwischen Mikrozephalen und Makrozephalen ist nicht zu übersehen! Wollen wir in diesem politisch bald schon »klinischen« Konflikt unterliegen? Oder wäre es nicht besser, ihn auf »humane« Weise zu verhindern, indem wir uns wieder um »normale« Köpfe bemühen? Gibt es nicht eine »Wahrheit des Menschlichen«, eine naturrechtlich-humane Ordnung für alle Menschen, die wahr, frei und glücklich sein wollen: im Westen wie im Osten? Und so lässt sich die Apologie einer derartig »abstrusen« Kunst beenden: Diese Kunst lobt das Glück in Bildern des Grauens. Und damit bleibt sich Wien, die europäische Donau, das Land, das immer Gegensätze verklammern musste, treu, wie jedes Volk, das nicht im Falschen, sondern im Echten sein Gewicht bewahren will: es entlarvt täglich Gegensätze, die morgen keine Gegensätze mehr sein können! Es warnt davor, heute für Worte zu sterben, die morgen keine Realität mehr haben! Es erinnert uns daran, dass das Leben nur eine kurze Komposition von Elend und von Größe ist, von Glück und Jammer. Lohnt es sich, unseres so ephemeren Zikaden- und Wurmdaseins wegen, unter Umständen bloßer räumlich bestimmter Sorgen wegen, die ewigen Höllengluten der Kernphysik auf uns niederprasseln zu lassen? Wir leben fast alle in falschen Träumen! Wenn wir uns selbst, unser Gesicht, einmal sehr genau ansehen, so werden wir vielleicht erkennen, dass wir gerade deshalb alle noch immer ein Gesicht haben. Aber doch ein Doppel-Gesicht: ein Gesicht, in dem Angst und Hoffnung, ja Verzweiflung und Zuversicht verschwistert sind. Die Wiener Schule sagt uns, dass wir alle gemeinsam keine Hoffnung mehr haben werden, wenn wir hinter unserem Gesicht der Angst nichts mehr aufleuchten lassen, nicht einmal mehr die schwächste Aussicht auf Versöhnung.
Ernst Fuchs, 1930 in Wien geboren, gehört seit 1951 zu den ersten Gründern der »Wiener Schule des Phantastischen Realismus[9] «. Er eröffnete in Wien eine Galerie, die zum Treffpunkt für junge Künstler wurde, die in ihm einen unbestrittenen Meister sahen, auch und gerade seiner enormen künstlerisch-technischen Fähigkeiten wegen. Der Reifeprozess war anhaltend. 1970 galt Ernst Fuchs als einer der hervorragendsten Vertreter der Wiener Ideakunst. Seine Werke wurden seit 1946 in den wichtigsten Galerien Europas, Amerikas und Japans gezeigt.
Tatsache ist, dass gerade in Wien der Altmanierismus zur Zeit des ersten Auftretens des Surrealismus enthusiastisch »wiederentdeckt« wurde. 1924 erschien das berühmte Werk des Wiener Kunsthistorikers Max Dvorak, Kunstgeschichte als Geistesgeschichte mit dem Fundamentalsatz, dass »der Manierismus eine konstitutive Bedeutung für die ganze Neuzeit« habe[10]. »Vielleicht hat die Beschäftigung mit dem Manierismus in Österreich gerade deshalb so intensiv eingesetzt, weil man im Lande des ›Schwierigen‹ und des ›Zerrissenen‹ in vielen Tendenzen des Manierismus sich selbst wiedererkannte, Wesen vom eigenen Wesen[11].« Das gilt vor allem für Ernst Fuchs, weil er – für eine solche »geistige« Kunst – unentbehrliche Voraussetzungen besitzt: Bildung, Intelligenz, Sensibilität, handwerkliche Meisterschaft. Außerdem verfügt Fuchs über eine außerordentliche Vitalität. Es steht ihm die Kraft der »Vereinigung« zur Verfügung, die mehr ergibt als einen banalen Synkretismus. Er schafft sich seine Ideakunst. Vorbilder des Altmanierismus bis zum neumanieristischen Jugendstil benutzt er, doch verfällt er ihnen nicht, speziell in der großen Reifezeit von 1960 bis 1970. Kennzeichnend für ihn ist ferner eine noch vorhandene Fähigkeit zur Erschütterung durch die Mythen der Religion, die aber stets mit dem Spannungsfeld vom Angst- und Verzweiflungszustand der modernen Menschheit konfrontiert werden: außerdem mit einem erleuchteten Gefühl für Möglichkeiten neuer Behausung, neuer Erlöstheit, neuer Zuversicht. Auch wenn die Symbolik von Ernst Fuchs verständlicher erscheint als etwa die von Hausner, so fasst er sie doch in ganz eigene Wendungen. Diese Symbole aus dem Alten und Neuen Testament etwa, aus der Apokalypse, aus jüdischer Gottesgrübelei, aus der »phantastischen« Angelologie der Mittelmeerkulturen lassen gewiss historische Beziehungen erkennen, doch bleibt die persönliche Tournure unverkennbar, weil alle diese »Stoffe« von einem selbstbewussten Subjektivismus in eine neue darstellerische Dimension hinüber verwandelt werden. Zudem herrscht Perfektionsstreben vor, das aber keineswegs nur kalte Artistik bekundet. Gewiss, »technische« Höchstleitungen, wie bei dem inzwischen ebenfalls international bekannten und anerkannten Landsmann von Fuchs, dem zeitweise so verfemten Leherb! Dabei ist beiden, die in ihrem Wesen so außerordentlich verschieden sind, eine ergreifende Vergrübeltheit zwischen Verzweiflung und Zuversicht eigen. Bei Fuchs gewinnen mögliche Antworten auf solche Innenerfahrungen alttestamentarische, prophetische Züge einer energiegeladenen Anballung von Zorn über den Missbrauch der Macht oder über die Verfälschung des Gottesworts, aber in einer faszinierenden Kristallisierung von Gewissheits-Visionen … mitten in der Misere unserer geistigen, seelischen und materiellen Umweltverschmutzung.
Man kann Ernst Fuchs als einen modernen Mythosophen bezeichnen, der speziell von »Mysterien« der alten Mittelmeerkulturen gefesselt bleibt. Das macht nicht nur den Reichtum seiner Inhalte aus. In der Auseinandersetzung mit »Urwahrheiten« altägyptischer, althebräischer und altgriechischer Mysterien wird angesichts solcher immensen Qualitäten sein Perfektionsdrang auf ganz natürliche Art angeregt, zumal er schon in früher Jugend, damals als »Wunderkind« angesehen, vor allem gut zeichnen und malen wollte. Es wird vielfach übersehen, dass die wichtigsten Vertreter der altmanieristischen Ideakunst von technischen Perfektionsvorstellungen geradezu heimgesucht waren; das gilt für Pontormo wie für G6ngora, für Rosso Fiorentino wie für John Donne. »Manierismus« als Ausdruck künstlerisch-technischen Unvermögens zu verstehen, entstammt den immer noch nicht überwundenen Vorurteilen unserer klassizistischen Bildungsgesellschaft, deren »Bildung« in Bezug auf Ideakunst noch immer höchst rudimentär ist.
Ernst Fuchs gehört – nicht nur handwerklich – zu den bedeutendsten Vertretern einer bewusst »integrierenden« Ideakunst unserer Zeit. Die besten Stile fesseln ihn wie die tiefsten Mythen, die heidnischen wie die christlichen. Nicht zufällig gehört er zu den wenigen Künstlern unserer Zeit, die noch Engel malen können, Engel des Schreckens und des Heils.
Außerdem hat er sich als versierter und vor allem in der Mythengeschichte wohlinformierter Schriftsteller erwiesen. Sein Buch Architectura Caelestis muss man lesen, wenn man nicht nur sein künstlerisches Werk, sondern überhaupt auch traditionelle Gehalte der modernen Ideakunst besser verstehen will[12].
In der Architectura Caelestis werden Visionen einer besonderen Architektur geschildert, deren Vorfahren aus dem Orient, aus Byzanz und Mauretanien stammen. Sie befruchteten die Hochgotik, den Manierismus, die Romantik und den Jugendstil. Elemente dieser »phantastischen« Architektur, die sich gegen die Geistlosigkeit moderner Massenarchitektur in den schrecklichen Einöden unserer Vorstädte richtet, findet man in fast allen Tafelbildern, Aquarellen, Grafiken und Zeichnungen von Ernst Fuchs. Sie alle sind durch antiklassische Züge gekennzeichnet, doch haben sie ein neues Maß in religiöser »Glaubensgewissheit«, die indes ganz subjektiv erfahren wird, im Zusammenhang mit Verzweiflung, Angst und Grauen in unserer Zeit. Vorwiegend um mythisch-gegenständliche und subjektiv-abstrakte Traumgebilde handelt es sich. Ernst Fuchs hat das, was er mit diesem Buch wollte, selbst so formuliert: »Das meiste des Gesagten aber gilt dem ungehinderten Traum von der auf Erden gewiss nie gebauten, darum himmlischen Stadt mit ihren unerschöpflichen Wundern, Terrassen, steinernen Katarakten aus rosa Quarz und Lapislazuli, Vision vom Garten aus Gold und Smaragd, wo jede Blume künstlich ist, nichts von Natur, sondern alles aus Kunst. O künstliche Stadt! Wie ist das Wort ›künstlich‹ doch ganz anders zu verstehen: ein Tor zum Reichtum des menschlichen Geistes und zu seinen Interpretationen. Und ist dieser Traum nicht der Anfang des menschlichen Lebens überhaupt?«
So entsteht künstliches Leben, phantastische Artifizialität wie in den Gedichten von Góngora. Wie ist, für Fuchs, das Wort »künstlich« zu verstehen? Er schreibt – für alle Vertreter der Ideakunst von gestern und heute –, es sei wiederholt: »Ein Tor zum Reichtum des menschlichen Geistes und zu seinen Inspirationen[13].« Und seine eigenen Inspirationen holt er sich aus alten Grottenmythen, »ob es sich nun um die Höhle des delphischen Orakels, um die Geburtsgrotte Jesu oder um die Offenbarungsgrotte Mohammeds handelt, um die Grotte oder den Gipfel des alles überragenden Berges, als Ort des Einblicks oder Überblicks, als Ort der Entrückung, um eine ›Ausnahmestellung‹ oder um den seltenen Aussichtspunkt: sie alle sind die bevorzugten Schauplätze wegweisender Erkenntnisse[14].« Spuren davon wird man ebenfalls auf manchen Bildern finden: mystische Höhlen, phantastische Heiligtümer: alles in einer labyrinthischen Architektur, die an die sogenannte Messkunst des 16. Jahrhunderts wie an Symbolismen uralter »kosmischer Kulturen[15] « erinnert.
Auch Vorbilder der altmanieristischen Architektur nennt Fuchs ausdrücklich, so etwa Verfremdung der Optik, der Fluchtpunkte und so weiter. Er weiß, dass sich aus dem »Grottenwesen« das »Groteske« ergibt, und zitiert dazu meine entsprechenden Untersuchungen[16]. Der Künstler wird zum »Artifex« im Erbe des Mythischen und der Preziosität. Die Meisterschaft des Artifex setzte, schreibt Fuchs, eine »Theologie der Kunst« voraus. Auf diese Weise entwickelte er eine Theorie über die Stellung des Künstlers in der heutigen Gesellschaft, zwischen der Götterdämmerung »verbrauchter« Mythen und der Renaissance vitaler Mythen, die vom subjektiv erschütterten Menschen regeneriert werden können. Das Subjekt soll in »Objektives« reintegriert werden, aber es darf niemals mehr die einmal errungene Freiheit verlieren, auch und gerade nicht in der systematischen Ideologisierung und Technisierung der Menschheit von heute. »Verbrauchte« Mythen! Einer der geistvollsten Landsleute von Ernst Fuchs, Friedrich Heer, schreibt vom Ende katholischer Mythen von Hölle, Purgatorio und Paradies. Doch werden diese Mythen nun ins Innere des Menschen verlegt.
Sie erscheinen als ewige psychische Zustände im Einzelnen und in den Erfahrungen seines Schicksals auf dieser Erde. Die reale Tatsache von Hölle, Purgatorio und Paradiso werde weder die »weiße Magie« der empirisch-kritischen Wissenschaft, noch die »rote Magie« kommunistischer Parteikirchen, noch die »schwarze Magie« der »alten Himmel- und Höllenpolitik der Römischen Kirche« null und nichtig machen können[17].
Genau das hat Ernst Fuchs begriffen und dargestellt. Wichtig ist, dass in seinem Werk, dem künstlerischen wie dem literarischen, die Verklärung der alt- und neumanieristischen Ideakunst bekennenden Charakter hat, dass man – wie bei Clerici – von einer bewussten Rezeption der sehr spezifischen Ideakunst sprechen kann, die uns von Zuccari formuliert wurde[18]. Meine historischen und existentiellen Hinweise wurden ebenfalls anregend.
So schreibt Ernst Fuchs in einem Werktagebuch, am Schluss seiner Architectura Caelestis, am 23. März 1964, er habe unmittelbar nach der Lektüre meines Buches Die Welt als Labyrinth folgendes Gedicht geschrieben, das ihm »wie im Traume eingefallen« sei.
Durch die WandUhr in Wände gesetztSandzeit WandzeitSand Uhr
In Dir pulst der Sand der WandZeit UhrSand UhrIn Dir NurIst die Wand.
Es handelt sich um ein typisches Figurengedicht. In der Literatur findet man sie von der Antike bis zur Gegenwart. Marino und Apollinaire haben solche auch »optisch« wirkenden Vers-Architekturen geschrieben. In ihnen wirkt der preziöse Bilderwitz, der so viele lyrische Werke im heutigen Österreich kennzeichnet.
Mauretanien wurde nicht aus Zufall zur Heimat einer wirklich eingeweihten Avantgarde der »experimentellen Poesie«. Ein derart »abstruses« Poesiebuch der »Ars phantastica« schrieb zum Beispiel H. C. Artmann unter dem Titel tök – ph’ rong – süleng. Es wurde von Fuchs und von zahlreichen anderen Künstlern der Wiener Schule illustriert[19]. So berühren sich auch hier Kunst und Literatur, historisch Gegebenes und subjektiv Erregtes. Ein neuer Traditionalismus wurde von einer besonders sensiblen und vielseitigen Avantgarde im Rahmen hochmoderner Intentionen legalisiert. »Eklektizismus«, so wird die neue Vulgärmeinung über die Kunst sagen. Das kann nur hämisch meinen, wer von den differenzierten »kulturellen« Zusammenhängen in Österreich, Frankreich und in Mittelmeerländern nicht viel weiß. Tradition ist dort Passion, Leiden und Leidenschaft geblieben. So schreibt Ernst Fuchs: »Die von Eklektizismus reden, haben vergessen oder nie gewusst, dass die wahre Kunst eine eigene Welt ist, die sich selber schafft durch den Künstler. Alles Gemeinsame ist Ausdruck dieser Einheit. Kunst wird aus Kunst gemacht und die Natur folgt der Kunst (nicht umgekehrt); denn Gott ist ja Creator, Künstler, und hat dem Menschen Seinen Geist verliehen, zu schaffen künstliche Dinge. Wie ihm die Materie gehorcht, gehorcht das Bild dem Menschen[20].«
Ich muss eine letzte Betrachtung anschließen. Der römische Kulturphilosoph Enrico Castelli, einer der scharfsinnigsten Vertreter der »Filosofia dell’Arte Sacra« und geistreicher Deuter ihrer Symbole und Bilder, schrieb in seinen Studien, das Paradies sei durch die Neugier des Intellekts verloren worden; im Kalvarium des Fortschrittdenkens habe man einen Weg beschritten, der wieder dorthin zurückkehre. »Die ganze Menschheitsgeschichte kann wie ein Kreuzweg verstanden werden der Unschuld, die nicht weiß und der Unschuld, die weiß[21].«
Damit könnte man lediglich einige symbolische Hintergründigkeiten von Malern wie Salvador Dalí und Max Ernst deuten. Angesichts des ebenso reichen wie konsequenten bisherigen Gesamtwerks von Ernst Fuchs hat man mit diesen Worten einen Schlüssel, der dem Verständnis seiner Themata dient, und zwar was Hintergründigkeiten wie Vordergründigkeiten angeht. Mit anderen Worten: Ernst Fuchs gehört zu den wenigen Malern, Bildhauern, Dichtern, Schriftstellern und Komponisten unserer Zeit, die nicht nur mit ihrer Phantasie, mit ihrer Innerlichkeit von der Rückkehr zu diesem Paradies künden, sondern die auch strengste äußere Formen der traditionellen liturgischen Kunst verwenden. Dabei werden die dämonischen Unheilvorstellungen der Modernen mit den konkreten Heilsbildern der kirchlichen Kunst in vielfältige Spannungsverhältnisse gebracht. Subjektive Angstvisionen bleiben einem objektiven »Bilderhimmel« (das Wort stammt von Ernst Fuchs) verpflichtet.
Fuchs tritt als Prophet des Unheils bloßer menschlicher Immanenz auf und als ein Epimetheus, der sich, wenn auch gebrochen, so doch noch immer gläubig, an die Heilsordnung eines unverletzten göttlichen Seins stets erinnert. Dementsprechend verbinden sich in den Themata seines Werks moderne apokalyptische Infernovorstellungen mit Erinnerungsbildern des verlorenen Paradieses, die – nicht nur in Europa – in einer noch intakten Liturgik auch magisch zu wirken vermögen.
Ernst Fuchs, ein katholisch getaufter Jude, gehört zu der großen Lignée deutschsprechender Hebräer, die im Grunde genommen stets von der Dialektik liturgischer Urbilder und gottentfremdeter Seinsverlorenheit bestimmt blieben. Fuchs wurzelt wie Franz Kafka und Paul Celan, wie Karl Kraus und Elias Canetti, wie Martin Buber und Morgenstern, wie auch Marc Chagall, im deutschen Sprachraum Mittel- und Osteuropas. Dort haben sie die elementare, ebenso mystische wie magische Religiosität des Hebräischen, einer der maßgebenden Komponenten des europäischen Geistes neben dem Griechischen, Romanischen, Germanischen, Angelsächsischen und Slawischen, nicht nur wachgehalten. Ihr schöpferischer religiöser »Asianismus« hat maßgebende Geister der ganzen Welt vor der Verflachung und Abstumpfung durch eine »Mechanisierung des Geistes« in unserer Epoche technologischer Frenesie gerettet. Ihre typisch religiöse Dialektik ist, trotz den Massenmorden in hitlerischen Vernichtungslagern, ein fruchtbares Element auch im neuen Europa geblieben.
An Ernst Fuchs wird deutlich, dass die Kunstgeschichte nicht nur als ein Kapitel der Religionsgeschichte (Castelli) angesehen werden kann. Vermutlich wird die moderne Kunst sich immer mehr in einen Engpass begeben, falls sie weiterhin auf diese Spannungsverhältnisse zwischen »Liturgie« und »Dämonie«, zwischen Transzendenz und Immanenz verzichtet.
Alle Kunst dieser Art, meint Castelli, sei mehr oder weniger »barock«. Ernst Fuchs geht, wie hier klargemacht wurde, von mannigfaltigeren Anregungen aus. Gotik, Quattrocento gaben ihm Vorbilder, doch wurden für ihn der Manierismus des rd.. Jahrhunderts, sowie der »Jugendstil« gerade Österreichs, wie er selbst erklärte, viel entscheidender. Alles Sein, alle »literarischen« Inhalte, alle Formen sind, seiner Meinung nach, ambivalent. Diese Ambivalenz kann nur überwunden werden, indem man weder auf die konkrete Darstellung spezifisch religiöser »Inhalte«, noch auf »meisterhaftes« künstlerisch-handwerkliches Formvermögen verzichtet.
Ernst Fuchs sucht also mutig alle Gegensätze zu vereinen, deren einzelne Pole heute in Frage gestellt werden: Schrecken und Seligkeit, Gemeinheit und Schönheit, aber auch literarischen »Contenuto« und sozusagen »reine«, absolute malerische Form. All dies gehört zu einer ganz persönlich religiösen Dialektik des Hebräertums, die zu einer Regeneration der heutigen religiösen Impotenz Europas beitragen kann; in Verbindung mit allen, die die Botschaft des heutigen Konzil-Cikumenismus nicht nur in einer bloß politischen, soziologischen Weise begriffen haben.
Was jeden angesichts des Werkes von Ernst Fuchs frappiert, ist die »abstruse«, manieristische Vielheit der »Inhalte« und die preziös-realistische künstlerische Darstellungsart. Um einem Künstler wie Ernst Fuchs gerecht zu werden, muss derjenige, der seinem Werk begegnet, zu einer auch persönlichen Deutung einer echt phantastischen »Discordia Concors« bereit sein. Wesentlich ist, zu erkennen, dass die dämonische Dramatik des Daseins beim Heilsstreben nach überrelativem Sein wirksam bleibt. Diese schaurige Zweideutigkeit des Menschlichen in diesem seinem Urkonflikt stellt Fuchs, wie Marcel Brion einmal über ihn schrieb, mit »fürchterlicher Genauigkeit« dar. Dies kennzeichnet auch seine künstlerischen Mittel: die Präzision ist nicht kalt, sondern magisch intensiv, so als sollten auch mit ihr die Auflösungstendenzen des Dämonischen überwunden werden, um auf diese Weise den »Bilderhimmel« zu retten, »von dem aus die Ebenbilder verkörpert werden[22] «.
Und schließlich: man kann von Träumen gleichsam in religiöser Aktion sprechen, um die ganz und gar religiöse realistisch-artistische Kunst von Fuchs von der bloß evokativ realistisch-artistischen Kunst des Surrealismus zu unterscheiden. Geistig und künstlerisch bleibt einer der modernsten Künstler unserer Zeit damit auch einer bestimmten Kunsttradition verbunden, ja einem künstlerischen Archetypus aller Zeiten, dem, wie Fuchs selbst einmal schrieb, »eminent manieristischen Zug im Wesen des Künstlers, der alle Zeiten so sehr befruchtet hat[23] «. »Auf der Jagd nach dem verlorenen Paradies wurde«, so heißt es an der gleichen Stelle, »so manche Metropolis, Utopia, Heliopolis, Ninive … gebaut, im Geiste ›nur‹; meist aber versanken sie unvollendet, kaum begonnen, im Sande der Geschichte … um immer daraus aufzusteigen in einer neuen Metamorphose, befördert von der Sehnsucht des Menschen nach Vollendung, nach dem ›besseren Leben‹, nach dem Elysium schlechthin – dem Paradies.«
Man findet weitere Informationen bei Helmut Weis, Ernst Fuchs. Das graphische Werk. Wien-München 1967. Darin auch eine »Biographie Mythomania« von Ernst Fuchs, zahlreiche Literaturangaben und Ausstellungsverzeichnis. Zu »Irregulären Mythen« vgl. auch Die Welt als Labyrinth, S. 191 ff.
3. Fabius von Gugel – Träume der Märchen
Der deutsche Maler, Grafiker, Zeichner, Radierer, Kupferstecher, Schriftsteller, Bühnen- und Porzellanbildner Fabius von Gugel hat mit Clerici und Fuchs handwerkliche Meisterschaft und Universalität gemeinsam. Sein zeichnerisches Talent ist im heutigen Europa nahezu einzigartig, ebenso seine ausschweifende, aber stets mit einer auffallenden Energie gebändigte Phantasie. Von sich selbst hat Gugel einmal gesagt, er biete zu diesem oder zu jenem Stoff »manieristische Variationen[24]