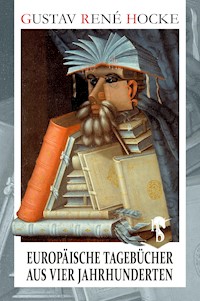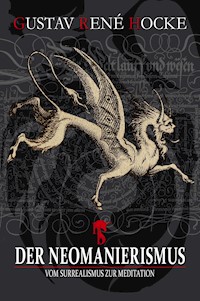9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Märchen, Traum- und Zauberwelten, Horror, Wahnsinn und das Abstruse … Phantastische Kunst und Literatur ist keine Erfindung unserer Zeit: Es gibt sie, seitdem Menschen künstlerisch tätig sind. In seinem originellen und atemberaubenden Streifzug durch die Kunst- und Literaturgeschichte Europas legt Gustav René Hocke anhand seines beeindruckenden Wissens den kulturgeschichtlichen Strang der Phantastik oder des Manierismus frei, der sich von der Antike bis in unsere heutige Zeit wie ein Roter Faden durch alle Epochen europäischer Kunstgeschichte zieht, bis er in unserer Zeit zu einer dominierenden Kunstform aufblüht. Mit »Manierismus in der Literatur« ist das zweite der vier zentralen Werke von Gustav René Hocke zur europäischen Geschichte der Phantastik nun erstmals als E-Book erhältlich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 517
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Gustav René Hocke
Manierismus in der Literatur
Sprach-Alchimie und esoterische Kombinationskunst
Paul Ludwig Landsberg gewidmet
»Das Feuer ist Mangel an Sättigung.«
Heraklit
»Wir werden auf die Geschichte hingewiesen, da erscheint uns ein neues Licht. Nach und nach lernen wir den Vorteil kennen, der uns dadurch zuwächst, dass wir bedeutende Vorgänger haben, welche aus der Folgezeit bis zu uns heran wirkten. Uns wird ja dadurch die Sicherheit, dass wir, insofern wir etwas leisten, auch auf die Zukunft wirken müssen, und so beruhigen wir uns in einem heiteren Ergehen.«
Goethe
»Begriff von Philologie: Sinn für das Leben und die Individualität einer Buchstabenmessung. Wahrsager aus Chiffren; Letternaugur.«
Novalis
»Am Ufer saß ich, Fischte, die öde Ebene im Rücken.«
T. S. Eliot
Erster Teil: Der magische Buchstabe
1. Europas verborgene Spannungsfelder
Aus dem »mundus subterraneus« der Geistesgeschichte
Im Spiegelbild des »modernen« Europäers verbergen sich entlegene Spannungsfelder. Sie haben einen Magnetismus eigener Art. Durch grelle Feuerzeichen mögen sie sich auswirken oder durch das rasche, nur nächtliche Blühen giftig erscheinender Blumen. Die Problematik des modernen Menschen kann man aus einer lediglich horizontalen Spannungsebene im Allein-Heute nur unvollkommen begreifen. Es gibt auch Spannungsschichten der Geschichte. Wer in sie dringt, steht vor vertikalen, geistig geologischen Strukturen des Problematischen. An ihren über- und ineinander gelagerten Berührungsflächen, gerade in Randschichten, gären und rauchen die chemischen, die alchimistischen, die esoterischen, die hermetischen Prozesse des Übergangs, der Krise, der speziell vom »Problematischen« erlebten Grenz-Lagen der Wende und der welthistorischen Peripetien des Geistes nicht nur des leidenden, des beleidigten Menschen vor allem. Gerade dieses Verborgene, diese Welt in der »Unterirdischkeit« des europäischen Geistes, beginnt uns zunehmend zu fesseln. Es scheint zur Aufgabe unserer Generation zu gehören, den »mundus subterraneus« in der europäischen Geistesgeschichte mit empirisch-kritischen Mitteln ans Licht des Tages zu heben. Diese oft bewusst versteckte Welt ist allerdings faszinierend. Sie ist reich an Grotten, verworrenen Gängen, Fossilien, farblosen Grottenasseln, blinden Fischen, überempfindlichen Fledermäusen, an von oben nach unten wachsenden Stalaktiten und an von unten nach oben steigenden Stalagmiten. Doch dazu mehr noch: In diesen Tropfstein-Höhlen unserer geistigen Überlieferungen finden wir, umgeben von eisiger Finsternis, wenn wir Glück haben, an bläulich-grünen Felswänden Zeichen, seltsam stilisierte »Hieroglyphen«, Botschaften unserer Vorfahren, für welche die Natur reine Dämonie war, die aber dafür Wahrheit fanden, Wahrheit nur in der eigenen Fantasie, ein inneres Abbild der Dinge, und die daher das bloße Abbild der Natur missachteten, verachteten.
Exoterik und Esoterik
Der europäische Geist will sich heute nicht mehr nur aus seinen äußeren, exoterischen Landschaften begreifen. Er möchte in die inneren, esoterischen Labyrinthe seiner Seinsgründe eindringen. Er möchte mehr über seinen »mundus subterraneus« wissen. Dieser Ausdruck stammt von Athanasius Kircher, dem »abstrusen« Polyhistor des 17. Jahrhunderts. Er meinte, das »Innere« unseres Planeten sei nichts anderes als ein nie entwirrbares Labyrinth. Welchen Sinn hat es, nicht nur in die Labyrinthe des Erdinnern, sondern nun in die »esoterischen« Labyrinthe des europäischen Kulturorganismus einzudringen? Man kann und wird es verstehen: Der »moderne« Mensch strebt nach einer nicht nur seelenkundlichen, sondern auch nach einer formenkundlichen Analyse aller jener Bestandteile der europäischen Kultur, die je und eh die »Problematik« seines Wesens (in der Geschichte) sichtbar gemacht haben. Er sucht nach psychischen Archetypen, nicht nur im Klinischen, nicht nur im Psychologischen. Er will das ihn – gerade heute – so unheimlich umdringende Problematische aller sogenannten »Kultur« in und aus dem begreifen, was gemeinhin als »Ästhetik«, als die Lehre vom »Schönen«, bezeichnet wurde.
Vielleicht wird überhaupt der intelligente moderne Europäer, sofern er nicht im Malstrom der technisierten Massengesellschaft untergegangen ist, dadurch zu einem neuen, durchaus schöpferischen Repräsentanten seiner geistigen Umwelt, dass er Wissen über das Absolute, Erlösung aus neurotischer Problematik in den Werken der Künstler, der Dichter oder Komponisten sucht. Welch ein Wandel! Niemand wird übersehen können, dass wir wieder mitten in einer neuen alexandrinischen Gnosis stehen, in einer Gnosis, die »Ur-Wahrheit«, Begegnung mit einem Absoluten, vor allem in Kunst, Literatur und Musik finden möchte, also im »vorkirchlichen« Raum. Das kann uns als ein Zeichen der Hoffnung gelten. Es liegt aber auch die Gefahr störender Neurosen nahe, Symptomen der heutigen politischen Selbstzerstörungs-Tendenzen. Unsere Ästhetik hat mit unseren psychologischen Errungenschaften nicht Schritt gehalten, sofern es um Grundelemente geht. Wir verfügen über eine Tiefen-Psychologie. Es wird Zeit, nach Elementen einer Tiefen-Ästhetik zu graben.
Formenkunde des Irregulären
Gnosis aus Begegnung mit nur Kunst, Literatur und Musik kann im psychischen Aufbau einer Persönlichkeit zerstörend wirken, wenn, gerade was »Problematiker« angeht, eine elementare Formenkunde im ästhetischen Weltbild fehlt oder mangelhaft ist. Wer Erlösung im Ästhetischen sucht, ohne die Strukturen der irregulären Ästhetik des Problematischen zu kennen, begibt sich in Gefahr. Geistig passt er sich, ohne es zu wissen, den vereinfachenden Prozessen der technisierten Massengesellschaft von heute an. Er wird Opfer einer »Mode«, so wie breite Schichten Opfer jeweiliger totalitärer Ideologien werden. Mehr noch: Er versteht sein irreguläres Ideal nicht einmal so, wie er es, in ehrlicher Gewissensprüfung, in stillen Stunden innig möchte.
Insofern wird für jeden, der das Problematische Europas und das Problematische in sich selbst illusionslos verstehen will, das »Unbewusste« in der unterirdischen Geistesgeschichte Europas Ereignis, als Weg für und zu persönlicher Freiheit … zu einem viel unmittelbareren Zwiegespräch mit dem nicht reduzierbaren Numinösen, zu einem Stehen vor Gott.
Geistesgeschichtliche Speläologie
Daher ergibt sich die Notwendigkeit, in einer Krisenzeit geistesgeschichtliche Speläologie, systematische kulturelle Höhlenforschung zu treiben. Sie soll weder vor-täuschen, noch ent-täuschen. Sie soll einen Ariadnefaden vermitteln, der in einem Labyrinth von Selbst-Täuschung zumindest zu einem Ausgang verhilft. Wer damit nicht zufrieden ist – am Ende unseres Weges –, der mag sich andere Ausgänge suchen. Wer sich in diese Schächte hinab- und auch hinaufbegibt, weiß, dass er sich zu einem Abenteuer anschickt, aber er wird hoffen dürfen – im Sinne der »Theologia Cordis«, des »Intelletto d’Amore« –, in seit Langem nicht durchwanderten Gängen auf jene Geheimzeichen zu stoßen, von denen bereits die Rede war. Doch mag es dann geschehen, dass diese Gebilde, bringt man sie ans Licht zurück, allzu »schockartig« auf Helle reagieren. Sie könnten dann – im Empfinden und Urteil des Lesers – wie Tiefwasserfische, hält man sie in die Sonne, nicht nur sterben, sondern blitzschnell zu Staub zerfallen, und das geschieht, wie man weiß, auch manchem archäologischen Ausgrabungsgut. Doch wollen wir versuchen, solchen Zeichen, Niederschlägen ursprünglicher Gebärden, zu einer wenigstens dokumentarischen Dauer zu verhelfen. In einem speläologischen Spiegel des europäischen Geistes mögen sie dann erhalten bleiben, Buchstabe um Buchstabe, Wort um Wort, Satz um Satz.
»Natürlich« und »Künstlich«
Zwei Ausdrucksgebärden wird dieser Menschenspiegel zunächst immer wieder verzeichnen, elementar gesagt, einen »natürlichen« und einen »künstlichen«. Und die gleiche Zweiheit wird dieser Spiegel auch angesichts des Ur-Duktus des Schreibens vermerken. Stellt man der »knappen«, zwar auch stilisierten, aber un-»verblümten« Weise die Art des verschnörkelnden, ver-blümten[1] Mitteilens gegenüber, so ist der literarische Manierismus (als Ausdrucksform des problematischen Menschen) so alt wie die Literatur selbst. Dieses Gegensatzes wurde man sich schon zur Zeit Platons bewusst. Das Streitgespräch zwischen Attizisten (Klassizisten) und Asianern (Manieristen) gehört zu den archaischen Spannungen des europäischen Geistes.[2] Das Wort »klassisch« ist ein Spätling in unserem Vokabular. In Altrom war es zunächst ein steuerrechtlicher Ausdruck. Ein classicus gehörte der höchsten Steuerklasse an.[3]
Attizismus und Asianismus
Warum heißt dieser Stil »asianisch«? Er ist – schon im 5. Jahrhundert v. Chr. – im griechischen Kleinasien entstanden. Durch die Begegnung des griechischen Mutterlandes mit altorientalischen Kulturen erhielt er entscheidende Impulse. Als seine ältesten Vorbilder gelten Gorgias von Leontini, Empedokles und vor allem der »dunkle« Heraklit, »Urahne des Surrealismus« (Breton) mit seinen verrätselnden Antithesen, Metaphern und Wortspielen. Schilderungen des damaligen Konflikts zwischen diesen beiden Stilen findet man in den rhetorischen Abhandlungen Ciceros und in Quintilians Lehrbuch der Rhetorik. »Das höchste Gesetz des Asianismus liegt in der Willkür« (Norden), aber es handelt sich, wie wir sehen werden, sehr oft auch um eine wohlerwogene, ja, berechnete Willkür.
Mimesis und Phantasia
Doch wollen wir versuchen, den Gegensatz von Attizismus und Asianismus im Zusammenhang mit unseren Manierismus-Problemen in ein anderes dialektisches Verhältnis zu bringen. Attizistisch wird schon im 2. Jahrhundert v. Chr. ein »Stil« genannt, der auf die alten »klassisch reinen«, »gesunden« (Cicero) attischen Vorbilder aus dem 5. und 4. Jahrhundert v. Chr. zurückgreift, insbesondere auf die Musterautoren Thukydides, Lysias und Demosthenes. Deren Ideal war die »Mimesis«, die Naturnachahmung bzw. die »Darstellung menschlicher Handlungen und Taten, in deren Umkreis der Mensch selbst eingeschlossen bleibt wie in dem eines Schicksals oder einer ursprünglichen Ordnung«.[6] Den asianischen Stil hat man bisher meist nur mit den polemischen Begriffen seiner attizistischen Gegner gekennzeichnet (vor allem Ciceros und Quintilians). Diese nur negativen Stilkriterien bedürfen der gleichen Korrektur, die uns Ernesto Grassi zum Mimesis-Begriff gegeben hat. Wir werden das im Laufe dieser Darstellung ergänzen. Doch wollen wir einleitend schon der attizistisch-»klassischen« »Mimesis« die asianisch-»manieristische« »Phantasia« gegenüberstellen. Wir berufen uns dabei auf drei Stellen in der Rhetorik des Quintilian (Ende des 1. Jahrhunderts n. Chr.).
Um die großen Stilgegensätze seiner Zeit zu charakterisieren, weist Quintilian auf die bildende Kunst hin. Er nennt dabei z. B. Theon von Samos, der sich durch ein lebendiges Erfassen von Vorstellungen auszeichne, durch »Phantasiai« (XII, 10, 6). An anderer Stelle schreibt er dazu: »Phantasiai nennen die Griechen – wir mögen dazu immerhin ›visiones‹ sagen – die Seelenkräfte, vermöge deren wir Bilder abwesender Dinge uns so lebhaft vorzustellen imstande sind, dass wir sie mit Augen zu sehen und leibhaftig vor uns zu haben glauben. Wer solche Vorstellungen lebendig erfasst, wird in Stimmungen sehr stark sein« … »Oft entstehen solche Bilder in der Langeweile und in krankhaften Wunschträumen« … »Dieses seelische Laster (animi vitium), warum sollte man es nicht zweckmäßig anwenden?«[7] (VI, 2, 29) Schließlich nennt Quintilian die Phantasiai: »Abbilder der Dinge«.
Wenn Quintilian etruskische (asianische) Künstler von attizistischen ebenso unterscheidet wie asianische Redner von attizistischen, wenn er Perikles mit der »Schlichtheit« des attizistischen Redners Lysias vergleicht, so können wir als einen Gattungsbegriff für asianische Stilmerkmale den Ausdruck »Phantasiai« wählen. Der attizistisch-klassisch-konservativen »Mimesis« kann man zumindest als heuristisches Prinzip das asianisch-manieristisch-moderne »Phantastikon« gegenüberstellen, und wir haben damit, wie wir noch näher belegen werden, die literarische Wurzel der subjektivistischen Idea-Lehre, des Disegno Fantastico, der Imitazione Fantastica der manieristischen Traktatisten der Jahrzehnte vor und nach Shakespeare wie der heutigen »Modernen« speläologisch vor uns.[8] Im Jahre 1650 schreibt einer der italienischen Programmatiker des damaligen Manierismus, Matteo Peregrini, in seinem Buch »Fonti del Ingegno« (Bologna 1650), es lägen die »Ideen der Dinge« »in unserem Busen«. Sie lagerten dort wie in einer Mustermesse oder wie in den Buchstaben-Kästen der Setzereien. Man könne sie daher auch »Immagini« oder »Fantasmi« nennen.[9] Dazu Shakespeare: »Und wie die schwangre Fantasie Gebilde / von unbekannten Dingen ausgebiert / gestaltet sie des Dichters Kiel, benennt / das luft’ge Nichts und gibt ihm festen Wohnsitz.«[10]
Alte und neue Redeweise
Zur Mimesis gehört die harmonische Ordnungslehre der »archaia retoriké«, der alten Redeweise, zum Phantastikon die »nea retoriké«, die neue Redeweise. Die Mimesis stellt den Menschen und sein Schicksal in kreishafter Harmonisierung, das Phantastikon den Menschen in »Fantasie-Bildern« dar. Die Phantasiai-Künstler kennen und brauchen das Korrektiv der »Natur« nicht. Die Welt der Fantasiebilder ermöglicht es, alles in alles zu verwandeln, die elementaren Aggregat-Zustände zu missachten. Nicht die Welt der Natur, sondern die Welt der Vorstellung wird zum künstlerischen Ereignis.
Hellenistische Ursprünge der »Phantasia«-Ästhetik
Kann man den Ursprung unserer zeitgenössischen Kunst- und Literatur-Revolution in hellenistische Zeit verlegen? Wir dürfen uns für erste Ansätze auf Kenner der Antike berufen wie z. B. Bernhard Schweitzer[11]. Fassen wir seine Forschungsergebnisse über den Begriff »Phantasia« kurz zusammen. »Phantasia«, Vorstellungsbild, wurde schon von Aristoteles mit der Kunst in Verbindung gebracht. In der stoischen Philosophie wird aus diesem mehr psychologischen ein kosmologischer Begriff. Durch Phantasia erfasst man den Weltgrund. Phantasia wird zu einer »Durchgangsstelle zwischen göttlichem Willen und menschlicher Ausführung«. Die mythische Ordnungswelt der Mimesis gerät allmählich aus den Angeln. Es erfolgt »die Geburt der revolutionären Persönlichkeit« – nach dem Erlebnis des Sonder-Daseins der Phantasia[12]. Dieses sich in einem neuen Sinne frei fühlende Subjekt will sich »nicht mehr dem Herkommen beugen und nicht mehr im handwerklichen Sinne Stein auf Stein zur gemeinsamen sterblichen Welt und zum gemeinsamen Weltbild fügen«. Es fordert »seine eigene Welt«. Der mythische Objektivismus der Mimesis wird durch den zunächst noch mythischen Subjektivismus der Phantasia-Gnosis verdrängt. Es beginnt die »Auf-Sich-Bezogenheit allen Fühlens und Denkens«. Daraus ergeben sich »neue Quellen der Kraft«. Der Künstler bezieht jetzt sein »Gesetz aus dem Innern«[13]. Es entsteht »ein neues Bewusstsein von schöpferischem, individuellem Gestalten«. Das Vorstellungsbild des Künstlers, die Phantasia, wird »identisch mit dem Angelpunkt des ganzen seelischen und geistigen Lebens«. Dieser Bruch erfolgte also im frühen Hellenismus (4.–3. Jhdt. v. Chr.).
Merkmale erster Wandlungen
Nicht die Ordnung, die Gemeinschaft, die Harmonie, sondern die Affekte und die individuelle Tragik, ja, »die Beobachtung pathologischer Reizerscheinungen« werden Ziele und Mittel von Kunst und Dichtung. »Das Ziel war nicht mehr objektive Richtigkeit, sondern subjektive Wirkung der Darstellung«[14]. Der Gegensatz von Mimesis und Phantasia wird immer stärker. Es handelte sich damals also schon um »die Todesstunde des klassischen Idealismus und um die Geburtsstunde des Individualismus«. Die Phantasia-Kunst-Idee tritt »in reifer Form zur Zeit der zweiten Sophistik auf und systematisiert bei Plotin«. Diese neuplatonische Phantasia-Ästhetik wirkt – wie wir wissen[15] – im gesamten europäischen Manierismus bis heute nach. »Der realen Nachahmung des Gegenständlichen wird die apriorische und in Gott gegründete Sympathie zwischen Natur und Künstler gegenübergestellt[16]. Philostratos schreibt (im Leben des Apollonios von Tyana VI. 19, p. 256, etwa 250 v. Chr.): »Die Phantasia – eine weisere Künstlerin als die Nachahmung (Mimesis) –. Nachahmung bildet, was sie sieht, die Phantasia aber auch das, was sie nicht sieht.[17]« »Der Wert des durch Phantasia gesetzten irrealen Bildes überstieg immer mehr den des realen Vorbildes; das Band, welches das künstlerisch Wirksame mit der Sinnenwelt verband, wurde immer dünner.« Seneca, einer der Lieblingsautoren maßgebender europäischer Manieristen, fasst diese Wendung in die Worte: »Es ist – ganz belanglos, ob der Künstler sein Modell draußen hat, auf das er seine Blicke richtet, sondern im Innern …«[18]
Zu dieser Hypostase der Phantasia gesellt sich dann eine neue – mehr ästhetisch-psychologische – Anwendung der platonischen Mania-Lehre. Es interferieren also nicht nur Asianismus und Manierismus, sondern auch Phantasia und Mania[19]. Doch vergessen wir nicht, dass dies alles im hellenistischen Neuplatonismus noch in einem mythischen Urgrund geborgen bleibt. Plotin schrieb eine der tiefsten Formeln zur Ästhetik der Antike: »Die irdische verfälschte Wirklichkeit verlangt nach der Ergänzung in einem schönen Bilde, damit sie sowohl als etwas Schönes erscheine als auch überhaupt sei.[20]« Die hyper-subjektivistische Säkularisierung erfolgt erst später.
»Ungesunde« Bilder
Davon, von der Gefahr, die Inhalte der Phantasia zu verabsolutieren, hat Quintilian (35–86 n. Chr.), als er von bestimmten »Phantasiai« als von »seelischen Lastern« schrieb, offenbar schon gewusst[21]. Die demiurgische Verabsolutierung der Phantasie-Innen-Welt musste also durchaus Baudelaire als Vorboten zu seinen »Paradis Artificiels« erschienen sein[22]. Eines ist sicher: Vom schöpferischen »irregulären« Phantasia-Kunstwerk von Rang bis zu den zahllosen künstlerischen manieristischen Manifestationen der Phantasia als »seelischer Laster« ergibt sich eine unendliche Skala von individuellen Entfaltungsmöglichkeiten. Wir werden sehen, dass diese neuen Aspekte einer manieristischen Gebärdenkunde dazu verhelfen, einen starren Schematismus zu vermeiden. Das »Phantastikon« kann irrational, aber, in einem besonders typisch manieristischen Sinne, auch sehr »ingeniös« sein, also stark der Kontrolle einer – im Sinne des Labyrinth-Erbauers Daidalos – berechneten Technik des phantastisch-intellektuellen Kunstingenieurs unterliegen.
Kontinuität im Irregulären
Dürfen wir den Asianismus mit dem Oberbegriff einer antinaturalistischen Kunst der Phantasiai kennzeichnen? Gibt es eine europäische Kontinuität des Anti-Harmonischen, des Irregulären? Wir wollen schrittweise vorgehen. Der Archäologe Reinhard Herbig hat den antiken (literarischen) Gegensatz von Attizisten und Asianern mit zeitgenössischen Begriffen auf die bildende Kunst übertragen, anlässlich einer Abhandlung über antike Fresken in Pompeji und in Boscoreale. Die (attizistischen) Fresken der Mysterien-Villa bei Pompeji sind: klar, einfach, schlicht, ungebrochen, ruhig, nicht überanstrengt, ohne überflüssige Akzente. Die (asianischen) Fresken von Boscoreale sind übersteigert, der formale Reichtum überwuchert den Inhalt. Diese Kunst überredet, überspannt, überrennt, aber eben auch mit gesuchten, berechneten Mitteln. In der »manieristischen« Kunst Altgriechenlands (z. B. in der pergamenischen Plastik) »verläuft keine Kontur ohne vielfache zittrige Brechungen, keine ohne stete Wendung und Wiederwendung«. Nirgends begegnet man »großen ungebrochenen Schwüngen des Verlaufs«. »Die Übergänge vollziehen sich in heftigem Bruch.«[23] Wie rund 1900 Jahre vorher Quintilian, so hat auch Baltasar Gracián vor 300 Jahren, 36 Jahre nach Shakespeares Tod, in seinem für den dichterischen Manierismus dieser Zeit maßgebenden Traktat über »Agudeza y Arte de Ingenio« auf diesen Dualismus eines natürlichen (»laconico«) und künstlichen (»asiatico«) Stils hingewiesen.
Schreibkünstler
Um auch den literarischen Manierismus als Konstante der europäischen Geistesgeschichte und in unserem Sinne als Ausdruck einer Triebstruktur zu begreifen, wird man mit dem Buchstaben, mit dem Alphabet beginnen müssen. Manierismus in der Literatur fängt nicht beim Wort, beim Satz, bei der Periode an. Schon der Buchstabe regt den Trieb zur Symbolisierung, Bereicherung, Ausschmückung, Verdunkelung und Verrätselung an, zur Kombination von Phantasie und berechnender Künstlichkeit. Der Buchstabe stellt nicht nur einen Laut dar. Er ist selbst ein bildhaftes Zeichen, das vor allem in den frühen Kulturen des Vorderen Orients einen magischen oder mystisch-religiösen Symbolwert hatte. Nimmt man Buchstaben zunächst als »Bilder«, so wird damit, nachdem wir einige Elemente des Manierismus in der Kunst untersucht haben[24], in optisch fassbarer Weise ein Übergang geschaffen für eine Darstellung des Manierismus in der Literatur.
Ein attizistisches, »klassisches« Zeichen für einen Buchstaben findet man in der Darstellung des Buchstaben »M« aus dem »Gründlichen Bericht der alten lateinischen Buchstaben« (um 1540) des deutschen Schreibkünstlers Johann Neudörffer. Dieses Zeichen dient dem klaren Erkennen und der Schönheit, die unmittelbares Bedeuten auszustrahlen vermag. Man ahnt attische Struktur antiker Tempel. Vergleicht man nun damit einen anderen Buchstaben aus der Shakespeare-Zeit, das Initial »W« von Paul Franck aus dessen Versalienbuch »Schatzkammer« (1601), so begegnet man der anderen, der asianischen Welt. Wie der Sinn eines manieristischen Kunstwerks oder Gedichts verdunkelt erscheint, so geht hier die Erkennbarkeit des elementaren Mitteilung-Zeichens verloren. Subjektivismus herrscht vor.
Die entfesselte Phantasie wird antiklassisch. »Ein ausschweifendes Schnörkelwesen bringt … das statische Regelschema der Renaissance ins Schwanken.« Inkommensurable Kurven bilden »Vexierbilder«[25]. »Das Prinzip der Veränderung und Verwandlungen, ein echt manieristisches, triumphiert in den Großbuchstaben der Kurrent.« Die Mitteilung wird deformiert. Es entsteht ein verschlüsseltes Lineament. Alles kann miteinander vertauscht werden. Doch dieses Verfahren verliert sich keineswegs im grenzenlos Überschwänglichen. Auch der Manierismus hat seine Ordnung, sein metaphysisches Idealgefüge. Sein Symbol ist das Labyrinth. Man findet zur Zeit des römischen und florentinischen Manierismus Buchstaben- und Wort-Labyrinthe. In dem »Neu Fundamentbuch« von Urban Weyss und Christoffel Schweytzer (Zürich 1562) kann man in dieser kunstvollen Konstruktion lesen: »Wer will erfahren der welt wesen Der thuo disen reimen lesen, Darinnen wirt er finden geschwind, Wie die ganze welt ist worden blind« usw. Die Verdeckung des Funktionswerts von Buchstabe und Wort beginnt beim literarischen Manierismus also schon beim Schreiben der Schriftzeichen. Es wäre voreilig, dies als »barockes« Schnörkelwesen ab- und gering zu schätzen. Auch die manieristische Schreibkunst ist ein Versuch, durch Kalkül das Berechenbare der Künstlichkeit mit dem Unberechenbaren des Phantastikon zu vereinen. Es handelt sich ursprünglich noch um alchimistische Verbindungs-Kunst auch beim Kunstschreiben sinn-bedeutener Zeichen, um den eigengearteten Ausdruck einer uralten »Alchimie du Verbe«. Die Dekadenz lässt nicht lange auf sich warten.
Gestik und Duktus
Wir wollen jedoch hier darauf verzichten, weitere Äußerungen einer solchen »Ausdruckskunde« zu verfolgen. Wir haben uns die Aufgabe gesetzt, eine historische Entwicklung darzustellen und eine manieristische Konstante in der europäischen Literatur mit Beispielen zu belegen[28]. Wir ziehen dieses empirische Verfahren vor, weil es uns vor Abstraktionen sichert, den Ursünden mancher »Literaturwissenschaft«. Wir werden dabei zunächst mit der Antithese: Attizismus – Asianismus operieren, in der Hoffnung, zum Schluss eine überzeugende Integration vortragen zu können.
Poetische Labyrinthe
Kehren wir zu unserem Alphabet – nun als Literatur – zurück. Wenn dem problematischen Menschen die Welt als Labyrinth erscheint und wenn Daidalos, wie wir noch sehen werden, als mythisches Urbild der artifiziellen, labyrinthischen Ordnung anzusehen ist, so können und müssen schon Buchstaben- und Zahlenkombinationen als elementare Mittel erscheinen, das Irrationale der Natur durch das Rationale des Kalküls zu überwinden. Doch soll in solchen artifiziellen Ordnungen gleichzeitig die Wunderbarkeit des unauflösbar Widersprüchlichen erhalten bleiben! Wieder ein dramatischer Grundzug des Manierismus, der selbst im pseudomythischen Nur-Noch-Spielen mit Buchstaben-Kombinationen zumindest noch zu ahnen ist. Wir werfen einen Anker in das Meer von Geschichte, das um uns braust, und versuchen eine erste Orientierung. Im Jahre 1651 veröffentlichte der deutsche Jesuitenpater Eusebius Nieremberg zu Madrid in spanischer Sprache ein merkwürdiges Werk. Es heißt »Occulta Philosophia de la Sympatia y Antipatia«. Es handelt sich um eine mystische Kosmologie, die bis ins 19. Jahrhundert hineingewirkt hat. Joseph Scheebens Interpretation der katholischen Mysterien wurde davon beeinflusst[29]. In diesem Werke Nierembergs, eines Zeitgenossen von Tesauro und Gracián[30], finden wir die Welt als »Laberinto Poetico« charakterisiert[31]. Der Wunderbau der Natur erscheint als eine Nachahmung der Kunst. Die Welt ist von Gott »gemacht«, in »artifizieller« Weise, nach Formeln der Arithmetik und der Kunst, nach Urgesetzen von Sympathie und Antipathie.
Um aber das göttliche Verfahren genauer zu erklären, weist Nieremberg – in dieser Epoche des damaligen Spätmanierismus – auf die Buchstabenlabyrinthe eines römischen Dichters aus konstantinischer Zeit hin, auf Optatianus Porfyrius. Die »höchst künstlichen« Labyrinthe des Porfyrius, in der »Manier« von Buchstaben-Reihen gebildet, erscheinen ihm »ingeniosissimi«, äußerst geistvoll. In tausend labyrinthischen »maneras« sei also eine göttliche Harmonie entstanden, eine rätselhafte (labyrinthische) Ordnung des Chaotischen. Uns interessiert vor allem, dass Nieremberg zur Erklärung dieser geheimnisvollen Strukturen auf die antiken Technopägnien hinweist, d. h. auf die Buchstaben- und Figuren-Gedichte der Antike. Wir begegnen damit einem ersten formalen Manierismus, der aus der Antike stammt, im Manierismus des 17. Jahrhunderts. Diese alten »poetischen Labyrinthe«, die auf älteste Kulturen, vor allem Ägypten und China, zurückweisen, haben in der zeitgenössischen Literatur zu einem oft schwer entwirrbaren Symbolismus angeregt. Einer ihrer Vorläufer, Mallarmé, nannte sein lyrisches Werk: »ein blumengeschmücktes Labyrinth«. Die Erzählungen des Spaniers Jorge Luís Borges (geb. 1899) haben den bezeichnenden Titel »Aleph«, hebräische Bezeichnung für den Buchstaben »A«[32]. Diese in jedem Sinne alexandrinischen Prosastücke sind gongoresk, bewusst nach Vorbildern des 17. Jahrhunderts stilisiert. Labyrinthe schreiben heißt anscheinend unentwirrbare Beziehungen herstellen, den Leser in »magische« Welten entführen[33]. Ein symbolisches Labyrinth wird – bei Borges – zu einem »unsichtbaren Labyrinth der Zeit«. Gedacht wird an ein »Labyrinth der Labyrinthe, an ein gekrümmtes, sich stetig ausdehnendes Labyrinth, das die Vergangenheit und Zukunft umschließt und die Sternenwelt in sich einbezieht.«[34]
Solche Technopägnien gehen zurück auf Alexandrien, auf den ersten großen Sammelpunkt des asianischen Manierismus, die Gegenwelt des Attizismus. Sie wurzeln im alexandrinischen Neuplatonismus. Die Ursprünge aber liegen in der Alphabet- und Zahlenmystik der semitischen Frühkulturen des Orients. Dieses kombinierende Prinzip hat auch die Kunst der konstantinischen Zeit beeinflusst[35]. In der manieristischen Literatur Spätroms wurde es zur Mode[36], im manieristischen 17. Jahrhundert aber zu einer Zwangsvorstellung. In der deutschen »Barock«-Dichtung wimmelt es von Buchstabenkünsteleien dieser Art.
Literarische Kuben
Labyrinthische Gesetzmäßigkeit! Im Jahre 1704 veröffentlicht Joh. Christoph Männling den »Europäischen Helikon«, ein Lehrbuch der Poetik, angeregt durch das Wirken der Marino-Schüler Hofmannswaldau und Lohenstein. Beide bezeichnet Männling als seine »Ariadne-Fäden«. Wie später Mallarmé, Valéry, Benn geht er auf die ursprüngliche Bedeutung des griechischen Wortes »Poietes« zurück; es kommt von »Machen«. Höchste Kunst des »poietischen« Machens bekunde man bei der Herstellung eines »Irrgedichtes«, eines »Cubus«, d. h. eines »Carmen Labyrintheum«, »welches in einen Irrgarten führt, und links und rechts, oben und unten, überzwerch, in die Breite und Länge gelesen wird. Es besteht aber das ganze Kunststück in dem allermittlersten Buchstaben, welcher groß gesetzt steht, von dem gehen hernach alle andern in die anderen Linien ab, wie solches hier als Exempel am deutlichsten kann zeigen, da wir die Worte nehmen wollen: Gott ist mein Trost. Also in der Mitten G den Anfang zu lesen machet, und mehr als 40mahl können gelesen werden«[37]. In Oviedo (Asturien) findet man eine vom Fürsten Silo erbaute Kirche San Salvador. Der Grabstein ihres Erbauers trägt eine Inschrift, die wie ein Geheim-Code aussieht. In der Mitte nach den vier Ecken t, t, t, t lässt sich der Satz »Silo princeps fecit« auf 45 760 verschiedene Arten lesen.
Das geheimnisvollste »Magische Quadrat«, Anagramme und Palindrome vereinigend, ist die berühmte Sator-Arepo-Formel[38].
Unter Hinzufügen von Alpha und Omega (in lateinischen Buchstaben) ergibt sich also:
Pangrammatische Kunstgriffe
Es gibt uralte formale Manierismen. Auch sie führen auf die graeco-orientalische Antike zurück. Wir können sie als manieristische Grundformen, als das kleine Einmaleins gleichsam ansehen für starke Spannungsverhältnisse zwischen Natur und Geist.
Älteste formale Manierismen in Bezug auf Buchstaben-Kombinationen sind die »lipogrammatischen« (z. B. Gedichte ohne den Buchstaben »s« o. Ä.) und »pangrammatischen« Kunstgriffe (z. B. möglichst viele aufeinanderfolgende Wörter mit demselben Buchstaben). Eines der berühmtesten pangrammatischen Kunststücke stammt von Ennius. Es lautet: »O Tite, tute, Tati, tibi tanta, tyranne, tulisti.« Ernst Robert Curtius findet – außer diesen beiden formalen Manierismen und den Buchstaben- oder Figurengedichten – weitere vier »Hauptarten«. Es sind:
1. Die »logodaedalia«, d. h. Verwendung von nur einsilbigen Wörtern in Versen; oder jeder Vers beginnt und endet mit einem Monosyllabon, wobei das Schlusswort jedes Verses als Anfangswort des nächsten wiederkehrt.
2. Das versfüllende Asyndeton, d. h. die Worthäufung im Vers.
3. Die versus rapportati, d. h. »mehrere verschränkte Aufzählungen, in denen die meist in der Dreizahl vorhandenen Nomina, Verba, Adjektive, adverbiellen Bestimmungen usw. erst durch Auflösung der Verskombination in ihrer Zugehörigkeit zueinander erkannt werden können, während die hörbare Satzgestalt zu falscher Vorstellung verführt, zurücktritt und erst für das Auge abgewickelt werden muss«. Ein Beispiel von Opitz: »Die Sonn’, der Pfeil, der Wind, verbrennt, verwundt, weht hin / mit Feuer, Schärfe, Sturm, meine Augen, Herze, Sinn.« Aufzulösen: Die Sonn’ verbrennt mit Feuer meine Augen usw.
4. Das Summationsschema, d. h. Summierung aller Gedichtmotive im Schlussvers.[39]
O Petrus – Proteus
Alle diese formalen Manierismen stammen aus der antiken Literatur. Sie kennzeichnen insbesondere den noch ausschließlich rhetorischen Charakter der »Manierismen« der lateinischen Literatur des Mittelalters. Sie tauchen aber auch in allen späteren manieristischen Epochen wieder auf, wobei sich allerdings, wie wir später sehen werden, eine fortschreitende Verwandlung und schließlich eine Preisgabe der überlieferten, der attizistischen rhetorischen Rezepte ergibt. Dies zu verfolgen und zu belegen, gehört zu den wichtigsten und reizvollsten Aufgaben einer Phänomenologie und Geschichte des literarischen Manierismus. Die Liste formaler Manierismen wird zwangsläufig länger werden.
Es kommt aber eine weitere Tendenz hinzu: die gewollte Verdunkelung, das Bemühen um ein geheimnisvolles Chiffresystem, um verbergendes Bedeuten. Novalis: »Rätselweisheit, oder die Kunst, die Substanz unter ihren Eigenschaften zu verbergen.« Baltasar Gracián preist in seinem schon erwähnten Traktat »Agudeza y Arte de Ingenio«[40] die Technik der Buchstaben- und Wort-»Verdrehung«. Auf diese Weise erzeuge man Wort-»Labyrinthe«. Die Buchstaben und Silben könne man so vertauschen, dass sich eine »Nueva y misteriosa significación« ergibt.[41] Anagramme u. Ä. dienen also nicht nur dem Spiel, dem Vergnügen, dem nur banalen Witz.
2. Sprachliches Doppelleben
»Ehrliche Verstellung«
Künstlichkeiten dieser Art dienen einem verbergenden Esoterismus, genauso wie die damals so geschätzte Hieroglyphik und Emblematik. Buchstaben-Kombinationen werden in den verschiedenen Formen des literarischen Manierismus im Europa des 17. Jahrhunderts (in Spanien Conceptualismo, Cultismo und Gongorismo, in England Euphuism, in Italien Marinismo, in Frankreich Préciosité, in Deutschland »Vernunft-Kunst«)[42] auch zu Methoden, um eine doppelte sprachliche Schicht zu erzeugen, einen sprachlichen Doppelsinn, eine sprachliche Ver-Stellung. Zum Lebensstil der Epoche gehört die so vielfach angepriesene Verstellung des persönlichen Verhaltens. Man lebt auf zwei Ebenen, einer intim-persönlichen und einer öffentlich-gesellschaftlichen. Diese auch charakterliche Esoterik und Exoterik bilden ein Grundthema im Handorakel von Gracián. Ein italienischer Dichter, Torquato Accetto, schrieb 1641 eine Schrift über die »Dissimulazione onesta«, die ehrliche Verstellung.[43] Gepriesen wird die Kunst der Verstellung. Man soll »änigmatisch« sein und »hintergründig«. Ja, die Schönheit ist nach Torquato Accetto nichts anderes als eine »liebenswürdige Verstellung« (Tutto il bello non è altro che una gentil dissimulazione).[44] Gracián erkennt Góngora, der neben Shakespeare und John Donne auch für uns noch der größte Lyriker des 17. Jahrhunderts ist, als Meister an, weil er »con mudar alguna letra«, mit der Umstellung einiger Buchstaben höchste Wirkungen erziele.[45] Durch die Verstellung von Buchstaben könne man vor allem rätselhafte »correspondencias«, Entsprechungen, erzeugen. Sogar theologische Mysterien würden uns auf diese Weise erschlossen. So wird aus »Dios« (Gott) »Di« »os« (Gib uns) z. B. das Leben, das Sein usw.[46] Es entstehen auf diese Weise geistvolle Zweideutigkeiten (»Equivocos ingeniosos«)[47]. Wortlabyrinthe sind somit nicht nur Ausdruck einer höchsten Subtilität. Sie dienen auch einer Verschlüsselung der Welt.
Geheimbotschaften
In den Tragödien und Komödien Shakespeares wimmelt es nicht nur von Wortspielen. Durch Buchstaben-Kombinationen und geheime Wortentsprechungen soll es darin ganze »Geheimbotschaften« geben. Man bemüht sich seit vielen Jahren um ihre Entzifferung. Bis 1950 sind darüber Hunderte von Büchern erschienen. Man hat aus solchen Chiffren vor allem herauslesen wollen, dass Bacon sich als Verfasser einzelner Stücke enthüllt. Vor Kurzem ist über diese chiffrierten Geheimbotschaften im Werke Shakespeares ein neues scharfsinniges Werk erschienen.[48]
Es gibt eine europäische Kryptologie und Aenigmatologie am Rande der Literatur, aber auf die Literatur stärker einwirkend als der Nicht-Adept glaubt.[49] Die »Geheim«-Schriften stehen besonders im 16. und 17. Jahrhundert in hoher Blüte. Leonardo ist auch hier der unerreichte Ahnherr. Reuchlin hat eine Geheimschrift entworfen. Galilei schrieb an Kepler chiffrierte Briefe über seine Entdeckungen. Von Trittenheim gibt es eine »Polygraphia« mit »Clavis«. Meist handelt es sich um Buchstaben-Kryptogramme, d. h. jeder Buchstabe kann mit einem anderen vertauscht werden. Das berühmteste Chiffre-System hat Lord Francis Bacon entwickelt.[50] Dazu gehört schon ein »Alphabet mit zwei Buchstaben«. Bacon erläuterte sein System mit folgenden Worten: »Die Chiffre hat die Eigenschaft, dass durch sie irgendetwas als irgendetwas bezeichnet werden kann.« Hier findet man zumindest einen Schlüssel für die Mentalität Hamlets, für die Vertauschbarkeit von Leben und Spiel, von Traum und Wirklichkeit … im »Schnittpunkt« der »Phantasie«. Athanasius Kircher schuf die erste praktisch brauchbare Code-Schrift in seiner »Polygraphia nova et universalis« (Rom 1663), einem der heute am meisten gesuchten Bücher dieses unerschöpflichen deutschen Jesuiten. Ein Lehrbuch der Kryptografie schrieb (1665) ein anderer deutscher Jesuit, Gaspar Schott, die »Schola Stenographica«.
Novalis fragt: »Sollten … die Kräfte die Verba … Dechiffrierungskunst sein?«[51] Im 20. Jahrhundert entwirft Karl Jaspers seine Philosophie als ein System zum Lesen der »metaphysischen Chiffre-Schrift«.[52] Das Lesen von Poesie wurde schon früh zu einer Dechiffrierungskunst. Die Tendenz des Versteckens und Verbergens kann in extrem verspielten Fällen sogar zur »Poesie« des Rebus-Rätsels führen, wie in den »Sonetti figurati« von G. B. Palatino.[53]
Buchstaben-Zauberer
Arthur Rimbaud hat eine »Alchimie du Verbe« geschrieben und in einem Gedicht »Voyelles« die Farben der Vokale (z. B. A noir, E blanc usw.) durch Farben charakterisiert. In seiner »Alchimie du Verbe« schreibt er: »Je notais l’inexprimable« (Ich schrieb das Unaussprechbare nieder). »Ich erklärte meine magischen Sophismen mit der Halluzination der Wörter.«[54] Mallarmé hat den Dichter einen »Buchstabenzauberer« genannt und in einem Brief die »Alchimisten« als »Vorfahren« bezeichnet.[55] Kennzeichnungen von Buchstaben durch Farben findet man schon in alten tibetanischen Sekten. Über Buchstaben-Magie haben neben vielen anderen zeitgenössischen Autoren auch Jünger und Benn geschrieben. »Wenn Sie in Zukunft auf ein Gedicht stoßen«, empfiehlt Gottfried Benn, »nehmen Sie bitte einen Bleistift wie beim Kreuzworträtsel.« Der Dichter »besitzt einen Ariadnefaden«. Jeder Mensch hat ein besonderes Sensorium, »es gilt der Chiffre, ihrem gedruckten Bild, der schwarzen Letter, nur ihr allein«.[56] Der Erfinder des heutigen »Lettrisme«, Isidore Isoù (geb. 1925 in Rumänien), schreibt in einem Traktat: »Die Zentralidee des Lettrisme geht davon aus, dass es im Geiste nichts gibt, was nicht Buchstabe ist oder Buchstabe werden kann.«[57]
Die Traktatisten des literarischen Manierismus im 17. Jahrhundert empfehlen als besonders wirkungsvolle »maniera« ausdrücklich die künstliche Buchstaben- und Wortverbindung. Nichts darf einfach sein, schreibt Matteo Peregrini in seinem Traktat »Delle Acutezze« (1639), sondern es muss auf das »grandemente raro« geachtet werden, auf das höchst Seltene[58]. Concettistisches Schreiben heißt über »maniere di legamento« verfügen.[59] »Schöne Dinge werden gemacht.« Gottfried Benn schreibt: »Ein Gedicht wird gemacht.« Manieristisches Dichten heißt souveräne Beherrschung einer sprachlichen Verbindungskunst, ein wissendes, geistig bestimmtes Dichten. Daher wird Dichtkunst für Paul Valéry eine »fête de l’intellect«, eine Feier des Geistes.
Dichten hat im 17. Jahrhundert vielfach wenig mehr mit dem klassischen Mit-teilen zu tun. Dichten heißt in erster Linie ästhetisches Wirken durch sprachliche Kombinationen. Das ist eine weitere entscheidende Feststellung für den gesamten europäischen Manierismus, vom antiken »Phantasiai-Asianismus«, von der spätrömischen Literatur, von der spätmittelalterlichen Dichtung über die Epoche Góngoras, Marinos, Donnes, Shakespeares, Harsdörffers, der zweiten schlesischen Dichterschule bis zur romanischen und germanischen Frühromantik, zur »antiklassischen« und »anti-idyllischen« Lyrik von 1880 bis heute.[60] Das Mittel der Mitteilung, die Sprache, der Buchstabe, das Wort, die Metapher, der Satz, die Periode, die lyrische Sinnfigur (concetto) werden autonom. Es wird auf ihren ursprünglichen Funktionswert verzichtet. Novalis: »Die Kraft ist der unendliche Vokal, der Stoff der Konsonant.« »Es können Augenblicke kommen, wo ABC-Bücher … uns poetisch erscheinen.«
Das bewusste Hantieren mit »rein äußerlichen« Buchstaben-Kombinationen beobachtend, sind wir schon auf den Drang zur Verschlüsselung, Verdunkelung, Verstellung gestoßen. Wir fanden eine Grundtendenz: das bewusste, wissende, »machende« Dichten. Wir begegnen schon am Ende dieser Motivkette weiteren Elementen.
Virtuosität und Extremismus
Bewusstes Hantieren? Absichtliche Verschlüsselung! Es gibt auch eine andere Maniera, ja, eine artifizielle Manía der klanglichen Beziehungen im Sprachlichen. Der Kryptografie entspricht eine Art lyrisch-verblüffender Phono-Graphie. Einer unserer maßgebenden Literaturtheoretiker des 17. Jahrhunderts, Emanuele Tesauro, hat in seinem »Aristotelischen Fernrohr«[61] eine regelrechte Buchstaben-Ästhetik, ein phonetisches Instrumentarium für manieristische Virtuosen geschrieben.[62] Die Tonqualität aller Vokale und Konsonanten wird genau bezeichnet, klangmalerische Wirkungen, d. h. »Sympathien« und »Antipathien«, die zwischen Lauten bestehen, werden beschrieben, wirkungsvolle Klang-»Konkordanzen« und »Dissonanzen« empfohlen. Seitenlang werden alle erdenklichen »maniere« dargestellt. Das geht bis zum onomatopoetischen Extremismus einer puren Buchstabenlyrik, sozusagen eines Lettrisme avant la lettre. So preist Tesauro die »metrischen Noten« seines Zeitgenossen Mario Bettini, dessen Nachtigall-Gedicht, nach welchem man nicht mehr wisse, ob dieser Vogel ein Dichter sei oder der Dichter ein »rosignuolo«. Die von Tesauro zitierten Verse Bettinis lauten:
»Quitó, quitó, quitó, quitóquitó, quitó, quitó, quitó,zízízízízízízízíquoror tiú zquá pipiquè.«[63]
Das ist liebenswürdiger Extremismus, virtuoses Gesellschaftsspiel, oft nachgeahmt von den Nürnberger Pegnitzschäfern, die auch alle anderen pangrammatischen Künsteleien kennen.[64] Sie übernahmen diese vor allem aus Italien, insbesondere aus dem Werk Marinos, des Musterautors Tesauros.[65] Hier ein Beispiel aus Harsdörffers Schäferoper »Seelewig«:
»Welt-witterndes Wetter. Kriegnebelnde Düfte, mordgleißendes Eisen, brandschmauchende Not, blitzspeiende Keile, keilrollende Lüfte …«
Solche Bravourstücke nannte Harsdörffer bezeichnenderweise Ergebnisse einer »Vernunft-Kunst«.[66]
Leporismus
Durch den Vokalreichtum der Sprache erreichte man in Italien stärkere Effekte und kunstvollere Kombinationen. Schon am Anfang der wiederauflebenden antiken und mittelalterlichen Manierismen steht Luigi Groto (1541–1581) mit seinen »Rime«.[67] Er gehört zu den ersten und kühnsten Buchstaben- und Wort-Ingenieuren des italienischen 16. Jahrhunderts, Marino bewunderte ihn. Seine Glanzleistung ist ein Sonett mit 52 Reimen. Paul Valéry, der den leoninischen, den mehrsilbigen Reim schätzte, müsste Groto umso mehr in sein Pantheon aufgenommen haben, als dieser ausdrücklich erklärte, der Gegenstand eines Gedichts sei völlig gleichgültig. Hier nur die erste Strophe dieses berühmten Sonetts:
»A un tempo temo, e ardisco et ardo et agghiacciouando a l’aspetto del mio amor mi fermoe stando al suo cospetto, a l’hor poi fermo Godo, gemo, languisco, guardo e tacio.«[68]
Zu beachten sind auch die Alliterationen und im 4. Vers das Summationsschema. Ein vollendetes Beispiel für einen manieristischen Versifex.
Verwegener, ingeniöser, daidalisch im Sinne eines »fabbricare« von Versen, sehen die Erzeugnisse des italienischen Lyrikers Lodovico Leporeo aus, erschienen zu Rom im Jahre 1634. Sein an dichtende »Tollheit« grenzendes Hauptwerk heißt »Decadario Trimetro«, und man wird an Graciáns Wort erinnert, laut dem »jedes Talent (ingenio) einen Grad von Wahnsinn«, enthalte,[69] oder an Tesauros Sentenz, es seien im Grunde die Irren besonders geeignet, schöne (paralogische) Verse zu machen.[70] Leporeo nannte sich selbst einen »Erfinder der Alphabetischen Poesie«. Was bei Harsdörffer noch »Vernunftkunst« war, wird bei Leporeo durch ein Zusammentreffen von Virtuosität und Extremismus zu einem fast »modernen« verbalen Automatismus.
Der Autor erklärt in einem Vorwort zu seinem abstrusen Werk ausdrücklich, er habe sich vorgenommen, »die italienische Lyrik schwierig zu gestalten«. Die absichtsvolle Verdunkelung ist vielleicht nur von Mallarmé so offen ausgesprochen worden (»ajouter un peu d’obscurité«, etwas Dunkelheit hinzufügen). Leporeo will 110 »Zehner« in 1100 Versen bilden, um damit 3300 »Korrespondenzen« zu erhalten. Der Vokalklang ist »zentral«, der Inhalt nebensächlich; man kann konventionelle Themata nehmen; der sprachliche Effekt ist entscheidend. Nachfolgend eine »Deca-Tredeca-Sillaba«. Sie müsste den jungen Hugo Ball, als er noch Dadaist war und für die »magisch gebundene Vokabel« schwärmte, entzückt haben. Man muss das Gebilde allerdings mit den Ohren und mit den Augen aufnehmen, denn das Spiel mit Lauten lässt sich nicht übersetzen. Der Inhalt aber ist banal.
»Sudo ignudo, egro, e negro, entro una cellaCufa stufa, ove piove il grano e spilla,Mentre il ventre, ivi, a rivi, il sangue stilla,Grido e strido, asmo, spasmo, e muio in quella.«
Apollinaire, der (in »Alcools«) Worthyperbeln liebte, hätte gewiss an folgenden Versen unseres Virtuosen der »Alphabetischen Poesie« Gefallen gefunden:
»Non Bárbaro Reobárbaro, Barbáricopuò guarire il martir mio mio misentericoSe non mi sfoio, muoio Climaterico,Ne mi risána il male ána d’Agárico.«
Leporeo war zu seiner Zeit als leidenschaftlicher »Anti-Klassiker« Mitglied der »Accademia dei Fantastici«. Als Begründer der »neuen Poesie«, des »Leporismo«, wurde er ebenso bewundert wie gehasst.[71] Die antike Ästhetik der »Phantasia« wiederholt sich in seltsamer Landschaft.
Leporismus, wenn auch im edelsten Sinne, begegnet man im Werke eines der größten »modernen« Dichter Englands, in manchen Gedichten von Gerard Manley Hopkins (1844–1889). Es muss angenommen werden, dass Hopkins (als Jesuit) Graciáns Werke gekannt hat. Sein »Inscape«-Begriff entspricht dem »Disegno interno« Zuccaris. Der beste Freund von Hopkins, Robert Bridges, tadelte den »Manierismus« dieses einzigartigen Vorläufers der neueren »modernen« Poesie Englands. Hopkins hat diesen Manierismus als »parnassische Sprache« bezeichnet. »Alle manieristischen Schulen sind groß im Hervorbringen von Parnassischem.« Es sei allerdings nicht »im höchsten Sinne Dichtung«. Es werde »auf und von der geistigen Ebene eines Dichters gesprochen, nicht aus Inspiration«. Große Dichter hätten alle ihren eigenen »parnassischen Dialekt«. Darin liege ihr »Manierismus«. Es gebe jedoch eine höhere Art von manieristischem Parnassisch. Hopkins nennt Poesie dieser Art »kastalisch«. Den höchsten Rang nimmt die »delphische« Dichtung ein, mit ihrer Sprache des »heiligen Bezirks«.[72] Da es eine vorzügliche Übersetzung der Werke von Hopkins gibt, erscheint es angemessen, zu seinem manieristischen (parnassischen) »Leporismus« wenigstens zwei kurze Beispiele zu geben.
»Lass Leben, erloschen, oh lass Leben ab- Weifen seine ehdem gesträhnte geäderte Vielfalt auf, Ganz auf zwei Spulen; trenne, dränge, pferche Sein Alles nun in zwei Herden, zwei Hürden – schwarz-weiß; Recht, unrecht; erwäge nur noch, achte nur noch, Bedenke nur Noch diese zwei; merk eine Welt, wo nur diese zwei zählen, Eines abstößt das andere; einen Marter-Rocken, Wo selbstgewunden, selbstgebunden, Scheide- und schutzlos, Gedanken wider Gedanken dumpf ächzend Knirschen.«
Den letzten Vers noch in englischer Sprache, weil dann die Kombinatorik von Silben und Buchstaben (viel mehr als bloße Alliteration) stärker erkennbar wird: »Where, selfwrung, selfstrung, sheate – and – shelterless thoughts against thoughts in groans grind«.[73]
Sein Gedicht über die »Waldlerche« rückt ihn noch mehr in die Nähe von Leporeo oder Bettini – der auch Jesuit war. Die ersten vier Zeilen hier nur englisch:
»Teevo, cheevo cheevio chee: O where, what can thát be? Weedio-weedio: there again So tiny a trickle of sóng-strain.«
Dann aus der Mitte des Gedichts folgende Verse:
»The ear in milk, lush the sash,And crush-silk poppies aflash,The blood-gush blade-gashFlame-rash rudredBud shelling or broad-shedTatter-tassel-tangled and dingle-a-dangledDandy-hung dainty head.«
Die meisterhafte Übersetzung von Ursula Clemen lautet:
»Die Ähre milchreif, saftig die Schärpe, und knitter-seidiger Mohn aufblitzend, Das wie spritzendes Blut, klaffender Schwerthieb Flammen-rasch hochrot Die Knospe sprengende oder breit-gespreitete Fetzig-quastig-verwirrt und hin- und herbaumelnd Stutzerhaft hängende zierliche Haupt.«
Man vergleiche aus J. Peletiers (1517–1582) »Art Poétique« (1555) eine andere »parnassische« Nachahmung des Vogelsangs:
»Déclique un li clictisTretis petit fétisDu pli qu’ il multiplieIl siffle au floc floriDu buisson, favoritD’Eco qui le replie.«[74]
Schließlich einige Verse aus dem berühmten Lerchengedicht Giullaume du Bartas’ (1544–1590): »La gentile alouette avec son tirelire / Tire l’ire à l’ire e tire lirant tire / Vers la voute du ciel / Puis son vol vers ce lieu / Vire, et désire adieu Dieu, adieu Dieu.«[75] Und aus dem »Kleinen Bestiarium« von Johann Klaj (1616–1656):[76]
»Die Lerch trierieret ihr Tiretilier,es binken die Finken den Buhlen allhier.Die Frösche coaxen und wachsen in Lachen,rekrecken, mit Strecken sich lustiger machen,es kimmert und wimmert der Nachtigall Kind,sie pfeifet und schleifet mit künstlichem Wind.«
»Cabala simplex«
Johann Christoph Männling, der bereits genannte Literaturtheoretiker der zweiten schlesischen Dichterschule, preist seinerseits in seinem »Europäischen Helikon«: »Kabbalistische Kunststücke«.[77] Er belehrt über »eine neue Zierlichkeit, da man nach der Aritmetico des ABC setzt, und nach demselbigen eine Rahmensentenz oder Spruch ausrechnet«. Es handle sich um »Cabala simplex« und »communis« oder auch um »Poesia artificialis«. Männling ist sich also bewusst, dass er sich schon sehr weit von der noch mythischen Kabbala, von der noch Näheres zu lesen sein wird, entfernt hat. »Cabala simplex!« Männling bietet eine Tabelle mit Buchstaben- und Zahlenreihen zur künstlichen Erzeugung von Spruch- und Namenpoesie. Er macht selbst auf diese Weise ein Gedicht und nennt das Ganze einen »Spiegel«, der »uns die Seligkeit und wahres Leben zeigt«.[78] Wir werden an Parmigianinos Selbstporträt im Konvexspiegel erinnert, am Anfang des neuzeitlichen Manierismus.
Männling lobt auch andere »Paragrammata«, so z. B. Palindrome, »Rücklinge«, Sätze, die man von vor- und rückwärts lesen kann. Sie wurden zwischen 1910 und 1920 im Zusammenhang mit dem literarischen »Konstruktivismus«, vor allem in Russland, wieder Mode. Solche »Rücklinge« sind in deutscher Sprache schwierig. Männling gibt ein Beispiel: »Gewiss sie rette, reiß sie weg.« Aus dem Englischen: »Madam, I’m Adam«. Oder: »Was it a cat I saw«. Ein anderes von Schopenhauer lautet: »Ein Neger mit Gazelle zagt im Regen nie.« In der zeitgenössischen modernen Dichtung Frankreichs hat man ganze Gedichte in der Form von Rücklingen verfasst. Dafür nur ein Beispiel und zwar »Adam« in drei Phasen:
»Un Nu / Né de l’Eden / Noble, bei, bon.«[79]
Rein »assoziative Kunst« dieser Art hat Hugo Ball nach seiner dadaistischen Zeit, als »Blendwerk und Diabolik« bezeichnet. »Eine rein bildnerische Antithese zur Natur und zum Geschehen ist nicht aufrechtzuerhalten.«[80]
Wir haben es hier wieder mit »sinnfreien Lineaturen«[81] zu tun, mit solchen grotesker Art, wie sie uns aus der Geschichte der manieristischen Kunst bekannt sind. Die (oder das) Groteske wird heute von der Literaturwissenschaft als kontinuierliche »Gattung« in der europäischen Literaturgeschichte angesehen.[82] Sie gehört seit der Antike zu einem der beliebten Ausdrucksmittel des Manierismus. Die kunstvolle Irregularität des Asianismus steht gegen die kunstvolle Regularität des Attizismus! »Witz (ingenio) ist das spielende Anagramm der Natur«, schreibt Jean Paul in der »Vorschule der Ästhetik«, »die Phantasie ist das Hieroglyphen-Alphabet derselben«. Phanta-»siai«! »Der wahre Reiz des Wortspiels« ist nach Jean Paul »das Erstaunen über den Zufall, der durch die Welt zieht, spielend mit Klängen und Weltteilen«, die »daraus vorleuchtende Geistesfreiheit, welche imstande ist, den Blick von der Sache zu wenden gegen ihr Zeichen hin«.[83] Elementare Strukturen dieser Art überdauern, in rein formaler Hinsicht, wechselnde epochale Stilmoden und verschiedenartige historische Situationen.
Von Z–A und von A–Z
Neo-rhetorisch erscheint z. B. das »pangrammatische« Gedicht eines der bedeutendsten zeitgenössischen Lyriker Italiens, Edoardo Cacciatore, in seinem Gedichtband »La Restituzione«.[84] Der erste Buchstabe des ersten Worts ist »Z«; jeder weitere Anfangsbuchstabe des ersten Worts der nächsten Zeile folgt der Reihenfolge des Alphabets bis A. Jeder Vers weist außerdem starke Alliterationen auf. Sie werden von den jeweiligen ersten Buchstaben des ersten Worts lautlich bestimmt. Nachfolgend als Beispiel die ersten vier Verse, als lyrische Buchstaben-»Musik« zu werten.
»Zampilla uno zodiaco da ogni zeroVieni vieni verso la via che va al veroUnisci l’udito all’unanime universoTempera alla tastiera un tuo tema terso.« usw.
Quirin Kuhlmann (1651–1689) schreibt ein »Güldenes Leben – ABC des Freitags«. Er freilich geht noch von A–Z, nicht von Z bis A. Der formale Manierismus also ist der gleiche, aber unsere »Moderne« irrationalisiert ihn, wie wir noch deutlicher sehen werden; sie stellt ihn auf den Kopf. So schrieben Vertreter der russischen Avantgarde des 20. Jahrhunderts »Rücklinge«, Verse, die man, wie wir wissen, auch von hinten nach vorn lesen kann, und sie malten Bilder, die, auf den Kopf gestellt, ebenso einen »Sinn« ergeben wie in normaler Lage.
Die letzten vier Verse des Gedichts Quirin Kuhlmanns lauten:
»Wahrhaftig wie der ist, von dem du,Mensch, bist worden,X gleichend, dem das X entreißt denKreuzesorden,Y ähnlich, Drei in eins, im Gottesbilde nett,Zeitleer an Jesus Brust, der sei DeinA und Z.«[85]
Worte ohne Folge
Im zeitgenössischen Frankreich wurde die Buchstaben-Lyrik enthusiastisch wieder aufgegriffen, allerdings meist als aggressives Mittel gegen klassizistische Ästhetik, gegen nur sentimentale Romantik und akademische Routine. Die »alogischen« Silbenassoziationen des Dadaismus regten zu einer Nonsense-Poesie an, die schließlich im »Lettrisme«, dessen spezifische Merkmale wir auch zur Unterscheidung noch kennenlernen werden, verendete. In einem Gedicht »Die Arbeit des Dichters« von Paul Eluard (1895–1952) heißt es voller Wehmut: »On arrive bien vite / aux mots égaux / aux mots sans poids / Puis / aux mots sans suite.«[86] Doch Eluard, der wie Apollinaire noch die hermetische Tradition kennt, findet immer wieder zu den eleganten Vorbildern der Preziosität zurück, zu den Preziösen des 17. Jahrhunderts.[87] Viele seiner schönsten Verse überwinden daher alles »Zufällige« des automatischen Schreibens, der literarischen Haussitte der Surrealisten. Eine derart doppelt »gekünstelte« Manier ist unverkennbar in Versen wie:
»Mais l’eau douce bougePour ce qui la touche,Pour le poisson, pour le nageur, pour le bateau,Qu’elle parteEt qu’elle emporte.«[88]
Antonin Artaud (1896–1948) lässt den »lettristischen« Desintegrationsprozess in einer einzigen typischen Strophe sichtbar werden. Man erkennt, wie die Sprache und die Klangkombination zerfallen. Das Prinzip der bloßen Klangwirkungen bleibt erhalten, aber die bindende Versstruktur wird aufgegeben. Und schließlich noch der Wortkörper selbst:
»Tout vrai langage / est incompréhensible, / comme la claque / du claque dents; / ou le claque (bordel) / du fémur à dents, (en sang) / faux / de la douleur sciée de l’os. / Dakantala / dakis ketel / to redaba / ta redabel / de stra muntils / o ept enis / e ept astra«.[89]
Der Uhren-Kleber
Der deutsche Lyriker Hans Magnus Enzensberger (geb. 1929), einer der erstaunlichsten Sprach-Alchimisten der neuen Generation in Deutschland, schreibt ein Gedicht: »Bildzeitung«. Darin findet man »Markenstecher-Uhrenkleber« und »Manitypisten-Stenoküre«.[90] Der Franzose Jacques Prévert (geb. 1900) hat ganze Gedichte nach diesem Prinzip gemacht: so z. B.: »Ein Greis in Gold mit einer Uhr in Trauer«, »ein Professor für Porzellan mit einem Flicker von Philosophie«; »ein Feldwebel in Schaum mit einer Pfeife im Ruhestand« usw.[91] Doch schon Morgenstern, Apollinaire und Hans Arp sind darin Meister. Auch Morgenstern wollte »die Sprache zerbrechen«. Der Mensch erschien ihm als »im Spiegelkerker gefangen«. Morgenstern erfindet Wort-»Phantasiai«: »Ein Stiefel wandern und sein Knecht / von Knickebühl gen Entebrecht«. Ähnliche Beispiele findet man in seinem Werk oft. Hans Arp kommt auf: »Kakadu-Kakasie« und auf »Schneewittchen-Hagelwittchen«; dann meint er: »Solches Kopfzerbrechen erklärt die Unzahl zerbrochener Köpfe«.[92] In Apollinaires »Alcools« findet man zahllose Buchstaben-und Wortspiele. Apollinaire (jüdisch-polnischer Herkunft, in Rom geboren, Wahl-Franzose) hat, was melancholische Brillanz und Neuerungssucht angeht, etwas von einem Erz-Neapolitaner zur Zeit Marinos und Lubranos. Er stellt ausdrücklich fest: »Die Überraschung (surprise) und das Unerwartete gehören zu den wichtigsten Anregern der heutigen Poesie.«[93] Marino hatte »stupore« empfohlen und die »bizzarria della novità«.[94]
3. Irreguläre Poesie
Die »Hétéroclites«
Literaturgeschichtlich kann man solche »Poesie« formelhaft als desintegrierten Leporismus bezeichnen. Doch haben Artaud und andere französische Lettristen im eigenen Lande Vorbilder. Italiens poeti bizarri (wie Groto, Leporeo u. v. a. heißen in Frankreich »poètes hétéroclytes« (unregelmäßig, irregulär). Es ist das Verdienst von Raymond Queneau in einer Sondernummer der Zeitschrift »Bizarre«, vergessene Ahnen der heutigen »Hétéroclites« entdeckt und eine ganze Galerie von bisher unbekannten Vertretern dieser ver-rückenden Wortverstellungs-Kunst vorgestellt zu haben.[95] Einer dieser französischen Ahnherren des »Irregulären« heißt Louis de Neufgermain. Er lebte – wie zu erwarten war – im 17. Jahrhundert. 1630 veröffentlichte er zu Paris ein Buch »Poésies et Rencontres«. Wir finden darin Buchstabengedichte, Buchstaben- und Silbenkombinationen, uns jetzt schon bekannte Produkte des Leporismus und auch des gerade damals in Paris geschätzten Marinismus. Für einen Monsieur Lope schreibt er ein »bizarres« Gedicht, von dem wir nur die letzten drei Verse zitieren:
»Vous lipus, liplopants, qui liplopez liplope,Langage liploplier par les syllabes lope,Lope est un nom d’héros, et cet héros est Lope.«
Schon Rabelais bietet solche Monstrositäten, man findet sie in der satirischen Literatur von Johann Fischart bis Cyrano de Bergerac. Parallelen in der bildenden Kunst, die »Bizzarrie« von Bracelli, die groteske Ornamentik und die »Zierseuche« des Ornamentstichs im 17. Jahrhundert haben wir kennengelernt.[96]
Alles findet ein »System«, auch das Abstruse. Die paralogischen Dichter der Poesia Alfabetica im 17. Jahrhundert bewegten sich – auch als »Extremisten« – noch in einem ästhetischen System, wenn auch in einem irregulären. Die Desintegration, von der noch mehr zu sagen sein wird, erreicht mit dem Dadaismus und seinen Nachahmern den Nullpunkt. Doch regt auch diese totale Irrationalisierung zur methodischen Erklärung, zur systematischen »Erfassung« an. Immer wieder wird bekanntlich auch im »Manierismus« eine Ordnung gesucht, allerdings eine Ordnung sehr eigener Art.
Spiel der Homonyme
Als Vorläufer des zeitgenössischen Lettrisme glaubte ein französischer Philologe, Professor Jean Pierre Brisset, sogar eine neue Weltordnung aus Buchstabenkombinationen gefunden zu haben, und zwar viele Jahre vor dem Dadaismus. Sein System der Weltaufschlüsselung durch Buchstaben- und Silbenkombinatorik hat, laut Breton, die verbalistische »Pataphysik« Alpred Jarrys angeregt, die »Paranoia-Kritik« Salvador Dalis, die Lyrik Raymond Roussels, Robert Desnos’ und Marcel Duchamps. Es wird vor allem James Joyce genannt, dessen Werk sicherlich den Höhepunkt der europäischen Alchimie du Verbe darstellt.[97]
Brisset findet geheime metaphysische »Entsprechungen«, wenn man Worte auf folgende Weise verstellt (dislocation):
Les dents, la bouche.Les dents, la bouchent,L’aidant la bouche.L’aides en la bouche.L’aide en la bouche.Laid dans la bouche.Lait dans la bouche.L’est dam á bouche.Les dents – la bouche.
Aus Je sais que c’est bien wird (je oder) jeu sexe est bien.
Es handelt sich, um mit alten rhetorischen Begriffen zu sprechen, um Wortnetze von Homonymen (gleichnamige, gleich oder ähnlich lautende Wörter von ganz verschiedener Bedeutung und etymologischer Herkunft bei gleicher oder abweichender Schreibweise). Sie sind gerade im Französischen zahlreich (saint, sain, sein, cinq). Hinzu kommen: »Diaphora«, d. h. Kombinationen mit den verschiedenen Bedeutungen und Verwendungsarten eines Wortes, Wiederholung mit Abwandlung des Sinnes; Amphibolie, d. h. Doppelsinn, Zwei- oder Mehrdeutigkeit der logischen Aussage eines Satzes; Paronomasie, Zusammenstellung gleichlautender oder ähnlicher Wörter von verschiedener oder entgegengesetzter Bedeutung (Rheinstrom-Peinstrom, Bistümer–Wüsttümer. Wir erhalten also eine Reihe weiterer formaler Manierismen. Während sie in älteren Literaturen vielfach noch einer »Aussage« dienten (Wortspiel), sollen heute »gegenstandslose« Wortnetze ähnlicher Art lyrische Stimmungen erwecken, in ein irreales Anderssein führen. James Joyce, in dessen letzten Werken weite Strecken mit großartigem Können und sprachlichem Wissen, wenigstens in elementaren Bezügen, auf das Verfahren solcher Kombination gegründet sind, erreicht damit, vor allem, wenn er auch die verschiedensten Sprachen mischt, erstaunliche Wirkungen. Er schuf sich seine eigene Kunstsprache.[98]
Wortnetze
James Joyce ist ein Sonderfall, durch einzigartige sprachliche Kraft, durch künstlerisches Vermögen, durch subtilen persönlichen Wahn-Sinn. Die alte Buchstabenlyrik aber ist in der zeitgenössischen Lyrik ganz Europas, von weniger Begabten gehandhabt, zu einer »Manier« geworden, die der alten »Zierseuche« des Ornamentstils in neuer, literarisch gegenstandslosen Weise entspricht. Vom Dadaismus der »Metapoetik« eines Altagor in Frankreich bis zum »Imaginismus« jesenins und zu den transmentalen Buchstabengedichten Chlèbnikows in der avantgardistischen Lyrik Russlands von 1920 bis 1925 geht eine Linie. Sie führt über das 17. Jahrhundert zurück nach Alexandrien. Nur nach Alexandrien? Warten wir ab! Fragen wir uns hier erst noch: Kann man ein solches historisches und universales Phänomen nur negativ werten? Handelt es sich in allen Fällen um Täuschung oder um Epigonentum? Schon das letztlich unergründliche Spätwerk James Joyces spricht dagegen. Auch einzelne, im echtesten Sinne durchaus »erschütterte« Vertreter der russischen Dichtung während der ersten Revolutionsjahre, zur Zeit also, als ein parteipolitischer Rigorismus den Geist noch nicht in den Dienst des »sozialistischen Realismus« gestellt hatte, beweisen, dass man es nicht nur mit Bürgerschreck oder mit einem irrationalen Jargon bloßer Verzweiflungsschreie in einer Welt im Übergang zu tun hat.
Der russische Geist stand immer Alexandrien und Byzanz näher als Athen. Velenier Wladimirovitsch Chlèbnikow (1885–1922) z. B. wollte eine universale Ursprache, wie Jakob Böhme eine adamische Sprache, wiederherstellen. Sie sollte gebildet werden aus der symbolischen Bedeutung, die jeder Buchstabe habe, aus einem mythischen Chiffre-Alphabet also. Eine Wortmagie dieser Art nährte dann seinen Metaphernschatz.
Auch in der jüngsten deutschen Literatur findet man viele Beispiele für Buchstaben-Kombinationen, so etwa von Weinheber Gedichte ohne e oder ohne s, usw. (»Hier ist das Wort«). In Brocks »Kotflügel-Wortkonzert in durchgeführter Sprache« liest man: »Spektralkonstruktion OBA FGKMRN / O Be A Fine Girl Kiss Me Right Now«.[99] Den Sinn der »Wirklichkeit in Vokalen« beschreibt Karl Krolow in einem seiner schönsten Gedichte.[100]
Worte
Einfalt erfundener Worte, Die man hinter Türen spricht, Aus Fenstern und gegen die Mauern, Gekalkt mit geduldigem Licht.
Wirklichkeit von Vokabeln, Von zwei Silben oder von drei’n: Aus den Rätseln des Himmels geschnitten, Aus einer Ader im Stein.
Entzifferung fremder Gesichter Mit Blitzen unter der Haut, Mit Barten, in denen der Wind steht, Durch einen geflüsterten Laut.
Vokale, – geringe Insekten, Unsichtbar über der Luft, Fallen als Asche nieder, bleiben als Quittenduft.
Immer wieder begegnen wir, wie in der manieristischen Kunst, schon in unserem einleitenden Alphabet – dem Zwiespalt: auf der einen Seite dem Streben nach sinnerschließender Gnosis, auf der anderen der sinnfreien, wenn nicht sinnlosen Virtuosität. Wir erwähnten, dass Hugo Ball in seiner frühen Züricher Zeit mit der »magisch gebundenen Vokabel« einen Kult trieb und selbst lettristische Gedichte schrieb. Später hat er das alles verdammt. »Die Metapher, die Imagination und die Magie selbst, die nicht auf Offenbarung und Tradition gegründet sind, verkürzen und garantieren nur die Wege zum Nichts. Sie sind Blendwerk und Diabolik. Vielleicht ist die ganze assoziative Kunst ein Selbstbetrug.«[101]
Der Sprachmantel Gottes
Solche Kontraste drücken in der Geschichte des europäischen Geistes latente Urspannungen aus. Nur selten brechen sie hervor, in chaotischen Stilrevolutionen und in scharfen Reaktionen dagegen. Die Dialektik hat sich gerade in den letzten dreihundert Jahren der europäischen Literatur immer mehr zugespitzt. Sie gewann schließlich, wie wir immer genauer sehen werden, einen ebenso dramatischen wie tragikomischen Charakter. Die manieristischen Autoren, wir müssen es immer wiederholen, finden ihre Urbilder nicht im »klassischen«, attizistischen Altertum, sondern in der orientalischen, semitischen, in der »asianischen« Antike der »Phantasiai«. Der ägyptische, chaldäische und hebräische Symbolismus (Bibel, Schriftexegese, Talmud, die spätere Kabbala, die alchimistische Literatur) haben schon den Neuplatonismus Alexandriens und den erneuerten Neuplatonismus von Florenz zur Zeit Marsilio Ficinos beeinflusst.[102] Es ist bekannt, dass der alexandrinische Neuplatonismus den »Asianismus« förderte, d. h. jene hyperbolische, extremistische Stilrichtung, die den Attizismus missachtete. In der Geschichte der manieristischen Kunst wird der »Subjektivismus« der antiklassischen Idea-Lehre (Zuccari) durch den florentinischen Neuplatonismus und kabbalistischen »Alchimismus« angeregt. Auch der Dichter Marino, das Haupt und Idol aller Marinisten im 17. Jahrhundert, beruft sich auf die Idea-Lehre und preist Ficino als »Geheimkämmerer Gottes«.
Doch wie die Klassizisten »klassische« Mythen benutzen, ohne deren ganzen Sinn gegenwärtig zu haben, Apollo und Demeter auftreten und reden lassen, als ob sie Puppen-Figuren wären, so geht schon im spätantiken Asianismus das Wissen um die ebenso tiefen wie reichen mythischen Hintergründe der semitischen Buchstabenmystik verloren. Die Spätlinge greifen mit zu kurzen Armen nach dem Sprachmantel Gottes.
Buchstabenmystik
Jede Hieroglyphe war für die Ägypter Bild eines Gotteswortes. Für die Juden hatten Buchstabe und Schrift nicht nur einen göttlichen Ursprung. Sie führten – symbolisch und kombinatorisch – auf Gott zurück. Der Buchstabe Aleph zum Beispiel bedeutete ganz bildhaft Gott.[103] In der orientalischen und graeco-orientalischen Literatur der Antike wimmelt es von Theologien, Kosmogonien, Angelologien und Anthropologien aufgrund von Buchstabenkombinationen der verschiedensten Art. Für den Alchimisten Zosimos hatten Buchstaben Eigenschaften, und sie verteilten Eigenschaften.
Die esoterische Buchstabenmystik der orientalischen Urantike ist (wie die chinesische) in erster Linie theognostisch. Sie bildete Elemente der Mystik, der Magie, der heilenden und bewältigenden Magie, aber auch der gottrufenden, der evokativen Klangmagie. Mit Buchstaben konnte man zaubern und verzaubern. Verzaubern durch den bloßen Klang von Buchstaben? »In Ägypten preisen die Priester sogar die Götter durch die sieben Vokale, indem sie diese der Reihe nach ertönen lassen, und statt Aulos und Kithara wird der Schall dieser Buchstaben gehört wegen ihres Wohlklanges.«[104]
In dieser theologischen Buchstaben-Kryptografie wurden ganze Systeme von Buchstabensymbolen entworfen. Im unergründlichsten Buch der jüdischen Kabbala, im Sepher Jetzira, bildete Elohim sein Universum mit den drei Büchern: Sepher (die Schrift), Sopher (die Zahl) und Siphur (das Wort). Also: Universum, Zeit, Körper. Von den Sephiros, die Elohim erschafft, hat der »Geist des Geistes« »22 Buchstaben geschnitten und in Stein gebildet«: Diese 22 Buchstaben sind die Grundlagen der drei Mütter, der sieben Doppelten und der zwölf Einfachen. Aus ihnen ist die ganze Welt gebildet. Das Alphabet wird zu einem kosmischen Chiffre-System.[105]
Lettristische Permutationen hatten auch im bloßen Klang von Buchstaben und Buchstabengruppen noch einen transzendentalen Sinn. Um 1150 v. Chr. machte man in Ägypten die »Entdeckung«, dass die wirksamste Gestalt des Urgott-Namens aus absolut sinnlosen Zusammenstellungen von Buchstaben bestünde. Sogar das »Zungenreden« ergab also mythischen Sinn. Auf diese Weise glaubte man eine »chemisch reine Gottheit« zu erhalten. Die spätere kabbalistische Bezeichnung Ziruph für Buchstabenversetzung bedeutet auch »Schmelzung«. Durch Buchstaben-Permutationen schmilzt man also gewissermaßen das Urwesen ein.
Es gab bestimmte Techniken dazu, so etwa die uns schon bekannten Palindrome, Rücklinge oder Krebsworte, die Kaimata (Worte werden untereinandergeschrieben, wobei man jedes Mal einen Buchstaben weglässt, z. B. unser schon zitiertes Amore, more, ore, re[106]