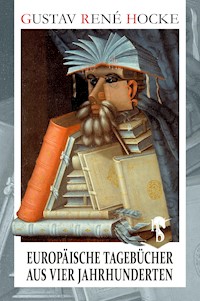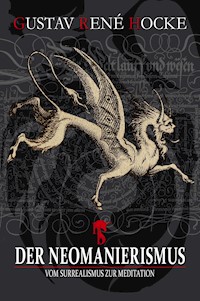9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Märchen, Traum- und Zauberwelten, Horror, Wahnsinn und das Abstruse … Phantastische Kunst und Literatur ist keine Erfindung unserer Zeit: Es gibt sie, seitdem Menschen künstlerisch tätig sind. In seinem originellen und atemberaubenden Streifzug durch die Kunst- und Literaturgeschichte Europas legt Gustav René Hocke anhand seines beeindruckenden Wissens den kulturgeschichtlichen Strang der Phantastik oder des Manierismus frei, der sich von der Antike bis in unsere heutige Zeit wie ein Roter Faden durch alle Epochen europäischer Kunstgeschichte zieht, bis er in unserer Zeit zu einer dominierenden Kunstform aufblüht. »Die Welt als Labyrinth«, Band 1 der Manierismus-Bibliothek von Gustav René Hocke, behandelt die Kunst und ist nun erstmals als E-Book erhältlich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 487
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Gustav René Hocke
Die Welt als Labyrinth
Manier und Manie in der europäischen Kunst
Beiträge zur Ikonografie und Formgeschichte der europäischen Kunst von 1520 bis 1650 und der Gegenwart
»Keine Realität ist wesentlicher für unsere Selbstvergewisserung als die Geschichte. Sie zeigt uns den weitesten Horizont der Menschheit, bringt uns die unser Leben begründenden Gehalte der Überlieferung, zeigt uns die Maßstäbe für das Gegenwärtige, befreit uns aus der bewusstlosen Gebundenheit an das eigene Zeitalter, lehrt uns den Menschen in seinen höchsten Möglichkeiten und in seinen unvergänglichen Schöpfungen sehen. – Unsere Muße können wir nicht besser verwenden, als mit den Herrlichkeiten der Vergangenheit vertraut zu werden und vertraut zu bleiben und das Unheil zu sehen, in dem alles zugrunde ging. Was wir gegenwärtig erfahren, verstehen wir besser im Spiegel der Geschichte. Was die Geschichte überliefert, wird uns lebendig aus unserem eigenen Zeitalter. Unser Leben geht voran in der wechselseitigen Erhellung von Vergangenheit und Gegenwart.«
Karl Jaspers
Erster Teil
Einführung als Vorwort
Zauber des Spiegels
Der französische Dichter Paul Eluard, von allen europäischen Surrealisten mit dem besten »inneren« Sehnerv ausgestattet, schließt sein Gedicht »Sterben« mit dem Dreizeiler: »Zwischen den Mauern lastet ganz der Schatten / Und ich steige hinab in meinen Spiegel / Wie ein Toter in sein offenes Grab.« Im Werk des Mitbegründers des Dadaismus, Tristan Tzara, findet man den Vers: »Spiegel, Früchte der Ängste«, und der zeitgenössische amerikanische Lyriker E. E. Cummings berichtet in einem Gedicht »Impression«: »Im Spiegel / sehe ich einen zarten / Mann / träumend Träume, Träume im Spiegeln Nach Hermann Bahr wollten Hofmannsthal, Rilke und George »die Welt im Spiegel sehen«. In der expressionistischen und surrealistischen Kunst von heute wimmelt es von Spiegeln und Gespiegelten, von Spiegelungen und Zerr-Spiegeltheiten.
Spiegelmetaphern findet man seit der Antike in der Literatur oft. Sie sind besonders beliebt im Hellenismus und im Mittelalter. Nach der Hochrenaissance, im »Manierismus«, wird diese Metapher fast zu einer Halluzination, wie Motive der Angst, des Todes, der Zeit. Das Gleiche gilt, wie G. F. Hartlaub in seinem Buch »Zauber des Spiegels« [1] nachgewiesen hat, für die Kunst. Wenn Plato die Tätigkeit des Künstlers mit einem Abspiegeln der Dinge verglich, so rief Leonardo in einem ganz anderen Sinne aus: »Der Spiegel ist unser Lehrmeister«. Am Aufgang der Neuzeit wird der Spiegel geradezu zu einem Symbol für die »Problematik« des »modernen«, des nachmittelalterlichen Geistes. Modern? Das Wort wird ab 1520 in einem sehr ähnlichen Sinne wie heute gebraucht. Vincenzo Galilei, der Vater des großen Anregers zu einer empirischen Naturwissenschaft, schreibt 1581 einen »Dialog zwischen der antiken und modernen Musik«. Rund sechzig Jahre später tadelt der italienische Literat Lorenzo Stellato die »modernen« Übertreibungen in der Poesie seiner Zeit.
Der Spiegel wird nicht nur zur Bestätigung einer neu gewonnenen Subjektivität. Er gibt vielmehr die Möglichkeit einer Kombination von Spiegeln. Als Leonardo in Rom weilte, wollte er eine achteckige Spiegelkammer bauen, ein optisches Labyrinth. Die unendliche Spiegelung ist die Vorläuferin des abstrakten Labyrinths der totalen Irrealität. Zahllose Möglichkeiten finden sich, Labyrinthe als Gegenpole alles »Durchschaubaren« aufzuzeichnen. In der neu gewonnenen Freiheit wird das »Wahrscheinliche«, das unmittelbar Verständliche, im Sinne der aristotelischen Regeln, kein bindendes Kriterium mehr. Es gibt nicht nur zwei Wahrheiten (Fideismus), es gibt mehrere, ja zahllose (Pyrrhonismus), und sie verlieren sich in der Undurchdringlichkeit des Labyrinths. Im letzten Sinne »wahr« seiend, wird schließlich nur noch das sich in seinem Denken spiegelnde Subjekt selbst (Descartes). Davon wird später in einer konkreteren Weise die Rede sein. Lesen wir vorerst noch einmal den Vers von Cummings: »träumend Träume, Träume im Spiegel«, und wenden wir diesen Spiegel auf einen »zarten Mann«, der 400 Jahre vorher gelebt hat. Wir haben zeitlich am Ende begonnen, wir wollen von vorne anfangen … In Italien. Dort und damals fing Europas »Moderne« an.
Ein europäisches Phänomen
Francesco Mazzola aus Parma, genannt »Il Parmigianino«, stellte sich im Jahre 1523 vor einen Konvexspiegel und malte ein verblüffendes Selbstporträt. Es geschah dies am Anfang einer neuen modischen Stilgewohnheit, die den Namen Manierismus erhielt. Für die Dauer von 150 Jahren sollte diese Pointenkunst das geistige und gesellschaftliche Leben von Rom bis Amsterdam, von Madrid bis Prag bestimmen. Das maskenhaft schöne Jünglingsgesicht Mazzolas ist glatt, undurchdringlich, rätselhaft; fast abstrakt wirkt es durch die Aufgelöstheit der Flächen. In der perspektivischen Verzerrung des Konvexspiegels wird der Vordergrund von einer riesigen, anatomisch allerdings abstrusen Hand beherrscht. Der Raum dreht sich in einer schwindelerregenden konvulsivischen Bewegung. Nur ein schmaler, ebenfalls verzerrter Teil des Fensters wird sichtbar; er bildet ein verbogenes langschenkliges Dreieck, und Licht und Schatten scheinen seltsame Zeichen in ihm zu erzeugen, staunenerregende Hieroglyphen. Das medaillonartige Bild stellt sich als Illustration zu einer geistreichen Formel dar. Es ist, um mit einem Begriff dieser Zeit zu sprechen, ein ingeniöses Concetto, eine scharfsinnige Pointenfigur, in optischer Form. Inhaltliche und formale Bestimmungen enthält es, die man zwischen 1520 und 1650 in der Kunst wie in der Literatur des damaligen Europa beachten musste, um modern zu sein. Einer der italienischen Theoretiker, Peregrini, nannte in seinem Traktat über die Sinnfiguren (»Trattato delle acutezze« 1639) deren sieben: »das Unglaubliche, das Zweideutige, das Gegensätzliche, die dunkle Metapher, die Anspielung, das Scharfsinnige, den Sophismus«. Das Bild ist nicht nur das Porträt des früh verstorbenen Parmigianino. Es weist über diese Epoche hinaus auf den manieristischen Menschentypus, auf den geistvoll-melancholischen Dandy, dessen ganzes Streben, nach Baudelaire, darauf gerichtet sein müsse, »erhaben zu sein«, »vor einem Spiegel zu leben und zu schlafen« (»Mein entblößtes Herz«). Die merkwürdige Tendenz von mehreren Generationen in diesem damals politisch so chaotischen Zeitalter Europas enthüllt es: den Drang nach dem Absonderlichen, nach dem Exklusiven, nach Extravaganz, nach dem Verborgenen jenseits und innerhalb der physischen, »natürlichen« Wirklichkeit, auch nach gesellschaftlicher Absonderung, nach aristokratischer Sonderstellung. Legitimiert wird sie durch das »scharfsinnige« Talent, und dieses fühlt sich nicht mehr an einen klassischen Kanon gebunden. [René Magritte: »Perpetuum Mobile«. Das Gespiegelte wird zum Spiegel.]
Dieser Menschentypus, der die Unmittelbarkeit scheut, die Dunkelheit liebt, sinnliche Bildhaftigkeit nur in der verkleidenden abstrusen Metapher gelten lässt, der das wunderlich (meraviglia) Überreale in das intellektuelle Zeichensystem einer äußerst stilisierten Sprache einzufangen sucht, ist weder historisch noch soziologisch ein Sonderling und erst recht keine Originalfigur. Er tritt im Zusammenhang mit einer problematisch gewordenen religiösen und politischen Wertordnung in bestimmten Phasen der europäischen Geistesgeschichte immer wieder auf, und zwar stets innerhalb einer mehr oder weniger »alexandrinischen« Kultur, an Höfen, in bürgerlichen Salons oder in den Konventikeln der Bohème. Ernst Robert Curtius hat den Begriff Manierismus, mit welchem im 16. Jahrhundert Vasari die künstlerische Ausdrucksweise des späteren Michelangelo kennzeichnete (maniera) – weil sie von der klassischen Harmonievorstellung abwich – historisch erweitert. In seinen (für die literarhistorische Manierismus-Forschung) wegweisenden Untersuchungen (Kapitel »Manierismus« in seinem Buch »Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter«)[2] schlägt Curtius vor, den Begriff Manierismus zu wählen »für alle literarischen Tendenzen, die der Klassik entgegengesetzt sind, mögen sie vorklassisch oder nachklassisch oder mit irgendeiner Klassik gleichzeitig sein«. In diesem Sinne sei »der Manierismus eine Konstante der europäischen Literatur«, »die Komplementär-Erscheinung zur Klassik aller Epochen«. Seine Höhepunkte finde man in der Spätantike, im Mittelalter, im 16. und 17. Jahrhundert. »Vieles von dem, was wir als Manierismus bezeichnen, wird heute als »Barock« gebucht. Mit diesem Wort ist aber so viel Verwirrung angerichtet worden, dass man es besser ausschaltet. Das Wort Manierismus verdient auch deshalb den Vorzug, weil es, verglichen mit »Barock«, nur ein Minimum von geschichtlichen Assoziationen enthält.« Wie Benedetto Croce weist Curtius auch kurz auf Parallelen im 20. Jahrhundert hin. Auch Eugenio d’Ors war in seinem Buch über das Barock in formenkundlicher Hinsicht zu dem Ergebnis gekommen, dass der »barocke« Stil sich, alternierend mit dem »klassischen« Stil, in der gesamten Geistesgeschichte nachweisen lasse. Er unterscheidet – von der Vorzeit angefangen – 22 Barockarten[3].
Wir stehen somit vor einem gefährlichen »embarras de richesse«. Es ist daher unumgänglich, sich schon in dieser Einführung um klare Abgrenzungen zu bemühen. Nach neueren Untersuchungen erscheint dies relativ einfach. Hier sollen zunächst jedoch nur elementare Strukturen aufgedeckt werden. In der späteren Darstellung müssten sie dann durch die Analyse der einzelnen Phänomene reicher ausgebaut werden. Wir folgen also Curtius, wenn wir – anstatt der Bezeichnung »Barock« – den Begriff »Manierismus« wählen für alle künstlerischen und literarischen Tendenzen, »die der Klassik entgegengesetzt sind, mögen sie vorklassisch oder nachklassisch oder mit irgendeiner Klassik gleichzeitig sein«, wir verzichten also auf die zeitliche Ausdehnung des Begriffs »Barock« bzw. Manierismus im Sinne von Eugenio d’Ors. Wir können uns auch nicht zur Unterscheidung von 22 Barock- bzw. Manierismus-Epochen entscheiden, zumal Rubrifizierungen dieser Art ohnehin dürftige kategoriale Hilfsmittel sind. Die Dialektik Klassik – Manierismus hat den Vorzug, Randfelder des Übergangs offen zu lassen, schließt also den zu engen Schematismus aus. Dennoch wird man natürlich auf die Begriffe »Manierismus« und »Barock« im zeitlich engeren Sinne nicht verzichten können. Sie haben sich jetzt eingebürgert, und damit muss man sich abfinden. Hier ergeben sich die größten Schwierigkeiten, aber auch sie lassen sich lösen. Viel unnötige Polemik kann erspart werden, wenn man oberbegrifflich die dialektische Beziehung Klassik – Manierismus für die ganze Kunst- und Literaturgeschichte gelten lässt, den Begriff Manierismus aber (vor allem in der Kunstgeschichte) im engeren Sinne auch weiter anwendet auf die Zeit von der »Hochrenaissance« bis zum »Hochbarock«. Es wird sich erweisen, dass Wylie Sypher mit seinen neuen Untersuchungen über Literatur und Kunst zwischen 1400 und 1700 recht hat. In seinem Buch »Four Stages of Renaissance Style«[4] unterscheidet er Renaissance, Manierismus, Barock und Spätbarock. Das ist nicht neu, aber Sypher weist genau die Übergänge von der Renaissance zum Manierismus und dessen Weiterwirken im »Frühbarock« nach. Dadurch wird es vor allem möglich, den Manierismus zwischen Renaissance und Barock viel schärfer vom Hochbarock zu unterscheiden als bisher. Wir können also, aufgrund vergleichender kunst- und literaturgeschichtlicher Untersuchungen, ebenso gut den Manierismus des 16. und 17. Jahrhunderts wie den Hochbarock zwischen 1660 und 1750 gesondert für sich definieren und gleichzeitig den Begriff Manierismus in seiner allgemeineren, vor allem in seiner psychologisch und soziologisch vertieften Bedeutung, der Anregung E. R. Curtius’ entsprechend, auf die europäische Geistesgeschichte anwenden, mit der wir uns hier begnügen wollen und müssen.
Bei unseren Untersuchungen, deren Anfänge in der Lehrzeit bei dem unvergesslichen großen Kritiker und Gelehrten, in den Studienjahren bei Ernst Robert Curtius in Bonn liegen und die während eines nun schon mehr als zehnjährigen Aufenthalts in Italien durch immer wiederholte Begegnung mit den unerschöpflichen geistigen Schätzen dieses Landes, also auch der bildenden Kunst, systematisch ergänzt wurden, stießen wir – und sicherlich nicht nur wir –, zunächst in deutlicherer Abgrenzung innerhalb der antiklassischen »Konstante« Europas, auf fünf »Manieristische Epochen«: Alexandrien (etwa 350–150 v. Chr.), die Zeit der »Silbernen Latinität« in Rom (etwa 14–138 n. Chr.), das frühe, vor allem das späte Mittelalter, die »bewusste« manieristische Epoche von 1520 bis 1650, die Romantik von 1800–1830 und schließlich die unmittelbar hinter uns liegende, aber noch stark auf uns einwirkende Epoche von 1880–1950. Jede Manierismus-Form bleibt anfangs noch. »klassizistisch« gebunden, verstärkt dann ihre »Ausdruckszwänge« (Gottfried Benn). Sie wird also »expressiv« , schließlich »deformierend« , »surreal« und »abstrakt« . Gerade das wird in unserer Darstellung zu belegen und zu erklären sein, nämlich am Beispiel der manieristischen Epoche von 1520 bis 1650 in einer besonderen Konfrontierung mit den Manierismen Europas in der Kunst und in der Literatur von 1880–1950.
Die Ahnenschaft des Revolutionären
Es wird in der vorliegenden Arbeit also versucht, nachdem E. R. Curtius die Beziehung zwischen dem Manierismus in der lateinischen Literatur des Mittelalters und der antiken Rhetorik und auch die Weiterwirkung rhetorischer Kunstformen auf den Manierismus des 16. und 17. Jahrhunderts dargestellt hat, Stilmerkmale, Ausdrucksformen und auch geistige Grundmotive dieser Epoche näher zu charakterisieren; ferner soll die »Wahlverwandtschaft« in der Kunst, (bzw. im zweiten Band in der Literatur) ausführlicher geschildert und belegt werden, die sich zwischen dem damaligen Manierismus und der Kunst, bzw. der Literatur des 20. Jahrhunderts ergibt, obwohl den meisten Protagonisten des 20. Jahrhunderts eine unmittelbare Beziehung dieser Art nicht oder nur wenig bewusst ist. Eine ganze Epoche kann somit der List der Geschichte unterliegen. Ihre eigengeartete Mitwirkung an der schöpferischen Kontinuität des europäischen Geistes wird dadurch nicht vermindert. Im Gegenteil. Die Einbeziehung des Überindividuellen, des anscheinend beziehungs- und geschichtslosen Geistes in den Strom der Tradition verleiht dem umstritten Revolutionärem, dem epochal Einmaligem Ahnenschaft und damit – nach Novalis – Adel und Würde. Dieser Versuch geht von einer Differenzierung des Manierismus in der Kunst aus. Erfahrung boten dafür europäische Ausstellungen, u. a. Wien (»Französische Fantastik«, 1946), Rom (Monsù, 1950), Neapel (»Manierismus«, 1952), Nürnberg (»Aufgang der Neuzeit«, 1952), Amsterdam (»De Triomf van het Manierisme« , 1955), Rom (Arcimboldi, 1955) und Florenz (»Pontormo e il primo Manierismo fiorentino«, 1956), ferner Einsichten aus zitierter und noch zu erwähnender Literatur der letzten Jahre. Einen entscheidenden Impuls erhielt dieser Essay jedoch durch literarhistorische Studien, aus denen sich ergab, dass die »outrierteste« Dichtung der Gegenwart im »Manierismus« einen Ursprung hat, und aus dem sich daraus ergebenden Schluss, dass sie eine – auch – historische Legitimation, vor allem eine nicht von heute datierende Sinnerfülltheit und Hintergründigkeit habe. Wie der literarische »Concettismus« auf rhetorische Figuren der lateinischen Literatur des Mittelalters zurückgreift, so der künstlerische Manierismus auf die Gotik. Zeitgenössische Dichtung im anscheinend antitraditionalistischen Gewand hat, wie »moderne« Kunst, einen europäischen, also (um nur eines zu erwähnen) einen nicht nur »primitiven« oder nur »existenziellen« Ursprung im Sinne einer pseudo-schöpferischen action gratuite, einer Willkürhandlung. Ihre Regungen, Bestrebungen, ihre Anliegen und Experimente, Uransätze zu ihren Funden, sind weder historisch noch europäisch »exterritorial«.
Zwischen Spätrenaissance und Moderne gibt es eine Typenverwandtschaft, allerdings keine Identität des Individuellen, was ohnehin eine paranoische Vorstellung wäre. Diese positive Einschränkung gilt allerdings nur für »echte« Talente. Die Epigonen einer persönlichen maniera wirken wie Lemuren auf den Bildern Boschs. Über geistesgeschichtliche Filiationen im anscheinend Ungewöhnlichen (des Ausdrucks) sagt Gottfried Benn, »dass sich im Verlaufe einer Kulturperiode innere Lagen wiederholen, gleiche Ausdruckszwänge wieder hervortreten, die eine Weile erloschen waren«. Über die bloßen Nachahmer schreibt er: »Gott erhalte ihnen ihren Nachahmungstrieb.«
Auch im Manierismus, das ist heute im Hinblick auf die Epoche zwischen Spätrenaissance und Spätbarock inzwischen eindeutig geworden, auch im Experiment, im schizothymen Ausdruckswahn, in der Gespaltenheit, lässt sich das echte vom falschen Talent unterscheiden, selbst dann also, wenn es sich um ein »Werk« handelt, das sich einer ästhetischen Kontrolle mit klassizistischen Maßstäben entzieht. Es muss schließlich wiederholt werden, dass schon die damalige manieristische Kunst als Ergebnis einer erregenden Synthese des europäischen Geistes zu betrachten ist. Man kann mit philologischer Akribie nachweisen, aufs Jahr genau, wie lateinischer Formsinn sich mit germanischen »Ausdruckszwängen« z. B. im florentinischen Manierismus verbindet, in romantischer Peregrinaliebe vermählt. Der Einfluss Dürers, Schongauers und Boschs auf die toskanischen Frühmanieristen, die ihrerseits in ganz Europa als Vorbilder empfunden werden, in Rom und Fontainebleau, in Madrid und Prag, in Haarlem und München, ist ebenso auffallend wie die bis vor Kurzem so starken geistigen Verflechtungen zwischen Paris, Rom, Berlin, München, Prag, London und Amsterdam.
Parmigianino schuf das Antlitz des europäischen Manieristen, und der kaum erkennbare Raum, der um ihn schwingt, ist sicherlich das: ein poetisches Labyrinth, wenn auch noch dasjenige Gottes. Die Welt mit ihren gestörten politischen und ethischen Ordnungen bildet keinen harmonischen Kosmos mehr. Sie ist eine terribilità (so nannte man Bilder Michelangelos), eine angstvolle Beziehungslosigkeit, ein Schrecken, der sich nicht mehr mit den Regeln der Klassik darstellen ließ, eine Verdrehung. Man wollte das Schreckliche, Seltsame, das in Raum und Zeit Heimatlose einfangen, um es zu bannen. In Florenz begann das Streben, durch individuelle maniera diese Welt der zerstörten Ordnungen darzustellen. In der Malerei gehen dort Pontormo, Rosso und Beccafumi den neuen Weg, in Rom die Brüder Taddeo und Federico Zuccari, in England Nicolas Hilliard und Isaac Oliver, in Prag am Hofe Rudolphs II. Giuseppe Arcimboldi, Bartholomäus Spranger und die Brüder Jamnitzer, in Holland Karel van Mander, in Frankreich Jean Coussin, in Deutschland Hans Reichle, um nur einige dieser Künstler-Nomaden zu nennen; sie aber geben in den Hauptstädten Europas mit staunenerregenden Kunstwerken Zeichen, Zeichen, durch die man immer wieder wissen sollte, dass der »Cortegiano«, der damalige Hof-Dandy, wie der »scharfsinnige« Geistige im Ansturm der lebenshungrigen Masse in seinem verwickelten So-Sein verharrt, dass er das unkomplizierte Da-Sein nobel verachtet.
Eine säkularisierte Rangordnung wird hergestellt: Geist (mente) hat jeder, Talent (ingegno) besitzen wenige; über Genie (genio) verfügen nur seltene Halbgötter. Der Edelmann Castiglione empfiehlt: »Wenn die Worte, die ein Schriftsteller gebraucht, etwas verborgenen Scharfsinn enthalten, so wird er mehr Autorität gewinnen. Der Leser wird über sich selbst hinausgeführt, er wird die geistvolle Begabung und die Ideen des Autors viel mehr zu würdigen wissen.« Hier handelt es sich also um eine Protokoll-Regel für den höfischen Dandyismus des 16. Jahrhunderts, und es wird damit ein soziologischer Hintergrund für den literarischen Geschmack sichtbar. Das Wort acutezza recondita (verborgener Scharfsinn) wurde zur Zauberformel für diesen damaligen Manierismus, der alles prägt: die Hof-»Manieren«, das Kunstgewerbe, die Mode.
Wie sich zeitgenössische Stilisierungen und Abstraktionen im Kunsthandwerk und im Werbestil ausbreiten, so drang auch damals die neue »Revolution« in fast alle Lebensgebiete ein. Die klassische Standardisierung galt als rückschrittlich. Sie bot dem individuellen Geschmack nicht genügend Raum. Vasen mussten verdreht, Broschen aufgeblasen, Uhren schief sein. Gebrauchs- und Schmuckgegenstände galten als schön, wenn sie kaum noch mit der Natur vergleichbar waren. Am Mittelmeer wurde das umrisslos Nordische Mode. Vasari berichtet, Pontormo habe seine Malweise geändert, nachdem er Stiche von Dürer gesehen hatte. In den Einleitungen zum Katalog der Ausstellung »Der Triumph des europäischen Manierismus« im Rijks-Museum zu Amsterdam (1955) belegt R. van Luttervelt die internationale Ausbreitung dieser Modekrankheit und vergleicht den »Serpentinata-Stil« mit dem Style Métro des 20. Jahrhunderts. Die Amsterdamer Ausstellung hat übrigens, wie kaum ein ähnliches Ereignis in Europa seit 1920, dazu gedient, die »Moderne« von ihrer vermeintlichen »Beziehungslosigkeit« zu befreien. Gerade dort gewann man den Eindruck, dass diese tausendfältige Transponierung des Realen ins Irreale mit intellektuellen Mitteln zu einem der charakteristischen Merkmale des europäischen Geistes gehört. Auch die Kunst kündet von wiederholter Weltflucht, von stets erneuertem Bestreben, das »Diesseitige«, sobald politisch und soziologisch eine babylonische Sprachverwirrung einsetzt, in eine akausale Traumwelt zu versetzen, gleichzeitig aber auch – mitten in der politischen Auflösung – einen neuen gemeineuropäischen »Stil« zu finden.
Man ist also auf die Darstellung eines Menschentypus und auf die Analyse vielfältiger und häufig sehr reizvoller »Kulturdokumente« angewiesen, wenn man das Zeitalter der maniera zu deuten unternehmen will, um seine vielfach auch nur verborgene Beziehung zur Gegenwart sichtbar werden zu lassen, dieses Zeitalters, das auch in Shakespeare Spuren hinterlassen hat. Wie er, so wuchs auch ein anderer genio puro der Epoche darüber hinaus, Leonardo da Vinci. Man wäre versucht, auch ihn, den Hermetiker, den unergründlichen Magier, den rätselhaften Grübler, der die Sprache und das Denken aus der Technik erneuert, als Manieristen zu bezeichnen. Leonardo, die Verkörperung des »Ingeniums«, die Valéry faszinierte, die höchste Form des scharfsinnigen Talents, das die Theoretiker des Manierismus, wie Gracián, Peregrini und Tesauro, als »cherubinisch« preisen, er steht, weil er sich »universal« verhielt, weil er vor dem Politischen, dem Ethischen, dem denkerisch Systematischen nicht zurückscheute, vor, über und hinter der Epoche wie ein Riese. Parmigianinos Bild weist immer wieder auf den richtigen manieristischen Phänotypus, wenn es auch seiner »Rätselhaftigkeit« wegen aus der Werkstatt Leonardos kommen könnte, dieses Bildnis, in welchem sich eine verdünnte Welterfahrung, in allzu früher Jugend erlitten, in einer zu frühen Resignation spiegelt. Er, Parmigianino, findet, wie seine Brüder im Stil, im Gegensatz zur vitalen Fülle Leonardos, den Schluss am Anfang. Es hat hamletische Züge, das Bildnis des genialischen Jünglings. Parmigianino starb, verzweifelt nach »magischen« Weltgeheimnissen suchend, im Wahnsinn. Man empfand die Welt zwar als poetisches Labyrinth Gottes, suchte aber nicht mehr nach dem Eingang oder auch nur nach dem Ausgang. Man blieb im Unentwirrbaren stecken. An der Verlorenheit fand man Gefallen, und mit dem »Wahnsinn« begannen andere zu spielen … auch damals.
Was ist ein wahrer Dichter, fragt der Humanist Conte e Cavaliere di Gran Croce Don Emanuele Tesauro (1591–1667) in seinem heute fast vergessenen Monumentalwerk mit dem zeitgerechten preziösen Titel: »Das aristotelische Fernrohr oder die Idee der scharfsinnigen Schreibweise … erläutert mit den Grundsätzen des göttlichen Aristoteles« (erschienen zu Genua im Jahre 1654; bis 1682 acht Ausgaben). Das bereits zitierte Buch Peregrinis, dem Manierismus gegenüber viel kritischer, erscheint 1639; Baltasar Graciáns berühmtes Werk über den Concettismus: »Agudeza y Arte de Ingenio« wurde 1642 veröffentlicht (Näheres darüber, um Wiederholungen zu vermeiden, im Literaturband). Schon prologisch erklärt Tesauro, der scharfsinnig Begabte unterscheide sich vom Plebejer. Er trenne, bevor er verbinde. Es sei daher geboten, alles andere als einfach zu sein. Ein wahrer Dichter sei derjenige, der fähig sei, »entfernteste Zusammenhänge miteinander zu verbinden« . Wir können auf diese literarischen Bezüge hier nicht verzichten, weil sie uns zur Einführung in die historischen Zusammenhänge unentbehrlich erscheinen. Mit diesem Rezept Tesauros nämlich wird eines der verbreitetsten und allgemeinsten Stilmerkmale für den damaligen literarischen Manierismus Europas unter seinen verschiedenen Namen gegeben: in Spanien Conceptismo oder Gongorismo, in Italien Concettismo oder Marinismo (nach dem Dichter Giambattista Marino, 1569–1625), in England Euphuism, wit und conceit, in Frankreich préciosité, in Deutschland Sinnspiel (Sinngedicht). Diese discordia concors Tesauros wurde damals in England so erklärt: »Kombination ungleichartiger Bilder oder Aufdeckung verborgener Ähnlichkeiten in anscheinend verschiedenartigen Dingen.« Nach Tesauro entspricht diesem Stilmittel in der Architektur die Illusionsperspektive, die in Parmigianinos Bild zu erkennen ist. Tesauro weist auf die berühmte Säulengalerie im römischen Palazzo Spada hin und meint, man solle auch schreibend »perspektivische Durchblicke« schaffen. Giambattista Marino, der »König« des italienischen Manierismus, fasst es in einem Concetto zusammen: »E del poeta il fin la meraviglia, / Chi non sa far stupir vada alla striglia.« Das »Wunderliche, Wunderbare« ist also Ziel der Dichtung – wer nicht verblüffen kann, soll zum Stallknecht gehen. Für Tesauro stellt sich die »Sirene« Marino als eines der höchsten Beispiele für concettistische Kunst dar. Er wird zum Prototyp der poeti moderni, der modernen Dichter.
Hier zwingen sich Vergleiche mit Zeitgenössischen auf. André Breton schreibt im »Manifeste du Surréalisme«: »Das Wunderbare ist immer schön, ganz gleich, welches Wunderbare; es ist sogar nur das Wunderbare schön.« (»Merveilleux« hat hier den Sinn des seltsam Wunderbaren, des Erstaunlichen.) Wie wird dieses »Wunderbare« im Surrealismus erschlossen? Breton zitiert einen seiner Freunde, Pierre Reverdy, der mit Tesauro fast wörtlich übereinstimmt: »Das Bild ist eine reine Schöpfung des Geistes. Es kann nicht aus dem Vergleich, vielmehr nur aus der Annäherung von zwei mehr oder weniger voneinander entfernten Wirklichkeiten geboren werden. Je entfernter die Beziehungen dieser Wirklichkeiten zueinander sind, desto stärker wird das Bild sein.« Schon früher hatte Lautréamont geschrieben, nur die Vereinheitlichung des Disparaten wirke schön, nach dem Vorbild: »die zufällige Begegnung eines Regenschirms und einer Nähmaschine auf dem Operationstisch«. Differenzierter ist die ästhetische Sentenz Baudelaires: »Was nicht unmerklich entstellt ist, wirkt kühl und empfindungslos; – hieraus ergibt sich, dass das Unregelmäßige, d. h. das Unerwartete, die Überraschung, das Erstaunen, ein wesentliches und charakteristisches Merkmal des Schönen darstellt« (aus »Raketen«, 1855–1862). Praktisch entstanden daraus bei Baudelaire, dessen schöpferische Kraft die Verspieltheit des Dandy überwand, die correspondances zwischen Tönen, Gerüchen und Gefühlen. Gracián hatte das metaphorische Sinnspiel definiert als »intellektuellen Akt«, der die »Verbindung« (correspondencia) zwischen den Dingen herstellt. Wer denkt nicht vor allem an Rimbaud, wenn Tesauro den wahren, den »ingeniösen« Dichter als denjenigen preist, der »alles in alles verwandeln kann, eine Stadt in einen Adler, einen Mann in einen Löwen, eine Schmeichlerin in eine Sonne«.
Neues Sehen
Wir stehen mit Tesauro am äußersten Ende der manieristischen Phase zwischen Renaissance und Hochbarock. Durch diese Begegnung ist allerdings zweierlei gewonnen: einige weitere Formeln für die Wesensbestimmung des Manierismus und ein weiterer Ausblick auf seine europäische Ausbreitung, damals wie heute. Wie steht es denn nun mit der bildenden Kunst? Sie eilt im damaligen Europa der Dichtung um mindestens 50 Jahre voraus, den Traktatisten über Literatur um mehr als hundert Jahre. Der europäische Manierismus zwischen Renaissance und Hochbarock bestätigt sich, findet zum ersten Mal – in dieser Phase – seinen Ausdruck in der bildenden Kunst, wenn man davon absieht, dass der Manierismus der mittellateinischen Literatur die Dichtung nach der Renaissance wieder stark anregte. Die erste bedeutende Kunstrevolution der Neuzeit begann schon vor Raffaels Tod (1520). Ihre Ursprünge liegen in Florenz. Mit genialischer antiklassizistischer Willkür suchen einige junge, gebildete, äußerst sensible Maler nach einem neuen Stil. Sie stoßen sofort auf Bewunderer und Gegner. Der Subjektivismus der Pontormo, Rosso, Beccafumi und des in Florenz lebenden Spaniers Alfonso Berreguete wird dadurch nur noch entschiedener: sie treten in einen bewussten Gegensatz zur akademischen Geschmackskultur ihrer Zeit. Die Künstler der Hochrenaissance hatten in der chaotischen Stunde eines erschreckenden neuen Sehens jenseits religiöser Ordnungen einen ausgleichenden Ordo durch den harmonisierenden Logos gesucht. Es ging diesen Meistern ähnlich wie den Griechen, so wie Hölderlin sie schilderte: weil sie Geheimnis, Spannung, Ungelöstes in sich hatten, erstrebten sie eine magische Präzision der Gleichgewichte. Die Renaissance-Künstler retteten sich, besänftigten ihre Problematik, während in astronomischen und geografischen Dimensionen die Welt immer größer wurde, während Glaubensinhalte zerfasert und politische und gesellschaftliche Ordnungen angegriffen wurden, während neue Reiche sich bildeten und die frühkapitalistische Wirtschaft eine erste Krise erfuhr. Der von außen angeregte Drang zur Maßlosigkeit wurde durch einen Rückgriff auf den klassischen Kunstkanon gebändigt. Dieses ebenso geniale wie künstliche Bemühen, eine gefährdete Denk- und Gesellschaftsordnung im dramatischen Übergang in ruhigen, glanzvollen, unbewegten Emblemen der Schönheit zu versteinern, gelang allerdings nur für ziemlich kurze Zeit.
Schon in der fiebrigen und gleichzeitig vom Intellekt so scharf überwachten Tätigkeit Leonardos spürt man, wie das Rätsel des Widerspruchs zur Halluzination wird. Mensch und Welt spalten sich. Der Blick verfängt sich in einem Labyrinth von Unauflösbarkeit. Gerade dies, das Labyrinth, fesselt Leonardo immer mehr. Die Schönheit wird zur geheimnisvollen Anmut. Flächen und Linien lösen sich vom nur gegenständlichen Zusammenhang, sie werden, wenn auch in einem vorerst noch erbitterten Spiel, schon selbstständig. Auch Raffael verliert, als er die Entwürfe für die Fresken der vatikanischen Loggien zeichnet, die Geduld für eine offensichtlich auch ihm später etwas mühsame Anmut und Würde; ein Drang zur Abstraktion, eine Freude am Selbstgenuss in der Kühnheit, eine Neigung zur bannenden Kraft, nicht nur der Schönheit, sondern der Gorgo, des Grauens, wird in der Sintflutdarstellung der Loggien sichtbar. Doch der entscheidende, vitale Übergang von der frühen zur späten Renaissance, von der sublimen Stilisierung der Renaissance-Klassik zur neuen »manieristischen« Expression wird erst im Werk Michelangelos zu einem geistesgeschichtlichen Ereignis. Das gilt erst recht für sein Spätwerk. Das »Jüngste Gericht« in der Sixtinischen Kapelle (1541), die »Bekehrung Pauli« (1545) und die »Kreuzigung Petri« (1550) in der Paolinischen Kapelle sowie seine letzten Zeichnungen wirken auf die jüngere Generation etwa so wie im 20. Jahrhundert Picasso auf europäische Maler, deren Vater auch er sein könnte. Durch den Expressionsdrang des alten Michelangelo, der noch tiefere Höllenschlünde zu kennen schien als Dante, werden der statische Harmoniebegriff und seine rationale Verengungstechnik gesprengt. Die dramatisierende Bewegung, die scharfe Schockwirkung durch verblüffende Kompositionseinfälle lassen die Nachahmer der Natur schon nach ganz kurzer Zeit biedermännisch erscheinen. Michelangelos damaliges futuristisches Manifest heißt kurz und bündig: »Si pinge col cervello, non con la mano« (Man malt mit dem Kopf, nicht mit der Hand). In seinen letzten Gedichten schildert er sich selbst als einen Gescheiterten, als einen Bettler, als einen Erniedrigten und Beleidigten in einem römischen Elendsquartier. Er hasst seine Umwelt, ihren Lärm, ihren Prunk, ihre Selbstzufriedenheit. Wie die Jüngeren, wie Pontormo, Rosso und Parmigianino empfindet er sich, bei allem Ruhm, nur noch als Lump, Zigeuner, Pinselfuchser, als ein moralisch in mancher Hinsicht Verdächtigter. In seinen letzten Stunden umfängt er die höchste und einzige, die hermaphroditische Geliebte: die »Idea«, als ein König des geistigen Europa.
So wirkt schon zwischen 1515 und 1525 in Florenz diese erste »moderne« Avantgarde, diese zwischen epikureischem Ausgleichsdrang und intellektuellem Hunger nach magischen Weltformeln hoffnungslos zerrissene Künstlerschaft. Es sind die toskanischen Frühmanieristen: Pontormo, Rosso, Beccafumi, Bronzino. Man hat vor unserer Jahrhundertwende darüber gestritten, ob diese Maler von »Rang«, ob sie also nicht bloße »Nachahmer« seien, im Sinne des unglückseligen Ausspruchs des nicht gerade fantasievollen und kritisch zuverlässigen Vasari, als er von ihnen meinte, sie malten »alla maniera di Michelangelo«. Es ist hier nicht der Ort, nach den hervorragenden Arbeiten von Panofsky, Dvorák, Briganti, Lossow, Benesch und Becherucci, um nur einige zu nennen, die verwickelten Zusammenhänge eines heute überwundenen Streits darzustellen[5]. Eine zuordnende Bemerkung ist unerlässlich. Tatsache ist, dass gegenwärtig die These Dvoráks, es habe der »Manierismus« in der Kunst »eine konstitutive Bedeutung für die ganze Neuzeit« an Geltung gewinnt, oder diejenige Brigantis, es sei mit der »manieristischen« Kunst ein selbstständiger neuer »Stil« entstanden, ein neuer »Geschmack«, eine neue »Sensibilität«, eine neue »geistige Haltung«. Kunsthistoriker und Kritiker Europas und Amerikas, die ihre ästhetischen Urteile nicht nur vom klassizistischen (oder spätbarocken) Kunstkanon ableiten, finden heute, es sei die »manieristische« Kunst vernachlässigt, missverstanden, jedenfalls unzulänglich gewürdigt worden. Ihr Blick auf diese historische Phase einer antiklassizistischen künstlerischen Darstellungsweise ist durch das vielfältige Experiment der »Moderne« von Cézanne bis Klee geschärft worden. Sicher ist, dass man den »Manierismus« heute weniger zum Gegenstand dogmatischer Polemiken oder geistesgeschichtlicher Kombinationen macht. Man zieht es viel mehr vor, das Werk der einzelnen Künstler in diesem äußerst vielfältigen manieristischen Stil »mit Augen« anzusehen, in diesem Stil, der vor 1520 entstand, im Barock nachwirkte, in der Romantik wieder auftauchte und manchen Tendenzen der zeitgenössischen Kunst zwischen 1880 und 1950 entspricht. Es gibt Versuche, der »modernen« Kunst (deren bedeutende schöpferische Gestalter fast alle zwischen 1880 und 1890 geboren sind) »Ahnen« zu schenken, und man hat dabei auch den »Manierismus« nicht übersehen. Kunstkritik und Kunstgeschichte gingen jedoch, von Ausnahmen abgesehen, eigene Wege. Die Kunstgeschichte beachtete – als akademische Wissenschaft – das Zeitgenössische zu wenig, und die Kunstkritik, die sich mit den Mitlebenden zu beschäftigen hatte, begnügte sich meist mit aphoristischen Hinweisen auf die welthistorische Tatsache, dass es geistige Kontinuität gibt, auch da, wo sie kaum noch zu erkennen ist. Die Wissenschaft unterlag der suggestiven Kraft des Vergangenen, die Kritik derjenigen der Gegenwart. Die Andeutungen genealogischer Beziehungen zwischen der »modernen« europäisch-amerikanischen Kunst zwischen 1880 und 1950 und derjenigen zwischen 1520 und 1660 hatten vor allem einen Charakter bloßer Aperçus, weil man sich jetzt erst über die Vielfalt des historischen Manierismus in Kunst und Literatur und über die Verschiedenheit »manieristischen« Verhaltens klar zu werden beginnt. Dass der damalige »Manierismus« ein europäischer Stil war (wie die zeitgenössische Kunst, Literatur), hatte man erkannt, nicht aber die zumindest dreifaltige Ahnenschaft des »Concettismus« zwischen 1520 und 1660.
1. Die erste Erschütterung
Saturnische Melancholie
In den Jahren 1554–1556 schrieb der florentinische Maler Jacopo da Pontormo (1494–1557) das wahrscheinlich merkwürdigste Tagebuch, das je ein europäischer Künstler hinterlassen hat. Meist ist darin die Rede von schmaler Kost, die der Sonderling sich zubereitet, von Fasttagen, von intimeren hygienischen Sorgen, von seltenen Begegnungen mit Freunden; und von einem von diesen wurde der erste bedeutende »Ausbrecher« aus der harmonischen Welt der Renaissance sogar einmal »geschlagen«. Ein dürftigeres, farbloseres und zugleich menschlicheres Dokument, im ganz elementaren Sinne des »Menschlichen«, kann man sich kaum vorstellen. Es wurde – merkwürdig genug – erst 1916 in Amerika, als Anhang zu einem Werk über die Zeichnungen Pontormos, in englischer Sprache und 1956 in Italien in der Ursprache veröffentlicht. Etwa in der Mitte dieser trostlosen Notizen findet man eine interessante Bemerkung über die Zeit von Ende März bis Ende April 1555. Eine Pestepidemie suchte Florenz heim. Es sei gewesen, so zeichnet Pontormo auf, als habe man »das Feuer im Wasser braten hören«. Die Schuld für die Katastrophe wird dem Mond zugeschrieben. Dieser angstvolle Hinweis auf die unheimliche Kraft des Mondes, auf die Unheimlichkeit der Nacht findet sich häufig in diesen Aufzeichnungen. Man begreift, dass Pontormo ein Melancholiker war, ein temperamento lunatico , ein Saturniker, und man weiß es auch aus Geschichten, die ein Zeitgenosse, der Anekdotensammler Giorgio Vasari (1511–1574), über ihn zu berichten weiß. Dieser peintre maudit , der noch vor Raffaels Tod (1520) seine ersten Bilder malte, war als mürrischer Menschenfeind berüchtigt, der mit einer Leiter in sein schwer zugängliches schäbiges Atelier kletterte und diese hochzog, damit niemand ihn besuchen könne. Vasari nannte ihn daher »un uomo fantastico e solitario«. Wie Leonardo wurde er wegen Nekrophilie angezeigt. Angeblich hatte er auf dem Friedhof Leichen nicht nur zu Studienzwecken ausgegraben. Solche Angriffe richteten sich gegen Persönlichkeiten, die man wie Leonardo als »Zauberer« oder wie Aretino als Publizisten oder wie Pontormo als Outsider fürchtete. Von Frauen ist im Tagebuch Pontormos allerdings nie die Rede, und das ist wohl auch ein Grund für diese Anzeige. Man kann eines als sicher annehmen: Wie Leonardo und wie Michelangelo fand Pontormo sein Ideal im Bilde des platonischen und wohl auch des nicht nur platonischen Epheben. Dieser erste Akzent auf eine erotische Invertiertheit ist unausweichlich.
Dazu das Bild Saturns! Marsilio Ficino (1433–1499) hatte in seinem Werk »De Vita triplice« (1494) Saturn als den Bringer der schöpferischen Melancholie bezeichnet. Plato war ein »Saturnkind«. Pontormo fand für seine eigene neue »Freiheit« wichtige Anregungen bei Dürer. Dürers »Melencolia« ist, nach den Untersuchungen Panovsky-Saxls[7] die Darstellung einer »Komplexion«, welche dem Einfluss des Saturn untersteht. Um diese Zeit wird der Saturn – wie bei Aristoteles – wieder ein Symbol der Genialität, allerdings auch der Verdüsterung, des Verbrechens, des Wahnsinns. Ficino definiert den saturnischen Typ in folgender Weise: »Selten gewöhnliche Charaktere und Schicksale, sondern Menschen, die von den anderen verschieden sind, göttliche oder tierische, glückselige oder vom tiefsten Elend niedergebeugte[8]« und er empfand sich selbst als einen Charakter dieser Art, weil er wusste, dass in seinem Horoskop der Saturn seinen Aszendenten Wassermann beeinflusste. Einem Freund schreibt Ficino einmal: »Ich weiß in diesen Zeiten sozusagen gar nicht, was ich will, vielleicht auch will ich gar nicht, was ich weiß, und will, was ich nicht weiß.«[9] Dabei klagt er über seinen lästigen Saturn. Ein psychologischer Grundzug des genialischen, melancholischen, subjektiven, bizarren, »manieristischen Menschen« vom Typus Pontormo wird hier in der mustergültigen Form eines paradoxalen, literarisch-manieristischen Concetto geschildert. Kontrastreiche Figuren dieser Art wirken bis in die Literatur des Barock hinein.
Von Pontormo sind Zeichnungen erhalten, die zu den interessantesten »aller Zeiten« gehören (Dvorák). Nicht nur das. Es handelt sich um die ergreifendsten Dokumente am allerersten Ursprung des europäischen »Manierismus« – immer von dieser Phase und nur von dieser ist jetzt die Rede. Vor ihnen versteht man, selbst wenn man die Einflüsse Michelangelos (1554 gestorben) gelten lässt, wie sehr dieser Schüler Leonardos und Andrea del Sartos in seiner seltsamen Vereinsamung und »saturnischen« Eigenbrötelei geahnt hatte, vor welchen ganz neuen Problemen der Mensch in dieser Zeit von 1520–1550 stand und vor welchen er noch stehen würde. Unruhe, Angst, Verlassenheit, »Unbehaustheit« treten gleichsam auf gegen Harmonie aller Teile, Proportion, Maß, Kreis, geordnete Mitte, Albertis Vollkommenheitsideal der Renaissance. Mit überraschender Plötzlichkeit tauchen sie auf in dem damals geistig so äußerst angespannten Florenz. Manche dieser Zeichnungen, vor allem diejenigen, von denen hier die Rede ist, sind Entwürfe für die Darstellung eines Jüngsten Gerichts, das Pontormo für den Chor von S. Lorenzo in Florenz plante, jedoch nie beendete. Die Technik dieser Zeichnungen ist für diese Zeit auffallend und neu: Betonung der Umrisse, ein extremer, aber immer expressiver Realismus, ein fast frenetischer Verzicht auf Details, sodass manche hohläugigen Gesichter an Zeichnungen von Käthe Kollwitz und manche »Aussparungen« an Matisse erinnern. An der hin und wieder korrigierten Linienführung kann man den Willen zur Deformation erkennen. Deformation? Man muss hier zunächst dem Verdacht ausweichen, in historisch unzulässiger Weise einen Begriff der zeitgenössischen Ästhetik auf die Vergangenheit zu übertragen, ja geradezu auf die Zeit der Hochrenaissance.
Renaissance: Auch Geburt eines Neuen
Suchen wir daher zunächst in damaligen literarischen Dokumenten nach Belegen und gehen wir davon aus, dass die Renaissance keineswegs nur die Wiedergeburt eines »Alten«, sondern auch die Geburt eines »Neuen« war. Der aus dem alten Ordo losgelöste Mensch sucht einen eigenen neuen Weg. Harmonisierenden Trostvorstellungen weicht er nicht immer aus. Gerade in dieser Frühzeit des Manierismus! An den Höfen besonders, an den Mittelpunkten des damaligen gesellschaftlichen Lebens, will man so viel von früheren »Ordo«-Vorstellungen hinüberretten wie möglich, aber die Unbefangenheit ist verloren. Konventionelle »Manieren« verdecken die Unsicherheit, Masken, geheimnisvolle Formeln, eine künstlich verdunkelte Sprache tauchen wieder auf wie zur Zeit der provenzalischen Hof-Kultur, aber viel bewusster und viel differenzierter wird alles, was zur äußeren Erscheinung, zum Wissen und zum Geheimnis des »Edelmanns« gehört. Nützliche Hinweise finden wir zunächst bei einem gewiss wegen Radikalität oder psychopathischer Charakterzüge unverdächtigen Zeitgenossen Pontormos, im damals weltberühmten Werk Baldassare Castigliones (1479–1529), im »Cortegiano«. Castiglione widmete sein Buch Franz I. Als Botschafter der Herzöge von Urbino und Mantua und als Apostolischer Protonotar unter Clemens VII. stand er mit den Größen seiner Zeit, vor allem mit denen des geistigen Lebens, in Verbindung. Er starb 1529 in Toledo, der Geburtsstadt Góngoras und der Wirkungsstätte Grecos, als Ehrenbürger Karls V. Der »Cortegiano« gehörte zu den Lieblingsbüchern Karls V. Um ein »idealistisches« Gegenstück zum Realismus des »Principe« Machiavellis handelt es sich, um ein Buch, das nicht nur für den höfischen Lebensstil Europas, sondern auch für die bella maniera in Kunst, Literatur, Musik tonangebend wurde, um eine Fundgrube vor allem für erste Merkmale des noch diskreten anfänglichen Manierismus dieser Phase. Das Wort maniera wird benutzt und definiert, also rund dreißig Jahre früher als bei Vasari. Etwa 130 Jahre vor Gracián und Tesauro, den bewunderten Theoretikern des Manierismus in seiner Endphase, beschreibt und empfiehlt Castiglione einige der wichtigsten manieristischen »Techniken«. (Der »Cortegiano« wurde zwischen 1513 und 1518 geschrieben und 1529, zwei Jahre nach dem Sacco di Roma und 28 Jahre vor Pontormos Tod in Venedig, zum ersten Mal veröffentlicht.) Man muss es dahin gestellt sein lassen, ob ein mürrischer Sonderling wie Pontormo, der wahrscheinlich auch viel weniger belesen war als seine meisten, z. T. hochgebildeten Zunftgenossen, ein solches Buch überhaupt gekannt hat. Aber er wirkte für die gesellschaftliche Welt, deren Neigungen, Geschmack und Interessen Castiglione sammelte und aufzeichnete. Pontormos Jünglingsporträts könnten Abbilder von Zöglingen des Ideal-Hofes von Urbino sein. Diskutiert hat er mit seinen Freunden, mit anderen »Fantasten« dieser ersten antiklassischen, revolutionären Avantgarde wie Rosso, der später Selbstmord beging, wie Beccafumi und Bronzino, beim Wein in den Fiaschetterien von Florenz über alles, was damals »modern« war, viele Nächte; und wenn man sich nicht einig wurde, schlug man aufeinander ein. Doch Argumente dieser Art scheinen Pontormo (dünn, langhaarig, wie ein Wilder [Vasari]), bei aller Rauheit, wie van Gogh, äußerst sensibel und wohl auch fromm, nicht gefallen zu haben. Daher die Leiter in seinem Atelier, Symbol der Zurückgezogenheit wie die Kammer van Goghs in Arles. Das Wichtigste, was Castiglione in seinem Vademecum für Weltleute sagte, hat Pontormo also sicher gewusst. Man kann es an seinen berühmtesten Werken ablesen. Castiglione empfiehlt schon die »Umkehrung« aller Logik. Er meint, alles werde schöner, »dicendo ogni cosa al contrario«, wenn man alles auf »umgekehrte« Weise sage. Ein Blick auf die berühmte, von Dürers Technik beeinflusste »Kreuzabnahme«, [Florenz, S. Felicita, 1523–1530] macht zunächst dies klar. Becherucci schreibt darüber: »Die Formen verketten sich mit rhythmischen Entsprechungen, die jedem rationalen Maß widersprechen.« Die ganze Gestaltentraube erscheint, der Schwerkraft nach, entmaterialisiert. Eine labyrinthische, der normalen »Realität« entgegengesetzte Gegen-Wirklichkeit wird in diesen »expressiven« Linien sichtbar, und was auffällt, ist der Mittelpunkt des Bildes: ein gegenständlich Unwesentliches, ein Tuch, ostentativ in die wesenlos gewordene Mitte gehalten. Dazu eine preziöse Farbgebung: Rubinrot, Violett, Türkis, alles in gleißendem Licht. A. M. Vogt stellt die Hypothese auf, es müsse schon während der Hochrenaissance, im Zusammenhang mit den »Primi Manieristi« von Florenz, eine Art geistiger »Untergrundbewegung« gegeben haben; in diesen Zusammenhängen spricht er von einer »Herausforderung«, von einer »simultanen Gegenleistung«, welche die Kunstgeschichte von ihrer fixen Idee der Sukzession langsam ablöst.[10] Zu den Farben Pontormos wird vermerkt, es handle sich um einen »Halbtonschritt der Farbe« und um eine Kraft der »minimalen Differenz«, Zeichen für ein Bedürfnis nach Aufhebung der Grenzen; es sei somit ein »neues Tongeschlecht« in der Malerei geschaffen (gefunden) worden, das selbstständig neben dem Dur-System und neben dem Moll-System der üblichen Farbnetze bestehe. Das ist gegenüber den »ruhigen« Tonverhältnissen in den Meisterwerken der Hochrenaissance ein wichtiger Schritt, den man, will man an den Ursprung, an den Ansatz dieser neuen »Urgebärde« gelangen, nicht übersehen kann.
In Pontormos »Kreuzabnahme« also wie in seinem Altarbild von San Michele Visdomini (1518) wird man die ersten konkreten Manifestationen der antiklassischen Revolution des Manierismus sehen müssen. Auch die ursprüngliche Verwendung des Begriffs maniera wird klarer. Vasari meinte in seinen »Viten«, diese Künstler malten »alla maniera di Michelangelo« . Es liegt darin ein tadelnder Beiklang. Manierismus gilt hier als bloße, ja sogar als schlechte Nachahmung. Beklagt wird hier also, dass diese Künstler keine eigene »Manier« haben (von lat. manus – Hand, übertragen manu, von Menschenhand, von der Hand, durch Kunst, gleichsam die persönliche Handschrift), dass sie übertreiben, zu unruhig, zu ungeordnet sind. Vasari hatte übersehen, dass diese »Antiklassiker« von Florenz nicht nur »Manieristen« im Sinne der bloßen Nachahmung waren, sondern dass sie mit der künstlerischen Darstellung zumindest gerade dieser »Unruhe« zu den ersten Vertretern einer neuen »Manier« wurden, dass sie die Begründer des neuen, durchaus eigengearteten »Manierismus« waren. Seit Vasari ist dieser Begriff rund 300 Jahre lang meist im tadelnden Sinne gebraucht worden. Erst seit Dvorák gewöhnt man sich allmählich daran, den »Manierismus« als einen eigenen Stil anzuerkennen. »Die anaturalistische Abstraktion« (Dvorák) wird das Ziel des Zeitalters. Anstatt der Naturnachahmung entwickelt sich eine »Fantasiekunst«. Sie »stellt die psychischen Erlebnisse und Emotionen höher als die Übereinstimmung mit der sinnlichen Wahrnehmung«.
Dieses neue Tongeschlecht also ist genau wie die mit »Unwichtigem«, mit dem drastisch Akzidentiellen schockartig ausgefüllte Bildmitte zweifellos das Ergebnis einer intellektuellen Überlegung. Ein »ingeniöser« Effekt wird erzielt durch etwas bewusst »Gemachtes« und allerdings sehr »Gekonntes«. Bei Castiglione finden wir ein merkwürdiges Sonett gelobt. Es handelt sich um das Erzeugnis eines ebenso »alogischen« wie gewollten Verfahrens. Tesauro und Gottfried Benn verlangen später vom guten Dichter »fabrizierte« sprachliche Gebilde.[11] Castigliones Begeisterung gilt einem Gedicht, in dem fast jedes Wort mit »S« anfängt, und diesen Kunstgriff charakterisiert er als »ingenioso e culto«. Damit sind zwei Begriffe vorweggenommen, welche mehr als hundert Jahre später Gracian und Tesauro berühmt machen sollten. Daraus ergibt sich zweierlei: Die »alogischen« rhetorischen Kunststücke des Spätmittelalters kehren in der antiklassischen »Mode« von Florenz zwischen 1520 und 1550 in der Malerei ebenso zurück, wie sie – über Castiglione – nach Spanien eindringen. Man erinnert sich, dass die bedeutendste Lyrik Spaniens im »Goldenen Zeitalter«, diejenige Góngoras, als »kultistisch« und als »ingeniös« bezeichnet wurde. Baltasar Graciáns »Agudeza y Arte de Ingenio« erschien teilweise erst 1642, ganz 1648, ein Flug also schon in der Dämmerung des Manierismus.
Wir stehen demnach vor einem doppelten Ursprung manieristischer Modernität: einem sonderlinghaften, verborgenen, höchst subjektivistischen und einem weltmännischen, gesellschaftlichen, vornehm individualistischen. Zwei Formen der Verdrängung und ihrer Bewältigung stehen sich gegenüber: eine etwas vertrackte, aber genialische »Privatlösung« und eine vom Drang nach allgemeinen guten, aber ausschließenden, exklusiven guten »Manieren« (des Hofs) bestimmte »kollektive« Lösung. Doch beide ergänzen sich. Bevor die geistigen Hintergründe im damaligen Florenz etwas erhellt werden, noch weitere Beispiele aus dieser paradoxen Kopplung: Pontormo-Castiglione. Im dreißigsten Kapitel seines Buches empfiehlt der Diplomat, Humanist und Polyhistor Castiglione dem Hof von Urbino, man solle in die Worte, die man schreibt, etwas »acutezza recondita« hineinlegen, also scharfsinnige Dunkelheit.[12] Oft lobt er, was »süß und künstlich« ist. Er wendet sich damit an die raue aristokratische Jugend. Wie Sokrates beschwört er sie. Sie sollen sich von der barbarischen Lebensart der Franzosen lösen. Ihm gefalle es, so schreibt er im 16. Kapitel, einen Jüngling zu sehen, der »etwas Ernstes« an sich habe, »etwas Schweigsames«. Diese »maniera riposata«, diese beruhigte Manier, verleihe würdigen Stolz, den Beweis einer Selbstbeherrschung. Mit anderen Worten: Castiglione empfiehlt mit seiner gesellschaftlichen »Hebammenkunst«: Distanz, Verschlossenheit, ein bewusstes Anders-Sein. Ist diese Anregung, eine »innere« Leiter hochzuziehen, um in der Verborgenheit des unnahbar Individuellen Abstand von der rauen Umwelt zu erlangen, sehr verschieden von der so konkreten Leiter des allmählich menschenscheuen, zergrübelten, wenn auch längst nicht »höfischen« Jacopo?
Die Antwort mag man in den Porträts vornehmer Jünglinge finden, die den größten Ruhm Pontormos ausmachen. Alles an dem Bilde Alessandro Medicis – außer den Augen und der rechten Hand – erscheint abstrakt. Die Vergeistigung legt um Mund und Wangen einen dekadenten Zug, die Augen blicken fassungslos, traurig, aber mit einer merkwürdig lauschenden Gefasstheit auf einen rätselhaften Blickpunkt. Die Hand greift nicht mehr zu. Sie zögert. Das pompöse, kardinalrote Gewand verhüllt, wie ein Panzer, den Körper. Dann das Porträt des Komponisten Francesco dell’Ajolle. Der Körper verschwindet fast im Schatten, beleuchtet bleibt ein »saturnisch« zergrübelter Blick, ein depressiv herabgezogener Mundwinkel, ein von empfindsamen Händen getragenes, hell beleuchtetes Buch, ein musikalisches Werk. Wenn man mit Recht Hamlet als die großartigste Figur des damaligen europäischen »Manierismus« preist, als den Zergrübelten, Zaudernden, stets anders Handelnden, als die Logik, die Konvention und die Pflicht es vorschreiben, als den auch erotisch Vieldeutigen, kann man sich dann nicht zumindest vorstellen, dass Shakespeare, sieben Jahre nach Pontormos Tod geboren, diese oder andere ähnliche Jünglingsporträts Pontormos gekannt habe, wenn auch nicht im Original? Damals zirkulierten durch die Hauptstädte Europas, viel schneller als man annehmen sollte, Gravüren, Zeichnungen berühmter Kunstwerke; und diese Zeit bebte geradezu vor intellektueller Gier. Das Schicksal »aufsehenerregender« Kunstwerke war damals abenteuerlich genug. Bevor dieser Abschnitt beendet wird, kann gerade in dieser Hinsicht auf den nächsten übergeleitet werden, auf Parmigianino. Das in der Einleitung bereits besprochene Selbstbildnis im Konvexspiegel (wie man annehmen darf, auch gemacht, um Möglichkeiten expressiver Deformation zu studieren) erregte, als der junge Künstler 1524 nach Rom ging, am Hofe Clemens VII. höchstes Aufsehen. Es galt als eine meraviglia, eine »Wunderbarkeit«, und erzeugte stupore, Erstaunen.[13] Parmigianino schenkte das kleine Bildnis diesem Papst, der in seinen Appartements, in der Engelsburg, Rom – nach Florenz – zum zweiten Zentrum des frühen europäischen Manierismus machte. Clemens VII. gab es weiter an das einflussreiche enfant terrible der Zeit, an Pietro Aretino. Dann kam es in den Besitz des venezianischen Bildhauers Alessandro Vittoria. Von dort gelangte es nach Prag, an den Hof Rudolphs II., den geistigen Sammelpunkt der Exzentrischsten des damaligen Europa, wo – in der Geburtsstadt Rilkes und Kafkas – einer der abstrusesten Maler der Epoche als »Reichsgraf« wirkte: Giuseppe Arcimboldi. Jetzt befindet sich das Bildnis in Wien.
Doch bevor wir uns von Pontormo trennen, noch die Frage, die man sich stellen wird: Ist er ein großer Künstler? Die Frage wird man nicht davon abhängig machen können, ob er »Klassiker« oder »Manierist« ist, sondern nur vom Rang dieser spezifischen und nicht andersgearteten Kunst. Dass Pontormo dann nicht nur als »großer« Künstler erscheint, sondern vor allem als großer Vorläufer, wird nicht bestritten werden können. Zu den »Größten« unter den Bahnbrechern und Erfüllern im Manierismus, wie dem späten Michelangelo, wie Tintoretto und Greco, wird man ihn nicht zählen können. Seine Grenzen liegen in seinem intellektuellen Egozentrismus, in seiner Verbissenheit. Es ist kein Zufall, dass er mit seiner geplanten Darstellung des Jüngsten Gerichts scheiterte. Erst mit dem »Jüngsten Gericht« Michelangelos, der über die echte innere Freiheit, über das größere Talent und über die sicherere geistige Universalität verfügte, wird, was diese expressive Form des Manierismus der neuen Generation angeht, eine ungeahnte Welt der Vollkommenheit eröffnet, einer neuen Vollkommenheit des »Ausdrucks«.
Die erste antiklassische »Erschütterung« in Europa, soweit wir vorerst ihren bloß künstlerischen und gesellschaftlichen Spuren folgen, wurde an zwei Polen sichtbar: am Werke eines Malers und in den Lebensvorschriften eines Weltmanns. Die Zeichnungen Pontormos legen diese Erschütterung«, als Folge neuer Erkenntnisse und sozialer Umwälzungen, gleichsam in einem brutal klinischen Sinne bloß. In den meisten Tafelbildern und Fresken Pontormos findet sich ein Ausgleich zwischen einem extremen Subjektivismus und einer Vorliebe der »Gesellschaft« für scharfsinnige Pointen, für »Verdrehtheiten« und »Dunkelheiten«. In den Porträts Pontormos wird dieser gefährliche Gegensatz am vollkommensten überwunden: Geheimnis verbindet sich wieder mit Anmut.
2. Anmut und Geheimnis
Welt im Schweben
Diese Formel wird für die erste Stufe des europäischen Manierismus nach der Hochrenaissance verbindlich, wenn man vom späten Michelangelo und von Erscheinungen in Rom zur Zeit Pauls III. absieht. Die Radikalität des ersten Anstoßes erscheint durch die Macht der aristokratischen Hof-Kultur aufgefangen. Aber die Erregung wirkt weiter. Sie wird durch einen schärferen Sinn für Geschmack, für klassizistische Dämpfungen neutralisiert, aber keineswegs abgetötet. Im Gegenteil. Man könnte meinen, dass die rigueur, die Strenge im Sinne Valérys, die den Künstlern durch die zwar preziöse, aber natürlich in einem geistigen Sinne nicht gänzlich »offene« Lebens- und Denkart der weltlichen und geistlichen Fürsten aufgezwungen wird, zu einer Steigerung der inneren Spannung führt. Das schönste Beispiel dafür bietet das Werk Parmigianinos, des »Mozart« unter den damaligen Künstlern. Siebenunddreißig Jahre alt war er, als er starb. Sein Werk hat bis tief ins 17. Jahrhundert hinein Generationen von Malern beeinflusst, besonders in Nordeuropa. Francesco Mazzola wurde 1503 in Parma geboren. Er, wie auch die anderen genialischen Vorläufer: Pontormo, Rosso sowie Beccafumi und Primaticcio, verbinden das Streben nach dem Geheimnisvollen, nach dem »Änigmatischen«, noch mit Anmut. Die »Hieroglyphik« des Daseins wird noch ins Gegenständliche hineingeprägt. Es löst sich aber im sogenannten Serpentinata-Stil die statische Form auf. Der Raum wird durch Tiefenachsen zerdehnt. Auf Ruhe und Ausgewogenheit wird verzichtet. Lossow hebt folgende Merkmale hervor: das Licht wird zu einem stärkeren Faktor in der Bildkomposition, hell beleuchteten Partien stehen dunkle Schattenflächen gegenüber ohne Übergang und Vermittlung. Zur farbigen Gestaltung: kühle, helle, glatte und »giftige« Töne mit vielen weißlichen, hellgrünen und gelben Nuancen, scharfe Kontrastierung satter oder kühler Farben. Neue Proportionierung der Gegenstände und Figuren; Streckung aller Längen, Zusammenziehung der Breitenproportionen. Die Haltung der Figuren wird gespreizt, geziert, verrenkt. – Diese Kunst zeichnet sich durch eine zarte Sensibilität aus, durch einen verfeinerten Geschmackssinn, durch ein Gefühl für magische Raumwirkung, für reichere Ausdrucksmöglichkeit im Porträt, für überraschende psychologische Nuance. Wie später, in der Lyrik Marinos und seiner Schüler, liebt man seltsame Gegenstände, ausgesuchte Gewänder, »überraschende« Elemente in Form und Inhalt. Eine Treibhausluft spürt man, eine invertierte Erotik der Verkleidungen, die später in Lyrik, Roman, Theater, Ballett eindringt. Man findet sie in den dichterischen Meisterwerken der »Concettisten« wieder, im Adone von Marino, in den Soledades von Góngora, in Marlowes Hero und Leander, in Shakespeares Maß für Maß.
Parmigianino ist ein Meister dieser Kunst der »Grazie und Subtilität« (Dvorák). Man vergleiche dazu die »Madonna con Figlio e Angeli« aus der Galleria Pitti in Florenz. Die Anmut der Madonna und der geschlechtlich ambivalenten Engel zeugt für eine von Raffael ausgehende Verfeinerung, die aber »outriert« wird. Die Gestaltengruppe links der Säule wirkt wie ein Strauß tropischer Blumen, und an »geheimnisvollen« Subtilitäten fehlt es wahrhaftig nicht: die Säulen mit den in »beschleunigter« Perspektive gezeichneten Stufen; die Prophetenfigur mit dem überlangen Arm, an eine Greco-Gestalt erinnernd; der Fuß Maria vor allem, auf dem Kissen ruhend wie ein eigengeartetes, skurril-schönes Lebewesen. – Subtilität gehört zur Concetto-Kunst. Sie ist ein Bestandteil des »Ingeniösen«, ein Element geistvoller Schönheit, ein Mittel, das »Verborgene« sichtbar zu machen. Man findet noch mehr davon in diesem Bild. Einer der Engel starrt auf das Geschlecht des Knaben; man erkennt ferner: Jede Figur hat eine eigene Blickrichtung. Jede lebt im Blick für sich und durch sich. Die Augen des Jesusknaben sind geschlossen, diejenigen des Propheten erscheinen wie maskiert. Rechts von der Madonna aber entfaltet sich dunkel, mächtig, in einer dämonischen Düsternis, die ein Fabelwesen zu verschleiern scheint, der Mantel, hinüberleitend in das ebenso subtile perspektivische Rätselspiel der in einer Mondlandschaft entgleitenden Säulenstufen. Die Madonna mit den überschlanken Händen, welche die blütenhafte Brust kaum berühren, scheint eher zu schweben als zu sitzen. Wie die Abdrängung des Wichtigen an die Peripherie, um ein »Vacuum« der Mitte zu schaffen, wird das »Schweben« für die ganze Folgezeit zu einem der beliebtesten modischen Motive.[14] Dieses »Schweben«, welches allen Gesetzen der Schwerkraft spottet, welches den Stoff spiritualisieren zu wollen scheint, welches den Phänomenen in der Welt den Aspekt psychischer, traumhafter Erscheinungen verleiht, findet man im Manierismus immer wieder bis zu Chagall und Dali.
Parmigianino wirkt »raffaelisch«, aber es fehlte ihm die heitere, unproblematische Lebensart des großen Renaissance-Meisters. Gegenwärtige italienische Kunsthistoriker, wie z. B. Lionello Venturi, neigen neuerdings zu einer anderen Wertung ihres bisher »Größten«. Der Maler Italiens, dem die Ehre zuteilwurde, neben den Schöpfern des geeinten Italiens im römischen Pantheon begraben zu werden – Raffael –, wird nicht mehr als die höchste schöpferische Figur der Renaissance empfunden. Venturi tadelt an ihm die oberflächliche Art, das Leben zu betrachten[15]. Bei Raffael löse sich alles in (nur) Anmut auf, bei Grünewald werde sogar das Lächeln der Engel dramatisch, aus der fast unerträglichen Spannung zwischen Gott und Welt. Wertungen dieser Art mögen fragwürdig erscheinen. Sie sind jedoch symptomatisch für die Revision des verabsolutierten Werts des klassischen Kunstkanons auch in der italienischen Wissenschaft. Doch, wie gesagt, Italien hat am Ende der Hochrenaissance seinen Francesco Mazzola, bei dem sich keineswegs alles »in Anmut auflöst«. Diese Übergangsfigur an der Schwelle des Manierismus war sicherlich alles andere als eine idyllische Natur. Francesco wirkte in Parma, ging dann nach Rom, wo er – wie viele andere – von der dramatischen Laokoongruppe hingerissen wurde, die de Fredi 1506 in den Weinbergen über dem »Goldnen Haus« des Nero gefunden hatte. Der Sacco di Roma vertrieb ihn aus der Ewigen Stadt, er konnte rechtzeitig fliehen, und damit begann der letzte Teil seines kurzen, unruhigen Lebens: wieder Parma, dann Verona und Venedig. Aus Parma musste er heimlich verschwinden, weil er Schulden gemacht hatte, um alchimistische Experimente zu finanzieren. Was wollte er finden? Den Stein der Weisen – oder Gold? Streben nach materiellen Werten in der »Magie« der Zeit, oder Streben nach einem ideell wie materiell Absoluten? Man weiß es nicht genau, aber auch sein Denken wird erfüllt vom florentinischen Neuplatonismus und von der magischen Naturphilosophie. Darüber später. Aus dem vieldeutig liebenswürdigen Dandy [Max Ernst: »Dandy mit Gardenia« ], der eine ursprünglich im Auftrag Pietro Aretinos gemalte »Venus mit Cupido« für Clemens VII. in eine »Madonna mit der Rose« umänderte und dessen Atelier zu einem Treffpunkt der eleganten geistigen Welt geworden war, wurde allmählich ein »Wilder mit langem Bart und ungeordnetem Haar« (Vasari). Francesco wurde immer wunderlicher und verfiel schließlich in Trübsinn. Manche Kritiker glauben, das Porträt aus den Uffizien sei sein Selbstbildnis. Es könnte mit der Schilderung Vasaris übereinstimmen. Für einen so jungen Mann haben die Augen eine unheimlich bohrende Kraft. Der Schilderer seraphischer Schönheit hatte sich in einen von Dämonen Gehetzten, in einen von Phantasmen heimgesuchten Maudit verwandelt, d.h., diese Seite seines Wesens brach im Mannesalter – ohne Möglichkeit des Ausgleichs – hervor, denn sie war gewiss von Anfang an vorhanden. Aus der Subtilität wird Skurrilität. Die Größe liegt in der Tiefe des Zwiespalts [»Johannes der Täufer in der Wildnis«].
Problematische Naturen
Ähnlich spiegeln Porträts des toskanischen Frühmanierismus, vor allem diejenigen Bronzinos, den Menschentypus wider, der wache Reflexion mit passiver Verträumtheit verbindet, erotische Vieldeutigkeit mit intellektueller Melancholie.[16] Eine Galerie von »problematischen Naturen« bietet sich dar. Der elegante Narziss, den Caravaggio und so viele Zeitgenossen darstellten[17], leidet an jeder materiellen Wirklichkeit, der erotischen, sozialen, politischen, religiösen. Spiel, Rätsel, Anmut, Geheimnis bilden neben Magie und Hieroglyphik einen Ausgleich. Im Streben nach Geheimnis verführt die noch dominierende Verliebtheit in Anmut zu einer unmenschlichen Anmut, zu einer deformierten Anmut. Sie erhält erst bei Greco wieder ein religiöses Gegengewicht. Bei ihm, dem bedeutendsten aller Maler dieser Zeit, nach dem späten Michelangelo, gewinnt die Anmut (Charme) ihre Urbedeutung als Carmen , als Faszination wieder – in Verbindung mit einem genial-subjektiven Gefühl für die »schöne« Wirkung der Farben, der Linien und Flächen, und zwar in einem abstrakten Sinne. Doch dieses morbid Problematische, das Psychologische, ja Psychologistische dieser Kunst macht sie – außer ihren so bezeichnenden und wegweisenden Formexperimenten – so »modern«, so »voraussetzungslos« menschlich, so geistig ambivalent, so wichtig also für jede Epoche, die zwischen verbrauchten alten Tafeln und noch nicht klar verständlichen neuen Weltformeln steht. Marcel Proust liebte, wie man weiß, die frühen Manieristen. Zauberhafte Lyrismen in seinen Romanen sind ihnen verwandt wie Picassos »blaue Epoche« den Porträtskizzen Pontormos. Neuere »religiöse« Bilder Dalis, der sich vor einiger Zeit Werke Rossos in Florenz genau angesehen hat, stehen dem toskanischen Frühmanierismus so nahe wie Frühwerke Pontormos Stichen Dürers. Es fällt jedem jedoch rasch auf: Dalis neoreligiöse Anmut verbindet sich weniger dem Geheimnis als dem plakativ Augenfälligen. Rossos religiöse Bilder [»Kreuzigung«] haben etwas von der lyrischen Dunkelheit des provenzalischen trobar clus. Aus den entsprechenden Werken Dalis strömt die Kälte von Abziehbildern [S. Dali: »Kreuzigung«]. Um das schwermütige Dolce in besten Gemälden, Fresken und Zeichnungen der toskanischen Meister mit gewiss umstrittenen, aber gerade darum von ihnen geschätzten Analogien zu interpretieren, ohne also dem problematischen Verfahren einer wechselseitigen Erhellung der Künste« zu verfallen, könnte man Verse Verlaines zitieren. Auch die tragische Existenz, die Existenz ohne gültige überweltliche Antwort des Dichters der »Poèmes Saturniens« (1866) und der »Fêtes Galantes« (1869) ist mit biografischen Zügen der frühen toskanischen Manieristen vergleichbar.
3. Serpentinata–konvulsivisch
Die Raum-Ding-Relativität
Am Ende seines Romans »Nadja« schreibt André Breton, der Programmatiker des zeitgenössischen Surrealismus: »Die Schönheit wird konvulsivisch sein oder sie wird nicht sein«. Später in »L’Amour Fou« kommentiert er: »Die konvulsivische Schönheit wird verschleiert-erotisch, explosiv-starr, magisch-zufällig sein oder sie wird nicht sein«. Nicht das gestalthafte, geordnete »Humane« steht im Mittelpunkt des Konvexspiegel-Selbstporträts Parmigianinos, sondern ein überdimensionaler, »paranoischer« Teilaspekt des Menschlichen, die hybride, im »Serpentinata-Stil« bewegte, »konvulsivische« Riesenhand. Hinter der »Änigmatik« steckt der kunstvoll verschleierte, auf Eis gelegte, gewollte, verspielte Wahnsinn des Para-Logischen, Para-Statischen und Para-Rhetorischen.[18]
Die »Riesenhand« im Selbstporträt Parmigianinos entspricht einem ersten, fast noch kindlich-übereifrigen Wunsch, im Raum jeden Gegenstand hinsichtlich seiner Bewegungsverhältnisse zu relativieren, d. h. von seinen normalen Dimensionen zu befreien, je nach der Angespanntheit des subjektiven Ausdruckszwangs. Die tiefsten Einsichten über die Raum-Ding-Relativität dieser Art hat schon Leonardo gehabt, der, wie wir später sehen werden, mit einigen seiner Theorien und Experimente noch eine ganz andere Entwicklung im Manierismus einleitet. Im Faszikel III seines »Traktats von der Malerei« schreibt er zur »stetigen« und »unstetigen« Bewegung – unter Nr. 340 »Beispiel einer Hand in Bewegung«: »Jede stetige Größe ist bis ins Unendliche teilbar. Das Auge, das die Hand betrachtet und sich dabei von a nach b fortbewegt, durchmisst hiermit einen Raum a–b, der eine stetige Größe und infolgedessen ins Unendliche teilbar ist. Die Hand, die sich in dieser Weise bewegt, verändert ständig ihre Lage und ihr Aussehen. In diesen Bewegungen kann man ebenso viel Aspekte wie Teilbewegungen unterscheiden. Also gibt es in dieser Hand unendliche Aspekte, die keine Vorstellungskraft fassen kann. Das Gleiche wird geschehen, wenn die Hand, anstatt sich von a zu b zu senken, sich von b zu a erhebt.« Weiter schreibt er: »Unendlich verschieden sind also die Aspekte, die uns jede menschliche Handlung bietet.«[19]