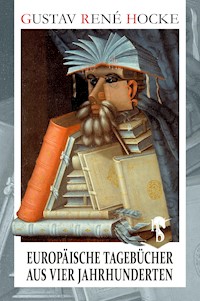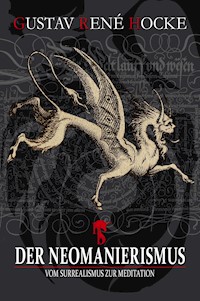19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die Lebenserinnerungen von Gustav René Hocke (1908–1984) sind ein besonderer Genuss nicht nur für Literatur- und Kunsthistoriker – spannend wie ein Roman schildert »Im Schatten des Leviathan« die Etappen seines wechselvollen Lebens. Die Kindheit in Brüssel, die Gräuel des Ersten Weltkriegs, die Jahre des Studiums in Berlin, Bonn und zuletzt Paris, in denen die Grundlage für seine tiefe humanistische Bildung gesetzt wird. Der Einstieg in die journalistische Karriere, die ihn in sein Traumland Italien versetzt, dann der Horror des Nazi-Faschismus und des Zweiten Weltkrieges, der ihn in ein Kriegsgefangenenlager in den USA verschlägt. Ein Neustart ins Leben kommt Anfang der 50er Jahre, als er in Rom seine Karriere als Auslandskorrespondent wieder aufnimmt, seine Tätigkeit als Schriftsteller weiterentwickelt und eine neue Familie gründet. Rom und Umgebung werden ihm von da an und bis zu seinem Lebensende zur Heimat. Fundamental bleibt in seinem Schaffen lebenslänglich die Idee einer liberalen und auf humanistischen Werten gegründeten Gesellschaft als einzige Möglichkeit, sich dem »Leviathan«, d. h. der Allmacht des Staates, zu widersetzen. Unzählige Personen begegnen ihm auf seinem Lebensweg: bekannte Schriftsteller, Künstler, prominente Politiker, Geistliche, sogar der Papst persönlich. Die daran gebundenen Erinnerungen fügen sich wie Mosaiksteine zu einem Gesamtbild zusammen: Ein wesentlicher Teil des 20. Jahrhunderts wird durch ihn als kritischen und warnenden Beobachter wieder lebendig.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1540
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Im Schatten des Leviathan
Lebenserinnerungen1908–1984
Herausgegeben und kommentiert von Detlef Haberland
Den Mitgliedern der Weißen Rose: Hans und Sophie Scholl, Christoph Probst, Alexander Schmorell, Willi Graf und Kurt Huber
Zu der Zeit wird der Herr heimsuchen mit seinem hartengroßen Schwert den Leviathan, die flüchtige Schlange, und den Leviathan,die gewundene Schlange, und wird den Drachen im Meere töten.
Jesaja, 27,1
Es sollen sie verfluchen, die einen Tag verfluchen können,und die da kundig sind, den Leviathan zu wecken!
Hiob, 3,8
Leviathan, das ist der Teufel, dessen Macht auf Erden niemand widerstehen kann, wie es im Buche Hiob heißt; von ihm wird gemeldet, dass er sich nicht mit dem Leibe begnüge, sondern auch den Seelen nachstelle, weshalb man auch mit ihm keinen Vertrag schließen kann. Das gilt für diejenigen, die glauben, sie hätten die geheimen Geister in ihrer Macht.
Jean Bodin, Daemonomania (1581)1
Unser Leben ist, wie das Ganze, in dem wir enthalten sind, auf eine unbegreifliche Weise aus Freiheit und Notwendigkeit zusammengesetzt.
Goethe, Dichtung und Wahrheit (1830)2
VORWORT
Niemand soll hier gerechtfertigt werden, erst recht nicht der Verfasser. Auch soll niemand angeklagt werden. Nicht immer hat es ein utopisches Gericht mit Irrenden, sondern viel häufiger mit dem Irrtum zu tun, mit anonymen psychischen Epidemien. Diese haben meist eine teuflisch-verbrecherische Bilanz. Ihr Irrgang ist von Millionen Opfern umzäunt. Dieser Leviathan ist zu entlarven. Dabei werden angeprangert die verführerischen Zerstörer unseres Jahrhunderts, die im Namen Leviathans, des »mythischen« totalen Staates, in ganz Europa das menschliche Leben im so »progressiven« 20. Jahrhundert vergiftet, die den moralischen Fortschritt gegenüber dem technischen erst gehemmt, dann unmöglich gemacht haben. Überall sucht man heute nach neuen »Denk-Modellen«, bleibt jedoch noch denjenigen des 19. Jahrhunderts verhaftet, wie Salme, die stets zu ihren Laichstellen zurückkehren.
Geschildert habe ich in diesen Erinnerungen aus persönlichem Erfahren und Erleben das Schicksal von fast zwei Generationen im Europa des 20. Jahrhunderts, die oft zu einer fast nur noch animalischen Selbstbehauptung gezwungen worden sind. Dabei berücksichtigte ich vor allem Tatsachen, die ich seit Jahren in meinen Tagebüchern aufgezeichnet habe; Texte, die ich – nach aller Bombensintflut – wie durch ein Wunder retten konnte.
Ohne Schuldgefühl oder ohne Reue bleibt jedenfalls jede Autobiographie flach, vordergründig. Insofern muss auch Selbstkritik maßgebend bleiben, und zwar nicht nur für Christen. Auch Atheisten bleiben ohne ständiges Examen de conscience menschlich fragwürdig.
In diesem Lebensbericht – von 1908 bis 1984 – überwiegen keineswegs Reflexionen. In Darstellungen zahlreicher persönlicher Begegnungen und Gespräche in Europa, Amerika und Asien werden ferner keineswegs nur »Hintergründe« eines politischen und kulturellen Geschehens von rund sieben Jahrzehnten sichtbar gemacht. Im Mittelpunkt steht ein individuelles, ja subjektives Leben mit seinem vielfach verwickelten Schicksal. Doch wird auch dieses »Persönliche« nicht als ein etwa besonderes Selbstsein angesehen. Es dient stets, ja vor allem, der Charakterisierung anderer Personen, mit denen ich in näherer oder lockerer Weise verbunden war. Dabei blieben immer Facts maßgebend, dokumentarisch nachweisbare Ereignisse, Zusammentreffen, Auseinandersetzungen, Entscheidungen, Folgerungen. Die erzählerische Form schließt also jede Art von Fiction aus, wenn auch nicht von – gesondert abgehobenen – kurzen Kommentaren. Eine Biographie romancée wurde bewusst vermieden.
Dem journalistischen Beruf und den schriftstellerischen Neigungen des Verfassers entsprechend soll nicht nur Politik »im Schatten des Leviathan« während eines jetzt schon fast hundertjährigen Krieges in manchen Hintergründen offenbar gemacht werden. Wie kann ein Individuum sich in einer vom »Leviathan« unterdrückten Gesellschaft mit einer auch bescheidenen Subjektivität bewähren, wie sein Selbst-Sein erhalten und vervollkommnen? Wie wirken sich die Spannungen von Subjekt und leviathanischem Staat in der Kunst, Dichtung, Musik, Philosophie, Religion und Publizistik aus? Auch diese Fragen werden im Zusammenhang mit eigenen Erlebnissen beantwortet, wobei der Schicksalspartner mir oft wichtiger erschien als ich selbst. Eine solche Art biographischer Geschichtsschreibung weist stets auf das Rätsel Mensch hin, auf das schwer zu ergründende, aber gerade und vor allem zu rettende Subjektive. Das gehört auch zu den wichtigsten Themen meiner anderen Bücher.
Außerdem ergab sich zwangsläufig so etwas wie ein Fresko über die Lebensgeschichte einiger europäischer Familien im »Schatten des Leviathan«. Auch Schicksale dieser Art gelten für viele andere. Ob ihre Leiden oder ihre Freuden, ihre Hoffnungen oder ihr Scheitern, ihre Selbstbehauptung oder ihr Untergang einen historischen oder metaphysischen Sinn gehabt haben; ob sie notwendig waren oder ob sie bloß barbarischen Zufälligkeiten in einer nun immer fragwürdigeren Menschheitsentwicklung entsprechen, das werden spätere Historiker, Philosophen und Theologen besser zu beurteilen vermögen als wir heute.
Dennoch könnte dieser Text dazu beitragen, den stets auf gleiche Weise Irrenden zu mahnen und den Irrtum fluchwürdig erscheinen zu lassen. Freiheit, Wahrheit, Gerechtigkeit, im alttestamentarischen Sinne, aber auch Leiden, Versagen und Erlösungsgewissheit christlicher oder buddhistischer Art sind unteilbar! Zumindest soll verständlich gemacht werden, dass das Individuum, das ebenfalls unteilbare Subjekt, erfahrend, wissend und urteilend, nicht wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, biologischen, etatistischen und religiösen Determinationen unterliegt, ohne von diesen Faktoren einseitig geprägt zu werden.
Wird er, der jetzt wirklich freie, subjektive Mensch – wie der große Historiker Arnold Toynbee meint – sozusagen von sich aus und durch sich selber den weiteren Gang der Geschichte bestimmen? Freilich stets um die Einwirkungen von außen wissend, aber sie im Bewusstsein organisierend und selbst leitend? Ohne sich dabei dem Überrealen des göttlichen Logos zu verschließen? Kann durch eine neue Zuversicht, die heute so manchen wieder beflügelt, ein Scheitern der Menschheit gleichsam in letzter Stunde verhindert werden?
Wir brauchen sicher neue Denkmodelle für die Zukunft! Ich hoffe, dazu nicht nur existentiell-private Anregungen gegeben zu haben, denn welchen Wert könnten Erinnerungen haben, wenn eine solche öffentlich gemachte Sammlung von Vergangenem sich nicht auf die Zukunft zu beziehen vermöchte! Licht und Schatten im Erleben von zwei Generationen sollen in einem eben vorwiegend persönlichen Bereich in Kontraste gebracht werden, die sich – auf die Zukunft hin – ausgleichen könnten. Vor dem Massen-Atomtod kann nur die von der schöpferischen Phantasie beflügelte und vom kritischen Realismus gelenkte Vernunft retten. Somit hoffe ich, vor allem der jungen Generation einiges Anregende gesagt zu haben, der neuen Generation, die das 21. Jahrhundert besser zu verwalten hätte als ihre Vorgänger das 20., von dem ich, jetzt mehr inaktuellen Meditationen ergeben, gerne Abschied nehme.
Dieser Text wurde mit Unterbrechungen von 1969 bis 1984 geschrieben.
Gustav René Hocke
Genzano di Roma
Herbst 1984
I. ERSTE KINDHEIT
Idyll im Atelier – Feuer über Brüssel 1908 bis 1918
Anno Domini 1908 war Brüssel eine blühende Handelsstadt, Mittelpunkt eines bereits umstrittenen Kolonialreichs, vielsprachiges Zentrum eines behaglichen, vor allem kulinarischen Glücks. Das Zentrum wetteiferte, was Theater, Restaurants und Dancings angeht, mit der prächtigeren Ville lumière, mit Paris. Doch zogen manche Deutsche und Engländer die kleinere Kapitale des erst 1830 entstandenen belgischen Einheitsstaates vor. Auch geistige Anregungen gab es, was auch Baudelaire über das Brüssel seiner Zeit gesagt haben mochte. Die Oper, an der Place de la Monnaie, unweit der berühmten spätgotischen Grand Place und der Börse, im pseudo-griechischen Stil gebaut, erhielt auch internationales Lob. Manche Dichter, wie Verhaeren, waren weit über die Grenzen des kleinen Landes hinaus bekannt. Der deutsche Schriftsteller Wilhelm Hausenstein schrieb einmal, dass Brüssel, ein mixtum compositum von französischer Eleganz, flämischer Vitalität und wallonischem Scharfsinn, einem surrealistischen Gebilde gleiche, einem objet surrealiste; »hier ist ein Zirkel quadriert; hier ist eine Dialektik gelungen.«1
Als ich dort, sonntags um 12 Uhr, beim Glockenklang, am 1. März 1908 im Zeichen der Fische und mit dem Aszendenten in den Zwillingen geboren wurde, konnte ich natürlich nicht ahnen, dass diese inzwischen zum Teil arg verbaute Stadt, nach tragischen Wirrsalen unter den Völkern Europas, die provisorische Hauptstadt eines vorerst nur wirtschaftlich geeinten Europa werden sollte. Doch klang der europäische Akkord schon bei meiner Geburt mit.
Mein Vater Josef Hocke war ein deutscher Kaufmann und Kunsthandwerker (in Ledersachen)2. Er stammte aus Viersen (Rheinland), doch war sein Vater zu Leitmeritz in Böhmen geboren worden. Meine Mutter3 war die Tochter des belgischen Hofmalers Gustave de Nève4, dessen Großvater wiederum Franzose gewesen war. Meine Großmutter mütterlicherseits stammte aber aus Trier, wo sie, gegenüber der römischen Porta Nigra, als Tochter eines Bäckermeisters das Licht der Welt erblickt hatte5. Der Bruder meiner Mutter, Émile, war ein erfolgreicher Architekt. Er gehörte zu den Frankophonen Brüssels, wie auch mein Großvater. Flämisch sprach man aber auch. Der damaligen französischen Schicht Brüssels waren »völkische« Probleme noch fremd. Man lebte und dachte gleichsam auf natürliche Weise europäisch. Außer französisch sprachen viele auch deutsch und englisch. Literatur und Bücher kannten keine Grenzen. Die großväterliche Familie war auf die Oberstadt ausgerichtet, auf die Rue Royale, die Rue Ducale und die Rue du Trône. Dort herrschten ein sanfter Klassizismus und, wie Wilhelm Hausenstein in seinem geistreichen Essay über Brüssel schrieb, »stille und schlichte Noblesse« vor. »Es überwogen Takt und Mäßigung«6. Doch hatte mein Großvater, als Maler, seine Fühler auch stets nach der eher flämischen Unterstadt ausgestreckt, nach einer elementar widersprüchlichen Welt des Absurden, von der Hausenstein schreibt, es sei »nirgends in so beirrender Art zu Hause wie in Brüssel«. Und er fügte hinzu: »Brüssel ist auf das Chimärische objektiv angewiesen; es gehört zu der Lebensordnung, die Belgien, die Brüssel heißt; es gehört metaphysisch zu dieser Welt, zu dieser Stadt.7« So wuchs ich, gleichsam ab ovo in einer dramatischen Dialektik von Klassik und Manierismus auf. Ich lernte früh sehen und verstehen: gerade das Abstruse, das kühn Zusammengesetzte, das Gesetz in anscheinender Willkür.
Die ersten fünf Lebensjahre lebte ich in angenehmen wirtschaftlichen Umständen. Mein Vater hatte ein geräumiges Geschäft für Lederwaren an einem der Haupt-Boulevards von Brüssel. Es ging ihm vorzüglich, denn er hatte einige eigene Patente gut verkaufen können. Bald kamen aber die ersten wirtschaftlichen Rückschläge, die nur noch wenige Auslandsdeutsche verschonten. Im Jahre 1913 musste er das allzu prunkvolle Geschäft schließen. Wir zogen in eine bescheidene Wohnung von Alt-Brüssel. Mein Vater kehrte zu seinem geschickten Kürschner-Handwerk zurück. An diese Lebensumstände erinnere ich mich noch aus besonderem Grunde.
Mein Vater hatte als Dragoner in Darmstadt gedient. Nationalist war er gewiss nicht, doch hatte er eine Schwäche für ebenso farbenreiches wie zuverlässiges militärisches Wesen. Das verleitete ihn dazu, mir und meinem ein Jahr jüngeren Bruder Willy8 aus Deutschland Spielzeug-Uniformen (mit Pickelhauben) schicken zu lassen. Derart verkleidet, wurden wir im Sommer 1914, als die Kriegswolken immer düsterer wurden, zum Spielen auf einen Platz in der Nähe unserer Wohnung geschickt. Kein Wunder, dass die besonders lebhaften gamins9 von Brüssel uns immer aggressiver als sales boches10 beschimpften. Wir reagierten mit dem für sie doppelten Schimpfwort »dreckige Franzosen«. So brach der entsetzliche Krieg von 1914 schon vor seinem Ausbruch zwischen uns und unseren Spielgefährten aus.
Generalmobilmachung Anfang August 1914! An diesen Tag erinnere ich mich heute noch, als sei er gestern gewesen. Mein Vater packte seinen Koffer, um sich in Köln zu melden, wo er sofort eingezogen und als Artillerist an die Front geschickt wurde. Weinend sammelte meine Mutter unsere Habseligkeiten und floh – durch das höchst erregte Zentrum – mit uns zu ihren Eltern in den Vorort Schaarbeek, in die Rue Josse Impens 103, in der Nähe der Place des Bienfaiteurs und des Parc Josaphat.
Dort hatte mein Großvater Gustave de Nève ein stattliches Haus. Die obere Etage nahm sein Maler-Atelier, sechs Meter hoch, ein. In dieser Umwelt habe ich die zweite Stufe meiner Kindheit erlebt: unter dem Geruch von frisch geöffneten Farbtuben, von Fresken und Tafelbildern, unter dem herben Duft eben zugespitzter Bleistifte, im Anblick mancher malerischer Werke in progress und vieler Bücher in verstaubten Regalen. Mein Großvater war, so könnte man sagen, ein Schüler, zumindest ein Anhänger Courbets, doch mehr noch des holländischen Realismus. Er stellte sich nicht als ein »großer Meister« vor, doch war seine handwerkliche Technik verblüffend. Gerade das bewunderte ich damals am meisten – wie die Handfertigkeiten meines Vaters.
Doch dieses zweite Idyll wurde schlimm gestört. Nach dem Ausbruch des Krieges kam es auch über Brüssel zu den ersten Luftkämpfen. Eines Abends saßen wir alle, mein Großvater, meine Großmutter, meine Mutter, mein Bruder Willy und ich, verängstigt im Garten, als plötzlich ein gewaltiger Feuerschein den Himmel erleuchtete. Ein deutscher Zeppelin war abgeschossen worden. Unsere Umwelt sah plötzlich teuflisch aus. So hatte ich schon 1914, sechs Jahre alt, meine erste Begegnung mit dem moralisch blinden Leviathan.
***
Kurz danach zogen deutsche Truppen in Brüssel ein. Mein Großvater, ein liberaler Pazifist, der auf die »Preußen« nicht gut zu sprechen war, wurde kreidebleich, als er es erfuhr. Doch wollte er bei diesem Einmarsch dabei sein, und er nahm auch mich mit, weil ich – wahrscheinlich – diesen allerdings schändlichen Einbruch in ein kleines, wehrloses und neutrales Land nie vergessen sollte. Wie hätte ich dieses Erlebnis unterdrücken können, nachdem es bald danach ein zweites Mal geschah! Inzwischen war der Bruder meiner Mutter, Émile, auch Frontkämpfer in der belgischen Armee, während mein Vater, wie gesagt, auf deutscher Seite irgendwo Mordgeräte des kaiserlichen Heeres zu bedienen hatte. Für ein Kind schwer zu verstehen!
So standen mein Großvater und ich also am Ende der Landstraße Löwen-Brüssel und sahen uns den allzu leichten triumphalen Einzug deutscher Truppen in meine französisch-flandrisch-wallonisch-deutsche Heimat an. Ein Herr sprach meinen Großvater an und fragte ihn nach der Zeit. Er antwortete, die Deutschen würden von Minute zu Minute erwartet. Großvater stieß für mich unverständliche Laute aus. Er schwankte. Ich stützte ihn, auch wenn er damals noch jung war.
Dann trafen die Eindringlinge endlich ein: Kürassiere mit bewimpelten Lanzen auf den Steigbügeln. Forsche Männer, blendende Uniformen, hohe glänzende schwarze Stiefel. Sie blickten stolz auf die feindselige Menge hinab. Ich dachte: »So muss Vater jetzt aussehen.« Da scheute plötzlich ein Pferd. Die Zuschauer verloren die Fassung. Ich wurde zu Boden geschleudert. Mein Großvater rettete mich vor dem Getrampel weiterer aus der Reihe springender Pferde und trug mich, da ich fast bewusstlos war, nach Hause zurück.
***
Nun, es wurde bald friedlicher, weil Belgien zu einem Etappengebiet geworden war. Mein Vater hatte auf die »Deutsch-Angehörigkeit« meiner Mutter bestanden, und da sie ihn liebte, sagte sie ihm ein entsprechendes Verhalten zu. Sie wurde im Brüsseler Hauptpostamt in der Zensurbehörde für Briefe angestellt. Mein Bruder und ich wurden der Deutschen Schule in Brüssel anvertraut, die, früher einmal von guter Art, jetzt in jedes Fach, auch in die bürgerlichen Rechnungsarten, Lobeshymnen auf den großen »Feldherrn« Wilhelm II. einschmuggelte. Doch gab es ein paar Lehrer, die auf geradezu magische Art und Weise deutsche Gedichte und Märchen vortragen konnten. Ich verliebte mich, trotz dieser für mich noch nicht ganz verständlichen Ereignisse, in die deutsche Sprache. Sie klang mir wohler und tiefer als das Französische, das wir zu Hause fast nur redeten. Die deutsche Sprache kam mir vor wie ein außerordentlich verflochtenes Traumgebilde, wie rätselhafte Musik, wie Grundtöne aus den Welten der Märchen; trotz allem Bangen, trotz allem Zorn.
Doch konnte auch das zweite Kindheits-Idyll, bei aller Umhegung, auch auf die Dauer nicht unverdorben bleiben. Täglich führte mich mein Schulweg an dem Vorort-Bahnhof von Schaarbeek vorbei. Auf dem Bahnsteig, den man einsehen konnte, wurden Verwundete von der Front in Nordfrankreich ausgeladen. Manche Verbände waren blutüberströmt. Ich schaute fassungslos zu, auf dieses gequälte Fleisch von Hunderten, die den Zügen entstiegen wie Lemuren. Einige brüllten vor Schmerzen. Einmal wurde mir übel.
Dabei waren diese Transporte von Amputierten und Blinden, von zerfetzten und zerrissenen Körpern nicht einmal das Schlimmste, denn ich gehörte nicht zu den gerade verzärtelten Kindern. Was mich besonders beeindruckte, war die gespenstische Stille dieses horrenden Vorgangs – außer dem gelegentlichen Brüllen –, die kalte Vorzüglichkeit der Organisation, die Sachlichkeit der Sanitäter, die diese blutenden Körper abschleppten wie beschädigte Ware in eine Reparaturwerkstatt. An diesen Tagen lernte ich den Krieg hassen, in den tiefsten Gründen meiner Seele.
***
Im Hause meines Großvaters hingegen, fern von solchen Szenen, erlebte ich bis 1918 die vielleicht schönste Zeit meines Lebens. Nach der Schule durfte ich in seinem Atelier sitzen und ihm beim Malen zuschauen. Trotz seines Kummers über die Leiden seines Landes sang er gern, die Palette in der Hand, wenn eine Farbenmischung ihm besonders gut gelungen erschien. Ich folgte gespannt jeder Nuance, denn er hatte mich schon unterrichtet, wie man perspektivisch zeichnen und das so vielfältige Grün zum Beispiel richtig voneinander abstufen kann. Wenn ich des Zuschauens müde wurde, blätterte ich in den vielen Kunstbüchern und Zeitschriften, die er in seinem Atelier gesammelt hatte. In dieser frühen Umwelt entstand meine Liebe, ja, meine Leidenschaft für Kunst und Literatur, ja auch für die Musik, denn mein Großvater sang zum Beispiel mit ganz guter Stimme die bekanntesten Arien vieler Opern.
Auch Photos seiner Werke blätterte ich neugierig durch. Von 1904 bis 1907 hatte er für den mächtigen Bauunternehmer Dupont die Räume der ersten Automobilausstellung im Cinquantenaire-Park von Brüssel mit pompösen Fresken ausgestattet. Die wichtigsten Dekorationsgemälde für die Säle der Brüsseler Weltausstellung von 1910 hatte er ebenfalls geleistet, unter enormem Aufwand an Kraft, Personal, Mitteln. Auch heute kann man in manchen Palästen, Privathäusern, Hotels usw. nicht nur solchen Monumental-Fresken, meist im Jugendstil, begegnen, sondern viel besseren Tafelbildern. Sie bekunden einen einfacheren, recht poetischen Stil, in dem sich, wie gesagt, Anregungen der holländischen Realisten mit dem Naturalismus der Franzosen nach 1870 verbanden. Den Anschluss an die moderne Kunst hat mein Großvater nie gefunden. Leider lachte er über sie. Er blieb dem alten Prinzip treu, dass ein Vogel Trauben, die er malte, als appetitanregend empfinden und mit dem Schnabel gierig in Angriff nehmen müsse. So hat jeder seine Grenzen; mein Großvater wurde durch einen zu bürgerlichen Rationalismus eingeengt. Vor den »Chimären« der Phantasie hatte er wohl Angst … wie vor den Preußen, trotz Brueghel und Bosch.
Von eher kleinem Körperwuchs, war mein Großvater schlank und drahtig. Sein Schnurrbart sträubte sich, auch wenn er Grund zur Heiterkeit hatte. Seine Augen konnten blitzen wie gewisse unruhig erscheinende Fixsterne. Spätnachmittags trug er ein Bild, an dem er arbeitete, in den Salon hinunter, der, auch das sei nicht vergessen, mit Veduten Alt-Roms ausgestattet war, setzte sich davor, zündete seine Pfeife an und sah es sich stumm an, so lange, bis wir uns zu räuspern wagten. Ich ahnte, wie genau, wie selbstkritisch er arbeitete! So wurde er mir – wie mein Vater mit seinem Kürschner-Handwerk, was Sorgfältigkeit der Planung und Ausführung angeht – ein Vorbild.
Doch verdanke ich meinem Großvater noch viel mehr. Wenn er sich an irgendwelchen seiner entstehenden Werkchen müde gesehen hatte, las er uns vor: Märchen von Perrault und Grimm, Fabeln von La Fontaine, Fénelons Télémaque, ein Buch, das ich heute noch gerne lese; aber auch Onkel Toms Hütte und Melvilles Moby Dick. Ich verstand nicht alles, doch gelang es meinem Großvater, auch wenn er ein ultraliberaler Rationalist und Atheist war, dem Leben jeder Art seine Atmosphäre von Geheimnis zu lassen. Er zauberte und verzauberte, auch in seinem kleinen Garten, der zum schönsten unseres Stadtviertels gehörte. Auch die Liebe zu Blumen und Pflanzen aller Art habe ich von ihm geerbt.
Freilich begnügte ich mich nicht mit so »edler« Lektüre. Ich kaufte mir von meinem Taschengeld ganze Stapel von Groschenheften, von meinem Großvater streng verboten, Geschichten über Buffalo Bill, Romane von Eugène Sue über die »Geheimnisse von Paris«, Schauergeschichten von Arsène Lupin11 und Ähnliches, was damals Mode war. Die allerersten Chaplin-Filme begeisterten mich in Miniatur-Kinos, vor deren Pforten noch Klingeln zum Besuch einluden. So erlebte ich auch in dieser Hinsicht typische »Brüsseler Gegensätze«, die mich später, ganz gewiss, vor ästhetischen und ideologischen Verengungen bewahrt haben. Freilich faszinierten mich am meisten Verse von Racine, La Fontaine und Goethe. Wäre ich, in der Tiefe meines Herzens, kein Anhänger der »Klassik« gewesen, hätte ich den »Manierismus« wohl nie verstehen können, das heißt in dieser Umwelt stets doppelt angeregt. »Nourri dans le sérail, j’en connais les détours«.12
Gewiss, in manchen Labyrinthen also wuchs ich bereits auf, begriff jedoch damals gewiss nicht alle ihre Umwege. Meine Mutter Anna de Nève, die wirklich schön war wie ein Engel auf einem Bilde von Rubens, sorgte auch für eine religiöse Erziehung. Sie hatte grüne Augen, kupferfarbenes Haar, eine zierliche Gestalt; sie konnte, bei aller Trauer über den abwesenden Mann, oft so herzlich lachen, dass ich es hören konnte … bis oben in das großväterliche Atelier. Ihre hübschen Kleider schneiderte sie selber. Sie aß gerne gut, vor allem Austern und Langusten. Doch rauchte und trank sie nicht. Sie ist ganz gewiss, während dieses vierjährigen Ersten Weltkriegs, ihrem deutschen Artilleristen in Russland treu geblieben. Kraft zu dieser durchaus tugendhaften Selbstbehauptung nahm sie zweifellos aus der Religion.
Bei allen atheistisch-aufklärerischen Neigungen meines Großvaters waren mein Bruder Willy und ich in der imposanten katholischen Marien-Kirche Brüssels, in Sainte-Marie, getauft worden. Meine Mutter legte Wert auf eine zumindest moralisch bestimmte religiöse Bildung, wie übrigens auch meine belgische Großmutter Susanne de Nève geb. Becker, wie gesagt eine deutsche Bäckerstochter aus Trier. Religion hieß für meine Mutter vor allem Verehrung und Kult der Madonna. Im Übrigen war ihre Frömmigkeit frei von Pharisäismus, servilem Kirchenglauben und Prüderie. Ich wuchs also in einem weltoffenen, weltaufgeschlossenen Katholizismus auf, was bemerkenswert ist, weil Brüssel wenigstens damals als eine der katholischsten Städte der Welt angesehen werden konnte. Anlässlich zu pathetischer Schwärmerei für die Gottesmutter sorgte in unserer Familie allerdings Großvater Gustave mit einem an Voltaire geschulten Sarkasmus für Ausgleich.
Dennoch blieb mir, von damals her, eine Neigung, bis heute, gerade über die Mysterien der Gottesmutter und der Dreifaltigkeit nachzugrübeln. Warum gab es nicht eine »Vier-Faltigkeit«, in die die »Mutter« Gottes eingeschlossen wurde? Dann, natürlich viel später, besonders in Italien, forschte ich nach den religionsgeschichtlichen Zusammenhängen der Magna Mater in Mittelmeer-Kulturen. Stätten der Madonnenkulte habe ich in Europa und anderswo besucht. Über sozusagen persönliche Beziehungen zur Madonna werden wir später noch hören.
Ich bin stets für eine vor allem »soziologische« Aufklärung eingetreten, habe kirchliche Missstände kritisiert, habe aber nicht zu begreifen vermocht, dass man Gott mit Kirche verwechselt, konventionelles Christentum mit der Lehre Christi und jede Religion nur als Ideologie einer Kaste von wirtschaftlichen und klerikalen Machthabern ansehen und definieren konnte. Welche geistige Armut! Wie wahr ist das Wort Hamanns: »Alles, was der Mensch zu leisten unternimmt, es werde nun durch Tat oder Wort oder sonst hervorgebracht, muss aus sämtlichen vereinigten Kräften entspringen; alles Vereinzelte ist verwerflich.«13 Ist der Glaube an ein oder an viele Mysterien nicht auch eine den Menschen entscheidend konstituierende Kraft, wie sehr man ihm auch skeptisch auf den Grund kommen mag?! Auch hier zeichnete sich ein Lebensthema ab.
***
Ohne väterliche Aufsicht, oder aus welchen Gründen auch immer, wurde ich freilich nicht das, was man einen »Primus« oder »Musterknaben« nennt. Im Gegenteil. Mit meinem Bruder machte ich »Kreuzfahrten« durch Brüssel, wobei wir uns, um das Fahrgeld zu sparen, hinten an den Straßenbahnen anklammerten. Wir fischten am Kanal von Hal, beschnupperten gratis die Blumen an der uns immer wieder anziehenden, so heiter gotischen und so selbstzufrieden barocken Grand Place. Wir beobachteten hektische Jobber in der bourse, unweit vom Boulevard Anspach, wir sammelten Kastanien im Bois de la Cambre und gründeten eine kleine Bande von Steinwerfern, die in unserem Stadtviertel einer anderen Gang dieser Art oft mit böser Wut begegnete. Offenbar hatten sich meine pazifistischen Überzeugungen noch nicht folgerichtig in die Praxis umgesetzt. Bis zur Sublimierung ist es ein weiter Weg.
Auf meinen Stadtfahrten liebte ich an manchen privaten und öffentlichen Bauten Brüssels einen, im Europa dieser Zeit besonders wilden Jugendstil, dessen geradezu zügelloser »manieristischer« Charakter beispiellos war; erst später habe ich ihn genauer verstanden und richtig – in dieser Weise – werten können. Der extrem individualistische Baugeschmack von mehr oder weniger vermögenden Honoratioren ging von dem Prinzip aus: chacun à sa manière. So wurde Brüssel, u. a. dank des genialen Architekten Victor Horta14, bald »Capitale de l’Art Nouveau« genannt. Es handelte sich nicht nur um angeberische, subjektivistische Willkür, sondern auch um Embleme des Fortschritts, denn progressiv wollte jeder sein, wenigstens im Stil seiner Hausfassade. Auch an futurologischen Entwürfen fehlte es nicht.
Brüssel hatte sich tatsächlich damals schon zum Zentrum einer »Freien Ästhetik« entwickelt. Das damalige Alt-Europa regte es zu einer ersten modernen Kunst an. Bevor sie in anderen Hauptstädten berühmt wurden, konnten in Brüssel früh Künstler anerkannt werden wie Rodin, Whistler und Liebermann (1884); Renoir, Monet und Redon (1886); Seurat, Pissarro und Morisot (1887); Toulouse-Lautrec und Signac (1888); Gauguin (1889); Cézanne und van Gogh (1890), Walter Crane, Larsson, Filiger und Chéret (1891). In Brüssel wurde der klassizistische Palladianismus zum ersten Mal systematisch in Frage gestellt. Anti-Symmetrie galt als Ausdruck der Freiheit! Um 1900 wurde der sogenannte »Art Nouveau«, mit den Architekten Blérot und Strauven zum Beispiel15, »flamboyant«, das heißt ultramanieristisch, also in »folle manière«, manieriert. Die Dialektik herrschte vor: Pieter Brueghel und Louis XVI. Ich nahm das natürlich nur unbewusst – mit den Augen – auf, aber Erinnerungen an diese frühe Umwelt haben meine späteren Manierismus-Studien entscheidend beeinflusst.16
***
Dann kam mein Vater endlich auf Urlaub. Er trug eine »schmucke« Uniform, eine Pickelhaube und einen umständlich langen Säbel. Doch wirkte er auf mich nicht gerade wie ein Held. Er war dem ersten Grauen, auch er, kritisch begegnet. Still und ernst, betroffen und skeptisch, kam er mir vor, er, der mir so gerne Bleisoldaten geschenkt hatte. Auch später, wenn er uns besuchte, wobei die Nachbarn argwöhnisch zuschauten, erschien er mir eher wie ein Vorbote des Versagens als des Sieges.
Bald –1917 – meldete sich der Hunger an. Meine Großmutter, die unermüdlich in Küche und Garten bemüht war, kaufte in Eimern Blut im Schlachthof und machte daraus, mit schlechtem Mehl, sogenannte Pfannkuchen. Die Preise stiegen. Meine Mutter musste im Brüsseler Postamt, um meist harmlose Briefe zu zensieren, Überstunden machen. Bald litt sie unter Herzschwäche.
Doch erlöste ich mich von diesem fortschreitenden Elend nicht nur durch immer abenteuerlichere Fahrten in der Umgebung Brüssels, in den dichten Wäldern – bis nach Waterloo hin. Eine allererste Verliebtheit kam hinzu. Violette, ihrer veilchenblauen Augen wegen, war unsere Nachbarin. Wir »liebten« uns. Wir spielten Vater und Mutter. Damals fühlte ich mich zum ersten Mal als Mann und Kavalier. In den Treibhäusern des Jardin Botanique küssten wir uns, in aller Unschuld die Großen nachahmend. Niemand schaute sich nach uns um. Man fühlte sich frei, frei auch von lästiger Neugierde und von provinziellem Naserümpfen. »Laisser aller: et en s’en fiche de la commandature«, hieß die Kriegsdevise.17
Später wurde mir dieses Brüsseler Freiheitsklima, anlässlich häufiger Besuche zwischen den beiden Weltkriegen, bewusster. Belgien hat eine wahrhaft freie Verfassung. Auszüge daraus kann man, unweit der Place des Martyrs, auf der sogenannten Kongresssäule lesen. Zu den stolzesten Früchten der Revolution von 1830 gehören Glaubens-, Presse-, Vereins- und Lehrfreiheit. Klaus Besser schrieb 1970 über Brüssel, es sei »die europäischste Stadt Europas«. »Brüssel ist im Lauf seiner Geschichte von vielen Nationen beherrscht worden, bevor es nach der Revolution von 1830 Belgiens Hauptstadt wurde. Spanier, Österreicher, Franzosen, Deutsche haben ihre Spuren hinterlassen. In Brüssel kreuzen sich französische und spanische Kultureinflüsse mit flämischen und englischen. Nirgendwo ist ein Ausländer so wenig Fremder wie hier. Es gibt einen Brüsseler way of life, aber er ist diskret, unaufdringlich, tolerant. Chauvinismus ist hier unbekannt. Nationalstolz im französischen oder englischen Sinne gibt es nicht. Dafür ist man zu stolz auf seine Freiheiten und auf seine Toleranz.«18 Eine würdigere Hauptstadt konnte sich das vorerst nur wirtschaftlich integrierte Europa fürwahr nicht aussuchen.
***
Zumindest mit der Toleranz hörte es allerdings 1918 auf, und zwar den Deutschen gegenüber, als der Zusammenbruch der Mittelmächte immer augenscheinlicher wurde. Wer hätte es den so nachsichtigen Brüsselern übel nehmen können, nachdem ihre Souveränität ohne jeden rechtlichen Anlass von Wilhelm II. und seinen Beratern so brutal verletzt worden war! Gerade das kränkte den Rechtssinn der Einwohner dieser noch nicht hundertjährigen Hauptstadt! Hatten sie sich nicht den größten Justiz-Palast der Welt gebaut, größer als den Petersdom, 150 Meter hoch, auf einer Fläche von 26.000 m²? »Damit wollte man dokumentieren«, schreibt Besser, »dass in Belgien das Recht mehr gilt als Kirche, Staat oder Militär.«19 Not und Hunger waren vom damaligen deutschen Imperialismus, allerdings eng verwandt dem einstigen englischen, französischen und auch belgischen, einer Stadt aufgezwungen worden, die neben dem Gelten-Lassen jeder Individualität und Meinung das Essen so liebte, dass kulinarische Künste dort bald als besser galten als in Paris oder in Florenz. Ich erinnere mich an eine Reklame im Straßenbahnwagen 72 vom Nordbahnhof nach Schaarbeek. Man sah eine Matratze. Darunter stand zu lesen: »Höhepunkt des Daseins«. Sicher kann man sagen, dass auch Belgien sich imperialistisch und kolonialistisch, jedoch nicht nationalistisch verhalten hat, oft in höchst unmoralischer Weise (Kongo!). Doch kann man diesem Lande, das mehr vom Segen des Glücks als des Leidens hält, nicht vorwerfen, es habe Leviathan nicht stets unter Kontrolle gehalten, in oft dramatischen, aber stets folgerichtigen Auseinandersetzungen.
***
Wir spürten im Herbst 1918 selbst im großväterlichen Hause die wachsende Abneigung und Rebellion, auch wenn ich dies alles erst später von meiner Mutter erfuhr. Mein Großvater hatte Schwierigkeiten mit den Nachbarn, als mein Vater zum letzten Mal im September 1918 nach Brüssel auf Urlaub kam. Man mied ihn. Meine Mutter wurde gelegentlich auf der Straße beschimpft, und meiner – ebenfalls deutschen – Großmutter ging es nicht anders. Mein Großvater blieb allerdings standfest, auch wenn er sogar geschäftliche Verluste erleiden musste. Wir standen in seiner Obhut. Das wollte er durch niemand verändert sehen. Doch nahm das böse Abenteuer des neuen Leviathan seinen Lauf. Es näherte sich der Waffenstillstand vom November 1918. Auf seinem letzten Urlaub in Brüssel hatte mein Vater, der sich über den Kriegsausgang keine Illusionen machte, mit den Worten Abschied genommen: »Auf Wiedersehen in Deutschland, im Rheinland, in Viersen.« Dort, in seiner Geburtsstadt, wohnte eine Schwester von ihm.
Anfang November war es vorbei. Das wie auch immer beschattete Kindheitsidyll nahm ein dramatisches Ende. Meine Mutter wurde mit uns beiden Kindern 24 Stunden nach Verkündigung des Waffenstillstands ausgewiesen. Viel konnte sie nicht mitnehmen. Im Nordbahnhof von Brüssel wurden wir nachts, noch unter deutschem Polizeischutz, in einen Zug Richtung Aachen hineingepresst. Er war beladen wie ein Bild von Brueghel mit den unwahrscheinlichsten Gestalten: zerlumpte Soldaten, Offiziere ohne Rangabzeichen, Verwundete, Krankenschwestern, Zivilisten, darunter viele Frauen, Kinder und Greise, sogar Hunde und Kanarienvögel. Auf den Dächern der Waggons hockten Hunderte junger Soldaten, struppig, abgerissen. Doch klang aus ein paar Kehlen müde der Refrain: »In der Heimat, in der Heimat, da gibt’s ein Wiedersehen.«
Welche Heimat? Warum musste ich alles, was ich so liebte, verlassen, den so tapfer heiteren Großvater, das schöne Haus in der Rue Josse Impens, das Atelier, den Parc Josaphat, die Schule, die Freunde, vor allem Violette?!
Schüsse ertönten. Jemand flüsterte, während meine weinende Mutter ihr schmales Gepäck verstaute: »Da werden Deserteure erschossen.« Wie konnte man Deserteure ermorden, wenn ein Krieg bereits verloren war? Diese Frage sollte für mich später eine besondere Bedeutung erhalten.
Fünf Tage dauerte die Fahrt in diesem Zug, einer Goya-Groteske ähnlich, bis Aachen. Schon in Löwen fehlte Trinkwasser. Ein paar Soldaten wollten, als wir – wie so oft – auf offener Strecke hielten, etwas von dem erquickenden Nass holen. Aus welchen Gründen auch immer: Sie kamen mit einigen Fässern Wein zurück. Auch ich trank ihn, halb verdurstet.
Indes hatte der ungewohnte Genuss dieses starken Rotweins verhängnisvolle Folgen. Fast alle Insassen des Gespenster-Zuges waren bald betrunken, vor allem die jungen Soldaten über uns auf den Dächern der Waggons. Schüsse hörte man immer häufiger. Jetzt hieß es, Partisanen seien am Werke. Auch unser geradezu unendlich langer Zug wurde beschossen; besonders dann, wenn die Lokomotive aus Mangel an Brennstoff stehen blieb und wieder Soldaten hinausgeschickt wurden, um Holz und Kohle herbeizuschaffen. Es stank bald wie in einem der Höllenschlunde Dantes. Von Dante wusste ich auch durch meinen Großvater früh etwas: Er hatte sich an Zeichnungen über Szenen des Infernos versucht.
Dann kam es zu dem unvergesslichen Verhängnis. Vor Lüttich fuhr unsere so gemischte Gesellschaft in einen langen, aber auch niedrigen Tunnel hinein. Oben lagerten, wie gesagt, verwelkte Jugendblüten der einst so stolzen Heere Wilhelms II. Sie wurden buchstäblich von der oberen Tunnelwand erdrückt. Der Zug hielt erst, als die meisten noch halb betrunkenen Fahrgäste an den Fenstern ihrer Abteile dicke, rote Blutsträhnen sahen; gemischt mit Kleidern und Fleischmassen.
Irgendjemand befahl: »Alles aussteigen!« Auch ich musste ins sogenannte Freie hinaus und sah die Folgen dieses Unglücks. Wieder wurde mir übel, wie anlässlich des Anblicks von Verwundeten-Transporten in Brüssel. Meine Mutter trug mich, tapfer wie immer, den weinenden Bruder an der rechten Hand zerrend, in den Totenzug zurück. Madonna! 24 Stunden später kamen wir in Aachen an. Etwas Düstereres, Armseligeres, Traurigeres als diesen damaligen Bahnhof hatte ich noch nicht gesehen. Aber man hörte keine Schüsse, keine Schreie mehr! Alte Damen reichten uns Brot und Milch. So betrat ich mein »Vaterland«.
II. EUROPAAM NIEDERRHEIN
Gymnasium in Viersen und in Mönchen-Gladbach – »Literatur und Lebensstil«1919 bis 1929
Fünf Tage nach dem Waffenstillstand vom November 1918 erreichte ich mit meiner Mutter und meinem Bruder die niederrheinische Stadt Viersen. Sie sollte die Heimat meiner zweiten Jugendzeit werden. Wie kamen wir dorthin? Mein Vater, der, wie gesagt, den Zusammenbruch der Mittelmächte vorausgesehen hatte, konnte als Deutscher kurz nach dem Kriege nicht nach Brüssel zurückkehren. Durch Heirat deutsche Staatsangehörige geworden, musste meine Mutter mit der Ausweisung rechnen. Daher hatte mein Vater ihr empfohlen, sich nach Viersen zu begeben, wo er geboren war und wo eine Schwester von ihm wohnte.
Noch wirkten die Bilder des Glücks, des Behagens, der Blumen im großväterlichen Garten, des kunstvoll ausgestatteten Hauses, des nach Farbtuben duftenden Maler-Ateliers umso länger lebendig nach, als die ersten Monate in Viersen grau, trübe und seelisch derartig niederdrückend waren, dass ich mich an diese erste Zeit nur an Tränen der Enttäuschung erinnern kann. Wir waren bei Tante »Finchen«, die verwitwet war und in engen Verhältnissen lebte, nur notdürftig in zugigen Dachkammern untergebracht worden. Die Speisekarte war für einen verwöhnten Brüsseler, dessen Großmutter, trotz des am Kriegsende auch in der belgischen Hauptstadt spürbaren Lebensmittelmangels, eine begabte Köchin gewesen war, dürftig genug. Meist gab es nur Kartoffeln; gebraten wurden sie in Kaffeesatz, wobei dieser sogenannte Kaffee aus Malzkörnern zubereitet worden war.
Es ist seltsam, woran man sich erinnert, wenn man unter derartigen Umständen als Kind nicht nur die Grenzen zwischen zwei Ländern und nicht nur die Umfassungen zweier Epochen überschreitet, sondern auch die Fülle einer selbst im Kriege farbenreichen Großstadt mit dem damaligen Nachkriegselend einer notleidenden Kleinstadt vertauscht. Dunkle, neblige Straßen; schweigsame, ernst blickende Kinder, in für uns unbegreiflichen Holzschuhen holländischen Stils einhergehend; ein Dialekt, den wir nicht verstanden; eine überfüllte kalte Volksschule, in der ich mich mit zweijähriger Verspätung bald wieder einzufinden hatte und wo ich meines französischen Akzents wegen ein für mich nicht immer angenehmes Aufsehen erregte. Hatten die belgischen Kinder mich, auch wegen meines deutschen Tonfalls, als »dreckigen Boche« beschimpft, so wurde mir in der ersten Viersener Zeit nicht selten auf dem Schulhof das Schicksal zuteil, von meinen eigenen jungen Volksgenossen als »dreckiger Franzose« bezeichnet zu werden.
Doch wurde diese erste Stufe des Trübsinns verhältnismäßig rasch überschritten. Die Sprache ist, bei allen Sonderproblemen dieser spezifischen Art, ein außerordentlich starkes Bindemittel. Die Schule war nicht schlecht. Ich glänzte merkwürdigerweise durch imponierende Gedächtnisleistungen im Religionsunterricht. Das wenige, was wir aus der Heiligen Schrift lernten, konnte ich in einem Bühnen-Hochdeutsch zitieren, das meine Fremdartigkeit, auch in der Kleidung, in etwa wettmachte. Meine Mutter nähte mir Anzüge eben noch immer nach Brüsseler Art, für manche Kinder und dann auch Lehrer Viersens in einem zu großstädtischen Schnitt. Doch auch das glich sich allmählich aus, denn zu den Feinden kamen bald Freunde, deren Eltern sich daran erinnerten, dass man Viersen, diese alte Siedlung zwischen Kleinstadt und industriell betriebsamer Mittelstadt, einmal »Klein-Paris« genannt hatte. Hinzu kam die erste wirtschaftliche Erholung. Sie machte durch den sprichwörtlichen Gewerbefleiß der Viersener erstaunlich rasche Fortschritte. Mein Vater war aus Russland zurückgekehrt. Ein neues Geschäft entstand. Es kostete viel Mühe, aber es blühte bald auf, doch dauerte der Aufschwung nur kurz.
Tiefere Freundschaften wurden alsbald im Viersener Gymnasium geschlossen. Man trug Schülermützen; man fühlte sich, leider auch ich, als Angehörige einer bevorzugten Schicht. Mir ging erst später auf, wie scharf der Kastengeist damals die Stadt in eine breite Unterschicht von Kindern höchst provinziell lebender sogenannter Proleten in Viersen und in eine winzige Oberschicht von Söhnen und Töchtern vermögender oder sozusagen akademischer Eltern trennte. Mittelpunkt dieser Oligarchie bildete die Familie Kaiser, das Fürstentum des sogenannten Kaiser’s-Kaffee-Geschäfts.1 Das alte Oberhaupt hatte sich aus kleinsten Verhältnissen zu einem fähigen Gründer einer lukrativen Filial-Organisation emporentwickelt und hatte sich stets als spendefreudiger Mäzen und fortschrittlicher Meister neuer betrieblicher Künste erwiesen. Dazu kamen die Familien der Textil-Fabrikanten, der Webkünstler, die in Viersen schon im Spätmittelalter berühmt waren; dann die Akademiker und die reichen Geschäftsleute, vor allem der Hauptstraße zwischen Neumarkt und Altem Markt.
Etwas anderes kam hinzu, um mich mit der neuen Umwelt immer vertrauter zu machen, aber um mich ihr gegenüber auch kritischer verhalten zu können. Ich gehörte jetzt nicht nur einem Clan an, dem ich indes allmählich skeptisch begegnete. Ideen einer ersten Kulturrevolution mit sozialen Vorzeichen breiteten sich schon damals aus, und zwar unter dem Einfluss des Expressionismus. Und noch ein Neues fügte sich an, dazu geeignet, alte Brüsseler Erinnerungen und neue Erfahrungen in Viersen in etwa in ein Gleichgewicht zu bringen.
Wie ich mir einst als zehnjähriges Kind die Flachland- und Waldumgebung erobert hatte, so auch jetzt an der Niers, durch Streifzüge meist einsamer Art, die Hügel und Niederungen bei Viersen. Die schwermütig-heitere Schönheit der niederrheinischen Landschaft zog mich an. Sie faszinierte mich wie ein romantisches Märchen. Dies gilt vor allem für die Sumpf- und Heidegebiete, für den »Broich« mit seinen gewundenen Wasserläufen, schilfumwehten Tümpeln, mit seinen dampfenden Wiesen, mit einer üppigen Vegetation, über der Himmel und Erde sich eng zu berühren schienen; wie auf Bildern alter holländischer Meister. Mein Großvater Gustave de Nève, der uns noch während der Inflation in Viersen besuchte und mit Kaffee und Schokolade versorgte, begleitete mich gelegentlich auf diesen Wanderungen. Während ich in einem Bach zu fischen versuchte, machte er flüchtige Farbskizzen dieser Natur, die mehr aus Wasser, Himmel und Pflanzen zu bestehen scheint, denn aus Erde und Stein. Ich habe ein paar dieser Croquis heute noch. Sie gehören zu den köstlichsten Reminiszenzen an diese Zeit.
Im Winter hingegen gab der »Hohe Busch«, das reich bewaldete Hügelgelände zwischen Viersen und Süchteln, Gelegenheit zu nicht selten lebensgefährlichen Schlittenrennen auf steilen Pfaden, mitten durch keineswegs regelmäßig stehende Bäume gezogen. Zur bestandenen Tertianer-Prüfung hatte mein Vater mir in Köln einen der ersten Bob-Schlitten für Kinder mit Lenkrad und Bremsen gekauft. Dazu hatte ich mir, von Filmen angeregt, eine nicht nur für Viersen allzu snobistische Sportkleidung angelegt: einen weißen Sturzhelm, einen blauen Shawl, eine gelbe Windjacke und rote Stiefel. Mein Bruder und ich wollten auch den verwegensten Dandys unter der Jugend dessen, was man damals, mit falscher Aussprache »Hautevolee« nannte, standhalten. Diese hatte Motorräder und Waffensammlungen, begeisterte sich für neue nationalistische Parolen und trank gerne singend Bier. Sie machten damit, ohne es zu wissen, leider nur manche ihrer Väter und Großväter nach. Ich hatte den dummen Ehrgeiz, immer an Brüssel denkend, großstädtische Novitäten einzuführen, der princeps elegantiae zu sein, von dem man spricht. Beatniks und Hippies gab es damals noch nicht, aber ihre Vorboten, allerdings in der Verkleidung der damals tonangebenden Londoner Dandys.
Außerdem wollte ich einer gewissen dunkelhaarigen Ruth imponieren, der selten zu sehenden Tochter eben eines dieser sagenhaften Fabrikanten. Das Wort »reich« spielte mindestens die gleiche Rolle wie das Wort »schön«, doch bedeutete der Ausdruck »reich« mehr sozusagen höhere Standesangehörigkeit als berechnende, materielle Gier. Das Wort »schön« hatte allerdings einen fatalen Beiklang von eleganter Auserlesenheit, Kapriziösität, Künstlichkeit. Es war bekannt, dass Ruths Eltern die Kleider ihrer Tochter in Köln von einer Meisterschneiderin herstellen ließen. Ruth symbolisierte in Viersen – und so auch manches andere Mädchen aus dieser Oberschicht – schlicht und einfach: Weltstadt! Mehr als Brüssel! Nun schon Paris! Ferien in San Remo! Im Übrigen war Ruth wirklich schön: wie ein Giorgione-Bild.
Wie erging es mir mit meinem hypermodernen Schlitten? Ohne Scheitern kein Aufstieg, ohne Blamage kein Stirb und Werde, und sicherlich auch nicht das, was mir später, ab Untersekunda, durch die Begegnung mit Dichtung, Musik und Kunst in einem bewussteren Sinne zuteilwurde: seelische Vertiefung, geistige Schärfe, Abstand von Mode und Geltungsstreben durch Kritik, Ironie und Satire; wenigstens zunächst einmal. Mit dem Schlitten ging es so zu: So rasch wie möglich verließ ich die Stadt. Bald lag die Kirche St. Remigius hinter mir in blauen und rötlichen Schleiern. Ich konnte es nicht abwarten, den neuen Rodelschlitten am Steilhang auszuprobieren. Ohne Zweitmann. Allein. Auf dem Bauche liegend. Sollte Ruth kommen, sie würde sich wundern. Einen solchen Rodelschlitten hatte Viersen noch nie gesehen. Mochte sie Modelle dieser Art in St. Moritz erlebt haben … in Viersen aber … Ja, sie würde staunen. Der Schnee lastete bläulich-funkelnd auf den Tannen. Still und klar war alles. Kein Mensch kam mir entgegen. Wie ich sie liebte … und diese welken Hänge im weißen Glanz … Den krachenden Frost, die Bläue des Himmels, das halb vom Schnee verhüllte Rotbraun des zähen Herbstlaubes … Wenn ich den Schnee zertrat, wurde das Moos sichtbar auf Wurzeln und Erde, auf dieser fetten Walderde, die im Sommer duftet wie Honig.
Nicht leicht war es, den Schlitten bis zur Kuppe hinaufzuziehen, aber oben atmete ich auf, wie der erste Bezwinger irgendeines Alpen-Gipfels. Ich war allein. Die Bahn ohne Spuren unter mir. Der Wald belebte sich: kleine, verächtlich winzige Schlitten, allerlei Leutchen, dann allmählich die üblichen Jungen Kurt, Hans, Franz, Joseph und – in bunte Mäntelchen gehüllt und zwitschernd – Ruth mit ihren Freundinnen. Ich sah sie von Weitem. Unter Zehntausenden hätte ich sie erkannt. Ihr Haar war schwarz wie Ebenholz und ihre Augen dunkel wie Brombeeren. Auf diesen Augenblick hatte ich gewartet, machte mich zurecht, umgeben von neugierigem Volk. Mein nagelneues, technisch vollendetes Ungetüm, wie es bewundert wurde. Vor allem aber auch spöttische, böse Augen hinter mir. Es wurde mir unheimlich. Bange Ahnung erfasste mich … Dann riss ein Rausch mich hin … Ich ließ mich auf den Bob fallen und raste los, sah und hörte nichts mehr.
Wie ich unten angekommen bin, bleibt mir unbekannt. Ich muss wohl kurz die Besinnung verloren haben. Als ich wieder zu mir kam, erkannte ich erst allmählich, was ich angerichtet hatte. Anstatt elegant auf dem so sorgfältig ausgesuchten Schneehügel zu landen, war ich mit ziemlicher Wucht auf einen Schlitten gestoßen, der dem meinen wie ein Ei dem anderen glich. Er gehörte Peter B., dem Sohn eines Kaufmanns in der Gladbacher Straße, der Ruth mehr den Hof machte, als mir lieb war. Beide Schlitten waren arg ramponiert. Ich blutete aus der Nase, Peter B. schimpfte fürchterlich, wobei sein Viersener Platt über Gebühr zur Geltung kam. Ich hatte aber die Genugtuung, dass Ruth, die leider Zeugin dieses dramatischen Vorfalls war, zuerst zu mir kam, mir ein Taschentuch reichte und sagte: »Sie bluten ja! Wie blass Sie sind.« Ich stotterte irgendetwas Dummes und hörte, wie die Menge, die sich um die Unfallstelle angesammelt hatte, lachte, nicht sehr nett lachte. Ohne Zweifel, der Schlitten war für Viersen in seinen Dimensionen nicht passend. Auch Ruth lachte, sie wandte sich plötzlich ab, überließ mir ihr duftendes Taschentuch und sagte höflich und bestimmt: »C’est la vie.«
***
Mit und nach solchen Niederlagen wurde man bald Untersekundaner. Viersen hatte sich nun [von den Folgen des Krieges] erholt und dabei selbst übertroffen. Die Hauptstraße glich vollends einem Corso in provinzieller Miniatur. Es gab für eine Stadt dieser Größe erstaunlich viele Cafés mit kleineren und größeren Orchestern, ein vornehmes Casino für Honoratioren, Hotels und Restaurants mit guter Küche, Tanzlokale und Tanzzelte sowie schließlich eine Kirmes, die sich weit und breit sehen lassen konnte. Die Viersener hielten es mit der katholischen wie protestantischen Kirchenordnung genau. Sie schätzten das gesittete Ordnungsdenken. Zur Verachtung guter Lebensgenüsse neigten sie keineswegs, besonders bei Festen ihrer strammen Schützenverbände. Nur eines mochten sie nicht: das Aufsässige und Skandalöse, die moralisch nicht abgeschirmte Vitalität. Man mag das Pharisäismus nennen. Sicher ist, dass das Spannungsverhältnis von Verbot und Freiheitsdrang, von Tabu und Selbstsucht unsere Lebensintensität und auch unsere Selbstkritik mehr förderte als ungehemmtes Walten der Ich-Sucht ohne Widerstände. Ich blieb Individualist. Meine Schlittenfahrt war symbolisch geworden: für Selbstbehauptung im Ungewöhnlichen und verlachtes Scheitern.
Das, was man kulturelles Leben nennt, war in Viersen durchaus rege, doch – wie es nicht nur damals üblich war – auf den konservativen Geschmack der Honoratioren, der Wohlmeinenden und Gutdenkenden bezogen. In der geräumigen Stadthalle gab es vorzügliche Konzerte. Theatergruppen aus ganz Deutschland traten dort auf. Ich erinnere mich vor allem an auch dezidiert gesellschaftliche Treffen. Doch Kultur gab Anlass zu einer eher sozialen Standes-Liturgie – wie in den meisten großen und kleineren Städten des damaligen Europa. Das festlich angezogene Publikum trat dort auf wie die Schauspieler auf der Bühne, und wir Schüler empfanden es als eine Art Initiationsritus, dabei sein zu dürfen, wobei wir Mozarts Klängen ebenso lauschten wie wir mit den Augen die herausfordernd eleganten Kleider der sonst wenig sichtbaren »höheren Töchter« abtasteten.
Das musste auf die Dauer zu dem führen, was man heute Protest-Ideologie nennt und früher als Kultur-Unbehagen bezeichnete. Ein wohl bester Teil der Jugend in Viersen, zum Teil von jungen Lehrern angeregt, die von dieser nachwilhelminischen Gründerzeit und von dieser Vorläuferschaft unserer heutigen sogenannten Wohlstands-Gesellschaft abgestoßen wurden, ahnte vorerst zumindest, dass da nicht alles in Ordnung war. Die Jugend war damals nicht nur ebenso kritisch wie heute; sie suchte ihren Tadel mit überlegten Argumenten zu belegen. So entstand in Viersen früh eine Art Protestgruppe avant la lettre. Ich fand mich in dieser Hinsicht früh mit Adolf Frisé2 und Gert Heinz Theunissen3 einig, die in Viersen wohnten und geboren waren. Wir wussten bald, dass wir zu den »Outsidern« gehörten, aus Unbehagen und Lebensfreude; aus Vitalität und Melancholie; aus Vorahnungen aber auch, zu welchen Katastrophen die Verwechslung von Schein und Sein führen können.
Ich muss allerdings sagen, dass meine aufrührerischen Tendenzen sich noch in einer positiven Dialektik von Lerneifer und Schulfeindschaft bewegten. Ich wollte mich sozusagen üben, um in Diskussionen nicht durch Unwissenheit beschämt zu werden. Diese Neigung, mir eine sozusagen eigene Kultur-Autonomie zu schaffen, wurde mir durch meine musikalischen Neigungen erleichtert. Schon als Zwölfjähriger hatte ich in dem gut ausgestatteten Viersener Konservatorium mit Violine-Unterricht begonnen. Wenn ich mich daran erinnere, kann ich, bei aller damaligen Aufsässigkeit gegen das Viersener Gymnasium, das ich bis Untersekunda besuchte, nur dankbar an diese Anstalt in der Wilhelmstraße denken, auch wenn meine Eltern kurz vor dem Ende des Untersekunda-Jahres wegen meines häufigen, angeblich ungebührlichen Benehmens den Rat erhielten, mich von ihr zu erlösen. Hauptgrund: unerlaubter Besuch von Tanzveranstaltungen, Schulschwänzerei, Verhöhnung einzelner Lehrer, zu auffallende Kleidung in der Schule, Überschreitung der Abendstunde mit Schülermütze, Unfug aller Art besonders im Mathematik-Unterricht.
Doch hatte dies alles, wie ich 20 Jahre später erfuhr, ganz andere Gründe. Der »Direx«4 konnte meine Einsprüche gegen überholte Unterrichtsformen nicht ertragen. Der nüchterne Teil des Lehrerkollegiums hatte sich gegen dieses harte consilium abeundi gewehrt. Doch reagierte dieser damalige Direktor, ein Spätvertreter harter militärischer Ordnung auch in der Weimarer Republik, einfach allergisch auf meine wohl natürlichen Selbstbehauptungen, also nicht nur auf meine in einem subjektiven Sinne illegitimen Selbstständigkeiten. Mit einem Wort: Ich wurde das Opfer einer autokratischen Willkür, die das Viersener Gymnasium, fast ein Generationsalter später, korrigierte, indem es mich zu einem Vortrag einlud. Leider lebte nur noch ein Lehrer aus der damaligen Zeit, der Englischlehrer, ein fortschrittlicher Geist.5 Er war es, der mir sagte, wie gespalten das damalige Lehrerkollegium gewesen sei, als ich – bei zumindest beachtlichen Durchschnittsleistungen – so hinauskomplimentiert worden war, ohne je ernste Missetaten begangen zu haben. Ich fühle mich jedenfalls heute noch als Opfer einer Übergangszeit zwischen provinziellem und europäischem Denken am damaligen Niederrhein, als Opfer auch mehr der sturen Ideologie eines einzelnen Mannes als einer allgemeinen gesellschaftlichen Kurzsichtigkeit.
***
So kam es, dass ich ins Gymnasium von Mönchen-Gladbach übersiedeln musste. Dazu später mehr. Denn ich muss vorerst noch sagen, dass uns in Viersen von nicht selten trinkfesten und auch sonst antikonformistischen Lehrern mit zärtlichem, von uns damals nicht wahrgenommenem Spott erzählt wurde, wir seien Künstler, nicht etwa Schüler. So übten wir denn Händel, Mozart, Schubert, und bei feierlichen Anlässen verwandelte sich die Aula in einen Konzertsaal; es zogen der verhasste Direktor, das Lehrerkollegium, die Elternschaft und allerlei Honoratioren ein. Wir spielten flott, was wir lange geübt hatten, und gaben uns das Aussehen routinierter Mitglieder eines städtischen Orchesters. Es pochte aber, gottlob selbst von den pianissimi verdeckt, unser Herz. Dankbar war ich dem etwas älteren Komponisten Willy Beste6 für auch harte musikalische Unterweisungen! Er wohnte, sein Vater war städtischer Beamter, in einer behaglichen Wohnung gegenüber der protestantischen Kirche an der Hauptstraße. Gut spielte er Orgel und Bratsche. Sorgsam führte er mich auch in die sogenannte moderne Musik ein, vor allem in die manieristischen Arabesken Strawinskys, die er »teuflisch genialer« fand als die letzten Quartette von Beethoven. Von diesem heute, soweit ich weiß, verschollenen Kleinstadt-Musikanten habe ich also viel gelernt. Der Viersener Gesellschaft gegenüber, die er als beispielhaft spießig bezeichnete, bekundete er – wie übrigens auch Gert Heinz Theunissen – nur Verachtung. Um Geld zu verdienen, schrieb er (wohl zu melancholische) Schlager für den Rundfunk.
Oft habe ich darüber nachgedacht, warum ich gerade beim Musizieren Glück empfand. Wahrscheinlich wegen der tätigen Mitwirkung, wegen der unmittelbaren Anregung, sich selbst, auch im bescheidensten Sinne, schöpferisch zu betätigen. Ähnliches empfand ich im Sprachunterricht und im Physiksaal, dessen Apparate – wir durften sie selbst aufstellen – alle Geheimnisse der Natur zu enthalten schienen, auch Blendwerk und Zauberei bei Funken sprühenden Reaktionen. Ich gehörte zu denen, die sich, sehr zum Ärgernis unserer Nachbarn, schon als Tertianer zu Hause ein eigenes Laboratorium einrichteten, mit Mikroskop, Reagenzgläsern, Retorten und anderen glitzernden Geräten, Töpfchen, Fläschchen und sogar schweren Giften. (Einiges explodierte gelegentlich.) In dieser Kulisse eines Dr. Faust en miniature fühlte ich mich wohl.
***
Man konnte bald wieder ins Ausland reisen. Manche Sommerferien verbrachte ich daher im Hause meiner Großeltern in Brüssel. Großvater Gustave de Nève war nicht nur älter, sondern auch weiser geworden; doch auf eine eher ich-bezogene Art, und das war für Angehörige dieser Schicht nicht nur im damaligen Brüssel bezeichnend. Höchstes Glück hieß, wie gesagt, chacun à sa manière, jeder auf seine Art.
Nach dem noch immer vorzüglichen Mittagessen, stets mit guten französischen Weinen, bat mich Großvater Gustave, mit den schelmischen Augen eines Till Eulenspiegel, ihm und der Großmutter Suzanne etwas »Trauriges« auf der Geige vorzuspielen. Ich wählte meist die »Chanson Triste« von Tschaikowsky oder »Solveigs Todeslied« von Grieg. Beide schliefen bald ein, jeder für sich, in einem hohen Ohrensessel sitzend. Vor Sonnenuntergang ging dieser für mich typische westliche Klein-Patriarch mit mir in den Garten und murmelte allerlei vor sich her. Ich verstand, im Wesentlichen, dass der Osten beziehungsweise der Norden ihm unheimlich waren, sogar die Musik seines »Ur«-Landsmanns Beethoven.
Natürlich gehörte für Gustave de Nève auch Deutschland nicht nur geographisch zum Osten. Offenbar war er reaktionär geworden, doch bin ich einem liberaleren Mann mit vorwiegender Sorge für den Nächsten später nie begegnet. Und Mut hatte er, wie der Löwe im Wappen Belgiens!
Eine ganz andere Atmosphäre herrschte in dem Hause meines Onkels Émile, des Bruders meiner Mutter, den ich schon erwähnt habe. Nachdem Émile de Nève 1914 bis 1918 in England Munitionsfabriken gebaut hatte, war er nach Brüssel zurückgekehrt; nicht nur als vermögender, sondern auch als kranker Mann. Ihm hatten wirklich die nordischen Nebel die Lungen ausgehöhlt. Doch wirkte er vorerst noch als einer der damaligen Großarchitekten Brüssels, in der Expansion neuer Vorstädte, wenn auch nur ein paar Jahre lang. Dann raffte ihn die in England erfolgte Ansteckung der Atemwege hinweg.
Émile war nicht nur ein Modell für Unternehmungsgeist und Umsicht. Er brachte, wie manche andere, auch englische Manieren mit nach Belgien. Seine Unternehmungen nahmen zu. Er hatte die Tochter eines der einflussreichsten Bauunternehmer in Brüssel geheiratet, die rosenwangige, üppige Hélène Dupont. Émile und Hélène besaßen am Stadtrand von Brüssel, am Bois de la Cambre, eine Villa mit englischem Park. Émile bewegte sich darin wie ein aufgeklärter Fürst und skeptischer Menschenfreund. Anzüge, Hemden und Schuhe kaufte er nur in England. Er bevorzugte taubengraue Anzüge mit azurfarbenen Hemden und Krawatten im Ton der Waldveilchen. Er sagte einmal: »Ich ziehe die Naturfarben vor, doch so wie die französischen Impressionisten sie in ihren Pastell-Zeichnungen wiedergaben.« Als Hobby baute er sich die ersten Radioapparate. Er fuhr leidenschaftlich gern Auto, doch hatte er mit den damaligen Vehikeln dieser Art stets Pech.
Außerdem pflanzte er in seinem Park, Beispielen der High Society Englands folgend, seltene Bäume und Sträucher. Keineswegs indes war er das, was man heute einen »Banal-Reaktionär« oder »introvertierten Kleinkapitalisten« nennt. Als Snob konnte man ihn erst recht nicht ansehen. Dafür war er zu intelligent. Doch ein Dandy war er gewiss. Er las Baudelaire und Rimbaud, doch auch Tolstoi und Dostojewski. Die wichtigsten Schriften von Karl Marx und Lenin waren ihm bekannt. Das hatte er in England gelernt, von Kollegen der Fabian Society,7 in feuchten und verrauchten, höchst lustlosen Bierkneipen der Black Pools bei Liverpool.
Mit den beiden Söhnen Émiles, mit Maurice und Jacques, machte ich oft wahrhaft verwegene Ausflüge … bis fast nach Waterloo, aber auch in das Hafenviertel Brüssels, das mir, mit seinen ebenso heiteren wie melancholischen Menschen, mehr Anregungen bot als die vornehm vor sich hindämmernden Villen am Bois de la Cambre. Dort fand ich die herrlichsten Absurditäten der Brueghel und Bosch wieder, auf die mein Großvater mich schon früh hingewiesen hatte, auch wenn er diese Meister hasste: wie die Pest, wie die Preußen, wie die katholische Kirche.
In etwa gehörte Émile de Nève schon damals zu den letzten Europäern, sozusagen von Geblüt, die Phantasie und Skepsis miteinander zu verknüpfen wussten, die energisch ich-bezogen waren, aber schon erkannten, dass Egoismus ohne Altruismus auf eine neue Weltkatastrophe hinleitete. Er lebte im Stil des antibürgerlichen Lord Brummell, doch war er einer der ersten Kapitalisten mit einem gewissermaßen guten schlechten Gewissen, die ich gekannt habe. A posteriori raffte ihn der Erste Weltkrieg – vor dem zweiten – grausam hinweg. Leviathan hatte wieder ein Meisterstück geleistet.
Was seine künstlerischen Konzeptionen angeht, so distanzierte sich Émile de Nève von den experimentellen Architektur-Schulen des »Art Nouveau«, von den Erneuerern wie Victor Horta,8 Henry van de Velde,9 Paul Hankar,10 Blérot11 usw. Wenn man den Jugendstil-Manierismus Brüssels als eine Mischung von Louis Seize und Brueghel-Phantasmen bezeichnet hat, so zog er den Palladianismus des englischen Klassizisten Inigo Jones vor.12 Von dessen nüchtern-eleganter Baukunst war er in London beeinflusst worden. Doch nahm Émile de Nève, anders als sein Vater Gustave, ihm vielfach zu wild erscheinende Experimente, wenn sie mit seinem Geschmack zu vereinbaren waren, stets positiv auf. Er war ein Ästhet des Ausgleichs, wie manche Frankophonen Brüssels. Er las schon Rimbaud, doch zog er Racine vor.
Den meisten ging es, nach den Reichtümern, die aus dem Kongo flossen und die König Albert weise verwaltete, um Geld. Der Maler James Ensor stellte in seinem inzwischen weltberühmten Bild »Der Einzug Christi in Brüssel« den Mammon in Frage. So liberal war König Albert, dass er den Schöpfer dieser genialen Satire, lange vor entsprechenden expressionistischen und surrealistischen Darstellungen dieser Art, in den Adelsstand erhob.
***
Vom Hause meiner Großeltern schlich ich mich oft nach dem Abendessen heimlich hinweg. Mein Großvater und mein Onkel hatten mir stets ein ganz nettes Taschengeld gegeben, doch musste ich mit den Münzen sparen, wie ein Bauer nach einem vernichtenden Hagelschlag. Ich fuhr wieder mit Straßenbahnen kreuz und quer durch Brüssel. In der Nähe der Grand Place ruhte ich mich aus, um die Mitternacht. In paradiesisch gemütlichen Kleinbürger-Kneipen aß ich moules et pommes frites.13 Gern ging ich dann über den Boulevard zu Fuß zum Gare du Midi nach Hause.
Eines Abends fand ich dieses Bahnhofsviertel gesperrt. Arbeiter demonstrierten gegen Preissteigerungen. Sie hatten, für meinen an Onkel Émile geschulten Geschmack, hässliche und schmutzige Schirmmützen auf; sie trugen schäbige Jacken; sie rochen nicht gut. Ihre Gesichter waren verzerrt und ihre Augen, wie mir schien, jetzt mit dumpf leuchtendem Gift geladen. Ich suchte Schutz in einer Bierschenke und sprach zum ersten Mal mit einer dieser »Figuren«, die man damals schon in Deutschland als »Untermenschen«14 bezeichnete. Ich verstand nur eins: seine Familie könne er kaum noch ernähren; dann die Mietpreise, die Ausbeutung, überhaupt … Auch Brüssel glich also – damals schon – einem Vulkan: Licht wurde Feuer, Feuer aus der Tiefe.
Ich verkroch mich noch für eine Weile in die damals »ständige Kermes« am Gare du Midi: Karusselle, Akrobaten-Buden, Tanzbars, Athleten- und Zauberer-Zelte aller Art. Es funkelte und blitzte, zur Anregung von Vergnügungen aller Art; Zirkusorgeln grölten in vorweggenommener Beat-Besessenheit. Ich wollte noch einen Kaffee trinken und entschied mich für eine mir besonders billig erscheinende Schenke. Ein hübsches Mädchen, dem ich ein freundliches Lächeln entlocken wollte, sagte kaltschnäuzig: »25 centimes«. Und dann hörte ich nur noch weiter: »25 centimes« für den einen und anderen … »25 centimes!« … Geld auf den Tisch, Geld in die Kasse. Kasse und Erbarmungslosigkeit? Güte? Nur noch »Gut«. In diesem Augenblick begriff ich, dass vor allem die Welt meines Großvaters gefährdeter war denn je und dass neue Lemuren sich erneut darauf vorbereiteten, für klingende Münze wieder einmal auch Blut fließen zu lassen.
25 centimes, 25 centimes, 25 centimes! Immerhin noch mit Monsieur! Mein Herr, gewiss, aber nicht mehr mit »bitte« oder »danke«!
***
Kehren wir zum »Osten« zurück, das heißt ins deutsche Rheinland, wo ich die meiste Zeit meiner Schülerjahre verbrachte, das heißt also – im Grunde – nach Westdeutschland. Osten oder Westen? Was war Westen, was Osten? Was bedeutete Nation, Klasse, Rasse? Dabei soll Glück, nach Jean Paul, »Übereinstimmung mit der Welt« bedeuten! Hingegen wurde man, ob man es wollte oder nicht, von einem allmählich paranoischen Chor von Fragern bestürmt. Vorerst noch etwas Gelassenheit?
Dann, wie gesagt, die Sprachen. Unser Jahrgang hatte einen Französisch-Lehrer aus der besonders prächtigen Lehrergeneration, die sich der bedeutenden historisch-kritischen Tradition der deutschen Geistesgeschichte verbunden fühlte. Die so oft missbrauchten großen Worte aus der Philosophie des Idealismus, mit denen Schüler geistig auch verzogen werden, lagen ihm nicht. Mehr noch: Er hatte Humor. Gelegentlich wirkte er wohl etwas sonderlingshaft auf uns, weil er sich gern burschikos gab (er hatte Schmiss) und weil er gern eine etwas monumentale Haltung einnahm (er hatte eine nicht allzu entfernte Ähnlichkeit mit Bismarck, weshalb wir ihn das »Denkmal« nannten), aber er verstand es derartig virtuos vom vorgeschriebenen Lehrgegenstand abzuweichen, dass ich mich auf der Universität noch an manche seiner Darstellungen über Etymologien, über literarische Kompositionsprobleme und schriftstellerische Technik erinnerte. Er behandelte uns allerdings mehr als Kinder denn als Erwachsene. Hin und wieder überschlug er sich dabei, so wenn er uns Sekundanern – wir fühlten uns schon sehr erwachsen – Ansichtskarten der Alpen zeigte, welche, hielt man sie gegen das Licht, durch eine sinnvolle Vorrichtung das Alpenglühen täuschend ähnlich vorführten, oder wenn er uns den berühmten Horaz-Vers über die Abneigung gegen die Masse15 – schmunzelndes, strahlendes Urbild eines ewigen Kommers-Studenten – in die deutsche Travestie kleidete: »Ich hasse die Canaille und halt’ sie mir vom Balge.« Wir spürten, dass er nichts unversucht ließ, uns Regeldetri und Paukerei zu erleichtern. Wir liebten und verehrten ihn deswegen. Ähnlich ging es uns mit einem neuen Englisch-Lehrer, der Alltags-Englisch mit uns sprach, mit dem Erfolg, dass wir auf unseren Spaziergängen in seiner Art miteinander englisch sprachen.
Im besten Sinne für eine gute Sache begeistert sein zu können, zeichnete damals, in der Weimarer Republik, manche Menschen aus. Die schüchternen Liebesbriefe, die wir einst mit den jungen Damen des nahen Lyzeums austauschten (was hatten wir uns für Verstecke erdacht!), waren in einem seltsamen Kauderwelsch von Deutsch, Englisch, Französisch und Latein geschrieben; es war darin von Bunsen und Goethe, von Leibniz und Dante die Rede. Um jenes barock-prunkvolle Schüler-Esperanto handelte es sich, das in allen Schulen der Welt wuchert. Es zeugt dafür, dass das Erlernte auch gut angelegt ist; es blüht weiter im Spiel, im unschuldigen Geltungsstreben und in der Freiheit dessen, der suchend und tastend auf dem Wege zur Persönlichkeit ist.
***
Inzwischen war ich, nun bald Primaner, zu dem, was man einen Mann nennt, herangewachsen. Platonische Augenspiele mit der verehrten Ruth des Viersener Gymnasiums genügten mir nicht mehr. Nach einem Konzert in der Aula des Viersener Gymnasiums, wo ich mit einigem Glück die »Frühlingssonate« von Beethoven vorspielen durfte – der Takt wurde durch den vorzüglichen Pianisten gerettet – lernte ich Maria Grün16 kennen, die ebenso charmante wie elegante, die ebenso heitere wie nachdenkliche Tochter eines Justizinspektors, der später durch finanziellen Leichtsinn infolge der Inflation in gerichtliche Schwierigkeiten verwickelt wurde. Maria wurde wie eine Kölner Karnevals-Prinzessin schlicht »Mariechen« genannt, auf eine fürwahr passende heitere rheinische Weise, denn dieser eher drollige Name entsprach ihrer stets ungetrübten Laune, ihrem schlagfertigen, gutmütigen Witz; auch ihrer Unbefangenheit und munteren Anti-Spießigkeit.
Mariechen gehörte zu den Rheinländerinnen hellsten französischen Gepräges. Geboren war sie in Saarlouis. Sie spielte, wie alle »höheren Töchter« damals, Klavier, las Gedichte und Romane, vor allem von Hermann Hesse; sie nähte ihre feschen Kleider selbst und vermochte es, wie eine Pariser Midinette, auch nur mit einem bunten Halstuch ihren jeweiligen Gewandungen eben jenes je ne sais pas quoi