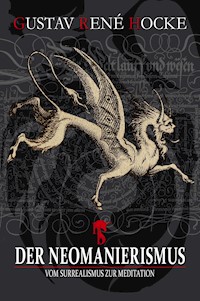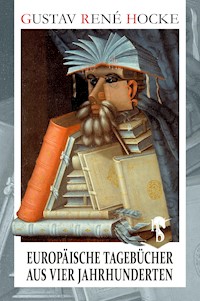
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Tagebücher – so vielfältig die Gründe sind, warum sie geschrieben werden, so vielfältig ist auch ihre Form. Aber immer sind sie ein Spiegel ihrer Zeit. Wer hat uns warum seine Tagebücher hinterlassen, welche haben Geschichte geschrieben? Gibt es Motive, die sich über die Zeit hinweg wiederholen und was hat sich im Laufe der Zeit verändert? Die überarbeite und gekürzte Ausgabe des Standardwerks zur literarischen Form des Tagebuchs von Gustav René Hocke geht aus der analytischen Lektüre von Hunderten von Tagebüchern aus ganz Europa von der Renaissance bis zur Gegenwart hervor. In Themenkreisen aufgeteilt werden Beweggründe, Motive, Schreibhaltungen und Schreibtechniken von Tagebuch-Autoren analysiert und verglichen. Die Tagebücher von Königen, Politikern und Widerstandskämpfern, Komponisten, Malern und Schriftstellern, ihre privaten Aufzeichnungen, Bekenntnisse und Reflexionen haben nicht nur einen dokumentarischen Wert, sondern sie gewähren einen tiefen Einblick in die immer wiederkehrenden Problematiken der menschlichen Existenz, in die humansten Aspekte unserer (Kultur-)Geschichte. Auf diesen echten, realen Humanismus gründet sich für Gustav René Hocke der europäische Geist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 899
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Gustav René Hocke
Europäische Tagebücheraus vier Jahrhunderten
Für Traudl
Nos autem cui mundus estpatria velut piscibus aequor.
Dante
Nec metuit solus esse,dum secum est.
Petrarca
Editorische Notiz
Diese neu bearbeitete und gekürzte Ausgabe beschränkt sich auf den Essay. Die Anthologie mit einer Auswahl der Tagebücherauszüge, auf die im Essay Bezug genommen wird, ist in dieser Ausgabe nicht enthalten. Der interessierte Leser findet aber über die ausführliche Bibliografie die entsprechenden Quellen für weitere Recherchen.
Grundmotive europäischer Tagebücher
Beiträge zur vergleichenden Literaturgeschichte
Vorhaben und Methode
Schon bei den ersten Vorarbeiten zu diesem Buch bin ich mir bewusst geworden, dass eine auch nur einigermaßen vollständige Geschichte des europäischen Tagebuchs von der Antike bis heute, wollte man jedem Autor und jeder Epoche gerecht werden, von einem Einzelnen kaum geleistet werden kann. Auch eine enzyklopädische Darstellung im lexikalischen Sinne würde mehrere Verfasser voraussetzen, wollte man eben diese Vollständigkeit und dabei auch wissenschaftliche Genauigkeit beanspruchen. Georg Misch hat uns eine vorbildliche Geschichte der Autobiografie geschenkt. Veröffentlicht wurden bisher – nach einer Arbeit von Jahrzehnten – die Darstellungen von der Antike bis zum Spätmittelalter. Angeregt wurde ich ohnehin gleich am Anfang dieses Vorhabens, wie bei meinen Manierismus-Studien, stärker von motivkundlichen Forschungszielen als von Arbeitsprinzipien des Darstellers und Deuters von Geistes-Geschichte. Mehr noch wurde ich in diesem Falle, also bei der Lektüre von Tagebüchern von der Renaissance bis zu unserer Gegenwart, von der überwältigenden Menschlichkeit ergriffen, die in diesen oft nur beiläufigen Kalendernotizen geborgen liegt, von ihrer nicht selten unmittelbaren Eindringlichkeit und häufig auch ganz und gar unliterarischen Aufrichtigkeit. Ein konkretes Problem der menschlichen Existenz fügte sich ans andere. Alles und jedes Humane zwischen Geist und Stoff, zwischen Ich und Umwelt gliederte sich im Laufe einer solchen aufmerksamen Lektüre bald von selbst, und zwar nicht im Sinne der Geschichtsschreibung, sondern im Sinne der noch jungen existentiellen Menschenkunde nach Motiven bestimmter Daseinserfahrungen. Gedacht sind diese Studien ferner als Beiträge zur vergleichenden Literaturwissenschaft im Anschluss an meine Darstellungen über Manierismus in der Literatur, zur Geschichte des europäischen Subjektivismus.
Die »Einteilung« ergab sich also zwangsläufig. Die vielfältigen Selbstaussagen, Beschreibungen, Szenen, Berichte wiederholten sich immer wieder. Sie machten bald ganz bestimmte »Zeichen« für Grunderfahrungen der menschlichen Existenz deutlich. Diese Zeichen wiesen auf die Möglichkeit einer Struktur, die Zeichen nämlich von: Angst und Glück; Wahrheit und Irrtum; Menschen und Mitmenschen; Gesellschaften und einem darin oft verzweifelt einsamen »Ich«; Frömmigkeit und Laster; Freiheitssehnsucht und Versklavung; Größenwahn und Demutskult; Liebessehnsucht und Liebesohnmacht; Frivolität und Caritas; Wahrheitsforderung und Selbstbetrug; künstlerische Besessenheit und Scheitern; Aufsässigkeit und mystische Wendung zum »Absoluten«. Selbstverständlich wurde bei der motivkundlichen Disposition dieses Stoffes nicht darauf verzichtet, Hinweise auf einzelne eigengeartete historische Situationen zu geben, und insbesondere nicht auf die Hervorhebung unverwechselbar individueller Merkmale einzelner Autoren. Im Gegenteil. Auch durch zahlreiche Zitate wurde den Abstraktionstendenzen einer verallgemeinernden, einseitig verstandenen Literatur-»Wissenschaft« entgegengewirkt. Wenn die Geschichte nach Augustinus die Geschichte eines Menschen ist, so bleibt jedes menschliche Motiv dennoch an eine konkrete Individualität und an eine bestimmte historische Situation gebunden. Die Grundfiguration des Humanen kann nur in der Vielfalt seiner Träger und in der Mannigfaltigkeit ihrer Entwicklungen zum Ausdruck kommen.
Viele Tagebücher Europas haben im besten Falle einen nur dokumentarischen Wert. Andere, bedeutendere, vor allem persönlichere Tagebücher enthalten, wir deuteten es schon an, Massen toten Stoffs. Überzeitliche, überpersönliche Werte findet man meist nur in Tagebuchpartien, die über besonders schicksalhafte Situationen, über dramatische seelische Erfahrungen berichten. Konzentriert habe ich mich auf die Wesens-Zeichen und Wesens-Situationen, habe also vermieden, gewissermaßen nur Scharen wert- und unterschiedsloser Bleisoldaten aufmarschieren zu lassen. Und selbstverständlich ist es, dass ich es nur aufgrund dieses Einteilungsprinzips wagen konnte, mit dieser mehrjährigen Arbeit zu beginnen.
***
Aus manchen Einzelstudien zur Diaristik in den verschiedenen europäischen Ländern habe ich wertvolle Anregungen empfangen. Allerdings war ich darüber erstaunt, dass die Ausgangspunkte zu einer Darstellung und Wertung vor allem »intimer« Tagebücher nicht immer richtig gewählt waren und dass sich nur sehr wenige namhafte Forscher mit diesem Problem in einem europäisch umfassenden Sinne intensiv und systematisch auseinandergesetzt haben. Entweder versuchte man, aus der Fülle echter, nicht für die Öffentlichkeit bestimmter Tagebücher eine sozusagen künstlerisch geprägte Form von »literarischen« Tagebüchern auszusondern, wobei man Tagebücher allein dann als geistesgeschichtlich relevant ansah, wenn sie literarischen Kunstwerken glichen; oder man benutzte Tagebücher aller Art zu systematischen psychologischen Studien, und zwar nur nach ganz bestimmten Kategorien eben dieser speziellen Erkenntnismethode. Dabei sind, wie ich meine, gerade die unliterarischen, das heißt, wenigstens im Vorhinein – wie Benjamin Constant einmal schrieb – nicht »für das Publikum« bestimmten Tagebücher, eben weil sie dann »echt«, wenn auch nicht immer ganz und gar »aufrichtig« sind, für eine Untersuchung dieser Mitteilungsform wichtiger als das literarische Pseudo-Tagebuch oder das fingierte Tagebuch. Selbstverständlich gibt es auch Tagebücher von echtem diaristischem Charakter, so zum Beispiel das von André Gide, die von vornherein zur Veröffentlichung bestimmt waren oder sogar schon zu Lebzeiten des Verfassers im Druck erschienen sind. Auf diese konnte nicht verzichtet werden, und ich werde zur gegebenen Zeit erklären, warum. Autoren hingegen, die die diaristische Form nur als Kunstmittel benutzen, werden mit ihren Titeln lediglich erwähnt. Reisetagebücher werden also nur dann beachtet, wenn sie einen persönlichen Bekenntnischarakter haben oder der diaristischen Frühzeit entstammen. Die herkömmliche und spätere Reisetagebuch-Literatur habe ich ganz ausgeschlossen. Über die Sekundärliteratur berichte ich vor allem in den beiden ersten Kapiteln, die einleitenden Charakter haben. Nähere Hinweise findet man in den Anmerkungen und im bibliografischen Teil.
***
Wer »intime« Tagebücher liest, muss für »Verwirrungen« Verständnis haben. Ausgehen muss er stets davon, dass dem Menschen nichts Menschliches fremd sein sollte, vor allem dann, wenn in jeglicher Gefahr nach einem Rettenden gesucht wird, sei es in einem immanent-ethischen oder in einem transzendent-religiösen Sinn. Eine moderne, eine untheoretische existentielle Menschenkunde, die von der philosophischen Anthropologie ausgeht und diese in einzelnen Teilen ergänzen kann, muss zwangsläufig die verschiedensten menschlichen Erfahrungen, auch solche extremer Natur, beachten und darstellen. Nur so nähert man sich wenigstens der Möglichkeit, eine Motivsammlung zu vervollständigen: zur Seelen- und Schicksalsgeschichte Europas. Eine solche Geschichte ist multiform und nicht monoton; spannungsvoll und nicht schematisch; dynamisch-komplex und nicht mechanisch-dialektisch. Stets sollte sie bestimmt bleiben von einem echten »realen« Humanismus, der in ältester mythischer oder moral-psychologischer Form zu den besten Grundlagen des europäischen Geistes gehört.
***
Valery Larbaud war es, glaube ich, der einmal von einem »hassenswerten Vorwort« schrieb. Er dachte dabei gewiss an das »moi haïssable«, an das »hassenswerte Ich« von Pascal. Hier und jetzt hatte ich also ein »hassenswertes« Vorwort zu dem diaristischen Drama des »hassenswerten Ichs« in Europa zu schreiben. Es lässt sich nicht vermeiden, will man den kritischen Leser, der zunächst einmal eine spannungsvolle und vielfältige Landschaft aus der Ferne klar überblicken will, bevor er sie durchwandern soll, vom Wert eines sinnvollen Unternehmens überzeugen. Ich lade den Leser ein auf eine Reise, die, wie ich hoffe, für ihn genauso beglückend und niederdrückend, genauso erregend wie beschwichtigend, genauso lehrreich und wohl auch hoffnungsreich in Bezug auf das hintergründige Gesicht des Homo europeus zu werden vermag, wie für mich, als ich die vielen Stationen dieses diaristischen Wegs hinter mich brachte. Dass auch der heutige Europäer eine weltgeschichtliche Aufgabe zu erfüllen hat, das fand ich am Ende meiner Reise doch mit einiger Sicherheit bestätigt. Das alte »Abendland« mag schon fast untergegangen sein. Wir sollten ihm nicht allzu sehr nachtrauern. Aus der Asche dieses sicherlich imposanten, aber keineswegs immer vollkommenen Phönix kann das neue, härtere, klarere, illusionslosere, moderne Europa auferstehen: im Zeitalter eines ganz neuen Ausgleichs.
***
Dieser Band umfasst Darstellungen und Analyse des Stoffs im motivkundlichen Sinne; am Ende dieser Sammlung findet man auch eine erste ausführliche Bibliografie europäischer Tagebücher. Sie enthält auch ergänzende bibliographische Angaben, auf die in den Anmerkungen aus Raumgründen verzichtet werden musste. Die nicht immer einfache Beschaffung von Literatur wurde mir durch Dr. Michael Freiherrn Marschall von Bieberstein und Fräulein Ursula Engel von der Deutschen Bibliothek in Rom, sowie von Prof. Dr. Walther Holtzmann, dem ehemaligen Direktor des Deutschen Historischen Instituts in Rom, erleichtert. Auch Edoardo und Vera Cacciatore vom Keats-Institut, ebenfalls in Rom, standen mir mit der Bibliothek dieses Hauses zur Seite. Anderen internationalen Instituten verdanke ich bibliografische Hinweise, für die ich hier erneut danke, so den holländischen, schwedischen, dänischen, ungarischen Kulturinstituten in Rom, sowie dem »Istituto Siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici« in Palermo. Auch Frau Dr. Gertrud Reitz von der Nassauischen Landesbibliothek Wiesbaden bin ich für bibliografische Ratschläge dankbar. Für Korrekturlesen und für die Zusammenstellung des Autorenregisters, in vorbildlicher Einheit von Sorgfalt und Geduld, sowie ebenfalls für Literaturbeschaffung habe ich besonders Frau Marguerite Schlüter vom Limes Verlag und Herrn Gert Quenzer zu danken. Gefördert wurde diese Arbeit vom Kulturkreis im Bundesverband der deutschen Industrie, vor allem dank dem verständnisvollen Interesse von Herrn Prof. Gustav Stein und Herrn Dr. R. De le Roi. Sie ermöglichten das Studium in verstreuten Bibliotheken.
Rom 1963
Gustav René Hocke
Kapitel I
Strukturen und Antriebe
1. Vielfältigkeit der Formen
Der europäische Geist hat eine seiner spannungsvollsten Ausdrucksformen im funkelnden Jahrtausendgeflecht seiner Literatur gefunden. Worte konnten Konflikte erzeugen und beenden; Taten konnten durch Worte infrage gestellt oder verherrlicht werden. Individuen und Nationen fanden stilisierte Bilder und Symbole ihrer Existenz in Gedichten und Epen, in Tragödien und Romanen, den Sinnbildern ihrer Träume von Angst und Schönheit. Wie kein anderer Erdteil verfügt Europa über einen Reichtum literarischer Sprachdenkmäler, der seit Hesiods »Werken und Tagen« charakterisiert wird durch folgerichtige Entwicklung und intensiven geistigen Austausch. Zeiten und Räume verbinden sich in diesen Dokumenten des Wortes; das gilt auch für die avantgardistischen Palastrevolutionen jeder Art. Der literarische Blutkreislauf Europas konnte stocken, vor allem durch politische Torheit; zum Erliegen kam er nie.
Es ist nicht lange her, dass man eine kontrastreiche Harmonie, eine concordia discors anstatt einer »organischen« Einheit in der Literatur Europas zu entdecken begann. Die zusammenklingende Vielfalt des klassischen und antiklassischen Schönheitsideals hat gerade in Europa die Literatur zum rhythmisch bewegten Atmungszentrum einer Kultur von eigener Art gemacht. Dies ist aus manchen sprachlichen, stilistischen und gattungsgeschichtlichen Merkmalen erschlossen worden. Auch ein Überblick über die Grundmotive europäischer Tagebücher macht die gegensatzschwere Harmonie durch sprachliche Erzeugnisse sichtbar, die jedoch weniger als planvoll gestaltete literarische »Denkmäler«, denn als unmittelbar, sozusagen vorliterarische menschliche Selbstzeugnisse der Europäer gelten können.
Die Aussicht auf eine erlebnisreiche Begegnung ist groß, denn auch die verborgene Menschlichkeit eines Erdteils muss in ihrer noch nicht literarisch verarbeiteten Problematik zur Geltung kommen. Den Themata einer europäischen Geistes- und Literaturgeschichte werden Motive einer europäischen Seelen- und Schicksalsgeschichte hinzugefügt. Die unmittelbare Einsicht in das »Menschliche«, das heißt, in das Drama des Menschen selbst, löst nicht nur Erschütterung aus, die durch den Anblick solcher Konflikte entsteht; sie enthüllt vielmehr eine typisch europäische Menschen-Landschaft, eine in sich zusammenhängende Grundsituation von spezifisch europäischen Sorgen und Verwirrungen, von Verdrängen und Verbergen, aber auch von Freiheit, Klarheit und Überwindung … meist im Selbsterkennen und Selbstbekennen.
Diese Voraussetzungen machen deutlich, warum hier vor allem »echte« Tagebücher aufgeschlagen werden sollen, nicht literarisch-geformte oder nur fingierte. Man wird sich zunächst einen kurzen Einblick in die Vielfältigkeit der Art und Weise, ein Tagebuch zu führen, verschaffen müssen.
Tagebuchartiges Aufzeichnen war in den frühesten geistig-gesellschaftlichen Gruppen Europas, in den ältesten Mittelmeerkulturen, so gebräuchlich wie die ersten Formen anderer schriftlicher Mitteilung1. Tagesberichte über die Taten der Götter und Könige tauchten ebenso früh auf wie Logbücher der Schifffahrt. In chronologischer Form wurden Tag um Tag äußere Begebenheiten aufgezeichnet: solche, die den Götterhimmel oder ein irdisches Staatswesen betrafen, also von allgemeinem Interesse waren, und solche, die nur für einen kleinen Kreis bedeutsam erschienen: für die Mannschaft eines Schiffes oder die Überwacher eines Hofzeremoniells, für die Priester eines Tempels oder die Mönche eines Klosters. Die Notiz der »Chronik« herrschte vor. Doch kam es schon im Hellenismus vereinzelt zu subjektiven Wertungen und eigenen Betrachtungen. Am Ausgang der Antike erfolgte dann der erste breite Durchbruch der Subjektivität, im Mittelalter mehrten sich »Seelengeschichten« und »Konfessionen«, und seit der Renaissance wurden ephemerides, diaria, journals, diaries,dnevniki, Tagebücher zu immer genaueren Spiegelungen der intimen, unteilbaren, souveränen Individualität.
Von den ältesten tagebuchartigen Chroniken, archaischen Formen der Geschichtsschreibung, von den dokumentarischen Erinnerungsbüchern über die »journaux intimes« der psychologischen und moralischen Selbstenthüllung aus pietistischer und romantischer Zeit bis zum hyperindividualistischen und zugleich zeitkritischen Tagebuch der »Moderne« führt ein weiter Weg. Seine wichtigsten Stationen sollen im Verlauf dieser Darstellung gekennzeichnet werden.
Zunächst die äußere Form! Wie sehen Tagebücher aus? Der Bogen ist weit gespannt. Es gibt einfache Notiz-Tagebücher, die Erinnernswertes in Stichworten festhalten. Sie gleichen einer mehr oder weniger systematischen Tage-Buchführung über Ausgaben, Krankheiten, Besuche, Gespräche, Verpflichtungen, Vorhaben, Wettererscheinungen, Naturkatastrophen, Wunderbarkeiten, wirksame Arzneien und lockende Küchenrezepte. Sie dienen vor allem dem Gedächtnis, der Organisierung äußerer Lebensverhältnisse. Diese älteste Form des Tagebuchs, das Memorandum über geschehene und zu geschehende Dinge, über acta und agenda, ist bis heute erhalten geblieben. Früh schon weiten sich manche Diarien zu Sammlungen von Entwürfen für Briefe und dichterische Werke, zu Kommentaren über Lektüre und Gespräch, über religiöse und politische Ereignisse; kritische Betrachtungen über Herrscher und Kriege, Volkstribunen und Aufstände kommen hinzu. Der Kritik an der Außenwelt folgt in zunehmender Weise die Beobachtung des eigenen Ichs.
Die Selbstbeobachtung dient der Selbsterkenntnis, und beide vermögen die Selbsterziehung zu fördern. Die Begegnungen mit der Umwelt und mit sich selbst kommen in Tagebüchern im Laufe der Zeit, wie wir schon sagten, zu sehr verschiedenartigen Mitteilungsformen. Neben Notiz-Tagebüchern stehen seit der Renaissance berichtende und allmählich auch in einem differenzierteren Sinne erzählende Tagebücher. Schon im 16. und 17. Jahrhundert stößt man auf stilisierende Tendenzen. Nach der Mitte des 18. Jahrhunderts (1762–1763, doch erst 1950 gedruckt) schreibt James Boswell das erste moderne »Konfessions«-Tagebuch Europas, als Reinschrift anhand zahlloser Notizen auf Zetteln aller Art. Sein auf diese Weise zustande gekommenes »Londoner Tagebuch« ist echt, doch folgt er vorausgehenden Neigungen, Berichte über Ereignisse verschiedenster Art in der Form fingierter Tagebücher niederzuschreiben, wie es vor ihm schon Daniel Defoe (1659–1731) mit seiner »Pest zu London« getan hatte. Damit entsteht das »literarische« Tagebuch, das seinen unmittelbaren, improvisierten und persönlichen Charakter überhöht und als Kunstwerk eigener Art neben Roman und Erzählung bestehen will2.
Dieser Abart werden wir noch begegnen. Doch wird es seit der Renaissance für die besten und wichtigsten Tagebücher Europas charakteristisch, dass sie alle diaristischen Eintragungsformen umschließen, dass sie also bloße Notiz und systematische Betrachtung, flüchtiges Erinnern und behagliches Berichten, erregtes Ausrufen und sorgfältiges Denken enthalten können. So entstehen im 16. Jahrhundert das Notizen-Tagebuch, das in der Nationalbibliothek Florenz aufbewahrte »Diario« des florentinischen Malers Jacopo da Pontormo (1494–1556) und die betrachtenden »Ephemerides« des scharfsinnigen Humanisten Casaubonus (1559–1614)3. Fast gleichzeitig mit Goethes dürrem Memorandum-Tagebuch, das er von 1775 bis zu seinem Tode führte, wird eines der subjektivsten Tagebücher Europas, die »Journaux intimes« von Benjamin Constant (1767–1830), geschrieben4, doch findet man auch darin ganze Seiten, die lediglich Notizen enthalten. Diese Mischform, die Mannigfaltigkeit der Ausdrucksweise, gehört zu den wichtigsten Merkmalen des echten, nicht literarischen Tagebuchs, wenngleich auch in fingierten Tagebüchern diese Kontraste als Stilmittel oft benutzt werden. Unsere Darstellung behandelt jedoch vorwiegend Tagebücher, die nicht oder zumindest nicht primär eine künstlerische Formung anstreben und die einen deutlich persönlich-bekennerischen Charakter haben. Ein weiteres wichtiges Kriterium ist im Verlaufe dieser Darstellung zu beachten: War dieses oder jenes Tagebuch im Vorhinein zur Veröffentlichung gedacht? Aussage und Stil werden meist von einer Intention oder von einem Verzicht dieser Art bestimmt. Im Allgemeinen mag gelten, dass Tagebücher, deren Publizierung nicht beabsichtigt war, einen höheren Grad von Aufrichtigkeit, jedenfalls von Unmittelbarkeit haben werden. André Gide hat solche Gefahr einer möglichen Beeinflussung von der Absicht her in seinen stets sehr »offenen«, trotzdem zugleich stark stilisierten Diarien klar erkannt. Am 30. März 1932 notiert er: »Die Aussicht auf eine wenn auch nur teilweise Veröffentlichung meines Tagebuchs … hat seinen Sinn entstellt5.« Das gilt nicht nur hinsichtlich eines möglicherweise Alles-Aussagens über sich selbst, sondern ebenso in Bezug auf eine absolute Offenheit im Urteil über Zeitgenossen. Aber auch hier sind die Übergänge fließend, denn keineswegs verhält es sich so, dass Tagebücher, die das Licht der Welt nie erblicken sollten, stets »aufrichtiger« sind als jene, die von Anfang an zur Veröffentlichung bestimmt waren. Man würde die meist komplizierte Natur der echten Tagebuchschreiber zu sehr vereinfachen, wenn man eine solche Behauptung aufstellen wollte. Die mögliche Verhaltensweise eines Menschen lässt sich nicht aus festen Regeln ableiten. Mancher wird sich geradezu ein Vergnügen daraus machen, die Öffentlichkeit durch die Preisgabe von Intimitäten zu schockieren; andere werden sich scheuen, einer seelischen Regung überhaupt schriftlichen Ausdruck zu geben. In »Notabene 45. Ein Tagebuch« schreibt Erich Kästner: »Ich bin auch der Versuchung nicht erlegen, mein Journal mit einem Kunstkalender zu verwechseln. Je mehr ein Tagebuch ein Kunstwerk sein möchte, umso weniger bleibt es ein Tagebuch. Kunstgriffe wären verbotene Eingriffe.« – »Tagebücher präsentieren gewesenes Präsens. Nicht als Bestandaufnahme, sondern als Momentaufnahmen. Nicht im Überblick, sondern durch Einblicke. Tagebücher enthalten Anschauungsmaterial, Amateurfotos in Notizformat, Szenen, die der Zufall arrangierte, Schnappschüsse aus der Vergangenheit, als sie noch Gegenwart hieß6.« Die Frage nach dem Grad der Aufrichtigkeit eines Tagebuches lässt sich durch theoretische Erwägungen allein nicht beantworten. Andere Zeugnisse müssen damit verglichen und – wenn möglich – andere Aussagen geprüft werden. Innere Widersprüche vermögen Aufschlüsse zu geben. Ferner kann aus dem diaristischen »Grundton«, aus dem Bild der gesamten Persönlichkeit und aus dem Vergleich mit anderen Werken ein Annäherungswert an den Wahrheitsgehalt erreicht werden. Einzelne Beispiele sollen dies später belegen.
Den »reinsten« Tagebüchern der letzten fünfhundert Jahre ist eins gemeinsam: die Unmittelbarkeit, der Verzicht auf Stilisierung, das Nebeneinander von Persönlichem und Sachlichem, im Fragmentarischen die Mischung von Staccato und Legato7. Der gute Brief hat ähnliche Eigenschaften, doch unterscheidet ihn, dass er sich an ein Du richtet; auch er kann Intimes enthalten – soweit man es diesem anderen Menschen mitteilen will. Das reine Tagebuch hat nicht die Tendenz, sich aus dem eigenen »Zimmer als Weltgeschichte« (Kafka) zu entfernen.
Kleist hat dem Gespräch nachgerühmt, dass es anregend auf die Inspiration wirke. Für die »allmähliche Verfertigung des Gedankens«, um die stockende Eingebung wieder in Fluss zu bringen, schien ihm Reden das beste Mittel. Vor allem das späteuropäische Tagebuchschreiben kann man häufig als eine Technik bezeichnen, durch ungehemmte Aussprache mit sich selbst in die Tiefe des eigenen Wollens und Empfindens zu gelangen. Ein derartiger Gewinn an Selbsterkenntnis rückt manche Tagebücher in die Nähe von Produkten des »automatischen Schreibens«, das als vorzügliches Steigrohr des Unterbewusstseins gelobt wird. Vielfach wurden Ergebnisse solcher Methode sogar als Dichtung ausgegeben. Das echte Tagebuch zeichnet sich durch eine ähnliche Zweckfreiheit aus, durch das Fehlen der Aufmerksamkeit auf berechnete Wirkung. Es soll weder belehrt oder erbaut, noch getröstet oder gar divertiert werden; es gibt keine Fabel, keinen kausal konstruierten Handlungsablauf und keine prädisponierte logische Einheit …
In seinen Tagebüchern notiert Robert Musil einmal: »Tagebücher? Ein Zeichen der Zeit. So viele Tagebücher werden veröffentlicht. Es ist die bequemste, zuchtloseste Form. Gut. Vielleicht wird man überhaupt nur noch Tagebücher schreiben, da man alles andere unerträglich findet. Übrigens wozu verallgemeinern. Es ist die Analyse selbst; – nicht mehr und nicht weniger. Es ist nicht Kunst8.« Gerade Musil war sich der Krise des überlieferten Romanstils bewusst geworden, der Schwierigkeiten, in einem nur noch konventionell-rationalen Sinne zu »erzählen«. James Joyce (und vor ihm Paul Desjardins) hatten daraus schon die Konsequenz gezogen. Die Technik des syntaktisch aufgelösten »inneren Monologs« sollte alle Strukturen des klassischen Berichts sprengen; es entstand – im »Ulysses« – ein Minuten-Stundenbuch des Unbewussten. Wahrheit und Wahrheiten werden darin offenbar, weil nichts mit Rücksicht auf gesellschaftliche Tabus verkleidet wird. Soziale Scheuklappen fallen. Vernachlässigung alles Pragmatischen lässt der Intuition – wenn auch nicht den Formkräften – breiteren Raum.
Doch ergibt sich auf diese Weise allein noch kein »interessantes« menschliches Tagebuch-Dokument. Damit ein »wertvolles« Diarium entsteht, muss – bei solcher Methode des »Automatismus« – ein selbstkritischer Geist oder eine vitale, fantasievolle Persönlichkeit schreiben. Fehlt es an diesen fundamentalen Eigenschaften, so dienen gerade beabsichtigte, ganz und gar strukturlose Tagesberichte meist modischen Exerzitien, banalen Eitelkeiten und schwachen Selbstbetrügereien.
2. Verschiedenartigkeit der Beweggründe
Damit taucht die zweite Frage auf: Warum schreibt man Tagebuch9? Oscar Wilde hat diese Frage in »Bunbury«, seiner trivialen Komödie für ernsthafte Leute, von Cecily beantworten lassen. Dort sagt Miss Prism: »Ich sehe nicht ein, warum Sie überhaupt ein Tagebuch führen!« Cecily antwortet: »Ich führe ein Tagebuch, um die wunderbaren Geheimnisse meines Lebens einzutragen. Wenn ich sie nicht niederschriebe, würde ich vermutlich alles vergessen.« Darauf entgegnet Miss Prism: »Meine liebe Cecily, das Gedächtnis ist das Tagebuch, das wir alle mit uns führen.« Cecily beendet das Thema: »Ja, aber es verzeichnet meistens die Dinge, die sich nie ereignet haben und sich gar nicht haben ereignen können. Ich glaube, das Gedächtnis ist für beinah alle dreibändigen Leihbibliotheks-Romane verantwortlich10.« Nach Oscar Wilde schreibt man also Tagebuch, um die Erinnerung unverfälscht zu erhalten. Vom Stoff her gesehen, ist dies das Merkmal der meisten Tagebücher, die keine literarischen Fantasiegebilde sind. Alles kann und muss darin seinen Platz finden: ein alltäglicher Besuch und eine Verdauungsstörung, die erste Idee zu einer geistigen Arbeit, das Mischen eines Schlaftrunks für die Nacht, eine Taufe genauso wie ein Diebstahl, ein Todesfall ebenso wie ein Spaziergang.
Gedächtnisstütze das ist ein Antrieb, und sicherlich der älteste11. Der Schweizer Henri-Frédéric Amiel, der eins der umfangreichsten Tagebücher Europas geschrieben hat, vierzehntausend Seiten, will alle seine »acta«, »cogitata« und »sentita«, also alle Begebenheiten in seinem Leben, alle seine Handlungen, Gedanken und Gefühle, durch sein Diarium »der Vergangenheit entreißen«. Diesem riesigen inneren Monolog wollte er, nach einiger Zeit (1840), eine innere Ordnung geben. Er dachte an fünf Rubriken: »Moralisches, Geistiges, Körperliches, interessante äußere Begebenheiten, Projekte (Pläne)« (30. Oktober). Doch gab er den Versuch bald auf; denn selbst ein einzelnes Diarium lässt sich nicht typisierend aufgliedern. Die fünf »Rubriken« Amiels sind jedoch interessant: Sie weisen uns auf die Grunderlebnisse hin, die aufbewahrt und dem Vergessen-Werden entrissen werden sollen. Aber bleiben wir bei den Antrieben! An einer anderen Stelle, am 20. September 1864, legt Amiel, gewissermaßen vor sich selbst, die Gründe dar, die dafür sprechen, dass er sein Tagebuch fortsetzen solle: zunächst: »weil ich allein bin.« Sein Tagebuch sei »sein Zwiegespräch, seine Gesellschaft, sein Gefährte, sein Vertrauter. Es sei auch sein Trost, sein Gedächtnis, sein schmerzstillendes Mittel, sein Echo, der Behälter seiner intimen Erfahrungen, sein psychologischer Wegweiser, sein Schutz gegen das Rosten der Gedanken, sein Vorwand zu leben, fast das einzig Nützliche, das er hinterlassen könne1213.«
Damit haben wir eine ganze Reihe wichtiger Beweggründe für das Tagebuchschreiben. In der Einsamkeit kann der Drang zu einem fixierten Selbstgespräch unüberwindlich werden, weil das Tagebuch das andere Ich vertritt. Tatsächlich sagt Amiel nach beendeten Eintragungen sich selbst »Gute Nacht«; auch Robert Musil beendet eine Betrachtung mit den Worten: »Gute Nacht Herr Musil«; und das andere Ich antwortet: »Gute Nacht Herr Musil.«
»Tagebuch führe ich«, schreibt der deutsche Schriftsteller und Publizist Jochen Klepper, »weil ich fasziniert bin von der Handlung, die ein anderer ›mit meinem Blute‹ schreibt14.«
Das Selbstgespräch regt zu Selbstauslegung, Selbstplanung und Selbstermunterung an. Daraus ergeben sich immer weitere Teilantriebe. Die Selbstauslegung führt zur intimsten Ich-Analyse, die Selbstplanung zu Entwürfen aller Art, die Selbstermunterung zur Selbstdiskussion über Lebensaufgaben und Lebensziele, über Irrtümer und Vorbilder. Benjamin Constant schreibt, dass er sein Tagebuch wie sein Leben behandle15, und dass sein Hauptantrieb die Angst vor der Langeweile sei. Dieser große Europäer, der nicht nur eines der geistvollsten, sondern auch eines der echtesten Tagebücher Europas schrieb, ermahnte sich selbst: »Soyons de bonne foi et n’écrivons pas pour nous comme pour le public.« Constants Journal war als echtes Tagebuch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt; es wurde erst fünfundsechzig Jahre nach seinem Tode aus dem Nachlass veröffentlicht16. Constant hütete es wie ein großes und liebes Geheimnis. Er nannte es einen »diskreten Zuhörer« und schrieb sein elegantes Französisch manchmal in griechischen Buchstaben, aus Angst vor der politischen Polizei, aber auch aus anderen Gründen. Denn über seinen »Liebeswahn« zu Madame de Staël vertraute er seinen Heften so viel Indiskretionen an, dass er sie und sich zu kompromittieren fürchten musste. Deswegen bezeichnete er sein Journal gelegentlich als »ein Lagerhaus von Torheiten17«.
Einen weiteren wichtigen Antrieb bilden die Selbstrechtfertigung und Selbstverteidigung im Kampf mit der Umwelt. In der Heimlichkeit des Nur-für-sich-Schreibens kann man ungestraft gegen Feinde und Kritiker toben und wettern. Baudelaires, Tolstois und Gides Tagebücher, um nur auf diese hinzuweisen, enthalten hierfür genügend Beispiele. Baudelaire wollte sich an ganz Frankreich rächen, der alte Tolstoi belastete für alle Ehekonflikte seine Frau mit oft furchtbaren Anklagen18. André Gide hat vor allem mit seinen literarischen Zeitgenossen in vielfach ebenso indiskreter wie ironischer Weise »abgerechnet«19.
Heimlichkeit und Einsamkeit! Es versteht sich, dass die zahllosen Tagebücher, die in Kasernen, Krankenhäusern und Gefängnissen oder in Verstecken während Kriegen und Revolutionen, unter Diktaturen oder in der Emigration geschrieben wurden, Ausbrüche unterdrückter Kritik und Meinungsfreiheit sind. In dieser Hinsicht wird vor allem das echte Tagebuch in Krisenzeiten zur Manifestation eines immanenten Ausdruckszwanges, ähnlich wie kritische Epochen in Dichtung, Kunst und Musik irreguläre, subjektiv-manieristische Ausdrucksformen erzeugen. Weil vorwiegend problematische Menschen subjektive, ich-analytische Tagebücher führen, veranlassen besonders Krisenzeiten den Problematiker zur diaristischen Auseinandersetzung mit sich und der Umwelt. Die spannungsvollsten Tagebücher Europas sind deshalb, wie wir noch sehen werden, diejenigen, in denen eine individuelle Krise ebenso zum diaristischen Antrieb wird wie eine krisenhafte Umwelt20. Starre Machtsysteme, tyrannische Staatsformen machen den Geist »einsam«, zwingen also den diaristischen inneren Monolog geradezu auf. Ernst Jünger erinnert in den »Strahlungen«, in diesem allerdings hochstilisierten Konzentrat mehrerer in den Jahren des Zweiten Weltkriegs entstandener Tagebücher, an das Tagebuch von sieben Matrosen, die im Jahre 1633 auf einer kleinen Insel im nördlichen Eismeer überwintern sollten und dort starben. »Ihr Tagebuch ist neue Literatur«, schreibt Jünger, »als deren Merkmal man ganz allgemein die Absetzung des Geistes vom Gegenstande, des Autors von der Welt bezeichnen kann.« – »Zu diesen Werken gehört die immer sorgfältigere Beobachtung, das starke Bewußtsein, die Einsamkeit und endlich auch der Schmerz.« Im totalen Staat könne das Tagebuch das »letzte mögliche Gespräch bleiben«21.
Damit sind schon einige der wichtigsten Antriebe genannt, doch bleiben für die historische Entwicklung der europäischen Diaristik zwei geradezu elementare Anregungen, die ihren Ursprung aus der europäischen Bewusstseinsbildung herleiten, von besonderer Bedeutung: die Person-Setzung im Sinne einer personalen Selbsterhöhung und die Selbsterkenntnis als Sinngebung der Selbstbeobachtung und Selbstauslegung. Das Problem der Ich-Steigerung seit der Entdeckung des Individuums in sokratischer Zeit, wie es sichtbar wird im personsteigernden Tagebuch, das wir das pharaonische Tagebuch nennen möchten, werden wir an anderer Stelle dieser Darlegung erörtern22. Auch das Grundproblem, das sich aus der delphischen Forderung des »Erkenne dich selbst« ergibt, soll in anderen Zusammenhängen dargestellt werden. Doch sei in Bezug auf Selbsterkenntnis als Antrieb schon hier auf ein geradezu klassisches Beispiel hingewiesen, das aus der Frühzeit echter »moderner« Tagebücher stammt, auf das bereits genannte »Londoner Tagebuch« von James Boswell23.
Wie so mancher Diarist beginnt Boswell im Stile alter Epen-Proömien mit einer grundsätzlichen »Einleitung«. Von allen Kenntnissen, meint er, sei die Selbsterkenntnis wohl am wichtigsten. Wenn jemand verfolge, was ihn innerlich bewegt und wie er sich nach außen hin verhält, könne er erfahren, »wie er gestaltet ist24«. So wolle er denn sein »wechselndes Empfinden und Verhalten aufzeichnen«. Das werde außerdem seine »Federfertigkeit befördern«. Sollte er aber doch einmal auf Abwege geraten, so werde das Tagebuch ihm helfen, sich eines Besseren zu besinnen. Einfälle, Launen und Fantasien wolle er festhalten, auch Anekdoten, Gespräche und Erlebnisse aller Art. Ein solches Beginnen freilich sei nicht ungefährlich, und wenn er auch stets mit der Wahrheit umgehen wolle, so werde er sich doch hüten aufzuzeichnen, was ihm zum Schaden gereichen könne. Nun, das Tagebuch von Boswell ist vor allem in seiner Vorliebe für »skandalöse« Berichte von amourösen Affären wirklich sehr ungeschminkt. Der ebenso lebenslustige wie erkenntnishungrige junge Literat ist in dieser Hinsicht mit Bekenntnissen wenig zurückhaltend. Eine genau beschriebene »venerische« Ansteckung etwa schildert er mit rücksichtslosem Realismus, macht sich dann aber klar, wie sehr er sich bessern und wie sehr er durch größere Frömmigkeit sich befleißigen müsse, ein wirklich bedeutender Mann zu werden. Das Streben nach Selbsterkenntnis ist bei Boswell, dem Schotten und heimlichen Katholiken, mit einem diaristischen Beichten verbunden. Durch das Bedürfnis nach seelischer Erleichterung wird der Beicht-Charakter, das mehr oder weniger moralisierende Sündenbekenntnis so vieler Diarien erklärt. Dieses Sich-selbst-Beichten, meist mit dem Wunsch nach Selbsterkenntnis zusammengehend, bildet einen der stärksten Antriebe für das »echte« Tagebuchschreiben. Es wird, wie wir noch sehen werden, in der europäischen Geistesgeschichte durch Überlieferungen angeregt, die speziell für die gesamte diaristische Literatur dieser Art einen bis heute ungebrochenen Einfluss behalten haben.
In diesen einleitenden Bemerkungen müssen weitere Antriebe zumindest schon erwähnt werden: die Mode, die Lektüre, die persönliche Anregung durch Freunde. Im aufklärerischen England war das Führen kritischer, »ehrlicher« Tagebücher schon früh üblich geworden, so wie im Italien und im Frankreich des 16. und 17. Jahrhunderts das Schreiben von chronistischen Diarien. Boswell berichtet, dass Johnson ihm empfohlen habe, »ein Tagebuch zu führen, ehrlich und ungeschminkt; es sei eine gute Übung und werde mir später unendlich lieb sein, wenn einmal die näheren Umstände aus dem Gedächtnis entschwunden seien«. Doch riet er, es geheim zu halten und bei seinem Tode verbrennen zu lassen. Stolz konnte Boswell ihm entgegnen, dass er bereits regelmäßig und fleißig an seinem Tagebuch schreibe25; denn schon 1758 hatte ihn der Schauspieler Love dazu angeregt. Dem Bericht seiner Unterredung mit Johnson lässt er den Satz folgen: »Und nun, mein Tagebuch, bist du nicht zu hoher Würde gelangt? Wirst du dich nun nicht doppelt und dreifach entfalten?«
Die persönliche Anregung! James Boswell war mit Jean-Jacques Rousseau, den er 1764 kennengelernt hatte, befreundet. Boswell begleitet im Februar 1766 die Geliebte und spätere Frau Rousseaus, Thérèse Levasseur, nach London, wohin Rousseau bereits vorausgefahren war. Schon in Paris wie später in England mag Boswell Rousseau dazu angeregt haben, seiner seit 1759 geplanten Autobiografie den Charakter von »Bekenntnissen« zu geben. Tatsache ist, dass Rousseau in England die ersten Entwürfe zu seinen »Confessions« schrieb, die fast alle Diaristen Europas von Rang beeinflusst haben26. So etwa E. T. A. Hoffmann, der in seinen Tagebüchern berichtet, dass er dieses epochemachende Werk, das 1781 erschienen war, mindestens dreißigmal gelesen habe27.
Zwischen den großen Diaristen Europas gibt es geheime Beziehungen; manches Tagebuch schult sich an einem anderen oder grenzt sich von diesem ab, um einen eigenen Stil zu gewinnen. Oft sind die Urteile kritisch, aus dem Geist des Widerspruchs entstanden. In seinem Tagebuch befasst sich Franz Kafka28 – außer mit den Diarien Kierkegaards – mit den mehr referierenden als reflektierenden Tagebüchern von Goethe29. Am 19. Dezember 1910 notierte er in einem ersten Anflug von Entzücken: »Ein wenig Goethes Tagebücher gelesen. Die Ferne hält dieses Leben schon beruhigt fest, diese Tagebücher legen Feuer dran. Die Klarheit aller Vorgänge macht sie geheimnisvoll, so wie ein Parkgitter dem Auge Ruhe gibt, bei Betrachtung weiter Rasenflächen, und uns doch in unebenbürtigen Respekt setzt.« An dieser Stelle wurde Kafka durch den Besuch seiner Schwester unterbrochen. Am folgenden Tage korrigierte er seine Beurteilung, so eilig, wie man es sich fast nur in Tagebüchern erlauben kann: »Womit entschuldige ich die gestrige Bemerkung über Goethe (die fast so unwahr ist wie das von ihr beschriebene Gefühl, denn das wirkliche ist von meiner Schwester vertrieben worden)? Mit nichts.«
Was sagt nun ein so intensiver, neuartiger und eigenartiger Tagebuchschreiber wie Kafka über das Tagebuchführen? In einer Aufzeichnung vom 23. Dezember 1911 wird der darin liegende Vorteil erläutert, nämlich »daß man sich mit beruhigender Klarheit der Wandlungen bewußt wird, denen man unaufhörlich unterliegt, die man im allgemeinen natürlich glaubt, ahnt und zugesteht, die man aber unbewußt leugnet auch, wenn es darauf ankommt, sich aus einem solchen Zugeständnis Hoffnung oder Ruhe zu holen«. Von besonderer Eindringlichkeit ist die sorgfältige Stilisierung, die auch für das Tagebuch Kafkas charakteristisch ist: »Im Tagebuch findet man Beweise dafür, daß man selbst in Zuständen, die heute unerträglich scheinen, gelebt, herumgeschaut und Beobachtungen aufgeschrieben hat, daß also diese Rechte sich bewegt hat wie heute, wo wir zwar durch die Möglichkeit des Überblickes über den damaligen Zustand klüger sind, darum aber desto mehr die Unerschrockenheit unseres damaligen, in lauter Unwissenheit sich dennoch erhaltenden Strebens anerkennen müssen.« Am 15. Oktober 1914 schreibt er in einer verzweifelt-depressiven Situation: »Das Tagebuch ein wenig durchgeblättert. Eine Art Ahnung der Organisation eines solchen Lebens bekommen.« Schon zwei Jahre vorher, am 25. Februar 1912, hatte er diese Möglichkeit einer Selbstbewahrung plötzlich erkannt: »Das Tagebuch von heute an festhalten! Regelmäßig schreiben! Sich nicht aufgeben! Wenn auch keine Erlösung kommt, so will ich doch jeden Augenblick ihrer würdig sein.«
Tatsächlich spiegelt ein echtes Tagebuch, selbst ein derart literarisch-stilisiertes wie dasjenige Kafkas, vor allem die »innere« Organisation eines Lebens wider. Kafka spricht vom Leben eines Verzweifelten, der alles opfern wollte und musste, um schreiben zu können. »Ich bin ja wie aus Stein«, so versucht er seinen Zustand zu beschreiben, »wie mein eigenes Grabdenkmal bin ich, da ist keine Lücke für Zweifel oder für Glauben, für Liebe oder Widerwillen, für Mut oder Angst im besonderen oder allgemeinen, nur eine vage Hoffnung lebt, aber nicht besser als die Inschriften auf den Grabdenkmälern« (15. Dezember 1910).
Kafka sucht im Tagebuch-Vorhaben alles das, was nicht schützt, alles das also, was die existentielle Daseinsangst mehr verstärkt als abschwächt. Die Schmerzerfahrung wird ihrer daseinerschließenden Potenz wegen forciert. Geradezu gespenstische Doppel-Ich-Erfahrungen ergeben sich. Am 16. November 1911 liest Kafka in einem eigenen »alten Notizbuch«: »Jetzt abend, nachdem ich von sechs Uhr früh an gelernt habe, bemerkte ich, wie meine linke Hand die rechte schon ein Weilchen lang aus Mitleid bei den Fingern umfaßt hielt.« Oder – im Entsetzen des »Ennui«: »Jetzt abends vor Langeweile dreimal im Badezimmer hintereinander mir die Hände gewaschen.« (23. Mai 1912.) Furcht, Sorge, Angst erlebt er vor allem in Träumen und notiert diese mit unheimlicher Präzision; so am 13. Dezember 1911: »Aus Müdigkeit nicht geschrieben und abwechselnd auf dem Kanapee im warmen und im kalten Zimmer gelegen, mit kranken Beinen und ekelhaften Träumen. Ein Hund lag mir auf dem Leib, eine Pfote nahe beim Gesicht, ich erwachte davon, aber hatte noch ein Weilchen Furcht, die Augen aufzumachen und ihn anzusehn.« Vielfach wird sein Tagebuch, wie etwa auch das von Georg Heym, ein Träumebuch.
Doch setzt sich Kafka nicht nur beständig dem Dasein aus; er »entwirft« sich auch immer wieder in Bezug auf sein persönliches Leben wie auf sein entstehendes Werk. Das Schreiben sei die ergiebigste Richtung seines Wesens, die alle anderen Fähigkeiten leer stehen lasse, schreibt er am 3. Januar 1912 und fügt hinzu: »Ich habe also nur die Büroarbeit aus dieser Gemeinschaft hinauszuwerfen, um, da meine Entwicklung nun vollzogen ist und ich, soweit ich sehen kann, nichts mehr aufzuopfern habe, mein wirkliches Leben anzufangen, in welchem mein Gesicht endlich mit dem Fortschreiten meiner Arbeiten in natürlicher Weise wird altern können.« Allmählich entdeckt er im diaristischen Sich-selbst-Versuchen sein Schicksal in der Literatur. »Der Sinn für die Darstellung meines traumhaften innern Lebens hat alles andere ins Nebensächliche gerückt« (6. August 1914). Der Antrieb zum Tagebuch wird hier von einem existentiellen Bedürfnis nach Selbstkommentar geweckt, der in keinem Augenblick der schmerzhaftesten Daseinserfahrung ausweicht. Im Gegenteil: Mit stets »offener Seele« und stets »offenem Leibe« nimmt er sie wie einen Traum auf, den man zugleich körperlich fühlt. Das Tagebuch erhält auf diese Weise wieder eine alte magisch-mediale Bedeutung. Es wird zu einem Instrument gnostischer Technik30.
3. Zur Psychologie des Diaristen
Wer schreibt Tagebuch? Gibt es Menschen, die hierfür eine spezifische Veranlagung haben? Die Antwort darauf wird nur lauten können: Auf einen bestimmten Charakter kommt es nicht an, doch sind die Tagebücher ebenso unterschiedlich wie die Charaktertypen, introvertierte oder extrovertierte, subjektiv oder objektiv denkende Menschen, exaltierte oder nüchterne Naturen. Kühl prüfende Mathematiker oder taktisch abwägende Heerführer schreiben anders als sensible Poeten oder sogar in der Selbstbeobachtung noch logisch und analytisch verfahrende Philosophen. Doch lassen sich dafür keine festen Regeln aufstellen. Goethe und Eichendorff haben »sachliche« Notiz-Tagebücher und Philosophen wie Maine de Biran und Amiel ausgesprochen subjektive, »intime« Tagebücher geschrieben; seit der Renaissance gibt es zu allen Zeiten dokumentarisch-sachliche neben ichbezogen-subjektiven Tagebüchern.
Trotzdem wird es einleuchten, dass der introvertierte, problematische Charaktertypus eher ein um das eigene Ich kreisendes Tagebuch führen wird als der extrovertierte Tatmensch. Nach der alten Charakterologie des Theophrast, die für die menschenkundlichen Erkenntnisse vieler moral-psychologischer Diaristen so wichtig gewesen ist, wird also der Melancholiker als »Introvertierter« und »Sentimentaler« ein ichbezogenes Tagebuch der intimen Selbstbeobachtung führen, der Phlegmatiker ein kühles Memorandum pflegen, der Sanguiniker ein Taten- und Aktionsverzeichnis anlegen und der Choleriker einen mehr oder weniger »verdrängten«, kritisch-polemischen Skandalkalender der Indiskretionen, Enthüllungen und persönlichen Angriffe verfassen. Da es nun Typen dieser alten wie Typen neuerer Charakterologien kaum in reiner Form gibt, kann es ebenso wenig »feste« Typen unter den Diaristen geben wie ausschließlich gruppenmäßig determinierte Romanciers oder auch Generale.
Eine Typisierung stößt also wie alle psychologischen Systematisierungen auf unüberwindliche Schwierigkeiten. Für geistesgeschichtliche Darstellungen und Wertungen sind solche Normierungsversuche bekanntlich von geringem Wert. Anders steht es mit der Charakterisierung einzelner Tagebuchschreiber aufgrund einer psychologischen Analyse ihrer Niederschriften. Dieser Versuch ist von der französischen Psychologin Michèle Leleu unternommen worden, und die Ergebnisse sind auch für die Literaturwissenschaft interessant. Hinsichtlich unserer Untersuchungen hat die Fortsetzung von acht Typengruppen – von »Nervösen, Sentimentalen, Cholerikern, Leidenschaftlichen, Sanguinikern, Phlegmatikern, Amorphen, Apathischen« – allerdings keinen wesentlichen Erkenntniswert, auch wenn Michèle Leleu ihr Schema auflockert31.
So fragwürdig eine Typologie von Tagebuchschreibern auch ist, so wenig selbst eine aufgegliederte Charakterologie von Diaristen zu speziellen psychologischen Erkenntnissen führt, soll doch auf die Beachtung bestimmter Charaktereigenschaften, die Tagebücher dieser oder jener Art erkennen lassen, nicht verzichtet werden. Die allgemeine Veranlagung des Egozentrikers oder des Allozentrikers, des Introvertierten oder des Extrovertierten, des Zyklothymen oder des Schizothymen wird natürlich die Eigenart eines Tagebuchs, seinen Inhalt wie seinen Stil bestimmen. Gehemmte oder ungehemmte, verletzbare oder widerstandsfähige Menschen, expansive oder kontaktarme, schüchterne oder weltgewandte Naturen, leidenschaftliche oder temperamentlose, verinnerlichte oder überwiegend nach außen gerichtete Charaktere werden sich selbstverständlich auch in ihren Diarien verschiedenartig manifestieren. Doch braucht es dazu keine Systematisierung. Die einzelnen Tagebücher als konkreter Ausdruck jeweils bestimmter Einzelmenschen mit jeweils so oder so zusammengesetzten Charaktereigenschaften sind Gegenstand unserer Untersuchung.
Ausdruck Europas
Weniger werden sich einzelne Formeln ergeben als lebendige Vielfältigkeiten eines in der Verborgenheit des Tagebuchs existierenden europäischen Menschentums. In einem weiteren historischen Sinne wird sich jeder einzelne Beitrag zu dem stofflich und gedanklich reichen europäischen Tagebuch als Ausdruck einer typisch europäischen Situation darstellen, als Ausdruck von Menschen, die eine subjektive Problematik erleben in einer Kultur, die schon nach ihrem ersten Höhepunkt im Griechenland des Perikles als problematisch empfunden wurde – bis sich allmählich geradezu eine Kultur des Problematischen, des Infrage-Stellens, der reflektierenden Selbst- und Weltbeobachtung entwickelte. Fast gleichzeitig schrieben Novalis und Wilhelm von Humboldt ihre Tagebücher. Novalis stellte als Mystiker ständig sein »empirisches« Ich infrage, Humboldt als Wissenschaftler die »naive« Welterfahrung. Novalis schrieb ein »subjektives«, Humboldt ein »objektives« Tagebuch. Beide aber sind Europäer, die Innen wie Außen, Ich wie Umwelt, Subjekt wie Objekt ins Licht des forschenden Geistes stellen. Beide erlitten ihr spezifisches Leid, die schmerzliche Erfahrung des Ungenügens, und beide suchten daher stets nach dem Umfassenden, dem Widerspruchslosen, dem Einheitlichen, dem Absoluten: der eine in dem Phänomen seines Über-Ichs, der andere in den Erscheinungen der Welt, der Natur wie des Geistes. Die individuelle Eigenart einzelner Tagebücher wird durch solche Gemeinsamkeiten nicht eingeschränkt; zahllose Autoren mit unverwechselbar eigenem Charakter haben gemeinsam an dem Schicksalstagebuch Europas geschrieben. Novalis träumte von einem diaristischen Universal-Buch, Herder von einer »Bibliothek der Schriftsteller über sich selbst« als »Beitrag zur Geschichte der Menschheit«. Wir wollen uns an dem europäischen Kapitel dieses universalen Tagebuches oder dieser »Bibliothek« versuchen. Wer schreibt Tagebuch? Wir sagten es schon: alle Charaktertypen. Aber jeder Einzelne schreibt sein ganz persönliches Tagebuch. Für uns sollen weniger die psychologischen Typen der Schreibenden interessant sein als – von der Vielfalt im Zusammenklang der europäischen Tagebücher ausgehend – das Herausarbeiten der Konstante, des spezifisch europäischen Charakters in den wesentlichen, von Europäern geschriebenen Tagebüchern. Sie haben geschrieben unter dem Zwange dessen, was ihnen an Eigenem gegeben war, und in der Freiheit, ihr Leben an die Zukunft weiterzugeben oder darauf in endgültigem Scheitern zu verzichten.
Kapitel II
Selbst- und Weltbeobachtung
1. Ursprünge und Entwicklungen der Selbsterkenntnis
Zwei religiös-ethische Forderungen der nachhomerischen griechischen Antike haben das Bewusstsein der für sich bestehenden, in sich seienden und unteilbaren Persönlichkeit geweckt: das »Erkenne dich selbst« und »Werde, der du bist«. Sokrates, Platon und Aristoteles schufen die immer wieder neu interpretierten Prologe für die so mannigfaltige Literatur der Selbsterkenntnis und Selbstbeobachtung in Europa. In seiner »Geschichte der Autobiographie« hat Georg Misch, eine Fülle fast vergessener hellenistischer und mittelalterlicher Literatur durchdringend, dargelegt, dass der geschichtliche Vorgang, den Jacob Burckhardt »die Entwicklung des Individuums32« nannte, sich in drei großen historischen Räumen vorbereitete: im nachhomerischen Griechenland, in den Schriften der Propheten Israels und in der Renaissance33. Über Mischs Dreiteilung hinausgehend, möchten wir von fünf historischen Räumen sprechen, indem wir den Hellenismus, vor allem der Spätantike (200–500 n. Chr.), sowie das Hochmittelalter miteinbeziehen. Von Heraklits Wort, es sei der Charakter das Schicksal des Menschen, bis zur seelengeschichtlichen Darstellung der Diotima im »Symposion« Platons bildet sich immer mehr die Vorstellung aus, dass eine Persönlichkeit sich im Verlaufe des Lebens entwickelt, und dass die Selbsterkenntnis zumindest Selbstüberwindung ermöglicht. Doch entsteht ein subjektives Ich-Bewusstsein – parallel zur Entfaltung manieristischer Kunstformen – erst im westlichen und östlichen Hellenismus. In Ciceros Briefen, in Senecas moralpsychologischen Episteln und Traktaten und in Marc Aurels Selbstbetrachtungen bereiten sich Selbstgespräche vor, kombinierte Selbst- und Weltbeobachtung vor allem. Diese Namen werden in bedeutenden Tagebüchern von der Spätantike bis zur Gegenwart immer wieder genannt. Sie bilden die großen orientierenden Sternbilder gerade in den Diarien, die Ich-Analyse mit Weltdeutung verbinden.
Marc Aurels »Selbstbetrachtungen« gehen aus von der platonischen Ansicht, es sei das Denken ein Gespräch der Seele mit sich selbst34. Sie wurden zu einem Vorbild für die tägliche Gewissensprüfung, zu einem Muster für systematische Reflexion und berührten sich darin mit ähnlichen christlichen Forderungen. Die kaiserlichen Meditationen sind schon früh als tagebuchähnliche Aufzeichnungen angesprochen worden, und zwar als solche von bereits subjektivem Charakter. In der Tat sind sie Ausdruck einer sich selbst spiegelnden Persönlichkeit, ihres Leidens an der Widersprüchlichkeit des menschlichen Lebens. Daher das Schwanken zwischen Skeptizismus und Religiosität, zwischen Pessimismus und Optimismus. Doch ist der Zeit und dem Stoiker Marc Aurel die subjektivistische Selbstüberschätzung noch ebenso fremd wie die minutiöse Schilderung eigener seelischer Erlebnisse und körperlicher Zustände im Stile der Empfindsamkeit, dieses gleichsam säkularisierten Abkömmlings des Pietismus, im Stile Rousseaus, der Romantiker, des Fin de Siècle und der zeitgenössischen Existentialisten. Selbst- und Weltbeobachtung gehen mehr auf die Erkenntnis der Natur der Menschen aus als auf die systematische Anatomie des eigenen Ichs35. Marc Aurel fragt nach dem Eigentümlichen der vernünftigen Seele. »Sie sieht sich selbst, zergliedert sich selbst, formt sich selbst, wie sie will; die Frucht, die sie trägt, erntet sie selbst … Außerdem umwandelt sie die ganze Welt und das Leere um diese herum und dehnt sich aus in die Unendlichkeit der Ewigkeit und umfaßt und umdenkt die periodische Wiedergeburt des Alls …36«
Doch zeigt sich ein Bruch mit dem noch »kosmisch« gebundenen, dem noch »mythischen« Menschen der Vorzeit, und damit wird der Vorstoß zur Person-Setzung in stoischem, zugleich aber individuellem Geist gewagt. Die Abgrenzung vom reinen Tatmenschen ist eindeutig. »Alexander und Caesar und Pompejus, was sind sie gegen Diogenes, Heraklit und Sokrates? Denn die einen durchschauen die Dinge und die Ursachen und die Stoffe, und ihr Leitvermögen war selbstgenügsam. Dort aber Vermutung über was für Dinge und Versklavung an wie viele Dinge37!« Insofern kann man Marc Aurel als eine der ersten »modernen« Persönlichkeiten bezeichnen, wenn auch im Sinne einer entschlossenen stoischen Person-Eingrenzung mit klaren Selbstentwürfen: Beherrschung des Ichs und Hilfe für den anderen.
Auch Seneca, Mentor des Kaisers Nero und zeitweiliger Verwalter des römischen Reichs, hat mit seinen »Briefen an Lucilius«, die ein fast vollständiges Lehrbuch der Moral darstellen, einen bis heute fortdauernden Einfluss auf die Tagebuchschreiber Europas ausgeübt. – Vielen galten Senecas Schriften als Vorbilder für Selbsterziehung im Sinne einer bewussten Bildung des Charakters. Neben der Selbstüberwindung wird hier eine noble Lehre der Selbstabgrenzung vom Leben der Polis und der Gesellschaft gegeben. Sie wird, wie wir in späteren Abschnitten sehen werden, mit den Leitfiguren des »Solitarius« und des »Occupatus« in den besten europäischen Diarien immer wieder aufgenommen, verarbeitet, neu gedeutet und – wie ein Universalschlüssel – auf immer neue psychische und soziale Situationen angewendet38. Wir wollen uns daher hier mit nur einem Beispiel aus diesen Episteln Senecas begnügen. Über den ethischen Sinn der Selbstbeobachtung schreibt er den für Diaristen der späteren romanischen, germanischen und slawischen Kulturbereiche Europas geradezu klassischen Leitsatz: »Du selbst zieh dich, so gründlich du kannst, vor Gericht, leite eine Untersuchung gegen dich ein; zuerst übernimm die Rolle des Anklägers, dann des Richters, endlich zuletzt die des Fürsprechers39.«
Tagebuchartige Aufzeichnungen, wir deuteten es schon an und werden es noch genauer darstellen, gehören zu den ältesten Sprachdenkmälern Europas. Nach dem ersten, allmählich Gestalt gewinnenden Eindringen in die noch wechselnden, unsicher tastenden Erfahrungen des Ichs entstanden Lebensbeschreibungen persönlicheren Charakters, in dem Maße, in dem der Mensch zu unbefangenerem und zugleich kritischem Erleben befähigt wurde. Georg Misch gebührt das Verdienst, innerhalb dieser historischen Entwicklung auf die »Heiligen Reden« des Rhetors Aelius Aristides von Smyrna (niedergeschrieben etwa 170–179 n. Chr.) hingewiesen zu haben40. In diesem Buch berichtet Aristides über seine Krankheiten und über Träume, in denen Asklepios ihm den Weg zur Genesung zeigt. Es finden sich darin verschwärmte Bekenntnisse – rund zweihundert Jahre vor den »Confessiones« des Augustinus! Doch halten wir vor allem fest, dass Aristides über seine Träume Tagebuch führte. Er schätzte den Umfang dieses Traum-Tagebuchs, das ihm verloren ging, auf über dreißigtausend Zeilen. Das Neue daran war, dass er »den Schwerpunkt aus der Verherrlichung Gottes … fortrückte in die empfindsame Darbietung des eigenen Ichs41«.
Autobiografische Schriften werden von dieser Zeit an immer häufiger. Lebensberichte treten jedoch mehr in der Form von Bildungs- und Bekehrungsgeschichten, von Heiligen- und Märtyrerbeschreibungen auf denn als Selbstdarstellungen. Die Bibel bietet in zunehmender Weise Anlass zu Kommentaren und Betrachtungen42. Der Übergang von den »heidnischen« Philosophen zum Christentum bildet ein zentrales Thema bis zu den »Confessiones« des Augustinus. Zu nennen sind für die griechische Kirche Hilarius, Bischof von Poitiers (um 350: »De trinitate«); der Theologe Ephraim aus Nisibis († 373: »Konfession oder Selbstanklage«); der Rhetor Libanios († 374: »Bios oder von der eigenen Psyche« von 374); der Kirchenvater Gregor von Nazianz (c. 329–c. 389: εις εαυτόν, Carmine de se ipso); der Bischof Synesios von Kyrene mit seinem Werk: »Dio oder vom eigenen Bios« (um 406) und für das lateinische Christentum etwa die »Confessio« des Apostels von Irland, Patrick (um 389–461); Paulinus aus Pella mit seiner Schrift: »Eucharisticos Deo sub ephemeridis meae textu«, Dankgedicht an Gott nach dem Text meines Tagebuchs, (459). Boethius mit seinem »Trost der Philosophie« und schließlich, von höchstem Rang, die 397–398 geschriebenen »Confessiones« des Augustinus, deren Einfluss auf die gesamte abendländische »Beichtliteratur« kaum hoch genug eingeschätzt werden kann.
Echte Tagebücher wird man in diesen Selbstdarstellungen, die um die Mitte des Jahrtausends sehr verbreitet und bis ins Hochmittelalter populär waren, nicht finden, doch ist ein Hinweis auf diese Literatur unerlässlich, weil sie für spätere echte, subjektive Reflexionstagebücher von entscheidender Bedeutung wurde. Sie lehrte Technik, Zweck und Sinn der Selbstbeobachtung, der Gewissensprüfung sowie der nun auch literarischen Beichte. Hier fanden, wie wir noch sehen werden, die Diaristen der Renaissance die Anregung, die einfachen Tages-Memoranden oder Register zu Tageschroniken nunmehr mit Betrachtungen über sich selbst, über das eigene Seelenleben und über das Gedeihen oder Versagen des eigenen Körpers zu füllen. Bemerkenswert ist außerdem, dass schon in der Spätantike in einzelnen Fällen Tagebücher als Vorlagen für Selbstbiografien benutzt wurden; anlässlich der »Heiligen Reden« des Aristides von Smyrna wie des »Dankgedichtes« Paulinus’ von Pella haben wir darauf hingewiesen. Synesios, der Bischof von Kyrene, stellte »die Forderung der täglichen Selbstbeobachtung schon im Interesse der Wahrsagekunst … die die menschlichen Charaktere unterscheiden muß« und infolgedessen »an der Individualisierung mitgewirkt hat«. Weil »frei von den Einflüssen der Außenwelt die individuelle Verfassung einer Seele sich in den Träumen« ausprägt, wird die regelmäßige Aufzeichnung der eigenen Träume wichtig. Deshalb regt er zur Abfassung sogenannter Epinyktiden, Nachtbücher, an, die die Ephemeriden, Tag(e)bücher, vervollständigen sollen und in denen man sich in der Kunst des Erzählens üben und zugleich mit allen seinen Freuden und Leiden bei der Nachwelt fortleben könne. »Sinn und Ausdruck für das Geheimnisvolle … lösen sich jetzt von der ausschließlichen Beziehung auf göttliche Dinge und nicht nur die Neuplatoniker und Augustin … reden gern von den ›recondita cordis‹«, den Geheimnissen des Herzens43. Zu erinnern ist ferner daran, dass dieses konsequente Achten auf eigene Träume, Tag um Tag, genauso wie die subjektiv erschütterte Lebensbeichte des Augustinus neu entsteht, während eine alte Welt untergeht. Diese Hinwendung zum Subjektivismus fällt mit dem Ende der Antike zusammen, mit der Zeit einer der schwersten politischen, wirtschaftlichen, sozialen und geistigen Krisen Europas. Der spätantike Subjektivismus wird ausgelöst durch ein verändertes Weltgefühl, das in zunehmendem Maß von der Problematik der menschlichen Existenz bestimmt ist.
2. Entwicklungen der Selbstbeobachtung
Das Mittelalter vermochte durch einen neuen politischen und theologischen Ordo-Gedanken diese erste Rückwendung auf eine personale Autonomie, als auf ein Rettendes in der Gefahr, noch einmal aufzuhalten, historisch gesehen noch einmal zu hemmen, nachdem die alte Kultur des Imperiums zusammengebrochen war44. Erst langsam entstanden neue Mittelpunkte geistigen Lebens: die Klöster, die Höfe, die Universitäten. Kaum aber hatte sich eine geistig homogene Gesellschaft neu gebildet, als nicht nur der theologische Zweifel wieder erwachte, sondern zugleich auch das auf den Einzelnen bezogene kritische Nachdenken in schicksalhaften persönlichen und politischen Situationen, das Abgrenzen der eigenen Person vom »falschen« Leben der andern, die individuelle Selbsterziehung innerhalb einer erneut als fragwürdig empfundenen Umwelt. Die Motive der Lebens-Problematik werden, bedeutsam für die Weiterentwicklung der Selbstbeobachtung in der späteren subjektiven Diaristik, im 14. Jahrhundert vor allem von Petrarca aufgegriffen.
Petrarcas biografische und moralpsychologische Prosaschriften gewinnen, wie wir später im Einzelnen nachweisen wollen, für die Durchführung eines der wichtigsten Themata europäischer Tagebuchliteratur geradezu kanonischen Wert. So haben wir nach Sokrates und Epiktet, Seneca und Marc Aurel, Aristides und Synesios, Libanius und Augustinus einen weiteren Ahnherrn der diaristischen Selbst- und Weltbeobachtung, und es ist für die Kontinuität der Leitmotive europäischer Seelen- und Schicksalsdarstellungen bezeichnend, dass Petrarca in seinen moralpsychologischen Traktaten, Dialogen und Episteln von manchen der hier hervorgehobenen antiken Autoren ausgeht, vor allem von Sokrates, Seneca und Augustinus45. In dieser Hinsicht hat man wie schon Marc Aurel so auch Petrarca als den ersten »modernen« Menschen bezeichnet, als einen der Vorläufer der Renaissance, die dann Tagebücher von immer subjektiverem Charakter hervorbringt. Wie spätere Denker der Renaissance empfindet sich schon Petrarca als einen Schriftsteller, der unter dem Zwang persönlicher Erwähltheit schreibt und vorbildlich lehrt: als Magister Europas. Er stellt sein Leben nicht nur dar, indem er sich selbst beobachtet, er wird sich auch des progressiven zeitlichen Ablaufes seines Schicksals bewusst, das er als sein ganz persönliches auffasst. Außerdem wird er einer wohl religiös begnadeten, zugleich aber individuell geprägten Sonderstellung inne durch seine Fähigkeit, kosmische Ur-Hieroglyphen und eigene Seelenregungen erkennen und beschreiben zu können. In der Hierarchie alles Seienden nimmt dieses Persönlich-Sein bewusst einen Sonderrang ein. Um ein mystisches Selbstbewusstsein handelt es sich, um das Gefühl der Einzigartigkeit, die ihn befähigt, in der Schöpfung die »uranischen Örter«, die Zeichen des Absoluten begreifen und doch auch im eigenen Herzen lesen zu können46.
In diesem subjektiven Machtgefühl unterscheidet sich Petrarca noch wenig von Leonardo da Vinci, doch schon sehr stark von Montaigne oder gar von Rousseau, diesen anderen, nun bereits neuzeitlichen, sozusagen weltlichen Propheten und laizistischen Kirchenlehrern der europäischen Diaristik. Bei Montaigne wird die Skepsis zu einem heuristischen Prinzip menschenkundlicher Essayistik. Für Rousseau wird die eigene Person unter dem durchdringenden Zauber der Selbstbeobachtung und im angeblich natürlichen, vielfach jedoch fast exhibitionistischen Selbstbekennen eine Realität wie die Natur, wie die Kirche, wie der Staat47.
3. Chronistische Ereignis-Register
Bevor wir diesen Weg in unserem einleitenden Querschnitt weiterverfolgen, müssen wir nun auch einen Blick auf Entstehen und Entwicklung dessen werfen, was man das spezifische Gefäß der Selbstbeobachtung nennen könnte: auf das Tagebuch, die tagtägliche Aufzeichnung als eine Sonderart und Abart der »Gattung« Prosa. Das diaristische Erinnern als eine besondere Technik des Aufzeichnens entwickelte sich zunächst als chronologische Sammlung, als datiertes Register, als diaristisches Taten- und Ereignis-Album – Gefäß und Aufbewahrungsmittel für beachtetes Welt- und Zeitgeschehen. Wir müssen nun in einem kurzen Längsschnitt den Weg beschreiben, den das Tagebuch als schriftliche Mitteilungs- und Aufbewahrungsform genommen hat, um hinreichende Fundamente zu gewinnen. Dann erst wird sich nachweisen lassen, wie die fortschreitende Entwicklung der Tagebuch-Chronik und die stetige Progression analytischer Psychografie zwei Strömen gleich an einem historischen Ort zusammenfließen: in der Renaissance. Im Anschluss wird deutlich werden, wie aus diesem Zusammenfluss ein neuer Ausgangspunkt entsteht, von dem aus sich die Hochformen der egozentrischen Ich-Analyse entwickeln, vom Pietismus und der Romantik bis zur Gegenwart. Dann erst werden wir auch den Weg frei haben für unsere eigentliche Aufgabe: die Darstellung von Grundmotiven in bedeutenden Tagebüchern Europas.
In Alt-Rom fanden die Tatenberichte der Kaiser, ihre politischen Denkwürdigkeiten oder Memoiren eine besonders ausgeprägte Form. Gerade diese politischen Autobiografien der Augustus, Tiberius, Claudius, Hadrian, Septimius Severus, einer Agrippina sind charakteristisch für die römische Kultur, so wenig im Einzelnen davon überliefert ist. Doch hat das antike Rom monumentale Tatenberichte und politische Autobiografien von älteren Mittelmeerkulturen übernommen. Das Ägypten der Pharaonen kannte im Totenkult »Bild-Tagebücher«, die Begebenheiten im Haushalt, im Gewerbeleben, in der Amtsführung, im Hofdienst, im Ackerbau als stellvertretende Wirklichkeit für vergangenes Leben festhielten. Etwa seit 3000 vor Christus gab es biografische Inschriften in ägyptischen Grabbauten, von denen manche, wie etwa die Lebensbeschreibung des Gouverneurs Una aus der 6. Dynastie, in Ich-Form abgefasst waren. So sehr jedoch die bildende Kunst, die Skulptur, individualisiert, die Biografie selbst bleibt vollkommen unpersönlich. Doch hat gerade diese ägyptische Grabbiografie nicht in ungebrochener Tradition auf die Römer eingewirkt; vielmehr zeigt sich eine Entwicklungslinie, die ihren uns bekannten Anfang im babylonischen Reich nimmt, in den Aufzeichnungen und Tatenberichten seiner Herrscher48.
Doch hat Alt-Rom in seiner Architektur altägyptische, pharaonische Verewigungsstile wie assyrische Kolossalvorstellungen übernommen. Es vereinen sich verschiedene Kolossalitäts-Ideale im römischen Cäsarismus, und wir werden sehen, wie derartige Vorbilder in persönlichen, subjektiven Tagebüchern Europas – von der Romantik bis heute – immer aufs Neue in individuellen Träumen von Größe und Unsterblichkeit wiederkehren.
Für die imperiale Hof-Diaristik Alt-Roms als einen der vielen historischen Antriebe aus älteren Mittelmeer-Kulturen wurden Herrschertaten-Berichte aus Persien und später auch die Darstellungen in Ich-Form aus der Bibel zum Vorbild. Unmittelbare Anregungen erhielt die kaiserliche Diaristik von den königlichen »Ephemerides« oder »Hypomnemata«, von den königlichen Berichten über das Leben am Hofe Alexanders des Großen49. Den ersten altrömischen Kaiserbericht hat Cäsar Augustus geschrieben, und mit diesem Beispiel aus den imperialen »res gestae« müssen wir uns hier begnügen. Augustus verfasste seinen Tatenbericht in seinem Todesjahr, 14 nach Christus, als die politische »Summe« einer fünfzigjährigen Herrschaft, im sakralen Stil eines Pontifex Maximus wie in der knappen Redeweise des Kaisers als Heerführer50. Pathos und Nüchternheit, Selbstverherrlichung und Selbstrechtfertigung mischen sich in diesem Dokument, das als Wort-Monument aere perennius gedacht war, ursprünglich im Tempel der Vestalinnen aufbewahrt und nach letztwilliger Verfügung auf zwei vor dem Grabmal aufgestellte Bronzepilaster graviert wurde. Ähnlich wie in so manchen Tagebüchern fehlt es auch darin nicht an Unrichtigkeiten, ja Korrekturen der Wahrheit, auch wenn gerade dieser kaiserliche Tatenbericht weitaus weniger Fälschungen enthält als so mancher spätere.
Von Tiberius stammt die Überschrift: »Die Taten des Gottes Augustus, durch die er die Welt dem Imperium des römischen Volkes unterworfen hat, und seine Aufwendungen für Staat und Volk der Römer51.« Das Dokument beginnt mit den Worten: »Neunzehn Jahre alt habe ich auf eigenen Ratschluß und aus eigenen Mitteln ein Heer geworben und dem Staat, der unter die Herrschaft einer Partei gekommen war, die Freiheit wiedergebracht.« Diese Befreiung des Staates ist das Grundthema einer auf Unsterblichkeit in der Erinnerung der Menschen hinzielenden Ich-Pyramide! »Durch neue Gesetze habe ich mehrfach Vorbilder der Vorfahren, die in unserer Übung nicht mehr Kraft hatten, wieder eingeführt und selbst für viele Dinge ein Vorbild zur Nachahmung der Nachwelt überliefert.« Rechenschaft wird also abgelegt im Angesicht der Ewigkeit, doch im Sinne einer immensen Selbststeigerung. Das imperiale Monumental-Diarium hat vor allem den Charakter einer Selbstruhm-Schrift, und es versteht sich: legitimiert durch politische, wenn auch nicht immer durch moralische Größe52. Weit weniger bedeutende Herrscher haben in späteren Jahrhunderten ebenfalls mehr oder minder fleißig Tagebücher geführt, die nun auch intimeren Charakter annahmen, wie zum Beispiel das »skandalös«-autistische Diarium Ludwigs II. von Bayern. Diarien schrieben auch unter andern Kaiser Friedrich III., König Eduard VI., Ludwig XVI., Viktoria von England, Friedrich II. (von Preußen), Nikolaus II. von Russland (meist über das Wetter) sowie einige Päpste53.
Die chronistischen Tagebücher erfahren ihre erste Wandlung in der Renaissance, und zwar zunächst in der italienischen, wo aus einer erneuten Hinwendung zur römischen Antike ein neues, alle Lebensbereiche umfassendes Weltgefühl entsteht. Das Beispiel der kaiserlichen Diarien, zusammen mit dem wachsenden Individualbewusstsein, regte nun auch andere, weniger herrscherliche Persönlichkeiten – Stadtschreiber, Notare, Beamte, Hof-Mercurii aller Art – dazu an, für sich, für ihr im Schatten der Weltereignisse lebendes Ich private Taten- und Ereignis-Verzeichnisse diaristischer Art statt politisch-offizieller anzulegen.
Gerade im Renaissance-Rom entstehen im Zuge des so mannigfaltigen Neuerfassens der Antike die ersten chronistischen Tagebücher Europas. Ferdinand Gregorovius hat sie für seine historischen Forschungen fleißig benutzt. Durch sie wurde er zu seinen eigenen »Römischen Tagebüchern« angeregt.
Die Tatenberichte der römischen Kaiser, Staatstagebücher eines gottähnlichen, souveränen, in diesen Ereignis-Aufzeichnungen jedoch völlig unpersönlichen Über-Ichs, wurden allmählich Vorbilder für die chronistischen Tagebücher solcher Untertanen, die als Advokaten, Gelehrte, Dolmetscher, Senatsschreiber, Nachrichten-Verfasser und so weiter an mehr oder weniger exponierter Stelle nur noch Zeugen, nicht Urheber von Ereignissen waren. Statt pathetischer kaiserlicher Monument-Journale werden immer nüchternere Privat-Diarien, Privat-»Zeitungen« abgefasst. Die Welt, in der man sich bewegt, wird nicht mehr von oben, sondern von unten und vor allem von allen möglichen Seiten- und Nebentüren her beobachtet. Und dann kommen Verschmitztheit und Indiskretion allmählich zur Geltung. Diese Tagebuch-Chronisten begreifen seit der zweiten Jahrtausendhälfte immer mehr, dass man persönlich die Ereignisse, deren Zeuge man ist, auch anders sehen und werten kann, als es in feierlichen Staatsbotschaften geschieht. Im Zuge des wachsenden »privaten« Person-Gefühls werden so auch die rein chronistischen Tagebücher – das heißt, die Diarien, die nicht über die eigene Person Betrachtungen anstellen, sondern nur äußere Begebenheiten »melden« – immer subjektiver, zumindest im Grundton des Berichts. Die anekdotische Kleinmalerei verdrängt das pathetische Fresko. Die Vorliebe für menschliche Eigenarten, Liebenswürdigkeiten und Schwächen, für den »human background«, wird immer auffallender: Kaiser und Päpste sieht man weniger auf ihren Thronen als in häuslichen Pantoffeln; Sprüche der Macht nimmt man nicht mehr gläubig auf wie religiöse Dogmen. Insofern sind diese Chronik-Diarien, auch wo sie nur über Ereignisse und Begebenheiten der Außenwelt berichten, zugleich Zeugnisse einer sehr persönlichen Weltbeobachtung.
In der Renaissance fließen die Traditionen der überwiegend chronistischen Tatenberichte vor allem Alt-Roms und die überlieferten hellenistischen Ansätze zu subjektiver Selbstbeobachtung allmählich zusammen. Die persönlichen sowohl wie die chronistischen Tagebücher werden in der Renaissance immer zahlreicher. Zugleich gewinnen auch die Chronik-Diarien eine immer persönlichere, kritische Färbung. Daneben entstehen – geistesgeschichtlich entscheidend – die ersten autobiografischen, fast »egozentrischen« Tagebücher. Einzelne – wie etwa diejenigen eines Pontormo, Casaubonus und John Dee54 – leiten in der Vereinigung von Selbst- und Weltbeobachtung die diaristische Neuzeit ein, auch wenn sie zumeist erst viel später veröffentlicht wurden, also auf die weitere Entwicklung nicht unmittelbar einwirken konnten. Diese wenigen erhaltenen Dokumente lassen erkennen, dass die subjektive Diaristik bereits in der Renaissance entstanden ist55. Außerdem ist anzunehmen, dass viele Schriften dieser Art vernichtet wurden oder noch heute in irgendwelchen Archiven und Bibliotheken einen Dornröschenschlaf halten56.
Die ältesten bisher bekannten italienischen Chronik-Tagebücher neuerer Art gehen auf das 14. und den Anfang des 15. Jahrhunderts zurück, so das »Diario di Anonimo Fiorentino« (1358–1389) und das »Diario Ferrarese« (1409–1502)57. Die Künstler-Tagebücher der Maso di Bartolomeo und Luca di Landucci umfassen die Zeit von 1447 bis 1453, beziehungsweise 1480 bis 151858. Das »Diario« Jacopo da Pontormos wurde zwischen 1554 und 1556 geschrieben, »als er den Chor von San Lorenzo ausmalte«59. Eins der ersten umfangreichen chronistischen »Zeitungs«-Tagebücher ist das »Diario della città di Roma« von Stefano Infessura (1436–1500). Es umfasst die Jahre 1303–1494. Die »res romanae« werden wie im Altertum als Weltereignisse empfunden, und Infessura ist stolz, ihr Zeuge zu sein60. Ein anderes Rom-Tagebuch von Rang, als Quelle für die Geschichte der Ewigen Stadt um 1500 häufig benutzt, ist das »Diarium« des Straßburger Geistlichen und späteren Zeremonienmeisters am Hofe Papst Alexanders VI. Johann Burckard (um 1445–1506)61