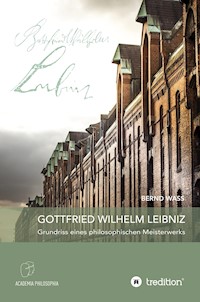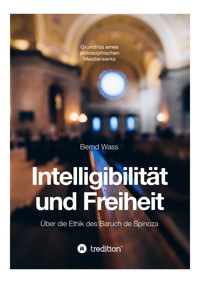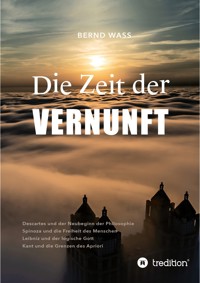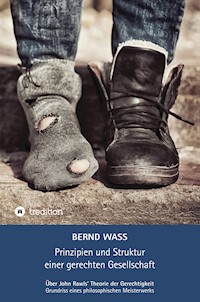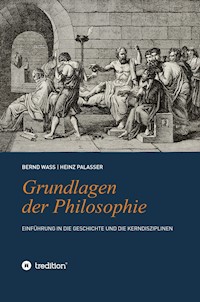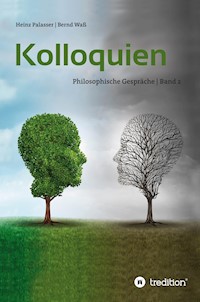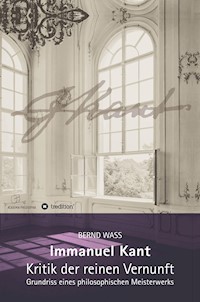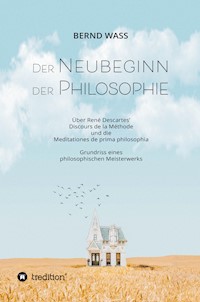
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wie kaum ein anderer Denker steht René Descartes für den Neubeginn der Philosophie. Ein Neubeginn, der vor allem entlang seiner beiden Hauptwerke, ›Discours de la Méthode‹ und ›Meditationes de prima philosophia‹, auskristallisiert. Es ist die Zurückweisung der ungeheuren epistemischen Sicherheit des Mittelalters samt der Philosophie seiner Autoritäten, die Abkehr von der Naturphilosophie Aristoteles', die methodologisch fundierte und begrifflich präzise Ausgestaltung der tradierten Beziehung von Ich, Welt und Gott, aber auch die literarische Selbstinszenierung, die Descartes berühmt werden lässt. Vor dem Hintergrund der Philosophie des Mittelalters und den philosophiehistorischen Implikationen des Cartesianismus sollen die außergewöhnliche Bedeutung Descartes' für das moderne Denken, die Originalität seiner Philosophie und der Grundriss seiner beiden Hauptwerke herausgearbeitet werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 242
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Der Neubeginn der Philosophie
Über René Descartes’ Discours de la Méthode und die
Meditationes de prima philosophia
– Grundriss eines philosophischen Meisterwerks –
Werkerschließung im Rahmen der Sommerakademieder Academia Philosophia, Frankreich, Logis de Beaulieu, Poullignac
© Academia Philosophia
Österreichische Privatakademie für Philosophie und philosophische Weltdeutung, 2020
Gründungsdirektoren: Mag. phil. Dr. phil. Bernd Waß, MSc; Mag. Dr. Heinz Palasser, MBA, MSc
www.academia-philosophia.com
Herausgeber: Academia Philosophia, Salzburg & Wien
Autor: Mag. phil. Dr. phil. Bernd Waß, MSc (www.berndwass.com)
Umschlaggestaltung, Illustration, Grafik: Mag. Petra Pfuner, CreativbüroVitamin©
Cover-Bild: Pexels, Jeffrey Czum, Creative Commons Zero (CCO) Lizenz
Verlag: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359, Hamburg
978-3-347-03467-9 (Paperback)
978-3-347-03468-6 (Hardcover)
978-3-347-03469-3 (e-Book)
Erste Auflage 2020
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
DER AUTOR
Bernd Waß studierte am Institut für Philosophie der Kultur- und Gesellschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Salzburg Analytische Philosophie. Zum Doktor der Philosophie promovierte er bei Prof. Dr. Reinhard Kleinknecht, Prof. Dr. Otto Neumaier und Prof. Dr. Volker Gadenne mit einer Arbeit zur Philosophie des Geistes. Er ist Philosoph und Privatgelehrter, ordentliches Mitglied der Österreichischen Gesellschaft für Philosophie und Gründungsdirektor der Academia Philosophia. Seine Arbeits- und Forschungsschwerpunkte finden sich in der Metaphysik, insbesondere der Philosophie des Geistes, und der Erkenntnistheorie.
Die Philosophie hat alles, um im besten Fall nichts mit ihr zu tun zu haben:
Sie ist theoretisch, nicht praktisch; sie ist lebensfern, nicht lebensnah und die Beschäftigung mit ihr ist überaus schwierig. Mit der Leichtigkeit des Seins hat sie nichts zu tun. Um es im Stil des französischen Philosophen und Seismografen des Verfalls, Emil M. Cioran, zu sagen: Das Pendel des Lebens schlägt nur in zwei Richtungen aus, in die der heilsamen Illusion oder der unerträglichen Wahrheit. Letztere ist ihr Geschäft. Welt und Mensch am Seziertisch des Denkens. Unter dem Philosophenhammer bleibt nichts heil. Vielleicht aber ist sie gerade deshalb so anziehend, so schillernd, so faszinierend, so tief; lässt sie einen nicht mehr los.
Zum Gebrauch der vorliegenden Abhandlung
Um den Gebrauch der vorliegenden Abhandlung zu erleichtern, sei auf einige Besonderheiten hingewiesen:
Besondere Aufmerksamkeit
Ausdrücke die vom Leser besondere Aufmerksamkeit erfordern oder die sich aus Gründen der besseren Lesbarkeit vom Fließtext abheben sollten, werden durch schräg gestellte Schriftzeichen gekennzeichnet. Zum Beispiel: Der Neubeginn der Philosophie Descartes’ zeigt sich an der präzisen Ausarbeitung des Verhältnisses von Ich, Welt und Gott.
Anführungsnamen
Um Ausdrücke, die erwähnt werden, von Ausdrücken zu unterscheiden, die verwendet werden, werden Anführungsnamen gebildet. Ein Anführungsname wird gebildet, indem der betreffende Ausdruck in einfache Klammern gesetzt wird. Zum Beispiel: ›Rene Descartes‹ ist der Name eines berühmten Philosophen. Anführungsnamen wurden, dem besseren Verständnis wegen, dort, wo entsprechende Kennzeichnungen fehlten, auch in Zitaten eingefügt.
Metaphorische Ausdrücke
Metaphorisch gebrauchte Ausdrücke werden in doppelte Klammern gesetzt. Zum Beispiel: Es sind wohl nicht zuletzt Descartes’ schriftstellerische Fähigkeiten, die es ihm erlauben »philosophische Minenfelder« beinahe spielerisch zu überwinden.
Kurze wörtliche Zitate
Wörtliche Zitate, mit einer Länge von bis zu sechs Zeilen, werden im Fließtext durch Anführungszeichen und Fußnote gekennzeichnet. Zum Beispiel: „Die Beredsamkeit besitzt unvergleichliche Kraft und Schönheit und die Poesie hinreißendste Lieblichkeit und Feinheit“1
Lange wörtliche Zitate
Wörtliche Zitate, mit einer Länge von mehr als sechs Zeilen (davon ausgenommen sind Zitate in Fußnoten), werden durch Einrückung, kleinere Schriftgröße und Fußnote gekennzeichnet. Zum Beispiel:
Was die Gedanken betrifft, die ich von einigen anderen Dingen außerhalb von mir hatte, wie vom Himmel, von der Erde, vom Licht, von der Wärme und tausend anderen, hatte ich keine große Mühe, zu wissen, von wo sie kamen. Denn ich bemerkte in ihnen nichts, was sie mir überlegen zu machen schien, und konnte deshalb glauben, daß diese Dinge, falls sie wahr waren, von meiner Natur abhingen, insofern sie eine gewisse Vollkommenheit hatte, oder daß ich sie, falls sie nicht von meiner Natur abhingen, aus dem Nichts schöpfte […]. Das aber konnte bei der Idee eines vollkommeneren Seins als dem meinigen nicht der Fall sein: denn sie aus dem Nichts zu schöpfen, war offenkundig ganz unmöglich. Ich konnte sie jedoch ebensowenig aus mir selbst schöpfen: denn es ist kein geringerer Widerspruch, daß das Vollkommenere eine Folge und Ding sein solle, das von etwas weniger Vollkommenen abhängt, als daß etwas aus nichts hervorgeht.2
Fußnoten
Manche Menschen mögen keine Fußnoten. Ich hingegen liebe sie. Nur mit einer Fußnote ist eine Seite gut gekleidet. Fußnoten stellen nämlich einen Mikrokosmos zusätzlich artikulierter, wenngleich nicht vordergründiger, Informationen und Gedankengänge dar. So finden sich darin erstens sämtliche Quellenangaben zu wörtlichen und sinngemäßen Zitaten; zweitens Anmerkungen, um bestimmte Begriffe oder Zusammenhänge in Zitaten zu erläutern; drittens Ausschnitte aus dem Originaltext, auf die nicht verzichtet werden wollte, obschon man sie hätte vernachlässigen können; viertens Erläuterungen und Hinweise zum besseren Verständnis des Textes (sowohl des Originaltextes als auch des hier vorliegenden Textes) insgesamt; fünftens Seitenverweise zum jeweiligen Abschnitt des Originaltexts, um die Orientierung zu behalten und es der LeserIn während des Studiums jederzeit zu erlauben, zwischen dem Originaltext und der hier vorliegenden Abhandlung zu vergleichen.
1 Descartes, René: Discours de la Méthode, Meiner, Hamburg, 2011, S. 11.
2 Descartes, René: Discours de la Méthode, Meiner, Hamburg, 2011, S. 61
Inhaltsverzeichnis
§ 1 Hintergrundüberlegungen
§ 1.1 Die Philosophie des Mittelalters
§ 1.1.1 Die Patristik
§ 1.1.2 Die Scholastik
§ 1.2 Der Standpunkt Descartes’: Philosophiehistorische Implikationen des Cartesianismus
§ 2 Discours de la Méthode
§ 2.1 Discours de la Méthode: Erster Abschnitt
§ 2.2 Discours de la Méthode: Zweiter Abschnitt
§ 2.3 Discours de la Méthode: Dritter Abschnitt
§ 2.4 Discours de la Méthode: Vierter Abschnitt
§ 2.5 Discours de la Méthode: Fünfter Abschnitt
§ 2.6 Discours de la Méthode: Sechster Abschnitt
§ 2.7 Rückschau
§ 3 Meditationes de prima philosophia
§ 3.1 Meditationes de prima philosophia: Erste Meditation über die erste Philosophie
§ 3.2 Meditationes de prima philosophia: Zweite Meditation über die erste Philosophie
§ 3.3 Meditationes de prima philosophia: Dritte Meditation über die erste Philosophie
§ 3.4 Meditationes de prima philosophia: Vierte Meditation über die erste Philosophie
§ 3.5 Meditationes de prima philosophia: Fünfte Meditation über die erste Philosophie
§ 3.6 Meditationes de prima philosophia: Sechste Meditation über die erste Philosophie
§ 3.7 Rückschau
§ 4 Der Neubeginn der Philosophie: Eine Rekapitulation
§ 5 Die Philosophie des René Descartes: Ein Fazit
Literaturverzeichnis
§ 1 Hintergrundüberlegungen
Seit der Gründung der Academia Philosophia verstehen wir uns als Bindeglied zwischen der akademisch-universitären Philosophie einerseits und einer breiteren Hörerschaft andererseits. Es wäre schade, so dachten wir uns, wenn die Faszination philosophischer Weltdeutung nur jenem kleinen Kreis von Menschen vorbehalten bliebe, der sich von Berufswegen mit der Philosophie beschäftigt. Auch wenn die Hochzeit der Philosophie – so es sie denn jemals gegeben hat – in einer ökonomisierten und am Maßstab des Praktischen orientierten Gesellschaft allem Anschein nach vorüber ist, glauben wir nichtsdestoweniger, dass die Beschäftigung mit philosophischer Weltdeutung für unser geistiges Leben unverzichtbar ist. Der Entwurf einer feingliedrigen, vernünftigen und logisch zureichenden Weltanschauung, die Disziplinierung des Denkens und die Verbesserung der Urteilskraft können nirgendwo vorzüglicher gelingen als in der Philosophie. Nicht zuletzt deshalb bemühen wir uns um die Vermittlung wissenschaftlicher Philosophie und die Pflege eines breit angelegten philosophischen Diskurses; außerhalb der Mauern der Universitäten, eine fachfremde Hörerschaft im Blick, aber dennoch auf akademischem Niveau. Ein Programm, das uns immer wieder vor intellektuelle Herausforderungen stellt. Im Versuch, eine solche Herausforderung zu bewältigen, nämlich eine Textgrundlage für den philosophischen Diskurs im Rahmen unserer alljährlichen Sommerakademie zu erarbeiten, ist das vorliegende Buch entstanden: ›Der Neubeginn der Philosophie: Über René Descartes ’Discours de la Méthode und die Meditationes de prima philosophia – Grundriss eines philosophischen Meisterwerks‹. Man kann es daher im Sinne einer Propädeutik lesen – als Vorbereitung zum Studium der beiden Originaltexte – aber auch als eine in sich geschlossene Arbeit, deren Anspruch es ist, das Denken des 1596 in Frankreich, in La Haye en Touraine, dem heutigen Descartes, geborenen und 1650 in Stockholm verstorbenen Philosophen René Descartes systematisch nachzuzeichnen und im Prinzip verständlich zu machen. Dementsprechend geht es hier nicht darum, dieses Denkgebäude kritisch zu durchdringen, als vielmehr darum, es im Sinne einer gewissen Vertrautheit ein erstes Mal zu begehen. Grundlage dieser Begehung sind die bei Felix Meiner erschienen Werke ›Descartes, René: Discours de la Méthode, Hamburg, 2011‹1 sowie ›Descartes, René: Meditationes de prima philosophia, Hamburg, 2008‹2. Die Behandlung sowohl der Methodenlehre (1637), mithin der Erkenntnis- bzw. Wissenschaftstheorie Descartes’, als auch der Meditationen3 (1641), mithin seiner Metaphysik, in ein und derselben Arbeit, ruht auf zwei Gründen auf: Einerseits lässt sich die Methodenlehre, die Descartes, weit über seine Zeit hinaus, berühmt macht, als Vorwort der Meditationen lesen und andrerseits, was philosophisch schwerer wiegt, ist sie deren unmittelbare methodische Voraussetzung. Denn insofern die Metaphysik, wie von Descartes intendiert, eine Fundamentalmetaphysik sein soll, und zwar im Sinne einer Grundlagenwissenschaft, die „nicht nur das eine oder andere spezielle Problem zu lösen, sondern die Grundlage aller Metaphysik, aller wissenschaftlicher Erkenntnis, ja […] aller menschlichen Erkenntnis“4 überhaupt zu legen hat, muss gezeigt werden, wie sie möglich ist. Und eben dies geschieht im ›Discours de la Méthode‹. Der ›Discours de la Méthode‹ – der Entwurf der Methode – und die ›Meditationes de prima philosophia‹ – die Reflexionen über die erste Philosophie – sind also miteinander verwoben, sodass es systematisch vernünftig erscheint, sie auch im selben Atemzug einer Behandlung zuzuführen.
Am Beginn eines jeden philosophischen Nachdenkens steht die Suche nach einem Drehpunkt, der das Zentrum dieses Denkens zu bilden vermag, von dem aus die Fäden der Analyse gesponnen aber auch verstehend zurückverfolgt werden können. War es beispielsweise in unserer Beschäftigung mit Gottfried Wilhelm Leibniz die Frage nach der Möglichkeit von Erkenntnis überhaupt, bei Immanuel Kant der Versuch die Metaphysik auf wissenschaftliche Beine zu stellen oder bei John Rawls der Gedanke an ein rational begründetes Fundament einer gerechten Gesellschaft, so ist es bei René Descartes der epochemachende, bis in die Gegenwart hinein nachklingende, alle bloße Nachahmung verwerfende und den Übergang vom Mittelalter in die Neuzeit markierende Neubeginn der Philosophie.5 Ein Neubeginn, der sich erstens in der Zurückweisung der ungeheuren epistemischen Sicherheit des Mittelalters samt der Philosophie seiner Autoritäten zeigt; der zweitens in einem Bruch mit der Antike besteht, vor allem mit der am Beginn der Neuzeit vorherrschenden Naturphilosophie Aristoteles’, wodurch drittens das Verhältnis von Ich, Welt und Gott, das in den Jahrhunderten des Übergangs vom Mittelalter zur Neuzeit auf vielfältige Weise gedeutet wird, eine methodologisch fundierte und begrifflich präzise Gestalt annimmt; und von dem sich viertens, letztlich nicht überraschend, zeigen wird, dass er über die weiteste Strecke gar keiner war. Dementsprechend werden wir uns zunächst, noch bevor wir uns mit Descartes selbst beschäftigen, mit der Philosophie des Mittelalters auseinandersetzen, sowie daran anschließend mit den philosophiehistorischen Implikationen des Cartesianismus. Denn nur vor diesem Hintergrund lässt sich die außergewöhnliche Bedeutung Descartes’ für das moderne Denken, die Originalität seiner Philosophie und die Wirkmächtigkeit seiner beiden Hauptwerke ›Discours de la Méthode‹ und ›Meditationes de prima philosophia‹ angemessen verstehen; lässt sich aber auch der Eindruck vermeiden, die hier vorgelegte Descartes-Exegese wäre nur eine fragmentarische Wiederholung eines zusammenhanglos daherkommenden und längst der Vergangenheit angehörenden Stücks Philosophie.
§ 1.1 Die Philosophie des Mittelalters
Spricht man von der Philosophie des Mittelalters, so überspannt man einen Zeitraum des abendländischen Denkens von rund eintausend Jahren. Ein Denken, das mit dem Untergang des weströmischen Reichs (476) bzw. der Schließung der Akademie Platons durch Kaiser Justinian I. (529) anhebt und mit dem Beginn der Reformation (1517), dem Anbruch der sogenannten Neuzeit, endet. Eingebettet in die Patristik6 – die Zeit der Kirchenväter7 – (in etwa 2. bis frühes 8. Jahrhundert) und die Scholastik8 – die Zeit der Schulen und der methodischen Beweisführung – (in etwa 11. bis ca. Ende 13. Jahrhundert) gibt es kaum eine andere Epoche der philosophischen Weltdeutung, deren Charakteristik so klar zutage tritt, wie jene der Philosophie des Mittelalters. Seit Augustinus von Hippo9 (354-430), dem größten der Kirchenväter und Lehrer des Abendlandes, insbesondere aber seit Bischof Anselm von Canterbury (1033-1109), gehorcht sie dem Motto: „Wisse um glauben, glaube um wissen zu können.“10 Die Philosophie, die bis hierher die großen Fragen um Welt, Mensch und Gott allein vermittelst der Vernunft zu beantworten suchte, „verbindet sich in dieser Periode mit dem religiösen Glauben und er mit ihr […]“11. Wie sonst zu keiner anderen Zeit „der abendländischen Geistesgeschichte lebt hier eine ganze Welt in der Sicherheit über das Dasein Gottes, seine Weisheit, Macht und Güte; über die Herkunft der Welt, ihre sinnvolle Ordnung und Regierung; über das Wesen des Menschen und seine Stellung im Kosmos, den Sinn seines Lebens, die Möglichkeiten seines Geistes im Erkennen des Weltseins und in der Gestaltung des eigenen Daseins; über seine Würde, Freiheit und Unsterblichkeit; über die Grundlagen des Rechts, die Ordnung der Staatsmacht und den Sinn der Geschichte“12. Der Wucht dieser Sicherheit nichts entgegenzusetzen vermögend, tritt die Philosophie zurück, denn die Lösung ihrer genuinen Probleme ist keine Kategorie mehr; „sie waren schon gelöst durch den Glauben“13. Das, was auf dem Boden dieses Glaubens stehend ab jetzt ihre Aufgabe ist, und bis zum Ende des Mittelalters auch bleiben wird, ist nur noch die „Begründung, Verteidigung, Erläuterung, wissenschaftliche Analyse und Synthese“14 der Inhalte desselben. Mithin: Die Philosophie eine Magd der Theologie. Ein Befund, der auf den einflussreichen Benediktinermönch und Kirchenlehrer Petrus Damiani (1006-1072) zurückgeht, für den die reine Philosophie eine Erfindung des Teufels ist und die Gesetze der Logik – für die Philosophie von alters her das Maß aller Dinge – vor Gott ungültig. Historisch gesehen erscheint es daher nicht verwunderlich, dass die Eigenständigkeit des philosophischen Denkens dieser Zeit vielfach bezweifelt wird. Doch man darf die Bedeutung der Philosophie des Mittelalters trotzdem nicht verkennen:
Einmal bildet das Mittelalter die Brücke von der Antike zur Neuzeit. Es hat nicht nur die alten Codices abgeschrieben, hat damit nicht nur Wissen und Kunst der Antike aufbewahrt, es hat in seinen Schulen auch die Kontinuität der philosophischen Problematik aufrechterhalten. Die so grundlegende Thematik, z. B. um die Substanz, die Kausalität, die Realität, Finalität, Universalität und Individualität, Sinnlichkeit und Erscheinungswelt, Verstand und Vernunft, Seele und Geist, Welt und Gott, taucht nicht erst im Humanismus und der Renaissance wieder wie neu und unmittelbar von der Antike kommend auf, sondern wird den neuzeitlichen Philosophen vom Mittelalter her übergeben. […] Und schließlich ist das Mittelalter in vieler Hinsicht vorbildlich: Formal durch die logische Schärfe und Stringenz seiner Gedankenführung und den objektiven Charakter seiner Wissenschaftsauffassung, bei der die Person immer zurücktritt hinter die Sache.15
Und inhaltlich durch seine Lehre vom Naturrecht, seine Lehrsätze über die Substanz, die Realität, die Seele, die Wahrheit, die Menschenrechte, das Wesen des Staates usw., die einen unverlierbaren Wert darstellen und worauf sich das Denken der Neuzeit, wenn auch in kritischer Absicht, wie selbstverständlich bezieht.16 Die tief greifenden philosophischen Gedanken und Ideen der Neuzeit, nicht zuletzt diejenigen Descartes’, die unsere Geistesgeschichte auf fundamentale Art verändern werden, sind keine creatio ex nihilo, die voraussetzungslos aus dem Nichts entstehen, sondern es handelt sich, wie Ernst Cassirer sagt, um die Weiterbildung gewisser großer geistiger Grundmotive, „die einen so allgemeinen Gehalt in sich tragen, daß sie den Wechsel der Zeiten überdauern. Jede Epoche bildet neue, ihr Gemäße Formen für sie aus; aber in all diesen Formen kehrt doch ein bestimmter gleichartiger Gedankeninhalt wieder. Hier gibt es keinen Sprung und keinen plötzlichen Bruch“17. Verschaffen wir uns daher einen Überblick über die philosophischen Errungenschaften der Patristik einerseits und der Scholastik andererseits:18
§ 1.1.1 Die Patristik
Was sich in der Patristik zunächst spiegelt, ist das Spannungsverhältnis des jungen Christentums zur Philosophie: Man lehnt sie ab und re-etabliert sie. Abgelehnt wird sie, weil man die Philosophen, die Wahrheits- und Weisheitssucher, schlicht und ergreifend nicht mehr benötigt. Wahrheit und Weisheit sind nämlich keine relativen, flüchtigen Gegenstände mehr, derer man, wenn überhaupt, nur mit äußerster Anstrengung habhaft zu werden vermag, sondern absolut, ewig und von Gott geoffenbart: ›“Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben […].“19‹ ist in der Bibel zu lesen, und weiter: „Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen.“20 Denn „die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir selbst aus. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut seine Werke.“21 Mit derartigen Evidenzen ausgestattet verwundert es freilich nicht, dass auf philosophische Weltdeutung verzichtet werden kann. Ein erster konkreter Hinweis auf Descartes’ philosophischen Neubeginn, denn der Geist dieser ungeheuren epistemischen Sicherheit wird die Philosophie des Mittelalters nicht mehr verlassen und Descartes wird einer der ersten sein, der wieder zweifelt. Nichtsdestoweniger aber wird die Philosophie, um zum Thema zurückzukommen, re-etabliert, indem der Vernunft, als einem von Gott gegebenen Erkenntnisvermögen, zumindest ein teilweises Recht eingeräumt wird, und es beispielsweise bei Paulus (10-60), dem Apostel und Theologen, heißt: „Was von Gott erkennbar ist, das ist […] [den Ungläubigen]22 offenbar; Gott hat es ihnen kundgetan, läßt sich doch sein unsichtbares Wesen und seine ewige Macht und Göttlichkeit seit Erschaffung der Welt durch seine Werke mit dem Auge des Geistes wahrnehmen.“23 Ein Für und Wider, das sich fortsetzt. Justin der Märtyrer (100-165) beispielsweise, einer der ersten Kirchenväter und Verteidiger des Christentums, heute im Übrigen der Patron der Philosophen, ist unzufrieden mit den alten Philosophenschulen: „Die Stoiker wissen nichts von Gott, die Peripatetiker sind zu geldgierig, die Pythagoreer zu theoretisch, die Platoniker zu kühn in ihren Behauptungen – nur für die Christen ist die Wahrheit zur Wirklichkeit geworden.“24 Doch andererseits musste ein hinreichend allgemeiner Standpunkt bezogen werden, der für die zu bekehrenden Ungläubigen, insbesondere für die Gebildeten unter ihnen, nicht nur annehmbar, sondern dessen Blickwinkel ihnen auch verbindlich war, und das war die Philosophie. Die zugunsten der Philosophie ausschlaggebende Entscheidung in diesem Hin und Her aus Ablehnung und Befürwortung findet sich schließlich bei Augustinus: Wenn die Philosophen etwas Wahres und dem Glauben Gemäßes gesagt haben, so Augustinus, „dann ist das nicht nur nicht zu fürchten, sondern wir sollten es wie von unberechtigten Besitzern zu unserem eigenen Gebrauch in Anspruch nehmen, und zwar in einem mehrfachen Sinn“25. Erstens gilt es, „den Geist überhaupt formal zu schulen, um zum klaren und schönen Denken und Sprechen zu kommen“26. Zweitens gilt es „die Gedanken der alten Philosophen aufzugreifen, um sich damit, wenn es notwendig ist, auseinanderzusetzen“27, und schließlich soll die Philosophie drittens dazu dienen, die Glaubenssätze spekulativ, d. h. in metaphysischer Analyse, zu erhellen, „während umgekehrt der Glaube auch […] die Vernunft weiterführen muß“28. Eine Formel, die zum Leitmotiv der gesamten mittelalterlichen Philosophie avanciert; und obschon ihr Stand auf den eines Hausmädchens zurückgestuft wird, spielt sie nichtsdestoweniger eine tragende Rolle, denn die Verheiratung von Religion und Philosophie, von Glaube und Theorie, von geoffenbarter Einsicht und logischer Strenge, ist für die Geschichte des Abendlandes von gewaltiger Bedeutung: „Jetzt konnte der Glaube zur Theologie werden, die Lehrverkündung zur Literatur, das Christentum zur Kultur. Seine Vertreter brauchten nicht ins Ghetto gehen, sondern konnten den Boden des Forums betreten, die Hörsäle der Universitäten, die Versammlungsräume der Parlamente und der Ministerien.“29 Zwar bleibt das Ja der Patristik zur alten Philosophie zwiespältig, werden etwa die Gedanken der Skeptiker und Epikureer fast zur Gänze vernachlässigt – verwertbar einzig die Argumente gegen den Polytheismus –, wird die große Philosophie des Aristoteles kaum berücksichtigt – zu blass sein Gottesbegriff des unbewegten Bewegers und seine Ethik viel zu sehr im Diesseits verwurzelt – und werden Platons umfassende Überlegungen weitestgehend auf seine Metaphysik reduziert – kann bei den Kirchenvätern letztlich nur das transzendente Moment der Ideenwelt, sein Körper-Geist-Dualismus und die Unsterblichkeit der Seele ein Gefühl von Wahlverwandtschaft heraufbeschwören –, doch die Philosophie wird nichtsdestoweniger zu einem beständigen Teil des mittelalterlichen Denkens. Die fundamentalen Probleme, die die Seelsorger, Prediger, Exegeten, Theologen und Apologeten der Patristik immer wieder auf philosophisches Terrain führen, sie dazu zwingen vermittelst philosophischer Methode voranzukommen, sind nämlich jene, die von alters her die Probleme der Philosophie sind: Wissen, Gott, Schöpfung, Logos, Mensch, Seele, Wahrheit, Freiheit, Sittlichkeit u. d. m. Was die Patristik diesbezüglich hervorbringt, wie sie versucht dem Glauben ein theoretisches, also logisch hinreichendes Fundament zu geben, das lässt sich, der Reihe nach, in aller Kürze in etwa so sagen:
Vor dem Hintergrund eines neuen, sich in den Anfängen der patristischen Philosophie ausbildenden, Wissensbegriffs, der die erkenntnislogische Differenz von Wissen und Glauben aufhebt30, weil sie mit der Erkenntnissicherheit geoffenbarter Glaubensinhalte unverträglich ist, fragt Augustinus in kritischer Absicht, was früher sei, das Wissen oder der Glaube, und er antwortet: An sich geht der Glaube voran, weil er unser Herz vorbereiten muss, einst das zu erkennen, was wir jetzt noch nicht begreifen. Soweit allerdings die menschliche Vernunft einsieht, dass dieser Vorrang von besonderer Güte ist, geht doch das Denken dem Glauben voran.31 „Und schließlich auch insofern noch, als wir nicht glauben könnten, wenn wir nicht einen denkenden Geist […] hätten.“32 Eine Auffassung, die „die Erhabenheit des geoffenbarten Glaubens bewahrt, […] die Möglichkeit […] für eine kommende Glaubenswissenschaft“33 aber nicht verbaut, weil sie ohne Sakrileg dazu berechtigt, der Offenbarung die Vernunft an die Seite zu stellen. So lässt sich nun etwa die Frage nach den Grundlagen und der Möglichkeit der Erkenntnis Gottes ohne Weiteres auf natürlichem Weg beantworten; kann aufruhend auf dem Begriffssystem der Stoa von der Ordnung und der Schönheit der Welt – also von Kausalität und Telos – auf das Wirken eines göttlichen Weltbaumeisters geschlossen werden; kann aber auch die Bestimmung des Wesens dieses Weltbaumeisters durchgeführt werden: Aus dem Blickwinkel des Neuplatonismus34 betrachtet, sieht man seine Transzendenz, sein nicht der Welt der sinnlich wahrnehmbaren Körper und Phänomene angehören, denn der ewige Gott ist, anders als die Körperwelt, unveränderlich; sieht man aber auch sein bloßes Geist sein, denn er ist nicht an den Raum gebunden, unteilbar und nicht ausgedehnt und darum in keiner Weise körperlich.
Was für die Frage nach der Erkenntnis Gottes gilt, gilt in gleicher Weise für das Problem des Schöpfungsbegriffs. Auch hier – sowie des Weiteren über all sonst – spielt die natürliche, auf Vernunft aufruhende, philosophische Deutung eine wichtige Rolle: Unter Rückgriff auf Platon (428-348 v. Chr.) sieht der Theologe Clemens von Alexandria (150-215), dass „der Schöpfung vorbildliche Ideen zugrunde liegen und sie die Realisierung eines mundus intelligibilis“35, einer durchdachten, verständlichen Welt, bedeutet. Zwar führt er, anders als Platon und der Neuplatonismus es tun, „entsprechend der Bibel den Begriff einer Schöpfung aus dem Nichts ein, die auf Grund eines göttlichen Willensaktes in der Zeit erfolgt“36, doch im Umgang mit dem sich daraus ergebenden Zeitproblem – dem Widerspruch eines ewigen Gottes mit der Zeitlichkeit der Schöpfung wie des Geschöpften – wird der Pfad der Offenbarung erneut verlassen. Denn bald nimmt man eine ewige Schöpfung an, aber nur, was den Willensakt der Schöpfung selbst angeht, während seine Realisierung in der Zeit liegt; bald ist nicht nur der Willensakt, sondern auch die Welt selbst ewig, und zwar derart, dass Welten kommen und gehen von Ewigkeit zu Ewigkeit; bald auch lässt man die Zeit erst mit dieser unserer Welt entstehen, während der Schöpfungsakt selbst zeitlos ist.37 Eine der diesbezüglich wohl berühmtesten Zeitbetrachtungen stammt von Augustinus. Im elften Buch seiner ›Confessiones‹38 behauptet er, dass es die Zeit, d. h. die Ordnung des Nacheinander, als eines Übergangs vom Zukünftigen zum Gegenwärtigen und vom Gegenwärtigen zum Vergangenen, nicht gibt. Das, was es gibt, ist nur Gegenwart, nämlich die Gegenwart des Zukünftigen, die Gegenwart des Gegenwärtigen und die Gegenwart des Vergangenen; denn die Zukunft ist ja stets noch nicht und die Vergangenheit stets nicht mehr existent. Eine zur Gegenwart erstarrte Zeit ist aber nicht Zeit, sondern Ewigkeit. Typisch ist aber „auch der Gedanke der Simultanschöpfung, wonach Gott, trotz des biblischen Berichts über das Sechstagewerk, die Welt doch auf einmal in der ganzen Breite ihres Formenreichtums geschaffen habe.“39 Ein Gedanke, der sich wie von selbst entlang der idealistischen Morphologie40, „die mit dem Platonismus und seiner Lehre von der Ewigkeit der Formen gegeben ist“41, aufdrängt.
Untrennbar mit der Schöpfungslehre ist der Logos42-Gedanke verbunden. Zunächst einmal „ist der Logos die Summe von Ideen, mit denen sich Gott selbst denkt.“43 Schon bei Philon von Alexandria (25 v. Chr.), einem der wirkmächtigsten Denker des hellenistischen Judentums, werden die „Ideen, die in der genuinen platonischen Philosophie eine Welt objektiver, in sich selbst ruhender unpersönlicher Wahrheiten waren, zu Gedanken eines persönlichen Gottes […].[44] Jetzt spiegeln sie das ganze Wesen Gottes wider, und darin liegt ihr Ursprung. Der Logos ist die ewige Weisheit Gottes, […] das Wort, durch das er sich selbst ausspricht […]“45. Was die Schöpfung betrifft, so ist er dementsprechend ihr „Urbild, ihre Ordnung und ihr Strukturgesetz“46. Wie im Timaios47 – Platons Lehre von der Selbstentfaltung der höchsten Vernunft – die Welt vom Demiurgen, nach Maßgabe der Ideen, geschaffen wird, „so wird auch hier durch den Logos alles geschaffen, was geschaffen ist. Was es an Geist und Gesetz in der Welt gibt, kommt von ihm. Darum ist die Welt nicht ganz Gott fremd, im Gegenteil, sie ist der Abglanz Gottes und man kann sie nun deuten als seine Fußspur und einen Weg zu Gott zurück“48. Aber auch im Zusammenhang mit der patristischen Anthropologie ist der Logos von Bedeutung, denn weil er nichts anderes ist, als die zweite Person in Gott, ist „alle spätere Lehre vom Göttlichen im Menschen, vom Seelenfünklein und dem Gewissen als einem göttlichen Richtmaß […] sachlich hier bereits angelegt“49.
Überhaupt spielt der Mensch eine zentrale Rolle, „denn in Folge seiner Teilhabe am Logos ist er mit dem Geiste Gottes verwandt“50, sodass er auf der einen Seite die sichtbare Welt vollendet, weil „er alles andere unter ihm […] in sich einschließt und so eine Welt im kleinen ist“51; und auf der anderen Seite in der Lage ist, das göttliche Wesen zu verstehen. So wird er zum Mittler zwischen Sinnlichem und Geistigem.
Wenig verwunderlich daher, dass vor allem die menschliche Seele von besonderem Interesse ist. „Der Mensch ist für die Patristik überhaupt in erster Linie Seele. Aber was ist die Seele?“52 Noch für den Kirchenschriftsteller Quintus Tertullian (155-220) ist sie materieller Natur, wenngleich von besonders feiner Qualität, weil andernfalls unklar wäre wie die Sinnesorgane, die selbst materiell sind, auf die Seele einwirken sollen; doch schon Origines Adamantios (184-253), der zu den bedeutendsten Gelehrten des christlichen Altertums zählt, „sieht ganz klar, daß die Seele Geist ist, sie ist ja gottverwandt“53. Und Gregor von Nyssa (340-394), Bischof und Kirchenlehrer, dessen Gotteslehre einen ersten Höhepunkt der Verschmelzung christlichen und platonischen Denkens darstellt, beweist bereits ihre Immaterialität, „und zwar aus dem Sinnen und Planen des Menschen, das doch geistige Tätigkeit sei, so daß auch der Sitz dieser Tätigkeit […] immateriell sein müsse“54. Was aber wesentlich ist, und zwar auch mit Blick auf Descartes, ist die Tatsache, dass schon in diesem frühen Stadium der christlich geprägten Philosophie Einheit, Individualität und Substanzialität der Seele deutlich stärker herausgestellt werden, als es bei den Griechen der Fall ist. „Die griechische Philosophie war viel zu sehr verwachsen mit der geistig belebten Naturanschauung [– dem Panpsychismus –]55 des Hellenenvolkes, um zwischen körperlichem Dasein und geistigem Leben eine scharfe Trennungslinie zu ziehen […].“56 Jetzt hingegen ist „die Seele […] eine geschaffene, lebendige, vernünftige Substanz[57], die dem organischen und empfindungsfähigen Körper durch sich Lebens- und Wahrnehmungskraft verleiht, solange als die hierzu fähige Natur Bestand hat“58. Darauf aufruhend wendet sich der syrische Philosoph und Bischof Nemesios von Emesa (spätes 4. Jh.) nicht nur gegen die Auffassung Platons, der zufolge die menschliche Seele nur eine Potenz, ein Vermögen, der höchsten Vernunft ist, sondern auch gegen jene Aristoteles’, wonach die Seele bloß Form ist, denn in beiden Fällen ist sie kein selbstständig, für sich Bestehendes. Mit der zunehmenden Substanzialisierung der Seele verschärft sich aber auch das Leib-Seele-Problem, also das Verhältnisproblem von Körper und Geist. Man ist hinund hergerissen zwischen monistischen Konzeptionen auf der einen Seite und dualistischen auf der anderen, ohne doch eine befriedigende Lösung zu finden.
Von der Seele wiederum ist es nur ein kleiner Sprung zu Wahrheit und Freiheit. Was die Wahrheit betrifft, so findet sich bereits bei Augustinus eine Konzeption derselben, die bei René Descartes, Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), David Hume (1711-1776) und Immanuel Kant (1724-1804) zur Standardauffassung wird: Notwendig und ewig sind Wahrheiten in Bezug auf ideale Sachverhalte, wie sie uns etwa in dem mathematischen Satz ›7+3=10‹ begegnen. Für jeden, so schreibt Augustinus in seiner Abhandlung über den freien Willen – De libero arbitrio –, „der Vernunft hat, ist dies ein allgemeingültiger Satz“59. Kontingent hingegen sind solche Wahrheiten, „die man auf Grund der konkreten Sinneswahrnehmung erfährt über diesen oder jenen Körper. Hier wisse man nicht, ob es sich auch in Zukunft so verhalten werde“60. Eine Vorwegnahme der fundamentalen neuzeitlichen Unterscheidung zwischen Vernunftwahrheiten und Tatsachenwahrheiten – obschon die Quelle der Wahrheit bei Augustinus ganz woanders liegt: Sie wird nämlich dem Geist von Gott eingestrahlt, aber nicht im Sinne einer Offenbarung, sondern im Sinne eines natürlichen Vorgangs.61 Ähnlich der Auffassung Platons, der zufolge die Wahrheit von der Seele, und zwar im Zustand der Prä-Existenz, a priori, also von Erfahrung unabhängig, im Reich der Ideen geschaut wird. Und was wiederum die Freiheit betrifft, so ist zwar unser Lebensweg durch die Ideen im Geiste Gottes determiniert, aber nicht kausal. Das ewige Weltgesetz Gottes führt nämlich nur in der vernunftlosen Natur zu kausaler Determination, während es im Bereich der Geistwesen ein ideales Sollen konstituiert, das gerade umgekehrt Freiheit voraussetzt, wenn es einen Sinn haben soll.62