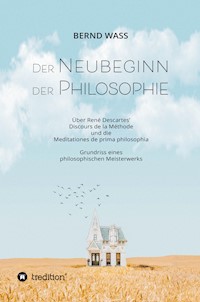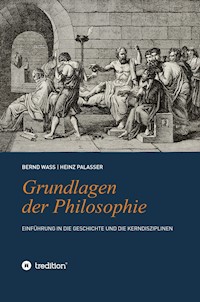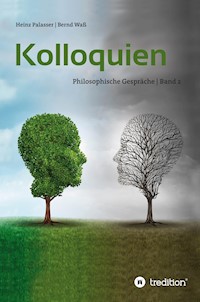9,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
John Rawls' Theorie der sozialen Gerechtigkeit gehört ohne Zweifel zu den wirkmächtigsten philosophischen Texten des 20. Jahrhunderts. In der hier vorliegenden Abhandlung wurde daher der Versuch unternommen, den Grundriss dieses umfangreichen moral- wie vertragstheoretischen Werks, in dem Prinzipien und Struktur einer gerechten Gesellschaft offengelegt werden, herauszuarbeiten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 445
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
BERND WASS
Prinzipien und Struktur einer gerechten Gesellschaft
Über John Rawls’ Theorie der Gerechtigkeit
– Grundriss eines philosophischen Meisterwerks –
Werkerschließung im Rahmen der Sommerakademie der Academia Philosophia, Italien, Castelfranco di Sopra, 2019
© Academia Philosophia
Österreichische Privatakademie für Philosophie und philosophische Weltdeutung, 2019
Gründungsdirektoren: Mag.phil. Dr.phil. Bernd Waß, MSc; Mag. Dr. Heinz Palasser, MBA, MSc www.academia-philosophia.com
Herausgeber: Academia Philosophia, Wien
Autor: Bernd Waß (www.berndwass.com)
Umschlaggestaltung, Illustration, Grafik: Mag. Petra Pfuner, Werbeagentur Vitamin©
Cover-Bild: Shutterstock, Standardlizenz: 666582304
Verlag: Tredition GmbH, Hamburg
978-3-7497-0201-5 (Paperback)
978-3-7497-0202-2 (Hardcover)
978-3-7497-0203-9 (e-Book)
Printed in Germany
Erste Auflage
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
DER AUTOR
Bernd Waß studierte am Institut für Philosophie der Kultur- und Gesellschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Salzburg Analytische Philosophie. Zum Doktor der Philosophie promovierte er bei Prof. Dr. Reinhard Kleinknecht, Prof. Dr. Otto Neumaier und Prof. Dr. Volker Gadenne mit einer Arbeit zur Philosophie des Geistes. Er ist Philosoph und Privatgelehrter, ordentliches Mitglied der Österreichischen Gesellschaft für Philosophie und Gründungsdirektor der Academia Philosophia. Seine Arbeits- und Forschungsschwerpunkte finden sich in der Metaphysik, insbesondere der Philosophie des Geistes, und der Erkenntnistheorie.
Die Philosophie hat alles, um im besten Fall nichts mit ihr zu tun zu haben:
Sie ist theoretisch, nicht praktisch; sie ist lebensfern, nicht lebensnah und die Beschäftigung mit ihr ist überaus schwierig. Mit der Leichtigkeit des Seins hat sie nichts zu tun. Um es im Stil des französischen Philosophen und Seismografen des Verfalls, Emil M. Cioran, zu sagen: Das Pendel des Lebens schlägt nur in zwei Richtungen aus, in die der heilsamen Illusion oder der unerträglichen Wahrheit. Letztere ist ihr Geschäft. Welt und Mensch am Seziertisch des Denkens. Unter dem Philosophenhammer bleibt nichts heil. Vielleicht aber ist sie gerade deshalb so anziehend, so schillernd, so faszinierend, so tief; lässt sie einen nicht mehr los.
(Bernd Waß)
Zum Gebrauch der vorliegenden Abhandlung
Um den Gebrauch der vorliegenden Abhandlung zu erleichtern, sei auf einige
Besonderheiten hingewiesen:
Besondere Aufmerksamkeit
Ausdrücke die vom Leser besondere Aufmerksamkeit erfordern oder die sich aus Gründen der besseren Lesbarkeit vom Fließtext abheben sollten, werden durch schräg gestellte Schriftzeichen kennzeichnet. Zum Beispiel: In der Gerechtigkeitstheorie von John Rawls wird Gerechtigkeit im Zusammenhang mit vollständiger Konformität betrachtet.
Anführungsnamen
Um Ausdrücke, die erwähnt werden, von Ausdrücken zu unterscheiden die verwendet werden, werden Anführungsnamen gebildet. Ein Anführungsname wird gebildet, indem der betreffende Ausdruck in einfache Klammern gesetzt wird. Zum Beispiel: ›John Rawls‹ ist der Name eines Philosophen. Anführungsnamen wurden, dem besseren Verständnis wegen, dort, wo entsprechende Kennzeichnungen fehlten, auch in Zitaten eingefügt.
Metaphorische Ausdrücke
Metaphorisch gebrauchte Ausdrücke werden in doppelte Klammern gesetzt. Zum Beispiel: Es ist fraglich, ob es »wahre« Gerechtigkeit gibt.
Kurze wörtliche Zitate
Kurze wörtliche Zitate, mit einer Länge von bis zu fünf Zeilen, werden im Fließtext durch Anführungszeichen und Fußnote gekennzeichnet. Zum Beispiel: „Ich betrachte also in erster Linie das, was ich vollständige Konformität nenne, im Gegensatz zur Theorie der unvollständigen Konformität.“1
Lange wörtliche Zitate
Wörtliche Zitate, mit einer Länge von mehr als fünf Zeilen (davon ausgenommen sind Zitate in Fußnoten), werden durch Einrückung, kleinere Schriftgröße und Fußnote gekennzeichnet. Zum Beispiel:
Eine noch so elegante und mit sparsamen Mitteln arbeitende Theorie muß fallengelassen oder abgeändert werden, wenn sie nicht wahr ist; ebenso müssen noch so gut funktionierende und wohlabgestimmte Gesetze und Institutionen abgeändert oder abgeschafft werden, wenn sie ungerecht sind. Jeder Mensch besitzt eine aus der Gerechtigkeit entspringende Unverletzlichkeit, die auch im Namen des Wohls der ganzen Gesellschaft nicht aufgehoben werden kann. Daher läßt es die Gerechtigkeit nicht zu, daß der Verlust der Freiheit bei einigen durch ein größeres Wohl für andere wettgemacht wird. Sie gestattet nicht, daß Opfer, die einigen wenigen auferlegt werden, durch den größeren Vorteil vieler anderer aufgewogen werden. Daher gelten in einer gerechten Gesellschaft gleiche Bürgerrechte für alle aus ausgemacht; die auf der Gerechtigkeit beruhenden Rechte sind kein Gegenstand politischer Verhandlungen oder sozialer Interessenabwägungen. […] Als Haupttugenden für das menschliche Handeln dulden Wahrheit und Gerechtigkeit keine Kompromisse.2
Fußnoten
Manche Leute mögen keine Fußnoten. Ich hingegen liebe sie. Nur mit einer Fußnote ist eine Seite gut gekleidet, wie mir deucht. Fußnoten stellen aber vor allem einen Mikrokosmos zusätzlich artikulierter, wenngleich nicht vordergründiger, Informationen und Gedankengänge dar. So finden sich darin erstens sämtliche Quellenangaben zu wörtlichen und sinngemäßen Zitaten; zweitens Anmerkungen, um bestimmte Begriffe oder Zusammenhänge in Zitaten zu erläutern; drittens Ausschnitte aus dem Originaltext, auf die nicht verzichtet werden wollte, obschon man sie hätte vernachlässigen können; viertens Erläuterungen und Hinweise zum besseren Verständnis des Textes (sowohl des Originaltextes als auch des hier vorliegenden Textes) insgesamt; fünftens Seitenverweise zum jeweiligen Abschnitt des Originaltexts, um die Orientierung zu behalten und es der Leserin/dem Leser während des Studiums jederzeit zu erlauben, zwischen dem Originaltext und der hier vorliegenden Abhandlung zu vergleichen.
1 Rawls, John: Eine Theorie der Gerechtigkeit, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1979, S. 25.
2 Rawls, John: Eine Theorie der Gerechtigkeit, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1979, S. 19 f.
Inhaltsverzeichnis
§ 1 Hintergrundüberlegungen
§ 2 Die Theorie der Gerechtigkeit
Teil 1: Theorie
Kapitel 1 Gerechtigkeit als Fairness
Abschnitt 1: Die Rolle der Gerechtigkeit
Abschnitt 2: Der Gegenstand der Gerechtigkeit
Abschnitt 3: Der Hauptgedanke der Theorie der Gerechtigkeit
Abschnitt 4: Der Urzustand und die Rechtfertigung
Abschnitt 5: Der klassische Utilitarismus
Abschnitt 6: Eine Gegenüberstellung von Utilitarismus und Theorie der Gerechtigkeit
Abschnitt 7: Intuitionismus
Abschnitt 8: Das Problem des Vorrangs
Abschnitt 9: Einige Bemerkungen zur Theorie der Moral
W1) Wesentliche Aspekte des ersten Kapitels über die Gerechtigkeit als Fairness
Kapitel 2 Die Grundsätze der Gerechtigkeit
Abschnitt 10: Institutionen und formale Gerechtigkeit
Abschnitt 11: Die beiden Grundsätze der Gerechtigkeit
Abschnitt 12: Deutungen des zweiten Grundsatzes
Abschnitt 13: Die demokratische Gleichheit und das Unterschiedsprinzip
Abschnitt 14: Faire Chancengleichheit und reine Verfahrensgerechtigkeit
Abschnitt 15: Die gesellschaftlichen Grundgüter als Grundlage der Aussichten
Abschnitt 16: Wesentliche soziale Positionen
Abschnitt 17: Die Tendenz zur Gleichheit
Abschnitt 18: Grundsätze für die Einzelmenschen: Der Grundsatz der Fairness
Abschnitt 19: Grundsätze für Einzelmenschen: die natürlichen Pflichten
W2) Wesentliche Aspekte des zweiten Kapitels über die Grundsätze der Gerechtigkeit
Kapitel 3 Der Urzustand
Abschnitt 20: Die Eigenart der Argumentation für eine Gerechtigkeitsvorstellung
Abschnitt 21: Die Darstellung der verschiedenen Möglichkeiten
Abschnitt 22: Die Anwendungsverhältnisse der Gerechtigkeit
Abschnitt 23: Die formalen Bedingungen des Begriffs des Rechten
Abschnitt 24: Der Schleier des Nichtwissens
Abschnitt 25: Die Vernünftigkeit der Vertragspartner
Abschnitt 26: Die Herleitung der beiden Gerechtigkeitsgrundsätze
Abschnitt 27: Die Herleitung des Prinzips des Durchschnittsnutzens
Abschnitt 28: Einige Schwierigkeiten im Zusammenhang mit dem Durchschnittsprinzip
Abschnitt 29: Einige Hauptgründe für die beiden Gerechtigkeitsgrundsätze
Abschnitt 30: Klassischer Utilitarismus, Unparteilichkeit und Altruismus
W 3) Wesentliche Aspekte des dritten Kapitels über den Urzustand
Teil 2: Institutionen
Kapitel 4 Gleiche Freiheit für alle
Abschnitt 31: Der Vier-Stufen-Gang
Abschnitt 32: Der Begriff der Freiheit
Abschnitt 33: Gleiche Gewissensfreiheit
Abschnitt 34: Toleranz und gemeinsames Interesse
Abschnitt 35: Toleranz gegenüber der Intoleranz
Abschnitt 36: Politische Gerechtigkeit und Verfassung
Abschnitt 37: Einschränkungen des Teilnahmegrundsatzes
Abschnitt 38: Die Gesetzesherrschaft
Abschnitt 39: Die Definition des Vorrangs der Freiheit
Abschnitt 40: Die Kantische Deutung der Gerechtigkeit als Fairness
W4) Wesentliche Aspekte des vierten Kapitels über die gleiche Freiheit für alle
Kapitel 5 Die Verteilung
Abschnitt 41: Der Begriff der Gerechtigkeit in der politischen Ökonomie
Abschnitt 42: Einige Bemerkungen über Wirtschaftssysteme
Abschnitt 43: Die Rahmen-Institutionen für die Verteilungsgerechtigkeit
Abschnitt 44: Das Problem der Gerechtigkeit zwischen den Generationen
Abschnitt 45: Zeitpräferenz
Abschnitt 46: Weitere Vorrangfragen
Abschnitt 47: Die Gerechtigkeitsvorschriften
Abschnitt 48: Berechtigte Erwartungen und moralischer Verdienst
Abschnitt 49: Vergleich mit Mischauffassungen
Abschnitt 50: Das Perfektionsprinzip
W5) Wesentliche Aspekte des fünften Kapitels über die Verteilung
Kapitel 6 Pflicht und Verpflichtung
Abschnitt 51: Die Argumente für die Grundsätze der natürlichen Pflicht
Abschnitt 52: Die Argumente für den Grundsatz der Fairness
Abschnitt 53: Die Pflicht, einem ungerechten Gesetz zu gehorchen
Abschnitt 54: Die Stellung der Mehrheitsregel
Abschnitt 55: Definition des zivilen Ungehorsams
Abschnitt 56: Definition der Weigerung aus Gewissensgründen
Abschnitt 57: Die Rechtfertigung des zivilen Ungehorsams
Abschnitt 58: Rechtfertigung der Weigerung aus Gewissensgründen
Abschnitt 59: Die Rolle des zivilen Ungehorsams
W6) Wesentliche Aspekte des sechsten Kapitels über Pflicht und Verpflichtung
Teil 3: Ziele
Kapitel 7 Das Gute als das Vernünftige
Abschnitt 60: Die Notwendigkeit einer Theorie des Guten
Abschnitt 61: Die Definition des Guten in einfacheren Fällen
Abschnitt 62: Eine Anmerkung zur Bedeutung
Abschnitt 63: Die Definition des Guten für Lebenspläne
Abschnitt 64: Die abwägende Vernunft
Abschnitt 65: Der Aristotelische Grundsatz
Abschnitt 66: Die Definition des guten Menschen
Abschnitt 67: Selbstachtung, gute Eigenschaften und Scham
Abschnitt 68: Einige Unterschiede zwischen dem Rechten und dem Guten
W7) Wesentliche Aspekte des siebten Kapitels über das Gute als das Vernünftige
Kapitel 8 Der Gerechtigkeitssinn
Abschnitt 69: Der Begriff der Wohlgeordneten Gesellschaft
Abschnitt 70: Die autoritätsorientierte Moralität
Abschnitt 71: Die gruppenorientierte Moralität
Abschnitt 72: Die grundsatzorientierte Moralität
Abschnitt 73: Eigenschaften der moralischen Gesinnungen
Abschnitt 74: Die Verbindung zwischen moralischen und natürlichen Einstellungen
Abschnitt 75: Die Grundsätze der Moralpsychologie
Abschnitt 76: Das Problem der Stabilität
Abschnitt 77: Die Grundlage der Gleichheit
W8) Wesentliche Aspekte des achten Kapitels über den Gerechtigkeitssinn
Kapitel 9 Das Gut der Gerechtigkeit
Abschnitt 78: Autonomie und Objektivität
Abschnitt 79: Die Idee der sozialen Gemeinschaft
Abschnitt 80: Das Problem des Neids
Abschnitt 81: Neid und Gleichheit
Abschnitt 82: Die Gründe für den Vorrang der Freiheit
Abschnitt 83: Glück und übergeordnete Ziele
Abschnitt 84: Hedonismus als Entscheidungsverfahren
Abschnitt 85: Die Einheit der Persönlichkeit
Abschnitt 86: Das Gut des Gerechtigkeitssinnes
Abschnitt 87: Abschließende Bemerkungen zur Rechtfertigung
W9) Wesentliche Aspekte des neunten Kapitels über das Gut der Gerechtigkeit
§ 3 Ein »Destillat« zweiter Ordnung
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
§ 1 Hintergrundüberlegungen
Seit der Gründung der Academia Philosophia verstehen wir uns als Bindeglied zwischen der akademisch-universitären Philosophie einerseits und einer breiteren Hörerschaft andererseits. Es wäre schade, so dachten wir uns, wenn die Faszination philosophischer Weltdeutung nur jenem kleinen Kreis von Menschen vorbehalten bliebe, der sich von Berufswegen mit der Philosophie beschäftigt. Auch wenn die Hochzeit der Philosophie – so es sie denn jemals gegeben hat – in einer ökonomisierten und am Maßstab des Praktischen orientierten Gesellschaft allem Anschein nach vorüber ist, glauben wir nichtsdestoweniger, dass die Beschäftigung mit philosophischer Weltdeutung für unser geistiges Leben unverzichtbar ist. Der Entwurf einer feingliedrigen, vernünftigen und logisch zureichenden Weltanschauung, die Disziplinierung des Denkens und die Verbesserung der Urteilskraft können nirgendwo vorzüglicher gelingen als in der Philosophie. Nicht zuletzt deshalb bemühen wir uns um die Vermittlung wissenschaftlicher Philosophie und die Pflege eines breit angelegten philosophischen Diskurses; außerhalb der Mauern der Universitäten, eine fachfremde Hörerschaft im Blick, aber dennoch auf akademischem Niveau. Ein Programm, das uns immer wieder vor intellektuelle Herausforderungen stellt. Im Versuch eine solche Herausforderung zu bewältigen, nämlich eine Textgrundlage für den philosophischen Diskurs im Rahmen unserer alljährlichen Sommerakademie zu erarbeiten, ist das vorliegende Buch entstanden: ›Prinzipien und Struktur einer gerechten Gesellschaft‹. Sein zentrales Thema ist John Rawls’ Theorie der Gerechtigkeit. Man kann es daher als Vorbereitung zum Studium des Originaltextes lesen aber auch als eine in sich geschlossene Arbeit, deren Anspruch es ist, Rawls’ Denken systematisch nachzuzeichnen und seinen Entwurf einer Theorie der Gerechtigkeit im Prinzip verständlich zu machen. Dementsprechend geht es hier nicht darum, dieses Denkgebäude kritisch zu durchdringen, als vielmehr darum, es im Sinne einer gewissen Vertrautheit ein erstes Mal zu begehen.1 Grundlage dieser Begehung ist John Rawls’ ›Eine Theorie der Gerechtigkeit‹, erschienen im Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1979.2
Wir werden uns ohne große Umwege, also über die weiteste Strecke, entlang der einzelnen Kapitel bewegen und Stockwerk für Stockwerk des Rawlschen Denkgebäudes ausleuchtend, in eine, unserem Vorhaben, angemessene Tiefe der Theorie der Gerechtigkeit vordringen. Das Ziel dabei ist philosophische Kenntnis. Am Ende des Tages wollen wir ein konzentriertes und zugleich philosophisch einigermaßen befriedigendes Gesamtbild dessen erhalten, was uns Rawls mit der Theorie der Gerechtigkeit vorlegt.
Es scheint geradezu symptomatisch zu sein, für die Zeit, in der wir leben, sich ausgerechnet jetzt mit der Theorie der Gerechtigkeit von John Rawls auseinanderzusetzen. Die Frage nach der Gerechtigkeit ist nämlich wieder en vogue, nicht nur in der Philosophie. Kein Wunder angesichts der aktuellen Krisen, seien es Staats-, Flüchtlings-, Umwelt- oder Wirtschaftskrisen, der Bürgerkriege und anderer kriegerischen Auseinandersetzungen, die sich über den Globus verteilt zutragen, und der humanitären Katastrophen in ihrem Gefolge. Langsam aber sicher gerät die an ein grenzenloses Wachstum glaubende und auf dem Boden unerbittlicher Profitmaximierung aufruhende, postindustrielle Gesellschaft an ihre Grenzen. Jetzt wird sichtbar, was lange Zeit unsichtbar blieb, kommt zum Vorschein, was der Deckmantel der Wohlstandsgläubigkeit und Konsumseligkeit gekonnt zu verbergen vermochte: Mafiose Konzerne, bankrotte Banken, korrupte Politiker, gewissenlose Manager, von der Gier zerfressene Spekulanten und der viel zitierte »kleine Mann«, der sich dem Treiben der Mächtigen hoffnungslos ausgeliefert fühlt und schon beinahe pathologisch zwanghaft versucht, sein Leben zwischen Reihenhaus-Mentalität und Kluburlaub sinnvoll erscheinen zu lassen, koste es, was es wolle, bilden zusammengenommen ein gesellschaftliches Geflecht, in dem die Gerechtigkeit nur noch insofern eine Rolle spielt, als sie den sozialen Akteuren zum eigenen Vorteil gereicht. Der Untergang der modernen Welt, so könnte man meinen, steht unmittelbar bevor und die Angst vor dem Verlust des eigenen Lebensstandards überdeckt die letzten Reste moralischer Integrität.
Doch bei allem Handlungsbedarf, der sich aus diesem, zugegebenermaßen äußerst zugespitzten und fragmentarischen, Befund herauslesen lässt und der großen Dringlichkeit, die anstehenden globalen Gesellschaftsprobleme zu lösen, müssen wir nichtsdestoweniger jede Form des Tätigwerdens im lebenspraktischen Sinn hintanstellen. Zumindest dann, wenn wir uns dieser Probleme vom Standpunkt der Philosophie aus zuwenden wollen, d. h. vom Standpunkt einer theoretischen Disziplin aus, deren einziger Beweggrund darin besteht, die Welt dereinst, in ihren allgemeinsten Zusammenhängen, vermittelst des reinen Denkens ausgeleuchtet zu haben. Wie hat es Arthur Schopenhauer so treffend formuliert? „Das ganze Wesen der Welt abstrakt, allgemein und deutlich in Begriffen zu wiederholen und es so als reflektiertes Abbild in bleibenden und stets bereit liegenden Begriffen der Vernunft niederzulegen: dieses und nichts anderes ist Philosophie.“3 Das Abbild, von dem hier die Rede ist, ist Theorie. Eine logisch organisierte, mithin nach Grund und Folge geordnete, rationale Weltanschauung. Ein – im Erfolgsfall – widerspruchsfreies Satzsystem, das uns darüber Auskunft gibt, was in ganz allgemeiner Hinsicht der Fall ist und was nicht. Man darf sich nicht täuschen lassen: Selbst die praktische Philosophie, zu der man Rawls’ Theorie der Gerechtigkeit zweifellos zählen muss, ist theoretisch.4 Auch hier geht es nicht um ein aktives Eingreifen, nicht um ein Tun in bestimmter Hinsicht, sondern ausnahmslos um ein gedankliches, mithin begriffliches Erfassen dessen, was vorliegt oder vernünftigerweise vorliegen soll. Ein Umstand, der womöglich Karl Marx zu seiner berühmten elften These über Feuerbach veranlasst hat: „Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert; es kommt drauf an, sie zu verändern.“5 Man muss ihm jedenfalls in diesem Punkt recht geben: Die Veränderung der Welt ist nicht das Geschäft der Philosophie. Vernünftigerweise! Denn Denken und Handeln – Theorie und Praxis – sind ganz verschiedene Formen der Auseinandersetzung mit Welt und Mensch. Sie haben streng genommen nichts gemeinsam. Es fehlt nämlich ein logisch einwandfreier Übergang vom einen zum anderen. Und noch aus einem weiteren Grund hat die Philosophie im Reich des Praktischen nichts zu suchen: Während es im Handeln über weite Strecken um die Lösung anstehender Probleme geht, es mögen einfache oder auch schwierige sein, geht es in der Philosophie darum, diese Probleme zu verstehen, ihrer im Denken überhaupt erst habhaft zu werden. Um ihr Vorhaben nicht zu verfehlen, muss sie daher stets und notwendigerweise Distanz halten; kann mit dem Gegenstand, den sie bedenkt, niemals zusammenfallen. Und so ist es auch im Fall der Gerechtigkeit: Es mag zwar die postulierte Distanz, oder anders gesagt, der Abstraktionsgrad des philosophischen Denkens, geringer sein, als dies im Zusammenhang mit anderen Entitäten der Fall ist, etwa mit Entitäten der Erkenntnistheorie, der Logik oder Metaphysik, doch es bleibt auch hier eine unhintergehbare Kluft zwischen dem Gegenstand und dem philosophischen Denken über diesen Gegenstand. Gerechtigkeit walten zu lassen ist etwas anderes, als sie zu bedenken. Das müssen wir im Auge behalten, um Rawls’ Hauptstück richtig zu deuten.
Versuchen wir also die Theorie der Gerechtigkeit, die Rawls über einen Zeitraum von mehr als vierzig Jahren ausgearbeitet hat, die aber im Kern eine Zusammenfassung und Erweiterung von Aufsätzen ist, die er zwischen 1958 und 1968 hervorbrachte, in rein theoretischer Absicht zu durchdringen und uns den Grundriss dieses philosophischen Meisterwerks zu erschließen.6 Dafür bedarf es allerdings zunächst einiger vorbereitender Überlegungen, die den Gegenstand dieses einleitenden Kapitels darstellen, ehe wir uns im Anschluss der eigentlichen Theorie widmen werden.
Beginnen wir mit dem Gravitationspunkt der Theorie der Gerechtigkeit: mit dem Begriff der Gerechtigkeit. Der Begriff der Gerechtigkeit ist nämlich derart mehrdeutig, dass es ratsam ist, schon am Anfang eine erste Klärung vorzunehmen, denn vieles nennt man gerecht bzw. ungerecht: „Nicht nur Gesetze, Institutionen und Gesellschaftssysteme, sondern auch die verschiedensten Handlungen, z. B. Entscheidungen, Urteile und moralische Bewertungen.“7 Darüber hinaus werden aber auch „Einstellungen und Verhaltensweisen von Menschen, wie […] diese selbst,“8 gerecht oder ungerecht genannt. Endlich ist sogar von bestimmten Empfindungen die Rede, vom Gerechtigkeitsgefühl, wenn man so will, womit gewissermaßen ein Gerichtshof der Gerechtigkeit vorgestellt wird, der moralischen Subjekten innezuwohnen scheint. Es stellt sich daher die Frage, welchen Gegenstand man prinzipiell im Sinn hat, wenn man die Gerechtigkeit zu verhandeln sucht; denn es macht einen erheblichen Unterschied, ob man beispielsweise über Handlungen diskutiert oder über Einstellungen oder Empfindungen. Rawls’ Antwort ist diesbezüglich eindeutig. Er schränkt den Gegenstandsbereich seiner Theorie der Gerechtigkeit auf die soziale Gerechtigkeit ein. Für uns, so Rawls, „ist der erste Gegenstand der Gerechtigkeit die Grundstruktur der Gesellschaft, genauer: die Art, wie die wichtigsten gesellschaftlichen Institutionen Grundrechte und -pflichten und die Früchte der gesellschaftlichen Zusammenarbeit verteilen“9.10
Diese vorbildliche erste Bestimmung des Gegenstands der Theorie der Gerechtigkeit erlaubt es uns zudem, Rawls’ Bemühungen disziplinär einzuordnen und uns auf diese Weise die »philosophische Kulisse« zu erschließen, im Rahmen derer die Theorie zur »Aufführung« gelangt. Das ist insofern von Bedeutung, als in den verschiedenen philosophischen Disziplinen nicht immer derselbe Standpunkt eingenommen wird und sich mit dem Standpunkt nicht nur die Fragen und Herangehensweisen verändern, sondern auch der Abstraktionsgrad. So sind beispielsweise die Fragen der Metaphysik wesentlich allgemeiner als jene der Erkenntnistheorie und diese wiederum wesentlich allgemeiner als jene der Ethik. Womit wir schon beim Thema sind: Grundsätzlich ist die Gerechtigkeit ein Gegenstand der Ethik, denn sie ist unzweifelhaft ein Aspekt des moralischen Handelns; dessen, was für ein Subjekt aus moralisch relevanter Sicht gesollt ist. Bereits Aristoteles verhandelt sie daher in seiner Tugendlehre als Teil der Moraltheorie.11 Die Ethik, oder eben anders gesagt, die Moraltheorie, begreift sich nämlich als diejenige philosophische Disziplin, die das moralisch Gesollte bedenkt. Es geht – vereinfacht gesagt – über weite Strecken darum, allgemeine moralische Normen, Werte, Einstellungen, Anschauungen und Handlungen, und zwar im Hinblick auf das moralisch Richtige, zu untersuchen und sie auf ein ethisch begründetes Fundament zu stellen, sie also ethisch begründet zu normieren.12 Denn während uns in der Moral, als einem praktischen Instrument der Lebensführung, nichts anderes übrig bleibt, als uns daran zu orientieren, was gemeinhin für moralisch richtig gehalten wird, trachten wir in der Ethik, als der theoretischen Durchdringung der Moral, danach, festzulegen, was moralisch richtig ist. Bei Rawls allerdings müssen wir über die Ethik hinausgehen. Sie bleibt zwar unser theoretisches Fundament, doch bedarf es einer Erweiterung: Wenn nämlich der Gegenstand der Theorie der Gerechtigkeit nicht die Gerechtigkeit des individuellen Handelns ist, sondern, wie oben gesagt, die Art, wie die wichtigsten gesellschaftlichen Institutionen Grundrechte und -pflichten und die Früchte der gesellschaftlichen Zusammenarbeit verteilen, so müssen wir in allgemeineren Zusammenhängen denken, den Abstraktionsgrad erhöhen; denn jetzt haben wir es mit den moralisch relevanten sozialen Verhältnissen einer Gesellschaft – ihrer politischen Grundordnung – zu tun, und derartige Entitäten sind Gegenstand der politischen Philosophie, insbesondere der Vertragstheorie.
Wie gesagt, wir sind dabei uns die Kulisse zu erschließen, weshalb wir uns in weiterer Folge zunächst mit einigen Grundüberlegungen zur politischen Philosophie beschäftigen wollen und im Anschluss über Vertragstheorien sprechen werden.13
Aufgabe der politischen Philosophie – früher auch ›Staatsphilosophie‹ genannt – ist die ethisch reflektierte normative Kritik der sozialen und politischen Verhältnisse von Gesellschaften. Dementsprechend fragt die politische Philosophie einerseits nach der besten politischen bzw. sozialen Ordnung von Gesellschaften, anderseits nach der Legitimation politischer Herrschaft. Als Teildisziplin der Philosophie lässt sie sich im Verhältnis zu den anderen Disziplinen der praktischen Philosophie bestimmen: Ethisch reflektiert und als normative Kritik die Ethik voraussetzend erweitert die politische Philosophie den Kreis des ethischen Fragens. Während die Ethik auf die theoretische Durchdringung des moralisch relevanten Handelns moralischer Subjekte beschränkt bleibt, sucht die politische Philosophie die normativen Grundlagen des politischen Gemeinwesens zu bestimmen. Von der Sozialphilosophie – als der Wissenschaft von den normativen Grundlagen des menschlichen Zusammenseins in der Gesellschaft – unterscheidet sie sich durch den engeren Bezug auf das politische System und die Politik von Gesellschaften, von der Rechtsphilosophie – als der Wissenschaft von der Geltung, der Begründung und dem Funktionieren der Rechtssphäre – durch den umfassenderen Gegenstand und die Nähe zur Ethik gegenüber dem faktischen Bezug auf die positive Rechtswissenschaft. Von den Sozialwissenschaften insgesamt und deren spezifischen theoretischen Zugängen, wie etwa der Gesellschaftstheorie, der politischen Theorie und Rechtstheorie, unterscheidet sie sich durch den ethisch reflektierten, kritisch-normativen Anspruch.14 Es geht hier also nicht darum, was der Fall ist, sondern was vernünftigerweise der Fall sein soll. Und zu guter Letzt unterscheidet sie sich auch von der politischen Theologie, und zwar insofern als sie den Grund aller Verhaltensregeln und -normen nicht in religiöser Offenbarung sieht, sondern ausschließlich in der menschlichen Praxis.
Diese anthropologische Grundhaltung der politischen Philosophie reicht bis in die Antike zurück. Für Aristoteles ist der Mensch, und zwar eben seiner Natur nach, ein zur politischen Gemeinschaft bestimmtes Wesen. Ein Zoon politikon, wie er sagt. Das gesellschaftliche Wesen des Menschen zeigt sich dabei zunächst in der Freundschaft als einer ausgezeichneten Form des Zusammenseins, ist aber zugleich der Ausgangspunkt der bürgerlichen Gemeinschaft selbst. Denn die bürgerliche Gemeinschaft, so Aristoteles in seiner Ethik, ist nur eine politische Erweiterung von Freundschaftsbanden. Ein weiterer anthropologischer Aspekt ist die weit ausgeprägte Sprachfähigkeit des Menschen. Sie ist für Aristoteles insofern von besonderer Bedeutung, weil sich die Grundsätze und Ziele einer Gemeinschaft, seiner Auffassung nach, nur in der öffentlichen politischen Debatte auslegen lassen; und diese Debatte wiederum ist für die Entscheidungsfähigkeit einer Gemeinschaft unabdingbar. Nichtsdestoweniger ist die aristotelische Deutung des Politischen nicht nur anthropologisch, sondern auch kosmologisch grundiert: Mit ihrer, im Glücksstreben des Menschen verankerten, sprachlich konkretisierten Einheit ist die Gemeinschaft zugleich ein Spiegel universeller kosmischer Strukturen, in denen das Prinzip einer Harmonie des Ganzen als letzte Zielausrichtung auf das Gute vorherrscht.
Erst im philosophischen Denken der Neuzeit kommt es schrittweise zu einer Zurückweisung nicht-anthropologischer, sprich kosmologischer, metaphysischer oder religiöser, Verankerung des Politischen und damit einhergehend zu den großen Entwürfen der politischen Philosophie. So wird etwa mit dem englischen Philosophen und Staatstheoretiker Thomas Hobbes die politische Gemeinschaft erstmals als eine vom Menschen selbst geschaffene, künstlich-technische Einrichtung gedeutet, die kein darüber hinausgehendes Bestehen eines sozialen Bandes voraussetzt. Der Ausgangspunkt von Hobbes’ Überlegungen ist die Natur des Menschen und der daraus hervorgehende Naturzustand. Hobbes fasst die menschlichen Individuen als egoistische, sich nur nach ihrem eigenen Vorteil richtende Wesen auf, deren natürliches Verhältnis zueinander der Krieg ist, und zwar der „Krieg jeder gegen jeden“15. „Ein Wolf ist der Mensch dem Menschen, nicht ein Mensch […].“16 Der berühmte Homo-homini-lupus-Satz, den Hobbes bei Titus Plautus17 entlehnt, beschreibt sozusagen den anthropologischen Fundamentalgrund, weshalb sich der Mensch von selbst, nach vernünftiger Überlegung, dazu entscheidet, sich in politischen Gemeinschaften zu organisieren: Nur so kann er sein Leben und seinen Besitz dauerhaft absichern; denn der Krieg, jeder gegen jeden, kommt außerhalb politischer Gemeinschaft nicht zum Stillstand, weil die Menschen nach Hobbes ihrer Natur nach sowohl in körperlicher als auch in geistiger Hinsicht gleich sind, und somit keiner endgültig als Sieger feststeht. Allein um dieser Lage zu entrinnen sind die Menschen erstens dazu bereit, auf ihr natürliches Recht auf alles18 – man könnte auch sagen, auf ihre absolut uneingeschränkte natürliche Freiheit – zu verzichten und zweitens mit anderen Verträge einzugehen. Weil aber die Verträge im reinen Naturzustand stets ungesichert bleiben, bedarf es darüber hinaus einer, den Vertragspartnern übergeordneten, Gewalt, die das Recht und die Macht besitzt, beide Partner zur Einhaltung des Vertrags zu zwingen und damit für eine Friedensordnung zu sorgen, in der allein sich eine prosperierende bürgerliche Gesellschaft entfalten kann. Eine solche, allen übergeordnete, Gewalt ist für Hobbes der Staat. Mit der von ihm maßgeblich beeinflussten Lehre von der Souveränität und der Deutung des Souveräns als eines sterblichen Gottes – dem sogenannten Leviathan – wird dann auch die alte Verbindung der Politik mit einer metaphysischen Sphäre der Wahrheit und Gerechtigkeit durchtrennt.19 Nicht nur dass sich die Menschen aus Vernunft zu einer Gemeinschaft zusammenschließen wird auch die Legitimation des Staates, also der allen übergeordneten Gewalt, durch Vernunft begründet und nicht mehr von der Gnade Gottes abgeleitet. Das diesbezüglich entscheidende Vehikel ist der sogenannte Begünstigungsvertrag. Der einzige Weg nämlich, so Hobbes, der zur Errichtung einer solchen allgemeinen Gewalt taugt, „die fähig ist, die Menschen vor dem Angriff fremder und vor gegenseitigem Unrecht zu schützen, […] besteht darin, alle ihre Macht und Stärken einem Menschen oder einer Versammlung von Menschen zu übertragen, die den Willen jedes einzelnen durch Stimmenmehrheit zu einem einzigen Willen machen.“20
Es ist eine wirkliche Einheit von ihnen allen in ein und derselben Person, die durch Vertrag eines jeden mit jedem so geschaffen wird, als ob jeder zu jedem sagte: Ich gebe diesem Menschen oder dieser Versammlung von Menschen Ermächtigung und übertrage ihm mein Recht, mich zu regieren, unter der Bedingung, daß du ihm ebenso dein Recht überträgst und Ermächtigung für alle seine Handlungen gibst21
Ist dies geschehen, so nennt man diese, zu einer Person vereinigte, Menge ›Staat‹. Die durch den Vertrag aller mit allen begünstigte Person oder Versammlung wird somit zum Souverän – alle anderen hingegen zu dessen Untertanen. Das Band, das die Menschen in ihrer politischen Gemeinschaft bzw. Gesellschaft zusammenhält, ist also nicht mehr in Gott verankert, sondern entsteht und erhält sich durch das Instrument des Vertragsschlusses. Eine typisch aufklärerische Denkbewegung. Gott wird gewissermaßen entmachtet und an seiner statt die Vernunft gesetzt, die nun allein die Grundlage der politischen, mithin staatlichen Gemeinschaft bildet.
Es ist zugleich die Geburtsstunde der Vertragstheorie bzw. des Kontraktualismus, der Lehre von der Begründung und Legitimierung politischer Ordnung und Herrschaft, mit der wir es hier zu tun haben. Im Gegensatz zur antiken Lehre des Aristoteles, der ja bekanntermaßen davon ausgeht, dass der Mensch ein von Natur aus zur politischen Gemeinschaft bestimmtes Wesen sei, geht die Vertragstheorie von an sich bindungslosen Individuen aus, die ihren eigenen Interessen folgen und sich in freier Entscheidung prinzipiell erst zur politischen Gemeinschaft entschließen müssen. Ein solcher Entschluss ruht aber, der Vertragstheorie nach, stets auf einem sogenannten Gesellschafts- bzw. Herrschaftsvertrag auf. Die grundlegende Idee dabei ist, dass sich alle künftigen Bürger, durch einen vertraglichen Zusammenschluss, wechselseitig binden und zugleich den Staat legitimieren Macht als politische Herrschaft auszuüben. Oder mit anderen Worten: Durch einen Gesellschaftsvertrag wird die politische Gemeinschaft überhaupt erst begründet und durch einen Herrschaftsvertrag die politische Macht legitimiert, die sie dauerhaft bewahrt. Die formale Struktur dieser Idee der Vertragstheorie umfasst drei Argumentationsschritte: 1) Der Naturzustand als fiktive Annahme, von der die rationale Überlegung auszugehen hat, 2) der Vertragsschluss als Resultat dieser rationalen Überlegung, samt den sich daraus ergebenden Bedingungen, und endlich 3) die Benennung der Aufgaben der Herrschaftsordnung sowie deren Sicherstellung.
Auszugehen ist also im ersten Schritt von einem vor-vertraglichen Naturzustand, in dessen Beschreibung jene Probleme namhaft gemacht werden, die die Vorzüge der absolut unbegrenzten Freiheit der Individuen – die für diesen Zustand insgesamt charakteristisch ist – beeinträchtigen. Gleichzeitig muss herausgearbeitet werden, dass die Beseitigung dieser Probleme im unmissverständlichen Interesse eines jeden Individuums liegen, und zwar auch dann, wenn es hierfür, aus logischen Gründen, unhintergehbar ist, die natürliche Freiheit zu beschränken.22 Da diese Aspekte insgesamt die für eine rationale Entscheidung zu berücksichtigenden Elemente darstellen, werden sie zumeist als die Grundbedingungen vertragstheoretischer Argumentation bezeichnet. Nicht zuletzt aber auch deshalb, weil die Charakterisierung der Probleme bereits implizit die Zielvorgaben für den Vertragsschluss enthalten.
Der zweite Schritt der Argumentation kennzeichnet den Vertragsschluss als möglichen Weg zur faktischen Beseitigung der Probleme: Eine Beschränkung der natürlichen Freiheit wird sicher nur dann freiwillig akzeptiert, wenn sie dem natürlichen Eigeninteresse aller entspricht. Das heißt, dass sich unter der Vielzahl individueller Interessen, einige für alle Individuen gleichermaßen fundamentale Interessen ausmachen lassen müssen, sodass eine Interessenidentität vorliegt, die in letzter Konsequenz in das gemeinsame Interesse einmündet, den Naturzustand zu verlassen. Gemeinhin wird davon ausgegangen, dass etwa körperliche Unversehrtheit, Leben, und Freiheit solche fundamentalen Interessen darstellen. Wenn nun klar gemacht werden kann, dass die Wahrung dieser Interessen ausschließlich im Rahmen politischer Gemeinschaft dauerhaft möglich ist, so liegt es im natürlichen, rationalen Eigeninteresse jedes Individuums, in eine politische Gemeinschaft einzutreten und dementsprechend zu kooperieren. Insofern ist eine, auf dem Vertragsschluss beruhende, politische Ordnung in einer ersten Hinsicht rational begründet. Eine vollständige rationale Begründung dieser Ordnung ergibt sich in weiter Folge dann, wenn die Bedingungen, der im Vertrag getroffenen Vereinbarungen, hinreichend gekennzeichnet bzw. explizit ausgewiesen sind. Kooperation wiederum bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Individuen sich in Bezug auf das jeweils gemeinsame Interesse einer gegenseitigen Respektierung versichern, d. h., dass jeder zur Beschränkung seiner absolut unbegrenzten Freiheit, und zwar angesichts der angemessenen Gegenleistung im normativ geordneten Vertragszustand, bereit ist, wenn es der andere auch und in gleicher Weise ist. Dabei darf allerdings die Beschränkung der absolut unbegrenzten Freiheit doch nicht über das unbedingte Maß hinausgehen.
Im dritten und letzten Argumentationsschritt werden die Ausführungsbedingungen des Vertragsinhalts bestimmt. Diese unterscheiden sich je nach Zielvorstellung. Bei Hobbes beispielsweise muss der Staat inneren Frieden und Rechtssicherheit stiften; bei Jean-Jacques Rousseau wiederum ist die Garantie republikanischer Freiheit, verwirklicht im Gemeinwillen, das Ziel und bei John Rawls endlich geht es über weite Strecken um die soziale Gerechtigkeit der politischen Grundstruktur der Gesellschaft. Somit schließt sich der Kreis und wir können nun besser verstehen, warum die Theorie der Gerechtigkeit nicht ausschließlich eine Moraltheorie, sondern auch eine Vertragstheorie ist. In dem sie nämlich zu begründen sucht, wie die wichtigsten gesellschaftlichen Institutionen vernünftigerweise Grundrechte und -pflichten und die Früchte der gesellschaftlichen Zusammenarbeit verteilen sollen, sucht sie, jedenfalls in einem wesentlichen Aspekt, eine politische Ordnung zu begründen, gemäß derer die künftigen Bürger gewillt sind, den Naturzustand zu verlassen und in eine, durch politische Herrschaft charakterisierte, Gemeinschaft einzutreten.
In der Tat versteht Rawls die Theorie der Gerechtigkeit als eine Vertragstheorie. Doch obwohl er in klassischer Weise von an sich bindungslosen Individuen ausgeht, die ihre eigenen Interessen verfolgen, haben wir es hier mit einer Theorie zu tun, die einen ganz anderen Gedanken formuliert, und die Rawls eigenen Angaben zufolge die klassischen vertragstheoretischen Konzeptionen übersteigt. So werden etwa die bekannten Vertragstheorien von John Locke, Jean-Jacques Rousseau und Immanuel Kant verallgemeinert und auf eine höhere Abstraktionsstufe gehoben.23 Insofern scheint es im Rahmen unserer Hintergrundüberlegungen angemessen, zumindest die Grundgedanken dieser Theorien offenzulegen. Der Reihe nach:24
John Lockes philosophiepolitisches Hauptwerk ›Zwei Abhandlungen über die Regierung‹25, 1689 erschienen aber schon lange zuvor im holländischen Exil konzipiert und geschrieben, beinhaltet, wie der Name bereits sagt, zwei Abhandlungen über die Regierung, die allerdings historisch von ganz unterschiedlicher Bedeutung sind. Während die erste Abhandlung als eine Kampfschrift gegen den Apologeten des Stuartschen Absolutismus Robert Filmer26 gedacht und aufgrund ihrer ausschließlich zeitgeschichtlichen Bezüge in der modernen politischen Philosophie kaum mehr von Belang ist, findet sich in der zweiten eine der Hauptquellen der Theorie des Liberalismus27. Jedenfalls ist sie das erste Werk in der Geschichte der politischen Philosophie, in dem – neben der Freiheit und Unverletzlichkeit der Person – auch der Schutz des privaten Eigentums ausdrücklich, und zwar als der eigentliche Staatszweck, formuliert wird. Wie Hobbes, so geht auch Locke von einem anthropologisch charakterisierten Naturzustand aus, in dem die Individuen prinzipiell frei und gleich sind.28 Hier befinden sie sich zwar – anders als bei Hobbes – nicht in einem andauernden Kriegszustand, weil sie in der Lage sind, das natürliche Gesetz und die damit verbundenen wechselseitigen Rechte und Pflichten zu erkennen, doch ob ihrer stark voneinander abweichenden Eigeninteressen werden sie doch häufig in die Irre geführt.29 Es gibt nämlich, so Locke, ohne Zweifel verdorbene und schlechte Menschen, die die Stabilität des Naturzustands, die auf diesem natürlichen Gesetz aufruht, jederzeit in Gefahr zu bringen vermögen. In Anbetracht der daraus resultierenden Unberechenbarkeit des Naturzustands wird daher niemand auf den Gebrauch von physischer Gewalt verzichten, wenn er seine Ziele so effektiver verfolgen kann. Weil aber dies zu einem ständigen Kampf ums Eigentum führt, ist das „große und hauptsächliche Ziel, weshalb Menschen sich zu einem Staatswesen zusammenschließen und sich unter eine Regierung stellen, […] die Erhaltung ihres Eigentums“30. Diesem großen Ziel, so Locke, sei nicht nur die staatliche Ordnung im Allgemeinen, sondern auch die Gesetzgebung und die konkrete Politik unterzuordnen. Vor allem aber dürfe die Staatsgewalt niemals, weder als Legislative noch als Exekutive, das Eigentum des Volkes antasten. Ein solcher Vorgang, der noch bei Hobbes nicht kategorisch ausgeschlossen ist, ist nach Locke jedenfalls illegitim und rechtfertigt darüber hinaus den Widerstand gegen die Staatsgewalt, weil er gegen den einzigen Zweck gerichtet ist, der ihr innewohnt. Aber auch im Zusammenhang mit der Staatsgründung selbst geht Locke einen anderen vertragstheoretischen Weg. Sie wird nämlich nicht auf der Grundlage eines Begünstigungsvertrags vollzogen, sondern auf der Grundlage der Treuhandschaft, der Idee der Ausübung oder Verwaltung fremder Rechte durch eine dazu bevollmächtigte Person oder Versammlung. Damit bleibt die Souveränität, anders als bei Hobbes, beim Volk, d. h. bei den Eigentümern. Was allerdings auch hier gelten muss, ist das Mehrheitsprinzip, d. h., der Grundsatz, dass diejenige Entscheidung für eine Person oder Versammlung gilt, die von der Mehrheit des Volkes befürwortet wird. Anders nämlich wäre es für das Volk unmöglich als ein Körper zu handeln und dementsprechend auch unmöglich jemals zu einem Treuhänder zu kommen. Ein auf diese Weise gegründeter Staat lässt sich nun seiner Form nach differenzieren, und zwar entsprechend der jeweiligen Ordnungsstruktur der Staatsgewalt. Je nachdem in welcher Beziehung die gesetzgebende (legislative), die vollziehende (exekutive) und die nach Außen hin über Frieden und Krieg, Bündnisse usw. entscheidende (föderative) Gewalt zueinander stehen, ergeben sich unterschiedliche Gebilde. Entscheidend, so Locke, ist allerdings in jedem Fall die Ordnung der Legislative, denn die Legislative ist die höchste Staatsgewalt. Hieraus ergibt sich ihm die Notwendigkeit der Gewaltenteilung. Es wäre nämlich eine „zu große Versuchung, wenn dieselben Personen, die die Macht haben, Gesetze zu geben, auch noch die Macht in die Hände bekämen, diese Gesetze zu vollstrecken“31. In wohlgeordneten Staaten ist daher die legislative von der exekutiven Gewalt getrennt.
Jean-Jacques Rousseau sticht zumindest in zweierlei Hinsicht aus der Reihe der Vertragstheoretiker heraus. Einerseits deshalb, weil sein Begriff des Volkes erstmals auch die Masse der freien, aber besitzlosen Unterschichten umfasst, die weder in den Theorien der Antike noch des Mittelalters und der Neuzeit adäquat berücksichtigt wurden; Andererseits deshalb, weil Rousseau die großen Probleme des gesellschaftlichen Zusammenlebens, die Hauptquelle allen Übels, nicht in der Natur des Menschen sieht, sondern in der Institution des Eigentums. Im Naturzustand, in dem die Menschen laut Rousseau noch vor der Entwicklung moderner Gesellschaften miteinander lebten, waren sie trotz aller natürlichen Unterschiede politisch gleichgestellt: Alle lebten in einem Zustand der Genügsamkeit, Unabhängigkeit, Muße und Zufriedenheit. Zwar könnte man Rousseau vorwerfen, ein allzu naives Bild vom Menschen und seiner sozialen Lebensweise gezeichnet zu haben, doch für die radikale Gesellschaftskritik, die darauf aufbaut, und die heute mehr denn je von großer Aktualität scheint, gilt das nicht. Der Mensch ist zwar in Rousseaus Augen ein soziales Wesen, doch sind die Menschen einander nur in gewissen natürlichen Formen des Zusammenlebens auf eine Art gleich, die allen erlaubt, ihren Anlagen nach in Glück und Frieden zu leben. In modernen Gesellschaften werden diese natürlichen Formen aber hintertrieben, in dem diese Gesellschaften den Boden dafür bereiten, dass sich die Macht einiger weniger sehr zum Nachteil der meisten Menschen auswirkt. Für Rousseau zeichnen hier vor allem die Entstehung von Privateigentum und die immer stärker voranschreitende Arbeitsteilung verantwortlich. Privateigentum und Arbeitsteilung sind der Motor für soziale Abhängigkeit und Ungleichheit. Die Gesellschaft spaltet sich so in Arme und Reiche und erst deshalb entspinnt sich zwischen ihnen ein allgemeiner Kriegszustand. Dieser Kriegszustand, in dem jeder einzelne sein Leben riskiert, ist aber vor allem für die Reichen doppelt unvorteilhaft, denn es steht nicht nur ihr Leben auf dem Spiel, sondern auch ihr Eigentum. Dieser Umstand, so Rousseau, gab den Ausschlag zu dem „durchdachtesten Plan, den jemals der menschliche Geist ausbrütete“32: Die Eigentümer erfanden den Staat, indem alle Mitglieder sich wechselseitig verpflichteten, das Leben und das Eigentum eines jeden anderen nicht anzutasten und damit in ewigem Frieden miteinander zu leben. So zerstörten sie unwiederbringlich die natürliche Freiheit, setzen für immer das Gesetz des Eigentums und der Ungleichheit fest, machten aus einer geschickten Usurpation[33] ein unwiderrufliches Recht und unterwarfen die Menschheit – zum Vorteil einiger Ehrgeiziger – der Arbeit, der Knechtschaft und dem Elend.34 Zwischen diesem, offensichtlich gegen Locke gerichteten, pessimistischen Ende der ›Abhandlung über den Ursprung und die Grundlagen der Ungleichheit unter den Menschen‹35 und Rousseaus philosophiepolitischem Hauptwerk ›Vom Gesellschaftsvertrag‹36, in dem es um die Grundlegung einer politischen Gemeinschaft geht, in der „jeder, indem er sich mit allen vereinigt, nur sich selbst gehorcht und genauso frei bleibt wie zuvor“37, scheint eine unüberwindbare Hürde zu bestehen. Denn de facto sieht sich Rousseau mit Gesellschaften konfrontiert, in denen, der darin vorherrschenden großen Ungleichheit geschuldet, nicht nur die Freiheit der meisten ihrer Individuen verloren und Arbeit, Knechtschaft und Elend ihr Los ist, sondern auch die gesellschaftlichen Sitten verkommen. Und so ist es wenig verwunderlich, dass Rousseau selbst seine Vertragstheorie für kaum realisierbar hält. Nichtsdestoweniger gilt sein Gesellschaftsvertrag – dessen Name im französischen Original ›Du contrat social‹ lautet – als einer der wirkmächtigsten der politischen Philosophie und zwar nicht zuletzt deshalb, weil hier bereits einige Grundgedanken des politischen Sozialismus ausformuliert wurden – vor allem was Eigentum, Freiheit und Gleichheit betrifft. Was wiederum die Konstruktion des Staates als solchen betrifft, so gibt es für Rousseau unabänderliche Bestimmungen, ohne die der Gesellschaftsvertrag überhaupt keinen Bestand hätte und also wirkungslos wäre.38 „Diese Bestimmungen lassen sich, bei richtigem Verständnis, sämtlich auf eine einzige zurückführen, nämlich die völlige Entäußerung jedes Mitglieds mit allen seinen Rechten an das Gemeinwesen als Ganzes“39. Gemeinsam, so Rousseau, „stellen wir alle, jeder von uns seine Person und seine ganze Kraft unter die oberste Richtschnur des Gemeinwillens; und wir nehmen, als Körper, jedes Glied als untrennbaren Teil des Ganzen auf“40. Auf diese Weise des Zusammenschlusses entsteht der Staat als eine „sittliche Gesamtkörperschaft, die aus ebenso vielen Gliedern besteht wie die Versammlung stimmen hat“41. Der Gemeinwille (volonté générale) fungiert dabei als Souverän und ist als solcher unveräußerlich, unübertragbar und unmittelbar. Er ist nichts anderes als der Wille des Volkes, insofern er sich auf die gemeinsamen Interessen aller, auf das Wohl des Gemeinwesens, richtet: Er ist also der Wille des Volkes als eine einzige Person gedacht, als ein gemeinschaftliches Ich. Der Gemeinwille hat daher stets das Gemeinwohl zum Gegenstand seines Wollens und dieses ist zugleich das Wohl aller Einzelnen, „weil es unmöglich ist, dass die Körperschaft allen ihren Gliedern schaden will“42. Seine wichtigste integrative Funktion ist für Rousseau die Gesetzgebung, die auf der Grundlage der oben angesprochenen Grundsätze erfolgt, und zwar nach gründlicher Diskussion und durch Abstimmung entsprechend dem Mehrheitsprinzip im Rahmen öffentlicher Versammlungen aller Glieder der Gesamtkörperschaft. Die wichtigsten Institutionen des Staates sind in diesem Zusammenhang Volk und Regierung. Das Verhältnis der beiden zueinander ist einfach: Das Volk ist der Souverän und die Regierung ist der vom Volk eingesetzte »Geschäftsführer«, der dafür sorge trägt, dass die Gesetze durchgeführt bzw. eingehalten werden. Dieser »Geschäftsführer« ist dem Volk unmittelbar verantwortlich und kann jederzeit abberufen werden, denn als Diener des Souveräns darf sich der Wille der Regierung niemals gegenüber dem Volk verselbstständigen.
Kommen wir nun, diese skizzenhafte Charakterisierung der von Rawls genannten Vertragstheorien abschließend, zu Immanuel Kant – wieder einmal. Diese große Lichtgestalt der Philosophie, die auf nahezu allen Gebieten herausragendes geleistet hat, hat sich auch im Zusammenhang mit politischer Philosophie einen Namen gemacht. Vor allem Kants Ideen des Rechts und des Rechtsstaates sowie seine Schrift ›Zum ewigen Frieden‹43 sind grundlegend und wirken bis in unsere Gegenwart hinein. Weil aber Rawls, neben Lockes zweiter Abhandlung über die Regierung (›The Second Treatise of Government‹ und Rousseaus ›Vom Gesellschaftsvertrag‹ (›Du contrat social‹), überhaupt alle moraltheoretischen Schriften Kants, von der ›Grundlegung zur Metaphysik der Sitten‹44 an, als für die Lehre vom Gesellschaftsvertrag maßgebend erachtet, muss eine zusammenfassende Darstellung an dieser Stelle scheitern. Denn hierzu zählen außerdem noch jedenfalls die ›Kritik der praktischen Vernunft‹45 sowie der erste und zweite Teil der ›Metaphysik der Sitten‹46. Schon jede einzelne Abhandlung für sich ist äußerst komplex, zusammengenommen allerdings bilden sie ein derart großes philosophisches Denkgebäude, dessen man in der hier gebotenen Kürze nicht habhaft zu werden vermag. Daher nur soviel: Kants Ethik ist in letzter Konsequenz eng mit seinen Überlegungen zur reinen Vernunft verwoben, womit er jenen Teil des menschlichen Erkenntnisvermögens bezeichnet, dessen Erkenntnisse ausschließlich a priori, mithin von aller Erfahrung unabhängig, stattfinden.47 Diese reine Vernunft lässt sich in theoretischer wie praktischer Absicht gebrauchen, sodass sie einerseits theoretische andererseits praktische Erkenntnisse hervorzubringen vermag. Im ersten Fall haben wir es mit einer bloßen Bestimmung von Gegenständen und ihren Begriffen zu tun, im zweiten Fall mit sogenannten Neuschöpfungen. Unabhängig davon, so Kant, läuft die Endabsicht der reinen Vernunft unhintergehbar auf drei Gegenstände hinaus: „die Freiheit des Willens, die Unsterblichkeit der Seele, und das Dasein Gottes“48. Doch es stellt sich die Frage, auf welches Interesse diese Endabsicht des reinen Gebrauchs der Vernunft gegründet ist: Ist sie bloß auf ihr spekulatives (metaphysisches) und also theoretisches, „oder vielmehr einzig und allein auf ihr praktisches Interesse gegründet“49? Für Kant liegt die Antwort auf der Hand: Weil uns ein Wissen über die Freiheit des Willens, die Unsterblichkeit der Seele und das Dasein Gottes – so denn die reine spekulative Vernunft überhaupt dazu in der Lage ist, ein solches Wissen hervorzubringen – für unser Verständnis der Natur, als dem Inbegriff der Erfahrung, keinen Nutzen erweisen würde, uns diese Kardinalsätze – wie Kant sie nennt – aber „gleichwohl durch unsere Vernunft dringend empfohlen werden: so wird ihre Wichtigkeit wohl eigentlich nur das Praktische angehen müssen“50. Die ganze Tätigkeit der reinen Vernunft, ist also auf diese drei Probleme gerichtet: Freiheit, Unsterblichkeit und Gott. Doch während es dem spekulativen und also theoretischen Interesse um ein Wissen geht, geht es dem praktischen einzig darum festzustellen, „was zu tun sei, wenn der Wille frei, wenn ein Gott und eine künftige Welt ist“51. Mit anderen Worten: Nicht das, was ist, steht im Mittelpunkt des praktischen Interesses der reinen Vernunft, sondern das, was sein soll. Und dementsprechend bedarf es auch des praktischen Gebrauchs der Vernunft, um hierüber Auskunft zu erhalten. Die Richtschnüre dieses Gebrauchs wiederum müssen reine praktische Gesetze sein, „deren Zweck durch die Vernunft völlig a priori gegeben ist, und die nicht empirischbedingt, sondern […] Produkte der reinen Vernunft sind“52. „Dergleichen aber sind die moralischen Gesetze, mithin gehören diese allein zum praktischen Gebrauch der reinen Vernunft […].“53 Was in dem bisher gesagten durchklingt, ist die letzte der drei berühmten Fragen, die Kant in der Transzendentalen Methodenlehre der ›Kritik der reinen Vernunft‹ aufwirft: Was darf ich hoffen, wenn ich tue, was ich soll?54 Sie ist nämlich theoretisch und praktisch zugleich, und zwar so, dass die praktische „nur als ein Leitfaden zur Beantwortung der theoretischen, und, wenn diese hoch geht, spekulativen Frage führet“55. „Denn alles Hoffen geht auf Glückseligkeit, und ist in Absicht auf das Praktische und das Sittengesetz [– mithin das moralische Gesetz –]56 eben dasselbe, was das Wissen und das Naturgesetz in Ansehung der theoretischen Erkenntnis der Dinge ist. Jenes läuft zuletzt auf den Schluß hinaus, daß etwas sei (was den letzten möglichen Zweck bestimmt), weil etwas geschehen soll; dieses, daß etwas sei (was als oberste Ursache wirkt), weil etwas geschieht.“57 Es ist also die Glückseligkeit, die zunächst einmal ein Verbindungsstück darstellt, zwischen dem theoretischen Vernunftgebrauch einerseits und dem praktischen andererseits. Nun ist die Glückseligkeit aber insgesamt, so Kant, die Befriedigung aller unserer Neigungen und die Gesetze dieser Befriedigung sind dergleichen zwei: nämlich die Klugheitsregel und das Sittengesetz.58„Das erstere rät, was zu tun sei, wenn wir der Glückseligkeit wollen teilhaftig, das zweite gebietet, wie wir uns verhalten sollen, um nur der Glückseligkeit würdig zu werden.“59 Jenes gründet sich daher „auf empirische Prinzipien; denn anders, als vermittelst der Erfahrung, kann ich weder wissen, welche Neigungen dasind, die befriedigt werden wollen, noch welches die Naturursachen sind, die ihre Befriedigung bewirken können“60. Dieses hingegen „abstrahiert von Neigungen, und Naturmitteln sie zu befriedigen, und betrachtet nur die Freiheit eines vernünftigen Wesens überhaupt, und die notwendigen Bedingungen, unter denen sie allein mit der Austeilung der Glückseligkeit nach Prinzipien zusammenstimmt […]“61. Weil Kant davon überzeugt ist, dass es ein solches Sitten- bzw. Moralgesetz tatsächlich gibt, das „völlig a priori (ohne Rücksicht auf empirische Bewegungsgründe […]) das Tun und Lassen, d. i. den Gebrauch der Freiheit eines vernünftigen Wesens überhaupt“62, zu bestimmen vermag, ist seine Ethik insgesamt reine Vernunftethik. Das a priori Gesollte einerseits und die Freiheit andererseits spielen dabei die Hauptrollen und Gott wiederum zeigt sich als ein letzter Ankerpunkt, denn ohne einen Gott, so Kant, „und eine für uns jetzt nicht sichtbare, aber gehoffte Welt, sind die herrlichen Ideen der Sittlichkeit zwar Gegenstände des Beifalls und der Bewunderung, aber nicht Triebfedern des Vorsatzes und der Ausübung, weil sie nicht den ganzen Zweck, der einem jeden vernünftigen Wesen natürlich und durch eben dieselbe reine Vernunft a priori bestimmt und notwendig ist, erfüllen“63.
Die »philosophische Kulisse«, von der oben die Rede war, ist nun fast zur Gänze erschlossen. Was uns noch fehlt, um auf Rawls’ Theorie der Gerechtigkeit gut vorbereitet zu sein, ist ein Exkurs zum Utilitarismus und Intuitionismus. Rawls versteht nämlich die Theorie der Gerechtigkeit auch als deren systematische moraltheoretische Gegenposition. Er geht davon aus, dass die Theorie der Gerechtigkeit eine Analyse der Gerechtigkeit bietet, die der vorherrschenden utilitaristisch-intuitionistischen Tradition überlegen ist.64 Insofern ist es an dieser Stelle naheliegend die wichtigsten Aspekte dieser Tradition offenzulegen; nicht zuletzt deshalb, weil auch Rawls selbst eine solche Vorgehensweise wählt:
Zunächst zum Utilitarismus65, der sogenannten Nutzen- bzw. Vorteilsethik:66 Jeremy Bentham, der Begründer des klassischen Utilitarismus, beurteilt die moralische Richtigkeit einer Handlung mit Bezug auf das Prinzip des Nutzens. Darunter versteht er ein Prinzip „das schlechthin jede Handlung in dem Maß billigt oder missbilligt, wie ihr die Tendenz innezuwohnen scheint, das Glück der Gruppe, deren Interesse in Frage steht, zu vermehren oder zu vermindern“67. Das Prinzip des Nutzens, oder besser gesagt der Nutzensumme, wird deshalb oft auch auf die Kurzformel gebracht, dass wir genau dann moralisch richtig handeln, wenn dadurch für möglichst viele Betroffene ein größtmögliches Glück geschaffen wird. Klarer noch äußerst sich Bernhard Bolzano. Im Lehrbuch der Religionswissenschaft schreibt er: „Wähle von allen dir möglichen Handlungen immer diejenige, die, alle Folgen erwogen, das Wohl des Ganzen, gleichviel in welchen Teilen, am meisten befördert.“68 Umgeschlagen auf die Frage nach einer moraltheoretisch zu rechtfertigenden, also gerechten, politischen Ordnung, die uns hier ja vordergründig interessiert, findet sich der Hauptgedanke des Utilitarismus, so Rawls, bei dem englischen Moralphilosophen Henry Sidgwick69 am klarsten und am leichtesten zugänglich formuliert: Eine Gesellschaft ist genau dann gerecht, „wenn ihre Hauptinstitutionen so beschaffen sind, daß sie die größte Summe der Befriedigung [der Eigeninteressen des Einzelnen]70 für die Gesamtheit ihrer Mitglieder hervorbringen“71. Der Grundzug des Utilitarismus, in seiner moraltheoretischen wie auch vertragstheoretischen Deutung, besteht dabei in der Übertragung des Prinzips der vernünftigen Entscheidung für einen Einzelmenschen72 auf eine Gruppe von Menschen:
Für einen Menschen ist es […] völlig richtig, jedenfalls wenn andere nicht betroffen sind, daß er so weit wie möglich auf sein eigenes Bestes, auf seine vernünftigen Ziele aus ist. Warum sollte nun eine Gesellschaft nicht nach genau demselben Grundsatz, angewandt auf eine Gruppe, verfahren, und demnach das, was für einen Menschen vernünftig ist, auch für eine Vereinigung von Menschen als richtig ansehen? So wie das Wohlbefinden eines Menschen aus der Reihe von Befriedigungen konstruiert wird, die er zu verschiedenen Zeiten in seinem Leben erfährt, genau so wäre das Wohl der Gesellschaft zu konstruieren aus der Erfüllung des Systems der Bedürfnisse der vielen Menschen, die zu ihr gehören. Für den einzelnen heißt der Grundsatz: bestmögliche Förderung seines eigenen Wohlbefindens, Befriedigung seiner Bedürfnisse; und dementsprechend lautet er für die Gesellschaft: bestmögliche Förderung des Wohls der Gruppe, weitestgehende Befriedigung des Systems der Bedürfnisse, das sich aus den Bedürfnissen der Mitglieder ergibt.73
„Ganz wie ein einzelner gegenwärtige und zukünftige Gewinne und Verluste gegeneinander aufrechnet, so kann eine Gesellschaft Wohl und Übel ihrer verschiedenen Mitglieder gegeneinander aufrechnen.“74 Entsprechend dem utilitaristischen Prinzip der Nutzensumme ist eine Gesellschaft genau dann richtig aufgestellt, wenn ihre Institutionen dazu nützlich sind, die Summe des Wohls der meisten ihrer Mitglieder zu maximieren.
Nun noch zum sogenannten ethischen Intuitionismus: