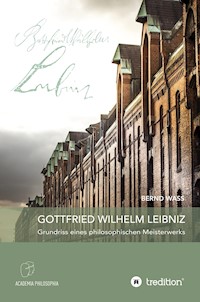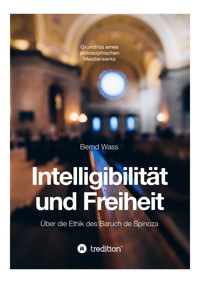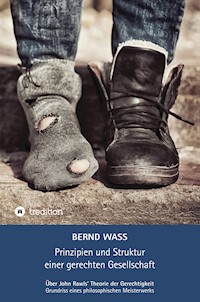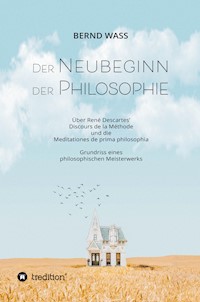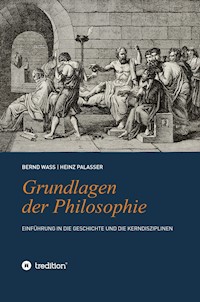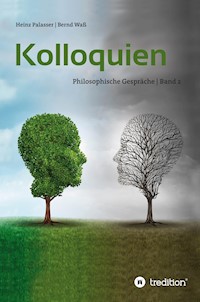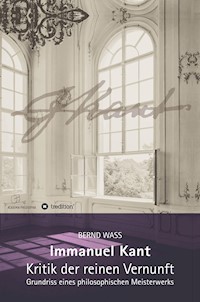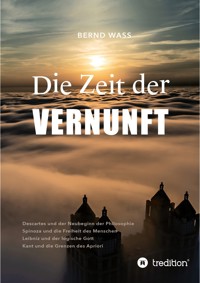
24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Zeit der Vernunft ist ohne Zweifel eine der faszinierendsten Epochen philosophischer Weltdeutung. Was sich hier über eine Zeitspanne von rund 200 Jahren artikuliert, ist die ungeheuerliche Idee, den christlich-dogmatischen Antworten auf die fundamentalen Fragen zu Gott, Welt und Mensch eine nicht-dogmatische, allein auf Vernunfttätigkeit beruhende, kritisch begründete und erkenntnislogisch hinreichende Vorstellung des Wirklichen gegenüberzustellen. Das vorliegende Buch soll Philosophieinteressierten dazu dienen, sich diese unglaublich spannende philosophische Zeit zu erschließen, und zwar entlang der Beiträge ihrer Protagonisten. Dementsprechend liefert es den Grundriss der Überwindungsphilosophie Descartes', der Freiheitsphilosophie Spinozas, der Versöhnungsphilosophie Leibnizens und der Desillusionierungsphilosophie Kants.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 977
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
DIE ZEIT DER VERNUNFT
Descartes und der Neubeginn der Philosophie | Spinoza und die Freiheit des Menschen | Leibniz und der logische Gott | Kant und die Grenzen des Apriori
Mit freundlicher Unterstützung der School of Philosophy Österreichische Privatakademie für Philosophie
© 2024 Bernd Waß
Autor: Mag. phil. Dr. phil. Bernd Waß, MSc
Umschlaggestaltung, Grafik: Mag. Petra Pfuner, Creativbüro Vitamin©
Künstlerische Gestaltung, Illustration: Martina Six, www.martinasix.at
Cover-Bild: Pexels (CC0)
ISBN Softcover: 978-3-384-09259-5
ISBN Hardcover: 978-3-384-09258-8
ISBN E-Book: 978-3-384-09260-1
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, An der Strusbek 10, 22926 Ahrensburg, Germany
Das Werk einschließlich seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", An der Strusbek 10, 22926 Ahrensburg, Deutschland.
Erste Auflage 2024
DER AUTOR
Bernd Waß studierte am Institut für Philosophie der Kultur- und Gesellschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Salzburg Analytische Philosophie. Zum Doktor der Philosophie promovierte er bei Prof. Dr. Reinhard Kleinknecht, Prof. Dr. Otto Neumaier und Prof. Dr. Volker Gadenne mit einer Arbeit zur Philosophie des Geistes. Er ist Philosoph, ordentliches Mitglied der Österreichischen Gesellschaft für Philosophie und Co-Gründer der School of Philosophy. Seine Arbeits- und Forschungsschwerpunkte finden sich in der Metaphysik, insbesondere in der Philosophie des Geistes sowie in der Erkenntnistheorie, insbesondere in der Phänomenwelt-Realwelt-Problematik.
DIE KÜNSTLERIN
›Die Zeit der Vernunft‹ wurde von der Wiener Künstlerin Martina Six illustriert. Ihr Leben ist geprägt von gegensätzlichen Momenten. Vom Aufwachsen am Land und vom Getriebe der Großstadt. Vom Eintauchen in eine technische Welt und von der Arbeit auf den Baustellen der Männer. Von der Erfahrung über die Wichtigkeit des Materiellen und des Geldes und vom Weg ins Immaterielle, vom Versuch, die Welt und die dahinterliegende Ordnung mit dem Geist zu erfassen, das Transempirische des Daseins zu entdecken und auszudrücken. Und schließlich vom Verhaftetsein im Kreislauf des Alltags, dem farblosen Funktionieren des Menschen und von der Loslösung als einer Hinwendung zum echten Leben, als einem sich Öffnen für neue Erfahrungen und Möglichkeiten. Und ihre Kunst: Ein Ausdruck dieses Mäanderns durch die zerklüftete Landschaft aus Äußerem, Innerem, Diesseitigem und Jenseitigem, der Versuch, das Selbst in einer Welt wie dieser begreiflich zu machen.
DIE PHILOSOPHIE HAT ALLES, UM IM BESTEN FALL NICHTS MIT IHR ZU TUN ZU HABEN: SIE IST THEORETISCH NICHT PRAKTISCH; SIE IST LEBENSFERN, NICHT LEBENSNAH UND DIE BESCHÄFTIGUNG MIT IHR IST ÜBERAUS SCHWIERIG. MIT DER LEICHTIGKEIT DES SEINS HAT SIE NICHTS ZU TUN. UM ES IM STIL DES FRANZÖSISCHEN PHILOSOPHEN UND SEISMOGRAFEN DES VERFALLS, EMIL M. CIORAN, ZU SAGEN: DAS PENDEL DES LEBENS SCHLÄGT NUR IN ZWEI RICHTUNGEN AUS, IN DIE DER HEILSAMEN ILLUSION ODER DER UNERTRÄGLICHEN WAHRHEIT. LETZTERE IST IHR GESCHÄFT. WELT UND MENSCH AM SEZIERTISCH DES DENKENS. UNTER DEM PHILOSOPHENHAMMER BLEIBT NICHTS HEIL. VIELLEICHT ABER IST SIE GERADE DESHALB SO ANZIEHEND, SO SCHILLERND, SO FASZINIEREND, SO TIEF; LÄSST SIE EINEN NICHT MEHR LOS.
GEWIDMET DEN SOMMERAKADEMIKERINNEN UND SOMMERAKADEMIKERN DER SCHOOL OF PHILOSOPHY, OHNE DIE DIESES BUCH NICHT ENTSTANDEN WÄRE, MEINEM LIEBEN FREUND HERRN DR. HEINZ PALASSER, OHNE DEN ES DIE SCHOOL OF PHILOSOPHY GAR NICHT GÄBE UND MEINEM VEREHRTEN DOKTORVATER UNIV.-PROF. DR. REINHARD KLEINKNECHT, OHNE DEN MIR DIE TIEFEN DER PHILOSOPHIE UNZUGÄNGLICH GEBLIEBEN WÄREN.
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Halbe Titelseite
PROLOG
KAPITEL 1: Hintergrund ÜBERLEGUNGEN
1.1 Zum Philosophiebegriff
1.2 Zur Erkenntnistheorie
1.3 Zur Metaphysik
1.4 Zur Ethik
KAPITEL 2: DER DREHPUNKT DES Nachdenkens
2.1 Die Philosophie des Mittelalters
2.1.1 Die Patristik
2.1.2 Die Scholastik
2.2 Neuzeit und Aufklärung
KAPITEL 3: DESCARTES UND DER Neubeginn DER PHILOSOPHIE
3.1 Discours de la Méthode
3.1.1 Ein Befund über den Zustand der Wissenschaften
3.1.2 Inspiration und Methode
3.1.3 Moral und Orientierung
3.1.4 Das Fundament der Erkenntnis
3.1.5 Grundlegung einer modernen Naturwissenschaft
3.1.6 Neuausrichtung und Fortschritt in den Wissenschaften
3.2 Die Meditationes de prima philosophia
3.2.1 Über das, was in Zweifel gezogen werden kann
3.2.2 Über die Natur des menschlichen Geistes
3.2.3 Über Gott, dass er existiert
3.2.4 Über das Wahre und Falsche
3.2.5 Über das Wesen der materiellen Dinge
3.2.6 Über die Existenz materieller Dinge und die Unterscheidung von Geist und Körper
3.3 Zusammenschau
KAPITEL 4: SPINOZA UND DIE Freiheit DES MENSCHEN
§ 4. 1 Die Metaphysik des Absoluten
§ 4.1.1 Substanz und Existenz
4.1.2 Substanz und Unendlichkeit
4.1.3 Erste Rekapitulation
4.1.4 Vielheit der Attribute und Unteilbarkeit von Substanz
4.1.5 Substanz-Monismus und Immanenz-Metaphysik
4.1.6 Zweite Rekapitulation
4.1.7 Freiheit, Verstand und Wille Gottes
4.1.8 Ewigkeit, Ding-Welt und Determinismus
4.1.9 Dritte Rekapitulation
4.1.10 Anthropomorphismus und Vorstellungsrealismus
§ 4.2 Die Theorie der adäquaten Erkenntnis
4.2.1 Gottes Idee von allem überhaupt als erkenntnislogische Spiegelung seiner Existenz
4.2.2 Ideen, Welt und Gott: Eine Frage der Relation
4.2.3 Erste Rekapitulation
4.2.4 Mensch, Geist und Körper
4.2.5 Innenwelt, Außenwelt und adäquate Erkenntnis
KAPITEL 5: LEIBNIZ UND DER logische GOTT
5.1 Der Anfangspunkt und die wichtigsten Bausteine des Systems
5.1.1 Das allgemeine Prinzip des Grundes
5.1.2 Die Begriffstheorie
5.1.3 Die Theorie der Ideen und der Möglichen Welten
5.1.4 Die Theorie der Existenz
5.1.5 Die Theorie der Erkenntnisgrade
5.1.6 Die Zeichentheorie
5.2 Die Monadologie
5.2.1 Seelenhafte Substanzen
5.2.2 Innere Tätigkeit und Perzeption
5.2.3 Einheit und Ich-Identität
5.2.4 Vielheit und Individualität
5.2.5 Die Allbeseelung des Universums
5.2.6 Die Differenzierung des Lebendigen
5.3 Das dreifache Freiheitsproblem
5.3.1 Die Freiheit Gottes
5.3.2 Die Freiheit des Individuums
5.3.3 Die Freiheit des individuellen Handelns
5.4 Die Theodizee – Leibnizens metaphysischer Sündenfall
5.4.1 Das Theodizeeproblem
5.4.2 Der Grundgedanke zur Lösung des Theodizeeproblems
5.4.3 Die Lösung des Theodizeeproblems
5.5 Zusammenschau
KAPITEL 6: KANT UND DIE Grenzen DES APRIORI
6.1 Das Ende des dogmatischen Schlummers
6.2 Die kopernikanische Wende der Denkungsart
6.3 Synthetische Urteile a priori als Endabsicht der Metaphysik
6.4 Die Vermessung des menschlichen Erkenntnisvermögens
6.4.1 Die Transzendentale Ästhetik oder die Vermessung des Anschauungsvermögens
6.4.2 Die Transzendentale Logik oder die Vermessung des Verstandes- und Vernunftvermögens
6.5 Die Grundverfassung der Wirklichkeit
6.6 Zusammenschau
KAPITEL 7: DIE Qintessenz
Literaturverzeichnis
Die Zeit der Vernunft
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Epigraph
PROLOG
Literaturverzeichnis
Die Zeit der Vernunft
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
ZUM GEBRAUCH
Die Zeit der Vernunft ist ohne Zweifel eine der faszinierendsten Epochen philosophischer Weltdeutung. Das vorliegende Buch soll Ihnen dazu dienen, sich diese unglaublich spannende philosophische Zeit zu erschließen, und zwar entlang der Beiträge ihrer Protagonisten: René Descartes, Baruch de Spinoza, Gottfried Wilhelm Leibniz und Immanuel Kant. Dementsprechend richtet es sich an Dilettant: innen, und zwar in der ursprünglich charmanten Deutung einer Liebhaber: in der Philosophie, die sich ohne schulmäßige bzw. universitäre Ausbildung und nicht berufsmäßig mit ihr beschäftigt, also aus purem Interesse, Vergnügen oder Leidenschaft. Ich habe daher versucht, die Dinge nicht komplizierter zu machen, als sie sind, habe sie aber auch nicht zu vereinfachen gesucht, wenn es mir nicht nötig schien. Es herrscht nämlich heute eine verführerische Tendenz vor, die Sache der Philosophie, dem Wunsch nach Allgemeinverständlichkeit geschuldet, zu einer weitaus seichteren Tätigkeit zu machen, als sie es in Wirklichkeit ist. Aber wie hat es der deutsche Philosoph Franz von Kutschera in seiner Philosophie des Geistes einst so treffend ausgedrückt: „Wirklich einfach und allgemeinverständlich ist leider nur schlechte Philosophie. In guter Philosophie bemüht man sich, auf Gipfel zu gelangen, von denen aus man eine Übersicht über die zerklüftete Landschaft unseres Wissens hat. Nur hohe Gipfel bieten einen solchen Überblick und auf sie kommt man nur mit Kraft, Ausdauer und angemessener Ausrüstung. In einem anderen Bild: Was nicht schwer ist, ist kein Gold.“ Lassen Sie sich also vom manchmal »störrischen Ross« der Philosophie nicht abwerfen. Sie werden sehen, es lohnt sich.
Erlauben Sie mir noch, auf einige Besonderheiten hinzuweisen, die Ihnen das Lesen bzw. das Studium des Buchs erleichtern sollen: Ausdrücke, die besondere Aufmerksamkeit verdienen, werden durch kursiv gesetzte Schriftzeichen gekennzeichnet. Um Ausdrücke, die erwähnt werden, von Ausdrücken zu unterscheiden, die verwendet werden, werden Anführungsnamen gebildet. Ein Anführungsname wird gebildet, indem der betreffende Ausdruck in einfache Klammern (› … ‹) gesetzt wird. Metaphorisch gebrauchte Ausdrücke werden in doppelte Klammern (» … «) gesetzt. Kürzere wörtliche Zitate werden im Fließtext durch klassische Anführungszeichen und Fußnote gekennzeichnet. Längere wörtliche Zitate (ausgenommen Zitate in Fußnoten) werden durch Einrückung, kleinere Schriftgröße und Fußnote gekennzeichnet. Und weil wir gerade bei den Fußnoten sind. Manche Menschen mögen keine Fußnoten. Ich hingegen liebe sie. Nur mit einer Fußnote ist eine Seite adäquat »gekleidet«. Fußnoten bilden nämlich einen Mikrokosmos zusätzlicher, wenngleich nicht vordergründiger Informationen und Gedankengänge. So finden sich darin – neben sämtlichen Quellenangaben – erstens Anmerkungen, um bestimmte Begriffe oder Zusammenhänge in Zitaten zu erläutern, zweitens Ausschnitte aus Originaltexten, auf die nicht verzichtet werden wollte, obschon man sie hätte vernachlässigen können, drittens Erläuterungen und Hinweise zum besseren Verständnis des Textes insgesamt und endlich viertens Seitenverweise zum jeweiligen Abschnitt des Originaltextes, um die Orientierung zu behalten und es der Leser: in während des Studiums jederzeit zu erlauben, zwischen dem Originaltext und der hier vorliegenden Abhandlung zu vergleichen.
Die Zeit der VERNUNFT
FANTASTISCHER RATIONALISMUS
„ MAN HÄTTE GLAUBEN KÖNNEN, DASS DIE TAGE ALLMÄHLICH HELLER WERDEN, DASS SIE IM GLANZ EINES SICH UNAUFHÖRLICH VERFEINERNDEN GEISTES LEUCHTEN, DASS DIE VERNUNFT DEN FEIND BESIEGT, DER SIE ZU VERSKLAVEN TRACHTET, IHN HINABSTÖßT INS REICH DER SCHATTEN. MAN HÄTTE GLAUBEN KÖNNEN, DASS SICH DER MENSCH ÜBER SICH SELBST ERHEBT; DASS ER SICH INS GEGENTEIL VERKEHRT, ZUM ANTIMENSCHEN WIRD; DASS ER AUFHÖRT MIT SEINEM ZERSTÖRERISCHEN ABERGLAUBEN, ALLE RELIGION BEENDET, DEN GÖTTERHIMMEL SCHLIEßT, DIE DIKTATUR DES NUTZENS, DIESES ERBARMUNGSLOSE REGIME DER ZWECKE STÜRZT UND SICH DER HERRSCHAFT DES GELDES ENTLEDIGT, IHRES HINTERHÄLTIGEN WAHNSINNS EINSICHTIG WIRD; ER – DER ZUM DENKEN GESCHAFFENE, VOM LOGOS BESEELTE, ZUM HÖCHSTEN GRAD DER ABSTRAKTION UND ALSO ZUR THEORIE BEFÄHIGTE. MAN HÄTTE GLAUBEN KÖNNEN, DER MENSCH WIRD SCHON BALD ZUM ÜBERMENSCHEN, ZUR LICHTGESTALT DES ZARATHUSTRA, ZUM PROPHETEN EINER GLORREICHEN ZUKUNFT. DOCH STATTDESSEN: DUNKELHEIT; DIE WELT IN EINEM ERBÄRMLICHEN ZUSTAND. VON IRREN REGIERT, VON GIERZERFRESSENEN AUSGEBEUTET UND VON FANATIKERN IN BRAND GESTECKT. UNTER DEM DECKMANTEL DES WOHLSTANDS SIND WIR LÄNGST IHRE KOMPLIZEN, STEHLEN WIR EINANDER DIE SEELEN, HABEN WIR DIE GROßEN UTOPIEN BEGRABEN. DIE DUMMHEIT KOMMT IN SO VERFÜHRERISCHEM GEWAND DAHER, TÄUSCHT UNS SO PERFIDE IN SIE HINEIN, DASS WIR SEHENDEN AUGES VERLEUGNEN, WAS ALLERORTS SICH ZUTRÄGT. DAS PENDEL DES LEBENS SCHLÄGT IM GLEICHEN TAKT. VOM ANBEGINN DER ZEIT, DER UNERTRÄGLICHKEIT DER WAHRHEIT NICHT GEWACHSEN, FLÜCHTEN WIR UNS IN HEILSAME ILLUSION. TRUNKEN VOR GLÜCK, SO BIZARR ES AUCH SEIN MAG, STÜRZEN WIR DEM TOD ENTGEGEN. LACHEND GEHEN WIR IN DIE FALSCHE RICHTUNG, ALS WÄRE NICHTS GESCHEHEN.“
– FRANÇOIS-MARIE STRAPACE –
PROLOG
Was Sie auf den folgenden Seiten zu lesen bekommen, das ist die Exegese einer großen philosophischen Weltdeutung, die ohne Zweifel zum faszinierendsten zählt, was die Philosophie jemals hervorgebracht hat. Die Rede ist vom neuzeitlichen Rationalismus oder wie ich lieber sagen möchte, vom Fantastischen Rationalismus1, von der ungeheuerlichen Idee, den christlich-dogmatischen Antworten auf die fundamentalen Fragen zu Gott, Welt und Mensch eine nicht-dogmatische, allein auf Vernunfttätigkeit beruhende, kritisch begründete und erkenntnislogisch hinreichende Vorstellung des Wirklichen gegenüberzustellen. Im Ausgang der Renaissance hebt hier ein philosophisches Denken an, das in Opposition zur tausendjährigen Doktrin des Mittelalters, in der es sich als Magd der Theologie verdingt, schon längst in Vergessenheit geratene, wenngleich nicht minder fundamentale Fragen wiederentdeckt und sie ins Zentrum seiner Überlegungen stellt: die Fragen nach der Möglichkeit und dem Umfang von Erkenntnis. Denn während im Mittelalter eine »ganze Menschheit« in der von Kirche und Religion proklamierten „Sicherheit über das Dasein Gottes, seine Weisheit, Macht und Güte; über die Herkunft der Welt, ihre sinnvolle Ordnung und Regierung; über das Wesen des Menschen […], seine Stellung im Kosmos“2 und vor allem über die Möglichkeiten des „Geistes im Erkennen des Weltseins“3 lebt, soll es nun darum gehen, ein Gebäude zu errichten, das seine rechtfertigende Kraft nicht einer religiös-dogmatischen Autorität, sondern allein der Vernunft verdankt. Was nämlich bisher über jeden Zweifel erhaben und unerschütterlich schien – Gott als universelle Begründungsinstanz –, gerät im 17. Jahrhundert nicht zuletzt ob der bahnbrechenden Entwicklungen der Naturwissenschaften endgültig ins Wanken.4 Der Wahlspruch der Philosophen, so könnte man sagen, ändert sich – und zwar spätestens, wie wir noch sehen werden, mit Descartes – und heißt ab nun in der Sprechweise des berühmten Aristoteles gesagt, ›Ich liebe Gott, aber noch mehr liebe ich die Wahrheit‹, weshalb es zu einer zentralen Aufgabe gerät, die Situation aufzuhellen, in der wir Menschen uns im Hinblick auf unser Wissen über die Welt befinden.5 Die Überwindung der Erkenntnisdogmatik der Alten, die Befreiung aus der Denkenge eines weitestgehend auf göttlicher Legitimation fußenden Denkens ist daher in der Tat der Dreh- und Angelpunkt der theoretischen Philosophie der Neuzeit. So entstehen an dieser entscheidenden Weggabelung der Philosophiegeschichte – vielleicht sogar der Menschheitsgeschichte – die großen rationalistischen Erkenntnistheorien.6 Einerseits, denn andererseits, und das ist bemerkenswert, entstehen zur selben Zeit die großen Metaphysiken. Doch das ist kein Zufall, denn sie sind nicht das Ergebnis einer Beschäftigung mit der Metaphysik der Metaphysik wegen, sondern der Notwendigkeit geschuldet, bestimmte Thesen der Erkenntnistheorien, und zwar jene im Hinblick auf die prinzipielle Erkennbarkeit der Welt, mit einer rationalen Letztbegründung zu versehen. Und dazu muss man vom Standpunkt des erkennenden Subjekts aus betrachtet – jedenfalls vor Immanuel Kant – unweigerlich metaphysischen Boden betreten. Tatsächlich sind die erkenntnistheoretische und die metaphysische Weltbetrachtung – jedenfalls historisch gesehen – lediglich zwei Seiten einer Medaille. Das zeigt sich z. B. im Fall von Descartes’ Gottesmetaphysik, vermittelst derer er zu zeigen sucht, dass Gott existiert und dass er kein Betrüger ist und daher insbesondere die Auffassung wahr sein muss, dass die Welt, wie sie im Erkennen vorliegt, kein Trugbild ist; oder im Fall von Leibnizens Theorie der möglichen Welten, diese von Gott hervorgebrachten begrifflich-logischen Blaupausen der Schöpfung, vermittelst derer er zu zeigen sucht, dass unsere wirkliche Welt, der Strukturgleichheit des menschlichen Denkens mit dem göttlichen wegen, einer vollständigen Erkenntnis prinzipiell zugänglich ist. Nicht zuletzt deshalb sind die Denkgebäude, mit denen wir es im Fantastischen Rationalismus zu tun haben, so atemberaubend und von einer Schönheit, die ihresgleichen sucht. Gebäude, in der Fantasie, Tiefenschärfe und Logik miteinander verschmelzen und ein theoriearchitektonisches Ganzes bilden, sodass man die Welt, die vor einem lag, auf eine Weise zu begreifen vermochte, ohne die es die Moderne nicht gäbe. Die Urheber der wichtigsten dieser Denkgebäude, dieser beeindruckenden Kathedralen aus Begriffen, die Protagonisten dieses Aufbruchs in eine neue Zeit, in die Zeit der Vernunft, sind unbestritten René Descartes, Baruch de Spinoza, Gottfried Wilhelm Leibniz und Immanuel Kant. Säulenheilige der Philosophie, wenn man so will. Um sie wird es gehen. Entlang ihrer wichtigsten Beiträge bzw. Hauptwerke erarbeiten wir uns in der Folge, so der Plan, den Grundriss einer Epoche, die derart spannend ist, dass Sie besser studierend zu Hause bleiben, anstatt ins Kino zu gehen, um es etwas altmodisch zu sagen.7 Es gibt nämlich nichts Vergleichbares. Und obwohl es kein Spaziergang wird, soviel ist sicher, die Mühe wird sich lohnen. Denn was Sie erwartet, ist ein intellektueller Sonnenaufgang von einem der höchsten Gipfel aus gesehen, die das systematische Denken zu erklimmen im Stande ist. Und davon abgesehen: „So, wie wir denken, leben wir.“8 Darum ist das Sammeln philosophischer Ideen, um es in Anlehnung an Alfred North Whitehead zu sagen, mehr als die nutzlose Beschäftigung weltentrückter Existenzen mit Fragen, die man ohnehin nicht beantworten kann, denn sie formen unseren Typ der Zivilisation.
1 Ich bezeichne den Rationalismus der Neuzeit deshalb als ›Fantastischen Rationalismus‹, weil es sich hier um eine Weltdeutung handelt, in der Fantasie und philosophische Logik auf eine Weise miteinander verschmelzen, wie es schöner und intellektuell gewinnbringender nicht sein könnte und sich bis heute nirgendwo mehr findet.
2 Hirschberger, Johannes: Geschichte der Philosophie, Altertum und Mittelalter, Herder, Köln, 1980, S. 318.
3 Ebenda.
4 Von Gott als universeller Begründungsinstanz ist deshalb die Rede, weil man unter Rückgriff auf Gott alles überhaupt (wenn auch zumeist dogmatisch und daher nur vermeintlich) zu begründen vermochte.
5 In Abwandlung des Wahlspruchs der Philosophen des Mittelalters, der durchaus hätte lauten können: Ich liebe die Wahrheit, aber noch mehr liebe ich Gott. Aristoteles’ Original lautete ja bekanntermaßen: Ich liebe Platon, aber noch mehr liebe ich die Wahrheit.
6 Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass neben den rationalistischen Erkenntnistheorien auch herausragende empiristische Erkenntnistheorien hervorgebracht wurden. Der entscheidende Unterschied besteht darin, dass der Ursprung aller Erkenntnis im Fall des Rationalismus in der Vernunft liegt, während er im Fall des Empirismus in der Erfahrung liegt. Vgl.1.2, Zur Erkenntnistheorie.
7 Insgesamt gesehen geht es uns darum, die wichtigsten Überlegungen unserer Protagonisten nachzuvollziehen und die wesentlichen Aspekte ihrer Gedankengebäude zu verstehen, weniger hingegen darum, sie in allen Details und kritisch zu durchdringen. Das wäre für den Anfang zu viel des Guten.
8 Whitehead, Alfred North: Denkweisen, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2001, S. 102 f.
Die hier abgebildete Darstellung der sieben freien Künste und der über ihnen thronenden Philosophie stammt aus der im ausgehenden 12. Jh. verfassten Enzyklopädie ›Hortus Deliciarum‹ (Garten der Köstlichkeiten) der Äbtissin des Klosters Hohenburg, Herrad von Landsberg.
KAPITEL 1
Hintergrund ÜBERLEGUNGEN
„PHILOSOPHIE IST EIN GRÜNDLICHES, SYSTEMATISCHES NACHDENKEN ÜBER LETZTE FRAGEN – FRAGEN, AUF DEREN NICHTAUFWERFEN DIE STABILITÄT UNSERER ALLGEMEINEN LEBENSPRAXIS BERUHT.“
– ROBERT SPAEMANN –
Wir haben im Prolog davon gesprochen, dass es sich sehr wahrscheinlich nicht um einen Spaziergang handelt, den wir hier zu unternehmen trachten, um den Fantastischen Rationalismus der Neuzeit zu durchdringen, sondern wohl eher um eine Gipfeltour. Dementsprechend müssen wir uns vorbereiten. Dazu gehört es einerseits, über einen gemeinsamen Philosophiebegriff nachzudenken und andererseits zu klären, auf welchem philosophischen, sprich disziplinären Terrain wir uns befinden. Dabei wird uns im Zusammenhang mit den Denkgebäuden von Descartes, Leibniz und Kant sowohl die Erkenntnistheorie als auch die Metaphysik begegnen und bei Spinoza darüber hinaus die Ethik.1
1.1 Zum Philosophiebegriff
Es gibt viele Fragen in dieser Welt und unter ihnen solche, die für unser intellektuelles Leben von profundem Interesse sind. Fragen über das Dasein des Menschen, das Wesen des Seins, die Existenz der Wirklichkeit, die Möglichkeit von Erkenntnis. Aber auch schlichte Fragen von der Art: Woran soll ich glauben? Und: Wie kann ein gutes Leben gelingen? Auf den ersten Blick scheinen diese Fragen nicht besonders schwierig zu sein, „aber in Wirklichkeit handelt es sich um […] [die] schwierigsten, die es gibt“2.
Wenn uns klar geworden ist, welche Hindernisse einer direkten und zuversichtlichen Antwort im Wege stehen, haben wir es in der Philosophie schon ein Stück weit gebracht. Die Philosophie ist nämlich nichts anderes als der Versuch, solche fundamentalen Fragen zu beantworten, und zwar nicht gedankenlos und dogmatisch zu beantworten, wie wir das im Alltag und selbst in der Wissenschaft oft tun, sondern kritisch, nachdem wir untersucht haben, was solche Fragen rätselhaft macht, und nachdem wir die ganze Verworrenheit und Verschwommenheit unserer normalen Vorstellungen erkannt haben.3
Diese auf Bertrand Russell zurückgehende Charakterisierung der Philosophie ist eine von vielen möglichen, wenngleich eine sehr treffende, wie ich finde. Eine andere, ebenso treffende Charakterisierung stammt von Robert Spaemann: Philosophie, so Spaemann, ist ein gründliches, systematisches Nachdenken über letzte Fragen – Fragen, auf deren Nichtaufwerfen die Stabilität unserer allgemeinen Lebenspraxis beruht. Deutlich wissenschaftlicher geht es vergleichsweise beim berühmten Aristoteles zu. In seiner Metaphysik ist zu lesen, die Philosophie sei die Lehre von den allgemeinsten Wahrheiten und den letzten Gründen.4 Was die allgemeinsten Wahrheiten betrifft, so lassen sich die diesbezüglichen philosophischen Bemühungen am besten dadurch charakterisieren, dass man sie in ein Verhältnis zu den Einzelwissenschaften setzt:
Wenn man nämlich in einer Spezialwissenschaft irgendeine Erkenntnis gewonnen hat, und wenn nun der forschende Geist noch weiter fragt nach den Gründen dieser Gründe, also nach den allgemeineren Wahrheiten, aus denen jene Erkenntnis abgeleitet werden kann, so gelangt er bald an einen Punkt, wo er mit den Mitteln seiner Einzelwissenschaft nicht mehr weiter kommt, sondern von einer allgemeineren umfassenderen Disziplin Aufklärung erhoffen muß. Es bilden nämlich die Wissenschaften gleichsam ein ineinander geschachteltes System, in welchem die allgemeinere immer die speziellere umschließt und begründet. So behandelt die Chemie nur einen begrenzten Teil der Naturerscheinungen, die Physik aber umfaßt sie alle; an sie also muß sich der Chemiker wenden, wenn er seine fundamentalsten Gesetzmäßigkeiten, etwa die des periodischen Systems der Elemente, der Valenz usw. zu begründen unternimmt. Und das letzte, allgemeinste Gebiet, in welches alle immer weiter vordringenden Erklärungsprozesse schließlich münden müssen, ist das Reich der Philosophie […]. Denn die letzten Grundbegriffe der allgemeinsten Wissenschaften – man denke etwa an den Begriff des Bewusstseins in der Psychologie, an den des Axioms und der Zahl in der Mathematik, an Raum und Zeit in der Physik – gestatten zuletzt nur noch eine philosophische […] Aufklärung.5
Was wiederum die letzten Gründe betrifft, so könnte man sagen, dass die Philosophie diejenige Disziplin ist, die einen Erkenntnisabschluss zu gewinnen sucht, und zwar durch die Angabe eben letzter Gründe. Ein letzter Grund ist dabei einer, der selbst keiner Begründung mehr bedarf. Der Erkenntnisprozess soll so auf ein letztgültiges Erkenntnisfundament zurückgeführt werden.
Tatsächlich ist die Frage nach dem Wesen der Philosophie so alt wie die Philosophie selbst und die Diskussionen ob der richtigen Antwort sind nach wie vor lebendig. Das liegt sehr wahrscheinlich daran, dass die Philosophie im Unterschied zu den zahlreichen einzelwissenschaftlichen Disziplinen keinen streng abgegrenzten Gegenstandsbereich hat. Der Grund dafür: In bestimmter Hinsicht kann alles Gegenstand philosophischer Betrachtung sein. Nicht nur Seiendes, sondern auch Nichtseiendes, nicht nur bestehende Sachverhalte, sondern auch bloß mögliche Sachverhalte und sogar Unmögliches, also unmögliche Sachverhalte, etwa widersprüchliche Gegenstände wie z. B. runde Vierecke. Manche Philosophinnen und Philosophen halten es daher für unmöglich, eine Definition von Philosophie nach dem Muster ›Philosophie ist die Lehre von …‹ geben zu wollen, denn die Antwort auf die Frage, was Philosophie ist und sein kann, variiert schließlich auch noch mit den philosophischen Schulen und Standpunkten. Es gibt, kurz gesagt, beinahe so viele Antworten auf diese Frage, wie es philosophische Schulen und Standpunkte gibt. Endlich ist sogar umstritten, ob die Philosophie überhaupt eine Lehre ist oder nicht vielmehr eine Art wissenschaftlicher Tätigkeit, etwa die Tätigkeit der Analyse von Sätzen und Satzsystemen. Zielführender könnte es daher sein, die Philosophie nach ihrem genuinen Problemfeld zu bestimmen. Denn trotz des unklaren Gegenstandsbereichs sowie der unterschiedlichen Schulen und Standpunkte gibt es ein Feld von Fragen und Problemen, mit denen sich Philosophinnen und Philosophen seit der Antike beschäftigen und wodurch darüber hinaus auch eine zumindest teilweise Abgrenzung von den Einzelwissenschaften möglich wird. Es handelt sich um Fragen und Probleme von ganz grundlegender Art, die normalerweise von keiner Einzelwissenschaft behandelt werden und die über den Bereich dessen, was die Einzelwissenschaften untersuchen, hinausgehen. Während man z. B. in den Einzelwissenschaften nach bestimmten Erkenntnissen oder allgemein gesagt nach Wahrheit sucht, wollen Philosophinnen und Philosophen wissen, ob und wenn ja wie Erkenntnis überhaupt möglich ist, welche Arten von Erkenntnissen es gibt und wie die Ausdrücke ›Erkenntnis‹ und ›Wahrheit‹ exakt zu definieren sind. Ein Mathematiker will das Verhältnis der Zahlen untereinander erforschen, doch ein Philosoph wird fragen: Was ist eine Zahl? Einen Psychologen interessiert die Tatsache, dass unsere psychische Verfassung unsere körperliche Verfassung beeinflusst und umgekehrt, doch dem Philosophen stellt sich die Frage, wie es überhaupt eine Beziehung zwischen körperlicher und geistiger Verfassung geben und wie man eine solche Beziehung erklären kann. Ein Physiker will wissen, woraus das Körperliche besteht „und was für die Schwerkraft verantwortlich ist, doch ein Philosoph wird fragen, woher wir wissen können, dass es außerhalb unseres eigenen Bewusstseins etwas gibt“6. Und endlich mag ein Historiker fragen, „was in einem bestimmten Zeitraum der Vergangenheit geschah, doch ein Philosoph wird fragen: Was ist die Zeit?“7 Das Hauptanliegen der Philosophie besteht demnach darin, sehr allgemeine Auffassungen über die Wirklichkeit, einzelne Aspekte derselben oder die Wirklichkeit insgesamt betreffend zu thematisieren, zu durchdringen, zu verstehen, zu begründen oder gegebenenfalls zu widerlegen.
Ein Verstehen allerdings, das man durch bloßes Nachdenken zu erlangen sucht, denn anders als die meisten Wissenschaften geht die Philosophie nicht empirisch vor. Wie hat es Arthur Schopenhauer einst treffend auf den Punkt gebracht: „Das ganze Wesen der Welt abstrakt, allgemein und deutlich in Begriffen zu wiederholen und es so als reflektiertes Abbild […] der Vernunft niederzulegen: Dieses und nichts anderes ist Philosophie.“8 Das Abbild, von dem hier die Rede ist, ist Theorie. Eine logisch organisierte, mithin nach Grund und Folge geordnete, rationale Weltanschauung. Ein widerspruchsfreies System von Aussagesätzen, das uns darüber Auskunft gibt, was in ganz allgemeiner Hinsicht der Fall ist und was nicht. Somit ist aber auch klar, worum es in der Philosophie nicht geht: Es geht nicht darum zu handeln, in den Lauf der Dinge einzugreifen, ihm eine andere Richtung zu geben. Ein Umstand, der womöglich Karl Marx zu seinem berühmten Satz veranlasst hat: „Die Philosophen haben die Welt nur unterschiedlich interpretiert, es kommt darauf an, sie zu verändern.“9 Lehnen Sie sich zurück, öffnen Sie eine gute Flasche Wein, denn in der Tat: Die Veränderung der Welt ist nicht das Geschäft der Philosophie. Vernünftigerweise!
An dieser Stelle sei mir ein Exkurs zum soeben eingeführten Begriff der Theorie erlaubt, denn die Rede von Theorien wird uns fortan begleiten: Wenn wir im Alltag vom Ausdruck ›Theorie‹ Gebrauch machen, dann tun wir dies auf ganz andere Weise, als es in der Philosophie der Fall ist. Theorien werden von vielen für etwas Unsicheres und Vorläufiges, ja in manchen Fällen sogar für etwas Unnützes gehalten – im Gegensatz zur Praxis, denn die Praxis gilt ihnen gemeinhin als unbezweifelbare Instanz, als Maß, an dem sich die Dinge zu messen haben. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir im Alltag nur über einen unzureichend genauen Theoriebegriff verfügen. Theorien im philosophischen Sinn – und letztlich auch im wissenschaftlichen – sind, wie oben bereits gesagt, Satzsysteme, die aus einer endlichen Menge von wahren Aussagesätzen bestehen und die einen Gegenstandsbereich nach Grund und Folge ordnen. Sie erfüllen strenge wissenschaftstheoretische und formallogische Anforderungen und wir sind damit imstande, einen bestimmten Ausschnitt der Welt umfassend und genau zu erklären. Alles andere sind keine Theorien. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die Entwicklung einer Theorie in diesem Sinn zu den größten Leistungen menschlicher Geistestätigkeit zählt. Ob alle wissenschaftlichen Satzsysteme, die als Theorien bezeichnet werden, tatsächlich Theorien sind, ist zwar fraglich, dass aber jedenfalls nichts von dem, was für gewöhnlich in der Alltagssprache und bisweilen auch in populärwissenschaftlichen Darstellungen mit dem Ausdruck ›Theorie‹ bezeichnet wird, tatsächlich eine Theorie ist, das sollte zumindest in Ansätzen schon jetzt einsichtig sein. Wenn man also beispielsweise sagt, der Detektiv habe eine Theorie, wenn er bloß mutmaßt, dass der Gärtner der Mörder sei, dann ist das dem soeben eingeführten Theoriebegriff nach Unsinn.
1.2 Zur Erkenntnistheorie
Die Grundfrage der Erkenntnistheorie lautet: Können wir die Welt erkennen und wenn ja, wie liegt sie uns vor? Die Erkenntnistheorie betrachtet also die Wirklichkeit, insofern sie Gegenstand der Erkenntnis von Subjekten ist – im Unterschied etwa zur Metaphysik, die die Wirklichkeit an sich betrachtet. Man kann die Erkenntnistheorie daher als Ausdruck des Versuchs verstehen, die Situation aufzuhellen, in der wir Menschen uns im Hinblick auf unser Wissen über die Welt befinden. Was man sich diesbezüglich erwarten darf, ist eine systematische Untersuchung aller möglichen Erkenntnisarten, verbunden mit der Frage, welche der möglichen Erkenntnisarten uns in die Lage versetzt, gesicherte Erkenntnisse über die Welt und uns selbst als eines Teils davon zu erlangen. Dabei geht es um alltägliche und wissenschaftliche Erkenntnis, um Erkenntnis einzelner Tatsachen und allgemeiner Gesetze, um Erkenntnis durch Erfahrung bzw. Wahrnehmung oder durch Vernunft, um Erkenntnis der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ebenso wie um moralische oder religiöse Erkenntnis.10 Darüber hinaus gilt es freilich zu klären, was Erkenntnis bzw. Wissen überhaupt ist; also, wovon genau die Rede ist, wenn wir behaupten, dass wir dieses oder jenes erkennen oder wissen. Im Alltag, aber auch in den meisten Wissenschaften tun wir nämlich so, als würden uns diese Begriffe keinerlei Schwierigkeiten machen. Unsere Gesellschaft bezeichnet sich als Wissensgesellschaft – Wissen ist zu einer gesellschaftlich wertvollen Ressource geworden –, doch philosophisch gesehen, ist es um die Rechtfertigung unserer Wissensansprüche nicht gerade gut bestellt. Es bedarf daher brauchbarer Kriterien, um »echtes« Wissen von bloßem Scheinwissen unterscheiden zu können. Doch damit nicht genug: Die Erkenntnistheorie verfolgt auch noch andere Ziele, etwa die Herausarbeitung einer irrtumssicheren Grundlage für unser gesamtes Wissen oder die Formulierung erster Erkenntnisprinzipien, die jede Wissenschaft als gültig voraussetzen muss.
Wir befänden uns allerdings nicht in der Philosophie, könnten wir ohne Widerrede fortfahren. Es gibt nämlich durchaus Philosophinnen und Philosophen, die das Projekt der Erkenntnistheorie für gescheitert halten. Hegel hat bekanntlich gegen die Erkenntnistheorie eingewendet: „Die Untersuchung des Erkennens kann nicht anders als erkennend geschehen und das ist so absurd, als schwimmen lernen, bevor man ins Wasser geht.“11 Leonhard Nelson ist ihm in ›Die Unmöglichkeit der Erkenntnistheorie‹ darin gefolgt. Man hat der Erkenntnistheorie im Wesentlichen Zirkularität vorgeworfen, was Hegel in seinem Einwand auch andeutet. Viktor Kraft, ein Mitglied des berühmten Wiener Kreises, hat den Einwand Hegels zum Ausgangspunkt einer systematischen Darstellung der Erkenntnistheorie gemacht, und er fragt in seiner Erkenntnislehre, ob nach Hegels Fundamentalangriff „Erkenntnistheorie überhaupt noch möglich“12 ist.
Man sollte erwarten, daß […] dies die erste Frage der Erkenntnislehre bilden müßte. Aber man hat sich nicht weiter mit ihr beschäftigt. Weil die Argumentation katastrophal erscheint und weil man sie doch nicht widerlegen kann, sich aber in seiner erkenntnistheoretischen Arbeit auch nicht stören lassen möchte, hat man darüber hinweggesehen und sich nicht weiter darum gekümmert. Solange jedoch nicht geklärt ist, wie es mit diesem schlagenden Einwand steht, weiß man nicht, ob das, was in der Erkenntnistheorie getrieben wird, überhaupt einen Sinn hat, oder was in ihr sinnvoll unternommen werden kann.13
Um darüber Klarheit zu bekommen, muß man sich bewusst machen, was im Begriff der Erkenntnis eigentlich gesucht wird. […] Was die Erkenntnislehre sucht, ist […] klarzustellen, was als Erkenntnis erreicht werden soll und wie es erreicht werden soll. Sie will nicht alles hinnehmen, was als »Erkenntnis« aufgetreten ist, und gelten lassen, was den Anspruch erhebt, Erkenntnis zu sein. Sie will vielmehr zwischen unhaltbaren und gerechtfertigten Erkenntnisansprüchen zu sondern ermöglichen […]. Erkenntnis ist das Ergebnis eines geistigen Handelns, eines methodischen Verfahrens. Handeln wird durch Ziele geleitet und die Erkenntnislehre hat das Ziel […], die Richtschnur für das erkennende Handeln aufzustellen: sie normiert dieses. In einer Norm wird eine bestimmte Beschaffenheit als eine geforderte aufgestellt.14
Die Erkenntnistheorie ist also zunächst und im Grunde eine normative Disziplin. Wenn man von der Unmöglichkeit der Erkenntnistheorie spricht, ist dies daher so zu verstehen, dass gewisse Ziele unerreichbar sind. Die Frage aber, welche Ziele (mit welchen Methoden) erreichbar sind und welche nicht, ist selbst schon eine typisch erkenntnistheoretische Frage. Doch nicht nur innerhalb der Grenzen der Erkenntnistheorie, sondern auch darüber hinaus stellt sich die Frage nach ihrer Legitimation. Denn:
Mit menschlicher Erkenntnis, ihren Voraussetzungen, ihrer Natur, Leistung und Entwicklung befassen sich viele wissenschaftliche Disziplinen. Neurophysiologie und physiologische Psychologie untersuchen die physiologischen Grundlagen von Erkenntnisvorgängen. Wahrnehmungs-, Denk- und Lernpsychologie studieren Typen und Strukturen von Erkenntnisleistungen, ihre Zusammenhänge untereinander und ihre Beziehungen zum Verhalten. Die Entwicklungspsychologie erforscht die Onto- wie Phylogenese der Erkenntnis, die Entwicklungsphysiologie die Entstehung des menschlichen Zentralnervensystems und der Sinnesorgane, die Biologie ordnet die Entwicklung des menschlichen Erkenntnisapparats in den größeren Horizont der Evolution kognitiver Funktionen bei anderen Lebewesen ein. Die allgemeine Sprachwissenschaft befaßt sich mit den Zusammenhängen zwischen Sprache, Denken und Erfahrung, die Soziologie mit der sozialen Konstitution und Vermittlung von Erkenntnisinhalten.15
Was bleibt nun angesichts dieser Vielzahl einzelwissenschaftlicher Zuständigkeiten für die Erkenntnistheorie als philosophischer Disziplin an Themen überhaupt noch übrig? „Noch für Kant stellten sich solche Fragen nicht. Zu seiner Zeit gab es keine eigenständige Psychologie oder Soziologie, keine biologische Anthropologie, wie sie seit Darwin möglich geworden ist. Es gab keine Disziplinen, die der Philosophie ihre Zuständigkeit für Fragen menschlichen Erkennens hätten bestreiten können.“16 Das ist heute anders. Jene universelle Zuständigkeit für alle wichtigen Fragen über die Welt und den Menschen, die früher viele Philosophinnen und Philosophen für sich reklamierten, wird nun mit ähnlicher Naivität von der Naturwissenschaft beansprucht. Das philosophische Erkenntnisideal des Apriori wurde vom naturwissenschaftlichen des Aposteriori abgelöst.17 „Als wissenschaftlich gelten weithin nur mehr die Methoden und Ergebnisse der Naturwissenschaft, nicht die der Philosophie.“18 Ob gerechtfertigt oder nicht, man muss anerkennen, dass es eine Fülle von Problemen gibt, die sich nur empirisch, d. h. durch naturwissenschaftliche Untersuchungen klären lassen. Man muss aber auch anerkennen, dass es Fragen gibt, die sich von den empirischen Einzelwissenschaften nicht behandeln lassen, weil sie die Voraussetzungen der jeweiligen Disziplin selbst betreffen. So geht z. B. die Biologie von einer (naiv-)realistischen Konzeption des Wirklichen aus, nach der es eine vom menschlichen Bewusstsein, „vom Erleben und Erkennen in ihrer Existenz wie Beschaffenheit unabhängige Außenwelt gibt, und sie beurteilt menschliche Wahrnehmung danach, in welchen Grenzen und wie genau unser Erleben den objektiven physikalischen Gegebenheiten entspricht.“19 Doch auf die Frage, ob ein solcher Realismus haltbar ist – eine der zentralen Fragen der Erkenntnistheorie – kann man von ihr keine (empirisch gestützte) Antwort erwarten. Die philosophische Erkenntnistheorie fragt also nicht nur, wie Erkenntnis zustande kommt, sondern sie prüft die Voraussetzungen von Erkenntnis überhaupt. Dadurch führt sie letztlich zu einer kritischen Selbstbestimmung und zu einer normativen Bewertung unserer kognitiven Fähigkeiten.
Blicken wir abschließend noch auf eine erkenntnistheoretische Debatte, die im Sinne dieser kritischen Selbstbestimmung von besonderem Interesse ist und die uns unmittelbar betrifft, die Debatte um Empirismus und Rationalismus. Empirismus und Rationalismus sind die dominanten erkenntnistheoretischen Positionen der Philosophie des 17. und 18. Jahrhunderts. Der Streit über die Grundlagen der Erkenntnis ist hier omnipräsent. Viele bedeutende Denker haben Abhandlungen verfasst, um ihrem jeweiligen Standpunkt Ausdruck zu verleihen. Der Reihe nach:
Der Kernthese des Empirismus zufolge, als dessen wichtigste Vertreter zumeist John Locke, David Hume und George Berkeley genannt werden, gründen alle oder jedenfalls die meisten unserer Erkenntnisse auf Erfahrung. Sie sind mit anderen Worten gesagt von Erfahrung abhängig. Man spricht daher auch von Erkenntnis a posteriori. Insofern kann man die Aussage Thomas von Aquins ›nihil est in intellectu quid non fuerit in sensu – nichts ist im Verstand, das nicht vorher durch die Sinne erfasst worden wäre‹ als Fundament des Empirismus verstehen. Die zentralen Elemente dieser Bestimmung bedürfen aber nichtsdestoweniger der Aufklärung. Das betrifft zunächst den Begriff der Erkenntnis. Fasst man ihn weit und zählt nicht nur Urteile und Schlüsse, sondern – wie Kant – auch Begriffe zu den Erkenntnissen, dann können sich hinter einem empiristischen Standpunkt drei voneinander unabhängige Thesen verbergen: Nämlich erstens, dass allen Begriffen, die wirklich etwas bezeichnen und die nicht bloß leere Worte sind, eine Erfahrung zugrunde liegt; zweitens, dass die Geltung aller Aussagen, die nicht aus anderen Aussagen ableitbar sind, auf Erfahrung beruht und schließlich drittens, dass alle wahren Aussagen, die nicht unmittelbar auf Erfahrung beruhen, aus Aussagen ableitbar sein müssen, die es tun. Darüber hinaus stellt sich die Frage nach der Bedeutung des Begriffs der Erfahrung. Die meisten Empiristen reduzieren Erfahrung auf das durch die äußeren Sinne Wahrgenommene oder Empfundene.20 Andere wiederum rechnen nicht nur die äußeren, sondern auch die inneren Wahrnehmungen, durch die der Geist seine eigenen Tätigkeiten und die in diesem Zusammenhang hervorgebrachten Begriffe wahrnimmt, zur Erfahrung. Und endlich ist noch zu klären, wie das Abhängigkeitsverhältnis zwischen Erkenntnis und Erfahrung jeweils bestimmt ist und was es im Genaueren heißt, dass Begriffe oder Ideen aus der Erfahrung stammen oder in ihr gegeben sind oder dass Aussagen von der Erfahrung abhängen. Eine Aufforderung, der wir zwar nicht nachkommen werden, die uns aber dennoch zeigt, dass sich empiristische Positionen auch im Hinblick auf die Deutung dieses Verhältnisses unterscheiden. Die klassische neuzeitliche Auffassung des Empirismus findet sich jedenfalls bei John Locke. John Locke spricht einerseits von innerer und äußerer Wahrnehmung und andererseits davon, dass der Verstand vor aller Erfahrung eine leere Tafel ist – eine tabula rasa –, ein passives Vermögen, dem sich die äußere wie die innere Welt sozusagen durch Erfahrung »einschreibt«.
Dem Empirismus entgegengesetzt gründen der Kernthese des Rationalismus zufolge, als dessen wichtigste Vertreter zumeist René Descartes, Baruch de Spinoza und Gottfried Wilhelm Leibniz genannt werden, alle oder jedenfalls die meisten unserer Erkenntnisse auf bloßer Verstandestätigkeit. Sie sind mit anderen Worten gesagt von Erfahrung unabhängig. Man spricht daher auch von Erkenntnis a priori. Zwar wird zugegeben, dass der Verstand erst durch die Sinneswahrnehmung zur Tätigkeit veranlasst wird, denn „Kraft einer bewunderungswürdigen Ökonomie der Natur können wir keinen abstrakten Gedanken haben, der nicht irgendetwas Sinnliches – und wären es auch nur sinnliche Zeichen wie Buchstaben und Laute – bedürfte“21; doch letztlich ist es der Verstand, der es uns erlaubt, Erkenntnisse zu gewinnen. Er ist darüber hinaus, wie etwa Leibniz immer wieder betont hat, weder eine Tabula rasa noch ein bloß passives Vermögen. Eine Tabula rasa nicht, weil ihm bereits vor aller Erfahrung ein »funktionales Gerüst« gegeben ist – die sogenannten eingeborenen Ideen, auf die er sich von Urteil zu Urteil und von Schluss zu Schluss stützt – und ein bloß passives Vermögen nicht, weil Erkenntnis nicht etwas ist, das uns sozusagen zustößt, sondern etwas, das wir aktiv hervorbringen. Was hier bereits durchklingt, ist der erkenntniskritische Rückgang des Rationalismus auf das Erkenntnissubjekt und die damit einhergehende Analyse der Verstandesleistung. Ein philosophischer Ansatz, der uns bereits bei Descartes begegnen wird und der in Kants Transzendentalphilosophie seinen systematischen Höhepunkt erlebt. Insgesamt gehen die Rationalisten davon aus, dass sich auf Dauer nichts der Einsicht durch den Verstand verschließen kann. Dementsprechend gibt es auch nur vorläufig – nicht grundsätzlich – unlösbare Probleme.
1.3 Zur Metaphysik
Seit dem Scheitern des logischen Empirismus – jener philosophischen Position am Beginn des 20. Jahrhunderts, der zufolge alle wissenschaftlich sinnvollen Sätze über die Welt entweder Beobachtungssätze sind oder Sätze, die sich mithilfe von Logik und Mathematik auf Beobachtungssätze zurückführen oder aus ihnen erschließen lassen – und dem Ende des Linguistic turn – die von den Begründern der Analytischen Philosophie wie Frege, Russell und Wittgenstein ausgegangene Idee einer Überwindung der Philosophie durch philosophische Sprachanalyse –, ist die Metaphysik zwar in die Philosophie zurückgekehrt, hat das Transempirische vor allem im Zusammenhang mit dem Aufstieg der Philosophie des Geistes neuen Aufschwung erfahren, doch im Vergleich zu allen bisherigen Zeiten führt sie nach wie vor ein Schattendasein. Die Gründe für diese nur zaghafte Revitalisierung nach dem raschen Niedergang der einst so großen, wenn auch umstrittenen Disziplin, wie wir bald bemerken werden, sind vielfältig. Dennoch kristallisieren Tendenzen aus: Da findet sich auf der einen Seite der schier unverrückbare Glaube vieler Einzelwissenschaftlerinnen und Einzelwissenschaftler, das Weltganze ohne Rückgriff auf metaphysische Realitäten erklären zu können. Es ist der Physikalismus, dem zufolge sich die Gesamtheit des Wirklichen in den von der Physik behaupteten Elementarteilchen und in Aggregaten solcher Teilchen erschöpft, der hier in seiner naturwissenschaftlichen Gestalt auftritt. Von der unreflektierten Vorstellung einer wahrnehmungsimmanenten Außenwelt getragen, wie sie im Naiven Realismus ihre philosophische Auskleidung findet und von der sich selbst die Physik nie ganz befreit hat, wird der Mythos eines der Erfahrung durch und durch zugänglichen Universums zur Doktrin. Auf der anderen Seite befindet sich die akademische Philosophie – so scheint es jedenfalls – noch immer in einem Rechtfertigungskampf um die eigene Existenz. Die intellektuellen Waffen, mithilfe derer sie diesen Kampf zu gewinnen sucht, zwingen sie zum Rückzug auf einen unmissverständlichen Standpunkt der Wissenschaftlichkeit. Dementsprechend ist die Begeisterung für Metaphysik auf beiden Seiten enden wollend. Doch man sollte sich von diesem Befund nicht beeindrucken lassen. Denn jene, die glauben, dass die empirischmathematischen Methoden der Naturwissenschaften hinreichend sind, um das Weltganze zu verstehen, irren sich ebenso wie jene, die glauben, man hätte es in der Metaphysik mit kruden, haltlos spekulativen, unwissenschaftlichen Gedankengebäuden zu tun. Die einen übersehen sowohl die wissenschaftstheoretischen Probleme der Objektivierung als auch den Umstand, dass ihre schlechthin wichtigste Voraussetzung, ohne die jede naturwissenschaftliche Forschung absurd wäre, selbst eine metaphysische ist: nämlich die Existenz einer objektiven, mithin von allen Subjekten und deren Bewusstseinsphänomenen unabhängige physische Welt. Die anderen wiederum übersehen nicht nur die erkenntnistheoretische Tragweite metaphysischer Gebäude, sondern haben auch nicht die geringste Ahnung im Hinblick auf deren Gütekriterien. Es sind vor allem diese beiden letzten Aspekte – die erkenntnistheoretische Tragweite metaphysischer Gebäude und ihre Gütekriterien – die uns im Zusammenhang mit dem Fantastischen Rationalismus und dem Versuch einer Überwindung der epistemischen Dogmatik des Mittelalters im besonderen interessieren. Doch zunächst noch zur Frage, womit wir es denn eigentlich zu tun haben: Was Metaphysik ist, was sie zu leisten imstande ist und was man also von ihr erwarten darf, darüber gibt es unterschiedliche Auffassungen. Für Peter van Inwagen etwa ist Metaphysik die Untersuchung letzter Realität.22„Der Ausdruck ›letzte Realität‹ verweist auf den Gegensatz von Erscheinung und Wirklichkeit und einem möglichen Regress von Realitäten. Die letzte Realität ist das, was hinter allen Erscheinungen steht und alle Regresse von Erscheinungen und relativer Realität abschließt.“23 Für Reinhard Kleinknecht – meinem verehrten Doktorvater – wiederum ist Metaphysik der Inbegriff der Frage nach der Existenz und Beschaffenheit einer (wahrnehmungs-) transzendenten Wirklichkeit, die als Realgrund einer (wahrnehmungs-) immanenten Wirklichkeit in Erscheinung tritt. Und für Uwe Meixner endlich ist Metaphysik diejenige menschliche Aktivität, „die darauf abzielt, auf einer hohen Stufe der begrifflichen Allgemeinheit ein Gesamtbild von allem überhaupt und von uns Menschen darin hervorzubringen“24. Letztlich aber, so könnte man mit Alfred North Whitehead und Viktor Kraft die Quintessenz einer weiter gefassten Metaphysikdeutung herausschälend sagen, sind Metaphysiken, also diejenigen Denkgebäude, die im Rahmen metaphysischer Beschäftigung hervorgebracht werden, spekulative Systeme allgemeiner Ideen, Erfindungen, fantasievolle Konstruktionen, die es uns erlauben sollen, jedes Element unserer Erfahrung als besonderen Fall eines allgemeinen Schemas zu begreifen.25 Doch hierin liegt nun gerade nicht das Moment ihrer Disqualifikation – worauf man aus der Perspektive des (wissenschaftlichen) Common Sense schnell zu schließen geneigt ist –, sondern das Moment ihrer außergewöhnlichen Tragweiten in erkenntnistheoretischen Belangen. Eine jede Metaphysik ist nämlich im Erfolgsfall erstens eine Theorie der erlebten Erscheinungen, der Bewusstseinsphänomene, des subjektiv Realen, zu dem alles gehört, was ein wahrnehmendes und denkendes Subjekt vorstellt: Häuser, Bäume, Hunde, Menschen, Bücher usw., schlechthin alles, was wir für gewöhnlich ›Welt‹ nennen; und ebenso Gedanken, Schlüsse, Urteile, Gefühle, Träume usw., schlechthin alles, was wir für gewöhnlich ›Geist‹ nennen. Weil damit aber auch die Bedingungen aufgestellt sind, unter denen die erlebnisgegebene Wirklichkeit einen rationalen, gesetzmäßigen Zusammenhang bildet, kommt man zweitens zu einer allgemeingültigen und notwendigen Erkenntnis bewusstseinstranszendenter Realität. Denn das, was den rationalen, gesetzmäßigen Zusammenhang der für sich allein genommen unzusammenhängenden Bewusstseinsphänomene konstituiert, muss aus erkenntnislogischen Gründen faktisch existieren. Weil man darüber hinaus bei genauerer Betrachtung zugeben muss, dass das von allen Wissenschaften gesuchte, nämlich das objektiv Reale, stets mit dem Bewusstseinstranszendenten zusammenfällt, ist durch eine Metaphysik nicht nur die erlebnisgegebene Wirklichkeit erklärt, sondern auch eine objektive Realität erkannt. Und diese allgemeine und notwendige Erkenntnis des objektiv Realen hat auch wirklich Geltung: „Sie gilt in der Weise einer notwendigen Annahme, einer Annahme, die anerkannt werden muß, weil sie die gegebenen Erscheinungen in ein rationales System bringt, weil sie die Ergänzung und Einordnung gibt“26, durch die sich die erlebnisgegebene Wirklichkeit, die Wirklichkeit der Erscheinungen, mithin die Bewusstseinswirklichkeit „als […] rational erweist“27.
Streng allgemeine Erkenntnisse von objektiver Realität sind also dadurch möglich, daß sie in der Weise und mit der Geltung einer Theorie aufgestellt werden. Und notwendig sind dann jene Erkenntnisse, welche sich aus diesen allgemeinen als besondere Fälle ergeben. Das ganze System einer strengen Erkenntnis von objektiver Realität besteht in Einsichten, daß etwas real vorhanden sein und so und so bestimmt sein und sich so und so verhalten muß, wenn die gegebene Wirklichkeit rational und begreiflich sein soll. […] So aber auch nur so läßt sich allgemeine und notwendige Erkenntnis einer objektiv realen Welt wirklich kritisch begründen: als Aufstellungen einer Theorie. […]28
Mit „dieser Erkenntnisweise der erklärenden Theorie“29 ist aber zugleich „das Prinzip einer Metaphysik […] hingestellt […], die so erwünscht und unentbehrlich ist als der konsequente Positivismus unhaltbar und unannehmbar ist, und die so wissenschaftlich ist als dieser wissenschafts-vernichtend.“30 Und zwar unabhängig davon, dass ihre Aussagen „weder Aussagen von Tatsachen noch syllogistisch beweisbar“31 sind, sondern „spekulative Annahmen, wenn man will“32. Denn die „Grundsätze, welche für unsere Erfahrung konstitutiv sind, können nur als unentbehrliche Bedingungen für ein logisches System“33 zum Verständnis der erlebnisgegebenen Wirklichkeit Geltung erhalten und auf keinem anderen, sprich empirischem Weg legitimiert werden.
Doch führt uns eine so verstandene Metaphysik nicht unvermeidbar in ein Erkenntnisdesaster, schnurstracks in eine Dunkelheit, die es doch zu überwinden gilt, eben gerade weil „die Grundsätze, derer sie sich bedient, keinen Probierstein der Erfahrung […] anerkennen“34? Ist es nicht so, dass dem Wahnsinn Tür und Tor offen stehen, wenn wir uns im Zusammenhang mit der Erkenntnis objektiver Realität von der Empirie verabschieden und uns tatsächlich auf die Metaphysik verlassen? Mitnichten! Die Metaphysik ist kein freies Spiel der Einbildungskraft, denn der Probierstein der Erfahrung wird durch den Probierstein der analytischen Anwendbarkeit, der logischen Perfektion und der erkenntnislogischen Kohärenz ersetzt. Womit wir abschließend bei den Gütekriterien metaphysischer Denkgebäude angekommen wären.
Der Probierstein der analytischen Anwendbarkeit: Die Wirklichkeit, die uns unmittelbar umgibt, ist immer schon Bewusstseinswirklichkeit. „Nur im Bewußtsein ist uns überhaupt etwas gegeben“35, gleichgültig, ob es sich um äußere, die Außenwelt betreffende oder um innere, die Innenwelt betreffende Gegebenheiten handelt. Die Aufhellung dieser Wirklichkeit „ist die einzige Rechtfertigung jeglichen Denkens; und den Ausgangspunkt für das Denken bildet die analytische Beobachtung […] [ihrer] Bestandteile“36. Wenn Metaphysik das Bemühen ist, ein System allgemeiner Ideen zu entwerfen, auf dessen Grundlage jedes Element des unmittelbar gegebenen Wirklichen interpretiert werden kann, so bedeutet ›analytische Anwendbarkeit‹, dass alles, „dessen wir uns als Erlebnis, Wahrnehmung, Wille oder Gedanke bewußt sind, den Charakter eines besonderen Falls im allgemeinen Schema haben“37 muss. Finden sich Elemente, auf die das nicht zutrifft, so ist die betreffende Metaphysik gescheitert oder jedenfalls verbesserungsbedürftig.
Der Probierstein der logischen Perfektion: Im Zusammenhang mit dem Probierstein der logischen Perfektion haben wir es mit den Gesetzmäßigkeiten der Logik zu tun; man könnte auch sagen mit den Gesetzmäßigkeiten des folgerichtigen Denkens. Es geht um logische Widerspruchsfreiheit, logische Verträglichkeit und logische Gültigkeit. Beginnen wir mit der logischen Widerspruchsfreiheit. Ein Aussagesatz A ist logisch widerspruchsfrei genau dann, wenn A nicht logisch widersprüchlich ist. A ist logisch widersprüchlich genau dann, wenn A die Negation von A impliziert. Bemühen wir Platon, der in der Apologie den Sokrates sagen lässt ›Ich weiß, dass ich nichts weiß‹38, um uns des Gemeinten gewahr zu werden: Der Satz ›Ich weiß, dass ich nichts weiß.‹ ist logisch widersprüchlich. Wenn ich weiß, dass ich nichts weiß, dann weiß ich ja etwas, nämlich dass ich nichts weiß. Ich kann aber nicht zugleich etwas wissen und nichts wissen. Logische Widerspruchsfreiheit zielt also auf die innere logische Struktur von Aussagesätzen ab. Anders verhält es sich mit der logischen Verträglichkeit. Sie beschreibt eine logische Beziehung zwischen Aussagesätzen. Ein Aussagesatz A ist logisch verträglich mit einem Aussagesatz B genau dann, wenn A nicht logisch unverträglich mit B ist. A ist logisch unverträglich mit B genau dann, wenn es unmöglich ist, dass sowohl A als auch B wahr ist. Mit anderen Worten: genau dann, wenn die Wahrheit des einen Satzes die Falschheit des anderen garantiert. Der Satz ›Alle Vögel, die Raben sind, sind schwarz.‹ ist z. B. logisch unverträglich mit dem Satz ›Vogel Nr. 453 ist ein Rabe und nicht schwarz.‹. Anders gewendet: ›Alle Vögel, die Raben sind, sind schwarz.‹ impliziert logisch ›Es ist nicht der Fall, dass Vogel Nr. 453 ein Rabe ist, der nicht schwarz ist.‹. Kommen wir noch zur logischen Gültigkeit. Mit der logischen Gültigkeit wird auf sogenannte Argumente Bezug genommen. Ein Argument – d. h. eine Aufeinanderfolge von Aussagen, mit der der Anspruch einhergeht, dass eine dieser Aussagen (nämlich die Konklusion) in einer bestimmten Folgebeziehung zu den anderen Aussagen (nämlich den Prämissen) steht – ist logisch gültig genau dann, wenn die Konklusion K des betreffenden Arguments aus den Prämissen P1 … Pn des Arguments logisch folgt. Dies ist genau dann der Fall, wenn es logisch unmöglich ist, dass alle Prämissen wahr sind und gleichzeitig die Konklusion falsch ist. Verdeutlichen wir uns dies auch hier an einem Beispiel:
P1) Alle Kreter sind Lügner.
P2) Epimenides ist ein Kreter.
K: Epimenides ist ein Lügner.
Dieses Argument ist logisch gültig. Warum? Wenn es wahr ist, dass alle Kreter Lügner sind und wenn es wahr ist, dass Epimenides ein Kreter ist, dann ist es logisch unmöglich, dass er kein Lügner ist. Er muss ein Lügner sein. Das ergibt sich zwingend aus P1 und P2. Mit anderen Worten: Die Konklusion dieses Arguments folgt logisch aus seinen Prämissen, denn es ist unmöglich, dass P1 und P2 wahr sind und zugleich K falsch. Was also den Probierstein der logischen Perfektion betrifft, so gilt: Finden sich in einer Metaphysik logische Widersprüche, logische Unverträglichkeiten oder logisch ungültige Argumente, so ist die betreffende Metaphysik gescheitert oder jedenfalls verbesserungsbedürftig.
Der Probierstein der erkenntnislogischen Kohärenz endlich ist die wichtigste Rückversicherung gegen den intellektuellen Wahnsinn, von dem oben die Rede war. Dabei handelt es sich um den erkenntnislogischen Zusammenhang der Grundsätze. Jedes theoretische Gebäude, daher auch jede Metaphysik, beruht auf einer Reihe von Grundsätzen und diese Grundsätze müssen erkenntnislogisch zueinander in Beziehung stehen. Das heißt, es muss einen folgerichtigen epistemischen Weg geben, der es einem erlaubt, vom einen zum anderen Grundsatz überzugehen. Andernfalls müsste man sich den Vorwurf gefallen lassen, die Wahl der Grundsätze beruhe auf bloßer Willkür. Ein gutes Beispiel sind Gottfried Wilhelm Leibnizens Grundsätze über die Monaden, die uns noch begegnen werden, also diejenigen Entitäten im Universum, die ihm als letzte, in sich geschlossene, vollendete und nicht mehr auflösbare Einheiten gelten. Da gibt es einerseits den Grundsatz, dass keine wirkliche Monade mit irgend einer anderen in direkter Verbindung steht, weder kausal noch sonst wie. Andererseits gibt es aber den Grundsatz, dass alle wirklichen Monaden auf bestimmte Weise zusammenhängen. Doch wie kann das sein? Hätte es Leibniz dabei belassen, so wäre sein metaphysisches Gebäude erkenntnislogisch inkohärent, die Wahl seiner Grundsätze willkürlich. Es gäbe nämlich keinen Erkenntnisweg, der es einem erlauben würde, vom einen Grundsatz zum anderen überzugehen. Die fehlende Verbindung liegt nun im Fall von Leibniz in dem Grundsatz, dass die Monaden prästabiliert sind, d. h., dass sie bereits vor ihrem Entstehen aufeinander abgestimmt wurden. Dementsprechend gilt: Finden sich in einer Metaphysik inkohärente Grundsätze, so ist die betreffende Metaphysik gescheitert oder jedenfalls verbesserungsbedürftig.
Fassen wir unsere Überlegungen zusammen, sodass sich der Standpunkt, von dem oben die Rede war, noch einmal auskristallisiert: Metaphysik ist der Versuch, ein System allgemeiner Ideen zu entwerfen, auf dessen Grundlage jedes Element der erlebnisgegebenen Wirklichkeit interpretiert bzw. verstanden werden kann, und zwar so, dass alles, was darin vorkommt, den Charakter eines besonderen Falls in einem allgemeinen Schema hat. Im Erfolgsfall ist nicht nur eine Theorie der Bewusstseinsphänomene aufgestellt, sondern zugleich eine Theorie bewusstseinstranszendenter, mithin objektiver Realität. Das Bedingende nämlich, das die für sich genommen zusammenhangslosen Bewusstseinsphänomene in einen gesetzmäßigen Zusammenhang bringt, kann aus erkenntnislogischen Gründen nichts anderes sein als objektive Realität. Weil sich aber eine solche Theorie dem Probierstein der Erfahrung notwendig entzieht – die Realität, von der sie spricht, liegt ja selbst niemals im Bewusstsein, d. h. in der Erfahrung vor –, muss sie dem Probierstein der analytischen Anwendbarkeit, der logischen Perfektion und der erkenntnislogischen Kohärenz standhalten. Ist das der Fall, so ist sie als erklärende Theorie des Wirklichen legitimiert und zwar trotzdem oder gerade weil sie von Realitäten handelt, die die unmittelbare Erfahrung transzendieren. Und was insbesondere die Metaphysiken betrifft, von denen im Zusammenhang mit dem Fantastischen Rationalismus der Neuzeit die Rede sein wird, so muss man sie durchaus als theoretische Gebäude in diesem Sinne betrachten.39
1.4 Zur Ethik
Die Ethik ist sehr wahrscheinlich jene philosophische Disziplin, die uns auch aus dem Alltag bekannt ist. Man liest und hört immer wieder von ihr, etwa wenn von Medizinethik, vom Ethikrat, von Unternehmensethik oder vom gleichnamigen Schulfach die Rede ist oder einfach nur davon, dass dieses oder jenes ethisch verwerflich oder ethisch zu begrüßen sei. Tatsächlich dringt die Ethik weit in die Alltagswelt vor und zählt heute neben der Philosophie des Geistes zu den aktivsten Disziplinen der Philosophie. Ihr Gegenstand oder besser gesagt ihr Gegenstandsbereich ist die Moral. In der Ethik haben wir es mit der Moral zu tun. Doch was ist Moral? Moral ist ein auf einen bestimmten Personenkreis bezogenes System von Werten und Verhaltensnormen (man spricht deshalb auch von Moralsystemen), die von den betreffenden Personen als verbindlich angesehen werden, aufgrund derer sie zwischen gut und böse zu unterscheiden trachten und versuchen, moralisch richtig zu handeln. Auf diese Weise ist die Moral als praktisches Instrument der Lebensführung in unsere Alltagswelt eingebettet. Sie dient uns zur Regulierung des Handelns, und zwar im Hinblick auf die Befriedigung der Eigeninteressen des Einzelnen. Diese Regulierung wird notwendig, wenn Menschen in Gemeinschaften leben, denn in einer Gemeinschaft müssen die Befriedigung der Eigeninteressen und das Wohl aller in eine Balance gebracht werden, so ein ernsthaftes Interesse daran besteht, die betreffende Gemeinschaft aufrechtzuerhalten. In welcher Weise das geschehen soll, darin unterscheiden sich die verschiedenen Moralsysteme und diese Frage reicht bereits weit in die Ethik hinein. Der Zweck der Ethik liegt nun dementsprechend darin, moralische Systeme auf Funktion, Sinnhaftigkeit, Begründbarkeit, Wahrheit und Bedeutungsgehalt hin zu untersuchen. Eine wichtige Aufgabe, denn wir halten uns an (moralische) Konventionen gemeinhin nur solang, solang sie uns als wahr oder sinnvoll oder begründet oder bedeutsam erscheinen. Die Ethik ist also diejenige philosophische Disziplin, die moralische Phänomene, moralische Fragestellungen, moralische Anschauungen und moralische Einstellungen zum Gegenstand ihrer Untersuchungen macht. Doch nicht nur das: Sie ist darüber hinaus eine Disziplin, die entlang der Beschäftigung mit der Moral sogenannte Moraltheorien hervorbringt. Das sind ideale Systeme, vermittelst derer man versucht, die Fehler etablierter Moralsysteme zu beheben. Denn während es im moralischen Kontext hinreichend ist, dasjenige zu tun, was für moralisch richtig gehalten wird, geht es in der Ethik darum, herauszufinden, was moralisch richtig ist. Solche idealen Systeme sollen uns daher Prinzipien an die Hand geben, die es uns erlauben, in jedem Fall zwischen gut und böse zu unterscheiden und moralisch richtig zu handeln. Im Zusammenhang mit Baruch de Spinoza wird uns die Ethik allerdings in einem anderen Kleid begegnen, denn historisch gesehen hat sie sich weitestgehend mit der Frage nach den Voraussetzungen bzw. den Bedingungen eines guten, d. h. gelingenden Lebens beschäftigt und das ist in der Tat die zentrale Frage Spinozas, wie sich uns noch zeigen wird.
Somit haben wir unsere Vorbereitungsarbeiten abgeschlossen. Im nächsten Schritt suchen wir noch einen Drehpunkt, der das Zentrum unseres Nachdenkens über den Fantastischen Rationalismus zu bilden vermag, bevor mit Descartes, Spinoza, Leibniz und Kant das eigentliche Spektakel – eine Aufführung in vier Akten – beginnt.
1 Das sind nebenbei gesagt drei der vier Kerndisziplinen der Philosophie. Diejenige Disziplin, die in dieser Aufzählung fehlt, ist die Logik, die Lehre von den Gesetzmäßigkeiten des folgerichtigen Denkens. Für eine Einführung in die Philosophie vgl. Waß, Bernd; Palasser, Heinz: Grundlagen der Philosophie, Einführung in die Geschichte und die Kerndisziplinen, 2., überarbeitete Auflage, tredition, Ahrensburg, 2023.
2 Russell, Bertrand: Probleme der Philosophie, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1967, S. 9.
3 Ebenda.
4 Vgl. Aristoteles: Metaphysik, Rowohlt, Hamburg, 2005.
5 Schlick, Moritz: Allgemeine Erkenntnislehre, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1979, S. 17 f.
6 Nagel, Thomas: Was bedeutet das alles? Reclam, Stuttgart, 2008, S. 6.
7 a. a. O. S. 7.
8 Schopenhauer, Arthur: Die Welt als Wille und Vorstellung, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2015, S. 521.
9