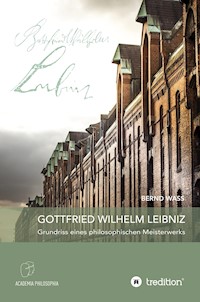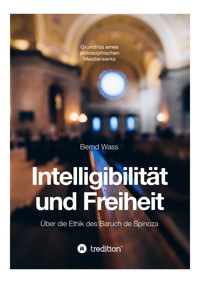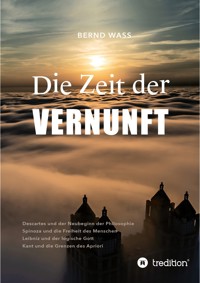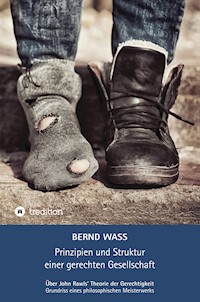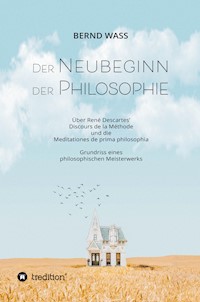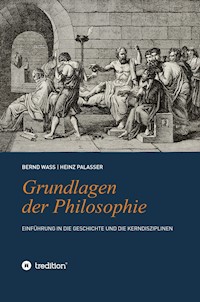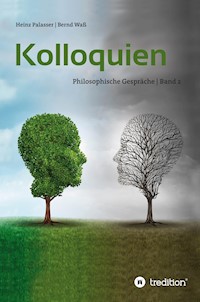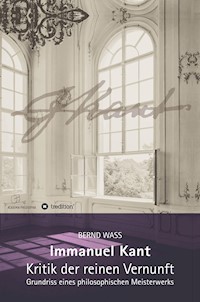
16,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Immanuel Kants Hauptwerk, die ›Kritik der reinen Vernunft‹, gehört nicht nur zu den großen Klassikern philosophischer Literatur, sondern ist ohne Zweifel auch eines der wirkmächtigsten in der Geschichte der Philosophie. Nichtsdestoweniger ist es schwer zugänglich und ohne fundierte philosophische Kenntnisse kaum zu verstehen. In dem hier vorliegenden Buch wurde daher der Versuch unternommen, die wesentlichen Stränge dieser so fundamentalen Weltdeutung, als einen Grundriss derselben, herauszuarbeiten und auf diese Weise in das intellektuelle Vermächtnis Kants einzuführen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 411
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Immanuel Kant Kritik der reinen Vernunft
– Grundriss eines philosophischen Meisterwerks –
Werkerschließung im Rahmen der Sommerakademie
der Academia Philosophia, Italien, Castelfranco di Sopra, 2018
© Academia Philosophia
Österreichische Privatakademie für Philosophie und philosophische Weltdeutung, 2018
Gründungsdirektoren: Mag.phil. Dr.phil. Bernd Waß, MSc; Mag. Dr. Heinz Palasser, MBA, MSc
www.academia-philosophia.com
Herausgeber: Academia Philosophia, Wien
Autor: Bernd Waß (www.berndwass.com)
Umschlaggestaltung, Illustration, Grafik: Mag. Petra Pfuner, Werbeagentur Vitamin©
Cover-Bild: Pexels, Creative Commons Zero (CC0) Lizenz
Verlag: Tredition GmbH, Hamburg
978-3-7469-5212-3 (Paperback)
978-3-7469-5213-0 (Hardcover)
978-3-7469-5214-7 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
DER AUTOR
Bernd Waß studierte am Institut für Philosophie der Kultur- und Gesellschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Salzburg Analytische Philosophie. Zum Doktor der Philosophie promovierte er bei Prof. Dr. Reinhard Kleinknecht, Prof. Dr. Otto Neumaier und Prof. Dr. Volker Gadenne mit einer Arbeit zur Philosophie des Geistes. Er ist Philosoph und Privatgelehrter, ordentliches Mitglied der Österreichischen Gesellschaft für Philosophie und Gründungsdirektor der Academia Philosophia. Seine Arbeits- und Forschungsschwerpunkte finden sich in der Metaphysik, insbesondere der Philosophie des Geistes, und der Erkenntnistheorie.
„Die Philosophie hat alles, um im besten Fall nichts mit ihr zu tun zu haben:
Sie ist theoretisch, nicht praktisch; sie ist lebensfern, nicht lebensnah und die Beschäftigung mit ihr ist überaus schwierig. Mit der Leichtigkeit des Seins hat sie nichts zu tun. Um es im Stil des französischen Philosophen und Seismografen des Verfalls, Emil M. Cioran, zu sagen: Das Pendel des Lebens schlägt nur in zwei Richtungen aus, in die der heilsamen Illusion oder der unerträglichen Wahrheit. Letztere ist ihr Geschäft. Welt und Mensch am Seziertisch des Denkens. Unter dem Philosophenhammer bleibt nichts heil. Vielleicht aber ist sie gerade deshalb so anziehend, so schillernd, so faszinierend, so tief; lässt sie einen nicht mehr los.“
(Bernd Wass)
Danksagung
Dem Mitbegründer und Gründungsdirektor der Academia Philosophia, meinem langjährigen Freund und intellektuellen Lehrer, Herrn Mag. Dr. Heinz Palasser, MBA, MSc, ohne dessen großer Beharrlichkeit im Aufbau der Akademie und nahezu unerschöpflicher Bereitschaft zum philosophischen Streit, die hier vorliegende Abhandlung niemals entstanden wäre.
Den Freundinnen und Freunden der Academia Philosophia, insbesondere den Sommerakademikerinnen und Sommerakademikern, ohne deren Liebe zur Philosophie, zum Müßiggang und zum Lebensgenuss es sehr wahrscheinlich keine Veranlassung gegeben hätte, eine solche Arbeit auf sich zu nehmen.
Den Freundinnen und Freunden der Academia Philosophia, insbesondere den Sommerakademikerinnen und Sommerakademikern, ohne deren Liebe zur Philosophie, zum Müßiggang und zum Lebensgenuss es sehr wahrscheinlich keine Veranlassung gegeben hätte, eine solche Arbeit auf sich zu nehmen.
Den Freundinnen und Freunden der Academia Philosophia, insbesondere den Sommerakademikerinnen und Sommerakademikern, ohne deren Liebe zur Philosophie, zum Müßiggang und zum Lebensgenuss es sehr wahrscheinlich keine Veranlassung gegeben hätte, eine solche Arbeit auf sich zu nehmen.
Zum Gebrauch der vorliegenden Abhandlung
Um den Gebrauch der vorliegenden Abhandlung zu erleichtern, sei auf einige Besonderheiten hingewiesen:
Besondere Aufmerksamkeit
Ausdrücke die vom Leser besondere Aufmerksamkeit erfordern oder die sich aus Gründen der besseren Lesbarkeit vom Fließtext abheben sollten, werden durch schräg gestellte Schriftzeichen kennzeichnet. Zum Beispiel: Die Unterscheidung von analytischen und synthetischen Urteilen, ist in der Philosophie von besonderer Bedeutung.
Anführungsnamen
Um Ausdrücke, die erwähnt werden, von Ausdrücken zu unterscheiden die verwendet werden, werden Anführungsnamen gebildet. Ein Anführungsname wird gebildet, indem der betreffende Ausdruck in einfache Klammern gesetzt wird. Zum Beispiel: ›Immanuel Kant‹ ist der Name eines deutschen Philosophen. Anführungsnamen wurden, dem besseren Verständnis wegen, dort, wo entsprechende Kennzeichnungen fehlten, auch in Zitaten eingefügt.
Metaphorische Ausdrücke
Metaphorisch gebrauchte Ausdrücke werden in doppelte Klammern gesetzt. Zum Beispiel: Es ist fraglich, ob es noch »wahre« Freunde gibt.
Kurze wörtliche Zitate
Kurze wörtliche Zitate werden im Fließtext durch Anführungszeichen und Fußnote gekennzeichnet. Zum Beispiel: „Die menschliche Vernunft hat das besondere Schicksal in einer Gattung ihrer Erkenntnisse: daß sie durch Fragen belästigt wird, die sie nicht abweisen kann; denn sie sind ihr durch die Natur der Vernunft selbst aufgegeben, die sie aber auch nicht beantworten kann, denn sie übersteigen alles Vermögen der menschlichen Vernunft.“1
Aufgrund der zum Teil äußerst langen Sätze Kants, habe ich mich, entgegen gängiger Praxis, dazu entschieden, Sätze mit einer Länge von bis zu sieben Zeilen als kurze wörtliche Zitate im Fließtext zu belassen, um das Lesen nicht durch übermäßiges fragmentieren des Textes zu erschweren.
Lange wörtliche Zitate
Wörtliche Zitate, mit einer Länge von mehr als sieben Zeilen (ausgenommen Zitate in Fußnoten), werden durch Einrückung, kleinere Schriftgröße und Fußnote gekennzeichnet. Zum Beispiel:
In diese Verlegenheit gerät sie ohne Schuld. Sie fängt von Grundsätzen an, deren Gebrauch im Laufe der Erfahrung unvermeidlich und zugleich durch diese hinreichend bewährt ist. Mit diesen steigt sie [...] immer höher, zu entferneteren Bedingungen. Da sie aber gewahr wird, daß auf diese Art ihr Geschäfte jederzeit unvollendet bleiben müsse, weil die Fragen niemals aufhören, so sieht sie sich genötigt, zu Grundsätzen ihre Zuflucht zu nehmen, die allen möglichen Erfahrungsgebrauch überschreiten und gleichwohl so unverdächtig scheinen, daß auch die gemeine Menschenvernunft damit im Einverständnisse stehet. Dadurch aber stürzt sie sich in Dunkelheit und Widersprüche, aus welchen sie zwar abnehmen kann, daß irgendwo verborgene Irrtümer zum Grunde liegen müssen, die sie aber nicht entdecken kann, weil die Grundsätze deren sie sich bedient, da sie über die Grenze aller Erfahrung hinausgehen, keinen Probierstein der Erfahrung mehr anerkennen. Der Kampfplatz dieser endlosen Streitigkeiten heißt nun Metaphysik.2
Fußnoten
Manche Leute mögen keine Fußnoten. Ich hingegen liebe sie. Nur mit einer Fußnote ist eine Seite gut gekleidet, wie mir deucht. Fußnoten stellen aber vor allem einen Mikrokosmos zusätzlicher, wenngleich nicht vordergründiger, Gedanken dar: In den Fußnoten finden sich dementsprechend erstens sämtliche Quellenangaben zu wörtlichen und sinngemäßen Zitaten; zweitens Anmerkungen, um bestimmte Begriffe oder Zusammenhänge in Zitaten zu erläutern; drittens Ausschnitte aus dem Originaltext, auf die nicht verzichtet werden wollte, obschon man sie hätte vernachlässigen können; viertens Erläuterungen und Hinweise zum besseren Verständnis des Textes (sowohl des Originaltextes als auch des hier vorliegenden Textes) insgesamt; fünftens Seitenverweise zum jeweiligen Abschnitt des Originaltexts, um die Orientierung zu behalten und es der Leserin/dem Leser während des Studiums jederzeit zu erlauben, zwischen dem Originaltext und der hier vorliegenden Abhandlung zu vergleichen.
1 Kant, Immanuel: Kritik der reinen Vernunft, Meiner, Hamburg, 1998, S. 5.
2 Kant, Immanuel: Kritik der reinen Vernunft, Meiner, Hamburg, 1998, S. 5.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1 Hintergrundüberlegungen
2 Die Vorrede
❅ Befund über den Zustand der Metaphysik ❅ Zweck der Kritik der reinen Vernunft ❅ Kopernikanische Wende der Denkungsart ❅ Konsequenzen und Nutzen des Vorhabens ❅
3 Die Einleitung
❅ Synthetische Urteile a priori als Endabsicht der Metaphysik ❅ Idee einer Transzendental-Philosophie und die Kritik der reinen Vernunft als deren architektonischer Plan ❅
4 Die Transzendentale Elementarlehre
❅ Vermessung der menschlichen Erkenntnisvermögen, mithin Vermessung von Anschauungs-, Verstandes- und Vernunftvermögen ❅
4.1 Die Transzendentale Ästhetik
❅ Begriffsbestimmung u. Vorhaben ❅ Erörterung Raum u. Zeit ❅ Allgemeine Anmerkungen ❅
§ 1 Vom Raum
§ 2 Von der Zeit
§ 3 Allgemeine Anmerkungen
4.2 Die Transzendentale Logik
❅ Einleitung zur Transzendentalen Logik: Hintergrundvoraussetzungen ❅ Logik an sich ❅ Logik im transzendentalen Sinn ❅ Einteilung in Analytik und Dialektik ❅
4.2.1 Die Transzendentale Analytik
❅ Verstand als Inbegriff aller formalen Gesetze bzw. Regeln des Denkens ❅ Entdeckung der Verstandesbegriffe und der Grundsätze des Verstandes als Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung ❅ Unterscheidung von Phänomenwelt und Verstandeswelt ❅
4.2.1.1 Erstes Buch: Die Analytik der Begriffe
❅ Funktionen des Verstandes ❅ Grundlegung der Verstandesbegriffe ❅ Objektive Gültigkeit der Kategorien als Bedingungen a priori der Möglichkeit von Erfahrung ❅
§ 1 Erstes Hauptstück: Von der Entdeckung aller reinen Verstandesbegriffe
§ 2 Zweites Hauptstück: Von der Deduktion der reinen Verstandesbegriffe .
4.2.1.2 Zweites Buch: Die Analytik der Grundsätze
❅ Transzendentale Urteilskraft ❅ Schematismus der reinen Verstandesbegriffe ❅ System aller Grundsätze des reinen Verstandes ❅ Die Zweiteilung der Welt in Sinnes- u. Verstandeswelt ❅
§ 1 Erstes Hauptstück: Vom Schematismus der reinen Verstandesbegriffe
§ 2 Zweites Hauptstück: System aller Grundsätze des reinen Verstandes .
§ 2.1 Axiomen der Anschauung
§ 2.2 Antizipation der Wahrnehmung
§ 2.3 Analogien der Erfahrung
§ 2.4 Postulate des empirischen Denkens überhaupt
§ 3 Drittes Hauptstück: Vom Grunde der Unterscheidung aller Gegenstände überhaupt in Phaenomena und Noumena
4.2.2 Die Transzendentale Dialektik
❅ Einleitung zur Transzendentalen Dialektik: Vernunft als Vermögen der Prinzipien und des Schließens ❅ reine Vernunft als Sitz des transzendentalen Scheins ❅
4.2.2.1 Erstes Buch: Von den Begriffen der reinen Vernunft
❅ Ideen als solche ❅ transzendentale Ideen ❅ System der transzendentalen Ideen ❅
§ 1 Von den Ideen überhaupt
§ 2 Von den transzendentalen Ideen
§ 3 System der transzendentalen Ideen .
4.2.2.2 Zweites Buch: Von den dialektischen Schlüssen der reinen Vernunft
❅ Aufdeckung des dialektischen Scheins der Paralogismen der reinen Vernunft (mithin der dialektischen Schlüsse der rationalen Psychologie), der Antinomie der reinen Vernunft (mithin der dialektischen Schlüsse der rationalen Kosmologie) und dem Ideal der reinen Vernunft (mithin den dialektischen Schlüssen der rationalen Theologie) ❅
§ 1 Erstes Hauptstück: Von den Paralogismen der reinen Vernunft
§ 1.1 Paralogismus der Substanzialität (1)
§ 1.2 Paralogismus der Simplizität (2)
§ 1.3 Paralogismus der Personalität (3)
§ 1.4 Paralogismus der Idealität (des äußeren Verhältnisses) (4)
§ 1.5 Betrachtung über die Summe der reinen Seelenlehre, zu Folge diesen Paralogismen
§ 2 Zweites Hauptstück: Die Antinomie der reinen Vernunft .
§ 2.1 System der kosmologischen Ideen
§ 2.2 Antithetik der reinen Vernunft
§ 2.3 Von dem Interesse der Vernunft bei diesem ihrem Widerstreit
§ 2.4 Transzendentale Aufgaben der reinen Vernunft (Abschnitt 4); skeptische Vorstellung der kosmologischen Fragen (Abschnitt 5); transzendentaler Idealismus als Schlüssel zur kritischen Entscheidung der kosmologischen Dialektik (Abschnitt 6)
§ 2.5 Kritische Entscheidung des kosmologischen Streits der Vernunft mit sich selbst
§ 3 Drittes Hauptstück: Das Ideal der reinen Vernunft
§ 3.1 Von den Beweisgründen der spekulativen Vernunft
§ 3.2 Von der Unmöglichkeit eines ontologischen Beweises vom Dasein Gottes
§ 3.3 Von der Unmöglichkeit eines kosmologischen Beweises vom Dasein Gottes
§ 3.4 Von der Unmöglichkeit des physikotheologischen Beweises
§ 3.5 Kritik aller Theologie aus spekulativen Prinzipien der Vernunft .
4.2.2.3 Anhang zur Transzendentalen Dialektik
5 Die Transzendentale Methodenlehre
❅ Bestimmung der formalen Bedingungen eines vollständigen Systems der reinen Vernunft in vier Abschnitten: Die Disziplin der reinen Vernunft ❅ Der Kanon der reinen Vernunft ❅ Die Architektonik der reinen Vernunft ❅ Die Geschichte der reinen Vernunft ❅
§ 1 Erstes Hauptstück: Die Disziplin der reinen Vernunft
§ 1.1 Die Disziplin der reinen Vernunft im dogmatischen Gebrauch
§ 1.2 Die Disziplin der reinen Vernunft in Ansehung ihres polemischen Gebrauchs
§ 1.3 Die Disziplin der reinen Vernunft in Ansehung der Hypothesen
§ 1.4 Die Disziplin der reinen Vernunft in Ansehung ihrer Beweise
§ 2 Zweites Hauptstück: Der Kanon der reinen Vernunft
§ 2.1 Vom letzten Zweck des reinen Gebrauchs unserer Vernunft
§ 2.2 Vom Bestimmungsgrund des letzten Zwecks der reinen Vernunft
§ 2.3 Vom Meinen, Wissen und Glauben
§ 3 Drittes Hauptstück: Die Architektonik der reinen Vernunft
§ 4 Viertes Hauptstück: Die Geschichte der reinen Vernunft .
6 Schlussbetrachtung
Anhang: Das verhängnisvolle Ding an sich
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Vorwort
Es ist viel leichter in dem Werke eines großen Geistes die Fehler und Irrthümer nachzuweisen, als von dem Werthe desselben eine deutliche und vollständige Entwicklung zu geben. Denn die Fehler sind ein Einzelnes und Endliches, das sich daher vollkommen überblicken läßt. Hingegen ist eben das der Stämpel, welchen der Genius seinen Werken aufdrückt, daß dieser ihre Trefflichkeit unergründlich und unerschöpflich ist: daher sie auch die nicht alternden Lehrmeister vieler Jahrhunderte nacheinander werden. Das vollendete Meisterstück eines wahrhaft großen Geistes wird allemal von tiefer und durchgreifender Wirkung auf das gesamte Menschengeschlecht seyn, so sehr, daß nicht zu berechnen ist, zu wie fernen Jahrhunderten und Ländern sein erhellender Einfluß reichen kann. Es wird dieses allemal: weil, so gebildet und reich auch immer die Zeit wäre, in welcher es selbst entstanden, doch immer der Genius, gleich einem Palmbaum, sich über den Boden erhebt, auf welchem er wurzelt.
Aber eine tiefeingreifende und weitverbreitete Wirkung dieser Art kann nicht plötzlich eintreten, wegen des weiten Abstandes zwischen dem Genius und der gewöhnlichen Menschheit. Die Erkenntniß, welcher jener Eine in EINEM Menschenalter unmittelbar aus dem Leben und der Welt schöpfte, gewann und Andern gewonnen und bereitet darlegte, kann dennoch nicht sofort das Eigenthum der Menschheit werden; weil diese nicht einmal so viel Kraft zum Empfangen hat, wie jener zum Geben. Sondern, selbst nach überstandenem Kampf mit unwürdigen Gegnern, die dem Unsterblichen schon bei der Geburt das Leben streitig machen und das Heil der Menschheit im Keime ersticken möchten (der Schlange an der Wiege des Herkules zu vergleichen), muß jene Erkenntniß sodann erst die Umwege unzähliger falscher Auslegungen und schiefer Anwendungen durchwandern, muß die Versuche die Vereinigung mit alten Irrthümern überstehen und so im Kampfe leben, bis ein neues, unbefangenes Geschlecht ihr entgegenwächst, welches allmälig, aus tausend abgeleiteten Kanälen, den Inhalt jener Quelle, schon in der Jugend, theilweise empfängt, nach und nach assimiliert und so der Wohlthat teilhaft wird, welche, von jenem großen Geiste aus, der Menschheit zufließen sollte. So langsam geht die Erziehung des Menschengeschlechts, des schwachen und zugleich widerspänstigen Zöglings des Genius. – So wird auch von Kants Lehre allererst durch die Zeit die ganze Kraft und Wichtigkeit offenbar werden, wann einst der Zeitgeist selbst, durch den Einfluß jener Lehre nach und nach umgestaltet, im Wichtigsten und Innersten verändert, von der Gewalt jenes Riesengeistes lebendiges Zeugniß ablegen wird. Ich hier will aber keineswegs, ihm vermessen vorgreifend, die undankbare Rolle des Kalchas und der Kassandra übernehmen. Nur sei es mir, in Folge des Gesagten, vergönnt, Kants Werke als noch sehr neu zu betrachten, während heut zu Tage Viele sie als schon veraltet ansehen, ja, als abgethan bei Seite gelegt, oder, wie sie sich ausdrücken, hinter sich haben, und Andere, dadurch dreist gemacht, sie gar ignorieren und, mit eiserner Stirn, unter den Voraussetzungen des alten Dogmatismus und seiner Scholastik, von Gott und der Seele weiterphilosophieren; – welches ist, wie wenn man in der neuen Chemie die Lehren der Alchemisten geltend machen wollte. – Uebrigens bedürfen Kants Werke nicht meiner schwachen Lobrede, sondern werden selbst ewig ihren Meister loben und, wenn vielleicht auch nicht in seinem Buchstaben, doch in seinem Geiste, stets auf Erden leben.1
1 Schopenhauer, Arthur: Die Welt als Wille und Vorstellung, dtv, München, 2002, S. 531 f.
1 Hintergrundüberlegungen
Seit der Gründung der Academia Philosophia verstehen wir uns als Bindeglied zwischen der akademisch-universitären Philosophie einerseits und einer breiteren Hörerschaft andererseits. Es wäre schade, so dachten wir uns, wenn die Faszination philosophischer Weltdeutung nur jenem kleinen Kreis von Menschen vorbehalten bliebe, der sich von Berufswegen mit der Philosophie beschäftigt. Auch wenn die Hochzeit der Philosophie – so es sie denn jemals gegeben hat – in einer ökonomisierten und am Maßstab des Praktischen orientierten Gesellschaft allem Anschein nach vorüber ist, glauben wir nichtsdestoweniger, dass die Beschäftigung mit philosophischer Weltdeutung für unser geistiges Leben unverzichtbar ist. Der Entwurf einer feingliedrigen, vernünftigen und logisch zureichenden Weltanschauung, die Disziplinierung des Denkens und die Verbesserung der Urteilskraft können nirgendwo vorzüglicher gelingen als in der Philosophie. Nicht zuletzt deshalb bemühen wir uns um die Vermittlung wissenschaftlicher Philosophie und die Pflege eines breit angelegten philosophischen Diskurses; außerhalb der Mauern der Universitäten, eine fachfremde Hörerschaft im Blick, aber dennoch auf akademischem Niveau. Ein Programm, das uns immer wieder vor intellektuelle Herausforderungen stellt. Im Versuch eine solche Herausforderung zu bewältigen, nämlich eine Textgrundlage für den philosophischen Diskurs im Rahmen unserer alljährlichen Sommerakademie zu erarbeiten, ist das vorliegende Buch entstanden: ›Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft – Grundriss eines philosophischen Meisterwerks‹. Es versteht sich daher als Einführung in Immanuel Kants erkenntnistheoretisches Hauptwerk ›Kritik der reinen Vernunft‹. Man kann es im Sinne einer Propädeutik lesen – als Vorbereitung zum Studium des Originaltextes –, als Verbindungsglied zu umfangreicheren Abhandlungen über Kant, aber auch als eine in sich geschlossene Arbeit, deren Anspruch es ist, Kants Denken systematisch nachzuzeichnen und seinen Versuch, die Metaphysik mit einem tragfähigen Fundament auszustatten und sie so auf wissenschaftliche Beine zu stellen, im Prinzip verständlich zu machen. Dementsprechend geht es hier nicht darum, dieses überaus komplexe Denkgebäude Satz für Satz, bis in den letzten Winkel zu durchdringen, als vielmehr darum, es im Sinne einer gewissen Vertrautheit ein erstes Mal zu begehen. Grundlage dieser Begehung ist die ›Kritik der reinen Vernunft‹ in der Edition Jens Timmermanns, erschienen bei Felix Meiner, Hamburg, 1998, Band 505 der Philosophischen Bibliothek.1 Die Besprechung von Vorrede und Einleitung berücksichtigt sowohl die erste Auflage [A] als auch die zweite Auflage [B]. Die Besprechung des Haupttextes berücksichtigt lediglich die zweite Auflage [B], was daran liegt, dass es sich hierbei um die hin und wieder verbesserte Auflage handelt, wie Kant selbst zu sagen pflegte.
Immanuel Kant, am 22. April 1724 in Königsberg geboren und am 12. Februar 1804, etwas mehr als zwei Monate vor seinem 80. Geburtstag, ebenda gestorben, ist ohne Zweifel einer der bedeutendsten Philosophen der Geschichte. Berühmt gemacht haben den Professor für Logik und Metaphysik der Universität Königsberg, Mitglied der Königlichen Akademie der Wissenshaften in Berlin, der als Kind auf den Namen ›Emanuel‹2 hörte, die drei großen philosophischen Kritiken, deren Ergebnisse er innerhalb von nur neun Jahren, in drei aufeinanderfolgenden Büchern, veröffentlichte: Die ›Kritik der reinen Vernunft‹3, d. i. Kants Erkenntnistheorie, in der ersten Auflage von 1781 und der zweiten Auflage von 1787, die ›Kritik der praktischen Vernunft‹4, d. i. Kants Ethik, von 1787 (Druckjahr 1788) und endlich die ›Kritik der Urteilskraft‹5, d. i. Kants Ästhetik und Teleologie6, von 1790. Ein monumentales, architektonisch ausgefeiltes, mithin bis ins letzte Detail der Kunst der Systeme genügendes, philosophisches Denkgebäude von gewaltigem Umfang.7 Ich denke, man übertreibt nicht, wenn man sagt, dass es sehr wahrscheinlich kein zweites philosophisches Bauwerk gibt, das auch nur annähernd dieselbe systematische Geschlossenheit aufweist. Und doch müsste man, um dem philosophischen Leben Kants einigermaßen gerecht zu werden, eine ganze Reihe weiterer Schriften ins Feld führen, deren Wirkmächtigkeit kaum geringer ausfällt: Etwa die ›Träume eines Geistersehers‹8 von 1766, die Schrift ›Zum ewigen Frieden‹9 von 1781 – von der beispielsweise Friedrich Schlegel10, ein Zeitgenosse Kants, sagt, dass der Geist, den diese Schrift atmet, jedem Freund der Gerechtigkeit wohltun muss und noch die späteste Nachwelt in diesem Denkmal die erhabene Gesinnung des ehrwürdigen Weisen bewundern wird –, die ›Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik‹11 von 1783 aber auch die ›Grundlegung zur Metaphysik der Sitten‹12 von 1785 und 1786.
Trivialerweise ließe sich aber auch Biografisches anführen.13 Obschon Kant, wie der letzte Dichter der Romantik, Heinrich Heine, ein wenig spöttisch zu sagen pflegte, „weder Leben noch Geschichte“14 hatte, weil er von außen her betrachtet, ein mechanisch geordnetes, fast abstraktes Dasein zu führen pflegte, das seinen Zeitgenossen zur Auffassung Anlass gab, die Uhr der Königsberger Kathedrale würde ihr Tagwerk nicht leidenschaftsloser und regelmäßiger verrichten als ihr Landsmann Immanuel Kant das seine, ist es doch mit derselben lautlosen Dramatik beschlagen, die jedem Aufleuchten unserer von Rätseln umstellten Existenz innewohnt. Die große Hannah Arendt wird 1957 in einem Brief an Karl Jaspers schreiben: „Bei Kant, scheint mir, hält sich eine ungeheure Welterfahrung mit einer ganz verkümmerten Lebenserfahrung die Waage. Dies liegt nicht an seinem persönlichen Schicksal, denn er hat, ohne sich je aus Königsberg zu rühren, die Welt gekannt. Aber diese Vorstellungs- und Einbildungskraft, die bei Kant so groß ist wie sonst nur noch bei Dichtern, hat ihn, was das Leben anlangt, im Stich gelassen.“15
Doch so reizvoll es auch sein mag, wir können weder auf die Biografie Kants noch auf seine Schriften jenseits der Kritiken eingehen. Ja, selbst die Behandlung der ›Kritik der praktischen Vernunft‹ und der ›Kritik der Urteilskraft‹ müssen wir aussparen. Viel zu umfangreich ist allein sein Hauptwerk und dieses Hauptwerk besteht unumstritten in der epochalen ›Kritik der reinen Vernunft‹. Ihm wollen wir unsere ganze Aufmerksamkeit widmen, denn wer die Philosophie Kants zu verstehen sucht, der muss allererst die ›Kritik der reinen Vernunft‹ zu verstehen suchen. Mit ihr steht und fällt nämlich das Verständnis eines philosophischen Programms, das wir heute, nicht ganz im Sinne Kants, wie wir noch sehen werden, als Transzendentalphilosophie diskutieren.
Was den Gang unserer Arbeit betrifft, so wird er ohne große Umwege entlang des Originals führen. Wir werden Kapitel für Kapitel abschreitend immer tiefer in die ›Kritik der reinen Vernunft‹ vordringen und – die wichtigsten Gedanken Kants herausschälend – ein Exzerpt derselben herstellen. Das Ziel dabei ist philosophische Kenntnis. Am Ende des Tages wollen wir ein konzentriertes aber nichtsdestoweniger tiefenscharfes Gesamtbild dessen erhalten, was Kant, vermöge der Kritik der reinen Vernunft, auf den Tisch legt. Um die Orientierung nicht zu verlieren, werden wir uns zu Beginn fast aller Kapitel, und zwar anhand der unten erstmals abgebildeten Karte, der genauen Position kundig machen, an der wir uns jeweils befinden. Das erleichtert die Aufgabe, das System im Blick zu behalten, während wir uns mit den Details zu beschäftigen haben. Des Weiteren müssen wir vorab einige Begriffe klären, die wir zum Einstieg benötigen, nämlich ›Kritik‹, ›rein‹, und ›Vernunft‹. Zwar können wir uns Kants Begriffsapparat, den er zum Zweck der Kritik der reinen Vernunft ausbildet und der derart umfangreich ist, dass er von Heinrich Ratke sogar lexikalisch systematisiert wurde, letztlich nur im Fortgang der Arbeit und Stück für Stück erschließen, doch ohne die genannten Begriffe bleibt schon die Hauptüberschrift des zu untersuchenden Gegenstandes unzugänglich. Denn was genau ist gemeint, wenn von einer Kritik der reinen Vernunft die Rede ist? Nun, in einer ersten Annäherung lässt sich sagen: Der Begriff ›Kritik‹ meint Prüfung; der Begriff ›Vernunft‹ meint das ganze obere Erkenntnisvermögen, das zwei besondere Methoden des Denkens unter sich befasst: nämlich Verstand und Vernunft; und endlich meint der Begriff ›rein‹, relativ auf Vernunft, dass jener Gesichtspunkt der Vernunft zur Debatte steht, wodurch alle Erkenntnis unter Ausschluss von Erfahrung – oder wie man heute sagen würde, unter Ausschluss des Empirischen – zustande kommt. Die Kritik der reinen Vernunft ist also die Prüfung des ganzen obersten Erkenntnisvermögens, insofern es mit Erkenntnissen befasst ist, die nicht den geringsten Anteil von Erfahrung einschließen; Erkenntnisse also, deren Objekte, so Kant, man gänzlich a priori zu bestimmen sucht.16 Eine philosophische Darbietung, deren unmittelbare Aufgabe in der Beantwortung zweier Fragen, einer Haupt- und einer Nebenfrage, liegt, die eng miteinander verwoben sind. Die Hauptfrage lautet: „Was und wie viel kann Verstand und Vernunft, frei von aller Erfahrung erkennen [...]?“17 Hier geht es darum, den Umfang und die Grenzen des auf reinem Denken aufruhenden Erkennens auszuloten. Die Nebenfrage wiederum lautet: „Wie ist das Vermögen zu Denken selbst möglich?“18 Hier geht es um die Hintergrundvoraussetzungen des Denkens, um seine allgemeinen Grundlagen. In beiden Fällen haben wir es mit Bedingungen der Möglichkeit zu tun: Im ersten Fall sind es die Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis a priori, die zur Debatte stehen, im zweiten Fall, die Bedingungen der Möglichkeit des Denkens überhaupt. Die Bedingungen der Möglichkeit sind Dreh- und Angelpunkt der Kritik Kants, und weil er hierfür den Begriff des Transzendentalen prägte – „ich nenne alle Erkenntnis transzendental, die sich nicht mit [...] Gegenständen, sondern mit unserer Erkenntnisart von Gegenständen [...] beschäftigt“19 –, haben wir es in der ganzen Folge mit transzendentaler Erkenntnistheorie zu tun. Doch wie schon bei Leibniz, so führen auch bei Kant, wenngleich von anderer Absicht getragen, die erkenntnistheoretischen Fragen zur Metaphysik.20 Die Kritik der reinen Vernunft ist nämlich „die notwendige vorläufige Veranstaltung zur Beförderung einer gründlichen Metaphysik als Wissenschaft [...]“21. Das müssen wir im Auge behalten. Denn in der Tat: Die Beförderung der Metaphysik zur Wissenschaft und eine in der Folge darauf aufruhende Metaphysik der Natur22, ebenso wie eine Metaphysik der Sitten, sind Kants größte Ziele.23 Ein Umstand, der schlechthin den Grund gibt, warum er, ganz im Stil der Rationalisten, ausschließlich an Erkenntnis a priori, an reiner Vernunfterkenntnis interessiert ist. Wenn nämlich Metaphysik – als Wissenschaft von den transzendenten, außerhalb der Erfahrung liegenden Gegenstände – überhaupt möglich ist, dann ist sie es trivialerweise nur im Rahmen von Erkenntnis a priori. Gewiss: Nicht alle Erkenntnis a priori ist metaphysische Erkenntnis, doch alle metaphysische Erkenntnis ist Erkenntnis a priori. Das wird uns der Fortgang der Arbeit bald vor Augen führen. Doch werfen wir zunächst einen Blick auf unsere Karte, um die Architektur der Kritik der reinen Vernunft einzusehen und ein erstes Gefühl zu bekommen, wohin unsere philosophische Reise gehen wird:
Abbildung 1: Karte der Kritik der reinen Vernunft, Gesamtdarstellung
Die Kritik der reinen Vernunft ruht insgesamt auf der Transzendentalen Elementarlehre und der Transzendentalen Methodenlehre auf. Gehen wir sie der Reihe nach durch:
Die Transzendentale Elementarlehre, der deutlich schwergewichtigere Teil der Kritik, besteht aus Transzendentaler Ästhetik und Transzendentaler Logik:
Die Transzendentale Ästhetik ist die Wissenschaft von allen Prinzipien der Sinnlichkeit a priori, oder wie Kant an manchen Stellen auch sagt, des Anschauungsvermögens a priori. Ihre Aufgabe besteht erstens darin, die sinnlich gegebene Welt, die Welt der Wahrnehmungsgegenstände, von allem zu befreien, was der Verstand durch seine Begriffe hin sie hineindenkt, sodass nichts als empirische Anschauung übrig bleibt. Zweitens muss darüber hinaus auch alles, was zur Empfindung gehört abgetrennt werden, sodass in letzter Konsequenz „nichts als reine Anschauung und die bloße Form der Erscheinung“24 vorliegt. „Bei dieser Untersuchung wird sich finden, daß es zwei reine Formen sinnlicher Anschauung als Prinzipien der Erkenntnis a priori gebe, nämlich Raum und Zeit [...].“25
Die Transzendentale Logik wiederum ist jene Wissenschaft, „welche den Ursprung, den Umfang und die objektive Gültigkeit“26 der reinen Verstandes- und Vernunfterkenntnis zum Gegenstand hat. Sie beschäftigt sich mit den Gesetzen des Verstandes und der Vernunft im engeren Sinn. Doch anders als die allgemeine, mithin klassische Logik abstrahiert die Transzendentale Logik nicht von allem Inhalt der Erkenntnis, denn es geht nicht darum, allein die logischeForm des Denkens aufzudecken, sondern darum, die allgemeinen Regeln zu finden, worauf alle Erkenntnis überhaupt, und somit auch alle Erkenntnis a priori, aufruht. Die Transzendentale Logik teilt sich zu diesem Zweck in Transzendentale Analytik und Transzendentale Dialektik:
Die Transzendentale Analytik ist der Kern der Transzendentalen Logik, denn hier werden sämtliche Elemente der reinen Verstandeserkenntnis aufgewiesen: die logischen Funktionen des Verstandes, samt den ihnen zugrunde liegenden reinen Verstandesbegriffen, ebenso wie die apriorischen Grundsätze desselben. Im ersten Buch der Analytik – der Analytik der Begriffe – finden sich daher auch die beiden berühmten sogenannten Tafeln: Die Tafel der logischen Funktionen des Verstandes in Urteilen und die darauf aufruhende Tafel der reinen Verstandesbegriffe oder Kategorien. Im zweiten Buch der Analytik wiederum – der Analytik der Grundsätze – werden die, auf den Kategorien aufruhenden, apriorischen Grundsätze des Verstandes offengelegt, die gleichsam ein Regelwerk darstellen, das die Urteilskraft lehrt „die Verstandesbegriffe [...] auf Erscheinungen anzuwenden“27. Insgesamt gesehen ein Gebilde von fundamentaler erkenntnislogischer Bedeutung, denn ohne Kategorien und Grundsätze gibt es keine Erkenntnis. Darüber hinaus ist die Transzendentale Analytik zugleich eine Logik der Wahrheit. Jede Erkenntnis nämlich, die ihr widerspricht, d. h. die nicht in das vorgelegte Schema passt, verliert auf der Stelle allen Inhalt, d. h. alle Beziehung auf irgendein Objekt, und damit alle Wahrheit.
Die Transzendentale Dialektik wiederum dient, und zwar über die weiteste Strecke, der Überwindung des sogenannten dialektischen Scheins. Es ist eine Kritik des „Verstandes und der Vernunft in Ansehung ihres hyperphysischen[28] Gebrauchs, um den falschen Schein ihrer grundlosen Anmaßungen aufzudecken [...]“29.
Der Transzendentalen Methodenlehre endlich obliegt die Aufgabe, die formalen Bedingungen eines vollständigen Systems der reinen Vernunft aufzuweisen. „Wir werden es in dieser Absicht mit einer Disziplin, einem Kanon, einer Architektonik, endlich einer Geschichte der reinen Vernunft zu tun haben [...]“30. Denn nachdem die Gesetzmäßigkeiten aber auch die Grenzen der reinen Vernunft offenliegen, stellt sich die Frage, wie man es – angesichts der Fallstricke, die ihr überall ausgelegt sind – zu einem Erkenntnisgebäude zu bringen vermag, das seinen Anspruch auf Wahrheit nicht schon durch ästhetische oder transzendentallogische Widersprüche einbüßt. Immer wieder nämlich verlässt die Vernunft, ob ihres unbändigen Hangs zur Erweiterung des Erkenntnisbestandes, und zwar über die Grenzen möglicher Erfahrung hinaus, den sicheren Weg, den ihr die Transzendentale Elementarlehre zu ebnen sich bemühte. Um also nicht erneut dem dialektischen Schein zu erliegen und bloß Gaukelwerke hervorzubringen, wie Kant sagt, bedarf es einer Methode, die es vermag, die Errichtung eines apriorischen Erkenntnisgebäudes sicher anzuleiten.
Die Kritik der reinen Vernunft ist also über die weiteste Strecke, nämlich der gesamten Elementarlehre entlang, eine Vermessung des menschlichen Erkenntnisvermögens, mithin des Anschauungs-, Verstandes- und Vernunftvermögens. Was sich hierbei auskristallisiert, das lässt sich, zu jedem Zeitpunkt des Studiums, aus drei unterschiedlichen Perspektiven einfangen: einer wissenschaftstheoretischen Perspektive, einer erkenntnislogischen Perspektive und einer wirklichkeitstheoretischen Perspektive.
Die wissenschaftstheoretische Perspektive offenbart sich in der Frage, wie synthetische Urteile a priori möglich sind. Es ist, meinem Dafürhalten nach, jene Perspektive, die Kant selbst eingenommen hat, denn wer den Versuch unternimmt, die Metaphysik auf wissenschaftliche Beine zu stellen, das ist ja das erklärte Ziel, und zugleich, wie wir noch sehen werden, die sie konstituierende Urteilsart zum Gegenstand der Betrachtung erhebt, der betreibt Wissenschaftstheorie – eine Teildisziplin der Erkenntnistheorie, die sich explizit mit der Frage nach der Möglichkeit wissenschaftlichen Wissens beschäftigt.
Die erkenntnislogische Perspektive wiederum offenbart sich in der Frage, inwiefern unser Erkenntnisapparat zugleich ein Konstruktionsapparat des Wirklichen ist. Liegt uns die Welt in unserem Erkennen in der Tat so vor, wie sie davon unabhängig vorliegt, oder geht das erkennende Subjekt gewissermaßen in das Erkannte ein, indem es selbst hervorbringt, was es erkennt? Aus dieser Perspektive eingefangen sind Kants Überlegungen klassisch erkenntnistheoretischer Natur, und zwar im Spannungsfeld von Realismus und Antirealismus.
Die wirklichkeitstheoretische Perspektive endlich offenbart sich in der Frage, was die Welt ist und wie sie uns gegeben ist. Aus dieser Perspektive eingefangen verdichten sich die Überlegungen Kants zu einer Wirklichkeitstheorie, denn er beantwortet sowohl den ersten, nämlich ontologischen, Teil der Frage, wenn auch nur im Sinne einer Minimalontologie, als auch den zweiten, nämlich erkenntnistheoretischen Teil.
Es ist, so könnte man in Anlehnung an eine Passage in Pascal Merciers Roman ›Nachtzug nach Lissabon‹ – des Philosophen Peter Bieri – sagen, ein Irrtum zu glauben, die entscheidenden Wendungen im Denken eines Philosophen, die seine Richtung für immer verändern, müssten von lauter und greller Dramatik sein, unterspült von heftigen seelischen Aufwallungen.31 In Wahrheit ist die Dramatik einer solchen Wendung oft von unglaublich leiser Art. Wenn sie ihre revolutionäre Wirkung entfaltet und dafür sorgt, dass sich einem die Welt von einem ganz anderen Standpunkt aus erschließt, so tut sie das lautlos, kaum wahrnehmbar. Ein Befund, dem der große Immanuel Kant wahrscheinlich zustimmen könnte, denn die Lautlosigkeit, mit der er die berühmte, die Kritik der reinen Vernunft zum Opus Magnum erhebende, geradezu dessen Anfang markierende, Kopernikanische Wende der Denkungsart vorträgt, die alle Philosophie in ein vollkommen neues Licht tauchen wird, gibt beeindruckend Zeugnis. Auf weniger als einer halben Seite dreht er, der Idee Kopernikus’ folgend, die doktrinäre und mit überwältigender Selbstverständlichkeit akzeptierte Hintergrundvoraussetzung der meisten Philosophen seiner Zeit um: Unsere Erkenntnis von Gegenständen wird nicht durch die Art der Gegenstände bestimmt, sondern die Gegenstände werden durch die Art der Erkenntnis bestimmt. Dem Bild des Kopernikus nach: Die Sterne drehen sich nicht um den Zuschauer, sondern der Zuschauer dreht sich um die Sterne. Das ist der Leitgedanke der Kritik und zugleich der Schlüssel zu einem in der Geschichte der Philosophie beispiellos radikalen nachdenken über das Denken. Ein Geniestreich, denn es ist ohne Zweifel der Zuschauer, den man in den Blick bekommen muss, ehe man die Welt, die einem »gegenüberliegt«, zu verstehen vermag. Versuchen wir also diesem Nachdenken über das Denken nachzudenken, uns die Philosophie des Alleszermalmer, wie der Aufklärer Moses Mendelssohn Kant nannte, fruchtbar zu machen, und mit dem Zuschauer gleichsam auch uns selbst zu bedenken.
2 Die Vorrede32
❅ Befund über den Zustand der Metaphysik ❅ Zweck der Kritik der reinen Vernunft ❅ Kopernikanische Wende der Denkungsart ❅ Konsequenzen und Nutzen des Vorhabens ❅
Die menschliche Vernunft hat das besondere Schicksal in einer Gattung ihrer Erkenntnisse: daß sie durch Fragen belästigt wird, die sie nicht abweisen kann; denn sie sind ihr durch die Natur der Vernunft selbst aufgegeben, die sie aber auch nicht beantworten kann, denn sie übersteigen alles Vermögen der menschlichen Vernunft.
In diese Verlegenheit gerät sie ohne Schuld. Sie fängt von Grundsätzen an, deren Gebrauch im Laufe der Erfahrung unvermeidlich und zugleich durch diese hinreichend bewährt ist. Mit diesen steigt sie [...] immer höher, zu entferneteren Bedingungen. Da sie aber gewahr wird, daß auf diese Art ihr Geschäfte jederzeit unvollendet bleiben müsse, weil die Fragen niemals aufhören, so sieht sie sich genötigt, zu Grundsätzen ihre Zuflucht zu nehmen, die allen möglichen Erfahrungsgebrauch überschreiten und gleichwohl so unverdächtig scheinen, daß auch die gemeine Menschenvernunft damit im Einverständnisse stehet. Dadurch aber stürzt sie sich in Dunkelheit und Widersprüche, aus welchen sie zwar abnehmen kann, daß irgendwo verborgene Irrtümer zum Grunde liegen müssen, die sie aber nicht entdecken kann, weil die Grundsätze deren sie sich bedient, da sie über die Grenze aller Erfahrung hinausgehen, keinen Probierstein der Erfahrung mehr anerkennen. Der Kampfplatz dieser endlosen Streitigkeiten heißt nun Metaphysik.33
Mit dieser bekannten und gleichermaßen schönen Passage – die der Vorrede der ersten Auflage entnommen ist – hebt Kants Befund über den Zustand der Metaphysik an. Er könnte dramatischer kaum sein. Die Königin der Wissenschaften, die sie einst war, ist in einem erbärmlichen Zustand. Der Modeton des Zeitalters bringt es „mit sich, ihr alle Verachtung zu beweisen und die Matrone[34] klagt, verstoßen und verlassen, wie Hecuba[35]“36: „Gerade noch Mittelpunkt von allem und durch so viele Schwiegersöhne und Kinder mächtig [...] werde ich jetzt, hilflos, aus meiner Heimat weggeführt.“37 Das ist am Ende des 18. Jahrhunderts wenig verwunderlich, denn seit der Scholastik beginnt sich das Klima Schritt für Schritt zu wandeln, in dem sich die nahezu uneingeschränkte Herrschaft der Metaphysik, unter der Verwaltung der Dogmatiker38 und im Dienste der römisch-katholischen Kirche, hat ausbilden können. Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft, Politik und Religion befinden sich im Umbruch: Die mit dem neuerlichen Erblühen der europäischen Städte einsetzende Intensivierung von Handel und Geldwirtschaft, die gesteigerte Nachfrage nach Handelsprodukten, die Differenzierung der Produktion, das rasante Bevölkerungswachstum im urbanen Raum und die schrittweise Anhebung des Bildungsniveaus und des Lebensstandards sind die Vorboten einer anderen Zeit. Seit dem 11. Jahrhundert kristallisiert ein selbstständiger Kaufmannsstand aus und in immer größerem Ausmaß steht dringend benötigtes Kapital zur Verfügung. Durch die Einführung des Kreditwesens und anderen Arten bargeldlosen Geschäftsverkehrs wird darüber hinaus die Globalisierung des Handels gefördert. So entstehen große Handelsgesellschaften ebenso wie das moderne Bankwesen. Im Sog dieser Veränderungen entwickeln sich neue Formen der Administration und Bürokratie, die ihrerseits den Übergang von der Universalmonarchie des Mittelalters zu den Staatsformen der Neuzeit begünstigen. Im 13. und 14. Jahrhundert werden erste Missions- und Handelsreisen nach Ostasien unternommen, die zu einem realistischeren Bild der Kulturen führen. Ende des 15., Anfang des 16. Jahrhunderts erfährt das traditionelle Weltbild der Europäer eine eindrucksvolle Erweiterung, insbesondere durch die Entdeckung Amerikas und die ersten Weltumsegelungen. Die Entdeckung neuer Länder nährt im Zusammenspiel mit dem expansionistischen Selbstverständnis der modernen Staaten das Streben nach kolonialer Herrschaft und Handelsdominanz. Dies wiederum befeuert einerseits die Idee, die europäische Vorstellung von Denken und Kultur als die einzig vernünftige zu vermitteln, markiert aber andererseits den Beginn eines schrittweisen Überdenkens des eigenen Weltbildes. Mathematik, Physik, Astronomie, Geografie und andere Wissenschaften erleben im Fahrwasser dieser tief greifenden Modernisierung einen atemberaubenden, nie da gewesenen Aufschwung. Das wissenschaftliche Selbstverständnis, neue Fragen an die Natur zu stellen und diese Fragen experimentell zu beantworten, zerstört zusammen mit der Entdeckung bisher unbekannter Länder und Sphären viele Mythen und Legenden und bewirkt ein neues Verständnis der Welt und des Menschen. Die starke Hinwendung der Wissenschaften zu den Realitäten der Natur, die von Kopernikus’ herbeigeführte Ablösung des geozentrischen durch das heliozentrische Weltbild, die Erfindung des Buchdrucks und die damit einhergehende Bildungsrevolution, die Ausbildung eines individualistischen Selbstverständnisses, das Wiederaufleben der antiken Skepsis, in seinen unterschiedlichen Ausprägungen, das wachsende Selbstbewusstsein im Hinblick auf den Gebrauch des eigenen Verstandes sowie die zunehmende Erschütterung kirchlicher und weltlicher Autoritäten und die damit einhergehende Ablehnung einer bloß durch Autorität begründeten Vorstellung von Wahrheit und Wirklichkeit stürzen, die nun ausgemergelte, über weite Strecken dogmatische und nicht zuletzt durch innere Gefechte längst zerrüttete, Metaphysik in den Abgrund. Kant sieht sich also mit einer morbiden, am Rande der Bedeutungslosigkeit dahinkränkelnden, Disziplin konfrontiert, die ihre Daseinsberechtigung allem Anschein nach verloren hat.
Doch es ist umsonst, schreibt Kant, ihr gegenüber Gleichgültigkeit erkünsteln zu wollen, weil die Gegenstände, die sie bedenkt – Gott, Freiheit und Unsterblichkeit –, der menschlichen Natur nicht gleichgültig sein können.39 Man kann sie also nicht einfach beiseiteschieben. Die letzten Fragen sind unhintergehbar metaphysische Fragen und im Bemühen die Perspektiven unserer Existenz auszuleuchten, müssen wir sie beantworten. Wir haben keine Wahl. Die Gleichgültigkeit aber, die der Metaphysik nichtsdestoweniger entgegenschlägt, obschon man auf ihre Erkenntnisse, so sie denn zu haben wären, am allerwenigsten verzichten wollte, ist offensichtlich eine „Wirkung nicht des Leichtsinns, sondern der gereiften Urteilskraft des Zeitalters, welches sich nicht länger durch Scheinwissen hinhalten läßt“40; gewissermaßen „eine Aufforderung an die Vernunft, das beschwerlichste aller ihrer Geschäfte, nämlich das der Selbsterkenntnis aufs neue zu übernehmen und einen Gerichtshof einzusetzen, der sie bei ihren gerechten Ansprüchen sichere, dagegen aber alle grundlosen Anmaßungen, nicht durch Machtsprüche, sondern [...] ihren ewigen und unwandelbaren Gesetzen“41 nach zurückweise. Ein Brückenschlag von besonderer Bedeutung: Der gesuchte Gerichtshof ist nämlich nichts anderes als die „Kritik der reinen Vernunft selbst“42. Denn nicht eine „Kritik der Bücher und Systeme“43 ist gemeint, sondern eine Kritik „des Vernunftvermögens überhaupt“44, und zwar „in Ansehung aller Erkenntnisse, zu denen sie, unabhängig von aller Erfahrung, streben mag, mithin die Entscheidung der Möglichkeit oder Unmöglichkeit einer Metaphysik überhaupt und die Bestimmung so wohl der Quellen, als des Umfangs und der Grenzen derselben [...]“45.
Dieser Aufforderung, den Weg der Selbsterkenntnis zu gehen, die Vernunft als oberstes Erkenntnisvermögen bis in den letzten Winkel zu durchleuchten und einen »Gerichtshof« einzusetzen, dessen Urteile in allen Streitigkeiten über die Wahrheit ihrer Erkenntnisse a priori eindeutig sind, ist Kant ohne Zweifel auf beeindruckende Weise nachgekommen. Denn mit der ›Kritik der reinen Vernunft‹ liegt eine tiefenscharfe und, wie er selbst sagt, vollständige Grundlegung der Metaphysik vor; ihre umfassende Rehabilitation nach langer, schwerer Krankheit. Es gibt nirgendwo einen Hinweis darauf, dass etwas anderes hätte erreicht werden sollen, als dies. War ihr „Verfahren bisher ein bloßes Herumtappen [...] unter bloßen Begriffen“46, so geht sie nun erstmals den sicheren Gang einer Wissenschaft.
Was diesen sicheren Gang betrifft, so sind Kants Vorbilder schnell genannt: Logik, Mathematik und Physik. Hier nämlich glaubt er das Rezept zu finden, das die Metaphysik zu revolutionieren vermag, und das als kopernikanische Wende der Denkungsart zu seinem ruhmreichen Vermächtnis wurde. Schließlich sind ja die genannten Wissenschaften solche, deren Erkenntnisse, so wie jene der Metaphysik, a priori gewonnen werden, zumindest über weite Strecken.
Zunächst zur Logik: „Daß es der Logik so gut gelungen ist, diesen Vorteil hat sie bloß ihrer Eingeschränktheit zu verdanken, dadurch sie berechtigt [...] ist, von allen Objekten der Erkenntnis und ihrem Unterschiede zu abstrahieren, und in ihr also der Verstand es mit nichts weiter, als sich selbst und seiner Form zu tun hat.“47 So kann man aber genau genommen gar nicht mehr von einer Wissenschaft reden als vielmehr von einer Propädeutik, die „gleichsam nur den Vorhof der Wissenschaften ausmacht, und wenn von Kenntnissen die Rede ist, man zwar eine Logik zur Beurteilung derselben voraussetzt, aber die Erwerbung derselben in eigentlich und objektiv so genannten Wissenschaften suchen muß“48.
Sofern nun in diesen Wissenschaften „Vernunft sein soll, [...] muß darin etwas a priori erkannt werden, und ihre Erkenntnis kann auf zweierlei Art auf ihren Gegenstand bezogen werden“49: Entweder handelt es sich um eine bloße Bestimmung des Gegenstandes und seines Begriffs (die dann bereits anderweitig gegeben sein müssen) oder es handelt sich um eine Neuschöpfung. „Die erste ist theoretische, die andere praktische Erkenntnis der Vernunft.“50 Womit wir bei Mathematik und Physik angekommen wären. In beiden Disziplinen haben wir es nämlich jedenfalls mit theoretischen und apriorischen Erkenntnissen zu tun. In der ersten mit ganz reinen, in der zweiten mit wenigstens zum Teil reinen, denn die Physik lässt neben der reinen Vernunft auch andere Erkenntnisquellen zu. Hier also muss sich das gesuchte Rezept finden.
Was die Mathematik betrifft, so ist sie bereits in der griechischen Antike, „den sicheren Weg einer Wissenschaft gegangen“51. Doch anders als im Fall der Logik, wo es die Vernunft, wie wir wissen, nur mit sich selbst zu tun hat, mit den formalen Regeln alles Denkens, und gar kein Objekt der Erkenntnis vorkommt, musste sich auch die Mathematik früherer Zeiten, den Vorwurf des Herumtappens gefallen lassen. Erst durch eine Revolution der Denkart ließ sie sich in den Stand einer strengen Wissenschaft heben, die sie heute ist. Schenken wir dem Philosophiehistoriker Diogenes Laertios glauben, so war es Thales von Milet, dem dieses Licht der Revolution aufgegangen ist:
Denn er fand, daß er nicht dem, was er in der Figur [des gleichschenkeligen Dreiecks]52 sahe, oder auch dem bloßen Begriffe derselben nachspüren und gleichsam davon ihre Eigenschaften ablernen, sondern durch das, was er nach Begriffen selbst a priori hineindachte und darstellte, (durch Konstruktion) hervorbringen müsse, und daß er, um sicher etwas a priori zu wissen, der Sache nichts beilegen müsse, als was aus dem notwendig folgte, was er seinem Begriff gemäß selbst in sie gelegt hat.53
Diese Einsicht, dass eine sichere Erkenntnis von Gegenständen erst dadurch zustande kommt, indem zum Vorschein gebracht wird, was in die Gegenstände selbst hineingedacht wurde, und das ihnen nichts zugeschrieben werden darf, was nicht notwendig aus dem folgt, was ihren Begriffen nach bereits in sie gelegt ist, revolutionierte, wenngleich viel später, auch die Naturwissenschaft.
Als Galilei seine Kugeln die schiefe Fläche mit einer von ihm selbst gewählten Schwere herabrollen, oder Torricelli die Luft ein Gewicht, was er sich zum voraus dem einer ihm bekannten Wassersäule gleich gedacht hatte, tragen ließ, [...] so ging allen Naturforschern ein Licht auf. Sie begriffen, daß die Vernunft nur das einsieht, was sie selbst nach ihrem Entwurfe hervorbringt [...]. Die Vernunft muß mit ihren Prinzipien, nach denen allein übereinkommende Erscheinungen für Gesetze gelten können, in einer Hand, und mit dem Experiment, das sie nach jenen ausdachte, in der anderen, an die Natur gehen, zwar um von ihr belehrt zu werden, aber nicht in der Qualität eines Schülers, der sich alles vorsagen läßt, was der Lehrer will, sondern eines [...] Richters, der die Zeugen nötigt auf die Fragen zu antworten, die er ihnen vorlegt.54
Und so hat sogar die Physik die so vorteilhafte Revolution ihrer Denkart lediglich dem Einfall zu verdanken, dem, was die Vernunft selbst in die Natur hineinlegt, gemäß, das in ihr zu suchen, (nicht ihr anzudichten,) was sie hierzu von ihr lernen kann, und wovon sie für sich selbst nichts wissen würde.55
Es sind also, wenn man so will, wissenschaftstheoretische Überlegungen, die Kant schrittweise zur kopernikanischen Wende der Denkungsart führen und zugleich zu einer Revolution nicht nur der Metaphysik, sondern der gesamten Philosophie. Da die Metaphysik aus derselben Erkenntnisquelle schöpft wie die Mathematik und zum Teil auch die Physik, nämlich aus reiner Vernunft, schlägt Kant in einem letzten Schritt vor, die Methode dieser Wissenschaften, wenigstens versuchsweise, auf die Metaphysik zu übertragen:56
Bisher nahm man an, alle unsere Erkenntnis müsse sich nach den Gegenständen richten; aber alle Versuche über sie a priori etwas durch Begriffe auszumachen, wodurch unsere Erkenntnis erweitert würde, gingen unter dieser Voraussetzung zu nichte. Man versuche es daher einmal, ob wir nicht in den Aufgaben der Metaphysik besser fortkommen, daß wir annehmen, die Gegenstände müssen sich nach unserem Erkenntnis richten, welches so schon besser mit der verlangten Möglichkeit einer Erkenntnis derselben a priori zusammenstimmt, die über Gegenstände, ehe sie uns gegeben werden, etwas festsetzen soll. Es ist hiemit eben so, als mit den ersten Gedanken des Copernicus bewandt, der, nachdem es mit der Erklärung der Himmelsbewegungen nicht gut fort wollte, wenn er annahm, das ganze Sternheer drehe sich um die Zuschauer, versuchte, ob es nicht besser gelingen möchte, wenn er den Zuschauer sich drehen, und dagegen die Sterne ruhen ließ. In der Metaphysik kann man nun, was die Anschauung der Gegenstände betrifft, es auf ähnliche Weise versuchen. Wenn die Anschauung sich nach der Beschaffenheit der Gegenstände richten müßte, so sehe ich nicht ein, wie man a priori von ihr etwas wissen könne; richtet sich aber der Gegenstand (als Objekt der Sinne) nach der Beschaffenheit unseres Anschauungsvermögens, so kann ich mir diese Möglichkeit ganz wohl vorstellen.57
Das ist in schlichter Formulierung der große Zauber der Kritik der reinen Vernunft, die bahnbrechende Umkehrung der Denkart. Versuchen wir uns das Gesagte – Kant möge es uns nachsehen – mithilfe einer Metapher zu verdeutlichen: Wollten wir aus einem Stück Teig Figuren ausstechen, so könnten wir, dem herkömmlichen Bild nach, über die Beschaffenheit dieser Figuren nichts wissen, bevor sie nicht ausgestochen sind und uns vor Augen liegen. Im Teig nämlich fände sich nicht der geringste Hinweis darauf, so penibel wir ihn vorab auch untersuchen würden, weil seine besondere Beschaffenheit von der Beschaffenheit der Figuren bestimmt wäre. Drehen wir das Bild aber um, sodass die Beschaffenheit der Figuren, die wir später vor uns liegen haben, von der besonderen Beschaffenheit des Teiges bestimmt sind, so könnten wir, in dem wir den Teig in Augenschein nehmen, über ihre Beschaffenheit etwas wissen, noch bevor sie ausgestochen sind.
Doch bei den Anschauungen, so Kant, können wir, wenn es um Erkenntnis gehen soll, nicht stehen bleiben. Hierfür bedarf es nämlich der begrifflichen Bestimmung derselben. Gegenstände zu erkennen bedeutet, ganz allgemein gesagt, nicht sie wahrzunehmen, oder sie irgendwie sonst ins Bewusstsein zu heben, oder bloß als Bewusstseinsinhalte vorzufinden, sondern sie unter Begriffe zu bringen. Eine Vorstellung, die in der Philosophie weit verbreitet ist. Erkenntnis ist wesentlich eine intellektuelle Leistung. Dem bisher schon Gesagten folgend, kann ich nun „entweder annehmen, die Begriffe, wodurch ich diese Bestimmung zu Stande bringe, richten sich auch nach dem Gegenstande, und denn bin ich wiederum in derselben Verlegenheit, wegen der Art, wie ich a priori hievon etwas wissen könne; oder ich nehme an, die Gegenstände, oder welches einerlei ist, die Erfahrung, in welcher sie allein (als gegebene Gegenstände) erkannt werden, richte sich nach diesen Begriffen“58. Letzterer nach „sehe ich sofort eine leichtere Auskunft, weil Erfahrung selbst eine Erkenntnisart ist, die Verstand erfordert, dessen Regel ich in mir, noch ehe mir Gegenstände gegeben werden, mithin a priori voraussetzen muß, welche in Begriffen a priori ausgedrückt wird, nach denen sich also alle Gegenstände der Erfahrung notwendig richten und mit ihnen übereinstimmen müssen“59.
Auf diese Weise also, „nach dieser Veränderung der Denkart“60, lässt sich die Möglichkeit von Erkenntnis a priori, und somit auch die Möglichkeit von Metaphysik als strenger Wissenschaft, deren Geschäft ja in nichts anderem besteht als darin, Erkenntnisse hervorzubringen, die von Erfahrung vollkommen unabhängig sind, „ganz wohl erklären, und, was noch mehr ist, die Gesetze, welche a priori der Natur, als dem Inbegriffe der Gegenstände der Erfahrung, zum Grunde liegen, mit ihren genugtuenden Beweisen versehen, welches beides nach der bisherigen Verfahrungsart unmöglich war“61.
Was aber damit zum Vorschein kommt, ist mindestens ebenso bedeutend, wie die Veränderung der Denkart selbst: nämlich eine Neubestimmung der Metaphysik. Metaphysik ist, dem von Kant gezeichneten Bild nach, zumindest vorläufig, nicht die Wissenschaft von Gott, Freiheit und Unsterblichkeit, nicht die Wissenschaft des Übersinnlichen, mithin des Wahrnehmungstranszendenten, sondern die Wissenschaft von den a priori gegebenen Gesetzmäßigkeiten der Natur, als dem Inbegriff der Gegenstände der Erfahrung, die ihr als Gesetzmäßigkeiten des Verstandes – und, wie wir noch sehen werden, auch der Vernunft – vorausliegen. Womit wir unweigerlich bei den Konsequenzen und dem Nutzen des Vorhabens Kants angekommen wären: Es ergibt sich nämlich aus dem bisher Gesagten, ein für die Metaphysik „befremdliches und dem ganzen Zwecke derselben [...] sehr nachteiliges Resultat“62, denn es ist einsichtig, dass wir auf diese Weise „nie über die Grenze möglicher Erfahrung hinauskommen können, welches doch gerade die wesentlichste Angelegenheit dieser Wissenschaft ist“63. Doch darin, dass wir die Sache „an sich selbst [...] zwar als für sich wirklich, aber von uns unerkannt, liegen lassen“ müssen, liegt nun gerade nicht das Moment ihrer Disqualifikation, sondern der Probierstein der Methode – mithin der Veränderung der Denkart – und der damit einhergehenden Annahme, dass sich die Beschaffenheit der Gegenstände nach der Beschaffenheit der Anschauung richtet und nicht umgekehrt:
Denn das, was uns notwendig über die Grenze der Erfahrung und aller Erscheinungen hinaus zu gehen treibt, ist das Unbedingte, welches die Vernunft in den Dingen an sich selbst notwendig und mit allem Recht zu allem Bedingten, und dadurch die Reihe der Bedingungen als vollendet verlangt. Findet sich nun, wenn man annimmt, unsere Erfahrungserkenntnis richte sich nach den Gegenständen als Dingen an sich selbst, daß das Unbedingte ohne Widerspruch gar nicht gedacht werden könne; dagegen, wenn man annimmt, unsere Vorstellung[64] der Dinge, wie sie uns gegeben werden, richte sich nicht nach diesen, als Dingen an sich selbst, sondern diese Gegenstände vielmehr, als Erscheinungen, richten sich nach unserer Vorstellungsart, der Widerspruch wegfalle; und daß folglich das Unbedingte nicht an den Dingen, so fern wir sie kennen, (sie uns gegeben werden,) wohl aber an ihnen, sofern wir sie nicht kennen, als Sachen an sich selbst, angetroffen werden müsse: so zeigt sich, daß, was wir Anfangs nur zum Versuche annahmen, gegründet sei.65
Im Versuch also, „das bisherige Verfahren der Metaphysik umzuändern, und dadurch, daß wir nach dem Beispiele der Geometer und Naturforscher eine gänzliche Revolution mit derselben vornehmen, besteht nun das Geschäfte dieser Kritik der reinen spekulativen[66] Vernunft“67. „Sie ist ein Traktat von der Methode, nicht ein System der Wissenschaft selbst; aber sie verzeichnet gleichwohl den ganzen Umriß derselben, so wohl in Ansehung ihrer Grenzen, als auch den ganzen inneren Gliederbau derselben.“68 Insofern ist die Kritik der reinen spekulativen Vernunft, das methodologische wie erkenntnistheoretische Fundament einer jeden künftigen Metaphysik. Auf ihm muss sie gegründet sein. Dann aber hat die „Metaphysik das seltene Glück, welches keiner anderen Vernunftwissenschaft, die es mit Objekten zu tun hat, (denn die Logik beschäftigt sich nur mit den Formen des Denkens überhaupt,) zu Teil werden kann, daß [...] sie das ganze Feld der für sie gehörigen Erkenntnisse völlig befassen und also ihr Werk vollenden und für die Nachwelt zum Gebrauch niederlegen kann [...]“69.
Nichtsdestoweniger mag man an den Nutzen einer so verstandenen, ihrer zentralen Gegenstände beraubten, Metaphysik nicht so recht glauben. Was ist denn das, fragt man sich, „für ein Schatz, den wir der Nachkommenschaft mit einer solchen durch Kritik geläuterten [...] Metaphysik, zu hinterlassen gedenken“70? Tatsächlich, so Kant, könnte man „bei einer flüchtigen Übersicht dieses Werks wahrzunehmen glauben, daß der Nutzen davon doch nur negativ sei, uns nämlich mit der spekulativen Vernunft niemals über die Erfahrungsgrenze hinaus zu wagen“71. Bei genauerer Betrachtung aber zeigt sich, dass mit dieser radikalen Einschränkung der Metaphysik, mithin der spekulativen Vernunft, überhaupt erst der Spielraum entsteht, in dem Gott, Freiheit und Unsterblichkeit jene fundamentale Rolle einnehmen können, die sie für die menschliche Existenz spielen: Wäre es nämlich so, dass die Metaphysik auf erfahrungstranszendente Gegenstände hinauszugreifen imstande wäre, und würde sie zutage fördern, dass es weder Gott noch Freiheit noch Unsterblichkeit gibt, was ja durchaus der Fall sein könnte, so gäbe es, ob der logischen Strenge, mit der sie als reine Vernunftwissenschaft zu operieren vermag, daran nichts mehr zu rütteln.72 So aber bleiben diese Gegenstände einem anderen Vernunftvermögen vorbehalten, das sie vor der Zerlegung auf dem Seziertisch theoretisch-spekulativer Erkenntnis bewahrt, und sie stattdessen als Gegenstände des notwendigen praktischen Gebrauchs versteht: die Rede ist von der reinen praktischen Vernunft. Ihr geht es nicht um theoretische Erkenntnis, nicht darum die Welt, in der wir leben, zu verstehen, sondern darum, sie im Sinne einer Lebenspraxis begreiflich zu machen. Es ist nicht das Wissen, worum es ihr geht, sondern das Glauben. ›“Ich mußte also das Wissen aufheben, um zum Glauben Platz zu bekommen“73‹ schreibt Kant in der Vorrede zur zweiten Auflage und verweist damit auf den Unterschied zwischen reiner (spekulativer) und praktischer Vernunft. ›Was kann ich wissen?‹ ist die Frage des einen Vermögens; ›Was kann ich glauben?‹ und ›Was soll ich tun‹ sind die Fragen des anderen.
„Bei dieser wichtigen Veränderung im Felde der Wissenschaften, und dem Verluste, den spekulative Vernunft an ihrem bisher eingebildeten Besitz erleiden muß, bleibt dennoch alles mit der allgemeinen menschlichen Angelegenheit, und dem Nutzen, den die Welt bisher aus den Lehren der reinen Vernunft zog, in demselben vorteilhaften Zustande [...], und der Verlust trifft nur das Monopol der Schulen, keineswegs aber das Interesse der Menschen.“74 Dagegen, weil jede Schule, und auch jeder Metaphysiker, unvermeidlich in subtil gesponnene Argumente für und gegen die Wahrheit gerät, ist durch die „gründliche Untersuchung der Rechte der spekulativen Vernunft einmal für allemal dem Skandal vorzubeugen“75, der „über kurz oder lang selbst dem Volke aus den Streitigkeiten aufstoßen muß, in welche sich Metaphysiker (und als solche endlich auch wohl Geistliche) ohne Kritik unausbleiblich verwickeln [...]“76. Durch die Kritik „kann nun allein dem Materialism, Fatalism, Atheism, dem freigeisterischen Unglauben, der Schwärmerei und Aberglauben, [...] zuletzt auch dem Idealism und Skeptizism, [...] die Wurzel abgeschnitten werden“77.
3 Die Einleitung78
❅ Synthetische Urteile a priori als Endabsicht der Metaphysik ❅ Idee einer Transzendental-Philosophie und die Kritik der reinen Vernunft als deren architektonischer Plan ❅
Schon unsere bisherigen Überlegungen zeigten, dass es die Metaphysik ausschließlich mit Erkenntnis a priori zu tun hat, also mit Erkenntnis unabhängig von Erfahrung. Das ist unmittelbar einleuchtend, denn eine Disziplin, deren Gegenstände, die sie bedenkt, außerhalb aller Erfahrung liegen, kann ganz unmöglich auf Erfahrungserkenntnis, mithin empirischer Erkenntnis, aufruhen. Doch damit nicht genug: Die Metaphysik wird letztlich, und zwar ihrem überwiegenden Teil nach, so Kant, aus einer ganz besonderen Art von Erkenntnis a priori bestehen: nämlich aus so genannten synthetischen Sätzen (oder Urteilen) a priori. Auf sie zielt die Endabsicht der Metaphysik und im Übrigen auch die Endabsicht aller anderen Vernunftwissenschaften. Dementsprechend groß ist ihre Bedeutung und die Beweise ihrer Möglichkeit nehmen breiten Raum ein. Vergegenwärtigen wir uns also, was damit gemeint ist:
Zunächst müssen wir zwischen Erkenntnissen a priori, denen wir bereits begegnet sind, und Erkenntnissen a posteriori unterscheiden:
Erkenntnisse a priori sind solche, „die schlechterdings von aller Erfahrung unabhängig stattfinden“79, die also auf Vernunfttätigkeit gegründet sind. Die sicheren Kennzeichen einer Erkenntnis a priori sind „Notwendigkeit und strenge Allgemeinheit.“80 Ihre Wahrheit oder Falschheit lässt sich nämlich auf der Grundlage des Widerspruchsprinzips, dem zufolge die Negation jedes Urteils a priori unausweichlich in einen logischen Widerspruch führt, mit absoluter Notwendigkeit bestimmen. „Findet sich also [...] ein Satz, der zugleich mit seiner Notwendigkeit gedacht wird, so ist er ein Urteil a priori.“81 „Das es nun dergleichen notwendige und im strengen Sinne allgemeine, mithin reine Urteile a priori, im menschlichen Erkenntnis wirklich gebe, ist leicht zu zeigen.“82