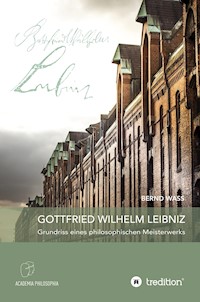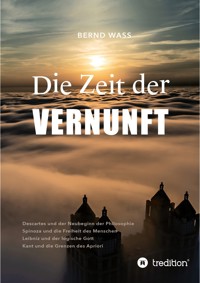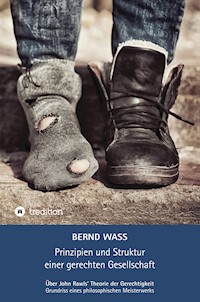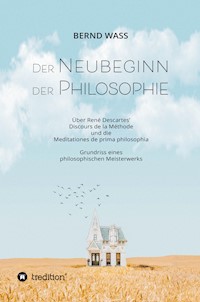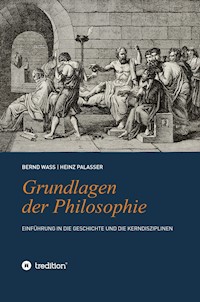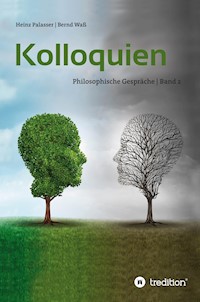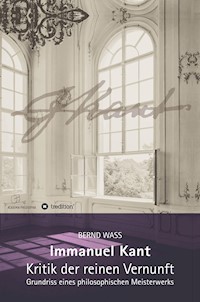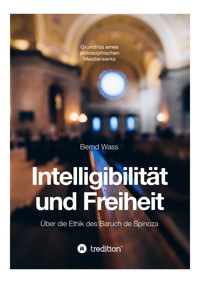
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Baruch de Spinoza ist im Kanon der großen Rationalisten eine Ausnahmeerscheinung. Aus der jüdischen Gemeinde ausgeschlossen und mit einem Bannfluch belegt, sucht er nach den Hintergrundvoraussetzungen eines selbstbestimmten und freien und also gelingenden Lebens. In seiner Ethik laufen die Linien zusammen: Gott und Welt sind intelligibel, allein der Tätigkeit der Vernunft nach begreifbar, weshalb der Erkennende zugleich der Glückselige ist. Denn der Weise vermag nicht nur der Knechtschaft der Affekte, diesem dauernden Wogen unstillbarer Begierden, törichter Freuden und zerstörerischer Trauer zu entkommen, sondern unter einem Aspekt von Ewigkeit klar zu sehen und sich dem Griff der Autoritäten zu entziehen. Im vorliegenden Buch wurde der Versuch unternommen, Spinozas Ethik, sein Hauptwerk, dieses nach geometrischem Vorbild artikulierte Gedankengebäude, das aus Definitionen, Axiomen, Lehrsätzen, Beweisen und Anmerkungen besteht, in eine »philosophische Erzählung« zu überführen, mit dem Ziel, den Grundriss desselben offenzulegen und es für alle Menschen zugänglich zu machen, die an philosophischer Weltdeutung interessiert sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 222
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Intelligibilität und Freiheit
Über die Ethik des Baruch de Spinoza
Grundriss eines philosophischen Meisterwerks
© 2023 Bernd Waß
Autor: Mag. phil. Dr. phil. Bernd Waß, MSc
Umschlaggestaltung, Illustration, Grafik: Mag. Petra Pfuner, CreativbüroVitamin©
Cover-Bild: Pexels, Ricardo Esquivel, Creative Commons Zero (CCO) Lizenz
ISBN Softcover: 978-3-347-82524-6
ISBN Hardcover: 978-3-347-82527-7
ISBN E-Book: 978-3-347-82850-6
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, An der Strusbek 10, 22926 Ahrensburg, Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", An der Strusbek 10, 22926 Ahrensburg, Deutschland.
Erste Auflage 2023
DER AUTOR
Bernd Waß studierte am Institut für Philosophie der Kultur- und Gesellschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Salzburg Analytische Philosophie. Zum Doktor der Philosophie promovierte er bei Prof. Dr. Reinhard Kleinknecht, Prof. Dr. Otto Neumaier und Prof. Dr. Volker Gadenne mit einer Arbeit zur Philosophie des Geistes. Er ist Philosoph und Privatgelehrter, ordentliches Mitglied der Österreichischen Gesellschaft für Philosophie und Gründungsdirektor der School of Philosophy. Seine Arbeitsschwerpunkte finden sich in der Metaphysik, insbesondere der Philosophie des Geistes sowie der Erkenntnistheorie, insbesondere der Phänomenwelt-Realwelt- Problematik.
Zum Gebrauch der vorliegenden Abhandlung
Um den Gebrauch der vorliegenden Abhandlung zu erleichtern, sei auf einige Besonderheiten hingewiesen:
Besondere Aufmerksamkeit
Ausdrücke, die vom Leser besondere Aufmerksamkeit erfordern oder die sich aus Gründen der besseren Lesbarkeit vom Fließtext abheben sollten, werden durch schräg gestellte Schriftzeichen gekennzeichnet. Zum Beispiel: Ein Weg, der schlussendlich, und das ist der rote Faden durch das gesamte Werk, zum größten Glück des menschlichen Daseins führt, zu Selbstbestimmung und Freiheit.
Anführungsnamen
Um Ausdrücke, die erwähnt werden, von Ausdrücken zu unterscheiden, die verwendet werden, werden Anführungsnamen gebildet. Ein Anführungsname wird gebildet, indem der betreffende Ausdruck in einfache Klammern gesetzt wird. Zum Beispiel: ›Baruch de Spinoza‹ ist der Name eines berühmten Philosophen. Anführungsnamen wurden dem besseren Verständnis wegen dort, wo entsprechende Kennzeichnungen fehlten, auch in Zitaten eingefügt.
Metaphorische Ausdrücke
Metaphorisch gebrauchte Ausdrücke werden in doppelte Klammern gesetzt. Zum Beispiel: Dabei ist der Selbsterhaltungstrieb der Fundamentalaffekt unter den Grundaffekten. Er ist zwar »blind«, um es mit Schopenhauer zu sagen, doch er sorgt dafür, dass wir unablässig tun, was zu tun nötig ist, um uns selbst zu erhalten.
Kurze wörtliche Zitate
Wörtliche Zitate mit einer Länge von bis zu sechs Zeilen werden im Fließtext durch Anführungszeichen und Fußnote gekennzeichnet. Zum Beispiel: „So sind Selbstbeherrschung, Nüchternheit, Geistesgegenwart in Gefahren usw. Arten von Selbstvertrauen, während Gefälligkeit, Mildtätigkeit usw. Arten von Edelmut sind.“1
Lange wörtliche Zitate
Wörtliche Zitate mit einer Länge von mehr als sechs Zeilen (davon ausgenommen sind Zitate in Fußnoten) werden durch Einrückung, kleinere Schriftgröße und Fußnote gekennzeichnet. Zum Beispiel:
So schließt die Freude, die von einem Gegenstand, z. B. A, herrührt, die Natur dieses Gegenstands A in sich, und die Freude, die von dem Gegenstand B herrührt, die Natur genau dieses Gegenstandes B; mithin sind diese beiden Affekte der Freude ihrer Natur nach verschieden, entstehen sie doch aus Ursachen verschiedener Natur. Ebenso ist der Affekt der Trauer, der von dem einen Gegenstand herrührt, seiner Natur nach von der Trauer verschieden, die sich aus einer anderen Ursache ergibt; und dasselbe muß von Liebe, Haß, Hoffnung, Furcht, Schwankungen des Gemüts usw. gelten; somit gibt es notwendigerweise so viele Arten von Freude, Trauer, Liebe, Haß usw., wie es Arten von Gegenständen gibt, von denen wir affiziert werden.2
Fußnoten
Manche Menschen mögen keine Fußnoten. Ich hingegen liebe sie. Nur mit einer Fußnote ist eine Seite gut gekleidet. Fußnoten stellen nämlich einen Mikrokosmos zusätzlicher, wenngleich nicht vordergründiger Informationen und Gedankengänge dar. So finden sich darin erstens sämtliche Quellenangaben zu wörtlichen und sinngemäßen Zitaten; zweitens Anmerkungen, um bestimmte Begriffe oder Zusammenhänge in Zitaten zu erläutern; drittens Ausschnitte aus dem Originaltext, auf die nicht verzichtet werden wollte, obschon man sie hätte vernachlässigen können; viertens Erläuterungen und Hinweise zum besseren Verständnis des Textes insgesamt; fünftens Seitenverweise zum jeweiligen Abschnitt des Originaltexts, um die Orientierung zu behalten und es der Leserin/dem Leser während des Studiums jederzeit zu erlauben, zwischen dem Originaltext und der hier vorliegenden Abhandlung zu vergleichen.
Legende
Ax: Axiom
Def: Defintion
Hs: Hauptsatz
Ls: Lehrsatz
1 De Spinoza, Baruch: Ethik in geometrischer Ordnung dargestellt, Meiner, Hamburg, 2010, S. 333, Ls 59.
2 De Spinoza, Baruch: Ethik in geometrischer Ordnung dargestellt, Meiner, Hamburg, 2010, S. 325, Ls 56.
Inhaltsverzeichnis
§ 1 Hintergrundüberlegungen
§ 2 Die Metaphysik des Absoluten (Teil 1 der Ethik): Von Gott
§ 2.1 Grundriss
§ 2.1.1 Substanz und Existenz
§ 2.1.2 Substanz und Unendlichkeit
§ 2.1.3 Erste Rekapitulation
§ 2.1.4 Vielheit der Attribute und Unteilbarkeit von Substanz
§ 2.1.5 Substanz-Monismus und Immanenz-Metaphysik
§ 2.1.6 Zweite Rekapitulation
§ 2.1.7 Freiheit, Verstand und Wille Gottes
§ 2.1.8 Ewigkeit, Ding-Welt und Determinismus
§ 2.1.9 Dritte Rekapitulation
§ 2.1.10 Anthropomorphismus und Vorstellungsrealismus
§ 2.2 Zusammenfassung
§ 3 Die Theorie der adäquaten Erkenntnis (Teil 2 der Ethik): Von der Natur und dem Ursprung des Geistes
§ 3.1 Grundriss
§ 3.1.1 Gottes Idee von allem überhaupt als erkenntnislogische Spiegelung seiner Existenz
§ 3.1.2 Ideen, Welt und Gott: Eine Frage der Relation
§ 3.1.3 Erste Rekapitulation
§ 3.1.4 Mensch, Geist und Körper
§ 3.1.5 Innenwelt, Außenwelt und adäquate Erkenntnis
§ 3.1.6 Zweite Rekapitulation
§ 3.2 Zusammenfassung
§ 4 Die Theorie der Affekte (Teil 3 der Ethik): Von dem Ursprung und der Natur der Affekte
§ 4.1 Grundriss
§ 4.1.1 Selbsterhaltung, Wirkungsmacht und Klassen von Affekten
§ 4.1.2 Bestimmung der Grundaffekte und der Sekundäraffekte
§ 4.1.3 Die Definition der Affekte
§ 4.2 Zusammenfassung
§ 5 Die Theorie der Affekte (Teil 4 der Ethik): Von menschlicher Knechtschaft oder von den Kräften der Affekte
§ 5.1 Grundriss
§ 5.1.1 Musterbilder, Begriffe des Vergleichens und das Ideal der Vernunft
§ 5.1.2 Kräfte und Intensitäten der Affekte
§ 5.1.3 Vom Guten und Schlechten der Affekte
§ 5.1.4 Aktivitäten des Geistes: Affekte der Vernunft als Gegengewichte
§ 5.1.5 Über die menschliche Freiheit
§ 5.1.6 Über die rechte Lebensweise – ein ordnender Anhang
§ 5.2 Zusammenfassung
§ 6 Die Theorie der Affekte (Teil 5 der Ethik): Von der Macht des Verstandes oder von menschlicher Freiheit
§ 6.1 Grundriss
§ 6.1.1 Die Macht des Geistes und die Heilmittel für die Affekte
§ 6.1.2 Der Aspekt der Ewigkeit
§ 6.2 Zusammenfassung
§ 7 Die Quintessenz
Literaturverzeichnis
§ 1 HINTERGRUNDÜBERLEGUNGEN
Seit der Gründung der School of Philosophy verstehen wir uns als Bindeglied zwischen der akademisch-universitären Philosophie einerseits und einer breiteren Hörerschaft andererseits. Es wäre schade, so dachten wir uns, wenn die Faszination philosophischer Weltdeutung nur jenem kleinen Kreis von Menschen vorbehalten bliebe, der sich von Berufswegen mit der Philosophie beschäftigt. Auch wenn die Hochzeit der Philosophie –so es sie denn jemals gegeben hat – in einer ökonomisierten und am Maßstab des Praktischen orientierten Gesellschaft allem Anschein nach vorüber ist, glauben wir nichtsdestoweniger, dass die Beschäftigung mit philosophischer Weltdeutung für unser geistiges Leben unverzichtbar ist. Der Entwurf einer feingliedrigen, vernünftigen und logisch zureichenden Weltanschauung, die Disziplinierung des Denkens und die Verbesserung der Urteilskraft können nirgendwo vorzüglicher gelingen als in der Philosophie. Nicht zuletzt deshalb bemühen wir uns um die Vermittlung wissenschaftlicher Philosophie und die Pflege eines breit angelegten philosophischen Diskurses; außerhalb der Mauern der Universitäten, eine fachfremde Hörerschaft im Blick, aber dennoch auf akademischem Niveau. Ein Programm, das uns immer wieder vor intellektuelle Herausforderungen stellt. Im Versuch, eine solche Herausforderung zu bewältigen, nämlich eine Textgrundlage für den philosophischen Diskurs im Rahmen unserer alljährlichen Sommerakademie zu erarbeiten, ist die vorliegende Spinoza-Exegese ›Intelligibilität und Freiheit, Über die Ethik des Baruch de Spinoza – Grundriss eines philosophischen Meisterwerks‹ entstanden. Man kann sie daher im Sinne einer Propädeutik lesen – als Vorbereitung zum Studium des Originaltextes –, aber auch als eine in sich geschlossene Arbeit, deren Anspruch es ist, das philosophische Leben Baruch de Spinozas, das er uns in seinem Hauptwerk ›Ethik in geometrischer Ordnung dargestellt‹ offenbart hat, verständlich zu machen. Der leitende Gedanke besteht dabei darin, dieses nach geometrischem Vorbild artikulierte Gedankengebäude, das im Wesentlichen aus einer Aneinanderreihung von Definitionen, Axiomen, Lehrsätzen und Anmerkungen besteht, in eine »philosophische Erzählung« zu überführen, die den Grundriss desselben offenzulegen vermag, sich aber dennoch nahe am Originaltext bewegt. Dementsprechend geht es hier nicht darum, dieses Gebäude kritisch zu durchdringen, als vielmehr darum, es im Sinne einer gewissen Vertrautheit ein erstes Mal zu begehen. Grundlage dieser Begehung ist die bei Felix Meiner 2010 erschienene, sich auf Carl Gebhardts1 kritische Ausgabe stützende Edition der Ethik Baruch de Spinozas mit dem Titel ›Ethik in geometrischer Ordnung dargestellt‹.2
Baruch de Spinoza, neben René Descartes, Gottfried Wilhelm Leibniz und Immanuel Kant der wichtigste Denker des neuzeitlichen Rationalismus, wird am 25. November 1632 als Bento de Espinosa im Judenviertel Amsterdams geboren.3 Der Sohn jüdischer Immigranten aus Portugal, der in der jüdischen Gemeinde als Baruch geführt wird und sich später latinisiert ›Benedictus de Spinoza‹ nennt, hat so radikal wie kein anderer Philosoph das traditionelle Denken „in Frage gestellt, hat Gott und Natur identifiziert, die Positivität aller überlieferten Religionen aufgewiesen, alle weltjenseitige Begründung von Moralität und Tugend abgelehnt, jeden auf des Menschen wohl ausgerichteten Zweck im Weltlauf verneint:“4 Für die Autoritäten seiner Zeit ist er „einer der großen Betrüger, Verführer der Menschen, nein: […] der größte und gefährlichste unter ihnen“5. Wenig verwunderlich, dass der Zeitgenosse René Descartes und Gottfried Wilhelm Leibnizens über die weiteste Strecke seines Lebens ein Außenseiter bleibt.6 Nicht nur im Sinne eines exotischen Sonderlings, der zurückgezogen lebt, der seinen Lebensunterhalt mit dem Drehen und Schleifen optischer Linsen verdient und ganz auf die Ausarbeitung seiner Philosophie bedacht ist, sondern vor allem im Sinne eines ruchlosen Gesellen, wie sich die niederländische Staatsmacht auszudrücken beliebt, eines atheistischen Zerstörers von Religion und Moral, mit dem Umgang zu pflegen einen jeden hätte verdächtig machen müssen. Schon früh beginnt er sich im Selbststudium mit Theologie und Philosophie vertraut zu machen, insbesondere mit den Schriften René Descartes und seine Kenntnisse über mehrere Jahre hinweg in der privaten Lateinschule von Juan de Brado, eines freigeistigen Mediziners, zu vertiefen. Je weiter er vordringt, umso deutlicher zeigt sich ihm die dogmatische Enge der religiösen Tradition, die sein Leben bestimmt. Sukzessive beginnt er sich davon zu distanzieren. Seine damit einhergehende bibel- und religionskritische Haltung und sein Angriff auf einige der zentralen Glaubenslehren der jüdischen Gemeinde führt schließlich zum Bruch. Denn „das Alte Testament erscheint ihm voll von Widersprüchen und Ungereimtheiten, und er will und kann nicht anerkennen, dass es in allen seinen Teilen nichts als die schlechthinnige Wahrheit enthalte“7. 1656, mithin vierundzwanzigjährig, wird er daher aus der Gemeinde ausgeschlossen. Aus Amsterdam vertrieben, zieht er 1661 in ein abgeschiedenes Haus nach Rijnsburg, einem Dorf in der niederländischen Provinz Südholland, in der Nähe der Universitätsstadt Leiden. Hier schreibt er einerseits die unvollendet gebliebene ›Abhandlung über die Verbesserung des Verstandes‹8 und andererseits die Abhandlung über ›Descartes’ Prinzipien der Philosophie in geometrischer Weise dargestellt‹9. Es ist dies die einzige Schrift, die zu seinen Lebzeiten unter seinem eigenen Namen publiziert wird. Nicht ohne Kalkül, könnte man sagen, denn sie macht Spinoza in der Öffentlichkeit als Descartes-Kritiker bekannt, woran ihm mit Blick auf die politische Führung seines Landes durchaus gelegen ist. Doch spätestens mit der Veröffentlichung des Theologisch-politischen Traktats10 1670 – Spinoza lebt mittlerweile in Den Haag –, in dem er vehement die Freiheit der öffentlichen Meinungsäußerung in Religion und Politik einfordert und als unabdingbares Element derselben zu rechtfertigen sucht, wird er endgültig zur Persona non grata, als der er sich nun heftigen Anfeindungen ausgesetzt sieht. Den ehrenden Ruf an die Universität Heidelberg lehnt er ab, um nicht noch tiefer in öffentliche Streitereien hineingezogen zu werden, vor allem aber, um sein Hauptwerk ›Ethik in geometrischer Ordnung dargestellt‹ zu vollenden, mit dessen Ausarbeitung er bereits in Rijnsburg begonnen hat. Tatsächlich schließt Spinoza seine diesbezüglichen philosophischen Meditationen 1675 ab und teilt Heinrich Oldenburg, dem Sekretär der Royal Society in London, den er seit vielen Jahren kennt, mit, dass er die Absicht hat, seine in fünf Teilen vorgetragene Abhandlung zu veröffentlichen. Auf Nachfrage Oldenburgs schreibt Spinoza, dass er nach Amsterdam gereist war – es muss Ende Juli, Anfang August 1675 gewesen sein –, um das Manuskript, das im Original leider nicht mehr erhalten ist, dem Druck zu übergeben, dass er sich aber, ob „übler Gerüchte, er wolle ein Buch veröffentlichen, in dem er zu beweisen suche, dass es keinen Gott gäbe, was bereits zu Verleumdungen seiner Person bis hin zu öffentlicher Anklage durch einen Theologen geführt habe“11, nun doch anders entschieden hätte. Und so kommt es, dass das Vermächtnis Spinozas erst posthum erscheint. Kurz vor seinem Tod, dessen genaue Umstände bis heute nicht zur Gänze aufgeklärt sind, gibt er seinen Freunden, die eine Ausgabe seiner nachgelassenen Schriften vorbereiten, die Anweisung, die ›Ethik‹ dort aufzunehmen. Spinoza stirbt am 21. Februar 1677 vierundvierzigjährig in Den Haag und noch im selben Jahr verlegt der Amsterdamer Buchverkäufer Jan Rieuwertsz die ›Opera posthuma ‹.12 Erst mehr als zwei Jahrhunderte später wird Spinoza, dessen System nicht nur den orthodoxen Juden, sondern auch den Christen und den meisten Gelehrten seiner Zeit als Atheismus, Determinismus oder mystisch-kabbalistische Irrlehre gilt, rehabilitiert, wenn auch nur symbolisch. 1927 erklärt der ordentliche Professor für hebräische Literatur der Universität Jerusalem, Joseph Klausner, das jüdische Volk habe gegen Spinoza eine schreckliche Sünde begangen und solle den Ketzer-Bannfluch aufheben. „Spinoza, dem Juden, rufen wir zu: Der Bann ist aufgehoben! Das Unrecht des Judentums gegen dich ist hiermit aufgehoben, und deine Sünde, die du auch immer an ihm begangen haben magst, sei dir vergeben.“13
Die Philosophie Spinozas muss man, so wie die Philosophie Descartes’, Leibnizens und Kants als Kind der kritischen Auseinandersetzung mit der philosophischen Weltdeutung des Mittelalters, insbesondere der Scholastik betrachten. Im Ausgang der Renaissance hebt hier ein philosophisches Denken an, das in Opposition zur tausendjährigen Doktrin der Philosophie des Mittelalters schon längst in Vergessenheit geratene, wenngleich nicht minder fundamentale Fragen wiederentdeckt und sie ins Zentrum seiner Überlegungen stellt: die Fragen nach der Möglichkeit und dem Umfang von Erkenntnis. Denn während im Mittelalter eine »ganze Menschheit« in der christlichdogmatischen „Sicherheit über das Dasein Gottes, seine Weisheit, Macht und Güte; über die Herkunft der Welt, ihre sinnvolle Ordnung und Regierung; über das Wesen des Menschen […], seine Stellung im Kosmos“14 und vor allem über „die Möglichkeiten seines Geistes im Erkennen des Weltseins“15 lebt, ist es nun darum zu tun, ein Gebäude zu errichten, das seine rechtfertigende Kraft nicht einer religiös-dogmatischen Autorität, sondern allein der Vernunft verdankt. Was nämlich bisher über jeden Zweifel erhaben und unerschütterlich schien – Gott als universelle Begründungsinstanz –, gerät im 17. Jahrhundert nicht zuletzt ob der bahnbrechenden Entwicklungen der Naturwissenschaften endgültig ins Wanken.16 Der Wahlspruch der Philosophen, so könnte man sagen, ändert sich – und zwar spätestens, wie wir wissen, mit Descartes – und heißt ab nun, in der Sprechweise des berühmten Aristoteles gesagt, ›Ich liebe Gott, aber noch mehr liebe ich die Wahrheit‹, weshalb es zu einer fundamentalen Aufgabe gerät, die Situation aufzuhellen, in der wir Menschen uns im Hinblick auf die Möglichkeit und den Umfang von Erkenntnis befinden.17 Das ist in der Tat der Dreh- und Angelpunkt der theoretischen Philosophie der Neuzeit, denn ohne eine vernünftige, d. h. gut begründete, logisch hinreichende und nichtdogmatische Vorstellung über die Erkenntniskraft des menschlichen Erkenntnisapparats, wären sämtliche Erkenntnisbauwerke und insbesondere alle wissenschaftlichen Gebäude, deren Legitimation sich seit der erkenntnisskeptischen Wende nicht mehr aus dem bloßen Glauben an Gott zu speisen vermag, – horribile dictu – auf Sand gebaut. So entstehen an dieser entscheidenden Weggabelung der Philosophiegeschichte die großen rationalistischen Erkenntnistheorien der Neuzeit.18 Einerseits, denn andererseits, und das ist bemerkenswert, entstehen zur selben Zeit die großen Metaphysiken. Meinem Erachten nach deshalb, weil sie nicht das Ergebnis einer Beschäftigung mit der Metaphysik der Metaphysik wegen sind, sondern der Notwendigkeit geschuldet, bestimmte Thesen der Erkenntnistheorien, und zwar jene im Hinblick auf die prinzipielle Erkennbarkeit der Welt, mit einer rationalen Letztbegründung zu versehen. Und dazu muss man, vom Standpunkt des erkennenden Subjekts aus betrachtet – jedenfalls vor Immanuel Kant – unweigerlich metaphysischen Boden betreten. Wir erinnern uns an Descartes’ Gottesmetaphysik, vermittelst derer er zu zeigen sucht, dass Gott existiert und dass er kein Betrüger ist und daher insbesondere die Auffassung wahr sein muss, dass die Welt, wie sie im Erkennen vorliegt, kein Trugbild ist; oder wir erinnern uns an Leibnizens Theorie der möglichen Welten, diese von Gott hervorgebrachten begrifflich-logischen Blaupausen der Schöpfung, vermittelst derer er zu zeigen sucht, dass unsere wirkliche Welt, der Strukturgleichheit des menschlichen Denkens mit dem göttlichen wegen, einer vollständigen Erkenntnis prinzipiell zugänglich ist.19 Tatsächlich sind Erkenntnistheorie und Metaphysik, jedenfalls historisch gesehen, lediglich zwei Seiten einer Medaille. Und was Baruch de Spinoza betrifft, um zum Thema zurückzukommen, so zeigt sich, dass er ganz in diesem Geiste philosophiert. Zwar läuft seine gesamte Philosophie auf eine Ethik hinaus, darauf deutet ja der Titel seines Hauptwerks unzweifelhaft hin, doch diese Ethik beruht auf einem Grundsatz, der Spinoza zunächst sowohl zu einer Metaphysik als auch zu einer Erkenntnistheorie veranlasst: Spinozas Prinzip – das Fundament seines Denkens –, vermittelst dessen er seine Ethik „organisiert hat und das dem Werk eine innere Konsistenz verleiht“20 –, lautet nämlich im ersten Hauptsatz: „Alles ist intelligibel“21, d. h. durch intellektuelle Anschauung, mithin auf Verstand bzw. Vernunft beruhender, also begrifflicher Anschauung – im Gegensatz zur sinnlichen Anschauung – begreifbar. Erst von hier aus schlägt er die Brücke zur Ethik im eigentlichen Sinn, denn im zweiten Hauptsatz heißt es dann: „Das gelingende menschliche Leben ist ein solches, das dieser Intelligibilität verpflichtet ist“22. Nimmt man nun beide Hauptsätze als Ganzes, so zeigt sich die Notwendigkeit, diese Ethik des gelingenden Lebens auf metaphysisch-erkenntnistheoretische Beine zu stellen: Denn erst nachdem in einer Metaphysik aufgewiesen wurde, dass die Welt tatsächlich auf eine Weise beschaffen ist, die sie insgesamt intelligibel macht und in einer Erkenntnistheorie darüber Auskunft gegeben wurde, wie ein solcherart verstandenes Begreifen der Welt realiter, d. h. mit Bezug auf einen erkennenden Geist einzulösen ist, lässt sich eine Ethik des gelingenden Lebens formulieren, die nicht ohne Konsequenzen bleibt, sondern in der Tat als Wegweiser eines diesbezüglich vernünftigen Handelns zu fungieren im Stande ist. Anforderungen, die sich unmittelbar in der Architektur der ›Ethik‹ spiegeln: Das in fünf Teile gegliederte Werk enthält im ersten Teil eine Metaphysik der Grundstruktur des Wirklichen, im zweiten Teil eine Theorie des menschlichen Erkennens und in den restlichen drei Teilen eine Ethik des vernünftigen menschlichen Handelns.
Doch zäumen wir das Pferd von der richtigen Seite auf: Was Spinoza unter dem Originaltitel ›Ethica Ordine Geometrico demonstrata‹ vorlegt und woran er mit kurzen Unterbrechungen von 1662 bis 1675 arbeitet, ist „ganz wesentlich die Theorie einer vernünftigen Weltorientierung des Menschen“23. „Und diese Orientierung ist die eines menschlichen Individuums, das sich Dingen der Welt einschließlich anderen menschlichen Individuen gegenübersieht, die von ihm selbst real verschieden sind. Die Bedingungen zu entwickeln, unter denen ein Individuum ihnen gegenüber einen Stand zu finden vermag, in dem es nicht von außen fremdbestimmt ist, sondern sich frei entfalten kann“24, ist daher das zentrale Ziel der Spinozanischen Ethik. Es soll ein Weg aufgewiesen werden, „den der Mensch durchlaufen muß, um das, was ihn immer schon bestimmt, als etwas zu begreifen, das die Bedingungen enthält, von denen her er sich im Ganzen seines Lebens“25selbst zu bestimmen vermag. Ein Weg, der schlussendlich, und das ist der rote Faden durch das gesamte Werk, zum größten Glück des menschlichen Daseins führt, zu Selbstbestimmung und Freiheit. Dabei spielen die sogenannten Affekte, die Spinoza im Besonderen Leidenschaften nennt, die wir nicht zu durchschauen vermögen und in deren Abhängigkeit wir nicht Herren unserer selbst sind, eine zentrale Rolle. Sie gilt es in den Griff zu bekommen oder mit Spionzas Worten gesagt, zu mäßigen, treiben sie uns doch vielgestaltig auftretend bald hierhin, bald dorthin, „wie von entgegengesetzten Winden bewegte Wellen auf dem Meer“26. Was es hierfür braucht, ist eine adäquate Erkenntnis der Welt, eine Erkenntnis der Welt an sich. Das ist nicht eine Erkenntnis kirchlicher oder akademischer Autoritäten, sondern Erkenntnis, die nichts anderes zum Gegenstand hat als „Gott und das, was aus ihm notwendigerweise folgt“27. Dabei spielen Verstand bzw. Vernunft – für einen Rationalisten wie Spinoza kaum überraschend – eine zentrale Rolle.28 Sie allein sind es, die die Kraft haben, „den Menschen aus dem Status der Unwissenheit zu befreien“29, und sie allein sind es, weshalb der Mensch nicht auf übermächtige „Instanzen verwiesen ist, von denen her er erfahren müßte, in welcher Weise er sein Leben zu führen hat, damit es ein gelingendes Leben ist“30. Das ist insgesamt gesehen der Dreh- und Angelpunkt in der Ethik Spinozas, der alle Teile zueinander in Beziehung setzt und zu einem systematischen Ganzen zusammenfügt: Ethik als die Bestimmung des Verhältnisses zwischen dem Menschen, als einem mit Verstand bzw. Vernunft ausgestatteten, handelnden und endlichen Einzelwesen, das sich in der Welt zurechtzufinden sucht, und einem absoluten Gott, der sich in adäquater Erkenntnis als dasjenige erweist, worin der Schlüssel zu einem gelingenden Leben liegt.31 Ethik also, die die Darlegung einer Metaphysik ebenso intendiert wie die Darlegung einer Erkenntnistheorie.32 Suchen wir uns einen ersten Überblick zu verschaffen:
Das Schlüsselelement in Spinozas Ethik, das ist unschwer zu sehen, ist eine adäquate Erkenntnis der Welt.33 Insofern gilt es zunächst zu klären, und zwar in der Tat vor allem anderen, ob adäquate Erkenntnis überhaupt möglich ist, ob also die Welt dementsprechend eingerichtet ist. Was hier im ersten Teil der Ethik ›Von Gott‹ anhebt, ist eine Metaphysik, in der Gott als eine unbedingt unendliche Substanz – als das Absolute – gedacht wird, als die er „wesentlich Macht ist […], eine Macht, die allein darin besteht, Dinge zu produzieren, und die sich in dieser Produktion restlos erfüllt“34. Dieser sogenannten ›immanenten Kausalität Gottes‹ nach – der zufolge „die Substanz nicht aus sich herausgehen muß, um Bestimmtes der Welt durch sich bestimmt sein zu lassen“35 –, sind alle Dinge, die Spinoza ›Modi‹ nennt, in der Substanz enthalten und, „verstanden als eine interne Relation von Substanz, so notwendig wie die Substanz selbst“36.37 Somit ist aber zugleich gewährleistet, dass alle Dinge prinzipiell begreifbar sind, und zwar so, wie sie an sich sind, weil ihnen die unbedingte Ursache, von denen sie herrühren, nicht transzendent ist, weil sie in ihnen begriffen werden kann. Das ist einleuchtend. Wenn die unbedingte Ursache eines Dings nicht außerhalb dieses Dings liegt, sondern innerhalb desselben, dann vermag man es vollständig aus sich selbst heraus zu begreifen. „Weder mit einem schöpferischen Verstand noch mit einem Willen, der zwischen Möglichem auswählte, ausgestattet, ist Gott keine Instanz, die gegenüber der tatsächlichen Welt etwas für sich zurückbehielte. Gott, der nur zusammen mit dem Insgesamt aller Modi ist, ist selbstgenügsame Ursache seiner selbst“38, aber nur insofern, als „er zugleich die Ursache aller Dinge ist“39. Eine überaus radikale Position: die Zurückstufung Gottes, des allmächtigen, allgütigen und allwissenden Schöpfers und Lenkers der Welt auf eine schlichte, wenn auch unbedingt unendliche Ursache. Spinozas Sündenfall, wenn man so will. Aus der Sicht der meisten seiner Zeitgenossen pure Blasphemie, die wohl ausschlaggebende Tatsache für die Verachtung, die man ihm entgegenbringt. Doch für Spinoza ist klar, dass „andersartige Konzepte Gottes, die die wirkliche Welt eine Schöpfung sein lassen, zu der sich Gott aus bloß möglichen Welten in seinem Verstand eigens entschieden hätte“40, ein großes Hindernis wären, nicht nur für die Wissenschaft, sondern auch für die Praxis eines gelingenden Lebens. „Sie gefährden die Rationalität des menschlichen Wissens und verweisen den Menschen in seiner Lebensführung auf unbegreifbare Sachverhalte, die er hinzunehmen habe und die hinzunehmen ihn in Spinozas Augen unmündig machen […].“41 Was hier durchklingt, das ist die Zurückweisung von Leibnizens Theorie der möglichen Welten.42 Zwar hat Leibniz einen ausdifferenzierten Entwurf vorgelegt, um die epistemische Dunkelheit Gottes vermittelst des diskursiven Verstandes in den Griff zu bekommen (ein Gott, über den Descartes noch nicht vielmehr zu sagen vermochte, als dass er existiert und kein Betrüger ist), doch der Gott Leibnizens ist nichtsdestoweniger ein Gott, der tut, was er will und schon allein deshalb bleibt er undurchschaubar.43
Als nächstes stellt sich die Frage, wie sich die Beziehung der von Gott produzierten Dinge zum erkennenden Geist denken lässt. Oder anders gesagt, wie die von Gott verursachte Welt dem erkennenden Geist vorliegt. Denn prinzipielle und faktische Erkenntnis sind nicht notwendig dieselben paar Schuhe, insbesondere dann nicht, wenn von der adäquaten Erkenntnis der Welt die Rede ist, d. h. von der Erkenntnis der Dinge an sich, die ja in Bezug auf die Mäßigung der Affekte und also Selbstbestimmung und Freiheit gefordert ist. Dementsprechend bedarf es im zweiten Teil der Ethik ›Von der Natur und dem Ursprung des Geistes‹ einer Erkenntnistheorie, die diesbezüglich Auskunft gibt. Spinozas Entwurf beruht auf einer Geist-Welt-Relation, die als Repräsentationsverhältnis gedacht wird, demzufolge die sogenannten Ideen – das sind Begriffe bzw. Wahrnehmungendes Geistes44, die ihrerseits Repräsentanten von wirklichen Dingen sind – und „körperliche Ereignisse, hervorgebracht von unterschiedlichen Attributen der einen Substanz, in strenger Korrelation zueinander stehen, mit der Folge, dass alle Ideen auch wahr sind, weil sie notwendigerweise mit ihren Objekten [– den Dingen und Ereignissen der Außenwelt –]45 übereinstimmen“46. Das ist eine Position, mit der Spinoza zunächst das Problem Descartes’ zu überwinden vermag, das darin besteht, dass man vom erkennenden Geist aus gesehen – und eine andere Sichtweise steht de facto nicht zur Verfügung – nicht wissen kann, ob den Ideen in der Tat außenwirkliche Gegenstände entsprechen. Doch es bleibt das Problem bestehen, wie der „endliche menschliche Geist […] um diese allem seinem Erkennen vorausliegende Wahrheit“47 – die sich aus der Erfahrungswirklichkeit ebenso wenig herleiten lässt, wie die Existenz der außenwirklichen Gegenstände selbst – auch wissen kann.48 Daher bestimmt die Frage nach dem erkenntnislogischen Zusammenhang zwischen der erlebten seelischen Wirklichkeit und einer objektiv existierenden Körperwelt den Fortgang der Untersuchungen. Den zweiten Teil der Ethik abschließend legt Spinoza eine Analyse der Erkenntniskraft des menschlichen Geistes vor. Was sich hier zeigt, ist die Art und Weise, wie sich adäquate Erkenntnis in Übereinstimmung von Geist und Welt faktisch realisiert.
Doch damit ist noch nichts gewonnen, könnte man sagen, denn obschon wir nach Spinoza de facto – nicht nur dem Prinzip nach – zu einer adäquaten Erkenntnis der Welt zu gelangen vermögen, zu einer Erkenntnis der Dinge an sich, verbürgt „durch die Ontologie einer immanenten Kausalität […], derzufolge Gott in jeder Idee, welcher auch immer, als deren Ursache ist und deshalb in ihr auch vom Menschen erkannt werden kann“49, muss konstatiert werden, dass eine solche Erkenntnis gemeinhin nicht vorliegt, dass wir mit Blick auf die Affekte weit davon entfernt sind, Herren unserer selbst zu sein.50 Das liegt nun aber nicht an irgendeiner Form von subjektiver Disziplinlosigkeit oder Unvermögen, sondern an der Grundverfassung des Menschen überhaupt, „nämlich zeitlich zu existieren und der Zufälligkeit körperlicher Affektionen ausgesetzt zu sein, die ihm die Dinge nicht, wie sie an sich sind, sondern lediglich in perspektivischer Verzerrung präsentieren“51