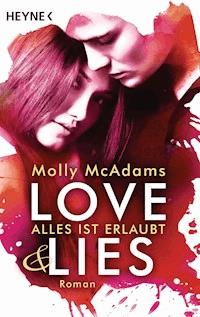9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: blue panther books
- Kategorie: Erotik
- Serie: Erotik Romane
- Sprache: Deutsch
Dieses E-Book entspricht ca. 192 Taschenbuchseiten ... Goodwin lebt auf einem Hausboot. Seine jüngere Schwester Luna kommt ihn dort gern besuchen, was seine ältere Schwester Dominica allerdings gar nicht gern sieht. Im Laufe der Jahre sind sich Goodwin und Luna sehr nahe gekommen, und eines Tages ist es dann soweit ... Doch Dominica und deren SM-praktizierender Mann kommen dahinter und wollen die erotisch-intensive Nähe zwischen Goodwin und Luna unbedingt verhindern. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt, als ihr Onkel ihnen Geld und eine Chance zu heiraten anbietet ... Diese Ausgabe ist vollständig, unzensiert und enthält keine gekürzten erotischen Szenen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 254
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Impressum:
Der reiche Onkel aus Jakarta | Erotischer Roman
von Lucinda McShannon
Lucinda McShannon wurde 1980 im irischen Cork geboren. Sie besuchte Internate in Hastings und am Bodensee sowie Hotelfachschulen in Basel und Garmisch-Partenkirchen. In dieser Zeit schrieb sie bereits Romantikromane sowie erste Erotikerzählungen unter Pseudonym. Ab 2002 arbeitete sie als Hotelfachfrau in Prien/Chiemsee. Nach der Entdeckung ihrer Bisexualität und Erotiksucht begann sie eine Psychotherapie, die sie aber bald abbrach. Seit ihrem Umzug nach München arbeitet sie im Management eines großen Hotels. Das erotische Schreiben ist nach wie vor ihr Hobby.
Lektorat: Nicola Heubach
Für K. T., zur Erinnerung an die schöne Zeit in Seattle
Originalausgabe
© 2020 by blue panther books, Hamburg
All rights reserved
Cover: Pressmaster @ shutterstock.com f11photo @ shutterstock.com
Umschlaggestaltung: MT Design
ISBN 9783964779946
www.blue-panther-books.de
1. Kapitel
»Verdammter Mist!« Goodwin Merriwell fluchte, als er von seinem Sattel auf das Pflaster sprang und den rechten Hinterreifen kontrollierte. Platt! Er musste über eine Glasscherbe oder einen Nagel gefahren sein. Ausgerechnet jetzt! Er war schon spät dran, und der Kunde wartete bestimmt schon ungeduldig auf seine Lasagne. Zum Glück war Goodwin, den alle wegen seines Nachnamens oder seines fröhlichen Gemüts nur Merry nannten, nicht mehr weit von seinem Ziel entfernt: Ralph Johnson.
Ralph Johnson, der Architekt, war schon über zwei Jahre Stammkunde bei »Goldwell & Sampson’s« Pizza Service und ließ sich sein Essen immer ins Büro bringen. Er gab gutes Trinkgeld. So einen Kunden vergraulte man besser nicht leichtfertig.
Merry schaltete den Elektromotor komplett aus und schloss das Dreirad an einen Laternenpfahl, bevor er die Styroporkiste aus der verdeckten Ladefläche hob. Die letzten fünfhundert Schritte musste er zu Fuß gehen.
Die nächste Straßenkreuzung war einer seiner »Meilensteine«, mit deren Hilfe er gedanklich seine Wege kreuz und quer durch die Stadt einteilte. Rechts konnte er die Madison Street entlang vorbei an den Wolkenkratzern der Downtown auf den weiten Meeresarm des Puget Sound blicken, zur linken Seite überragte der schneebedeckte Vulkankegel des Mount Rainier den hier etwas abgeflachten Capitol Hill. Noch einen Block weiter, vorbei am Haus der dicken Milton, die ihn immer in hauchdünnen Dessous empfing oder auch in einem Nylon-Nachthemd, das ihn eigentlich gar nicht antörnte, und ihn ins Bett schleifen wollte. Manchmal gelang ihr das auch – wenn ihre Bestellung kurz vor Feierabend kam und er nicht mehr sofort zum Laden des Pizzadienstes zurückmusste.
Jennifer Milton war ja ganz nett und auch nicht schlecht im Bett. Zwar stand Merry eher auf junge, zarte Dinger in seinem Alter, aber an manchen Tagen war ihm dieser Berg rosigen, dauergeilen Frauenfleisches auch ganz recht. In seiner Erinnerung sah er diese riesigen Brüste, die seitlich herabhingen, wenn sie auf dem Rücken lag, und er erinnerte sich an einen Tittenfick, bei dem sie beide Ellenbogen aufgestützt hatte, um ihre Melonen zusammenzudrücken und seinem Schnellboot eine Fahrrinne zu bieten, die eng genug war für ihn. Die Erinnerung sorgte für eine kurzfristige Versteifung in seiner Hose. Ein guter Schuss blieb ihm immer sehr plastisch in seinem Gedächtnis.
Jetzt nur noch wenige Schritte. Merry hastete die schmale Stichstraße zu Johnsons Haus hinauf. Der Rasen zu beiden Seiten war verdorrt, obwohl Seattle gar nicht mal wenige Regentage hatte, aber dieser Sommer meinte es vielleicht zu gut.
Der stadtbekannte Architekt stand schon hinter der riesigen Glasscheibe seines Arbeitszimmers und schaute auf die Straße herunter, dann verschwand er aus dem Sichtfeld und öffnete gleich darauf die Haustür.
»Na, Goodwin, komplett zu Fuß heute? Na ja, den Sonnenschein sollte man genießen.« Architekt Johnson war so ziemlich der Einzige, der Merry bei seinem richtigen Namen nannte.
»Reifenpanne«, gab Merry zurück. »Mein Dreirad habe ich unten am Broadway vor Mister Brentwoods Getränkeladen an eine Laterne gestellt. Da hat man es vom Laden her im Blick.«
»Na, dann schnell zurück, bevor auch noch die anderen Reifen zerstochen werden«, sagte Johnson und hielt ihm eine Kreditkarte hin. »Zieh dir drei Dollar Trinkgeld mit ab.«
»Danke, Mister Johnson«, sagte Merry und steckte die Karte in das Lesegerät, das an seinem Gürtel baumelte. Die Rechnung war schon eingegeben, er brauchte jetzt nur noch das Trinkgeld addieren und auf »okay« zu tippen. »Und guten Appetit.« Das Trinkgeld war immer willkommen, weil Merry nach seinem abgebrochenen Studium ohne festen Job war. Die Einsätze als Pizzafahrer brachten ihn mehr schlecht als recht über die Runden, und er stopfte häufig ein finanzielles Loch mit dem nächsten.
Er eilte zu seinem Dreirad zurück. Der Rat des Kunden kam nicht von Ungefähr: Wer mitten in der Stadt sein Fahrrad oder Dreirad länger als eine halbe Stunde unbeaufsichtigt ließ, musste damit rechnen, dass irgendwelche Spaßvögel damit anfingen, es gründlich zu demolieren.
Gerade eilte er am Haus von Mrs Milton vorbei, da trat diese in ihrer vollen Rubens-Fülle aus dem Haus. »Merry!«, tat sie überrascht. »Dich schickt der Himmel! Ich wollte gerade einen Nachbarn fragen, ob er mir hilft, meinen Hängeschrank wieder auf die Haken zu hieven. Das Ding ist mir runtergerutscht.«
»Ich komme gleich«, rief er zur Antwort. »Ich muss rasch mein Lieferdreirad abholen. Es steht vorn bei Brentwood.«
»Lass nur«, erwiderte sie. »Der schuldet mir noch einen Gefallen. Ich rufe ihn gleich an und bitte ihn, dein Fahrzeug für einen Moment in seinen Getränkemarkt zu holen. Da ist es sicher. Das Schloss wirst du dann wohl neu kaufen müssen, aber die paar Cent ersetze ich dir gern.«
»Okay.« Er ging auf das Haus zu mit der Gewissheit, dass es nicht beim Aufhängen eines Schrankes bleiben würde. Jennifer Miltons gewaltige Brüste zitterten unter ihrem weiten, luftigen Sommerkleid vor erwartungsvoller Geilheit. Die Frau war pathologisch anerkannte Nymphomanin und drehte buchstäblich durch, wenn sie nicht dreimal am Tag flachgelegt wurde, mindestens. Ihm konnte das nur recht sein.
»Komm rein, mein Süßer«, flötete sie ihm entgegen. »Schau mal in die Küche. Das ist eine Katastrophe.«
Er folgte ihr. Sie hatte recht. Die Katastrophe war sogar perfekt. Auf der Arbeitsplatte und dem Fußboden waren Berge von zerschmettertem Geschirr, gemischt mit gesplittertem Holz. Aus einem Spalt in einer geborstenen Hängeschranktür ragte ein ebenfalls zerbrochener Vibrator schräg nach oben.
»Ich glaube, ich ahne, wie das passiert ist«, sagte Merry.
»Ist nicht schwer zu erraten, was?« Sie grinste. »Ich war beim Pfannkuchenbacken und hatte das Ding da zwischen den Beinen. Der Orgasmus kam so plötzlich, dass ich mich irgendwo abstützen musste.«
»Und der Schrank war, wie es aussieht, ohnehin bis an seine Grenzen überlastet. Das hier ist Geschirr für eine mindestens zwölfköpfige Familie.«
»Ikea wirbt damit, dass das Ding was aushält.«
»Ich weiß«, erwiderte Merry. »Ich bin doch selbst letztes Jahr mit dir nach South Brenton gefahren, um diese herrliche Selbstbauküche zu erwerben. Weißt du noch?«
Das konnte sie eigentlich nicht vergessen haben. Es war ein Samstag gewesen, und in dem Möbelhaus traf sich halb Seattle mit der Gesamtbevölkerung von Tacoma sowie etlichen indianischen Bevölkerungsgruppen der Umgebung, und trotz dieses überdachten Menschenauflaufs hatte Jennifer Milton es geschafft, ihn in einen Kleiderschrank zu lotsen und sogar noch die Tür zu schließen. Dort hatte er sie im Stehen von hinten gevögelt, und es war ihr bravourös gelungen, ihre Orgasmusschreie mit einer Werbe-Ansage aus den Deckenlautsprechern zu tarnen.
»Ich glaube, es lohnt nicht, den Schrank wieder aufzuhängen«, fuhr Merry fort. »Wenn ich den Lieferwagen meines Chefs leihen kann, fahre ich dich nächste Woche noch mal hin.«
»Gute Idee«, erwiderte sie. »So machen wir das.«
»Also, ich muss dann wieder los. Bin im Dienst.«
»Aber für einen Quickie wird’s bestimmt noch reichen. Komm schon, du bist darin ja Experte.«
»Na schön.« Er zippte seinen Hosenschlitz auf.
»Ich mag deine ständige Einsatzbereitschaft«, lobte sie. »Du warst sicher mal bei den Pfadfindern. Immer bereit für eine gute Tat.«
Er grinste. »Also los. Im Stehen?«
»Hier im Türrahmen«, erwiderte sie und hielt sich auf beiden Seiten fest, um ihm den massigen Hintern entgegenzurecken. Er schob ihr Kleid hoch und legte ihr den unteren Teil über die Schultern. Eigentlich hasste er dieses Kunstfaser-Material, das bei jeder Bewegung ins Rutschen geriet und selbst dann noch nach Schweiß roch, wenn es frisch aus der Waschmaschine kam. Mit beiden Händen riss er ihr den Slip nach unten, der diese Bezeichnung nicht verdiente. Mit dem Wort »Slip« verband Merry immer etwas Feines, Elegantes, Mädchenhaftes. Diese Fettarschbedeckung hier war aber riesig. Drei Stück davon am Mast eines Segelbootes, und man schaffte es in zwei Tagen quer über den Pazifik.
Seinen eigenen Masten fuhr er jetzt ein und begann sofort, in der Mitte des mächtigen Schinkens, der selbst einem Grizzly alle Ehre gemacht hätte, ein- und auszufahren. Sie war nass wie ein Beutel Schmierseife. Begeistert klatschten seine beiden Hände auf zwei gewaltige Bisonschinken.
»Ah, du bist gut!«, seufzte sie. »Mit dir könnte ich es immer wieder machen!«
»Tust du ja«, gab er zurück. »Und es macht Spaß mit dir! Du bist eine Vollblut-Frau! Ja, soo! Das ist toll!«
Sie ließ ihren massigen Hintern kreisen, damit sein Lustholz in jeden Winkel und jede Falte ihrer massigen Möse kam. Sie saugte mit ihren glitschigen Wonnemuskeln an seiner Eichel, drängte sich ihm rotierend entgegen und keuchte wie eine Dampfmaschine. Wie hätte er das lange aushalten können?
»Ich komme!«, rief sie. »Mannmannnmannmann, ich komme!«
»Ja! Lass dich gehen! Komm! Ich bin auch gleich … ah, jetzt! Ich kann nicht mehr!« Er kam gegen den Tornado, der seinen Schwanz umstürmte, nicht an. Er ließ seinen Fluten einfach freien Lauf und verlor sich in ihrer enormen Nässe, in der seine paar Löffel Sperma gar nicht auffielen.
»Ah!«, seufzte sie. »Das war fantastisch! Das habe ich gerade gebraucht!«
Sein Schwanz war mit der allgemeinen Strömung aus ihr herausgespült worden, und er verschloss seine Hose. »Ich auch«, sagte er. »Es ist immer toll mit dir!«
»Dann musst du heute Abend noch einmal kommen«, meinte sie. »Ich bestelle mir einfach eine Pizza und lass sie von dir liefern.«
Das war eine Angewohnheit von ihr, die ihm schon oft gelegen gekommen war. Er verabschiedete sich gut gelaunt von ihr und eilte zu seinem Lieferdreirad zurück.
Merry war erleichtert, dass seinem Fahrzeug nichts weiter zugestoßen war. Es stand tatsächlich noch in der Halle des Getränkemarktes. Er schob es zur »Basis« zurück, wie er den Laden seines Auftraggebers für sich nannte, und ging in den Hinterhof zum Schuppen. Dort hingen einige fertig aufgezogene Räder an der Wand, damit es mit den nötigen Reparaturen schnell ging, wenn mal eines der fünf Dreiräder, die für »Goldwell & Sampson’s« unterwegs waren, eine Panne hatte. Das Auswechseln des Schlauches, die eigentliche Reparatur, würde Roberto am nächsten Samstag erledigen, ein netter mexikanischer Junge mit Down-Syndrom aus der Nachbarschaft, der während der Woche im Internat war. Merry und Roberto verstanden sich prächtig.
»Noch eine Tour, dann kannst du erst mal nach Hause«, sagte Mister Goldwell, einer der beiden Inhaber. »Ich brauch dich dann heute Abend noch mal. Großauftrag vom ›Flag Theatre‹. Siebzig Mal Pizza und vierzig Mal Pasta, fünf Kisten Wein und dreißig Sixpacks mit Bier. Du kannst dann den Pick-up zum Ausliefern nehmen.«
Das »Flag Theatre« war ein ehemaliges Kino, das irgendwann pleitegegangen war. Der jetzige Besitzer hatte daraus ein »Event Center« gemacht, das für Musikveranstaltungen, große Hochzeiten und Prominenten-Partys vermietet wurde. Der Schwerpunkt lag auf diesen Partys. Manche davon waren sogar richtige Orgien, und wie man hörte, ging es da nicht gerade zimperlich zu.
»Hört sich nach einer Fete an«, bemerkte Merry. »Kann Jim das nicht machen?« Er hatte eigentlich vorgehabt, seinen Vater zu besuchen, der in einem rollstuhlgerechten Apartment im »Swedish Manor« auf der südlichen Anhöhe des Capitol Hill lebte. Aber diesen Besuch konnte er auch verschieben. Die Stunde bei Vater war eh immer frustrierend.
»Jim ist noch nicht volljährig, und es kann sein, dass die Sachen in den Laden reingebracht werden müssen«, hörte er den Chef sagen, der sich dabei die Hände an seiner fleckigen Schürze abputzte. »Du kannst vorher noch eine Auslieferung ins ›Conservatory‹ machen, direkt zur Pforte, und dann das Dreirad mit nach Hause nehmen, bis du am Abend zurückkommst. Halb acht musst du hier sein und den Pick-up beladen.«
Das »Conservatory« war ein riesiges Jugendstil-Gewächshaus, das seit über hundert Jahren im nahen Volunteer-Park auf der Höhe des langgestreckten Hügels stand und eine Riesensammlung seltener Orchideen beherbergte.
Goodwin Merriwell nickte. Das hieß, er hatte den ganzen Nachmittag frei. Wahrscheinlich nahm der Chef heute keine weiteren Aufträge an, weil er mit der Großbestellung bestimmt die ganze Zeit zu tun hatte. Vielleicht würde Merry sogar ein Weilchen im Volunteer Park bleiben – dort oben auf der Anhöhe wehte immer ein angenehm frischer Wind, und durch den Sonnenhimmel, der sich in den Hunderten von Glasfenstern des »Conservatory« und in einem großen, ovalen Teich spiegelte, hatte man ein ganz besonderes Licht, das sich positiv auf die Stimmung auswirkte. Vielleicht könnte er auch ein halbes Stündchen abzweigen, um seinen Vater doch noch kurz im nahen »Swedish Manor« zu besuchen. Viel reden konnte er ohnehin nicht mit ihm, da Dad so gut wie nie ein Wort sagte, und wenn, dann war es irgendetwas Schroffes, was in der Regel kränkend wirkte. Seit dem Unfall war er ziemlich verbittert. Es gab zudem eine Menge Dinge, über die man nicht reden durfte – seine frühere Firma, die in Konkurs gegangen war, gehörte dazu. Finanzielles war überhaupt ein rotes Tuch, ohne dass Vater je sagte, warum. Immerhin hatte er sein gutes Auskommen.
Besser wäre es, Luna anzurufen, die jüngere seiner beiden Schwestern, überlegte er. Sie hatte es nötig, mal ein bisschen in die Sonne zu kommen, bei dem Kellerjob, den sie hatte.
Während er mit der Lieferung losradelte, meldete er sich bei Luna vom Mobiltelefon aus. »Was ist, Kleines, hast du Lust, ein bisschen im Volunteer Park abzuhängen? Ich hab den Nachmittag frei. Vielleicht könnten wir einen Abstecher zu Dad machen.«
»Schön, aber können wir uns nicht lieber bei dir treffen? Ich möchte heute nicht zu Dad, weil Dominica ihn am Abend besuchen will.«
Dominica war ihre ältere Schwester, mit der beide nicht besonders gut auskamen, Merry am wenigsten.
»Ich find’s bei dir zu Hause gemütlicher, und außerdem habe ich von ›Hershey’s‹ ein Päckchen mit toller neuer Arbeitskleidung bekommen, die könnte ich auch bei dir anprobieren und mir deine Meinung anhören.«
Das hörte sich gut an. Ihre Arbeitsklamotten waren immer eine Schau.
»Geht auch«, meinte er mit einer Beiläufigkeit, die verbarg, wie sehr er sich darauf freute. »Dann legen wir uns nach der Anprobe ein Weilchen in die Liegestühle. Bis nachher. Ab drei bin ich da.«
***
Goodwins Zuhause war etwas ganz Besonderes. Er hatte während des Studiums, als Mutter noch lebte und jeden Monat der Scheck pünktlich kam, ein Hausboot für einen Spottpreis erstanden: Gerade mal zwei Monatsmieten, wie er sie vorher für sein Apartment gezahlt hatte. Zwar musste er jetzt die Pacht für einen Liegeplatz und das Geld für Strom und Abwasser aufbringen, aber das war minimal, und er war sein eigener Herr. Gelegentlich fielen Reparaturen an, doch die meisten davon machte er selbst. Er hatte einen guten Ankerplatz auf dem Lake Union gefunden, an einem der Bootsstege gegenüber der Hauptverwaltung von »facebook«, einem zehnstöckigen grauen Kasten, in dem früher mal eine Versicherung gewesen war, der ihm leider die Sicht auf die imposante Kette der Cascade Mountains versperrte. Doch das war ein Mangel, den man vergessen konnte. Wenn man die Liegestühle an Deck stellte, hatte man einen freien Blick auf die Hügel ringsum – alles gehobene Wohngebiete mit viel Grün – und natürlich über den See, der im Norden vom beliebten Gas Works Park mit seinen historischen Industrieanlagen vor immergrünen Wipfeln begrenzt war. Auf dem See, der eigentlich einer von den vielen Meeresarmen des Stadtgebiets war, ragten ständig weiße oder farbenfrohe Segel auf, und Motorboote jagten über das pazifische Wasser hin und her und schickten pfeilförmig parallele Wellen über das spiegelglatte Wasser. Angeblich waren in Seattle mehr Boote als Autos zugelassen.
Klar, dass seine Schwester diesen freien Blick liebte. Sie bewohnte ein billiges Zimmer in einem alten Haus aus dunkelrotem Backstein mit fast vierhundert Einraum-Apartments in der East Olive Street, und das einzige Fenster ging nicht nach draußen, sondern zum düsteren Hausflur. Ihre Arbeitsstelle war ein Tanzlokal am nördlichen Broadway, kurz bevor die berühmteste Unterhaltungsmeile von Seattle in die 10th Avenue überging. Es lag im Keller unter einem Restaurant, das zurzeit geschlossen war.
Der Schuppen hatte bessere Jahre gesehen. Früher hatten hier Ray Charles und einige Jahre später Jimi Hendrix ihre ersten Auftritte gehabt, aber heute gab es dort kaum noch Live-Veranstaltungen. Hin und wieder verirrte sich eine Grunge-Band dahin, aber sonst tummelten sich auf der Bühne nur diverse zweitklassige Deejays und ein paar bedeutend bessere Gogo-Girls.
Luna war eines davon. Sie machte ihren Job mit Begeisterung, und je später der Abend war, desto mehr wurde aus der gelenkigen Eintänzerin eine geschickte Striptease-Künstlerin, die viel Applaus kassierte. Da ihr der Name Merriwell zu britisch und zu langweilig klang, nannte sie sich Luna Lightbone. Das passte zu ihrer zierlichen Gestalt, die fast immer in Bewegung war.
Nachdem Merry dem Pförtner des »Conservatory« sein Mittagessen gebracht hatte, kaufte er noch rasch ein paar Kleinigkeiten im Supermarkt und briet in der winzigen Kombüse seines Hausbootes ein paar Lachsschnitzel mit Rosmarin und ein wenig Knoblauch. Er kochte gern, besonders für Luna, die beinahe alles liebte, was er zubereitete. Fisch und Meeresfrüchte waren seine Spezialität, und er wäre nie auf die Idee gekommen, ihr einfach eine Pizza vorzusetzen.
Am Schwanken des Bodens bemerkte er, dass jemand vom Steg auf die Planken des Hausboots gekommen war. Er spürte, dass es Luna sein musste – ein größeres Gewicht hätte mehr Unruhe verursacht. Ein Glück, dass das Essen fertig war!
Sie brachte ein Lächeln herein. Jedes Mal, wenn er sie zur Begrüßung in die Arme nahm, staunte er, wie schmächtig sie war. Leicht wie ein Grashüpfer. Dass sie überhaupt so viel Energie zum Tanzen hatte, war ein Wunder.
Sie stellte einen kleinen Karton auf Goodwins Bett. »Riecht gut hier«, sagte sie. »Du hast mal wieder gezaubert. Gut, dass ich widerstanden habe, als ich gerade am ›Kentucky’s‹ vorbeikam. Mein Magen schrie nach einem Chickenburger, aber ich hab ihm gesagt, hier gibt es sicher etwas Besseres.« Sie gab ihm einen Kuss auf die Wange, wozu sie sich auf die Zehenspitzen stellen musste.
»Ich hab sogar eine große Flasche Ginger Ale für dich besorgt«, sagte er. »Setz dich an den Tisch, ich bringe das Essen.«
Gleich darauf stellte er die beiden Teller hin und schenkte ihr das süße Zeug ein. Er selbst trank einen Mangosaft. »Arbeitest du heute?«, fragte er, als er ihr gegenübersaß.
Sie zuckte mit den Schultern. »Nicht in unsrem Club. Ich habe ein Engagement außer Haus. Im ›Flag‹ soll ich auf einer Party tanzen.«
»Ich werde heute da das Essen liefern.«
»Passt ja gut. Sag mal, hast du danach frei? Du könntest dableiben und aufpassen, dass mich keiner angrapscht. Ist so ’ne Sexparty, und wenn die Kerle einen sitzen haben, strecken die ihre Finger auch nach dem Personal aus.«
»Ist gut, ich bleibe.«
»Du machst aber nicht mit, wenn es da zur Sache geht, oder? Ich könnte das nicht mit ansehen.«
»Natürlich nicht«, sagte er. Obwohl sie seine Schwester war, gab sie sich ziemlich eifersüchtig. Waren kleine Schwestern immer so – nur um sich dann irgendwann den besten Freund des großen Bruders zu angeln? Bei Merry waren da allerdings nicht gerade viele Fische im Teich. »Ich setz mich an den Personaltisch neben der Bühne, dann bin ich gleich oben, wenn dir einer zu aufdringlich wird. Was ist das denn für ein Haufen, der die Party macht?«
»Die Filmleute wieder«, sagte sie. »Die machen ein- bis zweimal im Monat an wechselnden Orten diese Jeder-fickt-mit-jeder-Fete, stellen die schärfsten Fotos und Filmsequenzen davon ins Internet und finanzieren mit den Abo-Geldern der Homepage-Nutzer ihre alternative Filmproduktion. Die waren mit ihrem Team schon öfter da.«
Das »Team« waren bezahlte Stripper, die in diesem Fall wegen ihrer speziellen körperlichen Beschaffenheit auch »Einpeitscher« genannt wurden.
»Keine schlechte Idee. Dann tut man ja etwas für die unabhängige Kunst und Kultur, wenn man bei so etwas die Sau rauslässt.«
»Untersteh dich. Diese Sachen werden im Internet immer wieder kopiert. Stell dir vor, man sieht dein Gesicht auf jeder zweiten Pornoseite. Dann kriegst du echten Ärger mit Dominica. Die muss schon wegen Floyd auf ihren guten Ruf achten. Und auf den ihrer Familie. Und du weißt ja, wie sittenstreng sie sich in letzter Zeit aufspielt«, erklärte Merry.
»Hm. Zurzeit ist unser Verhältnis auch nicht gerade gut, wie du weißt.«
Das war etwas untertrieben. Das Verhältnis zwischen ihnen war auf einem Tiefpunkt, und dieser hatte seinen Ursprung in einem Vorfall, der mittlerweile ein paar Jahre zurücklag und den beide aus unterschiedlichen Gründen ganz für sich behalten und nie wieder ansprechen wollten. Merry, weil er sich schämte, dass er es so weit hatte kommen lassen, und Dominica, weil sie fürchtete, ihr Mann würde sich dann von ihr abwenden. Und miteinander reden, das konnten sie erst recht nicht, denn wahrscheinlich wäre dann ein offener Streit zwischen ihnen entbrannt. Das war immer ein versteckter Schwelbrand, wie es ihn in vielen Familien gab, und die Beteiligten sorgten dafür, dass der Brand verdeckt blieb, um nicht zum offenen Feuer zu werden.
Dominica, verheiratet mit dem Bankier, Großspediteur und Reeder Floyd Dungold, war die ältere Schwester der beiden und fühlte sich nach Vaters schwerem Unfall, der ihn für den Rest des Lebens an den Rollstuhl fesselte, und dem Krebstod der Mutter für Goodwin und Luna verantwortlich. Das entsprach auch ihrer allgemeinen Tendenz, anderen überlegen sein zu wollen und sie zu beherrschen. Dass Vater im Rollstuhl saß, passte genau in diese Schiene, auch wenn sie das niemals zugegeben hätte. Jedenfalls bezeichnete sie es als ihr »Revier«, sich um Vater zu kümmern.
In Dominicas Augen war Luna zu jung für eigene Entscheidungen und musste ans Gängelband genommen werden, Goodwin schien ihr zu verantwortungslos. Ihm nahm sie übel, dass er sein Studium abgebrochen hatte und in den Tag hineinlebte – dabei hatte er sich einfach nur für zwei, drei Jahre eine Auszeit genommen, um sich im Leben zu orientieren. Andere machten in dieser Situation eine Weltreise, aber dafür fehlte das Geld. Als er das gegenüber seiner älteren Schwester einmal erwähnte, wurde sie ärgerlich und warf ihm vor, das Geld von ihr zu wollen, nur weil sie sich in ihrer Bank nach oben gearbeitet und dann den Chef geheiratet hatte.
Auf ihr Geld war Merry gar nicht aus. Was ihren Job betraf, war es aber in der Tat so gewesen, dachte Goodwin. Dominica hatte sich damals nach dem College bei der Bodenkreditbank beworben und dem Interviewer auf die Frage, was sie in ihrem Job erreichen wolle, geantwortet: »Den obersten Boss heiraten.« Man hatte sie eingestellt, weil sie anscheinend Humor hatte, was den meisten Bankangestellten fehlte. Eine dramatische Fehleinschätzung, denn ihr Ziel hatte sie bereits nach fünf Jahren erreicht. Merry stellte sich vor, dass sie dem Boss dafür auf seinem Schreibtisch öfter mal die Beine breitgemacht oder ihm im Aufzug einen geblasen hatte. Das heißt, ganz genau konnte er sich das nicht vorstellen – bei Dominica musste das lächerlich aussehen. Die und Sex? Undenkbar.
Seit ihrer Hochzeit – »Eheschließung« korrigierte sie immer, wenn man dieses Wort benutzte – hielt Dominica sich für eine Erfolgsfrau, die besser als alle anderen wusste, was im Leben wirklich zählte. Wer das nicht akzeptierte, wurde abserviert, selbst wenn es der eigene Bruder war, auf den sie in früheren Jahren mal ein begehrliches Auge geworfen hatte. Das war damals zu ihrem Bedauern schiefgegangen, und seitdem glaubte sie, sich als Sittenwächterin betätigen zu müssen.
Luna war etwas diplomatischer gewesen als er. Sie hatte sich bei einer Krankenpflegeschule eingeschrieben, von der sie wusste, dass man dort mindestens fünfundzwanzig sein musste. In diesen drei Jahren Wartezeit bis dahin wollte sie sich einfach »austoben« und eine Weile in ihrem Traumberuf arbeiten. So schaffte sie es, dass Dominica das widerstrebend akzeptierte und glaubte, Luna wäre bei einem seriösen Ballett. Von der Gogo-Bühne hatte sie keine Ahnung. Sie wusste auch nicht, dass Floyd, ihr Mann, manchmal heimlich zu Gast bei Lunas Bühnenshows war und sich am Anblick ihres Körpers ergötzte. Er tarnte sich mit salopper Kleidung, einem falschen Oberlippenbart und einer getönten Brille, was Luna aber nicht täuschen konnte. Sehr leichtsinnig von ihm, dachte sie manchmal. Wo er doch die Absicht hatte, bald in die Politik zu gehen! Er war aber nun mal eindeutig scharf auf sie, das spürte sie mehr als deutlich.
Es bestand also zwischen Luna und Dominica noch Kontakt, wenn auch auf ziemlichen Abstand, denn sonst hätte die Älteste sich zu sehr in alles eingemischt. Zum Glück wohnte sie auch ziemlich weit weg, in einem abgelegenen Teil von West Seattle, wo es zwischen den weitläufigen Fabrikanlagen von Boeing und der Lockheed-Werft ein geschlossenes Wohngebiet inmitten eines Grüngürtels gab, ummauert und von den schwarz Uniformierten einer Security-Firma bewacht.
Natürlich hatte Dominica keine Ahnung, wie das Leben wirklich ablief, insbesondere das von Luna und Goodwin.
***
So wenig, wie Dominica vom Leben der anderen wusste, so wenig ahnten diese von ihrem.
Ja, sie hatte ihren Bankdirektor geheiratet, aber es war nicht allein ihrer Zielstrebigkeit zu verdanken gewesen, sondern ihrer Fähigkeit, zur rechten Zeit am richtigen Ort gewesen zu sein und dem Glück, zur richtigen Zeit das Rechte in die Hände zu bekommen. Zum Beispiel ein pornografisches Heft, das sie in Abwesenheit des Herrn Direktors zwischen den Unterlagen eines Exportvertrages für fünfundsiebzig fabrikneue Chevrolet-Fahrzeuge nach Harbin in der Mandschurei gefunden hatte. Den Vertrag, den ihre Bank finanzierte, hatte sie selbst entworfen, und er lag nun zur Begutachtung beim Chef. Sie war in seiner Abwesenheit in das Büro geschlüpft, um ihn zur Sicherheit noch einmal zu überarbeiten.
Das Heft war ein alter Comic in Schwarzweiß. »Dungeon Devil«, stand auf der Titelseite, und auf dieser einzigen farbigen Seite hingen fünfzig oder mehr Frauen mit hochtoupierten blonden Frisuren der Sechzigerjahre, allesamt Doris-Day-Klone, mit gefesselten Händen an einer Kerkerwand. Ihre langen Röcke waren an den Seiten geschlitzt, und ein Gentleman, der aussah wie Frank Sinatra mit Sakko, Hut und Gatsby-Hosen, stand höhnisch-breitbeinig vor ihnen und stieß eine Sprechblase aus. »Ich ficke euch alle! Niemand von Euch kommt mir davon!« Im Innern des dünnen Heftes war er nur ein harmloser Versicherungsvertreter, der reihenweise Hausfrauen durch die Kanalisation verschleppte, um sie seinem düsteren unterirdischen Sklavenkerker einzuverleiben. Was dann passierte, konnte man nur ahnen, aber überall lagen riesige Peitschen herum. »Dass Frauen irgendwann den Führerschein machen oder gar wählen dürfen, werdet ihr nicht mehr erleben!«, sprechblaste er. »Ich werde es zu verhindern wissen!« Und er schwang eine besonders riesige siebenschwänzige Peitsche durch die modrige Kerkerluft.
Im Hintergrund kam gerade Satan persönlich durch ein Kellerfenster hereingeklettert. »Hallo! Ich bin der Satan!«, rief er mit Donnerstimme in schwarzen, zittrigen Lettern.
»Na und?«, rief eine der gefesselten Frauen, und eine andere sagte: »Who cares? – Was soll’s?«, als säße sie gerade unter der Trockenhaube und spräche mit ihrem Friseur.
Offenbar schien der Versicherungsvertreter mit seiner Peitsche so schlimm zu sein, dass Satan höchstens als möglicher Retter durchging.
»Na, so etwas scheint Ihnen ja zu gefallen«, hörte Dominica plötzlich eine Stimme.
Dominica riss die Beine vom Schreibtisch, schaffte es aber nicht, ihren engen Rock glattzuziehen. Bestimmt hatte der Chef auch längst gesehen, dass ihr Zeigefinger um eine bestimmte nasse Stelle ihres Slips gekreist hatte.
»Ich dachte, äh, Sie wären nicht da«, stammelte sie.
»War ich auch nicht«, sagte er. »Aber jetzt bin ich zur Stelle. Ziehen Sie mal Ihr Höschen aus. Her damit.«
Sie reichte ihm ihren goldfarbenen Satinslip mit dem kleinen feuchten Fleck.
»Ist beschlagnahmt«, entschied er. »Ich bin bereit, über dieses Ereignis hinwegzusehen, wenn Sie in den nächsten sechs Wochen während der Arbeit keine Unterwäsche tragen und ich jederzeit mit der Hand Zugriff in Ihren Schritt habe. Sie können auch Ihre Papiere nehmen und nach Hause gehen, wenn Ihnen das lieber ist.«
Sie schaltete schnell und schüttelte zu seinem zweiten Vorschlag den Kopf. »Können Sie haben, klar. Wir können das auch zu einer Dauereinrichtung machen. Brauchen Sie vielleicht noch mehr Höschen von mir?«
Der Bankmanager schüttelte den Kopf. »Eins reicht. Ich habe zu Hause vor dem Fernseher ein Pentagramm auf dem Fußboden. Ich lege Ihr Höschen hinein und verkünde einen Bannspruch. Dann müssen Sie mir zu Willen sein, wann immer mir danach ist.«
Was für ein bekloppter Spinner, dachte sie und antwortete achselzuckend: »Nun ja, wenn Sie meinen! Eigentlich haben Sie diesen ganzen magischen Zinnober aber gar nicht nötig.« Sie drehte sich spontan auf dem ledernen Chefsessel herum, auf dem sie sich noch immer lümmelte, zog den Rock bis zu ihren Hüften hoch und reckte ihm ihr rundes nacktes Hinterteil entgegen. »Suchen Sie sich eins meiner Löcher aus. Machen Sie aber schnell! In einer Viertelstunde kommt der Datenerfasser, der Sie ins ›Who is Who‹ aufnehmen will!«
Seitdem waren sie ein Paar. Unzertrennlich. Dominica hatte ihr Ziel vor der geplanten Zeit erreicht.
***
Goodwin und Luna hatten ihre leckeren Lachs-Portionen mit Genuss verzehrt, und Merry stand auf, um die Teller abzuräumen. Er hatte von gestern Abend noch zwei Strawberry Shortcakes, Sahnetörtchen mit frischen Erdbeeren, im Kühlschrank. Als er sie holte, wäre er beinahe gestürzt, weil draußen ein Rennboot allzu dicht vorbeigerast war und das eigentlich recht schwerfällige Hausboot mit seinen Heckwellen in heftiges Schwanken versetzt hatte.
»Jetzt noch etwas Süßes, und dann freue ich mich auf deine kleine Modenschau.«
»Kannst du auch«, versprach sie und machte ihren Löffel so voll, dass sie ihre Oberlippe mit Sahne beschmierte. Das sah ziemlich aufregend aus, fand Goodwin. Manchmal hätte er sie gern geküsst, aber macht man das bei seiner Schwester? So streckte er nur eine Hand aus, streifte ihr mit einem Zeigefinger die Sahne ab und schob sie sich in den Mund. Sie beugte sich plötzlich vor und … küsste ihn bedenkenlos auf die Lippen! Ihm trat auf einmal der Schweiß aus den Schläfen.
Was tun wir da?, fragte er sich. Er hatte immer Angst, dass er und Luna sich einander zu sehr annäherten – immerhin waren sie Geschwister. Andererseits hatte er den Eindruck, dass sie ständig dabei waren, ihre Grenzen zu überschreiten. Sie fühlten sich eindeutig zueinander hingezogen, und bloße Vernunft genügte nun mal nicht, um diese Grenzen einzuhalten.
Doch der Moment des Zweifels war schnell verflogen.
»Du bist ein Schatz«, sagte sie. »Gleich bekommst du auch deine Sondervorstellung. Bin schon gespannt auf dein Urteil.«
»Ich weiß schon, wie es ausfällt«, versicherte er. »Du kaufst dir immer die hübschesten Sachen. Ich kann mir schon denken, was passiert, wenn du sie beim Tanzen trägst. Die Burschen geraten in Trance, und diejenigen, die an der Bar sitzen, lassen sich von ihren Mädels schlecht verdeckt einen runterholen. Ist dir das eigentlich nie lästig?«
»Im Gegenteil«, versicherte sie. »Das ist doch der netteste Applaus, den man sich vorstellen kann. Du machst es doch auch, wenn ich dir vortanze.«
»Das ist etwas anderes. Da kann nichts passieren. Du bist meine Schwester. Und außerdem gehört das zu meiner ganz normalen Körperpflege.«
»Und ist sehr gesund«, wusste sie.